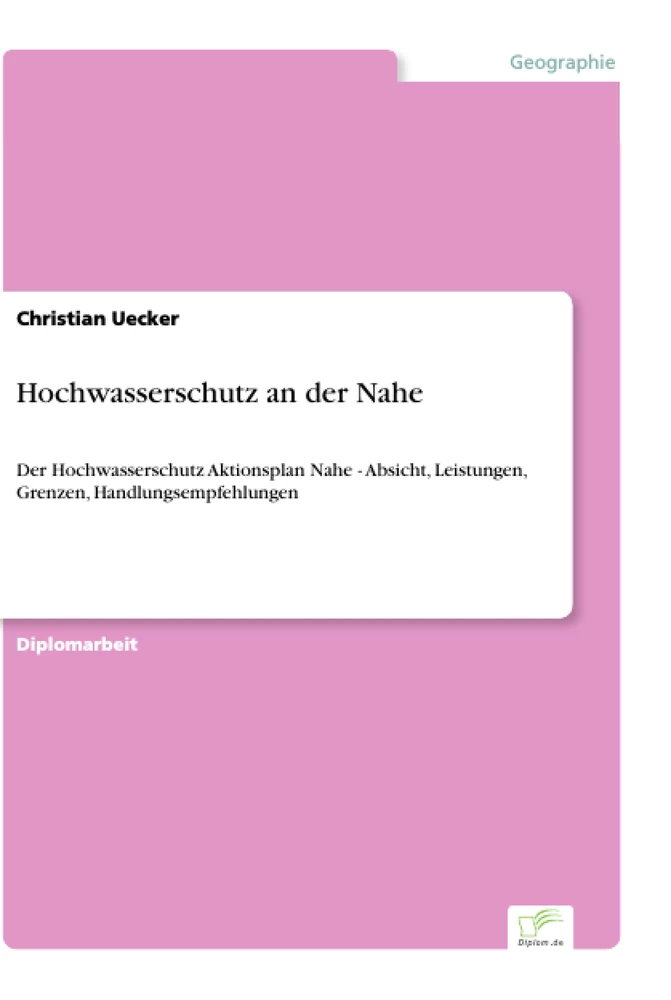Hochwasserschutz an der Nahe
Der Hochwasserschutz Aktionsplan Nahe - Absicht, Leistungen, Grenzen, Handlungsempfehlungen
©2005
Diplomarbeit
192 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Nach den Erfahrungen aus den großen Hochwassern in den 90er Jahren an Rhein, Oder, Elbe, Donau und Nahe ist deutlich geworden, wie wichtig überregionales Planen und Handeln bei der Hochwasservorsorge ist. Besonders die an den großen Flüssen Rhein, Oder, Elbe und Donau aufgetretenen Katastrophenhochwasser der Vergangenheit haben gezeigt, dass zur Verbesserung des Hochwasserschutzes das Hochwassermanagement optimiert werden muss. Daraufhin haben die Umweltminister der Bundesländer im März 1995 beschlossen, für die Einzugsgebiete hochwassergefährlicher Flüsse Aktionspläne zu erstellen. In den Aktionsplänen sollen die verschiedenen Interessengruppen und Verantwortlichen eines Flussgebietes auf allen politischen Ebenen ihre Aktivitäten in Sachen Hochwasserschutz und -vorsorge koordinieren und aufeinander abstimmen. Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser hat in der Folge eine Handlungsempfehlung zur Erstellung von Hochwasseraktionsplänen erarbeitet, die zum einen Hilfestellung bietet, zum anderen Grundlage für ein einheitliches Vorgehen ist.
Da alle Flussverläufe sich von einander unterscheiden, müssen auch die Hochwasseraktionspläne individuell auf die jeweiligen Flussgebiete abgestimmt werden. Alle haben jedoch das Ziel, im Sinne der Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz Hochwasserstände und -schäden zu vermindern, die Vorsorge zu verbessern und gleichzeitig einen Gewinn für Umwelt und Natur zu erzielen. Wichtig ist dabei, die wirtschaftliche Effizienz der geplanten Maßnahmen zu bedenken. Das heißt, eine Maßnahme darf nicht teurer sein, als die durch sie zu verhindernden Schäden. Eine Stärkung des Hochwasserbewusstseins erhofft man sich durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit.
Konkret soll hier der Hochwasser - Aktionsplan Nahe der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord und ihrer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Nahe betrachtet werden. Hauptanlass für die Erstellung des Aktionsplan Hochwasser im Einzugsgebiet der Nahe waren die ungewöhnlichen Hochwasserereignisse im Winter 1993/94 und 1995, die an der Nahe zu besonders extremen Hochwasserschäden führten. Der Schaden im gesamten Nahegebiet wird auf ca. 50 Mio.
Euro geschätzt. Die beiden Hochwasserereignisse haben wiederholt deutlich gemacht, dass Hochwasser naturgegebene Ereignisse sind, mit denen immer wieder gerechnet werden muss, dass der Mensch die Höhe und den zeitlichen Ablauf der Hochwasser durch die […]
Nach den Erfahrungen aus den großen Hochwassern in den 90er Jahren an Rhein, Oder, Elbe, Donau und Nahe ist deutlich geworden, wie wichtig überregionales Planen und Handeln bei der Hochwasservorsorge ist. Besonders die an den großen Flüssen Rhein, Oder, Elbe und Donau aufgetretenen Katastrophenhochwasser der Vergangenheit haben gezeigt, dass zur Verbesserung des Hochwasserschutzes das Hochwassermanagement optimiert werden muss. Daraufhin haben die Umweltminister der Bundesländer im März 1995 beschlossen, für die Einzugsgebiete hochwassergefährlicher Flüsse Aktionspläne zu erstellen. In den Aktionsplänen sollen die verschiedenen Interessengruppen und Verantwortlichen eines Flussgebietes auf allen politischen Ebenen ihre Aktivitäten in Sachen Hochwasserschutz und -vorsorge koordinieren und aufeinander abstimmen. Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser hat in der Folge eine Handlungsempfehlung zur Erstellung von Hochwasseraktionsplänen erarbeitet, die zum einen Hilfestellung bietet, zum anderen Grundlage für ein einheitliches Vorgehen ist.
Da alle Flussverläufe sich von einander unterscheiden, müssen auch die Hochwasseraktionspläne individuell auf die jeweiligen Flussgebiete abgestimmt werden. Alle haben jedoch das Ziel, im Sinne der Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz Hochwasserstände und -schäden zu vermindern, die Vorsorge zu verbessern und gleichzeitig einen Gewinn für Umwelt und Natur zu erzielen. Wichtig ist dabei, die wirtschaftliche Effizienz der geplanten Maßnahmen zu bedenken. Das heißt, eine Maßnahme darf nicht teurer sein, als die durch sie zu verhindernden Schäden. Eine Stärkung des Hochwasserbewusstseins erhofft man sich durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit.
Konkret soll hier der Hochwasser - Aktionsplan Nahe der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord und ihrer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Nahe betrachtet werden. Hauptanlass für die Erstellung des Aktionsplan Hochwasser im Einzugsgebiet der Nahe waren die ungewöhnlichen Hochwasserereignisse im Winter 1993/94 und 1995, die an der Nahe zu besonders extremen Hochwasserschäden führten. Der Schaden im gesamten Nahegebiet wird auf ca. 50 Mio.
Euro geschätzt. Die beiden Hochwasserereignisse haben wiederholt deutlich gemacht, dass Hochwasser naturgegebene Ereignisse sind, mit denen immer wieder gerechnet werden muss, dass der Mensch die Höhe und den zeitlichen Ablauf der Hochwasser durch die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christian Uecker
Hochwasserschutz an der Nahe
Der Hochwasserschutz Aktionsplan Nahe - Absicht, Leistungen, Grenzen,
Handlungsempfehlungen
ISBN-10: 3-8324-9372-7
ISBN-13: 978-3-8324-9372-1
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Fachhochschule Trier, Trier, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Hochwasserschutz an der Nahe
Der Hochwasserschutz Aktionsplan Nahe Absicht,
Leistungen, Grenzen, Handlungsempfehlungen
Diplomarbeit
zur Erlangung des Grades eines
Diplom Ingenieur (FH)
im Studiengang Umweltverfahrenstechnik,
Fachbereich Umweltplanung/Umwelttechnik
an der
Fachhochschule Trier, Standort Birkenfeld,
vorgelegt von
Christian Uecker
Neubrücke, März 2005
Christian Uecker
I
Eidesstattliche Erklärung
Hiermit versichere ich, die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet zu haben.
Neubrücke, den 31. März 2005
Name: Christian
Uecker
Matrikelnummer: 929.643
Christian Uecker
II
Danksagung
Nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeit möchte ich allen danken, die mir dabei
zur Seite standen.
Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Heinz Finken für die Vergabe und
Betreuung des Themas und dem Lehrbeauftragten Herrn Dipl.-Geol. Claus von
Janson für die Begleitung meiner Arbeit verbunden mit der Vermittlung von
Kontakten, ständiger Gesprächsbereitschaft, wiederholten Korrekturlesungen und
der Bereitstellung technischer Geräte.
Sehr danke ich Frau Dipl. Geographin Gabriele Ditter für ihren fachlichen Rat und
ihre kritische Begleitung.
Herrn Dipl.-Ing. W. Augst von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord, Herrn
Schalm von der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord, Herrn Schäfer von der
Unteren Wasserbehörde Kreisverwaltung Birkenfeld, dem Ingenieurbüro Björnsen
Beratende Ingenieure in Koblenz, sowie dem Ingenieurbüro Juhre & Boxleitner in
Trier danke ich für die Bereitstellung von Unterlagen, Literatur und die hilfreichen
Gespräche. Besonders danke ich Dipl. Ing. Christian Dittmar für seine technische
Hilfestellung.
Ferner danke ich meiner Familie und engen Freunden für Rückhalt und Ermutigung
während dieser Arbeit.
Christian Uecker
III
Inhaltsverzeichnis
1
EINLEITUNG ... 1
1.1
A
NLASS UND
Z
IEL
... 1
1.2
V
ORGEHENSWEISE
... 2
TEIL I: URSACHEN DER HOCHWASSERENTSTEHUNG UND MÖGLICHE MAßNAHMEN ZUM
HOCHWASSERSCHUTZ... 4
2
URSACHEN FÜR DIE ENTSTEHUNG VON HOCHWASSER ... 4
2.1
N
ATÜRLICHE
E
INFLUSSFAKTOREN
... 5
2.1.1
Niederschlag und Einzugsgebiet ... 5
2.1.2
Gebietsrückhalt ... 6
2.1.2.1
Boden als Wasserspeicher ... 6
2.1.2.2
Bewuchs ... 7
2.1.2.3
Geländestrukturen ... 8
2.1.2.4
Gewässernetz und Auen ... 8
2.2
A
NTHROPOGENE
E
INFLUSSFAKTOREN
... 9
2.2.1
Landwirtschaftliche Nutzung... 10
2.2.2
Forstwirtschaft ... 11
2.2.3
Flächenversiegelung und Bebauung ... 13
2.2.4
Gewässerausbau ... 14
2.2.5
Anthropogene Klimaänderungen und Luftverschmutzung ... 15
2.2.6
Ist anthropogene Einflussnahme ursächlich für die Häufigkeit von Hochwasser-Ereignissen? ... 17
3
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR HOCHWASSER... 18
3.1
D
IE ALLGEMEINEN
M
ÖGLICHKEITEN DES
H
OCHWASSERSCHUTZES UND DER
A
KTIONSPLAN
N
AHE
. 18
3.1.1
Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes ... 20
3.1.1.1
Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer, Uferrandstreifen und Auen ... 22
3.1.1.2
Einschränkungen des technischen Gewässerausbaus... 23
3.1.1.3
Sicherung und Wiederherstellung von Retentionsräumen und Überschwemmungsgebieten ... 24
3.1.2
Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes... 25
3.1.2.1
Hochwasserschutz durch Deiche ... 26
3.1.2.2
Deichsanierung und Deichneubau ... 26
3.1.2.3
Deichrückverlegung und Beseitigung von Sommerdeichen ... 27
3.1.2.4
Anlegen von Poldern ... 28
3.1.2.5
Hochwasserrückhaltebecken, Staustufen und Talsperren ... 30
3.1.2.6
Mobiler Hochwasserschutz... 32
3.2
M
AßNAHMEN IM UNBESIEDELTEN
B
EREICH ZUM DEZENTRALEN
W
ASSERRÜCKHALT
... 33
3.2.1
Erhöhung der Retentionswirkung durch landwirtschaftliche Maßnahmen ... 34
3.2.2
Erhöhung der Retentionswirkung durch forstwirtschaftliche Maßnahmen... 36
Christian Uecker
IV
3.3
M
AßNAHMEN IM
S
IEDLUNGSBEREICH ZUM DEZENTRALEN
W
ASSERRÜCKHALT
... 37
3.3.1
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser durch Rückhaltung und Versickerung... 39
3.3.2
Vermeidung von Versiegelung; Entsiegelung und Belagsänderung... 41
3.3.3
Überflutungsschutz oder Verlagerung für kleine Siedlungen oder wertvolle Biotope ... 42
3.3.4
Rückbau von hochwassergefährdeten Gebäuden ... 43
3.4
V
ERMINDERUNG DES
S
CHADENSPOTENZIALS IN HOCHWASSERGEFÄHRDETEN
G
EBIETEN
... 44
3.5
R
ECHTLICHE
G
RUNDLAGEN ZUM
H
OCHWASSERSCHUTZ IN
D
EUTSCHLAND
... 45
3.5.1
Bundeseinheitliche Rahmengesetzgebung zum Hochwasserschutz ... 45
3.5.1.1
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 12.11.1996... 45
3.5.1.2
Raumordnungsgesetz (ROG)... 47
3.5.1.3
Baugesetzbuch (BauGB): ... 48
3.5.1.4
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): ... 49
3.5.1.5
Probleme der Ausführung... 49
3.5.2
Gesetzliche Regelungen auf Landesebene... 50
3.5.3
Internationale Zusammenarbeit ... 50
TEIL II: HOCHWASSERSCHUTZAKTIONSPLAN NAHE UND SEINE BISHERIGE UMSETZUNG
BIS ENDE 2004 ... 51
4
DIE NAHE HYDROLOGISCH-GEOGRAPHISCHER ÜBERBLICK ... 51
4.1
K
URZCHARAKTERISTIK DES
N
AHEEINZUGSGEBIETES
... 51
4.2
H
YDROLOGISCHE
C
HARAKERISTIKA
... 53
4.3
F
LÄCHENNUTZUNG IM
E
INZUGSGEBIET
/
N
UTZUNG DER
B
ODENFLÄCHE
... 53
4.4
D
ER WASSERWIRTSCHAFTLICHE
R
AHMENPLAN
... 54
4.5
V
ORHANDENE
A
USWEISUNGEN VON
Ü
BERSCHWEMMUNGSGEBIETEN
... 55
5
KURZE DARSTELLUNG DES HOCHWASSER AKTIONSPLANES (KAHN) ... 57
5.1
V
ERANLASSUNG UND
A
NSATZPUNKTE FÜR DEN
H
OCHWASSER
A
KTIONSPLAN
... 57
5.2
A
LLGEMEINES ZUM
A
KTIONSPLAN
... 58
5.2.1
Die Entscheidung für den Aktionsplan und ihre Träger... 58
5.2.2
Perspektiven der Realisierung... 59
5.2.3
Prüfung der Wirksamkeit des Aktionsplanes ... 61
5.3
H
ANDLUNGSZIELE
... 61
5.4
M
AßNAHMENKATEGORIEN
... 62
5.4.1
Maßnahmen zur Verringerung der Schadensrisiken ... 62
5.4.1.1
Reglementierung und Anpassung der Nutzung ... 62
5.4.1.2
Pflege der Schutzbauwerke ... 63
5.4.1.3
Gesichtspunkte für die Maßnahmen ... 63
5.4.1.4
Kontrolle der Entwicklung der Schadenspotenziale ... 63
5.4.2
Erhöhung des Wasserrückhalts im Einzugsgebiet... 64
5.4.2.1
Renaturierung der Gewässer im Einzugsgebiet ... 64
5.4.2.2
Erhöhung des Wasserrückhalts auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen und in Siedlungsgebieten
... 65
Christian Uecker
V
5.4.3
Verbesserung des Hochwassermelde- und Vorhersagewesens ... 66
5.4.3.1
Erstellen von Karten der Überschwemmungsgebiete und der hochwassergefährdeten Bereiche ... 67
5.4.4
Verstärkung des Hochwasserbewusstseins... 67
5.5
Z
USAMMENFASSENDE
M
AßNAHMENÜBERSICHT
... 68
6
HOCHWASSERSCHUTZNIVEAU AN DER NAHE BIS ENDE 2004 ... 69
6.1
A
LLGEMEINES
... 69
6.1.1
Hochwasserbewusstsein und Bürgerbeteiligung ... 69
6.1.2
Umweltverträglichkeit ... 70
6.2
D
IE ÖRTLICHEN
M
AßNAHMEN DES
H
OCHWASSERSCHUTZES
... 70
6.2.1
Die örtlichen Maßnahmen vor Inkrafttreten des Aktionsplanes Nahe ... 70
6.2.1.1
Flutmulde Kirn ... 70
6.2.1.2
Kirn, Ritterwiese ... 71
6.2.1.3
Kirn, Wörther Weg... 71
6.2.1.4
Kirn, Hahnenbach... 71
6.2.1.5
Norheim... 72
6.2.1.6
Bingen ... 73
6.2.1.7
Alsenztal... 73
6.2.2
Die örtlichen Maßnahmen nach Inkrafttreten des Hochwasser - Aktionsplanes Nahe ... 74
6.2.2.1
Stadt Idar-Oberstein ... 74
6.2.2.2
Stadt Bad Sobernheim, Hochwasserschutz im Bereich der ... 78
6.2.2.3
Bad Kreuznach ... 79
6.2.2.4
Stadt Bingen ... 89
6.2.2.5
VG Rhein Nahe ... 89
6.2.3
Zusammenfassung der örtlichen Maßnahmen des Hochwasserschutzes... 89
6.2.3.1
Funktionale Schwerpunktbereiche der Maßnahmen... 90
6.2.3.2
Örtliche Schwerpunktbereiche der Maßnahmen... 91
6.2.3.3
Der Umfang der Maßnahmen ... 91
6.3
D
IE ÜBERÖRTLICH UMGESETZTEN
M
AßNAHMEN DES
H
OCHWASSERSCHUTZ
- ... 92
6.3.1
Konzeptionen, Planungen, Studien... 92
6.3.2
Feststellung der Überschwemmungsgebiete im Einzugsbereich der Nahe ... 92
6.3.3
Hochwassermeldewesen... 93
6.3.4
Polder... 93
6.3.4.1
Pfaffen-Schwabenheim... 93
6.3.4.2
Sobernheim... 93
6.3.4.3
Gemarkung Planig bei Bad-Kreuznach ... 93
6.3.5
Rückhaltemaßnahmen ... 94
6.3.5.1
Rückhaltemaßnahmen des Zweckverbandes Hochwasserschutz Alsenztal ... 94
6.3.5.2
Schaffung von Retentionsraum in Idar-Oberstein ... 97
6.3.5.3
Planungen von Rückhaltemaßnahmen durch LK Kusel und VG Lauterecken sowie VG Glan-
Münchweiler und LK Kaiserslautern ... 97
6.3.5.4
Planungen von Rückhaltemaßnahmen in Idar-Oberstein... 98
6.3.6
Zusammenfassung der überörtlichen Maßnahmen des Hochwasserschutzes ... 98
Christian Uecker
VI
6.4
D
IE FUNKTIONALE UND ÖRTLICHE
V
ERTEILUNG DER
M
AßNAHMEN UND DIE
M
AßNAHMENTRÄGER
... 99
TEIL III: BEWERTUNG DES HOCHWASSER AKTIONSPLANES NAHE UND SEINER
UMSETZUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ALLGEMEIN ENTWICKELTEN
GESICHTSPUNKTEN DES HOCHWASSERSCHUTZES ... 100
7
DIE LEISTUNGEN, DEFIZITE UND DIE AUFGABE DER WEITERENTWICKLUNG DES
HOCHWASSERSCHUTZES AN DER NAHE ... 100
7.1
B
ISHERIGE
L
EISTUNGEN DES
H
OCHWASSERSCHUTZES AN DER
N
AHE
... 101
7.1.1
Allgemeine Leistungen ... 101
7.1.2
Schwerpunktbereiche erbrachter Leistungen ... 101
7.2
D
EFIZITE BEI DEM
M
AßNAHMENKATALOG
... 103
7.3
D
EFIZITE BEI DER
U
MSETZUNG
... 104
7.4
D
IE
A
UFGABE DER
W
EITERENTWICKLUNG
... 105
7.5
Ü
BERSICHT DER
P
LANUNGEN
,
L
EISTUNGEN UND
D
EFIZITE
... 106
7.5.1
Maßnahmenübersicht der Planungen ... 106
7.5.2
Übersicht der im Rahmen des Aktionsplanes Nahe umgesetzten Maßnahmen... 108
7.5.3
Defizite der Umsetzungen... 110
8
GRENZEN DER WIRKSAMKEIT DES HOCHWASSER-AKTIONSPLANES UND
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ... 112
8.1
V
ORBEMERKUNGEN
... 112
8.2
D
AS
S
CHADENSPOTENTIAL IN HOCHWASSERGEFÄHRDETEN
G
EBIETEN
... 113
8.3
M
AßNAHMEN ZUR
V
ERRINGERUNG DER
S
CHADENSRISIKEN
... 113
8.4
M
AßNAHMEN ZUR
E
NTLASTUNG VON
W
ASSERAUFKOMMEN
... 114
8.5
M
AßNAHMEN ZUM
W
ASSERRÜCKHALT
... 115
8.6
S
CHUTZBAUWERKE
... 115
8.7
B
EDEUTUNG DES
E
INSATZES KOMMUNALER UND EHRENAMTLICHER
K
RÄFTE
... 116
8.8
I
NFORMATIONSARBEIT
... 116
8.9
Z
USAMMENFASSUNG DER
H
ANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
... 117
9
SCHLUSSFESTSTELLUNG ... 121
10
LITERATURVERZEICHNIS ... 122
11
QUELLENVERZEICHNIS DER KARTEN ... 127
12
ANHANG ... 128
Christian Uecker
VII
Abbildungsverzeichnis
ABBILDUNG 1: HOCHKLAPPBARER GEHWEG... 33
ABBILDUNG 2: PRINZIPDARSTELLUNG VERSICKERUNGSVERFAHREN UND
RÜCKHALTEMAßNAHMEN ... 41
ABBILDUNG 3: NAHE EINZUGSGEBIET... 56
Kartenverzeichnis:
KARTE 1: KIRN (RECHTSWERT: 2605826; HOCHWERT: 55169605)... 72
KARTE 2: NORHEIM (RECHTSWERT: 3418551; HOCHWERT: 5518568) ... 73
KARTE 3: ALSENZTAL (RECHTSWERT: 3414659; HOCHWERT:2510499)... 74
KARTE 4: IDAR-OBERSTEIN FISCHBACH-WEIERBACH
(RECHTSWERT: 2599799; HOCHWERT: 5510325) ... 78
KARTE 5: BAD SOBERNHEIM (RECHTSWERT: 3404183; HOCHWERT: 5516854) ... 79
KARTE 6: BAD KREUZNACH (RECHTSWERT: 3419638; HOCHWERT: 5523036)... 88
KARTE 7: PLANIG (RECHTSWERT: 3421988; HOCHWERT: 5525766) RÜCKHALTEMAßNAHMEN ... 94
KARTE 8: IMSWEILER (RECHTSWERT: 3413300; HOCHWERT: 5496745) ... 95
KARTE 9: ROCKENHAUSEN (RECHTSWERT: 3416109; HOCHWERT: 5501463) ... 96
KARTE 10: MANNWEILER (RECHTSWERT: 3413609; HOCHWERT: 5506953) ... 96
KARTE 11: IDAR-OBERSTEIN; JOHANNESPLATZ (RECHTWERT: 2595320; HOCHWERT: 5507871) .. 97
Rechts- und Hochwerte beziehen sich auf die Kartenmitte.
Christian Uecker
VIII
Tabellenverzeichnis
TABELLE 1: ADMINISTRATIVE ZUORDNUNG DES EINZUGSGEBIETES ... 52
TABELLE 2: BODENFLÄCHE... 54
TABELLE 3: TERMINE UND KOSTEN... 81
TABELLE 4: ÜBERSICHT DER HOCHWASSERSCHUTZ-MAßNAHMEN IN BAD KREUZNACH... 88
TABELLE 5: MAßNAHMENÜBERSICHT... 108
TABELLE 6: ÜBERSICHT DER IM RAHMEN DES AKTIONSPLANES NAHE UMGESETZTEN
MAßNAHMEN ... 110
TABELLE 7: DEFIZITE DER UMSETZUNGEN... 111
Christian Uecker
IX
Abkürzungsverzeichnis
H:
Hochwert
HW (95):
Hochwasser 1995
HWS:
Hochwasserschutz
KH:
Kreuznach
KAHN: Kommunale
Arbeitsgemeinschaft Hochwasserschutz Nahe
LK:
Landeskreis
R:
Rechtswert
SGD:
Struktur- und Genehmigungsdirektion
STAWA:
Staatliches Amt für Abwasser und Abfall
THW:
Technisches Hilfswerk
VG:
Verbandsgemeinde
1 Einleitung
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
1
1 Einleitung
1.1
Anlass und Ziel
Nach den Erfahrungen aus den großen Hochwassern in den 90er Jahren an Rhein,
Oder, Elbe, Donau und Nahe ist deutlich geworden, wie wichtig überregionales
Planen und Handeln bei der Hochwasservorsorge ist. Besonders die an den großen
Flüssen Rhein, Oder, Elbe und Donau aufgetretenen Katastrophenhochwasser der
Vergangenheit haben gezeigt, dass zur Verbesserung des Hochwasserschutzes das
Hochwassermanagement optimiert werden muss. Daraufhin haben die
Umweltminister der Bundesländer im März 1995 beschlossen, für die Einzugsgebiete
hochwassergefährlicher Flüsse Aktionspläne zu erstellen. In den Aktionsplänen
sollen die verschiedenen Interessengruppen und Verantwortlichen eines
Flussgebietes auf allen politischen Ebenen ihre Aktivitäten in Sachen
Hochwasserschutz und vorsorge koordinieren und aufeinander abstimmen. Die
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser hat in der Folge eine ,,Handlungsempfehlung zur
Erstellung von Hochwasseraktionsplänen" erarbeitet, die zum einen Hilfestellung
bietet, zum anderen Grundlage für ein einheitliches Vorgehen ist [40]. Da alle
Flussverläufe sich von einander unterscheiden, müssen auch die
Hochwasseraktionspläne individuell auf die jeweiligen Flussgebiete abgestimmt
werden. Alle haben jedoch das Ziel, im Sinne der ,,Leitlinien für einen
zukunftsweisenden Hochwasserschutz" Hochwasserstände und schäden zu ver-
mindern, die Vorsorge zu verbessern und gleichzeitig einen Gewinn für Umwelt und
Natur zu erzielen [35]. Wichtig ist dabei, die wirtschaftliche Effizienz der geplanten
Maßnahmen zu bedenken. Das heißt, eine Maßnahme darf nicht teurer sein, als die
durch sie zu verhindernden Schäden. Eine Stärkung des Hochwasserbewusstseins
erhofft man sich durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit.
Konkret soll hier der ,,Hochwasser - Aktionsplan Nahe" der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord und ihrer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
,,Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Nahe" betrachtet werden.
Hauptanlass für die Erstellung des ,,Aktionsplan Hochwasser im Einzugsgebiet der
Nahe" waren die ungewöhnlichen Hochwasserereignisse im Winter 1993/94 und
1995, die an der Nahe zu besonders extremen Hochwasserschäden führten (siehe
Anhang Bild 28 und 29). Der Schaden im gesamten Nahegebiet wird auf ca. 50 Mio.
1 Einleitung
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
2
Euro geschätzt. Die beiden Hochwasserereignisse haben wiederholt deutlich
gemacht, dass Hochwasser naturgegebene Ereignisse sind, mit denen immer wieder
gerechnet werden muss, dass der Mensch die Höhe und den zeitlichen Ablauf der
Hochwasser durch die Flächennutzung im Einzugsgebiet, den Gewässerausbau und
die Verkleinerung der natürlichen Rückhalteräume durch Bebauung verändert hat,
dass Deiche und andere Hochwasserschutzeinrichtungen keinen absoluten Schutz
garantieren können, und dass Siedlungen und andere Nutzungen in
Überschwemmungsgefährdeten Bereichen einem besonders hohen Schadensrisiko
unterliegen.
Daher beschlossen die Mitglieder der ,,Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Nahe" (K.A.H.N.) am 15.01.1999 in Bad
Kreuznach die Erarbeitung des ,,Aktionsplanes Hochwasser" mit dem Ziel, den
Schutz von Menschen und Gütern vor Hochwasser zu verbessern. Darin
eingebunden ist die ökologische Aufwertung der Gewässerlandschaften im
Einzugsgebiet der Nahe [45].
Im Hinblick auf diesen Aktionsplan Hochwasser widmet sich die vorliegende
Diplomarbeit der Frage, inwieweit dieser Aktionsplan bis Ende 2004 umgesetzt
wurde, welche Aspekte des Hochwasserschutzes offen bleiben und ob sich
Handlungsempfehlungen aus den bisherigen Umsetzungen ergeben.
1.2 Vorgehensweise
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden zunächst die Ursachen zur
Entstehung von Hochwassersituationen beleuchtet.
Diese lassen sich unterteilen in natürliche (Niederschlag, Gebietsrückhalt) und
anthropogene Ursachen (land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Flächen-
versiegelung, Gewässerausbau, gewerbliche und wohnräumliche Nutzung, sowie
mögliche anthropogene Klimaänderungen). Weiterhin werden generell mögliche
Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser bzw. zur Verminderung der
Hochwassergefahr in Kapitel 3 besprochen, die sich wiederum gliedern lassen in
Maßnahmen am Gewässer und in Überschwemmungsgebieten, Maßnahmen im
Freiraum sowie Maßnahmen im Siedlungsbereich.
1 Einleitung
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
3
Abschließend werden die rechtlichen Grundlagen zum Hochwasserschutz in
Deutschland angesprochen.
Dieser erste Teil ist durch Auswertung einer umfassenden Literaturrecherche
entstanden.
Der zweite Teil befasst sich speziell mit dem Untersuchungsgebiet und dem
Aktionsplan Hochwasserschutz. Zunächst werden in Kapitel allgemeine
Informationen zur Nahe und ihrem Einzugsgebiet gegeben.
Kapitel 5 befasst sich mit einer kurzen Darstellung des Aktionsplans der K.A.H.N. für
die Nahe.
In Kapitel 6 wird die bisherige Umsetzung des Hochwasserschutzaktionsplanes Nahe
bis Ende 2004 dargestellt. Diesem Teil liegt eine Auswertung von Literatur und einer
Datenzusammenstellung (vorhandene Pläne, Internet, Broschüren, Hand-outs) sowie
Ortsbesichtigungen und Gespräche mit zuständigen Fachleuten zugrunde.
Der dritte Teil enthält eine Bewertung des Hochwasserschutzaktionsplans und seiner
Umsetzung im Zusammenhang mit den allgemein entwickelten Gesichtspunkten des
Hochwasserschutzes mit den Fragen:
Was kam zum Tragen und was nicht?
Gibt es weiterführende Aspekte?
Dabei geht es in Kapitel 7 um die Feststellung, dass Planung und Umsetzung
Defizite aufweisen und daher fortentwickelt werden müssen und in Kapitel 8 um das
Aufzeigen von Handlungsansätzen, die im Rahmen der Gesichtspunkte des
Hochwasserschutzes und insbesondere des Hochwasserschutzaktionsplans Nahe
dringlich erscheinen. Im Ergebnis stellt Kapitel 9 fest, dass Erhebliches an
Handlungsperspektiven erarbeitet und umgesetzt wurde, dennoch aber viele nicht
oder nicht ausreichend wahrgenommenen Vorhaben noch der Bearbeitung bedürfen.
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
4
Teil I: Ursachen der Hochwasserentstehung und mögliche Maßnahmen
zum Hochwasserschutz
2
Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasser, als Zustand der höchsten Wasserführung eines Flusses, sind natürliche
Ereignisse im jahreszeitlichen Verlauf und kommen in regelmäßigen Abständen vor.
Ihre Entstehung und ihr Ausmaß sind abhängig von zahlreichen
Rahmenbedingungen und das Ergebnis eines komplexen Zusammenwirkens
unterschiedlicher Faktoren. Als Teil des Wasserkreislaufes sind Hochwasser in erster
Linie abhängig von der Stärke der Niederschläge - gegebenenfalls im
Zusammenwirken mit einer abschmelzenden Schneedecke - und von ihrer zeitlichen
und räumlichen Verteilung in Relation zur Größe und Struktur des Einzugsgebietes
und dessen Abflusseigenschaften. Neben den Wetterverhältnissen und den
Gegebenheiten des Einzugsgebietes bestimmen Bodenbeschaffenheit, Bewuchs,
Geländestruktur und Gewässernetz, die als natürliche Wasserspeicher wirken, die
Dynamik der Wasserstände [24].
Böden und Vegetationsdecke sowie auch Seen und natürlich strukturierte
Fließgewässer sind in der Lage, Niederschläge zeitweilig zu speichern bzw. ihren
Abfluss zu verzögern. Sind die Böden jedoch großflächig durch vorangehende
Niederschläge mit Wasser gesättigt oder stehen unter Frosteinwirkung, kommt es zu
einer Quasi-Bodenversiegelung: Die Speicherkapazität sinkt erheblich, während die
Abflussbereitschaft stark zunimmt. Dann fließt das Wasser nahezu vollständig über
die Oberfläche ab, sammelt sich in den Tälern und lässt die Flüsse über die Ufer
treten. Durch diese Bedingungen kann es zu Hochwasserereignissen kommen [6].
Für zusätzliche Spitzen sorgen die Schneeschmelze oder örtlich heftige Regenfälle.
Menschliche Eingriffe in Landschaft und Gewässer können diese Dynamik zusätzlich
verstärken und haben an vielen Flüssen nachweislich zu einer Verschärfung des
Hochwassergeschehens beigetragen [4].
Spätestens seit dem Elbehochwasser im August 2002 wird diskutiert, inwieweit der
Mensch durch Beeinflussung des Klimas selbst die Schuld an zunehmenden
Flutkatastrophen trägt. Der Auslöser des katastrophalen Elbehochwassers waren
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
5
extreme Niederschläge im oberen Elbeeinzugsgebiet und in den
Gewässeroberläufen der Zuflüsse in Böhmen, deren konkrete Ursachen von
zahlreichen Fachleuten nicht mehr nur auf natürliche Prozesse zurückgeführt werden
[37]. Teilweise ist diese Naturkatastrophe auf menschliche Fehler zurückzuführen [3].
Wenngleich Hochwasser zu jedem Fließgewässer als natürliches Phänomen
dazugehört, führten die im Folgenden näher beschriebenen Eingriffe des Menschen
im Elbeeinzugsgebiet sowie auch in anderen Einzugsgebieten, zu einer deutlichen
Verschärfung dieses Naturprozesses [37]. Im Folgenden werden die einzelnen
Faktoren zur Entstehung von Hochwasserereignissen beschrieben.
2.1 Natürliche
Einflussfaktoren
Maßgeblich für die Höhe des Hochwassers ist neben der zeitlichen und räumlichen
Verteilung der Niederschläge die Speicherwirkung des Einzugsgebietes durch
Boden, Bewuchs, Gelände und Gewässernetz [24].
2.1.1 Niederschlag und Einzugsgebiet
Primäre Ursache für die Entstehung von Hochwasser sind Niederschläge. Die
durchschnittliche Menge des Jahresniederschlags in Deutschland beträgt 770 mm,
das entspricht 770 l/m² Bodenfläche im Jahr. Wären diese Niederschläge
gleichmäßig über das Jahr verteilt, käme es nicht zu Hochwasser. Die natürlichen
Wasserspeicher hätten ausreichend Kapazitäten, um das Wasser aufzunehmen. Nun
sind die Niederschläge aber nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich sehr
unterschiedlich verteilt. So fällt auf der Zugspitze oder im Schwarzwald mit 1.600 mm
Jahresdurchschnitt ungefähr dreimal so viel Regen wie in manchen Gebieten
Ostdeutschlands. Bedeutend ist auch die Niederschlagsintensität. Tagelang
anhaltende, großflächige Dauerregen führen dazu, dass in den großen Flüssen die
Pegel stetig steigen. Denn dort tragen viele kleinere Nebengewässer den Abfluss
eines großen Einzugsgebietes zusammen. Hochwasser als Folge von Dauerregen
sind in der Regel recht gut vorhersagbar [24].
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
6
Lokal begrenzte, starke Schauer, oft von Gewittern begleitet, wirken sich besonders
in kleinen Einzugsgebieten aus. Sie treten vor allem im Sommer auf. Im Extremfall
können in einer Stunde über 100 Liter pro Quadratmeter fallen und dann innerhalb
kürzester Zeit an kleineren Flüssen und Bächen zerstörerische Sturzfluten auslösen,
die jedoch in der Regel räumlich sehr begrenzt auftreten. Die Schäden durch
Sturzfluten sind allerdings in der Summe der Ereignisse oft höher als bei den großen
Flusshochwassern, da die Vorwarnzeit sehr kurz ist [6]. Eine langjährige Statistik der
Versicherer in Baden-Württemberg hat verdeutlicht, dass 60 % der Hochwasser-
schäden durch Hochwasser außerhalb der großen Flusstäler anfielen [6].
2.1.2 Gebietsrückhalt
Der Gebietsrückhalt ist der Anteil des Niederschlags, der für eine bestimmte Zeit vom
Einzugsgebiet zurück gehalten wird, bevor er abfließt. Maßgeblich für den
Gebietsrückhalt sind die natürlichen Speichereigenschaften des Einzugsgebiets.
Diese Speichereigenschaften ergeben sich aus dem Zusammenwirken der
Speichermedien Boden, Bewuchs, Gelände und dem Gewässernetz einschließlich
der Gewässerauen [41]. Jedes der im Folgenden genannten Speichermedien erfüllt
seine Rückhaltefunktion innerhalb bestimmter natürlicher Grenzen. Sobald ein
Speicher aufgefüllt ist, wird der Folgespeicher belastet. Erst wenn die Speicher
insgesamt überlastet sind, steigen die Wasserstände in den Flüssen. Die vier
genannten Speichermedien ergänzen sich in ihrer Wirkung über weite Bereiche des
natürlichen Niederschlagsgeschehens und führen normalerweise zu überschaubaren
Abflussreaktionen. Bei Überlastung der vorhandenen Wasserspeicherkapazitäten
kommt es jedoch immer wieder auch zu extremen und unerwarteten
Hochwassererscheinungen [46].
2.1.2.1 Boden als Wasserspeicher
Das leistungsfähigste Wasserspeicherelement im Einzugsgebiet ist der Boden. Die
Wasseraufnahmekapazität in seinen Hohlräumen ist vor allem von Bodenstruktur,
Bodenmächtigkeit, Bodendichte, Humusgehalt, Durchwurzelung und dem
Sättigungsgrad abhängig. So kann lockerer Waldboden mehr Wasser aufnehmen als
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
7
verdichteter Lehmboden, Tonschichten in Bodenhorizonten wirken wie eine
Stauschicht. Allerdings ist die Speicherfähigkeit des Bodens ab einem spezifischen
Sättigungsgrad erschöpft [46]. Der Boden verhält sich wie ein Schwamm. Zunächst
kann er viel Wasser aufnehmen, bei anhaltenden Niederschlägen jedoch nimmt die
Wasseraufnahmekapazität ab. Hat es bereits längere Zeit geregnet, ist der Boden
wassergesättigt. Das Wasser sammelt sich dann an der Oberfläche, bildet in Mulden
Pfützen und fließt schließlich oberflächlich ab. So führen lang andauernde starke
Regenfälle auch in der Naturlandschaft irgendwann zu Hochwasser [41]. Gleiches
geschieht, wenn Niederschlag auf gefrorenen Boden fällt. Dieser kann dann ebenso
wenig Wasser aufnehmen wie eine Asphaltfläche. Daher ist die Gefahr von
Hochwasser im Winter erhöht. Generell kommt im Winter durch die höhere
Vorfeuchte des Bodens ein höherer Anteil des Niederschlags zum Abfluss als im
Sommer. Problematisch sind außerdem sehr starke Niederschläge innerhalb kurzer
Zeit: das Wasser kann dann nicht schnell genug in den Untergrund einsickern und
fließt ab, obwohl die Speicherfähigkeit des Bodens noch nicht ausgeschöpft ist; dies
ist häufig bei Sturzfluten der Fall [41].
2.1.2.2 Bewuchs
Der Bewuchs trägt über die verschiedenen Teilprozesse des Wasserhaushalts
erheblich zum Wasserrückhalt bei. Ein Teil des Niederschlags bleibt, ehe er den
Boden erreicht, zunächst an Pflanzen hängen. Grasland speichert zwei, Wald bis zu
fünf Liter Niederschlag pro Quadratmeter [24]. Nach dem Regenereignis verdunstet
das an den Pflanzen haftende Wasser, so dass dieses gar nicht erst den Boden
erreicht. Außerdem nehmen Pflanzen über ihre Wurzeln Wasser aus dem Boden auf.
Überdies verbessert der Pflanzenbewuchs die Speichereigenschaft des Bodens
dadurch, dass die Wurzeln Hohlräume schaffen, in denen sich das Wasser sammeln
und versickern kann. Auf bewachsenen Flächen dringt das auftreffende Wasser
schneller und tiefer in den Boden ein. Der beste Wasserspeicher sind dichte
Waldbestände. Innerhalb einer Stunde versickern auf ebenem Waldboden 60 bis 75
l/m², auf einer Weidefläche hingegen nur etwa 20 l/m² [24].
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
8
2.1.2.3 Geländestrukturen
Auch die Geländeform spielt eine Rolle für den Gebietsrückhalt. Das Gelände trägt
umso mehr zur Versickerung und zum Wasserrückhalt bei, je flacher es ist [41]. In
bergigen Landschaften fließt Niederschlagswasser schneller in den Tälern
zusammen und es hat weniger Zeit zu versickern. Dadurch können die Pegel der
Flüsse im Bergland naturgemäß sehr schnell ansteigen [46]. Im Flachland dagegen
kann mehr Wasser gespeichert werden: einerseits im Boden und auf den Flächen,
andererseits in den Gewässern und ihren Auen selbst. Steigt der Wasserspiegel so
stark an, dass der Fluss über die Ufer tritt, bieten naturnahe Auen im Flachland
ausgedehnte Überflutungsflächen [15]. Durch die Ausuferung wird auch die
Fließgeschwindigkeit reduziert. So kommt es im Flachland seltener zum Aufbau
großer Hochwasserwellen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Fluss bei
steigendem Wasserstand ungehindert ausdehnen kann und die Auen als
Retentionsräume wirken [59].
2.1.2.4 Gewässernetz und Auen
Auch die Fließgewässer selbst und ihre begleitenden Auen haben mit ihrer
Retentionswirkung eine wichtige Funktion für den Ablauf von Hochwasserwellen. Im
Flachland und bei ausgedehnten Überflutungsauen ist die Speicherkapazität des
Gewässernetzes am größten [24]. Sie ist umso wirkungsvoller, je früher das
Gewässer in die Aue ausufert. Mit dem Abklingen des Hochwassers läuft der
Gewässerspeicher wieder leer. Die Beschaffenheit des Gewässernetzes bestimmt
die Höhe und vor allem die Laufzeit des Hochwassers und damit das
Zusammentreffen der Hochwasserwellen aus Haupt- und Nebenflüssen [6].
Naturnahe Flüsse und die dazu gehörigen Auen sind durch eine ständige Dynamik
von Hoch- und Niedrigwasser geprägt. Auen und ihre Biozönosen benötigen die
regelmäßig wiederkehrenden Hochwasser für den Erhalt ihrer Artenzu-
sammensetzung, denn die Lebensgemeinschaft der Aue ist an den Wechsel von
Hoch- und Niedrigwasserständen angepasst. Auen wirken als natürliche
Retentionsflächen für Hochwasser, denn in den Auen wird das Wasser zurück ge-
halten, der Wasserabfluss gebremst und erst entschärft an die stromabwärts
liegenden Flussbereiche weiter gegeben [6].
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
9
2.2
Anthropogene Einflussfaktoren
Durch die in den letzten Jahren festgestellte Zunahme von Hochwasserereignissen
und den damit verbundenen Folgeschäden wurde eine Diskussion über die
Entstehungsursachen entfacht. Im Vordergrund der Diskussion steht dabei die Frage,
wie der anthropogene Einfluss auf das Hochwassergeschehen zu bewerten ist [6].
Anthropogene Eingriffe in das Abflussregime haben zu einer Zunahme von
Hochwasserereignissen geführt. In den vergangenen Jahrhunderten haben die
Menschen die Naturlandschaft Mitteleuropas großflächig zu einer Kulturlandschaft
umgewandelt. Wälder wurden gerodet, Sümpfe und Feuchtwiesen weiträumig
trockengelegt, Acker- und Weideflächen angelegt, Flüsse begradigt und kanalisiert.
Der Landschaftsverbrauch durch Städte- und Straßenbau nimmt noch immer täglich
zu. Diese vielfältigen anthropogenen Eingriffe in Landschaft und Naturhaushalt
haben auch einen Einfluss auf das Hochwassergeschehen. Dabei können sich alle
Eingriffe in die natürlichen Speicher Boden, Bewuchs und Gewässer auswirken [6],
[24].
Besonders bedeutend waren in diesem Sinne Gewässerausbauten, wie
Flussbegradigungen und Staustufenbau unter gleichzeitigem Verlust der natürlichen
Überschwemmungsflächen in den Auen. Durch diese Eingriffe kommt es zu einer
Beschleunigung des Abflusses und zu einer Verstärkung der Abflussspitzen. Häufig
treten hierdurch Überlagerungen der Hochwasserscheitel von Haupt- und
Nebenflüssen auf. Eingriffe in die Landschaft, die die Abflussbereitschaft der
Niederschläge im Einzugsbereich erhöhen bzw. die Speicherkapazität von Boden,
Vegetation und Fließgewässern vermindern, können regional zum Hochwasser-
geschehen beitragen. Schwierig ist die quantitative Bewertung der Auswirkungen des
Gewässerausbaus im Verhältnis zu Maßnahmen, die das Wasserrückhaltevermögen
im jeweiligen Flusseinzugsgebiet beeinflussen, wie beispielsweise künstliche
Flächenversiegelung und Intensivierung der Landwirtschaft, da diese sich in
verschiedenen Regionen bzw. Gewässerabschnitten unterschiedlich stark auswirken
können. Jedoch dürften sich Veränderungen im Umland stärker in Gewässern mit
sehr kleinem Einzugsgebiet auswirken, während in Flüssen mit größerem
Einzugsgebiet der Einfluss wasserbaulicher Maßnahmen stärker nachweisbar ist [3].
Aus Berechnungen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser geht beispielsweise
hervor, dass nur durch eine großflächige Veränderung der Landnutzung im
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
10
gesamten Einzugsgebiet Auswirkungen auf den Wasserabfluss zu erreichen wären
[41]. An größeren Flussgebieten ließe sich eine quantitative Schätzung des
anthropogenen Einflusses auf Hochwasserereignisse insofern vornehmen, als
kontinuierliche Messungen der Abflüsse und Wasserstände vorliegen und
Beschleunigungen des Abflusses sowie Verluste an Retentionsflächen bekannt sind.
Eine solche Modellrechnung ist bisher allerdings an großen Flüssen nicht
durchgeführt worden [3].
2.2.1 Landwirtschaftliche
Nutzung
Vor allem seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Agrarlandschaft vor allem durch
Flurbereinigungsmaßnahmen zur Errichtung großer, einheitlich zu bewirtschaftender
landwirtschaftlicher Nutzflächen - grundlegend verändert worden. Dabei sind
kleinräumige Landschaftsstrukturen, die den Oberflächenabfluss zurückhalten
können und als zusätzlicher Wasserspeicher wirken, wie Bodensenken,
Kleinstgewässer, Hecken, Feldgehölze und hanggliedernde Strukturen wie Wegraine
und Geländekanten, entfernt worden [24]. Vielerorts, auch in Hanglagen, wurde
Dauergrünland in Ackerland umgewandelt. Große Flächen wurden drainiert, Feucht-
und Moorgebiete entwässert, kleine Flüsse begradigt und das landwirtschaftliche
Wegenetz stark erweitert und meist wasserundurchlässig befestigt. Die
Wirtschaftswege wurden oft mit großem Gefälle angelegt, so dass der Niederschlag
beschleunigt in den Vorfluter fließt [3].
Durch landwirtschaftliche Nutzung werden die Bodeneigenschaften und der
Pflanzenbewuchs verändert, was sich direkt oder indirekt auf das
Hochwassergeschehen auswirkt: So vermindert die Umwandlung von Grünland in
Ackerland den Bewuchsspeicher ebenso wie Kulturen und Bewirtschaftungsformen,
bei denen der Boden ganz oder teilweise unbewachsen bleibt [43]. Auch die Art der
Bodenbearbeitung kann sich sehr stark auswirken. Ein aufgelockerter Boden kann
sehr viel Wasser aufnehmen. Schwere Maschinen hingegen verdichten den Boden,
so dass dessen Wasseraufnahmefähigkeit stark abnimmt [41]. Bedeutsam sind
Drainagen, die Staunässe auf landwirtschaftlichen Flächen verhindern sollen. Sie
waren oftmals überhaupt die Voraussetzung für eine ertragreiche Bewirtschaftung
bestimmter Flächen wie Auen oder Feuchtwiesen und auch Niedermooren [6]. Durch
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
11
diese Entwicklung in der Landwirtschaft haben sich Infiltration und
Grundwasserneubildung vielerorts verringert, die Bodenerosion verstärkt sowie der
flächenhafte Abfluss von Regen- und Schmelzwasser vergrößert und beschleunigt
und somit die Hochwassertendenz verstärkt. Durch die Eindeichungen wurden die
Auen von den Flüssen abgetrennt und wurden so nutzbar für Landwirtschaft,
Siedlungsbau und Verkehrsinfrastruktur. Diese Nutzungen verstärken einerseits den
schnellen Abfluss des Wassers und sind andererseits als erstes der
Hochwassergefahr ausgesetzt, und sie führen damit zu den hohen
volkswirtschaftlichen Kosten von Hochwasserereignissen [6].
2.2.2 Forstwirtschaft
Knapp ein Drittel der Fläche Deutschlands ist bewaldet. Neben ihren sonstigen Nutz-
und Schutzfunktionen wirken Wälder stark ausgleichend auf den
Gebietswasserhaushalt. Wesentliches Ziel der Forst- und Landwirtschaft ist es
Flächen besser bewirtschaftbar zu machen, d.h. zunächst die Trockenlegung der
entsprechenden Flächen. Dies durch Einsatz schwerer Maschinen umso
konzentrierter. Die tief und intensiv durchwurzelten Waldböden ökologisch gesunder,
standortgerechter Laubmischwälder in den Einzugsgebieten der Flüsse sind in der
Lage, große Mengen Niederschlags schnell aufzunehmen, zu speichern und
langsam wieder abzugeben. So werden Abflussspitzen verzögert und Trockenzeiten
durch relativ höhere Abflussspenden überbrückt. Im Nationalen Forstprogramm
Deutschland (NFD) der Bundesregierung ist zu lesen: ,,Wälder mindern
Hochwasserspitzen und geben die gespeicherten Wassermengen zeitlich verzögert
und gleichmäßig wieder ab". Ein einziger Hektar Wald könne ,,bei günstiger Struktur
bis zu zwei Millionen Liter Wasser" zurückhalten [8]. Während Brachland 12 %,
Weideland 30 % und Ackerland gar 35 % der Niederschläge ungebremst abfließen
lässt, schlucken gesunde Wälder nahezu alle Niederschläge; lediglich ein Rest von 5
% fließt oberflächlich ab [3]. Zwar sind dies Mittelwerte; im Einzelfall wirken
verschiedene Parameter wie der geologische Untergrund, die Bodenart und dichte,
die Zusammensetzung und das Alter des Waldes, wie auch dessen Vitalität. Aber
letztendlich gilt, dass gesunde Wälder ausgleichend auf den Abfluss wirken und so
einen Beitrag zur Verminderung der Hochwassergefahr leisten [25].
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
12
Trotz einer geringen Zunahme der Waldfläche in den letzten Jahrzehnten ist die
Funktion des Waldes für Wasserspeicherung und ausgleich eingeschränkt worden.
Die Hauptursachen dafür sind Rodung, Einsatz schwerer Maschinen, Forstwege mit
befestigter Oberfläche und ohne Vegetationsdecke, Schädlingsbefall, Verlust
geschlossener Waldgebiete infolge Verkehrswegebau und Bau von Fernleitungen für
Gas und Öl sowie die Auswirkungen von Schadstoffeinträgen. Die weit verbreitete
Bodenversauerung durch Schwefel- und Stickstoffeinträge bleibt über längere Zeit
wirksam und führt zur physiologischen Schwächung der Bäume, wodurch
Sekundärschäden begünstigt werden. Direkte Waldschäden durch Schwefel- und
Stickstoffverbindungen in der Luft treten im Elbeeinzugsgebiet besonders in den
Mittelgebirgen im Grenzbereich zwischen Deutschland, Polen und der
Tschechischen Republik auf. Die durch Kronenverlichtung erhöhte
Sonneneinstrahlung führt zur Mineralisierung der Kohlenstoffvorräte im Waldboden,
zum Humusschwund und dadurch zur Verringerung der Wasserspeicherkapazität
des Waldbodens und zu dementsprechend schnelleren Abflüssen. Außerdem führt
Kronenausdünnung zu einer Verringerung der Interzeptionsverdunstung und damit
zu verstärkten Auftreffen von Regentropfen am Boden. Verringerte Nadel-
/Laubdichte bewirkt darüber hinaus eine Abnahme der Transpiration. Dies führt auf
Stauwasserböden zu einer verstärkten Vernässung und bei Niederschlag zu einem
erhöhten Oberflächenabfluss. Die Situation wird weiter verschärft dadurch, dass die
Wurzeln kranker Bäume weniger Wasser aufnehmen und damit zurückhalten
können. Vielfach spielen auch gravierende waldbauliche Fehler eine große Rolle,
z.B. der Anbau von Altersklassen-Monokulturen nicht standortgerechter Baumarten
[4].
Nach Schanze (2002) hätten Bergwälder ein Extremereignis wie die Elbeflut nicht
verhindern können [4]. Bei vielen kleineren Ereignissen aber, könnten die Art der
Bodennutzung und der Zustand des Bewuchses das Überschwemmungsrisiko
durchaus eindämmen [4].
Besonders in den Hochlagen unserer Mittelgebirge ist das Schadensniveau der
Wälder nach wie vor hoch. So ist die Wasserretentionsfunktion unserer Wälder
insbesondere in den Hochlagen großflächig vermindert, was zur Verschärfung der
Hochwassersituation beiträgt. Die Flutkatastrophe in Sachsen im August 2002 wurde
zu Beginn vor allem durch die extremen Niederschläge und Wassermengen aus dem
Erzgebirge hervorgerufen. Das Erzgebirge ist einer der ,,Hotspots" des Waldsterbens
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
13
in Deutschland. In den dortigen Hochlagen sind vielerorts nur noch Kahlflächen
vorhanden, ein Umstand, der zu einer zusätzlichen Verschärfung des jetzigen
Hochwassergeschehens geführt hat. Eine neue Energie- und Verkehrspolitik sowie
eine Reduzierung des Schadstoffausstoßes ist daher auch für den
Hochwasserschutz wichtig [11].
2.2.3 Flächenversiegelung und Bebauung
Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Die
Entwicklung der Flächennutzung ist wesentlich geprägt durch eine stetige Zunahme
der Siedlungs- und Verkehrsflächen und - vor allem im Umland städtischer
Verdichtungsräume - eine Abnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen. In der
Bundesrepublik Deutschland beanspruchen die Siedlungs- und Verkehrsflächen
40.170 km² der Gesamtfläche von insgesamt 356.970 km² [3]. Das entspricht einem
Flächenanteil von 12 %. Derzeit werden als Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze,
Eisenbahnanlagen und Flughäfen) insgesamt 4,6 % des Bundesgebietes (Stand
1993) statistisch ausgewiesen - allein die Streckenlänge der Straßen nahm von 1970
(430.000 km) bis Mitte der neunziger Jahre (640.000 km) um fast 50% zu [14] - der
Anteil der Bauflächen beträgt 5,8 %. Hierbei handelt es sich nicht ausschließlich um
versiegelte Flächen, es werden auch unbebaute Flächen wie Innenhöfe und Gärten,
bei den Verkehrsflächen z.B. auch Böschungen, unbefestigte Wege oder Lärm-
schutzwälle mit erfasst. In Verdichtungsräumen, in denen die Hälfte der deutschen
Bevölkerung lebt, erreicht die Siedlungs- und Verkehrsfläche heute schon im
Durchschnitt einen Anteil von über 50 %, in Einzelfällen bis zu 75 % [14].
Stadterweiterung stößt in diesen Städten an ihre ,,natürlichen" Grenzen. Schaut man
sich die Entwicklung der Siedlungsflächen an, so kamen 1930 nur 80 m² auf jeden
Einwohner, Mitte der neunziger Jahre ist dieser Wert dreimal so hoch. Die Siedlungs-
und Verkehrsflächen in Deutschland haben sich seit 1900 von 3 % auf 12 % der
Fläche vervierfacht, dabei seit 1950 fast verdoppelt [4], [40]. Die tägliche Zunahme
der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland beträgt derzeit 130 ha, wovon
etwa 50 ha für den Hochwasserschutz relevant sind [49]. Von diesen 130 ha wird
etwa die Hälfte versiegelt [14]. Dabei wird das Niederschlagswasser meist direkt über
die Kanalisation abgeleitet [14]. Die Dachentwässerung in Rheinland-Pfalz wird seit
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
14
einigen Jahren nicht mehr in den Kanal abgeführt. Somit wird wieder stärker
versickert.
In welchem Ausmaß Versiegelung und Bebauung das Hochwassergeschehen im
konkreten Fall beeinflussen, ist abhängig vom Einzugsgebiet. In Verdichtungsräumen
ist die Beeinflussung höher als in ländlichen geprägten Einzugsgebieten. Deichbau,
Baugebiete und Verkehrsflächen in Überschwemmungsgebieten haben die natür-
lichen Retentionsflächen reduziert und den Hochwasserabfluss weiter beschleunigt.
Die Hochwasserstände durch die gewachsenen Siedlungs-, Gewerbe- und
Verkehrsflächen liegen am Rhein um 15 bis 20 Zentimeter höher als noch 1950.
Diese Zentimeter entscheiden darüber, ob z.B. die Kölner Altstadt überflutet wird
oder nicht. Daher ist eines der vordringlichsten Ziele des Hochwasserschutzes eine
Umkehr im Flächenverbrauch. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung hat
das Ziel vorgegeben, den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 ha pro Tag zu
reduzieren. Nun sind Strategien, Konzepte und Instrumente zu erarbeiten, die dieses
Ziel möglichst rasch realisieren lassen [11].
2.2.4 Gewässerausbau
Der Verlauf eines Hochwasserereignisses in einem Fließgewässer wird entscheidend
von der Struktur des Gewässers und der Wechselwirkung mit dessen Umland
bestimmt. Infolge des zunehmenden Ausbaus der Hauptfließgewässer sowie auch
der kleineren Zuflüsse ging durch flussnahe Eindeichung, Kanalisierung und
Regulierung und die Errichtung von Staustufen ein Großteil der natürlichen
Überschwemmungsflächen verloren: Der Rhein büßte etwa 80 % seiner Auen ein,
am deutschen Elbabschnitt sind nur noch ca. 13 % der natürlichen Überschwem-
mungsflächen erhalten [37]. Durch den Ausbau der Flüsse wurde eine Einengung
des Hochwasserprofils und dadurch eine Beschleunigung der Hochwasserwelle und
eine Verstärkung der Abflussspitzen bewirkt. In folge des Ausbaus der Flüsse und
der Anlage von Staustufen zur Energiegewinnung und zur Verbesserung der
Schiffbarkeit wurden die Auen vom Fließgewässer abgetrennt, es erfolgte eine
Einengung des Hochwasserprofils und dadurch kam es zu einem Verlust der
Auenvegetation. Beispielsweise hat sich durch den Verlust natürlicher
Überschwemmungsgebiete am Oberrhein in einer Größenordnung von 130 km² als
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
15
Folge des Ausbaus mit Staustufen zwischen 1955 und 1977 die Laufzeit einer
Hochwasserwelle von Basel bis Karlsruhe von zwei Tagen auf einen Tag halbiert [3].
Das Problem wird zusätzlich verschärft durch die oftmals gleichzeitig eintreffenden
Hochwasser der Nebenflüsse. Um durch die Überlagerung der Hochwasserwellen
auftretende Wassermassen auffangen zu können, müssten daher zusätzliche
Retentionsräume geschaffen werden. Flussbegradigungen führten zu einer
Verkürzung der Lauflänge und damit ebenfalls zu einer Abflussbeschleunigung. So
wurde z.B. der Elbelauf durch die Ausbaumaßnahmen der Vergangenheit, primär
Mäanderdurchstiche sowie Abtrennung und Ausdeichung von Flussschlingen, um
135 km verkürzt [48]. So fließen die Hochwasserwellen nicht nur schneller, sondern
auch steiler und mit größeren Volumina pro Zeiteinheit ab [48]. Auch die schrittweise
Errichtung einer zusammenhängenden Staustufenkette in der böhmischen Elbe und
an der unteren Moldau seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel der
Schiffbarmachung führte zu maßgeblichen Verkürzungen der Laufzeiten von
Hochwasserwellen [15]. Dadurch wird in den flussabwärts liegenden Abschnitten die
Hochwassergefahr stark erhöht. Weitere Verkürzungen des Flusslaufes durch
flussbauliche Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit mit dem Ziel der
beschleunigten Hochwasserabführung auf möglichst kurzem Wege sowie der Mittel-
und Niedrigwasserregulierung zur Verbesserung der Schiffbarkeit in den letzten 100
Jahren verursachten eine Vergrößerung des Sohlengefälles, eine Zunahme der
Sohlenerosion und des Feststofftransports [37], [41].
2.2.5 Anthropogene
Klimaänderungen und Luftverschmutzung
Viele Fachleute schrieben die extremen und zahlreichen Hochwasser der neunziger
Jahre erst dem statistischen Zufall zu. Neuere Forschungen ergaben jedoch, dass
sich seit den siebziger Jahren das Wettergeschehen deutlich verändert hat. Die neue
Entwicklung in der Klimaforschung zeigt:
·
zunehmende
Niederschläge,
wobei saisonale Unterschiede und Änderungen
beim Ereignisverlauf zu beachten sind [58];
·
zunehmende Wetteranomalien (Extremniederschläge), wobei hier die
regionalen Unterschiede entscheidend sind [58];
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
16
·
zunehmende Häufigkeit und Persistenz (Beharrlichkeit) von zyklonalen
Westlagen in Mitteleuropa, die für großflächige und lang anhaltende
Starkregen verantwortlich sind [58].
Das Model des Treibhauseffektes auf der Erde durch die Verbrennung fossiler
Rohstoffe und andere Abgase führt in mittleren und nördlichen Breiten der
Nordhemisphäre zu erhöhten Niederschlägen; in der Folge steigt das
Hochwasserrisiko [58].
Nach
GERSTENGARBE
(2000)
wissen die Klimatologen, dass der Übergang von einem
Klimazustand in einen neuen eine instabile Phase mit sich bringt. Zum Beispiel trat
beim Übergang vom wärmeren Klima im Hochmittelalter zur ,,Kleinen Eiszeit" ab
1450 auch eine Häufung von Extremen auf [23].
Die Änderung unseres heutigen Klimas geht auf die globale Erwärmung zurück, die
größtenteils anthropogen verursacht ist [23].
SCHELLNHUBER
(2000)
konstatierte "Im
vergangenen Jahrhundert erwärmte sich die Erde um 0,6° C. Bis Ende dieses Jahr-
hunderts wird ein Anstieg des globalen Mittelwertes der Erdoberflächentemperatur
um 1,4 bis 5,8° C angenommen" und bezieht sich auf die Analysen des Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) aus dem Jahre 2000, welche neben der
oben genannten Erderwärmung einen Meeresspiegelanstieg um 9 bis 88 cm bis zum
Jahre 2100 prognostizieren [54]. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein
Temperaturanstieg zu einer Intensivierung des Wasserkreislaufes führt, was sich in
erhöhten Niederschlägen und Verdunstungsraten äußern kann [13]. Die Aus-
wirkungen einer Klimaänderung im regionalen und lokalen Maßstab sind für
Deutschland bislang nur teilweise quantifizierbar. Eine entscheidende Rolle für das
Ausmaß klimabedingter Veränderungen spielt die räumlich-zeitliche Verteilung der
einzelnen Prozesse. Auch die Bundesregierung sieht in ihrem Bericht die in den
letzten Jahren verstärkt auftretenden Hochwasserereignisse im Zusammenhang mit
einer Zunahme von Starkregenereignissen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein wärmeres und feuchteres Klima in
Mitteleuropa die hochwasserrelevanten meteorologischen Faktoren insgesamt in
Richtung einer Hochwasserbegünstigung verändern würde. Allerdings besteht
weiterhin ein erheblicher Klärungs- und Forschungsbedarf hinsichtlich der
Auswirkungen der allgemeinen Klimaszenarien auf das regionale, sehr spezifische
Abflussregime der größeren Flusssysteme [8].
2 Ursachen für die Entstehung von Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
17
2.2.6 Ist anthropogene Einflussnahme ursächlich für die Häufigkeit von
Hochwasser-Ereignissen?
Diese häufig gestellte Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, da wie beschrieben
zahlreiche ineinander greifende Faktoren für die Bildung von Hochwasser
verantwortlich sind.
Primäre Ursache für außergewöhnliche Hochwasser sind immer außergewöhnlich
starke Niederschläge. Ist der Boden bereits wassergesättigt oder steht gar unter
Frosteinwirkung, kommt dies einer ,,natürlichen Versiegelung" gleich. Doch kann
durch menschlichen Einfluss ein Hochwasser erheblich verstärkt werden, sei es
durch Veränderung der Landschaft, durch das Roden von Wäldern, durch
Flächenversiegelung oder durch Gewässerausbau. Selbst Schutzmaßnahmen
können das Gegenteil bewirken und an anderer Stelle flussabwärts das
Hochwasser verstärken. So wird, wie bereits geschildert, durch massiven Deichbau
oder großräumige Flussbegradigungen eine Abflusswelle entscheidend beschleunigt.
Außerdem kann menschliches oder technisches Versagen bei der Bedienung und
Wartung von Schutzeinrichtungen zu einer Verschärfung beitragen. Hochwasser-
schäden entstehen durch Nutzung von Flächen, die eigentlich dem Fluss gehören
sollten. Als global bedeutsamster negativer Einfluss jedoch wirkt der weltweite
Klimawandel infolge des so genannten Treibhauseffekts, an dem der Mensch einen
wesentlichen Anteil hat. Insgesamt trägt der Mensch durch seine Eingriffe in den
Naturhaushalt zu einer Verschärfung der Hochwasserproblematik und damit zu einer
Verschlimmerung der Schäden bei [6].
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
18
3
Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser lassen sich untergliedern in Maßnahmen
am Gewässer und in Überschwemmungsgebieten, Maßnahmen im unbesiedelten
Bereich zum dezentralen Wasserrückhalt und Maßnahmen im Siedlungsbereich zum
dezentralen Wasserrückhalt.
Maßnahmen am Gewässer und den Überschwemmungsgebieten umfassen sowohl
technische - Deiche und Mauern, Hochwasserrückhaltebecken, Talsperren und
Polder als auch vorbeugende Maßnahmen Erhöhung der Retentionswirkung
durch Gewässerrenaturierung und Rückgewinnung natürlicher Retentionsflächen. Im
Einzugsgebiet lässt sich der dezentrale Wasserrückhalt durch verschiedene land-
und forstwirtschaftliche Maßnahmen erhöhen. Auch in Siedlungsgebieten bestehen
diverse Möglichkeiten zur Erhöhung der Retentionswirkung, wie Förderung der
Niederschlagsversickerung und des Wasserrückhalts, Entsiegelung von Flächen und
Dachbegrünungen. Im Folgenden sollen diese verschiedenen möglichen Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz und zur Hochwasserprävention erörtert werden.
Anschließend wird auf die rechtlichen Grundlagen zum Hochwasserschutz in
Deutschland eingegangen.
3.1
Die allgemeinen Möglichkeiten des Hochwasserschutzes und der
Aktionsplan Nahe
Seit dem Menschen in der Aue siedeln, besteht ein Konflikt zu den natürlichen
Geschehen des Hochwasserabflusses und den damit verbundenen
Überschwemmungen. Während in früheren Zeiten der reine Objektschutz, d.h. der
Schutz von überschwemmungsgefährdeten durch Errichtung von Deichen, Dämmen
oder Schutzmauern höchste Priorität besaß, wurde durch das Verständnis der
hydrologischen Vorgänge auch Maßnahmen zur Reduzierung der Abfluss-
konzentration und Erhöhung der Retentionsvermögens bedeutsam.
Der Hochwasser-Aktionsplan Nahe ist ein Instrument, um die verschiedenen
Maßnahmen des Hochwasserschutzes aufzuzeigen und stellt eine Entscheidung der
Verantwortungsträger zum Hochwasserschutz dar.
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
19
Dem Hochwasseraktionplan wird zum einen eine Analyse der konkreten
hydrologisch- geographischen Verhältnisse zugrunde liegen müssen, zum anderen
aber eine Erwägung aller Möglichkeiten zum Schutz vor Hochwasser.
So hat es erhebliche praktische Konsequenzen, ob Maßnahmen im Vordergrund
stehen, die bereits von vornherein das Wasseraufkommen reduzieren, oder aber
wenigsten soweit zurückhalten, dass es phasenweise und mit niedrigerer Höhe
ablaufen kann oder ob mit Deichen und Dämmen hochauflaufende Fluten vor
schützenswerten Bereichen ferngehalten werden sollen.
Dabei muss das, was grundsätzlich vorzuziehen wäre, nämlich die Entlastung von
Wasseraufkommen, keineswegs auch gewählt werden.
Grundsätzlich ist eine Entlastung des Wasseraufkommens vorzuziehen. Es sollte
keineswegs in den Hintergrund treten, etwa weil der Schutz nicht schnell und
ausreichend genug ausfällt oder weil Finanzen schon von schnell und unmittelbar
erforderlichen Maßnahmen verbraucht werden.
Die folgende Darstellung des Maßnahmenkatalogs des Hochwasser-Aktionsplanes
Nahe wird zeigen, wie sich die Verantwortungsträger entschieden haben.
So kommen für die Reduzierung von Wasseraufkommen
·
die Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer, Auen und
Uferrandstreifen
·
Sicherung und Wiederherstellung von Retentionsräumen
·
Einschränkung des technischen Gewässerausbaus
·
Erhöhung der Speicherwirkung durch land- und forstwirtschaftliche
Maßnahmen
·
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser durch Rückhaltung,
Versickerung, Vermeidung von Versiegelung, Endsiegelung und
Belagsänderung in Betracht.
Dazu können zur Rückhaltung von Wassermengen
·
Rückhaltebecken und Talsperren sowie
·
Polder
angelegt werden.
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
20
An den Schutz durch Deiche, die neu gebaut, gewartet oder verlegt werden müssen,
und die durch Mauern, Schutzwände, mobile Elemente unterstützt werden, wird in
der Regel zuerst gedacht.
Schließlich wird Minderung der Schadenshöhe in den Überflutungsgebieten durch
Verbot von Bauten und bestimmte Nutzungen, Bau- und Nutzungsauflagen,
Rückbauten und Verlagerungen geplant.
Dabei ergeben sich bei den einzelnen Maßnahmemöglichkeiten weitere
Entscheidungsnotwendigkeiten:
Beispielsweise geht es bei Rückhaltebecken um die Frage, ob die Fernwirkung oder
die Nahwirkung bevorzugt werden soll. Soll zur Speicherung von Grundwasser
beigetragen werden oder zur Aufhöhung von Niedrigwasser für die Schifffahrt, dann
muss die Anlage mindestens teilweise gefüllt bleiben, kann also nur begrenzt dem
Hochwasserschutz dienen.
An der Nahe wird der Aspekt der Niedrigwasser-Aufhöhung keine Rolle spielen,
auch die Grundwasserspeicherung wenig, wohl aber der Schutzzweck.
Ähnliche Interessenkollisionen sind bei Talsperren möglich zwischen
Trinkwasserversorgung, Stromerzeugung und Aufnahme von Hochwasser. Ist die
Talsperre gefüllt für den ersteren Zweck, fällt sie für den zweiten aus.
Als weiteres Beispiel zeigt sich bei der Versickerung des Regenwassers, dass zwar
Kosten durch geringere Erfordernisse bei der Abwasserkanalisation eingespart
werden können, aber vorausgesetzt werden muss, dass es zu keiner Kontamination
des Grundwassers kommt.
Es liegt die Vermutung nahe, dass die Verfasser des Aktionsplanes ihre
Entscheidung tendenziell nach dem Grundsatz ,,Mehr Raum für das Wasser" richten.
Die nachfolgende Darstellung der möglichen Maßnahmen wird eine Grundlage für
die Beurteilung ihrer Entscheidungen geben können.
3.1.1 Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Für eine nachhaltige Hochwasservorsorge sind Maßnahmen zur Erhaltung und
Reaktivierung der natürlichen Wasserspeicherung im gesamten Flusseinzugsgebiet
unerlässlich. Es muss so viel Wasser wie möglich so lange wie möglich auf der
Fläche gehalten werden. Die natürliche Speicherung in Gewässern und Auen muss
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
21
gefördert werden. Ein solches ,,Hochwasserflächenmanagement" sollte bei der
Hochwasservorsorge, dort wo es möglich ist, Vorrang vor einem
,,Hochwassermanagement" haben, das unter anderem die Vergrößerung der
Gewässernetzkapazität, den weiteren Deichbau und neue Hochwasser-
rückhaltebecken einschließt [3]:
Viele - im Folgenden näher zu erläuternde - Einzelmaßnahmen auf lokaler und
regionaler Ebene tragen zur Erhöhung des Wasserrückhalts in der Landschaft, zur
Begrenzung des oberflächlich abfließenden Niederschlagswassers und zur
Vermeidung einer beschleunigten Wasserableitung bei. Die Summe dieser
Einzelmaßnahmen wirkt hochwasserdämpfend. Diese Maßnahmen sind
selbstverständlich nicht nur auf Hochwassergefährdeten Flächen, sondern auf der
gesamten Flusseinzugsgebietsfläche durchzuführen.
Wirksamer Hochwasserschutz beinhaltet in erster Linie den Verzicht auf
Ausbaumaßnahmen, die nachhaltig in das Abflussregime eingreifen, wie
Flussbegradigungen, Kanalisierungen, Entfernung des Uferbewuchses und
Abtrennung der Auen vom Fluss. Daher sollten alle geplanten Ausbaumaßnahmen
hinsichtlich der genannten Aspekte geprüft werden. Maßnahmen, die eine
Verstärkung der Hochwassergefahr erwarten lassen, sollten zurückgestellt und
erneut diskutiert oder gänzlich unterlassen werden [3].
In zweiter Linie kommt es auf eine möglichst umfassende Wiedergewinnung von
Überschwemmungsgebieten an; sie können zur Abflachung der
Hochwasserabflussspitzen beitragen. Dabei ist der Rückverlegung von flussnahen
Deichen der Vorzug zu geben, weil das zum Fluss hin wieder geöffnete Gelände
auch schon geringeren Hochwasserereignissen ausgesetzt ist und sich auf diese
Weise Auen reaktivieren können. Dieser Vorgang bedarf keiner Steuerung. Polder
hingegen dienen der gezielten Rückhaltung bei Hochwasserereignissen; sie werden
in der Regel anderweitig, vor allem landwirtschaftlich genutzt, woraus
Interessenkonflikte entstehen können.
Bei der Rückgewinnung natürlicher Überschwemmungsgebiete haben Lösungen mit
möglichst geringen Eingriffen in den Naturhaushalt Vorrang.
In diesem Zusammenhang sind folgende Maßnahmen möglich:
·
Naturnaher
Gewässerausbau
·
Beseitigung oder Rückverlegung von Deichen und Dämmen
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
22
·
Änderung der Betriebsweise vorhandener Hochwasserrückhaltebecken und
Talsperren
·
ökologische
Flutungen.
Weiterhin können ohne den langwierigen Verfahrensgang dieser Maßnahmen
,,kleinere" Maßnahmen angewendet werden, wie beispielsweise der Einbau von
Sohlschwellen in das Gewässer und die Anpflanzung von Uferbewuchs zur
Erhöhung der Rauhigkeit. Jedoch besteht unter den Experten Uneinigkeit bezüglich
der Auswirkung von Auwäldern auf den Hochwasserabfluss. So betonen die einen,
dass Auwälder im Deichvorland auf lokaler Ebene ein Problem für die
Deichverteidigung im Hochwasserfall darstellen, wenn man mangels
Deichverteidigungswegen mit Booten zum Deich gelangen muss, und dass Auwälder
den Eisversatz erhöhen. Andere Fachleute bestätigen dies, betonen so die
überregional positive hydraulische Wirkung von Auwäldern [6], [49], [59].
3.1.1.1
Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer,
Uferrandstreifen und Auen
Nachdem in der Vergangenheit alle größeren Fließgewässer auf weiten Strecken
technisch ausgebaut wurden Begradigungen, Kanalisation, Anlage eines
regelmäßigen und befestigten Profils, Entfernung des Uferbewuchses, technisch
orientierte Gewässerunterhaltung, Abtrennung und Nutzung der Auen fand in den
letzten Jahren eine Trendumkehr hin zur Erhaltung der noch natürlichen
Gewässerstrecken und zum naturnahen Aus- und Rückbau der Gewässer statt [41].
Bei natürlichen Fließgewässern und ihren Auen ist die Speicherfähigkeit des
Gewässernetzes durch ihr vielgestaltiges und hindernisreiches Bett und eine meist
krümmungsreiche Laufentwicklung gegenüber ausgebauten Gewässern wesentlich
ausgeprägter. Diese Beschaffenheit des Gewässerbetts und der Bach- oder
Flussbegleitende Bewuchs sorgen für einen langsamen Abfluss und eine frühzeitige
Ausuferung in die umliegende Talaue. Dadurch wird ein Teil des
Hochwasserabflusses zurückgehalten. Des weiteren werden in naturnahen
Fließgewässern gegenüber technisch ausgebauten Gewässern geringere
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
23
Fließgeschwindigkeiten erreicht, welche den Hochwasserscheitel zu Gunsten der
Unterlieger dämpfen. Die durch die langsamere Fließgeschwindigkeit bedingte
Anhebung des Wasserspiegels führt zudem zu einem frühen Ausufern bei
Hochwasser. Damit können vorhandene Retentionsräume wieder genutzt und der
Hochwasserabfluss reduziert werden. Die genannten Wirkungen werden durch
krümmungsreiche Laufentwicklung, größere Profilquerschnitte, geringeres Gefälle,
raue Gewässersohle, Uferbewuchs und Anbindung des Gewässers an die Aue
erreicht [6].
Die durch die Erhöhung des Wasserspiegels bedingten häufigeren Überflutungen
wirken sich auf die Nutzungen in der Aue bzw. im Überschwemmungsgebiet aus.
Jedoch ist immer eine hydrologische Betrachtung des jeweiligen Gewässers
erforderlich, da auch hier gilt, dass Hochwasserschutz durch Wasserrückhalt dort, wo
das Wasser zurückgehalten wird, höhere Wasserstände als vorher bringt [41].
3.1.1.2 Einschränkungen des technischen Gewässerausbaus
Sofern Gewässer als Wasserstraßen für die Schifffahrt weiterhin genutzt werden
sollen, lassen sich Renaturierungsmaßnahmen nur bis zu einem gewissen Grad
durchführen, ohne die verkehrliche Nutzung bedeutend einzuschränken. Um eine
Verschärfung der Hochwassersituation als Folge der verkehrlichen Nutzung der
Gewässer weitgehend verhindern zu können, müssen sich die Bemühungen
vorrangig auf den vorsorgenden Hochwasserschutz konzentrieren, verbunden mit
dem Ziel, so weit wie nur möglich auf jegliche weitere Ausbaumaßnahmen zu
verzichten.
Für Wasserstraßen, auf denen zukünftig ein Transportaufkommen erwartet wird, das
einen Infrastrukturausbau erforderlich macht, müssen daher folgende Aspekte
berücksichtigt werden:
Ausbaumaßnahmen an Wasserstraßen sollten nur zugelassen werden, wenn auf den
Infrastrukturausbau der anderen Verkehrsträger (Schiene, Straße), die die gleichen
Transportrelationen bedienen, verzichtet sowie keine zusätzliche Konkurrenzsituation
zum Schienentransport geschaffen wird; der Umfang der Ausbaumaßnahmen muss
auf das notwendige Minimum beschränkt werden; die ökologische Verträglichkeit von
Gewässerausbaumaßnahmen ist durch Ausgleichsmaßnahmen zu sichern; der
Einfluss der Ausbaumaßnahmen auf die Hochwasserentwicklung sollte genau
3 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
Hochwasserschutz an der Nahe
Christian Uecker
24
geprüft werden und als wesentliches Entscheidungskriterium für oder gegen den
Ausbau gelten; entsprechend dem Ausbauniveau sollten Wegekostenabgaben
eingeführt werden, die gestaffelt nach Schiffsgröße (z. B. max. Abladetiefe) erhoben
werden, mit dem Ziel, die Benutzer der ausgebauten Wasserstraßen im Verhältnis zu
ihrem Nutzenvorteil zu belasten; wenn durch einen weiteren Ausbau ökologische
Schäden zu erwarten sind, die auch mittels Ausgleichsmaßnahmen kaum
kompensiert werden können, muss ein Verzicht auf den Ausbau - trotz
nachgewiesener infrastruktureller Notwendigkeit - erwogen werden [3].
Diese Vorgehensweise wird durch Zahlen gestützt, nach denen der Umfang der
deutschen Binnenschifffahrt trotz des Ausbaus des Wasserstraßennetzes auf
ganzjährige Fahrwassertiefen von 2 bis 3 m stark abgenommen hat.
Nach
DÖRFLER
(2001)
hat die deutsche Binnenschifffahrt zwischen 1975 und 1998
35 % ihrer Schiffe und 25 % ihrer Tragfähigkeit eingebüßt [24]. Allerdings ist hier
nicht die ausländische Konkurrenz berücksichtigt.
3.1.1.3
Sicherung und Wiederherstellung von Retentionsräumen und
Überschwemmungsgebieten
Natürliche Überschwemmungsgebiete bewirken eine Verlangsamung des
Hochwasserabflusses und eine Verminderung der Hochwasserspitzenabflüsse. Hier
besteht kein Versagensrisiko wie bei technischen Rückhaltemaßnahmen. Jedoch ist
der Flächenbedarf für die Verminderung der Hochwasserspitzen bei natürlichen
Überschwemmungsgebieten in der Regel höher als bei technischen Maßnahmen,
was in den wesentlich geringeren Einstauhöhen begründet ist. Außerdem kann man
hier nicht durch Steuerung in den Hochwasserablauf eingreifen. Dagegen sind
technische Rückhaltemaßnahmen mit erheblich höheren Kosten verbunden.
Nutzungskonflikte bestehen vor allem mit Siedlungs- und Gewerbeflächen sowie mit
der Verkehrsinfrastruktur; aber auch mit der Landwirtschaft, wenn
hochwasserempfindliche Kulturen angebaut werden. Bei an gelegentliche
Überflutungen angepassten landwirtschaftlichen Kulturen, wie beispielsweise
Grünland, besteht kaum eine Beeinträchtigung [7].
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832493721
- ISBN (Paperback)
- 9783838693729
- Dateigröße
- 13.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung – Umwelttechnik
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- ursache maßnahme geographie bewertung schadenspotential
- Produktsicherheit
- Diplom.de