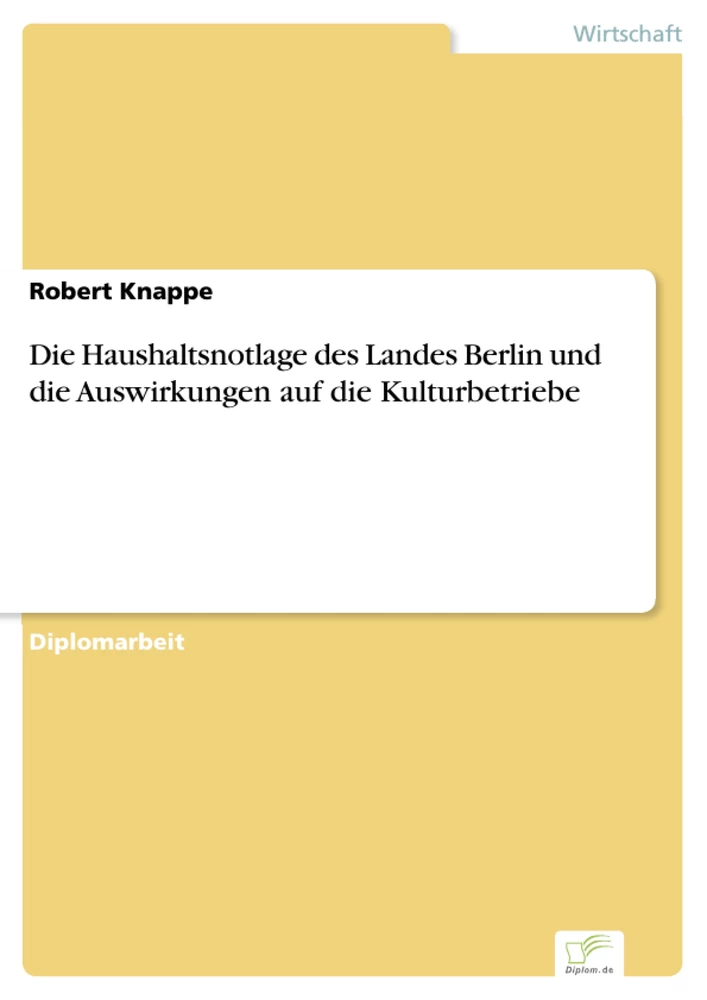Die Haushaltsnotlage des Landes Berlin und die Auswirkungen auf die Kulturbetriebe
Zusammenfassung
Kunst und Kultur sind noch nie ohne Subventionen ausgekommen. Schon das griechische und römische Theater wurden unterstützt, später die Kunst des Mittelalters durch die Kirche und die Kunst der Renaissance durch Fürsten oder Mäzene wie die florentinische Familie Medici häufig verbunden mit Eigeninteressen der Geldgeber, etwa zur Repräsentation oder Ruhmerlangung.
Seit dem 19. Jahrhundert übernehmen neben dem Bürgertum vor allem staatliche Institutionen und die Kommunen die Finanzierungsaufgaben der Kultur. Heute trägt die öffentliche Hand in Deutschland mit jährlich ca. 8,2 Mrd. Euro (2003), das entspricht 1,66 % des Gesamtetats der öffentlichen Haushalte und 101,5 Euro pro Einwohner, nach wie vor den Großteil des kulturellen Lebens in Deutschland, mit fallender Tendenz seit 2001. Die Länder brachten in 2001 43 %, die Kommunen 45% und der Bund 12 % der öffentlichen Mittel für die Kultur auf. Der private Anteil der Kulturfinanzierung liegt bei ca. 5 bis 10 %.
In Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte, wachsender Verschuldung und Forderungen nach Ausgabenkonsolidierung stehen diese Subventionen zunehmend unter Rechtfertigungsnot und Kürzungsdruck. Ganz besonders gilt dies für das hochverschuldete Land Berlin, das seit 2002 vor dem Bundesverfassungsgericht um die Anerkennung der Situation der extremen Haushaltsnotlage streitet, um Unterstützungen durch den Bund und die Bundesgemeinschaft zu erhalten.
Andererseits ist Berlin nicht nur die bundesrepublikanische Hauptstadt, sondern auch die Kulturhauptstadt Deutschlands, die trotz erfolgter Kürzungen nach wie vor ein kulturelles Angebot in einer Breite, Vielfalt und Qualität bietet, das bundesweit und - pro Einwohner betrachtet - vielleicht auch international seinesgleichen sucht.
Gang der Untersuchung:
In dieser Arbeit soll analysiert werden, wie die Haushaltsnotlage entstanden ist, welche Konsequenzen von ihr auf die Kulturbetriebe ausgehen und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen. Dazu wird der Status Quo aufgezeigt, von theoretischer und praktischer Seite kritisch beleuchtet, um zu einer vorsichtigen Gesamteinschätzung der Situation, Handlungsoptionen und einem Zukunftsausblick zu gelangen.
Zunächst wird das Phänomen der einfachen und extremen Haushaltsnotlage allgemein betrachtet. Im Folgenden wird analysiert, inwiefern in Berlin von einer Haushaltsnotlage betroffen ist, was die Ursachen dafür sind und welche Szenarien für die Zukunft bestehen. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Haushaltsnotlage des Landes Berlin
2.1 Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht auf Feststellung der extremen Haushaltsnotlage
2.1.1 Zum Begriff der „extremen Haushaltsnotlage“
2.1.2 Juristische Aspekte
2.1.3 Politische Aspekte
2.1.4 Finanzwissenschaftliche Aspekte
2.2 Ursachen, Symptome und aktuelle Situation
2.2.1 Aus Sicht der Senatsverwaltung für Finanzen
2.2.2 Aus Sicht der Gutachter Färber und Wieland
2.2.3 Aus Sicht des Bundes
2.2.4 Aus Sicht externer Autoren und Wissenschaftler
2.2.5 Im Vergleich mit anderen Bundesländern
2.3 Finanzplanungen für die Zukunft
2.3.1 Senatsverwaltung für Finanzen
2.3.2 Der Berliner Kulturetat
2.3.3 Auswirkungen des Klageerfolgs bzw. -misserfolgs auf das Land Berlin
3. Die Auswirkungen auf die Kulturbetriebe
3.1 Definition
3.2 Bedeutung der Kultur in und für Berlin
3.2.1 Direkte Einkommens- und Beschäftigungseffekte
3.2.2 Umwegrentabilitäten von öffentlichen Zuwendungen und positive Externalitäten im Kultursektor
3.2.3 Kulturpolitik in Berlin
3.3 Finanzierung und Haushalte der Kulturbetriebe
3.3.1 Einnahmequellen
3.3.2 Ausgabenstrukturen
3.3.2 Entwicklungen im Zeitablauf
3.4 Auswirkung der Haushaltsnotlage auf die Planungssicherheit
3.5 Mögliche Konsequenzen für die Kulturbetriebe
4. Lösungsansätze
4.1 Auf politischer Ebene: Kriterien für eine sinnvolle und effektive Haushaltskonsolidierung
4.1.1 Ökonomische und finanzwissenschaftliche Kriterien
4.1.2 Bestimmung der Güterart von Kultur und normative Kriterien
4.1.3 Politische Kriterien
4.1.4 Berücksichtigung der Zukunftsentwicklung Berlins
4.2 Auf Ebene der Kulturbetriebe: Private Finanzierungsquellen und wirtschaftlicheres Handeln
4.2.1 Sponsoring
4.2.2 Fundraising
4.2.3 Public Private Partnership (PPP)
4.2.4 Stiftungen
4.2.5 Mögliche Einnahmesteigerungen
4.2.6 Potentielle Ausgabensenkungen
4.3 Chancen und Grenzen des Controllings
4.4 Handlungsspielräume und –rationalitäten in Kulturbetrieben
5. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
[...]
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Mehreinnahmen und Mehrausgaben Berlins gegenüber dem Länderdurchschnitt (ab 2004 Soll)
Abb. 2: Primär- und Finanzierungssalden 1991-2009
Abb. 3: Kreditfinanzierungsquoten ausgewählter Länder (einschl. Gemeinden)
Abb. 4: Zins-Steuer-Quoten ausgewählter Länder (einschl. Gemeinden)
Abb. 5: Personal- und Sachausgaben ausgewählter Länder einschl. Gemeinden pro Einwohner
Abb. 6: Eckwerte zum Doppelhaushalt 2006 / 2007 und zum Finanzplanungszeitraum 2005 bis 2009
Abb. 7: Entwicklung des Berliner Kulturetats
Abb. 8: Aufteilung des Berliner Kulturetats 2005
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Berechnung des Primärdefizits und der Deckungslücke
Tab. 2: Strukturdaten einiger Länder im Vergleich
Tab. 3: Gegenläufige volkswirtschaftliche Effekte bei Konsolidierungsmaßnahmen
Tab. 4: Einsatzmöglichkeiten des operativen Controllings in Kulturbetrieben
Tab. 5: Die drei wesentlichen Rationalitäten in Kulturbetrieben
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Übersicht der geführten ausführlichen Interviews
Anhang 2: Übersicht der am Rande von Veranstaltungen geführten Kurzbefragungen
Anhang 3: Entwurf Doppelhaushalt 2006/07 und Eckwerte Finanzplanung 2005 bis 2009
Anhang 4: Eckdaten des Kulturhaushalts ab 2003
Anhang 5: Einzelplan 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung 2003-2007
1. Einleitung
"Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts.“ Theodor Heuss
Kunst und Kultur sind noch nie ohne Subventionen ausgekommen. Schon das griechische und römische Theater wurden unterstützt, später die Kunst des Mittelalters durch die Kirche und die Kunst der Renaissance durch Fürsten oder Mäzene wie die florentinische Familie Medici – häufig verbunden mit Eigeninteressen der Geldgeber, etwa zur Repräsentation oder Ruhmerlangung[1].
Seit dem 19. Jahrhundert übernehmen neben dem Bürgertum vor allem staatliche Institutionen und die Kommunen die Finanzierungsaufgaben der Kultur. Heute trägt die öffentliche Hand in Deutschland mit jährlich ca. 8,2 Mrd. € (2003), das entspricht 1,66 % des Gesamtetats der öffentlichen Haushalte und 101,5 € pro Einwohner, nach wie vor den Großteil des kulturellen Lebens in Deutschland, mit fallender Tendenz seit 2001[2]. Die Länder brachten in 2001 43 %, die Kommunen 45 % und der Bund 12 % der öffentlichen Mittel für die Kultur auf[3]. Der private Anteil der Kulturfinanzierung liegt bei ca. 5 bis 10 %[4].
In Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte, wachsender Verschuldung und Forderungen nach Ausgabenkonsolidierung stehen diese Subventionen zunehmend unter Rechtfertigungsnot und Kürzungsdruck[5]. Ganz besonders gilt dies für das hochverschuldete Land Berlin, das seit 2002 vor dem Bundesverfassungsgericht um die Anerkennung der Situation der extremen Haushaltsnotlage streitet, um Unterstützungen durch den Bund und die Bundesgemeinschaft zu erhalten. Andererseits ist Berlin nicht nur die bundesrepublikanische Hauptstadt, sondern auch die Kulturhauptstadt Deutschlands, die trotz erfolgter Kürzungen nach wie vor ein kulturelles Angebot in einer Breite, Vielfalt und Qualität bietet, das bundesweit und - pro Einwohner betrachtet - vielleicht auch international seinesgleichen sucht.
In dieser Arbeit soll analysiert werden, wie die Haushaltsnotlage entstanden ist, welche Konsequenzen von ihr auf die Kulturbetriebe ausgehen und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen. Dazu wird der Status Quo aufgezeigt, von theoretischer und praktischer Seite kritisch beleuchtet, um zu einer vorsichtigen Gesamteinschätzung der Situation, Handlungsoptionen und einem Zukunftsausblick zu gelangen.
2. Die Haushaltsnotlage des Landes Berlin
2.1 Die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht auf Feststellung der extremen Haushaltsnotlage
2.1.1 Zum Begriff der „extremen Haushaltsnotlage“
Es muss zwischen der einfachen und der extremen Haushaltsnotlage differenziert werden:
Die Entstehung und Erscheinungsformen einer einfachen Haushaltsnotlage sind vielfältig. Im Kern besteht sie aus einer hohen Verschuldung eines Landes, die es nicht mehr ermöglicht, verfassungsgemäße Haushalte[6] aufzustellen, wenn das Land seinen gesetzlichen Pflichten bei der Herstellung öffentlicher Güter nachkommen will[7]. Zur Feststellung einer Haushaltsnotlange hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung (BVerfGE 86, 148, S. 259ff.; Urteil vom 27. 5. 1992) Indikatoren entwickelt, die davon ausgehen, dass eine Haushaltsnotlage eines Bundeslandes dann vorliegt, wenn
a) die Kreditfinanzierungsquote (Anteil der bereinigten Ausgaben, der durch Neukredite finanziert wird[8] ) gegenüber dem Durchschnitt der Bundesländer mehr als doppelt so hoch ist und
b) die Zins-Steuer-Quote
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
zur selben Zeit weit über dem Durchschnitt (mindestens 70 %) der Bundesländer liegt[9].
c) Ergänzende Indikatoren wie der Haushaltsnettobeitrag
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
können optional ebenfalls herangezogen werden[10].
Durch die höhere Volatilität des Kriteriums a) ist Kriterium b) tendenziell von größerer Bedeutung[11]. Wegen der unterschiedlichen Strukturen der Stadtstaaten und Flächenstaaten werden bei der Berechnung der Kennzahlen Kommunal- und Landesebene aggregiert[12].
Eine extreme Haushaltsnotlage liegt dann vor, wenn die Mechanismen des Länderfinanzausgleichs nicht mehr für eine Hilfeleistung ausreichen[13]. Es war und ist einem Land in dieser Situation nicht mehr möglich, mittels eigener Anstrengungen den Zustand nicht verfassungsgemäßer Haushaltsstrukturen abzuwenden[14]. Außerdem kann als Indikator der finanzielle Aufwand betrachtet werden, der für eine Haushaltssanierung binnen 5 Jahren zum Erreichen der Zins-Steuerquote des Landes mit der nächst höheren Zins-Steuerquote notwendig wäre. Von einer nicht möglichen Selbsthilfe und damit extremen Haushaltsnotlage kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Betrag per anno mehr als 20 % des Haushaltsumfangs ausmacht[15]. Eine präventive Abwehr einer mit Sicherheit eintretenden extremen Haushaltsnotlage hält das Bundesverfassungsgericht für verfassungsrechtlich geboten, so dass der Anspruch auf Sanierungshilfe sogar vorbeugend entstehen kann[16].
2.1.2 Juristische Aspekte
Nach dem Konnexitätsprinzip in Art. 104a Abs. 1 GG folgt die Ausgabenlast der Aufgabenlast. Die hierfür erforderliche Finanzkraft hat die komplizierte mehrstufige Verteilung des Finanzaufkommens in der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Ist dies nicht der Fall und befindet sich ein Land in einer extremen Haushaltsnotlage, so urteilte das Bundesverfassungsgericht aus dem Bundesstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 1 GG und konkretisierend aus Art. 109 Abs. 2 GG, müssen die anderen Glieder des Länderfinanzausgleichs helfende Maßnahmen zur Wahrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einleiten[17].
Die Hilfen des Bundes sind an Anforderungen an das empfangende Bundesland gekoppelt, welche im sog. „Maßstäbegesetz“ (Gesetz über verfassungskonkretisierende, allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen vom 9. September 2001) im § 12 festgelegt sind. Dazu gehören folgende Punkte[18]:
- Die Hilfeleistungspflicht des Bundes ist nur in Ausnahmefällen gegeben.
- Das Land muss „ausreichende“ Eigenanstrengungen unternommen haben, um eine drohende Haushaltsnotlage abzuwenden oder sich aus ihr zu befreien, insbesondere eine Ausgabensenkung auf das Niveau vergleichbarer Bundesländer bzw. Stadtstaaten.
- Es besteht eine Kooperationspflicht: Die Sanierungshilfen sind mit strengen Auflagen und einem verbindlichen Sanierungsprogramm zu verknüpfen. Letzteres muss daran gemessen werden, ob es unter Einbeziehung der Bundeshilfen geeignet ist, die Bewirtschaftung aus eigener Verantwortung des Landes wieder herzustellen[19].
Die Frage nach dem eigenen Verschulden des jeweiligen Landes spielt explizit keine Rolle, da sie aufgrund einer zu komplexen und subjektiven Ursachenanalyse kein juristisches Tatbestandsmerkmal für eine Haushaltsnotlage ist[20], klingt aber doch implizit in dem zweiten Kriterium an, vgl. oben. Hier gibt es Interpretationsspielräume, die Konsequenzen für den Klageerfolg des Landes haben können. Daher soll die Verschuldensfrage im Folgenden erörtert werden.
Die Entscheidung, nicht permanente Neuverschuldungen hinzunehmen, sondern durch strukturelle Maßnahmen zum Abbau der Primärdefizite zu gelangen, wurde in Berlin mit Zeitverzögerung gegenüber anderen Ländern, die dies bereits gegen Mitte der 90er Jahre taten, getroffen, wie selbst Gutachterin Färber einräumt[21]. Dies wurde getan, obschon ein Bewusstsein für die aufgehende Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen in einem Senatsbeschluss bereits vom 7. Mai 1991 dokumentiert ist, der die Unausweichlichkeit von stetigen Bundeshilfen für das angebrochene Jahrzehnt betont[22]. Die eingetretene Krisensituation der öffentlichen Finanzen wurde jedoch von der damaligen großen Koalition verdrängt[23]. Wären jedoch die optimistischen Erwartungen der Vereinigungszeit, die auch vom Bund und der Wissenschaft gestützt wurden, eingetreten, u. a. dass Berlin auf 5 Mio. Einwohner anwachsen und der wirtschaftliche Strukturwandel rasch voranschreiten würde, dann wären die z. T. konstanten Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich und Steuern gedeckt gewesen[24]. Fraglich ist jedoch, ob das Land nicht zu einem früheren Zeitpunkt die Vision der „blühenden Landschaften“ als unrealistisch hätte verwerfen müssen. Entlastend wirkt die explizite Aufforderung des Bundes in den Jahren nach der Wiedervereinigung an die neuen Länder, ihre Primärdefizite durch Kreditaufnahme zu finanzieren, wie er es auch selbst getan hatte[25].
Der größte Teil des Ausgabenanstiegs geht auf das Wachstum der Sozialabgaben und die Migration zurück[26], also Umstände, für die Berlin nicht direkt verantwortlich gemacht werden kann. Ferner wurden die Bundeshilfen in einem so schnellen Maße zurückgefahren, das die zwingend erforderlichen Sanierungen im Ostteil der Stadt nicht ausreichend berücksichtigte[27]. Zwischen 1995 und 2000 hat Berlin bereits Konsolidierungsmaßnahmen von 10 % der Primärausgaben bzw. 2 Mrd. € umsetzen können. Steuereinnahmeausfälle wie in 2001ff. sind auf bundespolitische Entscheidungen zurückzuführen, insbesondere auf die Unternehmenssteuerreform[28]. Der Themenkomplex Krise der Bankgesellschaft Berlin, der auch Milliardensummen verschlungen hat, ist in der Verschuldensfrage sehr vielschichtig und wird z. Zt. noch gerichtlich erörtert; ein teilweises Mitverschulden der Landespolitik ist aber vermutlich kaum zu bestreiten. Auch im Bereich der lange beibehaltenen Wohnungsbauförderung, jährlich ca. 1 Mrd. €[29], wird sich die Landesregierung attestieren lassen müssen, dass dies ein Luxus für das Land war[30] ; der komplette Ausstieg ist jedoch inzwischen beschlossen[31]. Wären diese Krise und die Steuerausfälle in 2001 und 2002 nicht vorgekommen, dann wäre eine Sanierung des Landes aus Eigenanstrengung in 1999 und 2000 noch möglich gewesen[32].
Das Eigenverschulden wird von der Senatsverwaltung für Finanzen mit folgenden Aspekten bestritten[33]:
- Nicht beeinflussbare wirtschaftliche Entwicklungen,
- zurückgeführte Transferleistungen an Berlin,
- unausweichliche Mehrausgaben allgemeiner Art (Sozialabgaben),
- Stadtstaaten- und Hauptstadtstatus (Justiz, Polizei),
- politischer Wille (Hochschulen und Kultur mit Bundesaufgaben),
- Sozialverträglichkeit (Tarifangleichung bei Arbeitern und Angestellten),
- geringe Handlungsspielräume,
- Lasten aus der Wiedervereinigung und
- die Interdependenz der hoheitlichen Systeme.
Neben den zugesagten eigenen Sanierungsanstrengungen ist das Land darüber hinaus verpflichtet, die landesverfassungsrechtlichen Auflagen des Berliner Verfassungsgerichtshofs zu beachten. Durch dessen Urteil vom 31. 10. 2003 (VerfGH 125/02) wird der Senat dazu verpflichtet, nur zwingend erforderliche Ausgaben im Haushaltsplan zu veranschlagen sowie alle möglichen Einnahmequellen und Ausgabeneinschränkungen auszuschöpfen[34]. Hieraus ergibt sich die Frage, inwiefern Ausgaben des Kulturetats in diesem juristischen Sinne zwingend sind, bzw. welche konkrete Höhe als für zwingend erachtet werden kann. Art. 30 GG, die sog. Zuständigkeits-Generalklausel, verweist auf die generelle Kompetenz der Länder, sofern nicht dem Bund die Aufgabe explizit zugeschrieben ist[35]. Daraus leitet sich die Kulturhoheit der Länder ab[36]. Berlin ist neben Hamburg das einzige Bundesland, dessen Verfassung oder sonstige Verordnungen keine konkreten kulturellen Aufgaben und Pflichten Landes beinhalten[37]. Lediglich der Allgemeine Zuständigkeitskatalog in Nr. 17 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner Verwaltung nennt die Kultur als „Zuständigkeitsbereich“ der Verwaltung[38]. Anders war die Situation bis 1990 in Ost-Berlin, da es in dessen Verfassung in Art. 13 Abs. 4 hieß: „Die Kunst ist frei. Der Staat fördert das kulturelle Leben sowie die Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln.“[39]
Die im Konsens empfundene Kulturstaatlichkeit ist demnach in Berlin nicht juristisch, sondern vor allem politisch verankert und gesellschaftlich gewollt. Daneben geht aus den Gesetzen anderer Bundesländer auch nicht hervor, wie hoch die aufzubringenden Subventionen zu sein haben und welche Arten von Kultur in welchem Umfang gefördert werden sollen[40]. Eine finanzielle Pflicht zur Kulturförderung kann nach mehrheitlicher rechtsdogmatischer Meinung ebenfalls nicht aus anderen Vorschriften oder Grundrechten, etwa aus der freien Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 GG) oder der Kunstfreiheit (Art. 5 GG) abgeleitet werden. Es besteht nur eine moralische Pflicht[41].
Die Auswirkungen, die die Klage auf Bundeshilfen für den Kulturetat haben werden, können tendenziell aus den Auflagen abgeleitet werden, die seinerzeit Bremen und dem Saarland gestellt wurden. Denn diese Länder waren nicht gezwungen, sämtliche, im juristischen Sinn freiwillige Kulturausgaben zu streichen: Der Kulturhaushalt in Bremen wuchs sogar noch stetig nach dem Empfang der Bundeshilfe, von 1995 bis 2002 um 31 %[42]. Das ist weniger auf die Verankerung der Kulturförderung in der Landesverfassung, sondern eher auf die Sichtweise der Kultur als Zukunftsfaktor der Stadt innerhalb des Strukturwandels zurückzuführen. Bremen hat sich mit diesem Hintergrund auch als Kulturhauptstadt 2010 beworben. Dafür gab es zusätzliche Mittel, die der Kultur zu Gute gekommen sind. Vielleicht war auch die Lobby stärker, da Bremen traditionellerweise „Kultur“ unter den Landesausgaben aufführt und diese Aufgabe einem Mitglied des Senats – auch in der Ressortbezeichnung – zuordnet[43]. Das Saarland verzeichnete einen Anstieg der Kulturausgaben zwischen 1995 und 2001 um 15 %, jedoch erfolgte in 2002 eine Kürzung um 11 %[44]. Das Ausgabevolumen in Relation zum Schnitt aller Länder war 2001 im Saarland um 25 % geringer, in Bremen 43 % höher und in Berlin mit 108 % ebenfalls deutlich höher (deutscher Spitzenwert, gefolgt von Sachsen mit 88 %)[45].
Seit Jahren übersteigt in Berlin die Neuverschuldung die Investitionen, 2005 etwa um das Zweifache[46]. Dies verstößt gegen Art. 87 Abs. 2 Ziffer 2 der Berliner Landesverfassung, wonach die Neuverschuldung die Investitionen nur im Fall der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts überschreiten darf[47]. Da eine Veränderung dieser Situation nicht wahrscheinlich ist, kann dies auch als juristisches Argument für die Hilfsbedürftigkeit des Landes gesehen werden[48]. Jedoch ist bereits in ca. 10 Bundesländern die Neuverschuldung höher als die Investitionen[49].
2.1.3 Politische Aspekte
In den Jahren 2001 und 2002 hat sich die finanzielle Situation des Landes erheblich verschlechtert; die Deckungslücke lag bei ca. 7,5 Mrd. € (Folgejahre 4,5 Mrd. €, Tendenz fallend)[50]. Dies war zum einen durch Steuerausfälle bedingt, zum anderen durch die Krise der Berliner Bankgesellschaft[51]. Ohne dieses komplexe Thema hier differenziert betrachten zu können, ist es wohl trotzdem legitim, die Krise der Berliner Bankgesellschaft zumindest als teilweise politisch bedingte Ursache der Haushaltsnotlage anzusehen. Neben einmaligen Kapitalzuführungen (1,75 Mrd. € in 2001) sind auch ab 2005 jährlich 300 Mio. € für Risikoabschirmungen eingeplant[52].
Eine zukünftige finanzielle Erleichterung könnte die vom Land Berlin erwünschte Hauptstadtklausel im Grundgesetz bringen, sofern diese mit finanziellen Entlastungen einhergeht. Dazu müssten noch zusätzliche, derzeit in Landeskompetenz und –regie befindliche Aufgaben dem Bund übertragen werden oder zusätzliche Ausgleichszahlungen an Berlin erfolgen. Dies hängt jedoch zentral von einem Wiederaufleben und Verhandlungserfolg der im ersten Anlauf gescheiterten Föderalismuskommission ab und ist damit zumindest kurzfristig nicht greifbar[53].
2.1.4 Finanzwissenschaftliche Aspekte
Gemessen an Kennzahlen sind die Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts (s. Kap. 2.1.1) für eine einfache Haushaltsnotlage gegeben:
- Die Kreditfinanzierungsquote in 2005 liegt bei 20,7 % (Länderschnitt 8,6 %),
- die Zins-Steuer-Relation beträgt in 2005 21,7 % (Länderschnitt 12,7 %)[54].
Ferner ist der Pro-Kopf-Schuldenstand mit 18.100 € im Vergleich zum Länderdurchschnitt von 7.400 € (beides Schätzungen für 2005)[55] sehr hoch.
Ein Indikator für die extreme Haushaltsnotlage ist die große Deckungslücke von knapp 5 Mrd. € in 2004, die selbst bei hartem Sparkurs und erfolgendem Länderfinanzausgleich nicht auf ein Maß reduziert werden kann, auf dessen Basis Berlin ohne fremde Hilfe die jährliche Neuverschuldung entscheidend reduzieren könnte. Sie wird im Wesentlichen durch Neuverschuldung (in 2004 4.382 Mio. €) und Vermögensaktivierung durch Verkauf von Landeseigentum (580 Mio. €) ausgeglichen. Der verbleibende Betrag, etwa aus sich unterjährig ergebenden Differenzen zu den Planungen, werden als negativer Haushaltsabschluss ins Folgejahr übernommen[56].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Berechnung des Primärdefizits und der Deckungslücke
Quelle: Eigene Darstellung, zu den Daten vgl. Anhang 3
Anhand dieser Tabelle wird deutlich, dass selbst der vom Land anvisierte ausgeglichene Primärsaldo, d. h. die Ausgaben überschreiten nicht die Einnahmen (ohne Zinsen, Neuverschuldung und Vermögensaktivierung), nicht ausreicht, um aus der Schuldenfalle zu gelangen. Dazu müsste ein Primärüberschuss in Höhe der Zinsausgaben und des Fehlbetrags des Vorjahres erwirtschaftet werden. In 2004 wären dies über 3,7 Mrd. €. Der gesamte Konsolidierungsbedarf beträgt in 2004 somit knapp 5 Mrd. € (Höhe der Deckungslücke), der durch Einnahmesteigerung und Ausgabensenkung zusätzlich im Primärbereich erbracht werden müsste. Weil dies sehr unrealistisch ist[57], geht das Land davon aus, dass es ohne fremde Hilfe in Form von Entschuldung nicht auskommt, und leitet u. a. daraus den Anspruch auf Bundeshilfen ab. Selbst bei ausgeglichenem Primärbudget wächst der Schuldenberg exponentiell an, wenn eine Anfangsverschuldung vorhanden ist[58]. Des Weiteren spricht für eine extreme Haushaltsnotlage, dass seit Jahren kein verfassungskonformer Haushalt aufgestellt werden konnte[59].
Obwohl der Konsolidierungskurs greift und die Deckungslücke von 7,7 Mrd. € in 2002 auf 3,3 Mrd. € in 2006 reduziert werden kann, ist dennoch nach Einschätzung des Finanzsenators kein Ausweg aus der Schuldenfalle aus eigener Kraft möglich[60].
2.2 Ursachen, Symptome und aktuelle Situation
2.2.1 Aus Sicht der Senatsverwaltung für Finanzen
Einige triftige Gründe für die kostspielige, großzügige Ausstattung der Stadt im öffentlichen Sektor sind historisch bedingt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt aus dem Wirtschaftsverbund mit dem Umland gelöst und auch finanzwirtschaftlich isoliert[61]. Seit der Nachkriegszeit und während der Stadtteilung wurde der Westen massiv unterstützt. Dies begann schon 1948 mit dem sog. Notopfer Berlin, ab 1950 mit dem Gesetz über Hilfsmaßnahmen zur Förderung der Wirtschaft von Groß-Berlin (West) und ab 1952 mit dem Dritten Überleitungsgesetz (Gesetz über die Stellung des Landes Berlin im Finanzsystem des Bundes), das die Finanzierung sämtlichen Fehlbedarfs West-Berlins - einem Blankoscheck gleichend - pauschal garantierte[62]. Diese Mittel der Bundeshilfe machten regelmäßig die Hälfte des Berliner Haushaltsvolumens aus und sollten auch durch die finanzierten Objekte ein politisches Zeichen für die Stärke des Westens und die Überwindung der mannigfaltigen Kriegsfolgen setzen. Ähnliche Ziele verfolgte auch der Osten der Stadt[63]. Die Bundeshilfe betrug 1991 zusammen mit dem Fonds Deutsche Einheit noch 17,2 Mrd. DM und spülte während ihres gesamten Bestehens eine viertel Billion DM nach Berlin. Diese Unterstützungen wurden in den Folgejahren konsequent sukzessiv abgebaut[64]. Gleiches gilt für die Lohnzulagen (sog. „Zitter-Prämie“) bzw. massiven Steuervergünstigen für die Bevölkerung und Unternehmen West-Berlins, so dass nicht nur öffentliche Haushalte, sondern auch Wirtschaft und Arbeitsmarkt tangiert wurden[65]. Bis 1994 erhielt Berlin noch eine Bundeshilfe gemäß § 16 Abs. 1 des Überleitungsgesetzes. Die daraus fließenden Mittel lagen zwischen 1991 und 1994 bei durchschnittlich 5,5 Mrd. € pro Jahr. Der die Bundeshilfe 1995 ablösende Länderfinanzausgleich machte zwischen 1995 und 2004 im Schnitt per anno „nur“ 2,9 Mrd. € aus[66]. Finanzwissenschaftler Weinzen bezeichnet daher Berlin als das „Sparschwein der deutschen Vereinigung“[67]. Die in kurzer Zeit massiv gesunkenen Unterstützungen an das Land Berlin sind eine der Ursachen für eine sich von 1,8 auf 3,8 Mrd. € mehr als verdoppelnde jährliche Neuverschuldung des Landes zwischen 1991 und 1994[68]. Der von der Politik erwartete langfristige und zunächst tatsächlich eingetretene wirtschaftliche Aufschwung und der Bevölkerungszuwachs im wiedervereinigten Berlin schlugen ab 1995 in negative Wachstumsraten um und öffneten Finanzierungslücken[69]. Die „passive Konsolidierung“ der überdurchschnittlichen Versorgung mit öffentlichen Gütern durch ein Bevölkerungswachstum im Hinterland blieb aus. Es hat sich gegenteilig sogar der Druck zum aktiven Konsolidieren durch sinkende Geburtsraten und Abwanderungen verschärft. 1995 wurden erste Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen[70]. Das BIP Berlins lag 1990 pro Einwohner noch bei 108,7 % des Bundesschnitts; 2002 waren es nur noch 89,2 %. Der Wirtschaftsaufschwung der neuen Bundesländer vollzog sich wesentlich schwächer im wiedervereinigten Berlin, was auch durch steigende Arbeitslosenquoten dokumentiert wird (10,6 % in 1991 und 17,9 % in 2002)[71]. Ferner brachte die Wiedervereinigung erhebliche neue Lasten für Berlin, da das Realvermögen des Ostteils z. T. erheblichen Sanierungsbedarf aufwies und der Personalbestand im öffentlichen Sektor des Ostteils noch wesentlich höher als im Westen war[72]. Zudem bestanden viele Doppelungen zwischen Ost und West, die z. T. bis heute existieren. Die geförderten öffentlichen Güter unterlagen und unterliegen Kostenremanenzen und –rigiditäten (z. B. Tarifverträge), da die überdurchschnittliche Versorgung nur langsam abgebaut werden kann[73] und sich politische Widerstände gegen den Abbau formieren. Der transformatorische Strukturwandel fiel und fällt in Berlin insgesamt viel problematischer als in den übrigen neuen Ländern aus[74].
Ein häufig von Finanzsenator Sarrazin gebrauchter Hinweis lautet, Berlin habe kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem[75]. In der Tat lagen die Einnahmen Berlins in 2002 pro Einwohner um 25 % höher (absolut 3,5 Mrd. €) als im Länderschnitt, die Ausgaben jedoch um 48,5 % höher (absolut 6,8 Mrd. €)[76]. Die Mehrausgaben entfallen zu 4 Mrd. € auf Sachausgaben, zu 1,7 Mrd. € auf Personalaufwendungen und zu einer Mrd. € auf Zinszahlungen. Aus dieser Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird das Ziel abgeleitet, die Ausgaben längerfristig um 3 Mrd. € verringern zu müssen, um die jährliche Neuverschuldung zu reduzieren[77]. Jedoch können die Ausgaben nicht auf das Niveau eines Flächenlandes reduziert werden, da zum einen Stadtstaaten durch ihre Struktur höhere Pro-Kopf-Ausgaben haben und zum anderen die verfassungsgemäßen Aufgaben durch das Land erfüllt werden müssen[78].
Abb. 1: Mehreinnahmen und Mehrausgaben Berlins gegenüber dem Länderdurchschnitt (ab 2004 Soll)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 11
Seit den Jahren 2002 und 2003 sind die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge Berlins in der stark fallenden Kurve der Mehrausgaben sichtbar. Neben allen strukturellen Maßnahmen erfolgten zwischen 1993 und 2003 zusätzlich Vermögensaktivierungen von ca. 12 Mrd. €[79].
Die relativ hohen Einnahmen sind zu einem großen Anteil auf Transferzahlungen zurückzuführen: Länderfinanzausgleich zuzüglich 600 € pro Einwohner wegen des Stadtstaatenstatus, Sonderbedarfs-BEZ zum Abbau teilungsbedingter Sonderbelastungen und Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft, Solidarpakt II ab 2005 und Hauptstadtfinanzierung Sicherheit und Kultur in Höhe von 48,6 Mio. €[80]. Der Steueranteil an den Gesamteinnahmen beträgt 2005 (Soll) nur 40 %[81], der vom schwachen Wirtschaftswachstum bzw. der Rezession belastet wird[82]: 2003 lag der BIP-Index Berlins um 1,9 % unter dem von 1991; die Differenz zum Bundesschnitt betrug in 2003 18 Prozentpunkte[83]. Infolgedessen und flankiert von Steuerreformen und vergrößerten Abschreibungsmöglichkeiten lagen seit 1992 alle mittelfristigen Finanzplanungen Berlins hinsichtlich der Steuereinnahmen z. T. drastisch zu hoch. Die tatsächlichen Einnahmen stagnieren seit 1993 zwischen nominal 7,5 und 8,5 Mrd. €[84]. Insofern ist die Aussage des Finanzsenators, Berlin habe kein Einnahmeproblem, zu relativieren. Ferner sind infolge der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung die Sozialausgaben erheblich angestiegen. Der rein bezirkliche Anteil wuchs zwischen 1997 und 2001 um 10 %[85]. Es muss jedoch anerkannt werden, dass auch andere Bundesländer ähnliche Probleme zu bekämpfen hatten und diese sich dazu teilweise herber struktureller Maßnahmen bedient haben.
In der folgenden Grafik sieht man die sich öffnende „Schuldenfalle“ (leicht schraffierte Fläche) als vertikale Differenz zwischen den Balken und der unteren Linie:
Abb. 2: Primär- und Finanzierungssalden 1991-2009
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(d), S. 1
Das Finanzierungsdefizit (= bereinigte Einnahmen – bereinigte Ausgaben) kann trotz der Konsolidierungserfolge in Form des seit 2001 sinkenden Primärdefizits nicht ausreichend gesenkt werden[86]. Auch wenn die Balken des Primärsaldos in den positiven Bereich gehen, wird wegen der immer noch steigenden Zinslast ein Finanzierungsdefizit von gut 2 Mrd. € ab 2007 verbleiben[87], was Neuverschuldungen unumgänglich macht, wenn nicht andere Finanzierungsformen gefunden werden. Im Jahr 2005 plant die Senatsverwaltung ein Finanzierungsdefizit von 3,9 Mrd. €, was einer Defizitquote, d. h. nicht durch Einnahmen abgedeckte Ausgaben, von 18,9 % entspricht[88].
Die absoluten Spitzenwerte der Neuverschuldung lagen in 2001 bei 4,9 und in 2002 bei 6,0 Mrd. €[89], maßgeblich verursacht durch eingebrochene Primäreinnahmen und eine einmalige Kapitalzuführung an die Bankgesellschaft Berlin in 2001[90]. Die Schulden des Landes bestehen zum größten Teil aus Kreditmarktschulden, zu geringen Teilen aus Schulden gegenüber öffentlichen Verwaltungen und Kassenkrediten[91]. Durch stetige Neuverschuldungen wuchs der summierte Schuldenstand um 545 % von 11 Mrd. € in 1991 auf ca. 60 Mrd. € in 2005[92] und könnte sich auf geschätzte 105 Mrd. € in 2019 ausweiten[93]. Nahezu proportional dazu stiegen die jährlichen Zinsausgaben des Landes von 0,5 Mrd. € in 1991 auf 2,6 Mrd. € in 2005[94]. Proteste des Landes Berlin gegenüber dem Bundesfinanzministerium hinsichtlich der stark schrumpfenden Bundeshilfe in den frühen 90er Jahren wurden damit beantwortet, das Land könne sich höher verschulden[95]. Diesen Rat befolgte es. Bis 2007 wird sich der Schuldenstand trotz der eingeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen voraussichtlich mehr als versiebenfacht haben[96], mit nach wie vor steigender Tendenz.
Dabei kommen dem Land die derzeit für Kreditnehmer günstigen Kapitalmarktkonditionen, durchschnittlich gut 4 % Zinsen für Berlins Verbindlichkeiten[97], zu Gute. Ein Anstieg des Zinssatzes um einen Prozentpunkt würde bis zum Jahr 2007 ceteris paribus eine jährliche Mehrbelastung von 600 Mio. € durch Zinszahlungen bedeuten[98]. In diesem Umstand liegt auch eine weitere Unwägbarkeit der Planung, da die Senatsverwaltung auch in den kommenden Jahren von konstant niedrigen Kapitalmarktzinsen ausgeht[99].
Der Senat hat am 5. November 2002 die Feststellung der extremen Haushaltsnotlage beschlossen und entschieden, dass das Land Berlin die verfassungsrechtlich verankerten Ansprüche auf Sanierungshilfe geltend machen will, unter Berücksichtigung der zu erbringenden Eigenbeiträge[100]. Dazu hat der Senat, vertreten durch Prof. Wieland, einen Normenkontrollantrag gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BverfGG und §§ 76ff. BverfGG beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und dabei den von außen zu leistenden Sanierungsbeitrag auf 35 Mrd. € beziffert. Die anderen Bundesländer haben sich ablehnend dazu geäußert, mit Ausnahme von Zustimmungen der Länder Bremen und Saarland und einer neutralen Position Brandenburgs. Voraussichtlich noch im Jahr 2005 wird die mündliche Verhandlung stattfinden. Das Urteil wird in 2006 erwartet[101].
2.2.2 Aus Sicht der Gutachter Färber und Wieland
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat zwei unabhängige Experten damit beauftragt, je ein Gutachten zur Haushaltssituation des Landes Berlin zu verfassen[102]. Es handelt sich dabei um Prof. Dr. Joachim Wieland, LL.M., Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht der Universität Frankfurt am Main und Frau Prof. Dr. Gisela Färber, die an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer die Fachgebiete wirtschaftliche Staatswissenschaften, Finanzwissenschaften u. a. lehrt. Diese Gutachten dienen auch als Argumentationsgrundlage des Landes gegenüber dem Bund und dem Bundesverfassungsgericht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die formalen Voraussetzungen einer extremen Haushaltsnotlage in Berlin eindeutig erfüllt sind und beurteilen sie sogar als akut[103]. Begründet wird dies mit Argumenten und Statistiken, die z. T. in den vorangegangenen Kapiteln bereits dargelegt wurden.
Außerdem führt Färber an, dass der Grenzwert des zusätzlichen Indikators Haushaltsnettobeitrag in Berlin mit 24,8 % zwischen 1998 und 2002 so hoch ist, dass fast ein Viertel der öffentlichen Ausgaben von dem Schuldendienst absorbiert würde, setzte man die Verschuldung weiter fort, was letztlich die Erfüllung der verfassungsgemäßen Ausgaben unmöglich machte[104]. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wird die Einschätzung des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen genannt, wonach es bei einem Primärdefizit und einem gleichzeitigen Marktzins auf die bestehenden Schulden oberhalb der Wirtschaftswachstumsrate zu einem „explodierenden Staatsschuldenwachstum“ komme, was im Falle Berlins gegeben sei und damit auch als Indikator einer extremen Haushaltsnotlage herangezogen werden könne[105]. In langfristigen Hochrechnungen bis 2030 zeigt Färber anhand von Berechnungen unterschiedlicher Kennzahlen und Szenarien auf, dass es zu dem harten Sanierungsprozess keine Alternativen gibt, wenn das Land handlungsfähig bleiben will[106]. Durch Veränderungen in den komplizierten vertikalen und horizontalen Verrechnungsmechanismen des Länderfinanzausgleichs und der Steuermittel zwischen Länder und Bund bei Kindergeld, Eigenheimzulage und Investitionszulagen muss Berlin auch Einnahmeausfälle in jährlich dreistelliger Millionenhöhe durch die spezifische demographische Struktur hinnehmen[107].
Wieland urteilt, dass dem Land nur die „Wahl zwischen einem explosiv ansteigenden Schuldenstand oder einem weitgehenden Verzicht auf die Erfüllung freiwilliger und gesetzlicher Aufgaben“ übrig bleibt[108]. Die Haushaltsnotlage, insbesondere das Primärdefizit, sei vor allem strukturell bedingt, so dass Berlin nur eine geringe Verantwortung dieser Situation zugesprochen werden könne. Die Indikatoren des Bundesverfassungsgerichts seien zwar im Prozess von Bremen und dem Saarland willkürlich ohne theoretisches Fundament gewählt, jedoch allgemein gültig und damit auch für Berlin anwendbar[109].
2.2.3 Aus Sicht des Bundes
„Es gibt nur eine Gebietskörperschaft, der es noch schlechter geht,
als dem Bund selbst: nämlich Bremen.“[110]
Hans Eichel, Bundesfinanzminister
Angesichts der hohen jährlichen Neuverschuldungen des Bundes und des wiederholten Verfehlens des Maastricht-Kriteriums ist es sehr verständlich, dass der Bund ein geringes Interesse daran hat, Berlin finanziell zu unterstützen. Daher versucht der Bund derzeit, eine argumentative Front gegenüber Berlin aufzubauen, um seine grundsätzliche Negation der Haushaltsnotlage Berlins zu stützen. Ein Hauptaspekt besteht darin, dass die formalen Kriterien zur Feststellung einer Haushaltsnotlage nicht mehr gültig seien, da seit den letzten Urteilen von 1992 bezüglich der Länder Bremen und Saarland ein Paradigmenwechsel in den öffentlichen Finanzen und in den föderalen Strukturen stattgefunden habe, z. B. durch den neuen Länderfinanzausgleich 2005 bis 2019 und die deutsche Wiedervereinigung, die 1992 noch nicht hinreichend bzw. teilweise gar nicht in den Datengrundlagen enthalten war. Ferner müsse sich Berlin auch mit Kommunen vergleichen lassen, denn aus dieser Perspektive gehe es Berlin noch relativ gut. Zurückhaltung seitens des Bundes gibt es auch, weil die Gefahr besteht, dass andere Bundesländer, sofern sie beteiligt würden, durch die umfangreichen Hilfen selbst in eine Notlage geraten könnten[111]. Die Frage des Verschuldens der Notlage (vgl. Kap. 2.1.2) wird zu Lasten Berlins beantwortet. Die Argumente sind ähnlich, doch die Bewertung der Eigenschuld Berlins erfolgt in größerem Ausmaß, überwiegend hinsichtlich des Nichthandelns nach Auslaufen der Bundesförderung Mitte der 90er Jahre. Das Problem der Behandlung Berlins als Hauptstadt, insbesondere der Bereiche innere Sicherheit und Kultur, wird als unabhängig von der Verfassungsklage, jedoch auch als regelungsbedürftig, durchaus in Richtung einer Entlastung Berlins gesehen[112]. Nach den am 5. März 2003 ohne Konsens abgeschlossenen Gesprächen zwischen Berlin und dem Bund fasst Bundesfinanzminister Eichel die ablehnende Position des Bundes hinsichtlich des Zustands der extremen Haushaltsnotlage in einem Schreiben zusammen, in dem er hauptsächlich auf die durch Berlin selbst zu verantwortenden hohen konsumtiven Ausgaben und den daraus resultierenden verpflichtenden restriktiven Konsolidierungskurs gemäß § 12 Abs. 4 Maßstäbegesetz und gemäß europäischen Vorschriften hinweist. Ferner sei das Ziel des Erreichens eines Primärüberschusses nicht ausreichend, vielmehr müsse ein verfassungsgemäßer Haushalt, der auch die Zinslasten tragen kann, anvisiert werden[113].
2.2.4 Aus Sicht externer Autoren und Wissenschaftler
Nach Ansicht Volker Krönings, Bremens Finanzsenator a. D., sollte Berlin die konsumtiven Ausgaben noch stärker absenken, aber gleichzeitig die Investitionen erhöhen. Dies sei eine weitsichtigere und die lange Frist berücksichtigende Politik[114]. Gegen diese Meinung sprechen Statistiken, nach denen in Berlin die direkten Wirkungen und indirekten Spillover-Effekte und damit die Rentabilität von öffentlichen Investitionen auf die gesamte Berliner Wirtschaft relativ niedrig sind. Außerdem ist mit Nachfragesteigerungen und Umwegrentabilitäten aus der Verwendung von Finanzhilfen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht nur schwer zu argumentieren, weil dies andere Länder genauso tun könnten bzw. nichts dafür spricht, warum dies besonders in Berlin makroökonomisch von Vorteil sein sollte[115].
Prof. Peffekoven, Lehrstuhlinhaber für Finanzwissenschaft an der Universität Mainz und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums, erkennt zwar die Konsolidierungsbemühungen im neuesten Doppelhaushalt an, urteilt jedoch gleichermaßen, dass Berlins Eigenanstrengungen noch nicht weit genug gingen. Der Abbau des Primärdefizits könne lediglich ein Zwischenziel sein. Da der Senat die beiden Steuererhöhungsmöglichkeiten bei der Grund- und Gewerbesteuer ablehne, kämen nur weitere schmerzhafte Ausgabenkürzungen in Betracht[116].
2.2.5 Im Vergleich mit anderen Bundesländern
Einige Strukturdaten seien im tabellarischen Vergleich dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Strukturdaten einiger Länder im Vergleich
Quelle: Eigene Darstellung, zu den Daten vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 12 u. 20
Besonders auffallend ist die wirtschaftliche und soziodemographische Schwäche Berlins. Im Falle Bremens kann abgelesen werden, dass die Haushaltssanierung trotz des sukzessiven Erhalts von finanziellen Hilfen faktisch gescheitert ist, zu den Ursachen s. u.
Die beiden zentralen Indikatoren des Bundesverfassungsgerichts für die Feststellung einer Haushaltsnotlage seien im Folgenden im Ländervergleich dargestellt. Von Interesse ist auch das Jahr 1992, weil hier Saarland und Bremen durch das Bundesverfassungsgericht zu Haushaltsnotlageländern erklärt worden sind[117].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Kreditfinanzierungsquoten ausgewählter Länder (einschl. Gemeinden)
Quelle: Färber, 2003, S. 10
Der Graphik kann entnommen werden, dass die Kreditfinanzierungsquote seit 2001 deutlich höher ist als der zweifache Länderdurchschnitt. Dies ist auch in 2005 noch der Fall (20,7 % in Berlin zum Länderschnitt 8,6 %), vgl. Kap. 2.1.4.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Zins-Steuer-Quoten ausgewählter Länder (einschl. Gemeinden)
Quelle: Färber, 2003, S. 13
Die Zins-Steuer-Quote lag in 2001 ca. 7 Prozentpunkte über dem Länderschnitt, mit steigender Tendenz: Sie umfasst nahezu das doppelte Ausmaß des Länderschnitts in 2003 und gegenwärtig 21,7 % (Länderschnitt 12,7 %)[118]. Dies reicht wohl aus, um das Kriterium des Bundesverfassungsgerichts, „weit“ über dem Länderschnitt zu liegen, zu erfüllen. Dass Bremen noch höhere Werte hat, entschärft und relativiert die Dramatik der Berliner Situation nur geringfügig. Bremen erhielt seit 1993 ca. 8,5 Mrd. € Bundeshilfen in jährlichen Raten zur Beseitigung der Haushaltsnotlage (Saarland: 6,6 Mrd. €[119] ). Diese Gelder wurden nur teilweise zur Schuldentilgung, ansonsten für ein Investitionssonderprogramm, u. a. für den Hochschulbereich und die Infrastruktur, verwendet. Die Rentabilität dieser Investitionen und die zukünftigen Steuereinnahmen wurden überschätzt, so dass Bremen heute insgesamt noch stärker verschuldet ist als zum Zeitpunkt der Klage und sich nach wie vor jährlich immens, ca. mit einer Mrd. €, neu verschulden muss[120]. Das erklärt die sehr hohe Zins-Steuer-Quote.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Personal- und Sachausgaben ausgewählter Länder einschl. Gemeinden pro Einwohner
Quelle: Färber, 2003, S. 65
Beim Ausgabenvergleich zeigt sich der wenig überraschende Befund, dass die Berliner Sach- und Personalausgaben deutlich über dem Länderschnitt liegen und den bundesweiten Spitzenwert bilden. Jedoch ebenso deutlich sind die Konsolidierungsbemühungen und die Trendwende ab 2002 zu sehen. Bei den öffentlichen Investitionen hat Berlin Quoten, die unter dem Länderschnitt liegen, bei den Sachinvestitionen sogar 75 % unter Landesschnitt[121]. Trotzdem wird bei den Investitionen weiter gespart[122], obschon daraus mittel- bis langfristige Probleme entstehen können.
2.3 Finanzplanungen für die Zukunft
2.3.1 Senatsverwaltung für Finanzen
Der von der Senatsverwaltung für Finanzen erstellte Entwurf des Doppelhaushalts 2006 / 2007 und die Eckwerte bis 2009 wurden am 14. Juni 2005 vom Senat beschlossen und sollen am 17. August 2005 in das Abgeordnetenhaus eingebracht werden, um bis Ende November beraten zu werden[123]. Eine strenge Ausgabendisziplin bleibt wegen der Zinszahlungen von knapp 3 Mrd. € nach wie vor erforderlich, auch wenn der Konsolidierungskurs wirkt und ein erstmaliger Primärüberschuss in 2007 greifbar wird[124]. Ursprünglich sollte dieses wichtige Ziel nach Planungen des Jahres 2002 bereits in 2006 erreicht werden[125]. Deckungslücke, Finanzierungsdefizit und Neuverschuldung sollen von gegenwärtig jeweils ca. 4 Mrd. € mittelfristig auf gut 2 Mrd. € gesenkt werden. Die Planung geht von einer relativ positiven Entwicklung der Einnahmeseite durch ein größeres Steueraufkommen aus, bei gleichzeitig nahezu konstantem Ausgabeniveau ab 2006. In obig erwähntem Beschluss wurden im Einzelplan 17 der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Ausgaben im Vergleich zur früheren mittelfristigen Planung gegen den Trend sogar geringfügig erhöht, was insbesondere der Kultur zu Gute kommen soll[126]. Einen Alternativplan für den Fall des negativen Prozessausgangs gibt es nicht, zumindest nicht offiziell. Es darf ihn auch nicht geben, weil sonst die Haushaltsnotlage nicht glaubwürdig erscheinen würde[127].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Eckwerte zum Doppelhaushalt 2006 / 2007 und zum Finanzplanungszeitraum 2005 bis 2009
Quelle: Anhang 3
Der Personalaufwand soll erneut um ca. eine halbe Milliarde € reduziert werden. Dabei wurde der Personalbestand im unmittelbaren Landesdienst bereits von 207.151 Stellen in 1991 auf 130.657 in 2005 reduziert (entspricht 37 %)[128]. In 2001 hatte Berlin noch eine relative Mehrausstattung im öffentlichen Dienst von 36 % gegenüber dem Länderdurchschnitt, bei den Beamten sogar 51 %[129]. Um den Personalaufwand bis 2007 weitgehend stabil zu halten, sind allein Maßnahmen zwischen 2002 und 2007 im Volumen von einer Mrd. € notwendig, zumeist in Form von striktem Personalabbau und Änderungen im Tarif- und Besoldungsrecht[130]. Die Senatsverwaltung für Finanzen geht davon aus, dass noch ca. 25.000 Stellen im öffentlichen Dienst bis 2012 abgebaut werden müssen, um im Durchschnitt der Stadtstaaten zu liegen[131].
Die bei positivem Prozessausgang in einem Sanierungsplan verbindlich festzuhaltenden Eigenanstrengungen sollen sich in drei Maßnahmensträngen niederschlagen, die jährlich im Volumen zunehmen und langfristig, d. h. ab 2008, zusammen 2,5 Mrd. € Ausgabenreduktion gegenüber 2003 herbeiführen sollen[132]:
- Strukturelle Konsolidierungsentscheidungen mit langfristiger Perspektive (1,28 Mrd. €),
- Minderausgaben durch Tarifvertrag / Besoldung (0,25 Mrd. €),
- Absenkung der Wohnungsbauförderung (1,00 Mrd. €).
Im Durchschnitt muss jede einzelne Senatsverwaltung zwischen 2003 und 2007 6,6 % an Ausgaben einsparen[133]. Der Einzelplan Wissenschaft / Forschung / Kultur soll nach Senatsbeschluss vom 30. 9. 2003 eine Absenkung der Gesamtausgaben (Personalausgaben, konsumtive Sachausgaben und Investitionen) um 6,1 % bzw. 141 Mio. € von 2,302 Mrd. € in 2003 auf 2,161 Mrd. € ab 2007 erbringen[134]. Dieses Ressort zählt mit der Stadtentwicklung (Einsparungs-Soll im gleichen Zeitraum 17,5 %[135] ), dem Inneren (minus 6,1 %[136] ) und mit Bildung / Jugend / Sport (konstantes Ausgabenniveau[137] ) zu den größten Budgets der Hauptverwaltung[138]. Auffällig ist, dass in der Senatsvorlage von Finanzsenator Sarrazin vom 3. 2. 2003 von etlichen Senatsverwaltungen härtere Sparmaßnahmen gefordert wurden, etwa von Wissenschaft / Forschung / Kultur 25 %[139], was sich aber nicht durchsetzen konnte, vgl. die tatsächlichen Beschlüsse (6,6 % s. o.). Im Allgemeinen hat die Hauptverwaltung den umfangreicheren relativen und absoluten Teil der Konsolidierungsmaßnahmen zu tragen[140]. Von den großen Sachgebieten ist damit die Wissenschaft / Forschung / Kultur leicht unterdurchschnittlich hart betroffen. Am deutlichsten wird der Einzelplan Wirtschaft / Arbeit / Frauen mit 21,7 % Sparvolumen berührt[141]. Da generell wesentlich stärker an konsumtiven Sachausgaben als am Personalaufwand gespart wird (s. o.), werden die Einzelpläne mit einem hohen Anteil von Sachausgaben auch stärker von Einschnitten tangiert. Zum Vergleich: Wissenschaft / Forschung / Kultur hat Ausgabenanteile von 85 % konsumtiven Sachausgaben, 3 % Personalausgaben und 12 % Investitionen[142]. Das liegt daran, dass Zuschüsse zu kulturellen Einrichtungen oder Universitäten pauschal als Konsumtion gebucht und nicht nach Personalaufwand differenziert werden[143], auch wenn große Anteile der Zuschüsse in das Personal der geförderten Institutionen fließen. Politisch hat dies für die Landesregierung den Vorteil, dass sie einfach Zuschüsse kürzen kann und die inhaltliche Umsetzung auf die Mittelempfänger abwälzen kann. Die dort Bediensteten sind im Regelfall nicht unmittelbare Landesangestellte, so dass auch politisch brisante Personalentlassungen nicht vom Land getätigt werden müssen. Sicherlich ist aber auch der Vorteil nicht zu verkennen, dass bei dieser dezentralen Entscheidung über die Umsetzung der Kürzungen die jeweilige Institution besser weiß und entscheiden kann, wo und wie Geld gespart werden kann.
Trotz aller Maßnahmen und der Erzielung eines Primärüberschusses kalkuliert die Senatsverwaltung mit einem wachsenden Schuldenstand von 60 Mrd. € in 2005 auf 70 Mrd. € in 2009[144]. Wären in den Planungen des Senats für die Jahre 2004 bis 2007 keine Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen, würde der Schuldenstand im Jahr 2007 voraussichtlich nicht ca. 65 Mrd. €, sondern bereits 70,5 Mrd. € betragen[145]. Auch hier wird deutlich, wie groß der Sachzwang zum Konsolidierungskurs ist.
Als zusätzlich belastend kann sich der Umstand erweisen, dass die Planungen der Senatsverwaltung gemäß den Projektionen der Bundesregierung eine Erholung des Wirtschaftswachstums implizieren[146]. Wenn diese jedoch ausbleibt und es zu den prognostizierten Mindereinnahmen der öffentlichen Haushalte von über 66,8 Mrd. € bis 2008 kommt, davon allein bei den Ländern 28 Mrd. €[147], ist auch für Berlin mit weiteren Einbrüchen auf der Einnahmeseite zu rechnen, direkt bedingt durch Steuerausfälle und indirekt bedingt durch niedrigere Ländertransfers. Im Vergleich zur ursprünglichen mittelfristigen Planung mussten in den aktualisierten Eckwerten für 2006 bereits geringere Einnahmen von 850 Mio. € und 890 Mio. € in 2007 angesetzt werden[148].
2.3.2 Der Berliner Kulturetat
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Entwicklung des Berliner Kulturetats[149]
Quelle: Eigene Darstellung, zu den Daten vgl. Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 2005(b) u. vgl. Anhang 4 u. vgl. DIW, 2002, S. 24
Die relative Höhe des Kulturhaushalts zu den bereinigten Gesamtausgaben des Landes beträgt 1,82 % in 2005, was exakt dem bundesweiten Schnitt aller Länder (1,79 % in 2001) entspricht[150]: Der Kulturhaushalt nimmt innerhalb Berlins keinen übergewichtigen Raum ein. Jedoch pro Einwohner betrachtet lag das Ausgabenniveau in 2000 noch bei knapp 200 % des Länderdurchschnitts (185 € pro Kopf in 2001)[151], wie auch in den anderen Aufgabengebieten soziale Sicherung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hochschulen und Wohnungswesen[152]. In Relation zu anderen Großstädten liegen die Kulturausgaben Berlins aber nicht an der Spitze (Berlin 169 €, München 275 €, Stuttgart 285, Frankfurt a. M. 303 € jährliche Zuschüsse von Kommune, Land und Bund pro Einwohner in 2000)[153]. Zwischen 1995 und 2001 sind bundesweit die Kulturausgaben um 12,3 %, in einigen Flächenstaaten sogar um über 20 % gewachsen[154] ; in Berlin sind sie jedoch im gleichen Zeitraum um ca. 9 % bzw. zwischen 1997 und 2003 um 12,8 % oder 75 Mio. € gesunken[155]. Dies ist jedoch nur ein nominaler Wert, da die Kulturbetriebe auch Kostensteigerungen bei den Personal-, Sach- und Investitionskosten unterliegen. Wenn man eine moderate Kostensteigerung von 1,5 % per anno unterstellt[156], ergibt sich, dass die durch den Kulturhaushalt finanzierbaren Aufgaben real zwischen 1997 und 2003 um 22,1 % gesunken sind. Das entspricht, gemessen an durchschnittlichen Zuschüssen, der Schließung von allen drei Opernhäusern oder von 15 Orchestern. Verteilt auf die einzelnen Sparten erfolgten zwischen 1994 und 2000 nominale Zuschussreduzierungen bei den Theatern um 12 %, bei den Orchestern und Chören um knapp 25 % und bei den Museen, Sammlungen und Ausstellungen um 7 %. Zu den Folgen gehören ein Bauunterhaltungs- und Investitionsstau, die Einschränkung der künstlerischen Etats und der Wegfall vor allem von disponiblen Mitteln für freie Projekte[157]. Strukturelle Entscheidungen bestanden in der Schließung des Schiller-Theaters 1993, des Metropol-Theaters 1997 und der Zuwendungsstreichung für die Berliner Symphoniker e. V. 2004, was in den ersten beiden Fällen zweistellige Millionbeträge freisetzte und den Sparzwang an anderen Stellen gedämpft hat[158].
Veränderungen zu Gunsten der Berliner Kultur ergaben sich dadurch, dass sich vermehrt der Bund in Berlin engagierte, mit nach wie vor steigender Tendenz[159]. Im ersten Hauptstadtvertrag wurden neben anderen Förderbereichen für die Kultur von 1996 bis 1999 jährlich 31 Mio. € Bundesunterstützungen gewährt, die jedoch nicht zur Gänze real geflossen sind[160]. Dieser Betrag wurde 1999 auf 62 Mio. € aufgestockt, der als zweckungebundene Zuweisung in den Landeshaushalt floss[161]. Die erste explizite Hauptstadtkulturförderung bestand in dem „Vertrag zur Kulturfinanzierung in der Bundeshauptstadt 2001-2004“. Der zweite Hauptstadtkulturvertrag wurde am 9. 12. 2003 beschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. € werden durch ihn das Jüdische Museum, das Haus der Kulturen der Welt, der Gropius-Bau, die Berliner Festspiele, Bauinvestitionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (u. a. Restaurationen an der Museumsinsel), die Akademie der Künste, der Hamburger Bahnhof, die Stiftung Deutsche Kinemathek und die Freunde der Deutschen Kinemathek ganz oder anteilig finanziert. Durch Inkrafttreten des zweiten Hauptstadtkulturvertrages wurde der Berliner Kulturetat um 22 Mio. € entlastet, damit die von Kulturstaatsministerin Weiss befürwortete Opernreform finanziert werden könnte[162]. Der Hauptstadtkulturfonds wurde 2001 im Rahmen des Hauptstadtkulturvertrages eingerichtet und vergibt jährlich 10 Mio. € Bundesmittel an Einzelmaßnahmen und bedeutende Veranstaltungen von hoher Ausstrahlung und Innovativität[163]. Vom Bund erhalten ferner nach verworfener Normenkontrollklage der Länder, die ihre Kulturhoheit verletzt sahen[164], die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 75 % ihres umfangreichen Etats, die Staatskapelle einen Zuschuss von 1,8 Mio. € jährlich sowie die Rundfunk-, Orchester- und Chöre-GmbH (ROC-GmbH) 10 Mio. €, vgl. auch unten. Das Gesamtvolumen des kulturellen Engagements des Bundes an Berliner Institutionen beträgt damit 428 Mio. € per anno[165] und liegt damit inzwischen höher als der Kulturetat des Landes. Kulturpolitisch undurchsichtig ist jedoch, weshalb bestimmte Institutionen von herausragender, bundesweiter Bedeutung vom Bund gefördert werden und andere nicht, wie etwa die Staatsoper (mit Ausnahme der Orchesterzulage) oder die Berliner Philharmoniker[166].
Die größte strukturelle Veränderung auf Seite der vom Land getragenen Kulturbetriebe war die Errichtung der „Stiftung Oper in Berlin“ in 2004, in der nun alle drei Opernhäuser gemeinsam geführt und mittels eines Globalzuschusses (114 Mio. € in 2005) finanziert werden, der innerhalb der Stiftung verteilt werden muss. Es sind bis 2009 kumulierte Zuschussabsenkungen von 17 Mio. € geplant, die vor allem durch Einsparungen im Personalbereich und durch Einnahmeerhöhungen erbracht werden sollen. Im Ballett wurden bereits 40 Stellen gestrichen. Die Werkstätten werden derzeit zu einer Bühnenservice GmbH ausgegliedert, was weitere 80 Stellen einsparen soll. In der Staatsoper herrscht bereits eine außerordentlich restriktive Ausgabenpolitik mit Genehmigungspflicht für sämtliche Sachaufwendungen[167].
Gegliedert nach Empfängergruppen sieht der Kulturetat Berlins von 2005 in der neuen Buchungsform folgendermaßen aus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Aufteilung des Berliner Kulturetats 2005
Quelle: Eigene Darstellung und Aggregation, zu den Daten vgl. Anhang 4
Der Etat ließe sich wiederum in vier übergeordnete Förderungsbereiche aggregieren: Opern und Orchester absorbieren 39 % der Mittel, Sprechtheater und sonstige Bühnen 25 %, Museen 15 % und Sonstiges 21 %. Damit machen die personalkostenintensiven Bühnen- und Aufführungskünste mehr als zwei Drittel der aufgewendeten Steuergelder aus[168].
Die Planungen bis 2007 im Rahmen der Eigenanstrengungen zur Haushaltskonsolidierung, deren Eckwerte vom Senat am 1. Juli 2003 beschlossen worden sind[169], zeigen folgendes Bild auf[170]: Das Gesamtvolumen reduziert sich von 2003 bis 2007 um nominal 3,8 %. Der am härtesten betroffene Einzeltitel lautet „Orchester und Chöre“, worunter die durch den bereits jetzt gestrichenen Zuschuss insolventen Berliner Symphoniker e. V. und die ROC-GmbH fallen, unter der die Ensembles Deutsches Symphonie-Orchester (DSO), Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB), Rundfunkchor Berlin und der RIAS Kammerchor vereinigt sind. Ihr Zuschuss wird laut Plan von 9 Mio. € auf 0,8 Mio. € quasi komplett gestrichen. Weitere Gesellschafter der ROC-GmbH sind neben dem Land Berlin das Deutschland-Radio Berlin, die Bundesrepublik Deutschland und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)[171]. Sie müssten den Wegfall von über 5 Mio. € ggf. kompensieren, was sehr wünschenswert wäre, da es sich größtenteils um Spitzenensembles handelt[172]. Doch vom totalen Ausstieg hat das Land zwischenzeitlich Abstand genommen und auf unbestimmte Zeit vertagt[173]. Scheinbarer „Gewinner“ in der mittelfristigen Finanzplanung von 2003 ist die Stiftung Berliner Philharmoniker mit einer Steigerung von 2 Mio. €, die davon jedoch andere entfallende öffentliche Mittel kompensieren muss. Außerdem wurde die Planung durch die Senatsverwaltung für Finanzen zwischenzeitlich nach unten korrigiert.
2.3.3 Auswirkungen des Klageerfolgs bzw. -misserfolgs auf das Land Berlin
Vorrangiges Ziel ist es, dass die eigenen Sanierungsanstrengungen verstärkt greifen können und nicht durch Zinszahlungen absorbiert werden[174]. Der Haushaltsausgleich (nach Zinsen) könnte gemäß einem positiven Szenario von Färber im Jahr 2017 erreicht werden[175]. Der kumulierte Schuldenstand würde in diesem Fall 2030 ca. 104 Mrd. € betragen[176].
Als Sanierungshilfe kommen drei grundsätzliche Instrumente in Frage, die sich in der konkreten Ausgestaltung und den zeitdeterminierten Zinswirkungen unterscheiden[177]:
- Kontinuierliche Schuldendiensthilfen durch BEZ zur Senkung der Zins-Steuer-Quote auf die Höhe des nächsten finanzschwachen Landes binnen 5 Jahren,
- Tilgungshilfen in ggf. veränderlichen Raten oder
- sofortige Schuldenübernahmen von Schuldenbeständen durch den Bund und ggf. einige Ländern infolge der Beistandspflicht.
Am effektivsten wegen der sofortigen Wirkung sind die Schuldenübernahmen, z. B. durch einen Fonds, wie bei der Treuhandanstalt und der Deutschen Bahn geschehen. Dies würde auch die Erfahrungen Bremens und des Saarlands berücksichtigen und Fehlerwiederholungen vermeiden[178]. Die konkrete Höhe der Bundesleistung sollte so bemessen werden, dass das Land seine verfassungsrechtlichen Pflichten erfüllen kann und sich die Zins-Steuer-Quote auf einem Niveau stabilisiert, das mit dem Maastricht-Vertrag konform ist. Eine obere Grenze für die Hilfen ist grundsätzlich dann erreicht, wenn der Bund oder andere Länder selbst in eine Notlage geraten würden[179]. Eine relative, wenn auch mit Problemen behaftete Orientierung bietet sich mit dem nächst finanziell schwächeren Land ohne Notlage an. Erforderlich ist in jedem Fall die Definition von „ausreichend“ hohen Primärausgaben. Dies kann an den Indikatoren Primärausgabendeckungsquote (= Primärausgaben zu Primäreinnahmen) und Primärausgaben je Einwohner in Relation zum Länderdurchschnitt festgemacht werden. Färber quantifiziert die erforderliche Größenordnung zur Befreiung aus der Krise auf mindestens 35 Mrd. € [180]. Dies entspricht der proportionalen Hochrechnung der Zahlungen an Bremen anhand der Bevölkerung und auch dem Unterstützungsbetrag, den sich die Senatsverwaltung für Finanzen und das Land Berlin maximal als Prozessergebnis erhoffen[181].
Es ist jedoch auch denkbar, dass das Bundesverfassungsgericht ein Kompromissurteil fällt, sowohl was die Höhe als auch die Art der Beihilfen angeht, da die vergangenen Klagen 13 Jahre zurückliegen und Berlin als Bundeshauptstadt ein Sonderfall ist. In Betracht käme z. B. anstelle einer Entschuldung eine neue, erweiterte Definition der Bundesaufgaben in Berlin mit Entwürfen von Veränderungen der Finanzierungsstruktur[182], was tendenziell auch den Kulturbereich stark betreffen könnte. Dieser Einschätzung widerspricht jedoch Gutachter Wieland[183]. Bisher beträgt die Beteiligung des Bundes an den Hauptstadtaufgaben gemäß erstem Hauptstadtvertrag nur 0,35 % der gesamten Berliner Ausgaben (ehemals Bonn: 10 %), was nur 0,03 % des Bundeshaushaltes entspricht. Gegenüber Bonn war der Bund mit einer 70-prozentigen Zuschussbeteiligung an den Kulturinstitutionen wesentlich großzügiger[184]. Auch die Auflagen an Berlin sind durch das Gericht frei wählbar. In Frage kämen hier z. B. der Verkauf aller Wohnungsbaugesellschaften oder die Einführung von Studiengebühren für das Erststudium[185]. Völlig ausgeschlossen, auch seitens des Landes Berlin, wird der Fall, dass durch Bundeshilfen statt Entschuldungen laufende Haushalte (mit-)finanziert würden[186].
Die zentrale Aufgabe für das Land besteht darin, durch nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen das Primärdefizit in einen „angemessenen“ Primärüberschuss zu überführen[187]. Dieses Ziel existierte jedoch auch schon in den vergangenen Jahren und ist unabhängig von dem Verlauf des Prozesses, da die Zinszahlungen per definitionem nicht Bestandteil der Betrachtung des Primärsaldos sind[188]. Einschneidende Maßnahmen aus eigener Kraft des Landes waren und sind auch in Zukunft unumgänglich[189]. Angesichts eines Finanzierungsdefizits von nahezu 20 % bzw. 4 Mrd. € wird deutlich, dass selbst bei einer Teilentschuldung durch den Bund, die die Zinszahlungen verringern würde, die in 2005 aber „nur“ 2,6 Mrd. € ausmachen[190], unabhängig vom Prozessausgang harte Sparmaßnahmen erforderlich sein werden. Die Vorstellung, dass es ein Klageerfolg erlauben würde, den Konsolidierungskurs aufzuweichen und eine Stimmungsverbesserung in der Bevölkerung herbeizuführen, ist illusorisch. Mit einem nach Fußballstrategie klingenden Zitat drückte Finanzstaatssekretär Schulte die Situation so aus: „Vor dem Spiel ist nach dem Spiel.“[191] Somit dürfte die Perspektive für alle Beteiligten der Ausgabenseite des Landeshaushalts und insbesondere der Kultur mindestens mittelfristig stark angespannt bleiben. Schon in den leicht optimistischen Planungen von 2003 wird erwähnt, dass auch in den Jahren 2007ff. erhebliche Ausgabensenkungen nach wie vor unumgänglich sein würden[192]. Das erforderliche Handlungsvolumen ist so umfangreich, dass es nicht Betracht kommt, mögliche Konsolidierungsspielräume auszulassen. In den kommenden Jahren steht ein Prozess noch bevor, der - dem Zero Base Budgeting ähnelnd - eine Überprüfung und Neuordnung sämtlicher öffentlicher Aufgaben beinhaltet[193]. In der langfristigen Perspektive ist mit Sicherheit mit einer Absenkung des Mehreinnahmeniveaus auf ca. 12 % zu rechnen, da bis 2019 die Sonderbedarfs-BEZ und der Solidarpakt II vollständig auslaufen (jährlich linear um ca. 150 Mio. € abnehmend), was endlich einem zusätzlichen Konsolidierungszwang von ca. 2,5 Mrd. € oder 15 % der gesamten Einnahmen (2005) entspricht[194]. Dies allein übt schon einen großen Druck aus.
Dessen ungeachtet könnten Phänomene gemäß der ökonomischen Theorie der Politik zu Milderungen der Einschnitte führen, wenn – insbesondere im „politischen Konjunkturzyklus“ kurz vor Wahlen[195] – die pragmatischen Ziele der Haushaltspolitiker gegenüber programmatischen Zielen und Versprechungen, die der Bevölkerung kurzfristig zu Gute kämen, an Einfluss und Durchsetzungskraft verlieren würden, um Wählerstimmen zu gewinnen[196]. Dann käme auch der Hypothese, dass die Finanzierungskosten von staatlichen Leistungen und Gütern von der Bevölkerung unterschätzt werden (sog. Fiscal Illusion[197] ), vermehrte Bedeutung zu; besonders im Fall der exorbitanten Verschuldung Berlins.
[...]
[1] Vgl. Bertelsmann Stiftung, 1998, S. 22 u. 31f. u. vgl. Heinze, 2004, S. 34
[2] Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 18 u. 21
[3] Gemessen nach dem Grundmittelkonzeot, vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 15
[4] Vgl. Datenmaterial des Arbeitskreises Kultursponsoring, vgl. http://www.aks-online.org/aks_engine.shtml?id=27 am 20. 6. 2005 u. vgl. Bertelsmann Stiftung, 1998, S. 31f. u. vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 97
[5] Vgl. Kerber, 2002, S. XI-XIV u. vgl. Heinrichs, 1997, S. 17f. u. vgl. Wegner, 1999, S. 181-184
[6] Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, 2005(b), Art. 87 Ziffer 2: „[...] Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten [...]“
[7] Vgl. dazu ausführlich Färber, 2003, S. 7f.
[8] Vgl. ebda., S. 10 u. vgl. Kerber, 2002, S. 52
[9] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 18 u. 20 u. vgl. Färber, 2003, S. 9 u. 12 u. vgl. Wieland, 2002, S. 11-13 u. vgl. Kerber, 2002, S. 51
[10] Vgl. Färber, 2003, S. 9 u. 15
[11] Vgl. Wieland, 2002, S. 13
[12] Vgl. Färber, 2003, S. 9
[13] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 18 u. vgl. Wieland, 2002, S. 15
[14] Vgl. Färber, 2003, S. 4 u. vgl. Wieland, 2002, S. 15
[15] Vgl. ebda, S. 16
[16] Vgl. ebda., S. 17f.
[17] Vgl. ebda., S. 9f.
[18] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 19 u. vgl. Wieland, 2002, S. 19-21 u. vgl. Färber, 2003, S. 4
[19] Vgl. Färber, 2003, S. 86 u. vgl. Wieland, 2002, S. 19
[20] Vortrag von Prof. Wieland am 15. 6. 2005 in der Freien Universität Berlin, in Widerspruch zu Färber, 2003, S. 4
[21] Vgl. Färber, 2003, S. 79 u. vgl. Weinzen, 2004, S. 193 u. vgl. Weinzen, 2003, S. 156f.
[22] Vgl. Weinzen, 2004, S. 192
[23] Vgl. ebda., S. 193
[24] Vgl. Färber, 2003, S. 80-82
[25] Vgl. ebda., 2003, S. 81f.
[26] Vgl. Färber, 2003, S. 82
[27] Vgl. ebda., S. 83 u. vgl. Wieland, 2002, S. 5
[28] Vgl. Färber, 2003, S. 83
[29] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[30] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[31] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 22
[32] Vgl. Färber, 2003, S. 116
[33] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 19f.
[34] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen: Pressemitteilung vom 30. 11. 2004, http://www.berlin.de/SenFin/Presse/Alt/301104.html am 1. 7. 2005
[35] Art. 30 GG lautet: „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.“, vgl. http://www.netlaw.de/gesetze/gg.htm am 15. 6. 2005
[36] Vgl. Schmidt, 2002, o. S. u. vgl. DIW, 2002, S. 20
[37] Vgl. Deutscher Bühnenverein, 2004, S. A131-A143
[38] Vgl. ebda., S. A133
[39] Ebda., S. A132
[40] Vgl. Bertelsmann Stiftung, 1998, S. 30f. u. vgl. Schmidt, 2002, o. S.
[41] Vgl. Toepler, 1991, S. 8
[42] Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 32 u. vgl. DIW, 2002, S. 36
[43] Interview mit V. Kröning, 31. 5. 2005
[44] Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 32
[45] Vgl. ebda., S. 28
[46] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 2 u. 4
[47] Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, 2005(b), Art. 87 Abs. 2 Ziffer 2: „Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn andere Mittel zur Deckung nicht vorhanden sind. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. [...]“
[48] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 36 u. vgl. Wieland, 2002, S. 7
[49] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[50] Vgl. Anhang 3
[51] Vgl. Färber, 2003, S. 10
[52] Vgl. Anhang 3
[53] Vgl. Tagesspiegel 19-05-05, S. 7
[54] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 18 u. zur Situation in 2001 vgl. Wieland, 2002, S. 33
[55] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 18
[56] Vgl. Anhang 3
[57] Vgl. jedoch gegenteilige Meinung bei Rosenschon, 2003, S. 30-32
[58] Vgl. dazu auch Blankart, 2003, S. 369f. u. vgl. Wieland, 2002, S. 37
[59] Vgl. ebda., S. 34
[60] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(c), S. 1f.
[61] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 1
[62] Vgl. ebda., S. 1f. u. vgl. Weinzen, 2004, S. 183f.
[63] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 2 u. vgl. Weinzen, 2004, S. 184-186
[64] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 42 u. vgl. Weinzen, 2004, S. 184
[65] Vgl. Färber, 2003, S. 56 u. Weinzen, 2004, S. 185-188 u. vgl. McKinsey, 2005, S. 54
[66] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 6 u. vgl. Weinzen, 2004, S. 184
[67] Ebda., S. 188 u. vgl. Weinzen, 2003, S. 155
[68] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 7
[69] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 3-5
[70] Vgl. Färber, 2003, S. 57
[71] Vgl. ebda., S. 36-41
[72] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 2f.
[73] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 42 u. vgl. Färber, 2003, S. 63
[74] Vgl. ebda., S. 41
[75] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 17
[76] Vgl. ebda., S. 98. Die geringfügigen Differenzen zu Abb. 1 ergeben sich vermutlich aus einer „methodischen Bereinigung“ der Zahlenwerte der graphischen Darstellung, vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 11
[77] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 98
[78] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[79] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 15
[80] Vgl. ebda., S. 10
[81] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 4
[82] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 42
[83] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 5
[84] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 6f.
[85] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 43
[86] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 15
[87] Vgl. Anhang 3
[88] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 3f.
[89] Vgl. ebda., S. 7
[90] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 8 u. 11
[91] Vgl. ebda., S. 17
[92] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 8
[93] Vgl. Tagesspiegel, 16-07-2005, S. 10
[94] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 9
[95] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 19
[96] Vgl. ebda., S. 17
[97] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[98] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 96
[99] Vgl. ebda., S. 101
[100] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 17
[101] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin u. vgl. Wieland, 2002, S. 39 u. Vortrag von Prof. Wieland am 15. 6. 2005 in der Freien Universität Berlin
[102] Vgl. Wieland, 2002, u. vgl. Färber, 2003
[103] Vgl. Färber, 2003, S. 14 u. vgl. Wieland, 2002, S. 34
[104] Vgl. Färber, 2003, S. 18
[105] Vgl. ebda., S. 20
[106] Vgl. ebda., S. 21-31
[107] Vgl. ebda., S. 54-56
[108] Wieland, 2002, S. 6
[109] Vortrag von Prof. Wieland, am 15. 6. 2005 in der Freien Universität Berlin
[110] Zitiert aus Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[111] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[112] Vgl. Berliner Morgenpost, 24-01-2003, o. S. u. vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 111
[113] Vgl. ebda., S. 111f.
[114] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[115] Kurzbefragung von H. Schulte, 13. 1. 2005
[116] Vgl. Tagesspiegel, 21-06-2005, S. 10
[117] Vgl. Färber, 2003, S. 96
[118] Vgl. Kap. 2.1.4
[119] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[120] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin u. vgl. Lang, 2003, S. 8
[121] Vgl. Färber, 2003, S. 66f.
[122] Vgl. ebda., S. 89
[123] Vgl. Tagesspiegel, 21-06-2005, S. 10
[124] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen: Pressemitteilung vom 14. 6. 2005, http://www.berlin.de/SenFin/Presse/Alt/140605a.html am 16. 6. 2005
[125] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen: Erläuterungen zur extremen Haushaltsnotlage des Landes Berlin, http://www.berlin.de/SenFin/Presse/Alt/051102b.html am 16. 6. 2005
[126] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 69 u. ebda., 2005(d), S. 2 u. vgl. Tagesspiegel 08-06-2005, S. 10
[127] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[128] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 10
[129] Vgl. Färber, 2003, S. 62
[130] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 29
[131] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[132] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 22 u. vgl. Wieland, 2002, S. 34
[133] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 30
[134] Vgl. ebda., S. 69
[135] Vgl. ebda., S. 66
[136] Vgl. ebda., S. 60
[137] Vgl. ebda., S. 63
[138] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 107f.
[139] Vgl. ebda., S. 108
[140] Vgl. ebda., S. 103
[141] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 67
[142] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 108
[143] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 69f.
[144] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 8
[145] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 96
[146] Vgl. ebda., S. 100
[147] Vgl. Tagesspiegel, 13-05-2005, S. 17
[148] Vgl. Tagesspiegel, 15-06-2005, S. 10 u. vgl. Anhang 3
[149] Die Daten bis 1996 stammen vom DIW, 2002, S. 24, und liegen aufgrund einer anderen Ausgabendefinition tendenziell einige Millionen zu hoch. Ferner ist die absolute Höhe der Kulturausgaben ab 2003 um etwa 80 Mio. € niedriger als eingezeichnet. Dies hängt mit kameralistischen Umschichtungen zusammen: Die Förderung der Kirchen ist aus dem Kulturhaushalt herausgefallen und wurde an anderer Stelle verankert. Um eine wahrheitsgemäße Vergleichbarkeit im Zeitverlauf zu ermöglichen, wurde die alte Buchungsweise in der Graphik fingiert.
[150] Eigene Berechnung u. vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 18
[151] Vgl. Färber, 2003, S. 71 u. 75 u. vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 28 u. 30
[152] Vgl. Färber, 2003, S. 71
[153] Vgl. DIW, 2002, S. 37. Der Wert für Berlin beinhaltet nicht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz; mit ihr beträgt er 230 €.
[154] Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 21
[155] Eigene Berechnung, vgl. Anhang 4 u. vgl. Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 2005(b) u. vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2003, S. 32
[156] Vgl. Staatsoper Unter den Linden, 2002, S. 172
[157] Vgl. DIW, 2002, S. 26 u. vgl. Flierl, 2004, S. 10
[158] Vgl. DIW, 2002, S. 23
[159] Vgl. ebda., S. 20
[160] Vgl. Weinzen, 2004, S. 202f.
[161] Vgl. DIW, 2002, S. 28
[162] Vgl. Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 2005(a), S. 1f. u. vgl. DIW, 2002, S. 28f. u. vgl. Flierl, 2004, S. 6f. u. vgl. http://www.bundesregierung.de/Artikel/-,9568.440031/dokument.htm am 5. 6. 2005
[163] Vgl. http://www.berlin.de/hauptstadtkulturfonds/typo/index.php?id=145 am 5. 6. 2005
[164] Vgl. DIW, 2002, S. 20
[165] Vgl. http://www.bundesregierung.de/Artikel/-,9568.440031/dokument.htm, am 22. 7. 2005
[166] Vgl. DIW, 2002, S. 29
[167] Interview mit R. Unganz, 15. 7. 2005 u. vgl. Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, o. J., S. 1-36
[168] Aus dem Bereich „Sonstiges“ fließen auch einige Mittel in Aufführungskünste.
[169] Senatsbeschluss Nr. 1218/03, vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 45
[170] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(b), S. 70 u. Anhang 5. Die hier aufgeführten Titel über einzelne laufende Zuweisungen und Zuschüsse decken nur ca. ¾ des Kulturhaushalts ab, jedoch innerhalb dessen die größten Einzelposten.
[171] Vgl. http://www.roc-berlin.de/content/e51/index_ger.html am 22. 7. 2005
[172] Der RIAS-Kammerchor gilt beispielsweise als der beste deutsche Chor seiner Art. Auch das DSO unter Kent Nagano brachte es zu viel beachteten Erfolgen.
[173] Interview mit B. Bergmann, 7. 7. 2005
[174] Vgl. Färber, 2003, S. 97
[175] Vgl. ebda., S. 117
[176] Vgl. ebda., S. 92
[177] Vgl. ebda., S. 97f. u. vgl. Wieland, 2002, S. 26-29
[178] Vortrag von Prof. Wieland am 15. 6. 2005 in der Freien Universität Berlin
[179] Vgl. Wieland, 2002, S. 30
[180] Vgl. Färber, 2003, 99-109
[181] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[182] Vortrag von V. Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[183] Vortrag von Prof. Wieland am 15. 6. 2005 in der Freien Universität Berlin u. vgl. Kap. 3.4
[184] Vgl. Weinzen, 2004, S. 204f.
[185] Vortrag von Volker Kröning, MdB, ehem. Finanzsenator Bremens, am 31. 5. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[186] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 35
[187] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 21 u. vgl. Weinzen, 2003, S. 160
[188] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 101
[189] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen: Erläuterungen zur extremen Haushaltsnotlage des Landes Berlin, http://www.berlin.de/SenFin/Presse/Alt/051102b.html am 22. 7. 2005
[190] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2005(b), S. 2 u. 4
[191] Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[192] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2003(a), S. 99
[193] Vgl. ebda., S. 44 u. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 16
[194] Vgl. Senatsverwaltung für Finanzen, 2004(a), S. 13 u. Vortrag von H. Schulte, Staatssekretär für Finanzen, am 13. 1. 2005 im Netzwerk 21, Berlin
[195] Vgl. Mueller, 2003, S. 437-440 u. 446f.
[196] Vgl. Henke, 1999, S. 20f.
[197] Vgl. Zimmermann, 2001, S. 41 u. vgl. Mueller, 2003, S. 466f. u. 527-529 u. vgl. Henke, 1999, S. 20
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832493370
- ISBN (Paperback)
- 9783838693378
- DOI
- 10.3239/9783832493370
- Dateigröße
- 2.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Berlin – Wirtschaft und Management, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kulturmanagement finanzierung finanzen controlling kunst
- Produktsicherheit
- Diplom.de