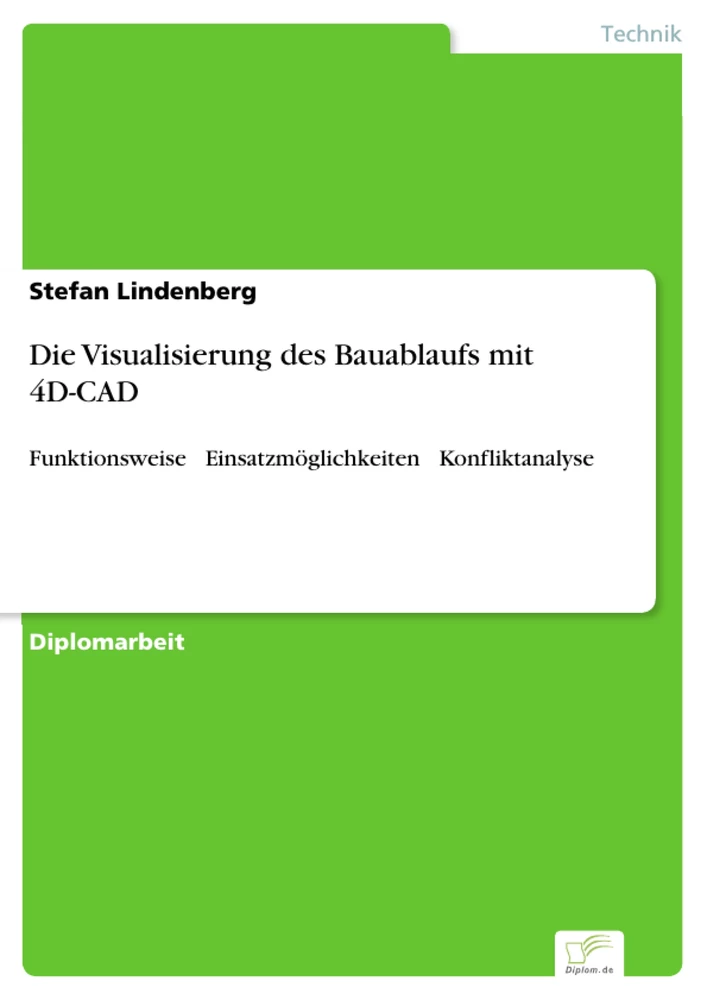Die Visualisierung des Bauablaufs mit 4D-CAD
Funktionsweise Einsatzmöglichkeiten Konfliktanalyse
©2005
Diplomarbeit
103 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Bauindustrie steht heutzutage zunehmend vor der Herausforderung komplexe Bauaufgaben in immer knapper bemessenen Planungs- und Ausführungsfristen umzusetzen. Diese Anforderung führt zu Bauablaufplänen, die eine enge und teilweise überlappende zeitliche Abfolge von Arbeitsabläufen vorsehen. Ein derart gestraffter Bauablaufplan hat zur Folge, dass die Arbeiten vieler Gewerke gleichzeitig zu koordinieren sind, wodurch die räumlichen Abhängigkeiten einzelner Arbeitsabläufe voneinander und von der Baustellensituation zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein unzureichend überdachtes Platzangebot auf der Baustelle führt in diesem Zusammenhang oftmals dazu, dass ein Bauablauf in vielen Situationen anfällig für Störungen ist.
Die geistige Vorwegnahme der mit parallel geplanten Vorgängen einher gehenden Bauzustände zeigt auch routinierten Baufachleuten zeitweilig die Grenzen ihrer Vorstellungskraft auf. Die konventionellen Darstellungsformen des Bauablaufs leisten im Bezug auf diese Problemstellung keine Abhilfe. Balkendiagramme, Liniendiagramme und Netzpläne abstrahieren die geplante Abfolge der Vorgänge in einem mehr oder minder starken Maße, und vermitteln kein unmittelbares Bild der geplanten Bauzustände zu bestimmten Zeitpunkten. Überdies können komplexe Bauablaufpläne, die vielfach verflochtene Vorgänge enthalten, in konventioneller Darstellung nicht ohne weiteres kommuniziert werden. Gerade die in ein Projekt involvierten Nichtfachleute können bei einer konventionellen Abbildung des Bauablaufs oftmals nicht die assoziative Brücke zu verschiedenen Baustellensituationen herstellen und erlangen selten einen Überblick bezüglich aller terminlichen Zusammenhänge. Straffe Bauzeitenpläne erfordern ebenso einen erhöhten Kommunikationsbedarf und Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten aller Verantwortungsbereiche. Um einen reibungslosen Bauablauf zu realisieren müssen Projektanforderungen und -einschränkungen sowie Problemstellungen unmissverständlich vermittelt werden.
Unberücksichtigte räumliche Zwänge oder Fehlinterpretationen einzelner Projektinhalte können zu teilweise ungeeigneten Bauablaufplanungen führen. Die Auswirkungen von Planungsentscheidungen, die nicht alle notwendigen Informationen mit einbeziehen, äußern sich in unproduktiven Arbeitsabläufen, terminlichen Verschiebungen und erhöhten Baukosten. Um die Auswirkungen dieser Entscheidungen im Kontext vieler Abhängigkeiten und Zwänge abzuschätzen und […]
Die Bauindustrie steht heutzutage zunehmend vor der Herausforderung komplexe Bauaufgaben in immer knapper bemessenen Planungs- und Ausführungsfristen umzusetzen. Diese Anforderung führt zu Bauablaufplänen, die eine enge und teilweise überlappende zeitliche Abfolge von Arbeitsabläufen vorsehen. Ein derart gestraffter Bauablaufplan hat zur Folge, dass die Arbeiten vieler Gewerke gleichzeitig zu koordinieren sind, wodurch die räumlichen Abhängigkeiten einzelner Arbeitsabläufe voneinander und von der Baustellensituation zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein unzureichend überdachtes Platzangebot auf der Baustelle führt in diesem Zusammenhang oftmals dazu, dass ein Bauablauf in vielen Situationen anfällig für Störungen ist.
Die geistige Vorwegnahme der mit parallel geplanten Vorgängen einher gehenden Bauzustände zeigt auch routinierten Baufachleuten zeitweilig die Grenzen ihrer Vorstellungskraft auf. Die konventionellen Darstellungsformen des Bauablaufs leisten im Bezug auf diese Problemstellung keine Abhilfe. Balkendiagramme, Liniendiagramme und Netzpläne abstrahieren die geplante Abfolge der Vorgänge in einem mehr oder minder starken Maße, und vermitteln kein unmittelbares Bild der geplanten Bauzustände zu bestimmten Zeitpunkten. Überdies können komplexe Bauablaufpläne, die vielfach verflochtene Vorgänge enthalten, in konventioneller Darstellung nicht ohne weiteres kommuniziert werden. Gerade die in ein Projekt involvierten Nichtfachleute können bei einer konventionellen Abbildung des Bauablaufs oftmals nicht die assoziative Brücke zu verschiedenen Baustellensituationen herstellen und erlangen selten einen Überblick bezüglich aller terminlichen Zusammenhänge. Straffe Bauzeitenpläne erfordern ebenso einen erhöhten Kommunikationsbedarf und Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten aller Verantwortungsbereiche. Um einen reibungslosen Bauablauf zu realisieren müssen Projektanforderungen und -einschränkungen sowie Problemstellungen unmissverständlich vermittelt werden.
Unberücksichtigte räumliche Zwänge oder Fehlinterpretationen einzelner Projektinhalte können zu teilweise ungeeigneten Bauablaufplanungen führen. Die Auswirkungen von Planungsentscheidungen, die nicht alle notwendigen Informationen mit einbeziehen, äußern sich in unproduktiven Arbeitsabläufen, terminlichen Verschiebungen und erhöhten Baukosten. Um die Auswirkungen dieser Entscheidungen im Kontext vieler Abhängigkeiten und Zwänge abzuschätzen und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9303
Lindenberg, Stefan: Die Visualisierung des Bauablaufs mit 4D-CAD -
Funktionsweise Einsatzmöglichkeiten Konfliktanalyse
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Universität Duisburg-Essen, Standort Essen, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis 1
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis... 3
1
Einleitung... 5
2
Die Bedeutung von 4D-CAD ... 8
3
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und
deren Verknüpfung ... 10
3.1
Die Abgrenzung von 3D-CAD-Modellen zur zweidimensionalen
Darstellung... 10
3.2
Das 3D-Modell als 4D-Komponente... 12
3.3
Der Bauzeitenplan als 4D-Komponente ... 14
3.4
Die Verbindung der Komponenten Das 4D-Modell ... 16
4
Die Einführung eines Beispielprojektes... 20
5
Die vierdimensionale Modellierung des Fallbeispiels ... 27
5.1
Erstellen des 3D-CAD-Modells mit Autodesk
Architectural
Desktop... 27
5.2
Erstellen des Bauzeitenplans mit Microsoft Project... 34
5.3
Erstellen des 4D-Modells in Navis Works
Jet Stream ... 41
6
Die Einsatzmöglichkeiten von 4D-Modellen ... 52
6.1
Das 4D-Modell als Kommunikationsmedium... 53
6.2
Die Prüfung von Bauablaufplänen und die Projektüberwachung mit
4D-Modellen... 56
Inhaltsverzeichnis
2
7
Die Auswertung des Beispielmodells ... 59
8
Der räumliche Planungsprozeß mit 4D-Modellen... 67
8.1
Begriffsbestimmung ... 68
8.2
Modellanforderungen und Eigenschaften der Räume als
4D-Objekte... 69
8.3
Die räumliche Planung und das Beispielprojekt ... 71
8.3.1
Planungssituation... 72
8.3.2
Problemstellung ... 74
8.3.3
Anpassung der Planung... 75
8.4 Vorgehensweise und vierdimensionale Planungsaufgabe... 79
9
Die kritische Analyse der räumlichen Gesamtstruktur... 82
9.1 Die RaumkonfliktSystematik ... 82
9.2 Die Analysefunktion ... 85
10
Schlußbetrachtung ... 93
Literaturverzeichnis... 96
Abbildungsverzeichnis... 98
Eidesstattliche Erklärung... 100
Inhaltsverzeichnis 3
Abkürzungsverzeichnis
2D
Zweidimensional bzw. zwei Dimensionen: Darstellungen als
Projektion auf eine Ebene: Grundriss, Ansicht, Schnitt
3D
Dreidimensional bzw. drei Dimensionen:
Räumliche Darstellungen - Perspektivische Abbildungen
3D-Anwendung
Software: 3D-CAD-Anwendungsprogramm
3D-Modell
3D-CAD-Modell
4D
Vierdimensional bzw. vier Dimensionen: Räumliche Darstellung
im zeitlichen Kontext 3D + Zeit
4D-Anwendung
Software: 4D-CAD-Anwendungsprogramm
4D-Modelle
4D-CAD-Modelle
AG
Auftraggeber
ADT
Autodesk
Architectural Desktop
BA
Bauabschnitt
BFS
Baufortschrittsimulation
BPP
Bauphasenplan
CAD
Computer Aided Design (engl.: rechnergestützter Entwurf)
DWG
Standarddateiformat (Vektorgrafikformat) in AutoCAD
GU
Generalunternehmer
NW
NavisWorks
Jet Stream
NU
Nachunternehmer
NWC
NavisWorks spezifische Cachedatei Dateierweiterung für
Abkürzungsverzeichnis
4
zwischengespeicherte CAD-Dateien zur Unterstützung des
Einlesevorgangs in NavisWorks
NWF
NavisWorks spezifisches Datei-Speicherformat Speichert eine
Liste mit allen angefügten Dateien einer NavisWorks-Datei
zusammen mit deren relativen Pfaden zu bereits vorhandenen
NWF-Dateien
TGA
Technische Gebäudeausrüstung
Einleitung
5
1 Einleitung
Die Bauindustrie steht heutzutage zunehmend vor der Herausforderung komplexe
Bauaufgaben in immer knapper bemessenen Planungs- und Ausführungsfristen
umzusetzen. Diese Anforderung führt zu Bauablaufplänen, die eine enge und teil-
weise überlappende zeitliche Abfolge von Arbeitsabläufen vorsehen. Ein derart
gestraffter Bauablaufplan hat zur Folge, daß die Arbeiten vieler Gewerke gleichzeitig
zu koordinieren sind, wodurch die räumlichen Abhängigkeiten einzelner Arbeits-
abläufe voneinander und von der Baustellensituation zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Ein unzureichend überdachtes Platzangebot auf der Baustelle führt in
diesem Zusammenhang oftmals dazu, daß ein Bauablauf in vielen Situationen
anfällig für Störungen ist.
Die geistige Vorwegnahme der mit parallel geplanten Vorgängen einher gehenden
Bauzustände zeigt auch routinierten Baufachleuten zeitweilig die Grenzen ihrer
Vorstellungskraft auf. Die konventionellen Darstellungsformen des Bauablaufs leisten
im Bezug auf diese Problemstellung keine Abhilfe. Balkendiagramme, Linien-
diagramme und Netzpläne abstrahieren die geplante Abfolge der Vorgänge in einem
mehr oder minder starken Maße, und vermitteln kein unmittelbares Bild der
geplanten Bauzustände zu bestimmten Zeitpunkten. Überdies können komplexe
Bauablaufpläne, die vielfach verflochtene Vorgänge enthalten, in konventioneller
Darstellung nicht ohne weiteres kommuniziert werden. Gerade die in ein Projekt
involvierten Nichtfachleute können bei einer konventionellen Abbildung des
Bauablaufs oftmals nicht die assoziative Brücke zu verschiedenen Baustellen-
situationen herstellen, und erlangen selten einen Überblick bezüglich aller
terminlichen Zusammenhänge. Straffe Bauzeitenpläne erfordern ebenso einen
erhöhten Kommunikationsbedarf und Informationsfluß zwischen den Projekt-
beteiligten aller Verantwortungsbereiche. Um einen reibungslosen Bauablauf zu
realisieren, müssen Projektanforderungen und einschränkungen sowie Problem-
stellungen unmißverständlich vermittelt werden.
Unberücksichtigte räumliche Zwänge oder Fehlinterpretationen einzelner Projekt-
inhalte können zu teilweise ungeeigneten Bauablaufplanungen führen. Die Aus-
wirkungen von Planungsentscheidungen, die nicht alle notwendigen Informationen
Einleitung
6
mit einbeziehen, äußern sich in unproduktiven Arbeitsabläufen, terminlichen
Verschiebungen und erhöhten Baukosten. Um die Auswirkungen dieser Ent-
scheidungen im Kontext vieler Abhängigkeiten und Zwänge abzuschätzen, und
diesbezüglich Planungssicherheit zu gewinnen, ist eine modellhafte Darstellung des
Bauablaufs von großem Nutzen.
Die fortschrittlichste bildhafte Darstellungstechnik besteht in der Verwendung von 4D-
Modellen. Durch die Integration von dreidimensionalen Modellen mit der Zeit werden
hierbei die Informationen eines konventionellen Projektplans in eine beständige und
zusammenhängende dreidimensionale Abbildung übersetzt. Die konsistente
Darstellung der Bauzustände ermöglicht die vollständige virtuelle Vorwegnahme des
Bauens in einem nahezu realistischen Raum-Zeit-Kontext. Durch die Verwendung
von 4D-Modellen können sowohl Bauablaufpläne erprobt, überprüft und bewertet, als
auch Planungsinhalte in einzigartiger Weise kommuniziert werden.
In der vorliegenden Diplomarbeit werden Aufbau, Funktionsweise und Einsatz-
möglichkeiten von 4D-CAD-Modellen (4D-Modelle) im Bauwesen und die Aus-
wertung von simulierten Bauabläufen untersucht. Ein Schwerpunktthema dieser
Ausarbeitung besteht in der Betrachtung und Bewertung von räumlichen
Zwangspunkten während der Bauausführung.
Zur Bearbeitung dieses Themas gliedert sich die Arbeit in vier ineinander
übergreifende Teile auf, deren wesentliche Inhalte und Ergebnisse in der Schluß-
betrachtung dieser Arbeit zusammengefaßt und bewertet werden:
· In Kapitel 2 und 3 werden die Grundlagen der 4D-Visualisation von Bauabläufen
erarbeitet. Einführend wird die Begrifflichkeit des ,,4D-Modells", insbesondere die
Bedeutung der Vierdimensionalität in diesem Zusammenhang, erklärt. Die
anschließende Beschreibung der 4D-Bausteine geht mit der Ausarbeitung der
technischen Anforderungen im Hinblick auf die Erfordernisse einer praktikablen
Verknüpfung von geometrischen und zeitlichen Informationen einher. Die
Erläuterung der prinzipiellen Komponentenverknüpfung vervollständigt die
Erarbeitung der grundlegenden Funktionsweise in der Theorie.
· Die Kapitel 4 und 5 konkretisieren die Funktionsweise von 4D-CAD-Anwendungs-
programmen durch die praktische Umsetzung der vierdimensionalen Visualisation
Einleitung
7
eines Bauablaufes. Zu diesem Zweck wird ein Beispielprojekt, einschließlich der
erforderlichen Bauwerksgeometrie, der Baustelleneinrichtung und dem zeitlichen
Projektrahmen eingeführt. Die Erstellung der Komponenten erfolgt unter
Verwendung von unterschiedlichen Software-Anwendungsprogrammen, deren
Funktionalität zugleich mit dem Modellierungsprozeß beschrieben wird. Dieser
Teil der Arbeit schließt mit dem Ergebnis eines vollständigen 4D-Modells, das auf
der Grundlage von konventionell dargestellten Informationen entwickelt wurde.
· Die Kapitel 6 und 7 stellen die Einsatzmöglichkeiten von 4D-Modellen in der
Bauindustrie vor. Hierbei stehen das Kommunikationspotential und die
Überprüfung von Bauabläufen und Baustellensituationen im Vordergrund. Der
Auswertung von vierdimensional visualisierten Bauabläufen folgt die Einarbeitung
von räumlich bedingten Konfliktsituationen, die anhand des Beispielprojekts
verdeutlicht werden. Räumliche Zwänge werden durch die Abbildung der
betreffenden Bauzustände identifiziert und durch die Anpassung der Planung
vermieden. Die in Kapitel 6 beschriebene prinzipielle Vorgehensweise bei der
Auswertung von 4D-Modellen erweitert die theoretischen Grundlagen der 4D-
Visualisation.
· In Kapitel 8 und 9 wird die Funktionalität von 4D-CAD-Anwendungsprogrammen
zur Simulation von dynamischen Arbeitsumgebungen vorgestellt. Durch die
Darstellung des ständigen Wechsels der genutzten Räume werden Zwangs-
punkte durch Überlagerungen von Raumanteilen in 4D-Modellen sichtbar. Die
gleichzeitige Abbildung der vierdimensionalen Aspekte eines Bauablaufes
eröffnet die Möglichkeit eine Vorgangsfolge durch die Anpassung des Platz-
angebotes in einer bestimmten Baustellensituation räumlich zu planen und
diesbezügliche Interferenzen im Vorfeld auszuschließen. Zur Einführung in diese
Thematik der weiterführenden 4D-Forschung werden Begriffe, Modellformate und
Eigenschaften für die erforderlichen Räume bei der Ausführung verschiedener
Vorgänge definiert. Anschließend wird der räumliche Planungsprozeß durch die
Anwendung auf das Beispielprojekt verdeutlicht. Räumliche Zwänge werden
visuell erfaßt und analytisch unter Einbeziehung einer systematischen Konflikt-
betrachtung bewertet.
Die Bedeutung von 4D-CAD
8
2 Die Bedeutung von 4D-CAD
Unter vierdimensionaler Darstellung wird im Allgemeinen die Animation von Bildern
eines oder mehrerer 3D-Objekte, durch deren Eingliederung in ein zeitliches
Ordnungsschema verstanden. Heute wird diese Darstellungstechnik ausschließlich
mit Computern realisiert. Durch die Kombination des graphischen Potentials von
3D-CAD-Anwendungsprogrammen (3D-Anwendungen) mit den Informationen einer
Terminplanungs-Software hat dieses Verfahren seine Verwendung in den Bau-
wissenschaften gefunden: Die 4D-CAD-Technologie.
Auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Darstellungstechnik entsteht durch die
Verknüpfung der einzelnen Objekte oder der Objektgruppen eines 3D-CAD-Modells
(3D-Modell) mit den Informationen des entsprechenden Bauzeitenplans ein vier-
dimensionales Bauablaufmodell (4D-Modell). Der geplante Baufortschritt kann so, in
Abhängigkeit von dem Detaillierungsgrad des verwendeten 3D-Modells und dem
damit einhergehenden Grad der Terminplanung, über alle gedachten Bauphasen
virtuell dargestellt werden. Diese zeitlich vorweggenommene Abbildung des Bau-
ablaufs wird auch als Baufortschrittsimulation (BFS) bezeichnet.
Die BFS wird in einer durch den Computer künstlich erzeugten Umgebung, die aus
einem 3D-Modell des Bauwerks und dem Baustellengelände sowie dessen
Erschließung besteht, abgespielt. Das Modell unterscheidet sich hierbei im Aufbau
grundlegend von dreidimensionalen Architekten oder Ingenieursmodellen. Archi-
tektenmodelle werden in der Regel verwendet um räumliche Proportionen und
ästhetische Aspekte zu verdeutlichen, oder um verschieden gestaltete Strukturen zu
illustrieren. Ingenieursmodelle werden wiederum verwendet um die Reaktion eines
Tragwerkes auf verschieden geartete Belastungen zu untersuchen. Während die
vorgenannten Modelle beispielsweise ganze Fassadenabschnitte mit gleicher
Oberflächenbeschaffenheit, oder einzelne Bauglieder zu Rahmenbauteilen,
zusammenfassen, ist ein Bauablaufmodell eine korrekte Darstellung aller für die
erwünschten Simulationsschritte erforderlichen Konstruktionsteile. Das bezieht sich
sowohl auf das Gebäude als auch auf die Baustelleneinrichtung. (
[7] S. 51)
Die Bedeutung von 4D-CAD
9
Während der Abspielzeit der Simulation, die proportional zu dem tatsächlichen
Zeitverlauf ist, verändert sich die modellhaft dargestellte Umgebung entsprechend
dem geplanten Baufortschritt. Demnach kann die BFS als eine scheinbar lückenlose
Aneinanderreihung von dreidimensional dargestellten Bauphasenplänen (BPP)
verstanden werden. Bei BPP handelt es sich um bildhafte Darstellungen einzelner
Bauzustände zu festgelegten Zeitpunkten. Sie werden in der Regel verwendet, um
komplizierte Projektphasen zu verdeutlichen oder die geplante Bauabwicklung in
zeitlich festen Abständen zu veranschaulichen. Der Zeitablauf geht aus isolierten
BPP nicht hervor, jedoch zeigt deren Aneinanderreihung deutlich auf, daß die
Bauablaufplanung einer vierdimensionalen Problematik unterliegt, da sich der Raum
mit fortschreitender Bauzeit verändert (
[17] S. 29).
In einem 4D-Modell ist die Zeit als die Darstellung der Bewegung eines Objektes im
Raum eingebettet. Daraus resultiert, daß die vierte Dimension in CAD-Anwendungen
als die Visualisierung von Zeit in der Form von Bildern der Entwicklungsphasen eines
dreidimensionalen Modells verstanden werden muß. Die Aufeinanderfolge von
dreidimensionalen Bildern stellt allerdings nichts anderes, als zusätzliche
Informationen desselben dreidimensionalen Objektes dar, auch wenn die Bewegung,
die mit der Reihenfolge assoziiert wird, eine neue Perspektive enthüllt. Die so
definierte vierte Dimension eröffnet im Hinblick auf eine größere physikalische Raum-
Zeit-Beziehung lediglich eine beschränkte Sichtweise: Die chronologische Anordnung
von 3D-Abbildungen als vierte Dimension. (
[7] S. 43)
Durch die Verbindung von räumlichen mit den entsprechenden zeitlichen
Informationen stellt sich das 4D-Modell eines geplanten Bauwerkes als eine, der
Realität im hohen Maße angenäherte Vorschau der tatsächlichen Erbauung dar. Bei
einer ausreichend detailliert geschichteten Animation des Modells können theoretisch
alle Tätigkeiten während der gesamten Bauzeit als Aufeinanderfolge von
Montageschritten visualisiert werden. Eine detaillierte BFS räumt Planern die
Möglichkeit ein, den geplanten Bauablauf hinsichtlich räumlicher und zeitlicher
Zwangspunkte zu untersuchen und einen optimalen Weg zur Realisierung einer
Bauaufgabe zu finden.
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
10
3 Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren
Verknüpfung
Ein 4D-Modell besteht aus einem 3D-Modell und einem EDV gestützten Bauablauf-
plan, der die zeitlichen Informationen liefert. Dadurch werden die drei Raum-
dimensionen um den Zeitverlauf als so zu verstehende vierte Dimension ergänzt. In
den folgenden Unterkapiteln werden die Anforderungen an die Komponenten, sowohl
grundsätzlich, als auch hinsichtlich ihrer Verwendung als zueinander kompatible
Bausteine eines 4D-Modells beschrieben. Das Kapitel führt über den Vergleich der
konventionellen 2D-Bauplanung mit dem Bauentwurf als 3D-Modell, bis hin zu der
prinzipiellen Komponentenverknüpfung und dem 4D-Modell als Resultat.
3.1
Die Abgrenzung von 3D-CAD-Modellen zur zweidimensionalen
Darstellung
Bauzeichnungen zeigen in der Regel die zweidimensionalen Projektionen eines
Bauwerkes auf verschiedene vertikale und horizontale Ebenen. Die Idee, daß ein
dreidimensionales Objekt als eine Ansammlung von zweidimensionalen Projektionen
abgebildet wird, erfordert von dem Betrachter ein ausgeprägtes räumliches Vor-
stellungsvermögen um sie anschließend wieder ins Dreidimensionale zu projizieren.
Gerade dem ungeübten Betrachter bereitet diese Form der Darstellung Schwierig-
keiten, da sie im Gegensatz zu der natürlichen Wahrnehmung der Umwelt steht
(
[7] S. 35). 3D-Modelle stellen hier die assoziative Brücke zwischen der konven-
tionellen 2D-Darstellung und der natürlichen Wahrnehmung her.
Mit den heute gängigen 3D-Anwendungen werden die Bauwerksmodelle aus
einzelnen 3D-Volumenmodellen aufgebaut, denen geometrische und technologische
Eigenschaften zugewiesen werden können. Das Erscheinungsbild der 3D-
Volumenmodelle richtet sich nach der benutzerdefinierten Einstellung der Farbe, der
Textur und anderer optischer Effekte.
Die 3D-Modelle können aus jeder Perspektive betrachtet und durch virtuelle Bau-
werksbegehungen untersucht werden. Details können aus unüblichen Blickwinkeln
beschaut und eventuelle Fehler in der Konstruktion, wie z. B. Bauteilüber-
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
11
schneidungen oder Auslassungen von Bauteilen, unmittelbar behoben werden.
Einmalige Überarbeitungen des Entwurfs oder der Konstruktion erfordern hierbei
auch nur die einmalige Anpassung des 3D-Modells, da alle benötigten Zeichnungen
sich direkt aus dem Modell ableiten. Im Gegensatz dazu müssen in der
konventionellen 2D-Planung viele unterschiedliche Zeichnungen abgeändert werden,
was einen vergleichsweise hohen Arbeitsaufwand bedeutet. (
[8] S.56, [6] S. 5)
Durch die Möglichkeit zur relativ schnellen Änderung und die wirklichkeitsnahe
Darstellung der einzelnen Bauteile können auch Entwurfsalternativen hinsichtlich
ihrer Proportion und Erscheinung überprüft werden. So können mehrere abgeänderte
und abgespeicherte Entwürfe nebeneinander verglichen oder dem Bauherren zur
Auswahl gestellt werden. Auf diesem Weg wird der Bauherr in seiner
Entscheidungsfindung hinsichtlich seiner Zustimmung zu dem Entwurf unterstützt.
Des weiteren hat der Bauherr die Möglichkeit die Architektur durch die virtuelle
Gebäudebegehung quasi zu ,,erleben". Bei dieser Funktion kann die Durchgangs-
geschwindigkeit und der Standort individuell bestimmt werden. (
[6] S. 5, [16] S. 212)
Bei Bauwerken mit komplexer geometrischer Konfiguration sind 3D-Modelle ebenfalls
ein effektives Hilfsmittel um die Gestalt der einzelnen Bauteile und den Aufbau des
Bauwerkes zu untersuchen und zu prüfen. Das Verständnis der Konstruktion oder
der Entwurfsinhalte ist nicht zuletzt für die beteiligten Fachplaner, Bauherren oder
Investoren von Bedeutung. 3D-Modelle dienen allen Interessengruppen als
Informationsquelle und verhelfen zu einem einvernehmlichen Verständnis der
Bauaufgabe bei allen Beteiligten. (
[6] S. 5, [14] S. 126)
Ein detailliert aufgebautes 3D-Modell kann als Muster zur Vorfertigung einzelner
Bauteile oder Ausrüstungsgegenstände verwendet werden. Informationen die aus
dem Modell abgeleitet werden, können beispielsweise von Nachunternehmern zur
frühzeitigen Beschaffung von Material genutzt werden. Fachplaner können das
Modell um ihre Planungsinhalte ergänzen, so daß diese frühzeitig auch anderen
Fachdisziplinen zur Verfügung stehen und Berücksichtigung im Bezug auf die
gesamte Konstruktion finden. Auf diese Weise können Planungsfehlern, wie z. B.
fehlenden Durchbrüchen etc., vorgebeugt werden. Diese zusätzlichen Informationen
sind in der 2D-Planung wiederum auf separaten Zeichnungen enthalten, weil zu viele
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
12
Planungsinhalte aus verschiedenen Fachdisziplinen in einer zweidimensionalen
Abbildung schnell zur Unübersichtlichkeit führen. (
[6] S. 3, [16] S. 211 f.)
3D-Modelle bieten gegenüber der zweidimensionalen Planung zahlreiche weitere
Vorzüge. In Abhängigkeit von den Funktionen des verwendeten Anwendungs-
programms können u. a. auch automatisierte Massenermittlungen oder Schwerpunkt-
berechnungen durchgeführt werden. Das größte Potential der im Bauwesen
verwendeten 3D-CAD-Technologie liegt allerdings in den graphischen Funktionen, da
sich die Softwareunternehmer mit ihren Produkten hauptsächlich an Architekten
richten.
3.2
Das 3D-Modell als 4D-Komponente
Ein 3D-Modell wird als 4D-Komponente auf der Grundlage von Entwurfszeichnungen
des Architekten entwickelt, sofern nicht zuvor schon in 3D geplant wurde. Ein
3D-Modell besteht aus verschiedenen Layern, die als einzelne Zeichnungsebenen
bestimmte Mengen an Informationen in dem Modell isolieren (
[6] S. 18). Die
Funktionsweise der Layer-Technik entspricht der vergleichsweisen Vorstellung vieler
übereinander liegender durchsichtiger Folien, auf denen jeweils zusammengehörige
Zeichnungselemente oder Objekte gezeichnet sind. Die Zusammenfassung einzelner
Objekte zu Objektgruppen mit Hilfe der Layer-Technik stellt einen grundlegenden
Schritt für die spätere Simulation dar. Die Anzahl der Objekte innerhalb einer Gruppe
sollte dabei der Fertigungsmenge je gewählter Zeiteinheit entsprechen (
[10] S. 87).
Die ,,Gruppierung" der Objekte erfordert bei vorliegenden 3D-Modellen des Archi-
tekten ggf. eine Überarbeitung, weil der Aufbau des Modells den gleichen Methoden
unterliegen soll, die auch mit der tatsächlichen Bauausführung assoziiert werden.
Dementsprechend müssen beispielsweise Gebäude, die in Taktfertigung hergestellt
werden, zunächst in Fertigungsabschnitte unterteilt werden.
Ein vorliegendes Gebäudemodell muß des weiteren um nicht vorhandene
Geometrien ergänzt werden. Krane, Be und Entladezonen sowie andere Objekte
der Baustelleneinrichtung, sind in der Regel nicht Teil eines Architektenmodells,
spielen aber bei der Abwicklung von Bauarbeiten eine große Rolle (
[6] S. 26). Viele
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
13
CAD-Anwendungsprogramme bieten die Möglichkeit zur Anbindung von Objekt-
bibliotheken für die Gegenstände der Baustelleneinrichtung an.
In vielen Fällen reicht die Anzahl der dargestellten Objekte nicht aus, um alle
erwünschten Vorgänge zu simulieren. Beispielsweise liegen in einem architekt-
onischen 3D-Modell selten Geometrien für Entwässerungskanal- und Abwasser-
installationsarbeiten, oder auch die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) vor. Um
mit der BFS später aufzuzeigen, wo und wann diese Arbeiten geplant sind, können
hierfür farblich gekennzeichnete Decken- oder Bodenareale verwendet werden (
[6]
S. 22, S. 26). Reicht diesbezüglich die Kennzeichnung vorhandener Objekte nicht
aus, müssen hier Geometrien, etwa in Form von transparenten Volumenkörpern o.
ä., ergänzt werden. Diese Objekte erscheinen in der BFS dann nur in dem den
Vorgang betreffenden Zeitraum.
Einzelne Objekte oder ganze Modelle können auch zu detailliert dargestellt sein. Ein
Modell, das zu viele graphische Informationen enthält, benötigt unter Umständen zu
viel Rechenkapazität und beeinflußt die Abbildung der Simulation oder deren
Geschwindigkeit. Der erforderliche Detaillierungsgrad des 3D-Modells ist davon
abhängig, in welchem Maße der Bauablauf für die BFS aufgeschlüsselt werden soll,
d. h. welche Simulationsschritte gezeigt werden sollen. Für die prinzipielle
Darstellung eines Arbeitstaktes könnte z. B. ein Treppenhauskern vereinfacht als
Quader modelliert werden, während bei der Darstellung von Schalarbeiten zu diesem
Zweck zunächst alle Wände des Treppenhauses modelliert werden müßten. Je nach
dem worauf beim Bauablauf der Fokus gerichtet ist, fällt der Detaillierungsgrad also
unterschiedlich aus. Ein einfaches schematisch aufgebautes Modell kann in
manchen Fällen ebenso nützlich sein, wie ein detailgetreues und vielschichtig
aufgebautes Modell. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang der Zeitaufwand zu
berücksichtigen: Je größer der Detaillierungsgrad ist, desto länger dauert die
Modellierung (
[18] S. 238).
Die Erstellung des 3D-Modells einschließlich aller erforderlichen Geometrien und der
Konfiguration der erforderlichen Zeichnungsebenen beansprucht den größten
Zeitaufwand bei der 4D-Modellierung.
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
14
3.3
Der Bauzeitenplan als 4D-Komponente
Der Bauzeitenplan zeigt den Bauablauf als zeitliche Abfolge aller für ein
Bauvorhaben notwendigen Teilleistungen. Er wird vom ausführenden Unternehmen
zunächst als grober Ablaufplan erstellt und mit der fortschreitenden Arbeits-
vorbereitung konkretisiert. In dieser Grobablaufplanung wird das Bauwerk in
Bauabschnitte unterteilt und die hierfür erforderlichen Ausführungszeiträume in
einem terminlichen Rahmen festgelegt. Auf der Grundlage des Grobterminplans wird
nach der Vorlage der endgültigen Ausführungspläne ein Feinterminplan entwickelt,
der die Arbeitspakete der Bauabschnitte bis hin zu einzelnen Arbeitsvorgängen
zergliedert. Der Grobterminplan umfaßt die gesamte Bauzeit, während der
Feinterminplan sich auf kleinere überschaubare Zeiträume bezieht. Die Bauzeit-
planung kann auf verschiedene Arten dargestellt werden, wobei der Bauablauf
entweder in Form eines gerichteten, endlichen und kreisfreien Graphen (Netzplan)
oder im Bezug zu einer Zeitskala (Balkendiagramm, Liniendiagramm), abgebildet
wird.
Für die Erstellung von Bauzeitenplänen sind mittlerweile vielzählige Termin-
planungsprogramme entwickelt worden, mit deren Hilfe sich komplexe und
umfangreiche Bauabläufe bequem über die Zeit darstellen lassen. Diese Software-
lösungen bieten auch die Möglichkeit der problemlosen Nachbearbeitung bei
eventuellen Veränderungen während der Bauzeit. Viele Anwendungsprogramme
beinhalten überdies auch Funktionen zur automatischen Ressourcenzuweisung zu
den Vorgängen. Ebenso gehören Überwachungs- und Kostenanalysefunktionen zu
den gängigen Programmpaketen.
Die EDV gestützte Ablaufplanung ergänzt das 3D-Modell um die Informationen der
Zeit, als so verstandene vierte Dimension.
In Abhängigkeit von seinem Detaillierungsgrad zerlegt der Bauzeitenplan die
Projektgeometrie in die Bauteile, die für die Erstellung eines Bauabschnittes, die
Ausführung einer Ablaufstufe oder eines Arbeitsvorganges relevant sind. Der
erwünschte Genauigkeitsgrad der BFS bestimmt hierbei, wie feingliedrig der
Arbeitsfortschritt durch den Terminplan festgelegt werden muß. In der einschlägigen
Literatur wird in diesem Zusammenhang von ,,Breakdown-key", der Aufschlüsselung
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
15
des Bauablaufs gesprochen. Eine mögliche Aufschlüsselungsmethode zeigt
Abbildung 1.
x x x x - x x x x
Abbildung 1: Breakdown-key (in Anlehnung an
[6]
S. 20)
Dabei ist die Projektgeometrie in Bauabschnitte, Stockwerke, Fertigungsabschnitte
innerhalb der Stockwerke, sowie in untergeordnete Arbeitsabschnitte innerhalb der
vorgenannten Fertigungsabschnitte unterteilt.
Weiterhin bedeuten bezüglich der Terminplanstruktur im Einzelnen:
Ablaufstufe
Dem Gesamtablauf untergeordneter Teilablauf;
Bsp.: Gründung, Rohbau der aufgehenden Konstruktion
Einzelablauf
Der Ablaufstufe untergeordneter Teilablauf;
Bsp.: Betondeckenherstellung, Herstellung von Betonstützen.
Arbeitsvorgang
Dem Einzelablauf untergeordneter Arbeitsvorgang;
Bsp.: Bewehren, Einschalen.
Arbeitsvorgangstufe
Dem Arbeitsvorgang untergeordneter Teilvorgang;
Bsp.: Biegen von Bewehrungseisen, Schalhaut ölen.
Bauabschnitt
Stockwerk
Fertigungsabschnitt
Arbeitsabschnitt
Ablaufstufe
Einzelablauf
Arbeitsvorgang
Arbeitsvorgangstufe
Projektgeometrie
Terminplanung
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
16
Durch die Kombination eines Strukturelements aus der Aufschlüsselung des
Bauzeitenplans mit dem jeweiligen Strukturelement der aufgeschlüsselten Projekt-
geometrie wird ein Simulationsschritt erzeugt. Dabei wird durch die Visualisation
einer Ablaufstufe je Bauabschnitt der prinzipielle Grobablaufplan veranschaulicht.
Hingegen bildet die Simulation eines Arbeitsvorganges je Fertigungsabschnitt den
Bauablauf auf der Grundlage eines Feinterminplans ab. Nicht jede Aktivität auf der
Baustelle paßt exakt in dieses Schema. Beispielsweise lassen Stahlstützen, die in
einem Erdgeschoß errichtet werden sollen und sich über zwei Stockwerke
erstrecken, den Arbeitsvorgang ,,Errichten der Stahlstützen" im 1. OG überflüssig
werden.
Letztendlich ist eine Aufschlüsselungsmethode jedoch sehr nützlich, um ein 4D-
Modell entsprechend dem erwünschten Detaillierungsgrad zu strukturieren und
aufwendige Nachbearbeitungen zu vermeiden.
3.4
Die Verbindung der Komponenten Das 4D-Modell
Bei der Erstellung eines 3D-Modells wird mit jedem modellierten Objekt eine
Ansammlung von Datensätzen, die alle geometrischen und nichtgeometrischen
Eigenschaften beschreiben, in einer Datenbankstruktur hinterlegt. Ebenso verfährt
eine Terminplanungs-Software um alle Informationen, die sämtliche Vorgänge
betreffen, abzuspeichern. Mit dem Import der Daten aus den Anwendungs-
programmen über die Schnittstellen des 4D-CAD-Anwendungsprogramms
(4D-Anwendung), stehen alle erforderlichen Datensätze zur Verfügung, um die
Komponenten zu einem 4D-Modell zu verbinden.
Innerhalb der 4D-Anwendungung kann auf verschiedene Weise auf die Datensätze
zugegriffen werden. So können die abgespeicherten Informationen der
3D-CAD-Datei durch entsprechende Befehle nach bestimmten Attributen, wie z. B.
Farbe oder Material gefiltert und zusammengefaßt werden. Weiterhin können
Objekte durch deren Markierung per Mausklick gruppiert werden. Die auf diese
Weise zusammengefaßten Datensätze können unter einer vom Anwendungs-
programm einmalig vergebenen Identifikationsnummer, als übergeordneter Daten-
satz, zwischengespeichert oder direkt mit den Daten der Terminplanungs-Software
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
17
verbunden werden. Die getroffene Auswahl an Daten wird in diesem Fall unmittelbar
mit den Informationen eines oder mehrerer Vorgänge, erneut als Verknüpfung,
eindeutig abgespeichert. Die vorgenannten Verfahrensweisen zur Gruppierung von
Objekten entsprechen einem ,,semiautomatischen" Vorgehen. Hierbei ist nicht
erforderlich, daß in den 3D-Anwendungen auf verschiedenen Zeichenebenen
gearbeitet wird. Diese Verfahrensweise ist jedoch gerade bei detaillierten Modellen,
oder bei einer großen Anzahl von Vorgängen im Bauzeitenplan, relativ mühsam. Die
Strukturen sind hier nicht aufeinander abgestimmt und viele Objekte sind zunächst
nicht eindeutig zu identifizieren. Hingegen werden bei der Verwendung der Layer-
Technik zusammengefaßte Datensätze bereits in die 4D-Anwendung importiert.
Diese können als geordnete Datenpakete den entsprechenden Informationen des
Bauzeitenplans zugewiesen werden.
Eine weitere und durchaus bequemere Methode der Komponentenverknüpfung
besteht in dem automatischen Abgleich von zugehörigen Datensätzen aus der
Terminplanungssoftware und der 3D-Anwendung. Bei diesem automatischen Ver-
knüpfungsverfahren werden die zusammengehörigen Vorgänge und Geometrien, an
einer bestimmten Stelle ihrer jeweiligen Datenstruktur, mit den gleichen
Informationen, etwa in Form einer Schlüsselnummer, versehen. Durch die
Anweisung übereinstimmende Datensätze an diesen Stellen erneut zusammen-
zufassen, entsteht so eine automatische Komponentenverknüpfung. Gerade
bezüglich der automatischen Verknüpfung ist die Verwendung des im voran-
gegangenen Unterkapitels erläuterten ,,Breakdown-key" nützlich, da die Strukturen
der Komponenten hier schon während ihrer Erstellung gegliedert und aufeinander
abgestimmt werden. Die Verknüpfung und das daraus resultierende 4D-Modell
bedarf dann oft nur noch einer entsprechenden Programmaufforderung, weil jeder
Vorgang eindeutig zu den entsprechenden Bauteilobjekten zugeordnet ist. Abbildung
2 verdeutlicht den prinzipiellen Aufbau eines 4D-Modells im Kontext der
Komponentenaufschlüsselung.
Die Verbindung der Komponenten durch die beschriebene Vorgehensweise wird als
,,linking-Methode" (to link - engl. für verbinden oder vernetzen) bezeichnet und
repräsentiert die Verknüpfungsoptionen der heute erhältlichen 4D-Anwendungen. Die
weiterführende Forschung auf dem Gebiet der 4D-Technologie befaßt sich derzeit
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
18
unter anderem mit der Entwicklung von Methoden zur automatischen Generierung
von 4D-Modellen, jedoch ist diese Technik zu dem heutigen Zeitpunkt unausgereift.
Abbildung 2: Der Entwicklungsprozeß eines 4D-Modells über den
Weg der Komponentenaufschlüsselung (Breakdown-key )
Nach der Verknüpfung ist jede Objektgruppe mit einem Start- und Endtermin
versehen, d. h. die 4D-Anwendung ,,weiß" über welchen Zeitraum die Objektgruppe
in der Simulation graphisch verarbeitet wird. Hierbei können nun alle Modellobjekte in
ihrer Start- bzw. Enddarstellung definiert werden. Auf diese Weise werden
Aufgabentypen festgelegt, die mit den jeweiligen Objektgruppen assoziiert werden.
Beispielsweise wird die Erscheinung eines zu errichtenden Bauteils als transparent
definiert, um die andauernde Herstellung über die entsprechende Vorgangsdauer zu
visualisieren. Nach Ablauf der Vorgangsdauer wird es in seiner Modelldarstellung
abgebildet das Bauteil ist nun fertiggestellt. Im Umkehrschluß können zurück zu
bauende oder abzubrechende Bauteile von ihrem Startzeitpunkt an in ihren vor-
3D-CAD-Anwendungs-
programm
Terminplanungs
- Software
4D-CAD-Anwendungsprogramm
4D-Modell, BFS
EDV gestützter
Ablaufplan
3D-Modell
Entwurfszeichnungen
Bauablaufplanung
Breakdown
-key
Direkter Weg
Indirekter Weg
Bauaufgabe
Die technischen Anforderungen an die 4D-Komponenten und deren Verknüpfung
19
definierten Modelldarstellungen abgebildet werden. Nach Ablauf des verknüpften
Vorgangs werden sie in der Simulation verdeckt dargestellt, d. h. sie sind nicht
sichtbar. In der Fachliteratur wird die Definition der Start- bzw. Enddarstellung als
,,Postmanipulation" der Objekterscheinung bezeichnet (
[4] S. 208). Diese
Bezeichnung beschreibt den Sachverhalt nicht exakt, da die Festlegung von
Aufgabentypen, in ähnlicher Weise wie die automatische Komponentenverknüpfung,
über die Programmaufforderung zum Abgleich vordefinierter Datensätze erfolgen
kann. Entsprechen diese Aufgabentypen den hierfür vorgesehenen Standard-
einstellungen der 4D-Anwendung, ist die Objekterscheinung automatisch definiert.
Bei der Verknüpfung der Komponenten können vielerlei Ursachen zu Problemen
führen. In manchen Fällen ist die Geometrie in einer Art und Weise definiert, die im
Widerspruch zu der Aufschlüsselung des Zeitplans steht. So können Geometrien in
dem 3D-Modell fehlen oder es wurde für einige Objekte kein Vorgang angelegt (
[6]
S. 24 ff). Des weiteren können Objekte auch auf den falschen Layern gezeichnet
sein. Die meisten Ursachen fehlerhafter Verknüpfungen der 4D-Komponenten lassen
sich bei der Überprüfung der Simulation allerdings erahnen und mit wenigen
Mausklicks beheben.
Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Erstellung von 4D-Modellen wird in
Kapitel 5 anhand eines Fallbeispieles verdeutlicht.
Die Einführung eines Beispielprojektes
20
4 Die Einführung eines Beispielprojektes
In der weiteren Ausarbeitung der vorliegenden Diplomarbeit wird die Erstellung eines
4D-Modells, unter Verwendung von ausgewählten Anwendungsprogrammen, anhand
eines Fallbeispiels konkretisiert. Zu diesem Zweck wird in diesem Kapitel ein
Beispielprojekt aus der Literatur zur Arbeitsvorbereitung (
[17] S.133 ff) eingeführt.
Das Projekt umfaßt den Neubau eines Bürogebäudes, das aus einer Tiefgarage,
sowie Erdgeschoß, 5 Obergeschossen und Dachaufbauten für Aufzugsüberfahrten
und Technikräumen besteht. Das Bürogebäude soll in einer frühen Entwicklungs-
phase eines neu angelegten Industriegebietes gebaut werden, das zu diesem
Zeitpunkt großzügige Platzverhältnisse für die Umsetzung des Bauvorhabens bietet.
Das Baugelände ist über eine bereits angelegte Stichstraße zugänglich und bietet
genügend Raum für die Ausführung einer geböschten Baugrube sowie ausreichend
Platz für eine geeignete Baustelleneinrichtung.
Das Bürogebäude erstreckt sich entlang der Stichstraße über rund 100 m und 25 m
senkrecht dazu. Einschließlich seiner Dachaufbauten wird das Gebäude in eine Höhe
von rund 25 m über das vorhandene Geländeniveau gebaut. Der Entwurf ist durch
vier vorspringende Baukörper, den sogenannten ,,Fingern", die im Bezug zur
Mittelachse des Gebäudes symmetrisch angeordnet sind, gekennzeichnet. Die
Fassade wird durch eine Kombination von straßenseitigen Metallverkleidungen in
den Bereichen zwischen den Fingern sowie einem Wärmedämm-Verputzsystem in
den übrigen Bereichen gestaltet. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine
weiträumige, sich über zwei Stockwerke erstreckende, Eingangshalle, die im
mittleren Gebäudebereich gelegen ist. Die Halle wird als Stahl-Glas-Konstruktion
ausgeführt, und ist von der Stichstraße aus über einen Vorplatz erreichbar. Die
Tiefgarage überragt die Gebäudeumrisse der aufgehenden Geschosse um ca. 20 m.
Die Erschließung der Garage erfolgt über eine zweispurige Rampe, die an den
Wendehammer der Stichstraße angeschlossen wird.
Die Fertigung des Bürogebäudes soll in zwei Bauabschnitten (BA) erfolgen, wobei
die Auftragsvergabe für den 2. BA erst im Anschluß an die Fertigstellung der
Rohbauarbeiten des 1. BA erfolgt.
Die Einführung eines Beispielprojektes
21
Die folgenden Abbildungen zeigen den Gebäudeentwurf in Grundrissen (Planraster
2,60/2,60 m) und Schnitt sowie den Lageplan. Die BA werden in den Abbildungen als
Etappe bezeichnet.
Abbildung 3: Lageplan des Bürogebäudes (aus
[17] S. 134)
Abbildung 4: Schnitt A-A des Bürogebäudes (aus
[17] S. 134)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832493035
- ISBN (Paperback)
- 9783838693033
- DOI
- 10.3239/9783832493035
- Dateigröße
- 5.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Bauwissenschaften, Baubetrieb und Bauwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- baufortschritt animation bauablaufplanung
- Produktsicherheit
- Diplom.de