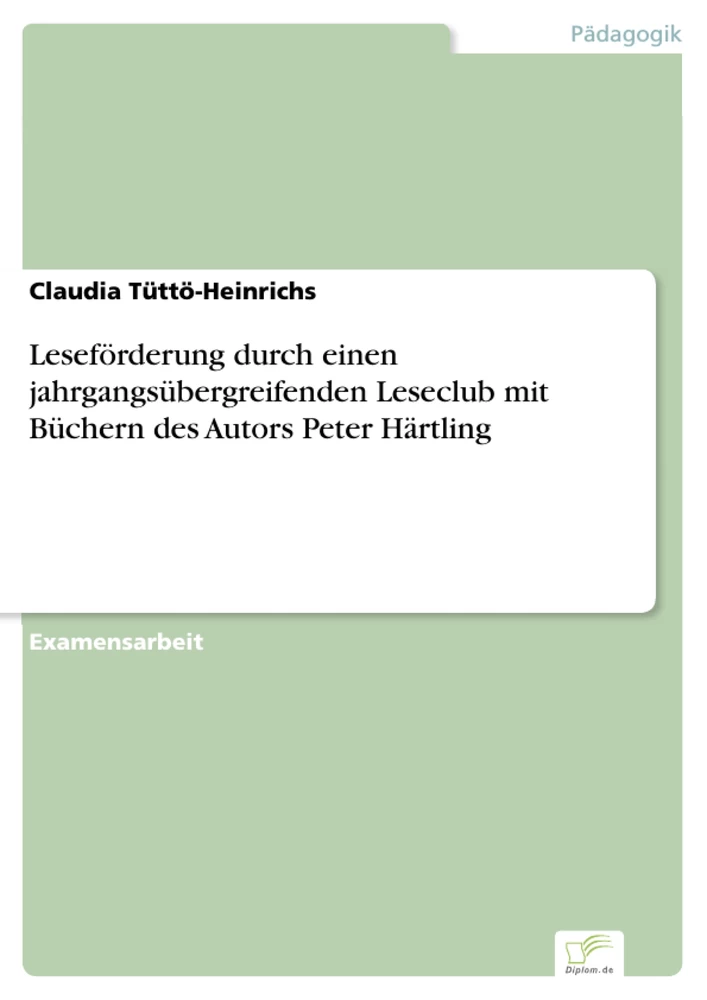Leseförderung durch einen jahrgangsübergreifenden Leseclub mit Büchern des Autors Peter Härtling
©2003
Examensarbeit
60 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Nicht erst seit PISA und IGLU ist Leseförderung in aller Munde. Lesen ist in der heutigen Medienwelt die wichtigste Kulturtechnik geworden. Leider lässt sich feststellen, dass viele Schüler in der Freizeit nicht mehr lesen. Das schulische Lesen bedeutet für sie Anstrengung und Benotung.
Die Schüler sollten jedoch dazu motiviert werden, zu lesen. Sie sollen erkennen, dass Lesen und die Beschäftigung mit Literatur Spaß machen kann. Aus diesem Grund hat sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit für das Thema Leseförderung entschieden. Kann man heute nicht Lesen, so führt das schnell zu Problemen im Alltag, im Beruf und in der Freizeit. Lesen muss man lernen und auch immer wieder üben und fördern.
Die vorliegende Staatsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Leseförderung durch einen Leseclub in der Schule.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Bedeutung des Lesens auf die Persönlichkeit des Lesers erläutert. Anschließend folgt eine kurze Darstellung über die Medienausstattung und nutzung heutiger Jugendlicher sowie Wirkungen der Medien auf ihre Konsumenten.
Im weiteren Verlauf wird erläutert, welche Faktoren bezüglich der Lesesozialisation auf den Leser einwirken und von Bedeutung sind. Der letzte Punkt des ersten Teils geht auf Leseförderung und deren Maßnahmen in Schule, Elternhaus und Gesellschaft ein.
Im zweiten Teil der vorliegenden Staatsarbeit wird der Verlauf einer Arbeitsgemeinschaft beschrieben. In einer Grundschule wurde im 3. und 4. Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft Leseclub eingerichtet, an der die Schüler freiwillig teilnehmen konnten. Die Schüler beschäftigten sich in der Zeit von Februar bis Juli 2003 mit dem Kinderbuchautor Peter Härtling, der auch Bücher für Erwachsene geschrieben hat. In einer Art Projekt arbeiteten die Schüler individuell zu verschiedenen Werken Härtlings und präsentierten diese in einer abschließenden Ausstellung.
Die vorliegende Arbeit beschreibt schulische und organisatorische Voraussetzungen für die Arbeitsgemeinschaft und stellt didaktisch- methodische Überlegungen an. Die Arbeit dokumentiert und reflektiert die Arbeit des Leseclubs.
Der Schluss der vorliegenden Arbeit reflektiert die Arbeitsgemeinschaft Leseclub und stellt Überlegungen und Folgerungen für die weitere pädagogische Arbeit in der Zukunft an.
Auf Grund des Datenschutzes wurden in der vorliegenden Arbeit alle persönlichen Namen durch *** gekennzeichnet. Der Anhang, der zum größten Teil aus Fotos und privatem […]
Nicht erst seit PISA und IGLU ist Leseförderung in aller Munde. Lesen ist in der heutigen Medienwelt die wichtigste Kulturtechnik geworden. Leider lässt sich feststellen, dass viele Schüler in der Freizeit nicht mehr lesen. Das schulische Lesen bedeutet für sie Anstrengung und Benotung.
Die Schüler sollten jedoch dazu motiviert werden, zu lesen. Sie sollen erkennen, dass Lesen und die Beschäftigung mit Literatur Spaß machen kann. Aus diesem Grund hat sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit für das Thema Leseförderung entschieden. Kann man heute nicht Lesen, so führt das schnell zu Problemen im Alltag, im Beruf und in der Freizeit. Lesen muss man lernen und auch immer wieder üben und fördern.
Die vorliegende Staatsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Leseförderung durch einen Leseclub in der Schule.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Bedeutung des Lesens auf die Persönlichkeit des Lesers erläutert. Anschließend folgt eine kurze Darstellung über die Medienausstattung und nutzung heutiger Jugendlicher sowie Wirkungen der Medien auf ihre Konsumenten.
Im weiteren Verlauf wird erläutert, welche Faktoren bezüglich der Lesesozialisation auf den Leser einwirken und von Bedeutung sind. Der letzte Punkt des ersten Teils geht auf Leseförderung und deren Maßnahmen in Schule, Elternhaus und Gesellschaft ein.
Im zweiten Teil der vorliegenden Staatsarbeit wird der Verlauf einer Arbeitsgemeinschaft beschrieben. In einer Grundschule wurde im 3. und 4. Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft Leseclub eingerichtet, an der die Schüler freiwillig teilnehmen konnten. Die Schüler beschäftigten sich in der Zeit von Februar bis Juli 2003 mit dem Kinderbuchautor Peter Härtling, der auch Bücher für Erwachsene geschrieben hat. In einer Art Projekt arbeiteten die Schüler individuell zu verschiedenen Werken Härtlings und präsentierten diese in einer abschließenden Ausstellung.
Die vorliegende Arbeit beschreibt schulische und organisatorische Voraussetzungen für die Arbeitsgemeinschaft und stellt didaktisch- methodische Überlegungen an. Die Arbeit dokumentiert und reflektiert die Arbeit des Leseclubs.
Der Schluss der vorliegenden Arbeit reflektiert die Arbeitsgemeinschaft Leseclub und stellt Überlegungen und Folgerungen für die weitere pädagogische Arbeit in der Zukunft an.
Auf Grund des Datenschutzes wurden in der vorliegenden Arbeit alle persönlichen Namen durch *** gekennzeichnet. Der Anhang, der zum größten Teil aus Fotos und privatem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9294
Tüttö, Claudia: Leseförderung durch einen jahrgangsübergreifenden Leseclub mit
Büchern des Autors Peter Härtling
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Amt für Lehrerausbildung, Staatsexamensarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Leseförderung durch einen jahrgangsübergreifenden Leseclub mit Büchern
des Autors Peter Härtling
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
...1
Teil I: Ergebnisse der Leseforschung
...2
1. Die Kulturtechnik Lesen...2
1.1 Bedeutung des Lesens in der Gesellschaft...2
1.2 Bedeutung des Lesens für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit...3
1.2.1 Erweiterung kognitiver Strukturen...3
1.2.2 Förderung von Fantasie und Kreativität...3
1.2.3 Förderung von Individualität und Identität...4
1.2.4 Erweiterung der sozialen Kompetenz...4
1.2.5 Erweiterung der sprachlichen Kompetenz...5
1.2.6 Verfügbarkeit von Wissensstrukturen...6
1.3 Schlussfolgerungen...6
2. Leseverhalten in der Medienumwelt...6
2.1 Medienausstattung von Kindern und Jugendlichen...7
2.2 Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen...8
2.3 Medienwirkungen...10
3 Lesesozialisation...11
3.1 Lesesozialisation in der Familie...11
3.2 Lesesozialisation in der Schule...13
3.3 Lesefähigkeiten und Lesegewohnheiten von Kindern und
Jugendlichen ...14
4 Pädagogische Schlussfolgerung: Leseförderung als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe...15
4.1 Leseförderung in der Familie...16
4.2 Leseförderung in der Schule...17
4.3 Leseförderung als gesellschaftspolitische Aufgabe...19
Teil II: Der Leseclub als möglicher Teil der schulischen
Leseförderung
...20
1. Bedeutung des Leseclubs für die schulische Leseförderung...20
2. Legitimation des Leseclubs durch den Hessischen Rahmenplan ...21
3. Schulische Voraussetzungen der *** Schule...23
3.1 Leseverhalten der Schüler...23
3.2 Mediothek...26
3.3 Bücher- und Lesesituation in den Klassen...27
3.4 Leseaktionen an der Schule...27
3.5 Zusammenfassung...28
4. Konzept der Arbeitsgemeinschaft Leseclub...29
4.1 Didaktisch- methodische Überlegungen...29
4.2 Ziele der Arbeitsgemeinschaft...35
4.3 Organisatorische Voraussetzungen...36
4.4 Auswahl der teilnehmenden Schüler...36
4.5 Planung der AG bis zu den Sommerferien...37
4.6 Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen...37
5. Durchführungsphase der AG...38
5.1 Gründung des Leseclubs und organisatorisches Vorgespräch...38
5.2 Vorstellung der Lieblingsbücher...40
5.3 Wir suchen einen Clubnamen, entwerfen ein Logo und basteln
ein Lesezeichen...41
5.4 Einführung in die Mediothek...42
5.5 Wir stöbern in der Mediothek und stellen interessante Literatur vor...43
5.6 Wir sind die Bücherdetektive und entwerfen einen
Fragenkatalog für Mitschüler...44
5.7 Lesenachmittage...44
5.8 Projektarbeit zu Peter Härtling...45
5.9 Ausstellung zu Peter Härtlings Werk...47
6. Zusammenfassung und Ausblick...49
6.1 Zusammenfassung der Arbeitsgemeinschaft und
Anschlussmöglichkeiten...49
6.2 Ausblick und Folgerungen für die weitere pädagogische Arbeit...52
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Auf Grund des Datenschutzes wurden in der vorliegenden Arbeit alle persönlichen
Namen durch *** gekennzeichnet. Der Anhang, der zum größten Teil aus Fotos und
privatem Material besteht, wird nicht veröffentlicht.
Diese Veränderungen beeinträchtigen die Qualität und das Verständnis der Arbeit
nicht.
1
Einleitung
Nicht erst seit PISA und IGLU ist Leseförderung in aller Munde. Lesen ist in der heutigen
Medienwelt die wichtigste Kulturtechnik geworden. Leider lässt sich feststellen, dass viele
Schüler in der Freizeit nicht mehr lesen. Das schulische Lesen bedeutet für sie Anstrengung
und Benotung.
Die Schüler sollten jedoch dazu motiviert werden, zu lesen. Sie sollen erkennen, dass Lesen
und die Beschäftigung mit Literatur Spaß machen kann. Aus diesem Grund hat sich die
Verfasserin der vorliegenden Arbeit für das Thema Leseförderung entschieden. Kann man
heute nicht Lesen, so führt das schnell zu Problemen im Alltag, im Beruf und in der Freizeit.
Lesen muss man lernen und auch immer wieder üben und fördern.
Die vorliegende Staatsarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Leseförderung durch einen
Leseclub in der Schule.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Bedeutung des Lesens auf die Persönlichkeit des Lesers
erläutert. Anschließend folgt eine kurze Darstellung über die Medienausstattung und nutzung
heutiger Jugendlicher sowie Wirkungen der Medien auf ihre Konsumenten.
Im weiteren Verlauf wird erläutert, welche Faktoren bezüglich der Lesesozialisation auf den
Leser einwirken und von Bedeutung sind.
Der letzte Punkt des ersten Teils geht auf Leseförderung und deren Maßnahmen in Schule,
Elternhaus und Gesellschaft ein.
Im zweiten Teil der vorliegenden Staatsarbeit wird der Verlauf einer Arbeitsgemeinschaft
beschrieben. In einer Grundschule wurde im 3. und 4. Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft
Leseclub eingerichtet, an der die Schüler
1
freiwillig teilnehmen konnten. Die Schüler
beschäftigten sich in der Zeit von Februar bis Juli 2003 mit dem Kinderbuchautor Peter
Härtling, der auch Bücher für Erwachsene geschrieben hat. In einer Art Projekt arbeiteten die
Schüler individuell zu verschiedenen Werken Härtlings und präsentierten diese in einer
abschließenden Ausstellung.
Die vorliegende Arbeit beschreibt schulische und organisatorische Voraussetzungen für die
Arbeitsgemeinschaft und stellt didaktisch- methodische Überlegungen an. Die Arbeit
dokumentiert und reflektiert die Arbeit des Leseclubs.
Der Schluss der vorliegenden Arbeit reflektiert die Arbeitsgemeinschaft Leseclub und stellt
Überlegungen und Folgerungen für die weitere pädagogische Arbeit in der Zukunft an.
1
Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit bezeichnet die männliche Bezeichnung auch die weibliche Form.
2
Teil I: Ergebnisse der Leseforschung
In den letzten Jahren hat es immer wieder verschiedene Untersuchungen bezüglich des
Lesens, der Leser und des Leseverhaltens gegeben. Trotzdem lassen sich eindeutige
Ergebnisse nur schwer ausmachen, zu einem einheitlichen Ergebnis ist man nicht gekommen.
1. Die Kulturtechnik Lesen
Das Lesen lässt sich in zwei unterschiedliche Formen unterteilen:
a) das funktionale Lesen
Lesen lässt sich hier als Kulturtechnik verstehen, die dem Leser hilft, sich in der Welt zurecht
zu finden. Lesen dient dabei als Werkzeug zum Denken. Kann man in der heutigen
Informationsgesellschaft nicht lesen, so wird man schnell zum Außenseiter (vgl.
www.hanspeter.stalder.ch/Lesesymposium.html
), weil notwendige Informationen ausbleiben.
b) die literarische Art des Lesens
Lesen kann uns unterhalten. Es kann uns mit Bildern und Sinnbildern erfüllen, kann Sinn
schaffen, Normen und Werte vermitteln (vgl.
www.hanspeter.stalder.ch/Lesesymposium.html
).
Lesen beinhaltet aber nicht nur das Aneinanderreihen von Buchstaben. Lesen bedeutet immer
auch Sinnentnahme und Verstehen (vgl.
www.dagmarwilde.de/fuergebnisse/lesenist.html
).
Lesen geschieht größtenteils vereinzelt, selten wird vorgelesen oder gemeinsam gelesen.
Lesen erfordert Anstrengung (vor allem beim Decodieren der Zeichen) und ist abhängig von
innerer Motivation und der Bereitschaft etwas zu leisten (vgl.
www.sub.uni-
hamburg.de/disse/18/pub4.html
).
1.1 Bedeutung des Lesens in der Gesellschaft
Lesen bezeichnet eine der wichtigsten Kulturtechniken der Menschheit. Das Lesen gehört
nicht zur Grundausstattung des Menschen. Er erwirbt es in einem langen Lern- und
Entwicklungsprozess. Der Mensch lernt, Zeichen und Symbole zu decodieren und zu
verstehen. Mit der Entstehung der Schriftsprache und der Entwicklung des Lesens ist der
Menschheit ein riesiger Schritt gelungen.
In der heutigen Zeit der Medienvielfalt ist das Lesen zu einer nicht mehr wegzudenkenden
Kulturtechnik geworden. Nicht allein die Nutzung der Computer und des Internets macht die
Kulturtechnik Lesen unverzichtbar (vgl. Hurrelmann in: Friedrich Verlag1998, Seite 3).
3
1.2 Bedeutung des Lesens für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit
Der Mensch wird durch das Lesen in vielfältiger Weise beansprucht. Viele Stellen des
Gehirns werden aktiviert, verschiedene Arten von Entwicklungen werden angeregt (vgl.
Weber in: Beisbart 1993, Seite 11). Durch das Lesen werden viele Fähigkeiten des Menschen
gefordert und gefördert. So fördert das Lesen unter anderem Konzentration und Ausdauer und
das ,,Sortieren und Einordnen individueller Erfahrungen in zeitgenössische und historische
Zusammenhänge."
2
Das Lesen bildet Qualifikationen aus, die notwendig sind, um sich in einer demokratischen
Gesellschaft zu einer selbstbestimmten und mitbestimmenden Persönlichkeit zu entwickeln
und dabei Mitbestimmung und Mitverantwortung zu tragen (vgl. Elsholz/ Lipowsky in:
Bertelsmann Stiftung 1995, Seite 10).
1.2.1 Erweiterung kognitiver Strukturen
Das Lesen lässt sich nicht als linearer, abbildhaft zu denkender Vorgang äußerer und innerer
Prozesse beschreiben. Vielmehr arbeitet der Leser vom Beginn seiner Leserbiographie an
aktiv an der Sinngebung eines Textes mit (vgl. Weber in: Beisbart 1993, Seite 16).
,,Kinderliteratur kann das Denken anregen."
3
Besitzt das Buch eine ansprechende Illustration,
so werden die kindlichen Leser zum genauen Beobachten, Vergleichen und Unterscheiden
angeregt. Sie wollen immer wieder neue Dinge kennen lernen und sich diese auch merken.
Dadurch entwickeln die Kinder die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und auch
Ursachen und Wirkungen in Beziehung zueinander zu bringen (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1).
Der Leser hat durch das Lesen die Möglichkeit, sich in andere Personen hineinzudenken, ihre
Wünsche, Empfindungen, Gedanken und Vorstellungen nachzuvollziehen (vgl. Elsholz/
Lipowsky in: Bertelsmann Stiftung 1995, Seite, Seite 11).
1.2.2 Förderung von Fantasie und Kreativität
Viele Bilderbücher, Comics, Märchen und überhaupt Kinderliteratur liefern Anregungen, mit
denen beim kindlichen Leser die Fantasie, schöpferisches Denken und die Gestaltungsfreude
gefördert werden. Das Kind wird ermuntert, selbst eigene Texte zu schreiben, Reime zu
bilden, mit Lauten zu spielen, Geschichten nachzuspielen und zu verändern. Viele Bilder aus
der Kinder- und Jugendliteratur bieten den Lesern die Möglichkeit sich Dinge vorzustellen,
die es in Wirklichkeit nicht gibt bzw. noch nicht gibt (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1).
2
Elsholz/ Lipowsky in: Bertelsmann Stiftung 1995, Seite 11.
3
Stiftung Lesen 1996, 3.1
4
Manche Geschichten haben einen offenen Schluss, der den Lesern die Möglichkeit bietet,
selbständig nach neuen Lösungen für Probleme zu suchen. ,,Kinder können durch
Bilderbücher erfahren, dass Menschen die Welt verändern und gestalten."
4
Die Förderung der
Fantasie und Kreativität der Kinder ist ihnen auch für ihr weiteres Leben sehr nützlich:
,,Kinder, die dazu ermuntert werden, ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken, ihre eigene
Meinung zu äußern... haben günstige Voraussetzungen, Anregungen aus der Kinderliteratur
aufzunehmen und ihre Eindrücke in Zeichnungen, Erzählungen, Erfindungen, plastischen
Gebilden oder in Rollenspielen zu verarbeiten."
5
1.2.3 Förderung von Individualität und Identität
Kinder- und Jugendliteratur bietet den Lesern immer wieder Figuren an, die zum
Identifizieren anregen. Die Leser versetzen sich in die Rolle der Protagonisten und nehmen
auf diese Weise aktiv am gelesenen Geschehen teil. ,,Der Lesende ist immer er selbst und
doch zugleich, selbstvergessend, ein anderer; er geht über in den anderen Horizont... ."
6
Zugleich bietet sich dem Leser jedoch auch die Möglichkeit, die Welt des Gelesenen wieder
zu verlassen und in die Realität zurückzukehren. Diesen Zeitpunkt kann der Leser selbst
bestimmen. Um die Individualität und Identität der Leser zu steigern, bieten Bücher oft
Lösungen für Probleme an. Bilderbücher vermitteln Einsichten und liefern die Anregung, sich
an Probleme heranzuwagen, nach eigenen Lösungsmöglichkeiten zu suchen und vorgegebene
Lösungen kritisch zu beurteilen. Kinderliteratur eröffnet den Lesern neue
Lösungsmöglichkeiten in bezug auf sachliche Probleme, Probleme des Zusammenlebens oder
auch der Gesellschaft (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1).
1.2.4 Erweiterung der sozialen Kompetenz
Die Kinder- und Jugendliteratur liefert oft Modelle für soziales Verhalten. Die kindlichen
Leser erhalten einen Überblick darüber, wie sich zum Beispiel das brave Kind richtig verhält.
Man erhält einen Einblick in ,,normales" Leben, also wie das Kind spielt, isst, schläft, sich
anzieht, gehorcht usw. In anderen Fällen erfährt das Kind, welche Konsequenzen es haben
kann, wenn es sich nicht an übliche Sitten assimiliert und sich abnorm verhält. Ein gutes
Beispiel für diese Art der Kinderliteratur, die sich mit Wert- und Normverstößen beschäftigt,
ist der Struwwelpeter (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1). Mit Hilfe dieser Literatur sollte vor
allem im 19. Jahrhundert Anpassung und Gehorsam durch Drohung und Gewalt erzwungen
4
Stiftung Lesen 1996, 3.1
5
Stiftung Lesen 1996, 3.1
6
Weber in: Beisbart 1993, Seite 17
5
werden. Die zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt sich dagegen immer
mehr mit Problemen, die aus dem Erfahrungsbereich und der Alltagswelt der Kinder
stammen. So werden in den Büchern immer wieder Probleme, wie zum Beispiel
Außenseiterrollen, körperliche Gebrechen, unerfüllte Wünsche nach Zuneigung und Liebe,
Arbeitslosigkeit und Trennung der Eltern angesprochen. Dadurch soll die Kommunikation
zwischen Kindern und Erwachsenen angeregt werden, sie sollen lernen, Verständnis für die
Anliegen des Anderen zu entwickeln. ,,Manche Bilderbücher zeigen, dass man lernen kann,
Konflikte auszusprechen, eigenes Verhalten durch Einsicht zu ändern und berechtigte
Ansprüche durchzusetzen."
7
Natürlich kann man nicht sagen, dass schon das Anschauen von
Bilderbüchern bzw. das Lesen von Kinderliteratur allein ausreicht, um zu helfen, Konflikte
gut zu lösen. Das hängt auch von der Einstellung der Erwachsenen, ihrem Umgang mit der
Literatur und ihren Kindern ab (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1).
1.2.5 Erweiterung der sprachlichen Kompetenz
Kinder erwerben ihre ersten Voraussetzungen für den Spracherwerb sehr früh, schon in der
Lallphase des Säuglings. Durch ihre Bezugsperson werden die Kinder angeregt, Sprache
nachzuahmen und mit ihr zu spielen. ,,Dieses Sprachbasteln lässt Kinder in allen Altersstufen
mit dem Wort- und Satzbau vertraut werden, hilft die Sprachphantasie und den Humor zu
entfalten und weckt auch die Fähigkeit zur Sprachkritik."
8
Junge Leser werden auch durch
Kinder- und Jugendliteratur zum schöpferischen Umgang mit Sprache angeregt.
Schon Bilderbücher ohne Text fördern die sprachliche Kompetenz der Kinder. Eltern bzw.
ältere Geschwister schauen mit dem Kind gemeinsam das Buch an, abgebildete Gegenstände,
Tiere oder Personen werden benannt. Auf diese Weise lernt das Kind, ,,Ding, Begriff und
Wort miteinander zu verknüpfen."
9
Durch die Anregung des Zuhörers, bzw. Mit- Erzählers
beginnt das Kind etwas später, eigene Geschichten zu den Büchern zu erfinden. Man sollte
Kinder nicht mit Bilderbüchern allein lassen, denn sie bekommen so keinerlei Anregungen
zum eigenständigen Erzählen (vgl. Stiftung Lesen 1996, 3.1).
Für die kindliche Sprachentwicklung sind Bilderbücher bis ins Grundschulalter sehr wichtig.
Bei erzählenden Texten sollte man auf bestimmte Kriterien achten, um den Kindern eine
anspruchsvolle Lektüre und alle möglichen Anregungen zu bieten. Die Texte sollten eine gute
sprachliche Qualität besitzen, dem Redefluss folgen, nicht zu viele unbekannte Begriffe
aufweisen (einige neue Begriffe bereichern jedoch den Wortschatz der Kinder!) und aus
7
Stiftung Lesen 1996, 3.1
8
Stiftung Lesen 1996, 3.1
9
Stiftung Lesen 1996, 3.1
6
einfachen Sätze entsprechend der kindlichen Redeweise bestehen. Außerdem regen
Wechselrede, Wiederholungen wichtiger Passagen und eingebaute Fragen das Kind ,,zum
Mitdenken, Mitsprechen und Mitgestalten an."
10
1.2.6 Verfügbarkeit von Wissensstrukturen
Mit Hilfe des Lesens können sich Schüler Informationen aller Art beschaffen und Wissen
aneignen. Sie erhalten die Möglichkeit, Zugänge zu fremden Kulturen, Wissensgebieten und
anderen schriftlich überlieferten Informationen zu finden. Sie können durch das Lesen die
Informationsbereitstellung von Büchern, CD- Roms, Zeitschriften und dem Internet effektiv
und effizient nutzen (vgl. Elsholz/ Lipowsky in: Bertelsmann Stiftung 1995, Seite 11).
Leider ist nur in wenigen Köpfen heutiger Jugendlicher verankert, dass man aus Büchern eine
Menge lernen kann, was für die Zukunft nützlich ist. Nur wenige Jugendliche sehen Lesen als
Erweiterung der Allgemeinbildung, Lernen für die Bewerbung, für Diktate oder für den guten
Sprachausdruck an. Durch Lesen lernt man die Welt kennen, kann Wortschatz und
Rechtschreibung verbessern (vgl. Schwarz in: FR 2003).
1.3 Schlussfolgerungen
Betrachtet man, welche Entwicklungen und Förderungen bezüglich der Persönlichkeit des
Lesers durch das Lesen hervorgerufen werden, so lässt sich feststellen, dass Lesen zu einer
der notwendigsten Qualifikationen unserer Zeit gehört. Diese Qualifikation ist in jeder Art
und Weise zu fördern. Menschen, die keine positive Erfahrung mit dem Lesen gemacht
haben, müssen diese in der Zukunft erleben.
In der heutigen Mediengesellschaft ist das Lesen zu einer nicht mehr wegzudenkenden
Fähigkeit geworden. Das Lesen ist für unser tägliches Leben, aber auch für Beruf und Freizeit
unverzichtbar geworden.
2. Leseverhalten in der Medienumwelt
Mittlerweile ist die Kindheit zu einer Medienkindheit geworden. Durch die Entwicklung
neuer Medien hat sich der familiäre Medienalltag entscheidend verändert. Noch nie hatten
Kinder eine solche Medienvielfalt wie heute (vgl. Stiftung Lesen 1996, 4.1).
Die erste Konfrontation zwischen Kindern und Medien erfolgt recht früh. Das stärkste
Medium ist hierbei wohl das Fernsehen, was gravierende Folgen haben kann:
,,Reizüberflutung, Verkümmerung der Phantasie, Rückgang eigener Aktivitäten wie Spiel und
10
Stiftung Lesen 1996, 3.1
7
Sport, Ängste, Aggressionen und mangelndes Abstraktionsvermögen"
11
sind nur einige
davon. Erfahrungen verschiedener Forschungen und auch die Kindergartenpraxis lassen ganz
einfach Folgendes feststellen: ,,Das Fernsehen ist schlecht- das Betrachten von Bilderbüchern
ist gut."
12
Man darf jedoch nicht vergessen, dass Kinder eigenständige Individuen sind. Sie setzen sich
selbständig mit ihrer Umgebung und auch ihrer Medienumgebung auseinander und sind nicht
nur zum Beispiel durch die Familie in ihrem Sozialisierungsprozess geprägt. Durch die
Beschäftigung mit Lektüre (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen) bekommen die Kinder einen
großen Vorteil für die Entwicklung ihrer Kreativität, Fantasie, Kommunikationsfähigkeit und
auch ihre Bildungsbereitschaft (vgl. Stiftung Lesen 1996, 4.1).
2.1 Medienausstattung von Kindern und Jugendlichen
Das Medienangebot und die Ausstattung an Medien hat in den letzten 30 Jahren einen
riesigen Zuwachs erfahren. Mittlerweile stehen für Kinder und Jugendliche nicht nur die
herkömmlichen audiovisuellen Medien wie Radio, Kassettenrekorder, Fernsehen, sondern
auch neue Medien wie Videorekorder, DVD- Player, Computer, Internet, Tele- und
Videospiele in großem Maße zur Verfügung (vgl. Stiftung Lesen 1996, Vorwort).
Auch das Angebot an Büchern und Zeitschriften ist ständig gewachsen, noch nie gab es eine
solche (Über-) Fülle an Büchern, noch nie wurde soviel gedruckt und verkauft wie heute. Man
findet eine Bücherschwemme und ständig steigende Verkaufszahlen. Trotz aller Fülle und
Verfügbarkeit der Bücher muss man sich aber die Frage stellen, ob alle Erst- und Neuauflagen
auch tatsächlich gelesen werden (vgl. Stiftung Lesen 1996, Vorwort).
Die Medienausstattung bietet den Nutzern eine Möglichkeit, ihre Informationsmöglichkeiten
durch Radio- und Fernsehprogramme und die Einführung anderer neuer elektronischer
Kommunikationstechniken zu erweitern. Dabei sollte man aber nicht die Gefahr aus den
Augen verlieren, dass sich vor allem nachfolgende Generationen nur noch einseitig am
elektronischen Medienangebot orientieren. Ihnen muss man immer wieder die Notwendigkeit
der Informationsbeschaffung durch Lesen verdeutlichen (vgl. Stiftung Lesen 1996, Vorwort).
Betrachtet man die Ausstattung an Büchern, so lässt sich feststellen, dass die Haushalte heute
über einen größeren Buchbestand als noch vor zehn Jahren verfügen. Durchschnittlich findet
man in Haushalten, in denen Jugendliche leben, 222 Bücher. Alarmierend ist jedoch, dass es
in jedem dritten Haushalt keine Kinder- und Jugendliteratur gibt und nur jeder zweite
11
Stiftung Lesen 1996, 4.1
12
Stiftung Lesen 1996, 4.1
8
Jugendliche eigene Bücher besitzt (vgl. Stiftung Lesen 1996, 1.3) Bei den Jugendlichen, die
Bücher besitzen, ist der Bestand oft so gering, dass er auf ein einzelnes Regalbrett passt (vgl.
Stiftung Lesen 1996, 1.4).
2.2 Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen
Anhand der Studie «Jugend und Medien» wurde das Medienverhalten von Kindern und
Jugendlichen heute im Vergleich zu dem früherer Generationen untersucht.
Die Studie weist darauf hin, dass das Medium Fernsehen mittlerweile seine Faszination des
Neuen, die es noch vor gut 30 Jahren hatte, verloren hat. Heute sind viele andere Medien, wie
zum Beispiel Videorekorder, DVD- Player, Musikanlagen, Computer und Internet auf dem
Vormarsch. Trotzdem ist das Fernsehen für die 12- 13jährigen das wichtigste Medium (vgl.
Stiftung Lesen 1996, 1.3).
Auch die Mobilität der Jugendlichen hat sich gesteigert, sie verbringen viel mehr Freizeit
außer Haus als zu Hause. Natürlich beeinträchtigt diese Mobilität auch das Lesen (vgl.
Stiftung Lesen 1996, 1.3).
Die Nutzung bestimmter Medien richtet sich vor allem nach den Eigenschaften, die ein
Medium mit sich bringt. Ein Medium mit vielen Eigenschaften ist dem Publikum wichtiger
als ein einseitiges Medium. Die Umfrage verdeutlicht, dass das Fernsehen für 80 % der
Befragten viele Eigenschaften mit sich bringt. Es ist unterhaltend, informativ, vielseitig und
ratgebend. Doch auch das Buch besitzt für einige Befragte viele Eigenschaften: es ist bildend,
es vermittelt Wissen, ist unterhaltend und interessant (vgl. Stiftung Lesen 1996, 1.3). Leider
wird aber ,,die Unterhaltungsfunktion von Büchern... von viel weniger Befragten
wahrgenommen, als die von Radio und Fernsehen"
13
. Das Buch besitzt ein großes Bildungs-
und Wissensimage. Das ist seine Stärke, kann aber auch für viele potentielle Leser eine
Hemmschwelle darstellen (vgl. Stiftung Lesen, 1996, 1.3). Aus diesem Grund ist es ,,in erster
Linie... Sache der Büchermacher, Buchverkäufer und Leseförderer, ihrem Publikum deutlich
zu machen, dass das Buch auch als Unterhaltungs- und Ratgeber- Medium nicht zweite Wahl
sein muss."
14
In einer weiteren Studie wurden Ende 1990 etwa 3600 Kinder im Alter zwischen 6 und 13
Jahren zu ihren Einstellungen zu Medien und ihrem Freizeitverhalten befragt. Es wurden auch
die Eltern der Kinder interviewt. 1994 wurden die Ergebnisse der Studie veröffentlicht und
dabei verdeutlichte sich, dass das ,,Fernsehen... für Kinder in unserem Land seit vielen Jahren
13
Stiftung Lesen 1996, 1.3
14
Stiftung Lesen 1996, 1.3
9
ein »normaler« Bestandteil ihres Alltags"
15
ist. Dem Fernsehen wird von allen Tätigkeiten ein
besonders hoher Stellenwert zugemessen. Die Ursachen für diesen hohen Stellenwert sind
vielfältig. Für die Kinder und Jugendlichen bietet das Fernsehen eine leicht verfügbare
Beschäftigungsmöglichkeit. Fast alle Haushalte sind mit mindestens einem Gerät ausgestattet
und das Programm läuft rund um die Uhr. Außerdem mangelt es den Kindern und
Jugendlichen häufig an Alternativen, es gibt keine Freizeiteinrichtungen, Sportplätze etc. für
die jungen Leute oder sie werden einfach durch schlechtes Wetter von anderen Aktivitäten
abgehalten (vgl. Stiftung Lesen 1996, 1.2). Fernsehen bringt für die Kinder und Jugendlichen
noch andere Vorteile mit sich. ,,Das Medium besitzt für Kinder eine vielschichtige
Attraktivität- zum einen durch seine »hoch bewerteten« Angebote, zum anderen durch
Erfüllung verschiedener Funktionen wie z.B. Zeitvertreib (bei Langeweile) oder auch
»Stimmungsregulierung« bei Ärger"
16
. Die Einführung des Kabelfernsehens in Deutschland
hat zu einer starken Veränderung des Fernsehverhaltens von Kindern und Jugendlichen
geführt. Die Nutzung des Mediums Fernsehens findet hauptsächlich zu Hause statt und wird
von zwei Strängen beeinflusst:
· Fernsehnutzungsstil der Eltern
· Umgang der Eltern mit den Fernsehwünschen der Kinder.
In der Vergangenheit beschäftigten sich auch einige Untersuchungen mit dem Leseverhalten
von Kindern und Jugendlichen, zuverlässige Ergebnisse fehlen jedoch. ,,Dennoch kann
festgestellt werden, dass es keinen generellen Rückgang des Lesens in der Bevölkerung
gibt... ."
17
Es wurde festgestellt, dass Jugendliche hauptsächlich abends lesen, die
durchschnittliche Lesezeit beträgt etwa zwanzig Minuten pro Tag. Damit schneidet die
Lesezeit schlechter ab als die Nutzungszeit anderer Medien, sie wird zudem oft nicht so genau
im Gedächtnis behalten, wie zum Beispiel das Fernsehen (vgl. Stiftung Lesen 1996, 1.3).
Für ihre Buchbeschaffung nutzen lesende Jugendliche öffentliche Bibliotheken und
Büchereien nicht sehr stark, sie leihen sich Bücher eher bei Freunden aus.
Zum Leseverhalten lässt sich sagen, dass ,,Mädchen und Frauen... überproportional mehr
`lesen' als Männer. Später nähern sich die Lesegewohnheiten einander an"
18
. Überraschend ist
auch, dass Vielleser gleichzeitig auch Vielseher (TV, Video) sein können. Die Nutzung
verschiedener Medien schließt sich gegenseitig nicht aus.
15
Stiftung Lesen 1996, 1.2
16
Stiftung Lesen 1996, 1.2
17
Stiftung Lesen 1996, Vorwort
18
Stiftung Lesen 1996, 1.3
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832492946
- ISBN (Paperback)
- 9783838692944
- DOI
- 10.3239/9783832492946
- Dateigröße
- 470 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Amt für Lehrerbildung – Studienseminar Wetzlar
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Februar)
- Note
- 2
- Schlagworte
- lesen leseforschung leseverhalten club
- Produktsicherheit
- Diplom.de