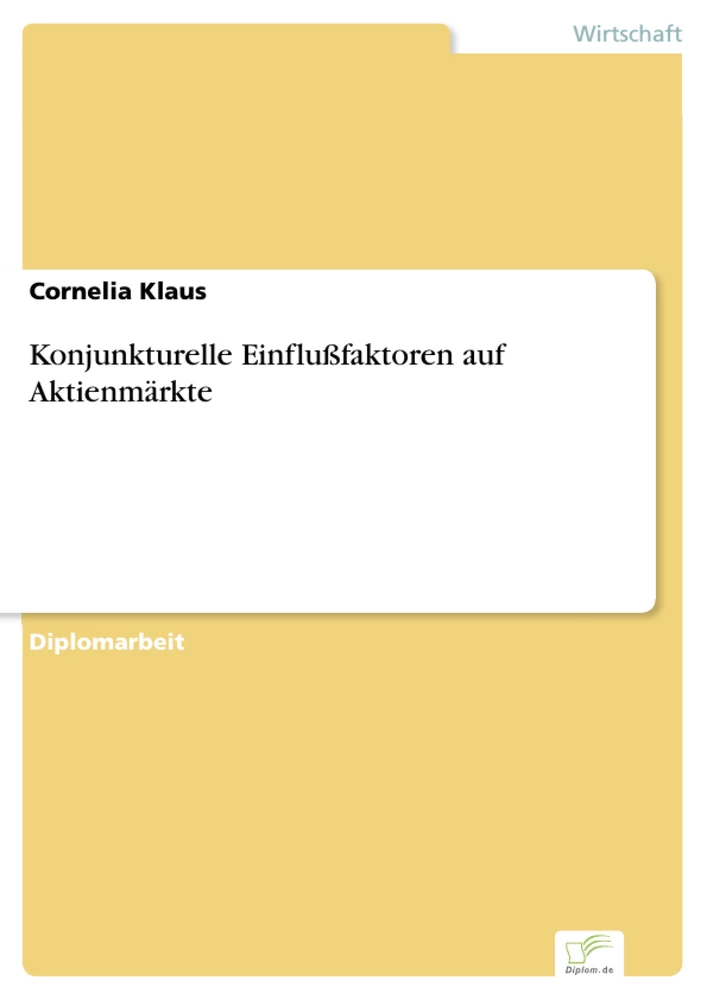Konjunkturelle Einflußfaktoren auf Aktienmärkte
©2004
Diplomarbeit
86 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Eine drei Jahre andauernde Baisse überschattete ab dem Jahr 2000 die Aktienmärkte und sorgte für Verwirrung und Ratlosigkeit unter den Marktakteuren. Die rapide Korrektur der zuvor spekulativen aufwärts gerichteten Übertreibungen verunsicherte derart, dass viele Anleger in den vergleichsweise sicheren Rentenmarkt flüchteten.
In Zeiten wie diesen rücken Erklärungsversuche in den Blickpunkt der Interessenten. Es drängt sich die Frage auf, welche Einflussfaktoren die Talfahrt in erster Linie begünstigt haben, und ob sich eine wage Prognose über die zukünftigen Entwicklungen aufstellen lässt.
Sind schlechte Unternehmensergebnisse schuld an der Misere oder haben sich die Märkte aufgrund von pessimistischen Konjunkturerwartungen abwärts bewegt? Inwieweit war der Terrorismus verantwortlich für die Baisse? Welche Einflussfaktoren wirken aus konjunktureller Sicht generell auf die Aktienmärkte? Sind es zukunfts-, gegenwarts- oder vergangenheitsbezogene Daten? Wie signifikant ist der Einfluss, und lassen sich wieder-kehrende Verhaltensmuster auf der Marktseite beobachten?
Diesem Thema widmen sich Finanzmarktteilnehmer zur Genüge. Offensichtlich ist dabei die Tatsache, dass eine Abkoppelung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Seite eines Landes und ferner der Weltwirtschaft undenkbar ist. Vielmehr liefert die Konjunktur den Aktienmärkten wichtige Impulse.
Diese Konjunktur-Aktienmarkt-Beziehung lässt sich zudem auch auf internationalem Terrain beobachten. Als Beispiel seien hier die Terroranschläge vom 11. September 2001 erwähnt. Die Aktienmärkte unterlagen weltweit einem signifikanten Einbruch aufgrund dieser Ereignisse. Obwohl sich die Geschehnisse nur in den USA abspielten, bekamen auch die anderen Weltbörsen die Situation zu spüren in Einzelfällen sehr deutlich.
Dies spiegelt die internationale Übertragung von Konjunkturimpulsen - hier durch soziale Unruhen/Terrorismus ausgelöst - wider.
Die Wirtschaftsentwicklung von Deutschland und die dadurch beeinflusste Aktienmarktsituation lassen sich dementsprechend nicht isoliert betrachten; ein Zusammenhang zu anderen großen Wirtschaftsstaaten ist gegeben. Zusammenfassend tangieren sich im internationalen Beziehungsgeflecht der Weltbörsen v.a. die USA und Europa, wobei stetig Stimmungsimpulse wechselseitig stattfinden. Die US-Wirtschaft nimmt dabei mit ihren Konjunkturdaten eine dominante Stellung ein und wirkt durch die globale Vernetzung in besonderem Maße auf andere […]
Eine drei Jahre andauernde Baisse überschattete ab dem Jahr 2000 die Aktienmärkte und sorgte für Verwirrung und Ratlosigkeit unter den Marktakteuren. Die rapide Korrektur der zuvor spekulativen aufwärts gerichteten Übertreibungen verunsicherte derart, dass viele Anleger in den vergleichsweise sicheren Rentenmarkt flüchteten.
In Zeiten wie diesen rücken Erklärungsversuche in den Blickpunkt der Interessenten. Es drängt sich die Frage auf, welche Einflussfaktoren die Talfahrt in erster Linie begünstigt haben, und ob sich eine wage Prognose über die zukünftigen Entwicklungen aufstellen lässt.
Sind schlechte Unternehmensergebnisse schuld an der Misere oder haben sich die Märkte aufgrund von pessimistischen Konjunkturerwartungen abwärts bewegt? Inwieweit war der Terrorismus verantwortlich für die Baisse? Welche Einflussfaktoren wirken aus konjunktureller Sicht generell auf die Aktienmärkte? Sind es zukunfts-, gegenwarts- oder vergangenheitsbezogene Daten? Wie signifikant ist der Einfluss, und lassen sich wieder-kehrende Verhaltensmuster auf der Marktseite beobachten?
Diesem Thema widmen sich Finanzmarktteilnehmer zur Genüge. Offensichtlich ist dabei die Tatsache, dass eine Abkoppelung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Seite eines Landes und ferner der Weltwirtschaft undenkbar ist. Vielmehr liefert die Konjunktur den Aktienmärkten wichtige Impulse.
Diese Konjunktur-Aktienmarkt-Beziehung lässt sich zudem auch auf internationalem Terrain beobachten. Als Beispiel seien hier die Terroranschläge vom 11. September 2001 erwähnt. Die Aktienmärkte unterlagen weltweit einem signifikanten Einbruch aufgrund dieser Ereignisse. Obwohl sich die Geschehnisse nur in den USA abspielten, bekamen auch die anderen Weltbörsen die Situation zu spüren in Einzelfällen sehr deutlich.
Dies spiegelt die internationale Übertragung von Konjunkturimpulsen - hier durch soziale Unruhen/Terrorismus ausgelöst - wider.
Die Wirtschaftsentwicklung von Deutschland und die dadurch beeinflusste Aktienmarktsituation lassen sich dementsprechend nicht isoliert betrachten; ein Zusammenhang zu anderen großen Wirtschaftsstaaten ist gegeben. Zusammenfassend tangieren sich im internationalen Beziehungsgeflecht der Weltbörsen v.a. die USA und Europa, wobei stetig Stimmungsimpulse wechselseitig stattfinden. Die US-Wirtschaft nimmt dabei mit ihren Konjunkturdaten eine dominante Stellung ein und wirkt durch die globale Vernetzung in besonderem Maße auf andere […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9207
Klaus, Cornelia: Konjunkturelle Einflußfaktoren auf Aktienmärkte
Hamburg: Diplomica GmbH, 2006
Zugl.: Fachhochschule Neu-Ulm, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
1
INHALTSVERZEICHNIS
1.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... 2
2.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... 3
3.
EINLEITUNG ... 4
4.
KONJUNKTURELLE ECKDATEN... 7
4.1.
Konjunkturzyklus ... 7
4.1.1.
Kennzeichnung ... 7
4.1.2.
Bestandteile... 7
4.2.
Konjunkturschwankungen ... 9
4.2.1.
Definition ... 9
4.2.2.
Messgrößen... 9
4.2.3.
Ursachen ... 10
4.2.4.
Schnittstelle der Konjunkturschwankungen mit den Aktienmärkten ... 11
5.
KONJUNKTURDATEN UND DEREN EINFLUSS AUF AKTIENMÄRKTE... 12
5.1.
Erläuterung relevanter Konjunkturdaten... 12
5.1.1.
Frühindikatoren ... 12
5.1.1.1.
Ifo-Geschäftsklimaindex ... 13
5.1.1.2.
ZEW-Konjunkturerwartungen ... 14
5.1.1.3.
Auftragseingänge ... 14
5.1.1.4.
Verbrauchervertrauen ... 15
5.1.1.5.
Einkaufsmanagerindex... 17
5.1.2.
Präsensindikatoren ... 18
5.1.2.1.
Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung ... 18
5.1.2.2.
Einzelhandelsumsätze... 19
5.1.2.3.
Bruttoinlandprodukt ... 20
5.1.2.4.
Arbeitsmarktbericht... 21
5.1.3.
Spätindikatoren ... 22
5.1.3.1.
Verbraucherpreise... 22
5.1.3.2.
Zinsniveau ... 23
5.2.
Reaktionen der Aktienmärkte ... 25
5.2.1.
Motive für Marktbewegungen ... 26
5.2.2.
Diverse Eintrittsszenarien ... 31
5.2.3.
Interpretation der Anleger ... 35
5.3.
Empirische Unterlegung ... 40
5.3.1.
Längerfristige Zusammenhänge ... 40
5.3.2.
Kurzfristiger Einfluss ... 48
5.3.3.
Studien ... 49
5.3.3.1.
Studie von Ray Fair... 49
5.3.3.2.
DekaBank-Studie ... 50
5.3.3.3.
Eigene Recherche... 51
6.
AUSSICHTEN... 57
7.
ANHANG ... 59
8.
LITERATURVERZEICHNIS... 78
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
2
1. Abkürzungsverzeichnis
BIP Bruttoinlandsprodukt
c.p.
ceteris paribus
EWU Europäische
Währungsunion
EZB Europäische
Zentralbank
FED Federal
Reserve
HVPI Harmonisierter
Verbraucherpreisindex
ISM
Institute for Supply Management
i.S.
im Sinne
i.S.v.
im Sinne von
MEZ Mitteleuropäische
Zeit
PMI
Purchasing Manager Index
US
United States
ZEW Zentrum
für
Europäische Wirtschaftsforschung
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
3
2. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Konjunkturzyklus ... 7
Abb. 2: Konjunkturschwankungen... 9
Abb. 3: Schnittstelle zu den Aktienmärkten... 11
Abb. 4: Indizes des Verbrauchervertrauens im Vergleich... 16
Abb. 5: Szenario-Tabelle mit tendenzieller Richtung der Aktienmarktreaktionen ... 31
Abb. 6: Wechselwirkungen ... 39
Abb. 7: Entwicklungsvergleich DAX und ifo-Geschäftsklimaindex (Daten s. Anhang)... 41
Abb. 8: Entwicklungsvergleich DOW Jones und ifo-Geschäftsklimaindex (Daten s. Anhang) ... 41
Abb. 9: Entwicklungsvergleich DAX und ZEW-Konjunkturerwartungen (Daten s. Anhang)... 42
Abb.10: Entwicklungsvergleich DOW Jones und ZEW-Konjunkturerwartungen (Daten s. Anhang) . 43
Abb.11: Entwicklungsvergleich DAX und US-Auftragseingänge (Daten s. Anhang) ... 43
Abb.12: Entwicklungsvergleich DOW Jones und US-Auftragseingänge (Daten s. Anhang)... 44
Abb.13: Entwicklungsvergleich DAX und Verbrauchervertrauen (Daten s. Anhang) ... 45
Abb.14: Entwicklungsvergleich DOW Jones und Verbrauchervertrauen (Daten s. Anhang)... 45
Abb.15: Entwicklungsvergleich DAX und Einkaufsmanagerindex (Daten s. Anhang) ... 46
Abb.16: Entwicklungsvergleich DOW Jones und Einkaufsmanagerindex (Daten s. Anhang)... 47
Abb.17: DAX-Handelsbewegung 02. Juni 2000... 48
Abb.18: DAX-Handelsbewegung 14. April 2000 ... 49
Abb.19: Verhältnis der Handelsbewegungs-Richtungen ... 53
Abb.20: Korrelationen... 54
Abb.21: Länge des Einflusses ... 55
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
4
3. Einleitung
Eine drei Jahre andauernde Baisse überschattete ab dem Jahr 2000 die Aktienmärkte und
sorgte für Verwirrung und Ratlosigkeit unter den Marktakteuren. Die rapide Korrektur der
zuvor spekulativen aufwärts gerichteten Übertreibungen verunsicherte derart, dass viele
Anleger in den vergleichsweise sicheren Rentenmarkt flüchteten.
In Zeiten wie diesen rücken Erklärungsversuche in den Blickpunkt der Interessenten. Es
drängt sich die Frage auf, welche Einflussfaktoren die Talfahrt in erster Linie begünstigt
haben, und ob sich eine wage Prognose über die zukünftigen Entwicklungen aufstellen lässt.
Sind schlechte Unternehmensergebnisse schuld an der Misere oder haben sich die Märkte
aufgrund von pessimistischen Konjunkturerwartungen abwärts bewegt? Inwieweit war der
Terrorismus verantwortlich für die Baisse? Welche Einflussfaktoren wirken aus kon-
junktureller Sicht generell auf die Aktienmärkte? Sind es zukunfts-, gegenwarts- oder
vergangenheitsbezogene Daten? Wie signifikant ist der Einfluss, und lassen sich wieder-
kehrende Verhaltensmuster auf der Marktseite beobachten?
Diesem Thema widmen sich Finanzmarktteilnehmer zur Genüge. Offensichtlich ist dabei die
Tatsache, dass eine Abkoppelung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Seite eines
Landes und ferner der Weltwirtschaft undenkbar ist. Vielmehr liefert die Konjunktur den
Aktienmärkten wichtige Impulse.
Diese Konjunktur-Aktienmarkt-Beziehung lässt sich zudem auch auf internationalem Terrain
beobachten. Als Beispiel seien hier die Terroranschläge vom 11. September 2001 erwähnt.
Die Aktienmärkte unterlagen weltweit einem signifikanten Einbruch aufgrund dieser Ereig-
nisse. Obwohl sich die Geschehnisse "nur" in den USA abspielten, bekamen auch die anderen
Weltbörsen die Situation zu spüren in Einzelfällen sehr deutlich.
Dies spiegelt die internationale Übertragung von Konjunkturimpulsen -hier durch soziale
Unruhen/Terrorismus ausgelöst- wider.
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
5
Die Wirtschaftsentwicklung von Deutschland und die dadurch beeinflusste Aktienmarkt-
situation lassen sich dementsprechend nicht isoliert betrachten; ein Zusammenhang zu
anderen großen Wirtschaftsstaaten ist gegeben. Zusammenfassend tangieren sich im
internationalen Beziehungsgeflecht der Weltbörsen v.a. die USA und Europa, wobei stetig
Stimmungsimpulse wechselseitig stattfinden. Die US-Wirtschaft nimmt dabei mit ihren
Konjunkturdaten eine dominante Stellung ein und wirkt durch die globale Vernetzung in
besonderem Maße auf andere Industrienationen und deren Aktienmärkte. Asien spielt noch
eine untergeordnete Rolle (, hat aber in den vergangenen Monaten nachweisbar an Stellenwert
gewonnen).
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit konjunkturellen Einflüssen auf
Aktienmärkte. Hervorzuheben sei hier die Tatsache, dass ich lediglich diejenigen
Einflussfaktoren berücksichtige, die von Seiten der konjunkturellen Lage ausgehen und eine
Aktienmarktreaktion hervorrufen. Wirtschaftliche Ereignisse/Veränderungen, die aufgrund
von Aktienmarktbewegungen resultieren, lasse ich außer Acht, da dies den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen würde. Dennoch bin ich mir darüber bewusst, dass auch von
den Finanzmärkten ausgehend -im Speziellen den Aktienmärkten- Einflussfaktoren auf die
Konjunktur bestehen. Es handelt sich um ein Beziehungsgeflecht mit Wechselwirkungen.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit widme ich mich Aspekten rund um das Thema "Konjunktur".
Dabei erwähne ich die Bestandteile eines Konjunkturzyklus und gehe auf geeignete
Messgrößen sowie Ursachen für Konjunkturschwankungen ein. Durch eine abschließende
Grafik sollen diese Aspekte visuell festgehalten und die Schnittstelle zu den Aktienmärkten
aufgezeigt werden.
Das erste Kapitel basiert hauptsächlich auf vorhandener Literatur und dient einer kurzen
Einführung in die Thematik der vorliegenden Arbeit.
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
6
Das zweite Kapitel bezieht sich auf dominierende Konjunkturindikatoren innerhalb der
Wirtschaft und deren Auswirkungen auf Aktiemärkte. Eine Aufteilung in die Kategorien
"Frühindikatoren", "Präsensindikatoren" und "Spätindikatoren" halte ich dabei für sinnvoll.
Bei der Aufführung der Konjunkturindikatoren berücksichtige ich neben deutschen/euro-
päischen Indikatoren auch US-amerikanische. Aufgrund der Übertragung von internationalen
Stimmungsimpulsen (wie bereits oben erwähnt) spielen diese eine erhebliche Rolle. Unter den
Aktienindizes rücken v.a. der deutsche Aktienindex DAX (DAX 30) und der amerikanische
Index DOW Jones (DOW Jones Industrial Average) zur Analyse in mein Blickfeld.
Die Vorgehensweise bei der Verfassung dieses Kapitels sieht dabei folgendes vor: Im ersten
Schritt erläutere ich die Konjunkturdaten, um ein Verständnis der Begrifflichkeiten
sicherzustellen. Anschließend beziehe ich mich auf Literaturquellen, die sich bereits mit der
Thematik der Zusammenhänge beschäftigt haben und fasse Ergebnisse von bereits vor-
liegenden Studien zusammen. In der folgenden Eigenrecherche, welche sich auf die Empirik
stützt, nehme ich selbst den Bezug zur Praxis auf.
Die Resultate der Eigenrecherche fasse ich in Tabellen zusammen.
Im dritten Kapitel, welche die "Aussichten" darstellen, liegt zunächst eine abschließende,
kurze Zusammenfassung der Thematik vor. Eine Einschätzung bzgl. der künftigen
Entwicklungen soll die vorliegende Diplomarbeit schließlich abrunden.
Angesichts des Umfangs der zu betrachtenden Einflussgrößen konnte ich in einigen
Teilbereichen nur eine synoptische Auswertung durchführen. Es galt, die komplexe Materie
in ihrer Analyse einzugrenzen.
Als Ziel dieser Arbeit soll nun aufgezeigt werden, welche Konjunkturindikatoren Einflüsse
auf die Aktienmärkte ausüben und v.a. in welcher Intensität. Kennt man die am Markt vor-
herrschenden Zusammenhänge, werden stattfindende Handelsbewegungen oftmals verständ-
licher.
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
7
Rezession/Depression
erneuter Aufschwung
4. Konjunkturelle Eckdaten
4.1. Konjunkturzyklus
4.1.1.Kennzeichnung
Ein Konjunkturzyklus bildet Veränderungen des Auslastungsgrades der gesamtwirtschaft-
lichen Produktionskapazität ab.
1
Dadurch rücken wirtschaftliche Veränderungen in den Blick-
punkt.
4.1.2.Bestandteile
Ein Konjunkturzyklus lässt sich in die folgenden vier Phasen gliedern:
- Aufschwung
- Hochkonjunktur / Boom
- Abschwung
- Rezession / Depression
Das Ausmaß und die Länge dieser Phasen variieren.
Abb. 1: Konjunkturzyklus
1
vgl. Curry (Wirtschaftszusammenhänge, 2000), S. 64
Konjunktur-
abschwung
Konjunktur-
aufschwung
Boom/Hochkonjunktur
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
8
Jede Konjunkturphase hat charakteristische Merkmale, die im Folgenden erläutert werden.
1
Der Aufschwung ist gekennzeichnet durch eine steigende Nachfrage sowie eine zunehmende
Produktionstätigkeit. Die Unternehmen erhalten mehr Aufträge, die Arbeitslosigkeit geht
zurück, und die Wirtschaft wächst. Aufgrund der erhöhten Konsumnachfrage und der damit
verbundenen, einsetzenden Preissteigerung, verzeichnen die Unternehmen höhere Gewinne.
In der Hochkonjunktur sind die Produktionskapazitäten schließlich voll ausgelastet.
Qualifizierte Arbeitskräfte unter den wenigen Arbeitslosen sind rar, und die Konsum-
nachfrage stagniert. Der Staat entzieht i.d.R. mit höheren Steuerabgaben dem Markt die
Nachfrage, um einer Überhitzung der Wirtschaft entgegenzuwirken. Die Kostensituation der
Unternehmen verschlechtert sich aufgrund der steigenden Löhne und höheren Rohstoffpreise.
Es folgt ein Konjunkturabschwung. Absatzschwierigkeiten machen sich bemerkbar. Die
Unternehmen fahren ihre Kapazitätsauslastung zurück. Resultierend steigen die Stückkosten.
Die Unternehmensgewinne sinken. Mit Entlassungen von Beschäftigten wird versucht, der
eingeschränkten Produktion entgegenzuwirken und die Kostensituation zu verbessern. Der
Staat erhöht seinen Konsum und mittels Steuersenkungen sollen die privaten Ausgaben
gefördert werden. Die Notenbank greift mit Zinssenkungen ein.
Im Tiefpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit herrschen eine geringe Produktionsaktivität, eine
Verschärfung am Arbeitsmarkt sowie eine geringe Konsumnachfrage. Die Konjunktur
befindet sich innerhalb ihres Zyklus in der Depression. Ein typisches Merkmal stellt ein sehr
niedriges Zinsniveau dar. Eine expansive Geld- und Fiskalpolitik beleben die Wirtschaft. Es
resultiert nach Durchschreiten der Talsohle ein erneuter Konjunkturaufschwung.
Saisonale Schwankungen -bedingt durch jahreszeitliche Geschehnisse- fließen in den
Konjunkturzyklus nicht ein.
1
vgl. Schätzle und Morgen (Handbuch Börse 2002), S. 30 ff.
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
9
4.2. Konjunkturschwankungen
4.2.1.Definition
Konjunkturschwankungen sind mittelfristige Wirtschaftsschwankungen, welche eine
Abweichung vom Trend darstellen. Als Trend wird die langfristige Wirtschaftsbewegung
-dargestellt durch das Bruttoinlandsprodukt- bezeichnet.
Abb. 2: Konjunkturschwankungen
4.2.2.Messgrößen
Mittels diverser Konjunkturindikatoren lassen sich derartige Schwankungen messen. Je nach
zeitlicher Entstehung dieser Messgrößen erfolgt eine Separation in Frühindikatoren,
gleichlaufende Indikatoren/Präsensindikatoren und nachlaufende Indikatoren/Spätindika-
toren.
1
Sehr hilfreich sind dabei die Frühindikatoren, da sie Hinweise auf den zukünftigen
Konjunkturverlauf geben. Beispiele hierfür sind der Ifo-Geschäftsklima-Index und die
Auftragseingänge.
1
vgl. Mattern (Praktiker-Handbuch Investment Research, 2000), S.60 ff.
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
10
Die Präsensindikatoren spiegeln die gegenwärtige Konjunkturlage wider. Eine sinnvolle
Größe stellt z.B. das Bruttoinlandsprodukt oder das Beschäftigungsniveau dar.
Anhand der Spätindikatoren lässt sich die Konjunktur-Entwicklung erst im Nachhinein
betrachten. Sie hinken der aktuellen konjunkturellen Situation hinterher. Den bedeutendsten
Spätindikator verkörpert das Preisniveau.
1
Als weiteres Einteilungskriterium der Konjunkturindikatoren kann die Art der Entstehung
herangezogen werden. So gibt es quantitative und qualitative Indikatoren. Die quantitativen
weisen numerische Ergebnisse/Zahlen auf und liefern dementsprechend "harte" Daten. Im
Gegensatz dazu beruhen die qualitativen Indikatoren auf Einschätzungen bzw. "weichem"
Datenmaterial.
2
Auch die Unterscheidung in Bezug auf die Art des betrachteten Gegenstandes findet in der
Praxis ihre Verwendung. Es kann nach Aktivitätsindikatoren, Finanzindikatoren, Sentiment-
indikatoren, Preisindikatoren und Rohstoffindikatoren getrennt werden.
3
In Kapitel 3 werden die für die Aktienmärkte wichtigsten Konjunkturindikatoren (unterteilt in
Früh-, Präsens- und Spätindikatoren) erläutert.
4.2.3.Ursachen
Konjunkturschwankungen lassen sich in aller Regel nur multikausal erklären, da sie durch
mehrere Faktoren bedingt sind. Die Ursachen können ihrer Art entsprechend in reale/güter-
wirtschaftliche, monetäre/geldwirtschaftliche und psychologische Bereiche eingeteilt
werden.
4
Zusätzlich wird in exogene (= nicht-ökonomische) und endogene (= ökonomische) Ursachen
separiert. Zu den exogenen Einflüssen gehören z.B. politische Geschehnisse oder Naturereig-
nisse.
1
vgl. Curry (Wirtschaftszusammenhänge, 2000), S. 65
2
vgl. Oppenländer (Hrsg.) (Konjunkturindikatoren, 1995), S. 26 ff.
3
vgl. Mattern, C. (Konjunkturindikatoren im Portfoliomanagement 2004), Vorlesungsskript SS 2004 Kapitel 3.1
4
vgl. Holstein (Konjunkturtheorie, 1998), S. 11
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
11
4.2.4.Schnittstelle der Konjunkturschwankungen mit den
Aktienmärkten
In der Konjunkturanalyse wird ein systematischer Zusammenhang zwischen der Konjunktur
und den Aktienmärkten erkannt.
1
Die folgende visuelle Darstellung zeigt die Berührung der konjunkturellen Komponente zu
den Aktienmärkten auf.
psychologische Faktoren reale Faktoren monetäre Faktoren
Erwartungen / Aussichten v.a. wirtschaftliche Zinshöhe,
der ökonomischen
Ereignisse, Natur- Preisniveau
Akteure (sind relevant katastrophen,
für die Konsum- und soziale Unruhen,
Investitionsentscheidungen) technische Erfindungen
positive / negative Wirkungen auf das Wirtschaftswachstum
Messungen dieser Schwankungen mittels Konjunkturindikatoren
Aktienmärkte
Abb. 3: Schnittstelle zu den Aktienmärkten
1
vgl. Schätzle und Morgen (Handbuch Börse 2002), S. 29
Einfluss
Höhe dieser Konjunkturindikatoren
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
12
5. Konjunkturdaten und deren Einfluss auf Aktien-
märkte
5.1. Erläuterung
relevanter Konjunkturdaten
In den vergangenen Jahren erhöhten sich die Anzahl und die Qualität der Konjunktur-
indikatoren erheblich.
1
Die Publikation dieser Daten erfolgt zumeist mit saisonbereinigten
Werten.
2
Im Folgenden werden die von den Aktienmarktakteuren vielbeachteten Indikatoren erläutert.
Je nach subjektivem Belieben können jedoch auch andere Konjunkturdaten in den Fokus der
Betrachtungen rücken.
5.1.1.Frühindikatoren
Um Konjunktur-Prognosen möglichst genau aufzustellen, bedienen sich Ökonomen
verschiedener internationaler Frühindikatoren.
Die für die Anleger relevanten sind dabei die nachstehend aufgelisteten Indikatoren. In den
Klammern ist das der Beschreibung zugrunde gelegte Herkunftsland (bzw. die Herkunfts-
länder) genannt.
- Ifo-Geschäftsklimaindex
(Deutschland)
- ZEW-Konjunkturerwartungen
(Deutschland)
- Auftragseingänge (Deutschland, USA)
- Verbrauchervertrauen
(USA)
- Einkaufsmanagerindex
(USA)
Sie basieren meist auf qualitativem Datenmaterial und erweisen sich in der Praxis oftmals als
zuverlässige Konjunkturprognostiker.
1
vgl. Lenz und Moersch (Schlüsselkennzahlen für die Märkte, 2000), S. 39
2
vgl. Mattern (Praktiker Handbuch Investment Research, 2000), S. 17
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
13
5.1.1.1. Ifo-Geschäftsklimaindex
Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat seit 1960 einige konjunkturelle Auf- und Abschwünge
prophezeit. Er kann das reale Bruttosozialprodukt um bis zu 4 Quartale vorausschätzen und ist
aufgrund seiner Prognosegüte einer der meist beachteten Konjunkturindikatoren für Deutsch-
land.
1
Jeden Monat wird dieser Geschäftsklimaindex vom Ifo-Institut in München aufgestellt. In
Form einer schriftlichen Umfrage unter 7.000 Unternehmen innerhalb ganz Deutschland
werden Beurteilungen über die aktuelle Geschäftslage sowie Einschätzungen über das
kommende Halbjahr eingeholt.
Die befragten Unternehmen stammen aus den Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes, des
Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels. Sie können ihre aktuelle
geschäftliche Situation als "gut", "befriedigend" oder "schlecht" angeben und ihre
Geschäftserwartungen für die folgenden sechs Monate als "günstiger", "gleich bleibend" oder
"ungünstiger" kennzeichnen.
Zur Ermittlung des Subindex für die aktuelle Geschäftslage werden die prozentual
angefallenen "schlecht"-Antworten von dem Prozentanteil der "gut"-Antworten subtrahiert.
Ebenso verhält es sich bei der Aufstellung des Subindex für die Geschäftserwartungen, der
eine Differenz von den prozentualen "günstiger"-Antworten und den prozentualen
"ungünstiger"-Antworten abbildet. Die neutralen Antworten ("befriedigend" und "gleich
bleibend") fließen somit in die Bewertung der beiden Subindizes nicht ein.
Das Geschäftsklima ergibt sich schließlich aus den Salden der aktuellen Geschäftslage und
den Erwartungen. Das Jahr 2000 dient als Basisjahr für die Berechnung des daraus
resultierenden Geschäftsklimaindex.
Bis zum 24. Februar galt noch 1991 als Basisjahr und somit zur Normierung des Index. Bis
dato erfolgte jedoch auch noch eine Trennung von Ost- und Westdeutschland unter den
Umfrageergebnissen.
2
1
vgl. Stierle (Hrsg.) (INFER Studies Vol.2, 2000), S. 36 ff.
2
vgl. www.ifo.de
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
14
Positiv zu bewerten ist bei diesem Indikator, dass sich seine Daten auf den laufenden Monat
beziehen und dadurch sehr zeitnah sind. Zudem enthalten sie keine Revisionsanfälligkeit, d.h.
sie unterliegen keinen nachträglichen Korrekturen.
1
5.1.1.2. ZEW-Konjunkturerwartungen
Monatlich ermittelt durch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim,
veranschaulicht dieser Index seit 1991 regelmäßig eine Konjunkturprognose für Deutschland.
Die Daten belaufen sich auf den aktuellen Monat.
Mittels einer Umfrage unter insgesamt etwa 350 Finanzanalysten und institutionellen
Anlegern frägt das ZEW-Institut Erwartungen hinsichtlich diverser ökonomischer Größen und
bezogen auf das kommende Halbjahr ab. Die Prognosen sind qualitativer Art im Sinne von
"unverändert", "besser" oder "schlechter". Es resultiert also lediglich eine Stimmungstendenz.
Aus dieser Umfrage, die als "ZEW-Finanzmarkttest" bekannt ist, werden zwei Indikatoren
gewonnen: der G-Mind (German Market Indicator) und die ZEW-Konjunkturerwartungen.
Letzteres entstammt der speziellen Frage nach der Konjunktureinschätzung der Befragten für
das kommende Halbjahr. Eine Saldierung der hierfür geleisteten prozentualen positiven Ant-
worten von den negativen Antworten ergibt den Indikator.
2
Aufgrund der qualitativen Daten des Indikators besteht keine Korrekturanfälligkeit. Auch die
sehr zeitnahe Veröffentlichung spricht für die ZEW-Konjunkturerwartungen als Barometer.
5.1.1.3. Auftragseingänge
Der Auftragseingang ist definiert als der "Wert aller im Berichtsmonat vom Betrieb fest
akzeptierten Aufträge auf Lieferung selbst hergestellter oder in Lohnarbeit gefertigter
Erzeugnisse".
3
Die Daten dazu ermittelt in Deutschland das Statistische Bundesamt
4
. In den
USA ist die US-Statistikbehörde für deren Aufstellung verantwortlich.
5
Die Zahlen werden in
einem monatlichen Turnus publiziert und belaufen sich jeweils auf den Vormonat.
1
vgl. Mattern (Praktiker Handbuch Investment Research, 2000), S. 265
2
vgl. www.zew.de
3
vgl. Oppenländer (Hrsg.) (Konjunkturindikatoren, 1995), S. 77
4
vgl. www.deutsche-boerse.de
5
vgl. Müller (Daten, 2004), S 35
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
15
Sie ermöglichen Rückschlüsse auf die zukünftige Produktionsentwicklung und die damit
einhergehende Ertragsentwicklung deutscher Unternehmen.
1
Bezüglich der zeitlichen Differenz zwischen den Auftragseingängen und der Produktion ist
eine getrennte Betrachtung von Verbrauchs- und Investitionsgütern vonnöten. Die Industrie-
produktion von Investitionsgütern findet mit einer größeren Zeitverzögerung statt als die
Verbrauchsgüterproduktion.
2
Allerdings sind die Auftragseingänge der langlebigen Güter von
größerer Bedeutung, da dieses Investitionsverhalten von künftiger konjunktureller Zuversicht
zeugt.
Unglücklicherweise sind die Auftragseingangsdaten bei ihrer Publikation teilweise verzerrt
bzw. liefern ein falsches Bild der wirtschaftlichen Situation. Dies ist der Fall, wenn Groß-
aufträge beinhaltet sind, die zu einer sprunghaften Monatsentwicklung führen. Auch
Revisionen der Zahlen sind in der Praxis keine Seltenheit.
3
5.1.1.4. Verbrauchervertrauen
In Volkswirtschaften, die einen hohen Konsum verzeichnen, spielt das Verbrauchervertrauen
einen signifikanten Stellenwert. In der amerikanischen Wirtschaft z.B. leistet der Konsum
einen hohen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt.
Für die USA werden zweierlei Indizes zum Verbrauchervertrauen aufgestellt zum einen von
der Universität von Michigan, andererseits von dem Conference Board (wobei erstere Daten
früher veröffentlicht werden). Zwischen den Daten besteht zumeist eine gleichgerichtete
Entwicklung (s. Abb. 4).
Das Consumer Research Center der University of Michigan führt dazu monatlich ein
telefonisches Interview mit mindestens 500 US- Konsumenten durch. Pro Ermittlungsphase
werden 60 Prozent der Beteiligten ausgetauscht, so dass jede befragte Person in maximal zwei
aufeinanderfolgenden Gesprächen sein Urteil abgibt. In den 50 Fragen äußern sich die
Haushalte zu aktuellen Gegebenheiten und Zukunftserwartungen, wie z.B. der persönlichen
finanziellen Lage oder den Konjunkturerwartungen.
1
vgl. Lenz (Schlüsselkennzahlen für die Märkte, 2000), S. 37
2
vgl. ebd., S.37
3
vgl. Stierle (Hrsg.) (INFER Studies Vol.2, 2000), S. 35
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
16
In den Gesamtindex des Verbrauchervertrauens fließt der Teilindex der Erwartungen zu 60
Prozent ein, während der für die aktuelle Situation erstellte Teilindex nur 40 Prozent beiträgt.
1
Die durch die University of Michigan gewonnen Erwartungshaltungen der Befragten werden
bei dem Verbrauchervertrauensindex des Conference Boards berücksichtigt.
Der vom Conference Board ermittelte Wert wird ebenso monatlich publiziert und beruht auf
einer Umfrage unter 5.000 Haushalten. Er ist dementsprechend repräsentativer als der Index
der University of Michigan. Die Befragung deckt folgende Aspekte ab
2
:
- allgemeine
Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Region
- letzteres in Hinblick auf einen sechs Monate späteren Zeitpunkt (= Prognose)
- aktuelle Lage der freien Arbeitsstellen
- Arbeitsmarkt-Situation zu einem sechs Monate späteren Zeitpunkt (= Prognose)
- Familieneinkommen sechs Monate später (= Prognose)
Hierfür teilen die Befragten eine qualitative Beurteilung mit, die Aufschluss über ihre
Tendenz gibt. Nach erfolgter Gleichgewichtung der oben genannten Aspekte entsteht der
Index.
Positiv hervorzuheben ist bei beiden Indizes die zeitnahe Veröffentlichung. Die publizierten
Daten beziehen sich auf den laufenden Monat
Quelle: Haver Analytics (www.haver.com/COMMENT/020628.htm)
Abb. 4: Indizes des Verbrauchervertrauens im Vergleich
1
vgl. www.deutsche-boerse.de
2
vgl. Förtsch (Hrsg.) (Wirtschaftsindikatoren, 2003), S. 76
Konjunkturelle
Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
17
5.1.1.5. Einkaufsmanagerindex
Der seit 1931 existierende, landesweit ermittelte US-amerikanische "Purchasing Manager
Index" (PMI) dient einer Einschätzung der Wirtschaft und Vorhersage konjunktureller
Wendepunkte. Eine Publikation findet am ersten Werktag eines jeden Monats statt, und die
Zahlen belaufen sich auf den Vormonat.
Das zeitnah aufgestellte Barometer bildet dank seiner frühzeitigen Prognosefähigkeit einen
vielbeachteten Indikator.
1
Das Institute for Supply Management (ISM) unternimmt zu seiner Aufstellung eine
monatliche Umfrage unter grob 400 Unternehmen aus 20 Branchen des verarbeitenden
Gewerbes.
2
Hierzu beurteilen Einkaufsmanager bzw. verantwortliche Mitarbeiter für den
Einkauf und die Logistik neun Bereiche mit der Einschätzung "höher", "unverändert" oder
"niedriger". Eine Frage lautet z.B.: "Wie bewerten Sie den Auftragseingang Ihrer Firma
relativ zum Vormonat?"
Die Summe aus den positiven Antworten und der Hälfte der unentschiedenen Antworten wird
innerhalb jeder dieser neun Teilbereiche durch die Gesamtzahl der Antworten dividiert. Als
Resultat entsteht für die neun Bereiche jeweils ein individueller Indikator. Werte unter 50
stehen für eine Kontraktion, Werte über 50 deuten auf eine Expansion hin.
3
Für den Einkaufsmanagerindex werden allerdings nur fünf Bereichs-Indikatoren berück-
sichtigt:
4
- die
Auftragseingänge,
- die
Produktion,
- die
Lagerbestände,
- die Beschäftigtenzahl und
- die
Lieferbedingungen.
Die auf qualitativen, weichen Daten basierte Erhebung verhindert eine Revisionsanfälligkeit
des Index.
1
vgl. Stierle (Hrsg.) (INFER Studies Vol.2, 2000), S. 77
2
vgl. Müller (Daten, 2004), S 35
3
vgl. Stierle (Hrsg.) (INFER Studies Vol.2, 2000), S. 78
4
vgl. Moersch (Schlüsselkennzahlen für die Märkte, 2000), S. 38
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832492076
- ISBN (Paperback)
- 9783838692074
- DOI
- 10.3239/9783832492076
- Dateigröße
- 681 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm; früher Fachhochschule Neu-Ulm – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- wirtschaftsindikator börse kapitalmärkte market mover
- Produktsicherheit
- Diplom.de