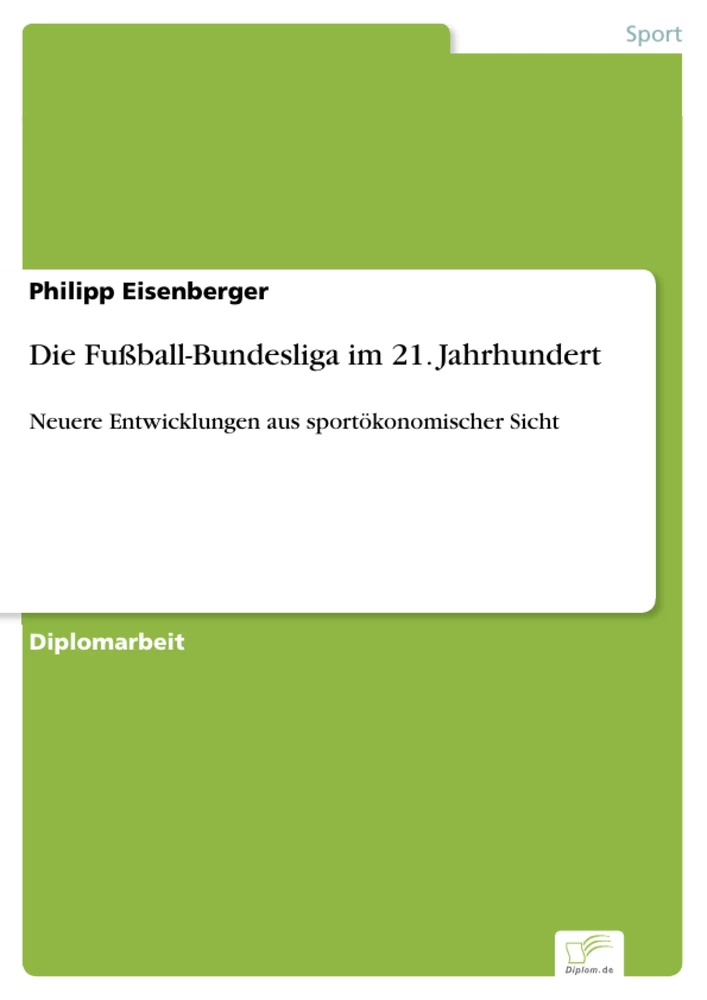Die Fußball-Bundesliga im 21. Jahrhundert
Neuere Entwicklungen aus sportökonomischer Sicht
Zusammenfassung
Die Sportökonomie ist eine in Deutschland noch relativ junge Wissenschaftsdisziplin, weshalb auch der Grad der Institutionalisierung noch gering ist. In den letzten Jahren wurde aber immer mehr deutlich, dass der Sportsektor, insbesondere der Bereich des vereins- und verbandsorganisierten Sports, viele Besonderheiten aufweist, die in einer speziellen Sportökonomie erforscht werden müssen.
Der größte Teil der sportökonomischen Forschung in Europa beschäftigt sich mit dem Ligasport und hier speziell mit dem Profifußball. Für eine ökonomische Analyse des Fußballs spricht sicherlich dessen Bekanntheit und Popularität in Europa und speziell in Deutschland. So ist der Fußball hierzulande die am häufigsten aktiv betriebene Sportart und gleichzeitig strömen regelmäßig Hunderttausende in die Stadien oder es sitzen Millionen vor den Fernsehbildschirmen.
Schon von daher scheint eine Untersuchung dieser Branche sinnvoll zu sein. Die größte Antriebsfeder für vermehrte ökonomische Forschungsaktivitäten war jedoch die in den letzten Jahren/Jahrzehnten stark gestiegene wirtschaftliche Bedeutung der Fußball-Bundesliga. So sind die Gesamteinnahmen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich angestiegen. In der Spielzeit 1989/90 betrugen die Einnahmen noch ca. 180 Mio. EUR, in der Saison 1995/96 waren es bereits ca. 450 Mio. EUR. Den Höhepunkt erreichten die Umsätze in der Spielzeit 2002/2003 mit ca. 1,15 Mrd. EUR.
Darüber hinaus wird weiterhin mit steigenden Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fernsehrechten, gerechnet. Somit hat die Branche Fußball-Bundesliga gesamtwirtschaftlich eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. Ebenso hat in den letzten Jahren vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Notwendigkeiten eine Professionalisierung im Profifußball eingesetzt, wodurch sich Bundesliga-Vereine zunehmend zu Bundesliga-Unternehmen entwickeln. Insofern gewinnen auch betriebswirtschaftliche Probleme, wie insbesondere die Anforderungen an das Management von Bundesligavereinen, immer mehr an Bedeutung.
Aus diesen Gründen beschäftigt sich auch diese Arbeit mit verschiedenen sportökonomischen Fragestellungen der Fußball-Bundesliga, wobei hier die 1. Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt stehen soll, da sie weitaus größere ökonomische Auswirkungen hat, aber auch weil für die 2. Bundesliga weit weniger Informationen und Daten zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz sind viele Ergebnisse auch auf […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Ausgestaltung des Profifußballs in Deutschland
2.1 Die organisatorische Entwicklung der Fußball-Bundesliga
2.2 Der Ligabetrieb und seine zentralen Organe
2.2.1 Deutscher Fußball-Bund (DFB)
2.2.2 Fußballclubs und Fußballspieler
3 Die Fußball-Bundesliga – wirtschaftliche Situation und Bedeutung
3.1 Einnahmequellen eines Fußballbundesligisten
3.1.1 Mediale Rechte
3.1.1.1 Die Entwicklung der Fernsehgelder
3.1.1.2 Die derzeitige Ausgestaltung der Vermarktung der Fernsehübertragungsrechte
3.1.1.3 Das zukünftige Potenzial der Einnahmen aus medialen Rechten
3.1.1.3.1 Langfristige Einflussfaktoren
3.1.1.3.2 Die Bedeutung des Pay-TV
3.1.2 Sponsoring
3.1.2.1 Grundlagen des Sportsponsorings
3.1.2.2 Trikotsponsoring
3.1.2.3 Ausrüsterverträge
3.1.2.4 Bandenwerbung
3.1.2.5 Aussichten
3.1.3 Ticketing / Hospitality
3.1.4 Merchandising
3.1.5 Transfererlöse
3.1.6 Sonstige Einnahmen
3.2 Ausgabeposten eines Fußballbundesligisten
3.2.1 Spielergehälter
3.2.2 Transferaufwendungen
3.2.3 Spielbetriebsausgaben
3.2.4 Sonstige Ausgaben
3.3 Die finanzielle Situation des Profifußballs in Deutschland
3.3.1 Das Problem von Überinvestitionen
3.3.2 Die Vermögenslage der Bundesligisten
3.3.3 Ausblick und Lösungsmöglichkeiten
4 Neueste Entwicklungen in der ökonomischen Fußballforschung
4.1 Betriebswirtschaftliche Literatur
4.1.1 Profifußball und Börse
4.1.2 Corporate Governance in Fußballunternehmen
4.1.3 Controlling
4.1.4 Rechnungslegung, Steuern und Bilanzen
4.1.5 Finanzierung
4.1.6 Management und Steuerung
4.1.7 Marketing
4.2 Volkswirtschaftliche Literatur
4.2.1 Theoretische Grundlagenliteratur zur Ökonomie des Fußballs
4.2.2 Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg
4.2.3 Stadionfinanzierung
4.2.4 Die Fernsehübertragungsrechte unter besonderer Berücksichtigung der Zentralvermarktung
4.2.5 Der Spielermarkt unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Transferregelungen
4.3 Studien und Sammelwerke
4.4 Sonstiges
5 Die Finanzierung von Fußballstadien in Deutschland
5.1 Die Notwendigkeit von Stadioninvestitionen und deren Finanzierung
5.2 Finanzierung: Privat oder öffentlich?
5.2.1 Die öffentliche Hand als traditioneller Investor
5.2.1.1 Die abnehmende Bedeutung öffentlicher Finanzierung
5.2.1.2 Die wirtschaftlichen Auswirkungen öffentlich finanzierter Stadionprojekte
5.2.1.2.1 Die Fußball-WM 2006 als wirtschaftlicher Erfolg
5.2.1.2.2 Lohnt sich die WM doch nicht?
5.2.1.2.3 Fazit: Großveranstaltungen als notwendige Voraussetzung
5.2.2 Die Beteiligung privater Investoren
5.2.2.1 Privatinvestoren, die kein Bundesligaverein sind
5.2.2.2 Das Engagement von Bundesligaunternehmen
5.2.2.3 Zwischenfazit
5.3 Die tatsächliche Ausgestaltung der Finanzierungen
5.3.1 Die Alternative: Public-Private-Partnership
5.3.2 Die Finanzierung der AWD-Arena in Hannover als Beispiel einer Public-Private-Partnership
5.3.2.1 Organisationskonzept
5.3.2.2 Finanzierungskonzept
5.3.3 Die faktische Beteiligung der verschiedenen Investorengruppen – entspricht sie den Erwartungen?
5.3.3.1 Die öffentliche Hand
5.3.3.2 Private Investoren
5.3.3.3 Die Vereine
5.3.3.4 Zwischenfazit
5.4 Private Investitionen als rentable Investments?
5.5 Fazit: Public-Private-Partnerships als Königsweg
6 Ist der sportliche Erfolg in der Bundesliga käuflich?
6.1 Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg
6.2 Was ist „sportlicher Erfolg“?
6.3 Der Einfluss finanzieller Faktoren
6.3.1 Erfolgsfaktor „Finanzpotenzial“
6.3.2 Erfolgsfaktor „Spielergehälter“
6.4 Der Einfluss nichtfinanzieller Faktoren
6.4.1 Erfolgsfaktor „Trainer“
6.4.2 Erfolgsfaktor „Management“
6.5 Die Bedeutung des Zufalls
6.5.1 Glück und Tagesform als spielbeeinflussende Zufallskomponenten
6.5.2 Wettmärkte als effizienter Informationslieferant
6.6 Fazit: Der sportliche Erfolg ist niemals komplett käuflich
7 Schlussbetrachtung und Ausblick
Anhang A: Stadioninvestitionen in Deutschland für die WM 2006
Anhang B: Weitere Stadioninvestitionen in Deutschland
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die Stellung des DFB bei der Organisation der (1.) Bundesliga und der 2. Bundesliga
Abbildung 2: Einnahmequellen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga der Saison 2003/2004
Abbildung 3: Fernseherlöse der Fußball-Bundesliga (2005/2006 geschätzt)
Abbildung 4: Ausgabepositionen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga der Saison 2003/2004
Abbildung 5: Die Herkunft der finanziellen Mittel
Abbildung 6: Überlassungspreise privater Fußballstadien
Abbildung 7: Modellhafte Organisations- und Finanzierungsstruktur einer PPP-Finanzierung
Abbildung 8: Ausgewählte Besitz- und Betriebsgesellschaften in der Fußball-Bundesliga
Abbildung 9: Konzessionsmodell / BOT-Modell AWD-Arena Hannover
1 Einleitung
„Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich versichere Ihnen, es ist weitaus ernster.“
Bill Shankley, ehemaliger Manager des FC Liverpool
Die Sportökonomie ist eine in Deutschland noch relativ junge Wissenschaftsdisziplin, weshalb auch der Grad der Institutionalisierung noch gering ist. In den letzten Jahren wurde aber immer mehr deutlich, dass der Sportsektor, insbesondere der Bereich des vereins- und verbandsorganisierten Sports, viele Besonderheiten[1] aufweist, die in einer speziellen Sportökonomie erforscht werden müssen.[2]
Der größte Teil der sportökonomischen Forschung in Europa beschäftigt sich mit dem Ligasport und hier speziell mit dem Profifußball. Für eine ökonomische Analyse des Fußballs spricht sicherlich dessen Bekanntheit und Popularität in Europa und speziell in Deutschland. So ist der Fußball hierzulande die am häufigsten aktiv betriebene Sportart und gleichzeitig strömen regelmäßig Hunderttausende in die Stadien oder es sitzen Millionen vor den Fernsehbildschirmen. Schon von daher scheint eine Untersuchung dieser Branche sinnvoll zu sein.[3] Die größte Antriebsfeder für vermehrte ökonomische Forschungsaktivitäten war jedoch die in den letzten Jahren/Jahrzehnten stark gestiegene wirtschaftliche Bedeutung der Fußball-Bundesliga.[4] So sind die Gesamteinnahmen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich angestiegen. In der Spielzeit 1989/90 betrugen die Einnahmen noch ca. 180 Mio. EUR, in der Saison 1995/96 waren es bereits ca. 450 Mio. EUR.[5] Den Höhepunkt erreichten die Umsätze in der Spielzeit 2002/2003 mit ca. 1,15 Mrd. EUR.[6] Darüber hinaus wird weiterhin mit steigenden Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fernsehrechten, gerechnet. Somit hat die Branche Fußball-Bundesliga gesamtwirtschaftlich eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung.[7] Ebenso hat in den letzten Jahren vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Notwendigkeiten eine Professionalisierung im Profifußball eingesetzt, wodurch sich Bundesliga-„Vereine“ zunehmend zu Bundesliga-„Unternehmen“ entwickeln.[8] Insofern gewinnen auch betriebswirtschaftliche Probleme, wie insbesondere die Anforderungen an das Management von Bundesligavereinen, immer mehr an Bedeutung.[9]
Aus diesen Gründen beschäftigt sich auch diese Arbeit mit verschiedenen sportökonomischen Fragestellungen der Fußball-Bundesliga, wobei hier die 1. Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt stehen soll, da sie weitaus größere ökonomische Auswirkungen hat, aber auch weil für die 2. Bundesliga weit weniger Informationen und Daten zur Verfügung stehen.[10] Nichtsdestotrotz sind viele Ergebnisse auch auf die 2. Liga übertragbar. Ferner werden auch die internationalen Vereinswettbewerbe und die Fußball-Weltmeisterschaft 2006[11], wenngleich diese teils einen bedeutenden Einfluss auf die Bundesliga und die Clubs[12] haben, nur am Rande betrachtet.
Zum Aufbau der Arbeit: Zunächst werden in Kapitel 2 notwendige Grundlagen für das Verstehen der späteren Zusammenhänge gelegt. Dazu erfolgt eine Charakterisierung der Fußball-Bundesliga anhand einer Beschreibung der organisatorischen Entwicklung und insbesondere der Neuordnung der zentralen Organe nach der Verbandsreform 2001. Im Folgenden unterteilt sich die Arbeit in vier voneinander relativ unabhängige Bereiche. In Kapitel 3 werden die Einnahme- und Ausgabenposten von Fußballunternehmen der Bundesliga dargestellt, wobei auch die dazugehörigen Märkte beschrieben werden, bevor dann auf die daraus resultierende finanzielle Situation der Bundesliga eingegangen wird. Hierdurch soll insbesondere die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung des Profifußballs deutlich gemacht werden. Gleichwohl dienen diese Ausführungen gleichzeitig als wichtige Grundlage späterer Sachverhalte. Anschließend gibt Kapitel 4 aufgrund der auch in der Wissenschaft zunehmenden Bedeutung des Profifußballs einen Überblick über den neuesten Stand der ökonomischen Fußballforschung, indem die neueste Literatur beginnend ab dem Jahr 2002 kurz vorgestellt wird. Kapitel 5 geht auf die Stadionfinanzierung ein, welche durch die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland eine besondere Aufmerksamkeit erfahren hat. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Finanzierung eher aus öffentlichen oder privaten Mitteln erfolgen sollte. Ebenso wird die faktische Ausgestaltung der Finanzierungen im Rahmen der WM 2006 näher beschrieben und diskutiert, ob private Stadioninvestitionen entgegen weitläufiger Meinungen doch profitabel sein können. Kapitel 6 widmet sich mit der Frage, ob sportlicher Erfolg käuflich ist oder nicht, einem eher theoretischen Thema. Hierbei stehen die Untersuchung finanzieller und nichtfinanzieller Einflussfaktoren sowie des Faktors Zufall im Mittelpunkt. In Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick.
2 Die Ausgestaltung des Profifußballs in Deutschland
Die folgenden beiden einführenden Abschnitte beschreiben kurz grundlegende Sachverhalte zur Fußball-Bundesliga, die für das weitere Verstehen dieser Arbeit unerlässlich sind. Der erste Teil versucht die Fußball-Bundesliga näher zu definieren, indem er die Entwicklung des Fußballs in Deutschland und speziell der Bundesliga beschreibt, wobei der Schwerpunkt auf dem Austragungsmodus liegt. Im zweiten Unterpunkt wird auf die zentralen Organe der Fußball-Bundesliga eingegangen, die den Ligabetrieb organisieren bzw. Bestandteil dessen sind. Im Vordergrund steht hier die neue Organisationsstruktur des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach der Verbandsreform im Jahre 2001.
2.1 Die organisatorische Entwicklung der Fußball-Bundesliga
Als Beginn der Geschichte des Fußballs in Deutschland kann man die Gründung einer Schülerspielgemeinschaft, welche streng genommen den ersten deutschen Fußballclub darstellte, im Jahre 1874 ansehen.[13] Allerdings dauerte es noch viele Jahre, bis am 28. Januar 1900 in Leipzig der Deutsche Fußball-Bund (DFB)[14] gegründet wurde und somit erstmals eine bundesweite Organisation des Fußballs gegeben war.[15] Die erste Deutsche Fußballmeisterschaft wurde im Jahre 1903 ausgetragen. Erster Deutscher Meister wurde damals der VfB Leipzig mit einem 7:2 gegen den DFC Prag. Bis zum Jahr 1963 wurde der Deutsche Meister nach verschiedenen Systemen ermittelt. Es gab noch keine zentrale Liga, sondern die teilnehmenden Mannschaften mussten sich in regionalen Gruppen zunächst für eine später stattfindende K.-o.-Runde oder weitere Gruppenspiele qualifizieren. Die beiden besten Mannschaften führten schließlich das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft durch.[16]
Die Gründung der deutschen Fußball-Bundesliga, welche bis heute in ihren Grundzügen besteht, erfolgte zur Saison 1963/64. In diesem Rahmen kam es zu einer radikalen Neuorganisation des Veranstaltungsbetriebes. So wurde eine zentrale oberste Spielklasse geschaffen, in der erst 16 Mannschaften, ab 1965/66 18 Mannschaften[17] in einer Hin- und Rückrunde mit wechselndem Heimrecht zweimal gegeneinander antreten.[18] Eine zweite Bundesliga gab es damals noch nicht. Deutscher Meister durfte sich nennen, „wer nach Durchführung aller Spiele die meisten Gewinnpunkte erzielt hat“[19]. Die Bewertung der einzelnen Spiele erfolgte damals noch nach der 2-Punkte-Regel[20]. Ebenso wurden erstmals Berufsfußballspieler zugelassen, da ohnehin unter der Hand Zahlungen an die Spieler erfolgten. Bis dahin waren alle Spieler Amateure und es war ebenso verboten, Profimannschaften zu bilden.[21] Um die Zahlungen an die Spieler zu begrenzen, wurden allerdings zunächst Gehaltsober- und Untergrenzen eingeführt und die Ablösesummen wurden limitiert.[22] Im Jahre 1972 wurden allerdings alle diese Einschränkungen wieder abgeschafft.[23]
Bis zur Saison 1973/74 bestand die Fußball-Bundesliga nur aus dieser obersten Spielklasse, gleich danach folgten die Regionalligen. Im Jahre 1974 wurde vom DFB mit der 2. Bundesliga eine weitere deutsche Profiliga eingeführt. Diese war zunächst einige Jahre in eine Nord- und Südgruppe aufgeteilt, ab der Saison 1980/81 wurde aber auch sie eingleisig, wobei in Anlehnung an die 1. Bundesliga ebenfalls 18 Mannschaften antraten.[24] Die Absteiger aus den beiden Ligen wurden seit 1963 nach verschiedenen Regeln ermittelt, seit 1992/93 steigen die letzten drei Mannschaften aus der Bundesliga direkt in die 2. Liga ab.[25] Aus der 2. Bundesliga wiederum steigen vier Mannschaften direkt in die zwei Regionalligen (Nord/Süd) ab.[26] In der Saison 1995/96 wurde schließlich die noch heute geltende 3-Punkte-Regel[27] eingeführt.[28]
Heute ist allerdings nicht nur der Gewinn der Meisterschaft, der sicherlich viel Prestige und Anerkennung bringt, für die Vereine interessant, sondern besonders aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ebenso die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe. Die Berechtigung zur direkten Teilnahme oder an verschiedenen Qualifikationsrunden ergibt sich anhand des Tabellenplatzes am Ende der Saison. An der Champions League, die wirtschaftlich mit Abstand den lukrativsten Wettbewerb darstellt, dürfen in der Saison 2005/06[29] auf jeden Fall die beiden Erstplazierten der Bundesliga teilnehmen. Der dritte Verein muss in die Qualifikation; wird diese nicht erfolgreich beendet, spielt diese Mannschaft genau wie die Mannschaften auf den Plätzen vier und fünf im UEFA-Cup. Auch der DFB-Pokalsieger nimmt am UEFA-Cup teil. Darüber hinaus haben die Vereine auf den folgenden zwei oder drei Plätzen ebenfalls die Chance, sich über den UI-Cup für den UEFA-Cup zu qualifizieren.[30]
2.2 Der Ligabetrieb und seine zentralen Organe
Da die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren in der Bundesliga in den letzten Jahren immer weiter an Gewicht gewonnen hat, sind die Bundesligaclubs gezwungen ihre Strukturen an die Erfordernisse der Zukunft anzupassen. Vor diesem Hintergrund kam es am 1. Juli 2001 zu einer Neuordnung des verbandsrechtlichen[31] Rahmens für die Fußball-Bundesliga. Im Folgenden werden überblicksartig die neuen[32] Strukturen und die zentralen Organe für den Betrieb der Ligen beschrieben. Hierzu zählen insbesondere der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der hier im Mittelpunkt stehen wird, sowie die Vereine und die Fußballspieler.[33]
2.2.1 Deutscher Fußball-Bund (DFB)
Das zentrale Organ des deutschen Fußballs stellt der DFB dar, dessen Hauptaufgaben u. a. in der Entwicklung und Förderung des Fußballsports, der Teilnahme an internationalen Wettbewerben durch Auswahlmannschaften sowie der Organisation der 1. und 2. Bundesliga liegen.[34] Seit der Strukturreform im Jahre 2001 fungiert der DFB zwar immer noch als Dachverband der Amateur- und Profivereine, der unmittelbare Einfluss auf den Betrieb der Lizenzligen wurde allerdings aufgegeben, indem die Durchführung des Spielbetriebes der (1.) Bundesliga[35] und 2. Bundesliga auf den Ligaverband übertragen wurde.[36]
Der Liga-Fußballverband e. V. (Ligaverband) kann als eine „Tochtergesellschaft“ des DFB angesehen werden (vgl. Abbildung 1) und ist der als Verein eingetragene Zusammenschluss der lizenzierten Vereine und Kapitalgesellschaften der Fußball-Lizenzligen Bundesliga und 2. Bundesliga.[37] Die Hauptaufgabe des Ligaverbandes liegt darin, die vom DFB exklusiv überlassenen Ligen Bundesliga und 2. Bundesliga zu betreiben.[38] Nichtsdestotrotz besteht aber weiterhin eine enge Bindung zwischen DFB und Ligaverband. So wurden beispielsweise in einem Grundlagenvertrag gegenseitige Rechte und Pflichten[39] vereinbart.[40] Darüber hinaus ist der Ligaverband für die Vergabe der Lizenzen an Vereine und Spieler zuständig. Durch die Gründung des Ligaverbandes hat sich der Einfluss der Vereine auf die Lizenzligen erheblich vergrößert, da die Mitgliederversammlung des Ligaverbande s ausschließlich durch die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga gestellt wird.[41] Geschäftsführer des Ligaverbandes ist die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL)[42]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die Stellung des DFB bei der Organisation der (1.) Bundesliga und der 2. Bundesliga
Quelle: In Anlehnung an Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 415.
Die DFL[43] ist für das operative Geschäft des Ligaverbandes zuständig und übernimmt als Dienstleistungsgesellschaft fast alle Aufgaben, die mit der Durchführung der Lizenzligen verbunden sind.[44] Dazu gehören neben der Leitung des Spielbetriebes auch die exklusive Vermarktung der Bundesliga und 2. Bundesliga. Hierunter fallen die Vergabe der Übertragungsrechte im Fernsehen und Hörfunk sowie die Vermarktung des Bundesligalogos. Lediglich die Lizenzvergabe an Vereine und Spieler verbleibt beim Ligaverband.[45]
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Fußballvereine durch die Gründung von Ligaverband und DFL an Macht gewonnen haben und folglich besser in der Lage sind, die Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga nach ihren Bedürfnissen optimal zu vermarkten.[46]
2.2.2 Fußballclubs und Fußballspieler
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Ligabetriebes sind die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga (je 18 Mannschaften), die den Wettbewerb um die deutsche Fußballmeisterschaft ausspielen. Zur Teilnahme am Spielbetrieb dieser Ligen müssen sich die Vereine einerseits sportlich und andererseits auch wirtschaftlich durch den Erwerb einer Spiellizenz qualifizieren, wobei sportliche, technische, organisatorische und wirtschaftliche Kriterien zur Vergabe herangezogen werden. Im Rahmen der organisatorischen Gestaltung der Fußballvereine genehmigte der DFB den Clubs am 24.10.1998, zusätzliche Rechtsformen (AG, GmbH und KGaA) anzunehmen und sich so vom Idealverein in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Das vorrangige Ziel war, den Vereinen bessere Finanzierungsmöglichkeiten zu ermöglichen (z. B. durch einen Börsengang) und die Einbindung von Interessengruppen (z. B. Sponsoren oder Vermarkter) zu erleichtern.[47]
Den wichtigsten Bestandteil des Ligabetriebes stellen aber sicher die Spieler selbst dar. Die Zulassung der Spieler zum Spielbetrieb ist in der sog. Lizenzordnung Spieler (LOS) geregelt. Grundsätzlich dürfen demnach Amateure, Vertragsamateure und Lizenzspieler zum Spielbetrieb zugelassen werden. Die Lizenzspieler stellen jedoch den größten Teil der Spieler in den Bundesligen. Zwei Voraussetzungen muss der Spieler erfüllen, um am Ligabetrieb teilnehmen zu dürfen: Erstens muss ein gültiger Arbeitsvertrag mit einem Bundesligaclub vorliegen. Zweite Voraussetzung ist ein Lizenzvertrag zwischen Spieler und Ligaverband. Dieser regelt die Rechte und Pflichten aller Lizenzspieler.[48]
3 Die Fußball-Bundesliga – wirtschaftliche Situation und Bedeutung
In diesem Kapitel werden überblicksartig die Einnahmequellen und Ausgabenposten von Fußballunternehmen der Bundesliga beschrieben, wobei der Fokus auf den beiden wichtigsten Einnahmepotenzialen mediale Rechte und Sponsoring/Werbung liegt. Dadurch soll eine genauere Charakterisierung der Bundesligisten und deren Geschäftsfelder erreicht werden. Darüber hinaus werden anhand aktueller Zahlen die wirtschaftliche Entwicklung und die steigende Bedeutung der Branche „Fußball-Bundesliga“ skizziert. Abschließend wird auf die finanzielle Situation der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga eingegangen.
3.1 Einnahmequellen eines Fußballbundesligisten
Die Gesamteinnahmen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga sind seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich angestiegen und haben sich teilweise sogar erheblich gesteigert. So betrugen die Einnahmen in der Spielzeit 1989/90 noch ca. 180 Mio. EUR, in der Saison 1995/96 waren es bereits ca. 450 Mio. EUR.[49] Den Höhepunkt erreichten die Umsätze in der Spielzeit 2002/2003 mit ca. 1,15 Mrd. EUR. In der darauf folgenden Saison 2003/2004 kam es zum ersten Mal zu einem geringen Rückgang auf 1,09 Mrd. EUR, der jedoch auch auf das schwache Abschneiden der deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben zurückzuführen ist.[50] So rechnen 53 % der Bundesligamanager mit einem Gesamteinnahmenanstieg schon in der kommenden Saison und sogar 71 % halten einen Anstieg über die nächsten fünf Jahre für möglich.[51]
Ein Fußballunternehmen hat grundsätzlich fünf größere Einnahmepositionen, die zusammen bereits über 80 % der Erlöse darstellen. Dazu zählen die Erträge aus medialen Rechten (primär Fernsehrechte), Sponsoring und Werbung, Ticketing und Hospitality, Merchandising sowie Transfers. Ebenso existieren einige „sonstige Einnahmenquellen“ von jeweils geringerer Bedeutung. Die beiden wichtigsten Einnahmepositionen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga in der Saison 2003/04 waren das Sponsoring mit einem Anteil von 30,54 % und die Einnahmen aus medialen Rechten mit 26,73 % an den Gesamteinnahmen (vgl. Abbildung 2). Damit fielen die Fernsehgelder seit langem erstmals wieder hinter die Sponsoringeinnahmen zurück.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Einnahmequellen der Vereine der 1. Fußball-Bundesliga der Saison 2003/2004
Quelle: In Anlehnung an DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 12.
Eine große Bedeutung haben ebenfalls die Erträge aus Ticketing und Hospitality mit 18,99 % der Einnahmen. Die Erlöse aus Merchandising und Transfers spielen mit einem Anteil von 3,98 % und 2,93 % dagegen eine relativ geringe Rolle. Die „sonstigen Einnahmen“ summieren sich immerhin auf 16,83 % der Erlöse und sind daher in ihrer Gesamtheit nicht zu vernachlässigen.[52]
3.1.1 Mediale Rechte
Dieser Abschnitt beschreibt zunächst kurz die Gründe für das Ansteigen der Fernsehgelder seit Beginn der Fußball-Bundesliga und geht dann in Grundzügen auf die aktuelle Ausgestaltung der Vergabe der medialen Rechte ein. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Einnahmemöglichkeiten.
3.1.1.1 Die Entwicklung der Fernsehgelder
Wie bereits oben dargestellt, stellen die medialen Rechte, die rund ein Drittel der Erlöse eines Erstligisten ausmachen, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Bundesligisten dar. Dadurch ist aber auch eine gewisse Abhängigkeit gegeben. So sind die Erlöse seit einigen Jahren rückläufig und durch das Sponsoring werden derzeit leicht höhere Einnahmen erzielt.[53] Da jedoch die Fernsehrechte im Gegensatz zu den anderen Einnahmeposten über ein weitaus größeres Erlöspotenzial verfügen, sollen diese zuerst beschrieben werden.[54]
Zu den medialen Rechten werden grundsätzlich die Auswertungsmöglichkeiten über Fernsehen, Hörfunk[55] und Internet gezählt. In jüngster Zeit haben aber auch Rechte aus Neuen Medien und Mobile Devices (Handhelds, Notebooks und Handys) an Bedeutung gewonnen.[56] Die mit Abstand größte Einnahmeposition für die Fußballbundesligisten stellen jedoch weiterhin die Fernsehverwertungsrechte dar. Diese lassen sich nach drei Kriterien aufgliedern: dem Verwertungssystem (Free-TV, Pay-TV, Pay-per-Channel, Pay-per-View), der Verwertungsform (live und zeitversetzt) sowie dem Verwertungsumfang (volle Spiellänge, Zusammenfassung, Highlights etc.). Des Weiteren ist zwischen In-und Auslandsrechten zu unterscheiden.[57]
Als einen entscheidenden Grund für die wachsende ökonomische Bedeutung der Fußball-Bundesliga kann man die kontinuierlichen Einnahmesteigerungen aus den Fernsehgeldern sehen.[58] Hierbei spielten die Veränderungen spezifischer Marktverhältnisse und fernsehtechnischer Möglichkeiten eine ausschlaggebende Rolle. Diese lassen sich grob in drei Phasen einteilen:[59]
In der ersten Entwicklungsphase seit der Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 existierte noch kein funktionsfähiger Sportrechtemarkt in Deutschland. Der einzige Anbieter von Übertragungsrechten war der DFB und auf der Nachfrageseite bestand ein Monopol aus den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Nachdem die Vereine anfangs sogar für die Übertragung zahlen mussten, erhielten sie ab der Saison 1965/66 erstmals Lizenzerlöse. Diese waren jedoch sehr niedrig und entsprachen nicht dem regulären Marktpreis. Bis zur Saison 1984/85 konnte die 5-Mio.-EUR-Grenze jedoch noch nicht übersprungen werden (vgl. Abbildung 3).[60]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Fernseherlöse der Fußball-Bundesliga (2005/2006 geschätzt)
Quelle: In Anlehnung an Kruse, J. (2004), S. 54 sowie Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 29.
Im Jahre 1984 kam es zu entscheidenden Veränderungen der Marktverhältnisse. Durch die Gründung privater Fernsehanstalten entstand ein reger Wettbewerb auf der Nachfrageseite. Die neuen Sender sahen Fußball ferner als ein „Zugpferd“ zur Etablierung im Fernsehmarkt und investierten so viel Geld in die Fernsehrechte. Als erster privater Sender erwarb RTL die Rechte in der Saison 1988/89. Ein weiterer Grund für die Steigerung war das Aufkommen von Sportrechteagenturen. Der DFB veräußerte die Rechte nicht mehr selbst direkt an die Fernsehsender, sondern gab sie an diese Agenturen ab, welche aufgrund ihrer Spezialisierung deutlich höhere Verkaufserlöse (1989/90: rund 23 Mio. EUR) erzielen konnten.[61]
Die dritte Phase der Preisentwicklung begann im Jahre 1991 mit der Einführung des analogen Pay-TV (Premiere). Durch die Live-Übertragung einzelner Bundesligaspiele im Bezahlfernsehen konnten so erneut neue Refinanzierungspotenziale erschlossen und Preissteigerungen erreicht werden. Erst die technische Weiterentwicklung hin zu einem digitalen Pay-TV sorgte jedoch für den Durchbruch und erlaubt es dem Zuschauer, alle Spiele live zu sehen und darüber hinaus einzelne Spiele gegen eine Gebühr auszuwählen (Pay-per-View).[62] In der Saison 2001/2002 wurde mit Einnahmen in Höhe von über 350 Mio. EUR schließlich ein neuer Höhepunkt erreicht. Es waren sogar Zahlungen von 460 Mio. EUR in der Saison 2003/2004 vereinbart, die allerdings nicht mehr vollständig geleistet wurden. Nach der spektakulären Insolvenz der Kirch-Gruppe fielen die Einnahmen bis auf 290 Mio. EUR in der Saison 2003/04 zurück und bewegen sich bis heute auf diesem Niveau.[63]
3.1.1.2 Die derzeitige Ausgestaltung der Vermarktung der Fernsehübertragungsrechte
Wie bereits erwähnt, wurden die Fernsehrechte an der Bundesliga (ebenso der DFB- und Liga-Pokal) in der Geschichte der Bundesliga immer zentral vom DFB (derzeit von der „Tochter“ DFL[64] in Eigenregie) selbst oder aber den beauftragten Rechteagenturen (so vermarktet Sportfive bis 2006 die Auslandsrechte an der Bundesliga[65] ) vergeben. Daher wird in diesem Zusammenhang von einer Zentralvermarktung der Fernsehrechte gesprochen.[66] Ziel dieses Systems ist, über eine solidarische Umverteilung der Fernsehgelder eine Angleichung der finanziellen Basis der Vereine und somit die Voraussetzung für einen ausgeglichenen sportlichen Wettbewerb zu schaffen.[67]
Die Verteilung der TV-Gelder erfolgt dabei nach einem vorgegebenen Schlüssel. Die Vereine der 1. Bundesliga erhalten 77,5 % der Gesamteinnahmen, 22,5 % gehen an die 2. Bundesliga. 50 % der Gelder, die der 1. Bundesliga zugeteilt wurden, werden gleichmäßig auf die Vereine verteilt, so dass ihnen ein gewisser Mindestbeitrag sicher ist. Die anderen 50 % der Gelder sind variabel und werden zu 75 % nach dem sportlichen Erfolg der letzten drei Jahre und zu 25 % nach dem sportlichen Erfolg der aktuellen Saison verteilt.[68]
Allerdings ist umstritten, ob es überhaupt notwendig ist, das Gleichgewicht in einer Liga durch einen organisierten Erlösausgleich zu erhalten.[69] Ebenso stellt sich die Frage, ob durch das in der Bundesliga angewendete Umverteilungssystem überhaupt eine Angleichung der finanziellen Basis möglich ist.[70] Vor diesem Hintergrund wird bis heute intensiv diskutiert, ob die Zentralvermarktung aus ökonomischer und juristischer[71] Sicht das richtige Verfahren darstellt oder ob nicht eine Einzelvermarktung, bei der die Vereine die Rechte an ihren Spielen selbst vermarkten, die bessere Lösung ist.[72] Obwohl diese Diskussion wohl noch länger anhalten wird, hat sich die DFL mit der Europäischen Kommission im Oktober 2003 auf ein neues grundsätzliches Verfahren zur weiteren Zentralvermarktung bis 2009 geeinigt. Danach müssen die Rechte für Pay- und Free-TV sowie für die Verwertung über Internet und Mobilfunk zukünftig in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren getrennt voneinander angeboten und öffentlich ausgeschrieben werden. Außerdem dürfen die Verträge nur noch für maximal drei Jahre ausgeschrieben und vergeben werden.[73] Darüber hinaus erhalten die Fußballunternehmen in ausgewählten Bereichen zum ersten Mal Eigenvermarktungsrechte.[74]
Die Einzelvermarktung findet seit längerem bereits bei den Europokalspielen ihre Anwendung. Nachdem die Zentralvermarktung durch den DFB im Jahre 1997 vom Bundesgerichtshof untersagt wurde, vermarkteten die Vereine ihre Heimspiele im UEFA-Cup[75], im UI-Cup und in den Qualifikationsspielen der Champions-League selbst. So lassen sich bei einer attraktiven Partie bis zu 5 Mio. EUR an Einnahmen von nationalen und internationalen Fernsehanstalten erzielen. Die größte Einnahmequelle stellen aber ganz klar die Champions-League-Rechte dar. Diese werden unter Auflagen der EU-Kommission weiter zentral von der UEFA vermarktet, die den Großteil der Erlöse über Start-, Punkt- und Erfolgsprämien sowie einen sog. „Market-Pool“ wieder an die teilnehmenden Vereine ausschüttet.[76] So nahm Bayern München in der Saison 2000/01 als Champions-League-Sieger ca. 46 Mio. EUR allein aus Fernsehgeldern ein.[77]
3.1.1.3 Das zukünftige Potenzial der Einnahmen aus medialen Rechten
3.1.1.3.1 Langfristige Einflussfaktoren
Schwer einzuschätzen ist, wie sich die Einnahmen aus den Fernsehrechten langfristig entwickeln werden. Denn mit der Vermarktungsart (Zentral- oder Einzelvermarktung) sowie der Entwicklung des Fernsehmarktes haben zwei unterschiedliche Faktoren einen großen Einfluss auf die Einnahmen aus der Erstverwertung, die ca. 84 % der Erträge aus Fernsehrechten ausmachen.[78]
So könnte die Einführung der Einzelvermarktung zu einer völligen Neuordnung des Marktes für Fernsehrechte führen. Allerdings ist die Zentralvermarktung in ihrer heutigen Form bis zum Jahre 2009 gesichert.[79] Ob die Einnahmen dadurch steigen oder sinken, ist umstritten; Kritiker rechnen mit einem Rückgang der Erlöse, da das Angebotsmonopol des DFB (DFL) aufgeweicht würde. Positive Stimmen halten jedoch insgesamt steigende Einnahmen für möglich, da die Vereine ihre Spiele individuell effizienter vermarkten könnten.[80] Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die finanzstarken und erfolgreichen Clubs relativ höhere Einnahmen erzielen werden; hier stellt sich dann insbesondere die Frage nach einem neuen Umverteilungssystem – insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits das derzeitige Umlagesystem besonders von den reicheren Clubs kritisiert wird. Diese erhalten in der Tat weitaus weniger aus dem Topf als ihre Konkurrenten in den anderen europäischen Top-Ligen.[81] Hier zeigt sich ein Dilemma zwischen nationaler und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.[82]
Auf der anderen Seite ist fraglich, wie sich der Fernsehmarkt an sich entwickelt, d. h. ob das Refinanzierungspotenzial der Sender durch Werbeeinnahmen etc. hoch genug ist, um teure Fernsehrechte zu erwerben. Der Werbemarkt scheint sich nach einer Krise allerdings wieder leicht zu erholen. Darüber hinaus werden Digitalisierung und technischer Fortschritt weiterhin neue Möglichkeiten zur Verwertung medialer Rechte liefern. Besonders die Kabelnetzbetreiber werden die Fernsehlandschaft wesentlich beeinflussen. Dies könnte auch die Türen für eine Eigenvermarktung weiter öffnen.[83] Des Weiteren wird immer wieder die Einführung eines eigenen Bundesliga-Senders kolportiert, um die Fernsehgelder zu erhöhen. Ob es dazu demnächst kommen wird, ist allerdings sehr fraglich, vielmehr wird diese Alternative wohl als ein Druckinstrument zur Erhöhung der derzeitigen Fernsehgelder eingesetzt.[84]
Neben diesen beiden wohl wichtigsten Einflussfaktoren werden die Einnahmen auch von der Entwicklung der Neuen Medien abhängen. Da sowohl die Breitbandzugänge zum Internet als auch MMS-fähige Handys und höhere Übertragungsraten auf dem Vormarsch sind, steht dem Wachstum rein technisch nichts im Wege. Allerdings stellt sich die Frage, wie sich diese Märkte vor dem Hintergrund eines umfangreichen Fußballangebots im Free-TV entwickeln werden.[85] Mittel- bis langfristig wird es hier aber wohl deutliches Steigerungspotenzial geben, welches aber aufgrund der dezentralen Vermarktung in diesem Bereich hauptsächlich den größeren Clubs zufallen wird.[86]
Wichtig wird auch der zukünftige Vermarktungserfolg der Bundesliga im Ausland sein. Immer wieder wird kritisch geäußert, dass die Vermarktung der Auslandsrechte noch verbessert werden könne. Die Zahlen scheinen dies zu belegen, so erzielte z. B. die Premier League in England 75-90 Mio. EUR an Einnahmen aus Auslandsrechten, die Bundesliga im gleichen Zeitraum dagegen nur rund 15 Mio. EUR. In diesem Zusammenhang spielt auch die Eroberung des asiatischen Marktes, speziell Chinas, eine große Rolle. So reiste im September 2004 eine deutsche Delegation nach China und unterzeichnete dort ein Memorandum über eine zukünftige Zusammenarbeit. Eben solche Reisen können zu einer Stärkung der Marke „Fußball-Bundesliga“ im Ausland beitragen und die Einnahmen insbesondere aus Fernsehgeldern erhöhen.[87] In diesem Zusammenhang wird auch darüber nachgedacht, die Anstoßzeiten der Bundesliga zu verändern und den Spieltag zeitlich zu strecken.[88] Hier besteht jedoch die Gefahr, dass die Integrität des Spieltages gefährdet wird.[89] Positiv auf den Fußball als Freizeiterlebnis und damit auf die Höhe der Fernsehgelder wird sich sicherlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland auswirken.[90]
3.1.1.3.2 Die Bedeutung des Pay-TV
Besonders interessant erscheinen diese Fragen vor dem Hintergrund, dass die Fernsehgelder in anderen europäischen Top-Ligen[91] höher sind als in Deutschland[92], insbesondere in England. Als Grund wird der höhere Anteil von Pay-TV in anderen Ländern angesehen. Durch eine Steigerung dieses Anteils auch in Deutschland versprechen sich viele Experten deutlich höher Einnahmen.[93] Derweil gibt es in Deutschland Pläne für einen zweiten Pay-TV-Sender von ProSiebenSAT.1 bzw. Kabel Deutschland. Ein Wettbewerb zwischen zwei Pay-TV-Anbietern würde den Wert der Fernsehrechte sicherlich mittelfristig erhöhen.[94] Ebenso wird darüber nachgedacht, die Highlights eines Spieltages erst später auszustrahlen, um die Exklusivität des Bezahlfernsehens zu steigern.[95] Sollte das umfangreiche Free-TV-Angebot allerdings erhalten bleiben, ist auch keine größere Nachfrage im Pay-TV zu erwarten.[96] Ferner ist eine Aufstockung der Liga von 18 auf 20 Clubs im Gespräch.[97] Dies würde die Anzahl der Spieltage und Spiele erhöhen sowie vermutlich auch die Gesamteinnahmen aus den TV-Rechten, die dann allerdings auch auf mehrere Clubs verteilt werden müssten.[98] Selbst eine Veränderung des Spielmodus durch Einführung einer Play-off-Runde oder von Relegationsspielen um den Auf- und Abstieg wird diskutiert.[99]
Es ist noch anzufügen, dass die Maximierung einer Einnahmequelle wie z. B. der audiovisuellen Rechte (Fernsehrechte) auf keinen Fall isoliert betrachtet werden darf. So bestehen vielschichtige Interdependenzen zu anderen Einnahmemöglichkeiten aus Sponsoring, Merchandising und Ticketing. So verlangen die Sponsoringeinnahmen eine hohe Kontaktzahl, die bei einer umfangreicheren Ausstrahlung im Pay-TV sinken dürfte.[100] Auch der Stadionzuschauer darf nicht vergessen werden, sorgt er doch für die nötige Atmosphäre bei der „Produktion“ des Gutes Fußballspiel. Dies muss insbesondere bei Vorschlägen wie der Verlegung der Anstoßzeiten berücksichtigt werden.[101]
Abschließend ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Vergabe der Fernsehrechte für die Saison 2006/2007 höhere Preise erzielt werden dürften. So hält der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, einen Betrag von rund 500 Mio. EUR für marktgerecht.[102] Der DFL-Chef Christian Seifert ist davon überzeugt, dass allein die Pay-TV-Rechte 1 Mrd. EUR wert sind.[103] Allerdings wird es wohl zu einer vermehrten Verlagerung hin zum Pay-TV und einer Aufteilung des Spieltages kommen. Dies wird sicherlich erneut zu Fanprotesten führen. Vor dem Hintergrund der abnehmenden Konkurrenzfähigkeit in Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen muss sich aber auch der Fan die Frage stellen, was er möchte. Denn höhere TV-Einnahmen würden die Bundesliga auch international wieder wettbewerbsfähiger machen, es stände wieder Geld für gute und attraktive Spieler zur Verfügung und auch das Niveau der Bundesliga würde wohl mittelfristig wieder steigen. Es werden in diesem Bereich in den nächsten Jahren also mit Sicherheit viele weitreichende Änderungen anstehen.[104]
Ein erster Schritt in diese Richtung ist durch den kompletten Verkauf der Fernsehrechte an der Champions League ab der Saison 2006/2007 (Free- und Pay-TV) an den Bezahlsender Premiere bereits gemacht. Es wird geschätzt, dass daraus Einnahmen von 60-70 Mio. EUR je Saison resultieren, was einer etwa 15-prozentigen Steigerung entsprechen würde.[105] Nur einen Tag später wurde bekannt, dass Premiere ebenso Interesse an einem vollständigen Erwerb der Bundesligarechte hat. Des Weiteren plant der Bezahlsender in diesem Zusammenhang die Etablierung eines eigenen Free-TV-Senders, in dem weniger interessante Begegnungen gezeigt werden sollen. Ferner gab es auch bereits kritische Stimmen, die negative Wirkungen für den Fußball befürchten, wenn dieser der Öffentlichkeit nicht mehr frei zugänglich wäre.[106]
3.1.2 Sponsoring
Im ersten Abschnitt geht dieses Kapitel zunächst auf definitorische Abgrenzungen des Sportsponsorings ein. Dann werden die drei Hauptbereiche des Fußballsponsorings Trikotwerbung, Ausrüsterverträge und Bandenwerbung näher skizziert, bevor im letzten Teil ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung folgt.
3.1.2.1 Grundlagen des Sportsponsorings
Zu den zwei bedeutendsten Absatzmärkten im bezahlten Fußball gehört neben den medialen Rechten der Markt für Werbung und Sponsoring. In der Saison 2003/2004 waren die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring erstmals wieder höher als jene aus der Verwertung medialer Rechte.[107] Sie beliefen sich inzwischen auf rund 300 Mio. EUR.[108] Grund waren allerdings die starken Rückgänge der Erlöse aus Fernsehgeldern, denn auch die Sponsoringeinnahmen selbst gingen leicht zurück.[109] Allerdings hat das Sportsponsoring als Kommunikationsinstrument in den letzten Jahren generell eine deutliche Aufwertung erfahren. So lagen die Einnahmen in der Spielzeit 1999/2000 noch bei rund 150 Mio. EUR.[110] Als Ursache kann u. a. die steigende Reaktanz der Konsumenten gegenüber klassischen Werbeformen wie z. B. der Fernsehwerbung angesehen werden.[111]
Das Sportsponsoring lässt sich aus der Sicht des Marketings kennzeichnen als
- die Zuwendung von Finanz-, Sach-, und/oder Dienstleistungen von einem Unternehmen, dem Sponsor,
- an eine Einzelperson, eine Gruppe von Personen oder eine Organisation bzw. Institution aus dem gesellschaftlichen Umfeld des Unternehmens, dem Gesponserten,
- gegen die Gewährung von Rechten zur kommunikativen Nutzung von Personen bzw. Organisation und/oder Aktivitäten des Gesponserten
- auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.
Existiert eine Übereinkunft aufgrund eines Vertrages, so wird aus Sicht der Sponsoren von Sponsorship gesprochen.[112]
Nicht eindeutig ist in der Literatur die Abgrenzung von Werbung und Sponsoring. So werden oft auch einzelne Werbemaßnahmen wie z. B. die Bandenwerbung, die nicht auf einem umfassenden Leistungs-Gegenleistungs-Prinzip basieren, als Sportsponsoring bezeichnet. Da auch bei der Erfassung der Einnahmen auf Vereinsebene meist auf eine Unterscheidung verzichtet wird, soll im Folgenden der Begriff „Sponsoring“ für beide Einnahmequellen verwendet werden.[113]
Das Sponsoring im Sport ist also gekennzeichnet durch eine Leistungs-Gegenleistungs-Beziehung, wobei die Sponsoren durch ihr Engagement den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens, eines Produkts oder einer Marke steigern wollen.[114] Hierbei schätzen die Unternehmen insbesondere die Multiplikatorwirkungen durch Fernsehübertragungen.[115] Darüber hinaus ist der Fußball mit einer Reihe positiver Attribute besetzt (kampfbetont, leistungsorientiert, dynamisch und zeitgemäß)[116] und kann so als Katalysator angestrebter Imageveränderungen dienen. Ebenso kann in Märkten mit hoher Konkurrenz und homogenen Produkten das Sportsponsoring zur sekundären Produktdifferenzierung eingesetzt werden. Insbesondere mit dem Sponsoringvertrag verbundene Eintrittskarten und der Zugang zu VIP-Bereichen erlauben eine bessere Kunden- und Mitarbeiterbindung. Insofern können allein durch moderne Stadien auch die Sponsoringeinnahmen erhöht werden.[117]
Das Sponsoring der Bundesliga-Vereine findet hauptsächlich in den drei Bereichen Trikotwerbung, Bandenwerbung und Ausrüsterverträge statt.
3.1.2.2 Trikotsponsoring
Auf das Trikotsponsoring entfallen dabei die Haupteinnahmen. Diese werden in der Regel von den sog. Hauptsponsoren geleistet, die darüber hinaus meist auch bei weiteren Werbeflächen im Stadion oder in anderen Bereichen bevorzugt behandelt werden. So erhalten Hauptsponsoren z. B. das Recht, mit dem Vereinsemblem für eigene Produkte zu werben.[118] In der Saison 2004/2005 nahmen die 18 Mannschaften der 1. Bundesliga so zusammen allein 95 Mio. EUR ein, womit die Einnahmen in diesem Bereich in den letzten fünf Jahren um über 53 % gestiegen sind.[119] Damit hat das Sponsoring in der Bundesliga eine beachtliche Erfolgsgeschichte hinter sich, sind doch erst im Jahre 1974 die ersten Mannschaften mit Trikotwerbung aufgelaufen. Erste deutsche Mannschaft mit Trikotwerbung war Eintracht Braunschweig mit dem Sponsor „Jägermeister“.[120] Nur fünf Jahre später waren alle Bundesligisten mit Trikotsponsoren ausgestattet, wobei die Gesamterlöse der Bundesliga gerade einmal 3,5 Mio. EUR betrugen.[121] Heute nimmt die Bundesliga im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen die Spitzenreiterposition ein. Jeder deutsche Bundesligist nimmt durchschnittlich 4,9 Mio. EUR pro Jahr ein, in Italien liegt der Wert bei 3,1 Mio. EUR, in England bei 2,9 Mio. EUR, in Frankreich bei 2,3 Mio. EUR und in Spanien bei nur 1,8 Mio. EUR.[122] Als Gründe werden der große Absatzmarkt in Deutschland und das professionelle Auftreten der Vermarktungsagenturen gesehen.[123] So haben fast alle Bundesligavereine ihre Sponsoringrechte, zumindest aber Teile davon, an solche Agenturen abgegeben.[124] Der Preis für die Trikotwerbung richtet sich dabei nach dem Bekanntheitsgrad, dem Image, dem sportlichen Erfolg und der Medienpräsenz des jeweiligen Vereins. Die Verträge enthalten dementsprechend in der Regel eine erfolgsabhängige Komponente.[125] Daher variieren die Einnahmen zwischen den Vereinen auch erheblich. Branchenprimus in der Saison 2004/2005 ist der FC Bayern München, der von T‑Mobile 17 Mio. EUR jährlich erhält; der FSV Mainz bekommt im Rahmen des Vertrages mit DB Winterthur hingegen nur 2 Mio. EUR.[126]
3.1.2.3 Ausrüsterverträge
Eine weitere wichtige Einnahmequelle stellen die Ausrüsterverträge zwischen Sportartikelherstellern und Bundesligaunternehmen dar. Gerade vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sind die Erlöse gestiegen, da sich die Ausrüster im Umfeld der WM platzieren möchten.[127] Es handelt sich dabei um ein vertraglich fixiertes Ausrüstungsabkommen, nach dem sich die Vereine verpflichten, ausschließlich die Produkte des Vertragspartners – wie Wettkampfs- und Trainingsbekleidung sowie Schuhe – von den Spielern tragen zu lassen.[128] Einen wichtigen Parameter für die Höhe des Vertrages stellen die verkauften Trikots an die Fans (sog. Replica) dar. Die namhaften Ausrüster konzentrieren sich in letzter Zeit immer mehr auf die Top-Clubs, wodurch auch in diesem Bereich die Schere zwischen „Arm“ und „Reich“ weiter auseinander zu gehen scheint.[129]
3.1.2.4 Bandenwerbung
Zu den beliebtesten Werbeformen bei den Unternehmen zählt die Bandenwerbung, und das, obwohl die Möglichkeit des Anbringenens von Werbebotschaften auf Banden, d. h. auf fest installierten Stadionbegrenzungen, in der Bundesliga erst seit Mitte der achtziger Jahre existiert. Seitdem ist es in diesem Bereich zu vielfältigen Neuentwicklungen gekommen. So werden inzwischen Banden in der zweiten Reihe, Powerpacks (zwei übereinander stehende Banden), Radialbanden (die Bande wird durch eine Krümmung der Werbefläche um bis zu 45 % erhöht), Werbeteppiche (neben dem Tor im 3-D-Format) oder auch Drehbanden aufgestellt.[130] Letztere erhöhen die Einnahmen deutlich, da es so durch Intervallschaltung möglich ist, einen Sponsor auf einer ganzen Spielfeldseite zu zeigen, was die Werbewirksamkeit erhöht. Bayern München entwickelte sogar ein neues Bandenrotationssystem, bei dem die Bandenwerbung in einem bestimmten Ausmaß um das Spielfeld „wandert“ und so mehr Zuschauer erreicht. Seit 2001 sind auch elektronische LED-Videobanden erlaubt, die aufgrund hoher Kosten allerdings kaum Anwendung finden. Vielmehr vertreten Experten die Meinung, dass diese Werbeform von der virtuellen Bandenwerbung abgelöst werden wird, die bereits seit dem. 01. 04. 2000 erlaubt ist. Mit Hilfe von Computertechnologie wird auf einfarbigen Banden für den Fernsehzuschauer Werbung eingespielt, wodurch regionale und nationale Werbesplits möglich sind.[131]
Neben den Hauptsponsoren und Ausrüstern haben die Bundesliga-Clubs darüber hinaus überregionale Co-Sponsoren und regionale Sponsoren, welche jeweils aus einem großen Sortiment an individuellen Leistungspaketen wählen können. Neben der schon ausführlicher dargestellten Bandenwerbung zählen dazu Videotafelwerbung, Stadiondurchsagen (vor, nach und während des Spiels), Halbzeit-Spiele oder Anzeigen in der Stadionzeitung. Ergänzend hinzukommen können z. B. Fototermine mit der Mannschaft, Autogrammstunden mit Spielerpersönlichkeiten oder andere produktfördernde Maßnahmen. Dies kann dazu führen, dass z. B. alle Spieler die Wagenmarke des Hauptsponsors fahren.[132]
3.1.2.5 Aussichten
Die Sättigungsgrenze scheint im Bereich Sponsoring zwar noch nicht erreicht zu sein, aber die großen Steigerungsraten der Vergangenheit werden sich sicherlich nicht wiederholen lassen. Trotzdem rechnen für das Jahr 2005 immerhin 64 % der Führungskräfte der Bundesligaunternehmen mit steigenden Einnahmen in diesem Segment.[133] Denn das Trikot- und Ausrüstersponsoring ist in seinen Möglichkeiten begrenzt. Einnahmesteigerungen können wohl nur noch über innovative Werbeformen erreicht werden. So bietet besonders die virtuelle Bande gerade bei internationalen Spielen Steigerungspotenziale. Auch die Einführung bislang verbotener Werbeformen wie Rasen- und Tornetzwerbung, die in anderen Sportarten schon eingesetzt werden, könnten innovative Einnahmemöglichkeiten darstellen.[134]
Die beste Möglichkeit zur Einnahmesteigerung liegt aber sicher im Verkauf von Stadion-Namensrechten. Vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und den damit zusammenhängenden Stadionneubauten haben bereits eine Reihe von Arenen den Namen eines Sponsors angenommen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Verein Eigentümer des Stadions ist oder dass das Recht im Rahmen einer langjährigen Verpachtung auf den Pächter übergeht.[135] Die Bedeutung des Verkaufs von Namensrechten wird auch vermutlich weiter steigen, da es eine langfristige und solide Finanzierungsalternative im Stadionbau darstellt.[136] So schätzen Experten, dass 10-15 % der jährlichen Kosten für Zins und Tilgung direkt aus den Namensrechten finanziert werden können.[137] Zugleich werden teilweise auch einzelne Tribünen in der Praxis vermarktet.[138]
Eine weitere mögliche Einnahmequelle könnte das sog. Ligasponsoring darstellen, bei dem die Sponsoren als Werbepartner einer Liga fungieren und auch meist deren Namenszug in den Liganamen integriert wird.[139] Darüber hinaus erhalten sie normalerweise weitere exklusive Rechte zur Werbung in den Stadien. Die Einnahmen gehen dabei größtenteils an die Vereine, teilweise sind aber auch die Ligaorganisation und Verbände an den Erlösen beteiligt. So erhielt die englische Premier League beispielsweise ungefähr 16 Mio. EUR pro Jahr aus dem Ligasponsoring.[140] Es stellt sich allerdings die Frage, ob ein Ligasponsoring überhaupt gewünscht wird, da es in Konkurrenz zu anderen Sponsoringformen steht.[141] So scheiterten bereits im Jahre 2003 aus diesem und anderen Gründen die Verhandlungen zwischen der DFL und Vodafone über ein mögliches Ligasponsoring.[142] In der jüngsten Vergangenheit wurde das Thema wieder aktuell, als bekannt wurde, dass u. a. der Pay-TV-Sender Premiere an einem Erwerb des Namensrechts interessiert ist. Erwartet werden dabei Einnahmen von 40 bis 50 Mio. EUR pro Saison.[143]
Letztlich gehen die meisten Experten davon aus, dass sich die Schere zwischen „armen“ und „reichen“ Clubs besonders im Bereich des Sponsorings weiter öffnen wird, da sportlich erfolgreichere Clubs besonders im Fernsehen mehr Zuschauer erreichen und so für die Unternehmen interessanter sind.[144]
3.1.3 Ticketing / Hospitality
Zu Beginn der Bundesliga stellten die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Ticketing) noch die einzige Finanzierungsquelle für die Vereine dar.[145] Dies hat sich über die Jahre weitgehend geändert. Heute spielen die Einnahmen aus medialen Rechten und Sponsoring die wichtigste Rolle. So sank der Anteil der Erlöse aus Ticketing und Hospitality[146] von 26,5 % in der Spielzeit 1999/2000 auf 16 % in 2001/2002.[147] Dennoch sind die Erlöse aus dem Stadionbesuch mit einem Anteil von 18,99 % in der Saison 2003/2004 immer noch die drittgrößte Einnahmequelle der Bundesligavereine und somit von großer Bedeutung.[148] Darüber hinaus sind die Einnahmen sehr stabil, da sie sich von Saison zu Saison kaum verändern. Ein Teil der Erlöse steht aufgrund der vorab verkauften Dauerkarten[149] bereits vor der Saison fest, was eine größere Planungssicherheit und auch finanzielle Vorteile durch z. B. Zinsgewinne mit sich bringt.[150] Ferner sind diese Einnahmen sehr profitabel, da die Bruttomargen oft bei über 80 % liegen.[151]
Die Zuschauerzahlen sind seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich gestiegen und stellen einen Indikator für den Fußballboom in Deutschland dar. Seit der Saison 2003/2004 liegt die 1. Bundesliga mit einem Schnitt von 35.048 Zuschauern pro Spiel sogar europaweit an der Spitze, wobei allein zur vorherigen Saison eine Steigerung der Besucherzahl um 10 % erzielt werden konnte. Dieser Trend hat sich in der gerade beendeten Spielzeit 2004/2005 fortgesetzt, als 11.568.788 Besucher in die Stadien kamen. Dies waren 37.806 Zuschauer pro Spiel und somit eine erneute Steigerung um rund 8 %.[152] Als Hauptgrund sind die neuen modernen Arenen, die anlässlich der Weltmeisterschaft 2006 gebaut wurden, zu sehen.[153] So kam es in den neuen Stadien zu einer immensen Steigerung der Zuschauerzahlen zwischen 34 und 104 %.[154] Auch wenn diese hohen Zahlen aufgrund des Neugiereffekts nicht dauerhaft gehalten werden können, ist der Anstieg erheblich.[155] Eine gewisse Nachhaltigkeit der gestiegenen Zuschauerzahlen kann aber bereits beobachtet werden.[156]
Aber nicht nur die Zuschauerzahlen sind gestiegen, sonder darüber hinaus in einem noch größeren Umfang die Erlöse. Ursächlich dafür sind die durchschnittlich höheren Eintrittspreise[157] durch das höhere Angebot an Business-Seats und VIP-Logen[158] sowie die Umwandlung von Steh- in Sitzplatzbereiche.[159] Denn dieser neu geschaffene Komfort erlaubt die Abschöpfung einer höheren Zahlungsbereitschaft.[160] Es wird geschätzt, dass Logen und Business-Seats bis zu 50 % der Stadioneinnahmen ausmachen können.[161] So nahm in der Saison 2003/2004 jeder Bundesligaclub durchschnittlich rund 11,5 Mio. EUR aus Eintrittsgeldern ein.[162]
Zusätzliche Einnahmen versuchen die Clubs durch eine verstärkte Etablierung stadioninterner oder ‑naher Dienstleistungen zu erzielen. So findet man im oder am Stadion heute schon teilweise Restaurants oder Hotels, aber auch Geschäfte und Museen. Die Tendenz geht somit klar hin zu einer Schaffung einer „Erlebniswelt Stadion“.[163]
Wie in den Bereichen Sponsoring und mediale Rechte üblich, werden auch die Ticketingrechte der Vereine zunehmend von Vermarktungsagenturen übernommen. Das Ticketing umfasst dabei alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Eintrittskarten. Darin inbegriffen sind die Herstellung, der Verkauf der Werbeflächen auf den Karten, der Vertrieb und Einzelverkauf, die Einlasskontrolle und die Preisgestaltung. Dafür erhalten die Vermarkter in der Regel die Vorverkaufsgebühr und einen Provisionssatz zwischen 3 und 10 %.[164]
Insgesamt ist mit einem weiteren Anstieg der Einnahmen aus Ticketing und Hospitality, wenn auch moderat, zu rechnen. Die Manager der Bundesligisten erwarten zu 35 % steigende Umsätze in diesem Bereich und weitere 47 % rechnen immerhin mit gleich bleibenden Einnahmen.[165] Einige Stadien hatten aufgrund der Um- und Neubauten noch nicht die volle Kapazität erreicht und werden jetzt wahrscheinlich für weiter steigende Zuschauerzahlen bei höheren Eintrittspreisen sorgen. Ebenso versprechen moderne Abrechungssysteme und eine bessere Steuerung des Waren- und Personaleinsatzes ansteigende Cateringumsätze durch höhere Umlaufgeschwindigkeiten.[166] Ebenso bestehen durch optimierte Werbeflächen gute Voraussetzungen zur Steigerung der Sponsoringeinnahmen.[167] Ein Fragezeichen stand jedoch bis vor kurzem hinter den Einnahmen aus dem Hospitality-Geschäft. Denn lange war die steuerliche Behandlung der Logen nicht abschließend geklärt. Wären in diesem Bereich Nachteile für die Unternehmen entstanden, hätten die Logen sicherlich nicht mehr zu den heutigen Preisen vermietet werden können.[168] Doch seit kurzem besteht dank einer Entscheidung des Bundesfinanzministeriums rechtliche Klarheit. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von VIP-Räumen als Betriebsausgaben ist gegeben. Die Clubs müssen also nicht mit Einbußen in diesem Bereich rechnen.[169]
3.1.4 Merchandising
Das Merchandising zählt heute mit einem Anteil von knapp 4 % an den Erlösen und Gesamteinnahmen von jährlich etwa 40-80 Mio. EUR[170] sicher nicht mehr zu den wichtigsten Einnahmequellen der Bundesligisten. Früher war der Anteil dieser Einnahmen zwar einmal höher (über 7 % in der Saison 2001/2002), allerdings ist dies auf das rasante Wachstum in den anderen Bereichen zurückzuführen.[171] Dennoch hat es darüber hinaus eine wichtige Bedeutung, um das strategische Ziel der Fan-Bindung und Markenpflege zu unterstützen.[172]
Als Merchandising- oder Fanartikel werden alle Produkte bezeichnet, die in Verbindung mit dem Namen eines Fußballclubs verkauft werden.[173] Dabei ist im Detail zwischen den drei verschiedenen Vertriebsformen Merchandising, Licensing und Komplettvermarktung zu unterscheiden.[174] Wenn der Club die Artikel komplett selbst vertreibt oder aber nur Teile der Vermarktungsrechte (z. B. Funktionslizenzen, Produktlizenzen für Randprodukte) an Dritte abgetreten werden, so wird von Merchandising im engeren und weiteren Sinne gesprochen.[175] Die Produktion der Artikel wird in der Regel an Partnerunternehmen abgegeben, um das wirtschaftliche Risiko zu begrenzen. Der Vertrieb geschieht dagegen in Eigenvermarktung über clubeigene Fanshops und Versandhandel oder Internet. Das Vermarktungsrisiko verbleibt dann beim Verein. Oft wird aber auch der Vertrieb der Fanartikel durch Lizenzabkommen komplett an die Produzenten abgetreten, die diese dann über den Groß- und Einzelhandel vertreiben. Dafür zahlen diese einen Festbetrag und/oder eine gewisse Gebühr je verkauften Artikel.[176] In diesem Fall spricht man vom sog. Licensing.[177] Bei der Komplettvermarktung werden alle Rechte an den Fanartikeln oder einem Teil davon gegen eine Gebühr an eine Agentur oder einen Rechtehändler abgegeben. Darüber hinaus werden auch die Erlöse nach einem vorher festgelegten Schlüssel aufgeteilt. In der Praxis sind häufig verschiedene Kombinationen dieser Idealtypen anzutreffen[178], wobei der Trend wieder zur Selbstvermarktung geht und die Rolle der Agenturen und Vermarkter abnimmt.[179]
Die Höhe der Merchandising-Einnahmen hängt dabei vom Bekanntheitsgrad des Vereins und der Spieler, dem sportlichen Erfolg und den Marketing-Aufwendungen des Vereins ab.[180] Aber auch die Internationalisierung des Fußballs durch z. B. die Einführung der Champions League und die damit einhergehende Kommerzialisierung haben zu höheren Einnahmen geführt. Sogar Erfolge der Nationalmannschaft erhöhen die Absätze der Clubs.[181] Dabei ist die Verteilung der Einnahmen auf die einzelnen Vereine der Liga sehr ungleich, da mehr als zwei Drittel der Erlöse auf nur fünf Vereine entfallen.[182]
Das Merchandising wird seinen Anteil im Vergleich zu den anderen bedeutenden Einnahmequellen zwar in Zukunft nicht im großen Maße steigern können. Jedoch deutet vieles darauf hin, dass sich die Einnahmen durchaus erhöhen lassen.[183] Dies bestätigen auch die Zukunftsaussichten der Bundesligamanager, die zu 47 % von einem Wachstum in diesem Bereich ausgehen.[184] So scheint insbesondere die Bundesliga im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen einen großen Nachholbedarf zu haben. Während in Deutschland nur rund ein Drittel der Anhänger Fanartikel besitzen, sind es in England 60 % und in Spanien 63 %.[185] Ebenso stellen die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und die steigenden Zuschauerzahlen in den Stadien Faktoren da, die für einen Anstieg der Einnahmen sprechen. Genauso eröffnen neue innovative Produkte wie Spar- oder Kreditkarten, die in Zusammenarbeit mit Finanzinstituten vergeben werden, neue Absatzmöglichkeiten.[186] Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Umsätze allein noch nichts aussagen, entscheidend für die Vereine sind schließlich die Gewinne. Gegen ein größeres Wachstum spricht folglich die geringe Unsatzrendite im Merchandising, die bei gerade einmal bei 10-15 % liegt.[187] Viele Clubs sollen sogar über Jahre Verluste in diesem Segment gemacht haben.[188] Die Gewinne können jedoch über eine professionelle Ausrichtung[189] im Bereich Merchandising ohne Frage gesteigert werden.[190] So muss es im Rahmen eines Controllings beispielsweise zu verschiedenen Kontrollmaßnahmen und Wirkungsmessungen kommen, um die Erfolgswirtschaftlichkeit und Effizienz der Merchandising-Aktivitäten zu bewerten.[191]
3.1.5 Transfererlöse
Relativ große Einnahmen lassen sich durch Spielertransfers erzielen. Dies verdeutlicht der Wert der Bundesligakader. So wird der gesamte Transferwert der Bundesligisten momentan auf knapp über 1 Mrd. EUR geschätzt. Allein der FC Bayern München verfügt demnach über Spieler im Wert von über 170 Mio. EUR. Dagegen wird der Transferwert von Hannover 96 auf ca. 44 Mio. EUR geschätzt und der von Mainz 05 nur auf 12,5 Mio. EUR.[192] Allerdings hat die Bedeutung von Transfererlösen seit dem Bosman-Urteil abgenommen, da für Spieler, deren Vertrag abgelaufen ist, keine Ablösesummen mehr fällig werden und diese ablösefrei wechseln können.[193] So können Vereine in einer Krisensituation ihre Liquiditätslage nicht mehr auf einen Schlag durch mehrere Spielerverkäufe verbessern. Ebenso ist der Verkauf nur noch in den Transferfenstern der Sommer- und Winterpause möglich.[194] Besonders problematisch kann dies im Falle eines Abstiegs werden, da ein Großteil der Spieler nur Verträge für die entsprechende Liga besitzt und so ablösefrei wechseln kann. Dies kommt einer Kapitalvernichtung beim absteigenden Club gleich.[195]
[...]
[1] Für eine kurze Zusammenfassung der ökonomischen Besonderheiten des Profifußballs vgl. ausführlicher z. B. Kurscheidt, M. (2005a), S. 216-221 oder Lehmann, E. / Weigand, J. (2002b), S. 95-101.
[2] Vgl. Klein, M.-L. (2004), S. 13.
[3] Vgl. Klein, M.-L. (2004), S. 14.
[4] Vgl. Schmidt, L. / Welling, M. (2004), S. 5.
[5] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 43.
[6] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2003), S. 11.
[7] Vgl. ausführlicher Kapitel 3.1.1.3.
[8] Vgl. Schewe, G. / Gaede, N. / Küchlin, C. (2002), S. 9.
[9] Vgl. Klein, M.-L. (2004), S. 18-19.
[10] Daher ist unter dem Begriff „Bundesliga“ im Folgenden immer die „1. Bundesliga“ zu verstehen.
[11] Eine Ausnahme bilden hier die im Rahmen der Fußball-WM 2006 errichteten Stadien und die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der WM.
[12] Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Begriffe Fußballverein, Fußballclub, Fußballteam, Fußballmannschaft, Fußballunternehmen und Fußballkapitalgesellschaft ungeachtet der tatsächlich zugrunde liegenden Rechtsform synonym verwendet. Demzufolge werden Rechtsformspezifika wie etwa AG, KGaA etc. nicht aufgeführt.
[13] Gründer war der vom englischen Sport begeisterte Lehrer Konrad Koch aus Braunschweig.
[14] Einen Überblick über die heutige Ausgestaltung des DFB gibt das Kapitel 2.2.1.
[15] Vgl. Frick, B. (2005b), S. 1.
[16] Vgl. Erning, J. (2000), S. 31-32.
[17] Diese Regelung wurde nur in der Saison 1991/92 ausgesetzt. Damals wurden im Rahmen der Wiedervereinigung mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden zwei zusätzliche Mannschaften in die Bundesliga aufgenommen. Außerdem wurde sechs weiteren Ostclubs die Teilnahme an der 2. Liga ermöglicht.
[18] Vgl. Erning, J. (2000), S. 32.
[19] Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.) (2004), § 2 Nr. 2a.
[20] Nach dieser erhielt der Sieger einer Partie 2:0 Punkte, der Verlierer 0:2 und bei einem Unentschieden bekamen beide Teams 1:1 Punkte zugesprochen. Vgl. Erning, J. (2000), S. 32.
[21] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 24.
[22] Die Untergrenze lag bei 250 DM pro Monat, die Obergrenze bei 1.200 DM pro Monat, die maximale Ablösesumme bei 50.000 DM, wobei nicht mehr als 5.000 DM an den Spieler selbst gezahlt werden durften.
[23] Vgl. Frick, B. (2005b), S. 2.
[24] Vgl. Erning, J. (2000), S. 32.
[25] Vgl. Erning, J. (2000), S. 33.
[26] Vgl. Erning, J. (2000), S. 34-35.
[27] Nach dieser erhält der Gewinner 3 Punkte, der Verlierer 0 Punkte und bei einem Unentschieden bekommen beide Mannschaften je 1 Punkt gutgeschrieben.
[28] Vgl. Erning, J. (2000), S. 32.
[29] Die hier dargestellten Kriterien gelten für die Qualifikation der internationalen Wettbewerbe in der Saison 2005/2006, die Qualifikationsbedingungen können sich jedoch theoretisch jährlich ändern, da sie von der Reihenfolge der Mitgliedsländer in einer Rangliste abhängen, die sich nach der sog. UEFA 5-Jahreswertung ergibt. Vgl. hierzu ausführlicher o. V. (2005a) und o. V. (2005b).
[30] Vgl. Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.) (2005); neben diesen Regelungen existieren zahlreiche Sonderregelungen, die aber nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen und hier nicht weiter erläutert werden.
[31] Anders als in anderen Ländern wie z. B. den USA ist die Liga in Deutschland kein selbständiger zentraler Akteur, sondern ein verbandlicher Zusammenschluss aller an ihr beteiligten Lizenzvereine. Vgl. Straub, W. (2002), S. 106.
[32] Auf die alten Strukturen und den Reformprozess kann hier nicht näher eingegangen werden, da dies den Rahmen sprengen würde und nicht Thema dieser Arbeit ist. Vgl. hierzu ausführlicher Schmidt, S. (2003). c
[33] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 415.
[34] Vgl. Deutscher Fußball-Bund (2001), § 4.
[35] In Satzungen etc. wird die 1. Fußball-Bundesliga nur Bundesliga genannt.
[36] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 415, sowie Deutscher Fußball-Bund (2001), § 16a.
[37] Vgl. Ligaverband (2001), Präambel.
[38] Vgl. Ligaverband (2001), § 4.
[39] So erhält der Ligaverband 25 % der Medieneinnahmen bei Länderspielen vom DFB und dieser vom Ligaverbund einen Pachtzins, der anhand Medien und Zuschauereinnahmen aus den Bundesligaspielen berechnet wird. Vgl. Müller, J. C. (2003), S. 559.
[40] Vgl. Müller, J. C. (2003), S. 559.
[41] Bis zum Frühjahr 2001 gehörten die Clubs als außerordentliche Mitglieder noch unmittelbar dem DFB an. Vgl. Müller, J. C. (2003), S. 558.
[42] Vgl. Ligaverband (2001), § 7 Nr. 2.
[43] Kontrollmedium der DFL ist ein Aufsichtsrat, der bewusst personengleich mit dem Vorstand des Ligaverbandes ist. Dadurch sollen langwierige Abstimmungsprozesse vermieden und die Kommunikation verbessert werden. Vgl. Holzhäuser, W. (2004), S.21.
[44] Vgl. Ligaverband (2001), § 4; vgl. Deutsche Fußball Liga GmbH (2001), § 2.
[45] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 416.
[46] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 416.
[47] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 416.
[48] Vgl. Littkemann, J. / Brast, C. / Stübinger, T. (2003), S. 417.
[49] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 43.
[50] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2003), S. 11.
[51] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 16.
[52] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 12.
[53] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 12.
[54] Vgl. Klewenhagen, M. / Klotz, P. / Sohns, M. / Weilgurny, M. (2005), S. 12.
[55] In diesem Zusammenhang läuft derzeit ein Grundsatzprozess, in dem die privaten Fernsehsender aus Informationsgründen kostenlose Radioübertragungen aus den Stadien fordern. Die ersten beiden Instanzen wurden jedoch verloren und mit einer anderen Entscheidung ist wohl auch in weiteren Instanzen nicht zu rechnen. Vgl. hierzu ausführlicher WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 71-73.
[56] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 58.
[57] Vgl. Elter,V.-C. (2002), S. 260.
[58] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 34.
[59] Vgl. Amsinck, M. (1997), S. 62.
[60] Vgl. Schewe, G. / Gaede, N. (2002), S. 136-137.
[61] Vgl. Schewe, G. / Gaede, N. (2002), S. 137.
[62] Vgl. Schewe, G. / Gaede, N. (2002), S. 137.
[63] Vgl. Roy, P. (2004), S. 38.
[64] Vgl. ausführlicher Kapitel 2.2.1.
[65] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 29.
[66] Vgl. Elter,V.-C. (2002), S. 261.
[67] Vgl. Elter,V.-C. (2002), S. 261.
[68] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 10-11. Für das detaillierte Verfahren der Aufteilung (allerdings mit alten Zahlen, aber nach dem gleichen Prinzip) vgl. Elter, C.-V. (2002), S. 262-265.
[69] Vgl. Roy, P. (2004), S. 38.
[70] Vgl. Hübl, L. / Swieter, D. (2002b), S. 39.
[71] Hier spielen kartellrechtliche Fragen auch auf europäischer Ebene eine große Rolle, auf die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen werden kann. Vgl. hierzu ausführlicher Kuczera, M. (2004).
[72] Vgl. Roy, P. (2004), S. 38-39.
[73] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 59.
[74] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 60.
[75] Durch die Einführung einer Gruppenphase seit der Saison 2004/2005 sind den Vereinen mehr Spiele garantiert, was den Wettbewerb aufwertet und auch zu höheren Einnahmen aus den TV-Rechten führen könnte.
[76] Vgl. WGZ-Bank / Deloitte & Touche (2001), S. 71-72.
[77] Vgl. Nitschke, A. (2003), S. 26.
[78] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 13.
[79] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 35.
[80] Vgl. zu dieser Diskussion die Artikel in Kapitel 4.2.4.
[81] Denn selbst wenn die Bundesliga ihre Fernseheinnahmen auf das Niveau der anderen Top-Ligen steigern könnte, würde das den deutschen Top-Clubs im internationalen Vergleich nur bedingt helfen. Bei angenommenen 500 Mio. EUR aus den Fernsehrechten erhielte z. B. der FC Bayern München Mehreinnahmen von gut 10 Mio. EUR und damit insgesamt ca. 26 Mio. EUR. Berücksichtigt man, dass Juventus Turin allein aus einem Pay-TV-Vertrag unglaubliche 90 Mio. EUR pro Jahr erhält, ist dies sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vgl. Klewenhagen, M. / Klotz, P. / Sohns, M. / Weilgurny, M. (2005), S. 15.
[82] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 4.
[83] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 75-76.
[84] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 13.
[85] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 67-70.
[86] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 14.
[87] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 67-70.
[88] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 13.
[89] Vgl. Erning, J. (2000), S. 148.
[90] Vgl. Nitschke, A. (2003), S. 24.
[91] Mit Ausnahme von Spanien.
[92] Laut dem Manager des FC Schalke 04, Rudi Assauer, hängt die Bundesliga im internationalen Vergleich im Allgemeinen derzeit deutlich hintendran. Als Grund sieht er die geringen Einnahmen aus den Fernsehrechten. Diese Millionen wären seiner Meinung nach genau die, die den deutschen Vereinen auf dem internationalen Transfermarkt fehlen. Vgl. Beer, J.-J. (2005), S. 10.
[93] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 6.
[94] Die entscheidende Frage ist dabei, wie viele Deutsche sich wirklich einen Dekoder anschaffen würden, wenn der Fußball weitestgehend aus dem Free-TV verschwinden würde. Nach einer Umfrage sind immerhin 8 % der Bundesbürger und damit hochgerechnet 4,2 Mio. Menschen an einem Abo interessiert. Dies unterstreicht sicherlich das Potenzial des Pay-TVs. Vgl. Klewenhagen, M. / Klotz, P. / Sohns, M. / Weilgurny, M. (2005), S. 14-17.
[95] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 33.
[96] Vgl. Nitschke, A. (2003), S. 22.
[97] Am 29.06.2005 gab es auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Ligaverbandes auf Antrag von Eintracht Frankfurt bereits eine Abstimmung über eine Aufstockung, die allerdings von 19 Vereinen abgelehnt wurde. Drei enthielten sich und zehn stimmten dafür. Vorher wurde den Vereinen von der DFL empfohlen den Antrag abzulehnen, da man Risiken bei der Finanzierung sah, vgl. o. V. (2005c). Da trotz der Empfehlung der DFL zehn Vereine für eine Erweiterung der Liga stimmten, scheint dieses Thema noch nicht endgültig vom Tisch zu sein und bleibt eine Alternative für die Zukunft. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München würde hingegen die Liga gerne auf 16 Mannschaften verringern, da es seiner Meinung nach Qualität wichtiger als Quantität ist. Vgl. Franzke, R. / Wild, K. (2005).
[98] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 33.
[99] Vgl. Franzke, R. / Wild, K. (2005).
[100] Viele Experten erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Sponsoringsummen geringer ausfallen werden. Vgl. Klewenhagen, M. / Klotz, P. / Sohns, M. / Weilgurny, M. (2005), S. 14-17.
[101] Vgl. Nitschke, A. (2003), S. 27.
[102] Vgl. Franzke, R. / Wild, K. (2005).
[103] Er argumentiert, dass der Pay-TV-Sender Premiere einen Börsenwert von 2 Mrd. EUR hat, und da die Hälfte der Zuschauer Premiere nur wegen des Fußballs abonniert hat, sei dieser Wert angemessen. Diese Argumentation ist sicherlich angreifbar und gehört wohl bereits zum „Pokerspiel“ der im Herbst 2005 beginnenden Verhandlungen der Fernsehrechte. Vgl. Salz, J. / Steinkirchner, P. (2005), S. 15.
[104] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 35.
[105] Vgl. o. V. (2005i), S. 16.
[106] Vgl. o. V. (2005j), S. 26.
[107] Vgl. Abbildung 3.1.
[108] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 16.
[109] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 12.
[110] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2003), S. 9.
[111] Vgl. Bierwirth, K. (2003), S. 4.
[112] Vgl. Hermanns, A. (1997), S. 36-37.
[113] Vgl. Roy, P. (2004), S. 42.
[114] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 39.
[115] Vgl. Schaffrath, M. (1999), S. 172.
[116] Vgl. UFA Sports (Hrsg.) (2000), S. 13.
[117] Vgl. Roy, P. (2004), S. 42-43.
[118] Vgl. Erning, J. (2000), S. 250.
[119] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 40.
[120] Allerdings spielte Braunschweig in der damaligen Regionalliga Nord und nicht in der Bundesliga. Vgl. Schaffrath, M. (1999), S. 167.
[121] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 16.
[122] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 41.
[123] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 15.
[124] Vgl. Schaecke, M. / Zinnenlauf, B. / Delonga, D. (2003), S. 106-107.
[125] Vgl. Ziebs, A. (2002), S. 45.
[126] Vgl. O. V. (2004), S. 24.
[127] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 41.
[128] Vgl. Schumann, F. (2005), S. 123.
[129] Vgl. Bierwirth, K. (2003), S. 7.
[130] Vgl. Schumann, F. (2005), S. 123.
[131] Vgl. Bierwirth, K. (2003), S. 8-9.
[132] Vgl. WGZ-Bank (Hrsg.) (2002), S. 55.
[133] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 17.
[134] Vgl. Bierwirth, K. (2003), S. 10-11.
[135] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 42.
[136] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 43.
[137] Vgl. Weilgurny, M. (2005), S. 19-20.
[138] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 40.
[139] Vgl. Fischer, C. (2004), S. 101.
[140] Vgl. Fischer, C. (2004), S. 102-103.
[141] Vgl. Fischer, C. (2004), S. 100-101.
[142] Vgl. Meier, L. / Kroder, T. (2003), S. 5.
[143] Vgl. Bossmann, B. (2005), S. 32-33.
[144] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 15.
[145] Vgl. Erning, J. (2000), S. 247.
[146] Unter Hospitality versteht man insbesondere die Rechte zur Vermarktung an Business-Seats, VIP-Räumen, Logen, Parkplätzen und Restaurantplätzen (Catering). Vgl. Elter, V.-C. (2002), S. 267.
[147] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2003), S. 9.
[148] Vgl. Abbildung 3.1.
[149] Der Dauerkartenanteil lag in der Saison 2003/2004 bei immerhin etwa 54 %. Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 56.
[150] Vgl. Roy, P. (2004), S. 45. Darüber hinaus ermöglicht die Planungssicherheit dieser Einnahmequelle eine Abtretung der Rechte im Rahmen einer ABS-Finanzierung.
[151] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 13.
[152] Eigene Berechnungen nach DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005b).
[153] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 40.
[154] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 39.
[155] Vgl. Vornholz, G. (2005), S. 11.
[156] Vgl. Weilgurny, M. (2005), S. 18.
[157] Die Eintrittspreise konnten meist zwischen 30 und 50 % angehoben werden. Da der durchschnittliche Eintrittskartenpreis in Deutschland mit 15,63 EUR brutto weit unter den Preisen der anderen Top-Ligen Europas liegt, scheint hier noch weiteres Potenzial vorhanden zu sein. Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 39.
[158] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 40.
[159] Vgl. Swieter, D. (2002), S. 32.
[160] Vgl. Roy, P. (2004), S. 45.
[161] Vgl. WGZ-Bank (Hrsg.) (2002), S. 58.
[162] Vgl. DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.) (2005a), S. 12.
[163] Vgl. Roy, P. (2004), S. 46.
[164] Vgl. Elter, V.-C. (2002), S. 268.
[165] Diese Zahlen sind dagegen eher noch positiver zu beurteilen, da die meisten Stadien schon fertig gestellt und daher die Einnahmen im nächsten Jahr nicht mehr in großem Maße durch neue Plätze zu steigern sind, vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 17.
[166] Oft ist eine Verdoppelung der bisherigen Cateringumsätze zu beobachten.
[167] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2005), S. 40.
[168] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 16. Zu der Besteuerung von Logen vgl. ausführlicher Emmrich, M. (2003).
[169] Das Bundesfinanzministerium gab mit einem Rundschreiben über die „Ertragssteuerliche Behandlung von Aufwendungen für VIP-Logen in Sportstätten“ eine einheitliche Vorschrift für alle Bundesländer heraus. Vgl. ausführlicher Kreuzer, H. P. (2005).
[170] Hierbei handelt es sich um die offiziellen Zahlen der DFL. Die Informationen unterscheiden sich jedoch teilweise erheblich, so findet man z. B. Werte bis zu 80,6 Mio. EUR in anderen Studien. Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 18. Als Grund für diese Differenzen können die undurchschaubaren Vermarktungsformen der Vereine und fehlenden Publizitätspflichten angesehen werden. Vgl. Roy, P. (2004), S. 40.
[171] Vgl. Abbildung 3.1.
[172] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 18.
[173] Vgl. Roy, P. (2004), S. 40.
[174] Es existieren verschiedene Definitionen von Merchandising, die sich im Detail unterscheiden. Da dies nicht Schwerpunkt der Arbeit ist, wird auf eine nähere Ausführung verzichtet. Darüber hinaus werden die Begriffe Merchandising und Licensing oft synonym verwendet, was verwirrend ist. Wenn im Folgenden von Merchandising gesprochen wird, umfasst dies auch die Einnahmen aus dem Licensing.
[175] Vgl. Rohlmann, P. (2002), S. 381.
[176] Vgl. Roy, P. (2004), S. 40.
[177] Vgl. Rohlmann, P. (2002), S. 381.
[178] Vgl. Gömmel, R. (2002), S. 112.
[179] Vgl. Rohlmann, P. (2003), S. 2.
[180] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 18.
[181] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 19.
[182] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 18.
[183] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 19.
[184] Vgl. Ernst &Young (Hrsg.) (2005), S. 17.
[185] Vgl. HVB Equity Research (Hrsg.) (2003), S. 18.
[186] Vgl. WGZ-Bank / KPMG (Hrsg.) (2004), S. 44.
[187] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 17.
[188] Vgl. Gömmel, R. (2002), S. 115.
[189] Für einen detaillierten Einblick zur Professionalisierung des Merchandisingprozesses vgl. Schewe, G. / Becker, S. / Gaede, N. (2004). Für einen Praxiseinblick anhand Bayer 04 Leverkusen vgl. Busch, W. (2004).
[190] Vgl. Gömmel, R. (2002), S. 118.
[191] Vgl. Rohlmann, P. (2002), S. 388.
[192] Vgl. o. V. (2005e). Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da sie sehr wahrscheinlich nicht auf dem Transfermarkt zu erzielen sind. Vgl. ausführlicher die Ausführungen in Kapitel 3.3.2.
[193] Vgl. Hübl, L. / Swieter, D. (2002a), S. 106.
[194] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 23.
[195] Vgl. Ernst & Young (Hrsg.) (2004), S. 24.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832491994
- ISBN (Paperback)
- 9783838691992
- DOI
- 10.3239/9783832491994
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Wirtschaftswissenschaften, Konjunktur- und Strukturpolitik
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- stadionfinanzierung public-private-partnership sportökonomie stadien
- Produktsicherheit
- Diplom.de