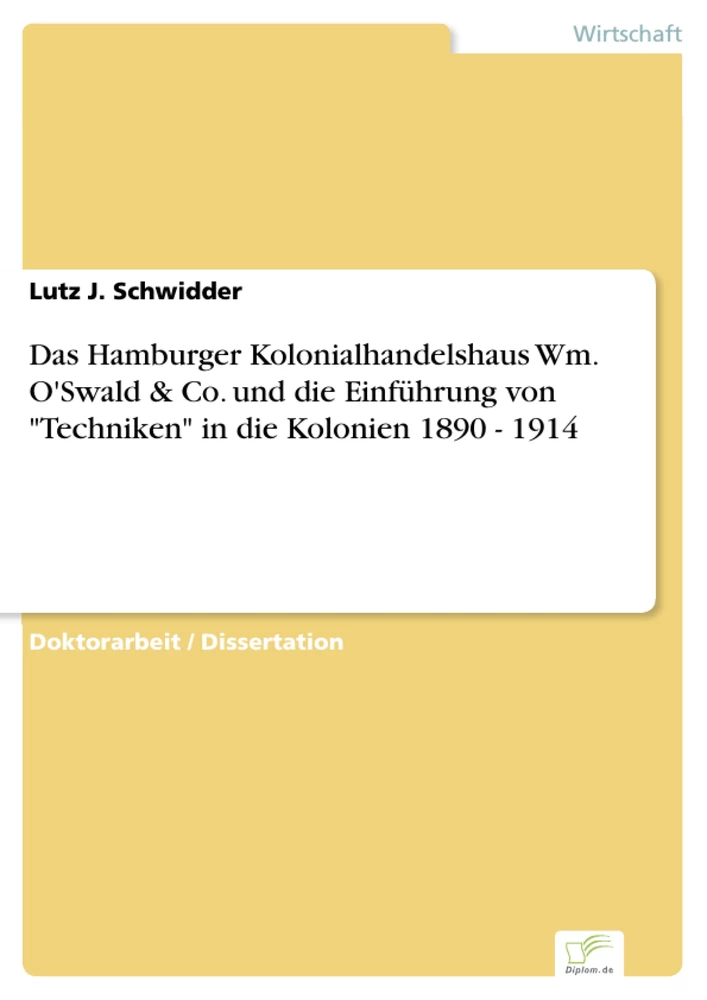Das Hamburger Kolonialhandelshaus Wm. O'Swald & Co. und die Einführung von "Techniken" in die Kolonien 1890 - 1914
©2004
Doktorarbeit / Dissertation
841 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Bereich der deutschen Kolonialgeschichte allgemein kann wohl als gut erforscht gelten, und die Einführung technischer Neuerungen wie Dampfschiffe, Eisenbahn und Telegraph wurde zumindest ansatzweise beschrieben, doch fehlt insbesondere eine Beschreibung der Anwendungen und Auswirkungen, die die neue Technik auf das Leben in der Kolonie hatte. Ohne die Kenntnis solcher Folgewirkungen bleiben jedoch Rückschlüsse auf die Effektivität der Technik und damit auch ihr Einfluss auf die Kolonialpolitik reine Mutmaßung es ist unmöglich, solche Auswirkungen von reinem Wunschdenken bzw. Kolonialpropaganda und apologetik zu trennen (z.B. die Kolonie als Absatzmarkt der Industrie des Mutterlandes).
Die Gruppe der Kolonialisten, die die meisten Kontakte mit neuer Technik hatten bzw. diese im großen Maßstab erst einführten, waren die Kaufleute. Diese Gruppe auf die Folgen der Techniken zu untersuchen, bietet darüber hinaus den Vorteil, gleichzeitig die Reaktionen auf dem afrikanischen Kontinent, z.B. auf den Bahnbau und auch in Europa, hier etwa auf neue Stoffdruckverfahren oder auf die Expansion der Nahrungsmittelindustrie, zu erfahren, also alle für die koloniale Wirtschaft relevanten Verfahren untersuchen zu können.
Obwohl es einige Untersuchungen zu Kolonialkaufleuten gibt, so beschränken sich diese doch auf mehr oder minder kurzgefasste Firmengeschichten oder sie werden in Zusammenhang mit bestimmten Handelsgütern erwähnt, dagegen wird eine Verbindung von Handelsfirmen und Technik selten untersucht. Einer der Gründe dafür ist sicherlich auch die schmale Informationsbasis. Da Handelsfirmen in der Regel nichtstaatlich organisiert waren, entfiel der Zwang zum Archivieren über die Fristen hinaus, die eventuell gesetzlich vorgesehen waren. Die Firmen, die bis heute weiterbestehen, gehen mit Genehmigungen zur Einsicht ihrer Firmenarchive zu Forschungszwecken sehr sparsam um.
Unter diesen Aspekten betrachtet, ist die Firma O`Swald ein echter Glücksfall für die Forschung; obwohl bis heute zumindest als Firmenname präsent, wurden ihre Geschäftsakten von der Firmengründung bis weit nach dem Ersten Weltkrieg dem Hamburger Staatsarchiv übergeben, wo sie der Forschung zur Verfügung stehen. Der Grund dafür ist wohl in der engen Verbindung zu suchen, die die Firmengründer mit dem Stadtstaat hatten, so stellten sie unter anderem einen Bürgermeister und die Stadt ihrerseits ehrte die Familie durch die Benennung eines Kais im Hafen […]
Der Bereich der deutschen Kolonialgeschichte allgemein kann wohl als gut erforscht gelten, und die Einführung technischer Neuerungen wie Dampfschiffe, Eisenbahn und Telegraph wurde zumindest ansatzweise beschrieben, doch fehlt insbesondere eine Beschreibung der Anwendungen und Auswirkungen, die die neue Technik auf das Leben in der Kolonie hatte. Ohne die Kenntnis solcher Folgewirkungen bleiben jedoch Rückschlüsse auf die Effektivität der Technik und damit auch ihr Einfluss auf die Kolonialpolitik reine Mutmaßung es ist unmöglich, solche Auswirkungen von reinem Wunschdenken bzw. Kolonialpropaganda und apologetik zu trennen (z.B. die Kolonie als Absatzmarkt der Industrie des Mutterlandes).
Die Gruppe der Kolonialisten, die die meisten Kontakte mit neuer Technik hatten bzw. diese im großen Maßstab erst einführten, waren die Kaufleute. Diese Gruppe auf die Folgen der Techniken zu untersuchen, bietet darüber hinaus den Vorteil, gleichzeitig die Reaktionen auf dem afrikanischen Kontinent, z.B. auf den Bahnbau und auch in Europa, hier etwa auf neue Stoffdruckverfahren oder auf die Expansion der Nahrungsmittelindustrie, zu erfahren, also alle für die koloniale Wirtschaft relevanten Verfahren untersuchen zu können.
Obwohl es einige Untersuchungen zu Kolonialkaufleuten gibt, so beschränken sich diese doch auf mehr oder minder kurzgefasste Firmengeschichten oder sie werden in Zusammenhang mit bestimmten Handelsgütern erwähnt, dagegen wird eine Verbindung von Handelsfirmen und Technik selten untersucht. Einer der Gründe dafür ist sicherlich auch die schmale Informationsbasis. Da Handelsfirmen in der Regel nichtstaatlich organisiert waren, entfiel der Zwang zum Archivieren über die Fristen hinaus, die eventuell gesetzlich vorgesehen waren. Die Firmen, die bis heute weiterbestehen, gehen mit Genehmigungen zur Einsicht ihrer Firmenarchive zu Forschungszwecken sehr sparsam um.
Unter diesen Aspekten betrachtet, ist die Firma O`Swald ein echter Glücksfall für die Forschung; obwohl bis heute zumindest als Firmenname präsent, wurden ihre Geschäftsakten von der Firmengründung bis weit nach dem Ersten Weltkrieg dem Hamburger Staatsarchiv übergeben, wo sie der Forschung zur Verfügung stehen. Der Grund dafür ist wohl in der engen Verbindung zu suchen, die die Firmengründer mit dem Stadtstaat hatten, so stellten sie unter anderem einen Bürgermeister und die Stadt ihrerseits ehrte die Familie durch die Benennung eines Kais im Hafen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9193
Schwidder, Lutz J.: Das Hamburger Kolonialhandelshaus Wm. O'Swald & Co.
und die Einführung von "Techniken" in die Kolonien 1890 - 1914
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Universität Hamburg, Dissertation / Doktorarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Inhaltsangabe
Anmerkungen
Einleitung
1
1
Der alte Handel und sein relatives Ende
Ende
des
Waffenhandels
11
7
Elfenbeinhandel
13
8
Ende des Kauri Muschel Geschäft
17
12
Das Ende des Orseille Handels
19
14
Familiengeschichte
O`Swald
20
14
Schiffsverkehr Firma O`Swald eigene Reederei
24
16
Die Entwicklung der Schiffslinien
29
17
Firma O`Swald und die DOAL
Das tägliche Geschäft
41
21
Die
Eisenbahnen
in
Ostafrika
45
22
Die O`Swald´sche Faktoreien in Ostafrika
52
24
Mombasa
52
24
Bagamoyo
63
28
Daressalam
72
31
Muanza
78
33
Tanga
85
35
Die Inder und ihre Stellung zu Firma O`Swald
95
38
Die
europäische
Konkurrenz
120
47
Firma
Hansing
122
47ff
DOAG
134
47ff
Firma W. Hintzmann & Co
143
47ff
Firma
Smith
Mackenzie
152
47ff
Firma
Leon
Besson
160
47ff
Produktenhandel
176
68
Nelken
177
68
Coprah
197
76
Kautschuk
223
88
Häute/Felle
236
93
Chillies
264
103
Sesam
265
104
Wachs
266
106
Muscheln
268
107
Reis
270
108
Kaffee
273
109
Baumwolle
276
111
Bodenschätze
282
113
Mangroven
282
114
Importenhandel
291
116
Manufakturen
295
117
Wellblech
299
119
Zement
302
121
Bauholz
306
123
Streichhölzer 309
124
Seife
313
127
Steinzeug
320
132
Emaille
326
135
Feze
328
136
Farben
334
139
Maschinen
336
140
Lebensmittel 361
149
Bier
368
153
Tabak 375
159
Petroleumhandel
392
168
Stoffe,
Tuche
und
Fertigwaren
402
172
Grey Goods
404
173
Whites
413
178
Unterhemden
422
183
Handkerchiefs
428
186
Kitambi
(Witambi)
433
189
Malabars
441
194
Cangas
446
196
Kanikys
450
198
Kikoys
466
210
Shawls
478
218
Decken
535
264
Schlußbemerkungen
402
Firma O`Swald in Ostafrika
545
270
Welthandel
549
271
Zusammenfassung
555
Anmerkungen
557
Literaturverzeichnis
828
1
Die industrielle Revolution, die Ende des 18. Jahrhunderts begann, setzte in Europa
im 19. Jahrhundert in die Lage, durch technische Überlegenheit seine schon vorhan-
denen Kolonialgebiete zu vervielfachen. (1) Die neuen Erfindungen auf den Gebieten
der Infrastruktur und Kommunikation, wie etwa Kanal- und Eisenbahnbau, Telegra-
phie und Telefon, ermöglichten es, die nun eroberten Gebiete auch auszunutzen,
genauer Plantagenwirtschaft und Handel in Gegenden zu betreiben, in denen es bis-
her ökonomisch unsinnig war.
Ohne diese Erfindungen und denen auf den Gebieten des Medizin- und Militärwe-
sens (z.B. Chinin, Maschinenwaffen, Schlachtschiffe) hätte eine weitere ,,Kolonialisie-
rungswelle", ein ,,New Imperialism", wahrscheinlich nicht stattgefunden, eine Berliner
Kongo Konferenz wäre unnötig gewesen, doch der Anteil, den die neuen Techniken
daran hatten, wird bis heute nicht ausreichend gewürdigt. ,,In the phase of consolida-
tion, the links that tied the colonies to Europe and promoted their economic exploita-
tion included steamship lines, the Suez Canal, the submarine telegraph cables and
the colonial railroads."(2) Das ist eine der Thesen, die Daniel R. Headrick, Professor
of Social Sciences, in seinem Werk ,,The Tools of Empire" vertritt. Seiner Meinung
nach sind unsere Kenntnisse dieser ,,Werkzeuge" noch keinesfalls ausreichend und
die Diskussion, ob und inwiefern sie einen Einfluss auf die diversen Kolonialmächte
und ihre ,,Imperialismen" hatten, beginnt gerade. (3) Sein Beitrag besteht hauptsäch-
lich aus Forschungen auf dem Gebiet der Einführung von Techniken im englischen
Kolonialreich. Wenn man an die Rolle Englands als Keimzelle der industriellen Revo-
lution und als größter Kolonialmacht des ,,New Imperialism" denkt, ein nur zu ver-
ständlicher Ansatz. Die Arbeit zeigt allerdings auch den bisher recht geringen Kennt-
nisstand auf diesem Gebiet, und was für das größte ehemalige Kolonialgebiet gilt, gilt
erst recht für das vergleichsweise kleine deutsche.
Der Bereich der deutschen Kolonialgeschichte allgemein kann wohl als gut erforscht
gelten, und die Einführung technischer Neuerungen wie Dampfschiffe, Eisenbahn
und Telegraph wurde zumindest ansatzweise beschrieben, doch fehlt insbesondere
eine Beschreibung der Anwendungen und Auswirkungen, die die neue Technik auf
2
das Leben in der Kolonie hatte. Ohne die Kenntnis solcher Folgewirkungen bleiben
jedoch Rückschlüsse auf die Effektivität der Technik und damit auch ihr Einfluss auf
die Kolonialpolitik reine Mutmaßung es ist unmöglich, solche Auswirkungen von rei-
nem Wunschdenken bzw. Kolonialpropaganda und apologetik zu trennen (z.B. die
Kolonie als Absatzmarkt der Industrie des ,,Mutterlandes").
Die Gruppe der Kolonialisten, die die meisten Kontakte mit neuer Technik hatten
bzw. diese im großen Maßstab erst einführten, waren die Kaufleute. Diese Gruppe
auf die Folgen der Techniken zu untersuchen, bietet darüber hinaus den Vorteil,
gleichzeitig die Reaktionen auf dem afrikanischen Kontinent, z.B. auf den Bahnbau
und auch in Europa, hier etwa auf neue Stoffdruckverfahren oder auf die Expansion
der Nahrungsmittelindustrie, zu erfahren, also alle für die koloniale Wirtschaft rele-
vanten Verfahren untersuchen zu können.
Obwohl es einige Untersuchungen zu Kolonialkaufleuten gibt, so beschränken sich
diese doch auf mehr oder minder kurzgefasste Firmengeschichten (4) oder sie wer-
den in Zusammenhang mit bestimmten Handelsgütern erwähnt , (5) dagegen wird
eine Verbindung von Handelsfirmen und Technik selten untersucht. (6) Einer der
Gründe dafür ist sicherlich auch die schmale Informationsbasis. Da Handelsfirmen in
der Regel nichtstaatlich organisiert waren, entfiel der Zwang zum Archivieren über
die Fristen hinaus, die eventuell gesetzlich vorgesehen waren. Die Firmen, die bis
heute weiterbestehen, gehen mit Genehmigungen zur Einsicht ihrer Firmenarchive
zu Forschungszwecken sehr sparsam um.
Unter diesen Aspekten betrachtet, ist die Firma O`Swald ein echter Glücksfall für die
Forschung; obwohl bis heute zumindest als Firmenname präsent, wurden ihre Ge-
schäftsakten von der Firmengründung bis weit nach dem Ersten Weltkrieg dem
Hamburger Staatsarchiv übergeben, wo sie der Forschung zur Verfügung stehen.
Der Grund dafür ist wohl in der engen Verbindung zu suchen, die die Firmengründer
mit dem Stadtstaat hatten, so stellten sie unter anderem einen Bürgermeister und die
Stadt ihrerseits ehrte die Familie durch die Benennung eines Kais im Hafen
(O`Swaldkai).
3
Die Firma Wm. O`Swald Co. handelte von ihrem Stammhaus in Hamburg aus im
Im- und Export mit Ostafrika, Zanzibar und Madagaskar. Gegründet 1831, begann
die Firma ab 1847/48 mit dem Handel ab Zanzibar. (7) Der Kontakt zwischen dem
Stammhaus O`Swald in Hamburg und der Filiale/Faktorei in Zanzibar gestaltete sich
recht eng, da die Firmengründer Zanzibar streng überwachten um sie betriebswirt-
schaftlich profitabel zu führen, Verschwendung zu verhindern und um über die teil-
weise damals noch recht unsicheren politischen Verhältnisse schnell unterrichtet zu
werden. Darüber hinaus war das Stammhaus für den Einkauf der (von afrikanischer
Seite gesehenen) Importe sowie für den Verkauf der Exporte (Produkte Ostafrikas,
angebaut und/oder gesammelt) zuständig, musste ergo über jede Veränderung im
Geschmack der (afrikanischen) Endverbraucher unterrichtet werden. Gleichzeitig
sollte es über die Ergebnisse des Produktenverkaufes in Europa/Amerika/Asien be-
richten bzw. Kritik an der Ankaufspraxis der Faktorei anmelden und Verbesserungen
vorschlagen. Je länger die Faktorei bestand, desto mehr Konkurrenz bekam sie, erst
in Form europäisch/US-amerikanischer Firmen, später auch von angloindischen
und so nahmen die Informationen über deren Wirken, über Pläne und Pleiten einen
zunehmend größeren Raum in der Firmenkorrespondenz ein. Üblicherweise sandte
die Firmenzentrale eine Art Generalbericht an Zanzibar, dem dann spezielle Berichte
über Importe (in Hamburg als ,,Expedition" bezeichnet, da nach Zanzibar bestimmt)
und Produkte entweder beilagen oder folgten, je nach Umfang. Die Berichte wurden
kopiert (Tintendurchdruck, von Ernst Hieke sehr anschaulich geschildert) (8) und
jahrgangsweiße gebunden, je nach Menge der Berichte in einem oder mehreren
Bänden, deren Seitenzahlen dann das Zitieren relativ einfach und übersichtlich ges-
talten.
Da im Staatsarchiv nur die in Hamburg gesammelten Archivmaterialien liegen, kann
man dort die Berichte der Faktorei Zanzibar (und anderer Faktoreien, so sie die Zu-
stimmung erhielten, in direkten Kontakt zum Stammhaus zu treten) nur als Samm-
lung der Originalbriefe (-berichte) einsehen, deren Zitate umständlicher ausfallen.
Zwar wurde auch hier zunächst die Reihenfolge Generalbericht, Importe- und Pro-
4
duktenbericht eingehalten, doch wurden hier die Seiten für jeden Brief eigens ge-
zählt, so dass im Zitat erst das Briefdatum und dann die Briefseite angegeben wer-
den muss, zusätzlich, da oft unter gleichem Datum, die Angabe des Berichtsteils
(genereller oder Hauptbrief, Importen- oder Produktenbrief), die mit zunehmender
Größe aus Platz- und Handhabungsgründen jeweils gesondert abgelegt wurden.
In späteren Zeiten, vor allem nach Einführung der Schreibmaschinen als Arbeitser-
leichterung auf beiden Seiten der Korrespondenz, nahm die Menge der Informatio-
nen zu und durch die Gründung neuer Faktoreien, über die dann ebenfalls berichtet
werden musste, erschienen viele ,,Sonderberichte", z.B. über die Standorte der ge-
planten Faktoreien. Zanzibar wurde zur ,,Hauptfaktorei" ausgebaut und die Korres-
pondenz um Rechnungsberichte und Rundschreiben Zanzibars an die anderen Fak-
toreien erweitert, erstere wohl um die Übersicht in der zur Papierflut angewachsener
Korrespondenz zu behalten und letztere zur allgemeinen, besseren Information des
Stammhauses in Hamburg, das zu dieser Zeit versuchte, möglichst viele Briefwech-
sel der Faktoreien auf die Hauptfaktorei zu beschränken und sich von dieser nur das
Wichtigste, für alle Faktoreien Interessante, mitteilen zu lassen. So gesehen, bietet
die Korrespondenz einen Eindruck von der Organisation einer kolonialen Handelsfir-
ma und von den Veränderungen, die bei deren Expansion entstanden, vom Versuch
aus dem fernen Hamburg ,,alles unter Kontrolle" zu behalten und dem Zwang, Teile
dieser Kontrolle an eine neue Hauptfaktorei abzutreten, um nicht vom Alltagsge-
schäft des Faktoreinetzes bis zur Handlungsunfähigkeit ,,blockiert" zu werden.
Der Wert dieser Quelle für die Forschung ist recht hoch anzusetzen, da sie nicht, wie
etwa regierungsseitige Quellen, z.B. Farbbücher, von vornherein für eine breite Öf-
fentlichkeit vorgesehen war. Im Gegenteil, es gab nur einen kleinen Kreis von Nut-
zern, die Spitze der Firma O`Swald, der Faktoreileiter, später Hauptfaktoreileiter
Zanzibar, berichtete an die Firmeninhaber, respektive diese an ihn und die Korres-
pondenz diente ausschließlich dem Gedeihen des gemeinsamen Geschäftes. Fehler
darin bekam man mehr oder minder rasch selbst zu ,,spüren". Da der Handel von und
nach Ostafrika nur von einer Hand voll europäisch/US-amerikanischer Firmen betrie-
5
ben wurde und die noch zudem überwiegend über die gleiche Infrastruktur und zwar
etwa gleichzeitig, versorgt wurden (Schiffslinie, Anlandung/Spedition über eine Lan-
dungsbrücke je Hafen), kann man von einem Oligopol sprechen, das Fachkundige
leicht überwachen konnten. Täuschungsmanöver einzelner Firmen, z.B. bei Fakto-
reigründungen oder Versand von Produkten, wirkten nur kurzfristig. Die Grenzen der
Aussagefähigkeit dieser Quelle liegt also bei Entwicklungen, die außerhalb des
kaufmännischen Geschäftes lagen, beispielsweise bei politischen Entwicklungen,
Gesetzen, Missionsangelegenheiten, oder Gebieten, die sich abseits ihres Faktorei-
netzes befanden. (9)
Da aber Äußerungen aus nichtamtlichen, nichtmilitärischen und nichtmissionarischen
Quellen nicht gerade zahlreich sind, zeigt diese ergo die Entwicklung Ostafrikas und
der Kolonialindustrie Europas via Importenberichte aus einer seltenen, gut informier-
ten Perspektive.
Der Zeitraum dieser Arbeit, 18901914, ist nicht willkürlich gewählt, sondern baut auf
Vorgängerarbeiten auf und führt diese weiter bis zu der für den deutschen kolonialen
Handel einschneidenden Zäsur des Ausbruchs des ersten Weltkrieges. Damit soll
auch erreicht werden, zumindest an einer deutschen Handelsfirma, quasi exempla-
risch, die Entwicklung kolonialer Handelsfirmen von Beginn des Handels mit Ostafri-
ka in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg aufzuzeigen und so
eine Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, die eine Überprüfung beispielsweise von
Firmenjubiläumsschriften erlaubt, einer Hauptquelle für unser Wissen um solche
Handelsfirmen. (10) Die Zeit vor 1890 kann als vergleichsweise gut dokumentiert gel-
ten; neben den Veröffentlichungen zu Jubiläen beschäftigte sich der Wirtschaftshisto-
riker Ernst Hieke ausführlich mit den Anfängen der Firma Wm. O`Swald Co.. (11)
Hieke, wie auch Kremling und die Jubiläumsschrift, pflegten einen eher narrativen
Stil, der allerdings die Organisation des Geschäftes der Firma O`Swald sowohl in
Zanzibar wie auch in Hamburg recht klar beschrieb und durch die neuere Arbeit, eine
Dissertation von Karl Evers, im großen und ganzen bestätigt wurde. (12)
6
Karl Evers schrieb seine Dissertation auf Basis eines Marxistischen Geschichtsbil-
des, das heute wohl nicht mehr verwendet werden würde, doch sind seine Ausfüh-
rungen zum Handel O`Swalds durch Untersuchungen zu dieser Dissertation bestätigt
worden, ebenso wie seine Auflistung älterer Literatur. (13) Da er sich allerdings eines
eher mathematisch orientierten Schreibstils bediente, mit einer Textgliederung durch
Abschnittsnummerierung in arabischen Ziffern, entstand das Kuriosum, dass man
eine bestimmte Information zwar sehr schnell findet, die gesamte Arbeit jedoch
schwerer lesbar ist, als die Hiekes rund 50 Jahre vorher. Ob man Evers Schlussfol-
gerungen heute immer noch vollständig folgen mag, ist wohl eine Frage des eigenen
Standpunktes. Die Vorgeschichte zur Gründung der Firma O`Swald und ihrer interna-
tional/kolonialischen Ausrichtung wird in einem eher populärwissenschaftlichen Werk
Heinz Burmesters geschildert, dessen flüssiger Stil und Annotation dem Anspruch
eines solchen Buches gerecht werden. (14)
Da diese Arbeit einen anderen Aspekt des kolonialen Handels untersucht als bei
Hieke und Evers, die sich mehr auf den Anfang und die erste Ausbreitung der Firma
O`Swald konzentrierten, hilft die von Evers benutzte und kommentierte Literatur nur
bedingt weiter. Nötig sind darüber hinaus Informationen über die Einführung von
Technik in Ostafrika und hierfür ist man zum Teil wieder auf ältere Literatur angewie-
sen, die erstens eher national ausgerichtet und zweitens schlecht überprüfbar ist, da
viele Archive oder zumindest Teile davon dem zweiten Weltkrieg zum Opfer fielen.
Ein gutes Beispiel dafür ist der Bereich Schifffahrt, in dem es Arbeiten zur Errichtung
deutscher Schiffslinien nach Ostafrika gibt, welche jedoch aus den dreißiger Jahren
dieses Jahrhunderts stammen und mehr oder minder unter dem Eindruck des Ver-
lustes der Kolonien gemäss den Versailler Verträgen standen. (15) Trotzdem erwie-
sen sich diese Literaturquellen noch immer informativer als die neuere Arbeit über
die sogenannten ,,Reichs-Post-Dampfer" möglicherweise, weil hierbei ein zu großes
Spektrum an Schiffsverbindungen behandelt wurde. Somit blieb für einzelne Schiffs-
wege ein zu kleiner Raum, um ihre Entstehung und eventuelle Kartelle genauer zu
erforschen. (16) Hilfreicher sind da schon kleinere Artikel in speziellen Periodika, die
7
sich mit der Geschichte einzelner Schiffstypen beschäftigen und so zumindest Eck-
daten liefern bzw. bestätigen können und damit die Archivquellen überprüfen. (17)
Bei einer Einordnung der Schiffahrtsorganisation in die Geschichte Ostafrikas zeigt
sich erneut, wie dünn das vorhandene Material wirklich ist, immerhin reicht es aber
aus, sie ansatzweise zu erfassen. (18)
Besser, wenngleich auch hier narrativ und populärwissenschaftlich, ist es um die Li-
teratur im Bereich der Eisenbahnen Ostafrikas bestellt. Hier gibt es immerhin Be-
schreibungen der Entstehung beider Bahnsysteme, des deutschen und des engli-
schen und somit Möglichkeiten, die Aktionen der Kaufleute in Bezug auf Transporte,
Faktoreigründungen und ähnlichem zu erklären bzw. nachzuvollziehen. Ob dieser
Effekt allerdings beabsichtigt oder auch nur angestrebt wurde, bleibt zu bezweifeln,
die Literatur scheint eher als Denkmal britischen und deutschen Pioniergeistes ge-
dacht zu sein, oder als Information für bahngeschichtlich interessierte Kreise. (19)
Über den Handel selbst gibt es vergleichsweise viele Äußerungen, allerdings mit
zahlreichen Einschränkungen. Mehrere Autoren beschränken sich auf einzelnes
Handelsgut, wie z.B. Feuerwaffen, Elfenbein oder Kaurimuscheln, für Zanzibar ist
auch der Nelkenhandel interessant, doch so wichtig diese Arbeiten sind, was hier
keinesfalls bestritten werden soll, so geben sie nur beschränkt Auskunft über den
kolonialen Handel insgesamt, ganz zu schweigen von Einflüssen moderner Technik.
(20) Auch zeitlich scheinen viele Autoren sich nicht weiter als bis zum Jahre 1890 zu
,,trauen". Ob das an den auch von Karl Evers für seine Arbeit angegebenen Gründen
liegt, ob man kein Material für diese Zeit finden kann oder ob gar zu große Aktenber-
ge abschrecken, ist nicht leicht zu bestimmen. (21) Die Arbeiten, die über diese
,,Grenze" hinaus führen, sind mehrheitlich auf einzelne Teile Ostafrikas bezogen
(deutsch oder britisch Ostafrika, Zanzibar) und können demzufolge nur Teilaspekte
erhellen bzw. bestätigen. (22) Eine Bestätigung durch eine zweite Veröffentlichung
ist überwiegend nicht zu erhalten, manche Überraschung auf diesem Gebiet stellt
sich bei näherer Betrachtung als neues Zitat einer älteren Publikation heraus. Die
einzige Arbeit, die ein anschauliches und wohl zutreffendes Bild des Handels insge-
8
samt zeichnet, wenngleich etwas summarisch, stammt von einem ehemaligen Com-
mis, der ,,draußen" war. Obwohl älteren Datums, scheint sie bisher recht wenig Be-
achtung gefunden zu haben. (23)
Loofs Arbeit hebt die besondere Beziehung der kolonialen, europäischen und US-
amerikanischen Kaufleute zu der Compradorenschicht Ostafrikas den Indern, hervor,
eine Beziehung deren Bedeutung auch in dieser Arbeit bestätigt wird und die vom
Angestelltenstatus bei europäischen Firmen bis zu erfolgreicher Konkurrenz ging, so
manchem Pflanzer ein ,,Dorn im Auge" (24) war und die Afrikaner auf die Rolle der
Endabnehmer, des Konsumenten, verwies. Das Thema ,,Inder in Ostafrika" war auch
bereits Subjekt vieler Arbeiten, doch behandelte man die Inder darin eher als Bevöl-
kerungsgruppe, in der Kaufleute vertreten waren. Indische Kaufleute als Gruppe er-
wähnte man selten, im Zusammenhang mit Technik allenfalls beim Bahnbau. (24a)
Die einzige Arbeit, die den Zusammenhang von Technik und Kaufleuten zumindest
ansatzweise behandelt, ist bezeichnenderweise eine über ein britisches Unterneh-
men, die Mackinnon-Gruppe. Sie war John Galbraith eine Studie im ,,New Imperia-
lism" wert und gibt ein gutes Gegenbeispiel zu der in dieser Arbeit behandelten Firma
ab. Handelt es sich bei Firma O`Swald eher um ein mittleres deutsches Unterneh-
men, kann man Mackinnon als ,,Global Player" sehen, mit Verbindungen nach Euro-
pa, Afrika und Asien. Als Begründer und Besitzer der IBEA, später der Firma Smith
Mackenzie Co., war die Mackinnon Gruppe ein direkter Konkurrent zur Firma
O`Swald (und wohl, nach dem ersten Weltkrieg, ihr ,,Erbe"). (25)
Da diese Arbeit sich mit Technik im weitesten Sinne, eingesetzt im Handel mit Ostaf-
rika, befasst, muss auch nach den Folgen gefragt werden, die technische Neuerun-
gen auf die Importe hatten, also auf diejenigen Güter, die in Europa oder in den USA
für den Export, unter anderem nach Ostafrika hergestellt wurden. Da das Archivwe-
sen in Europa besser ausgestattet ist als in Ostafrika, sollten derartige Untersuchun-
gen eigentlich kein Problem sein. Eines der ersten und zugleich überraschendsten
Ergebnisse der Vorarbeiten zu dieser Dissertation war aber, dass die Erforschung
der Technik- und Unternehmensgeschichte der letzten 100 Jahre in Europa und USA
9
sehr zu wünschen übrig lässt, das Material über solche Themen eher noch dürftiger
ist als das über Afrika- bzw. Kolonialgeschichte. Ein möglicher Grund dafür liegt wohl
in der Größe der Lieferfirmen. Sie schienen eine mittlere Größe, gemessen an den
nationalen, europäischen Industrien, nicht zu überschreiten, beziehungsweise wenn
sie der Großindustrie angehörten (z.B. Metallgießereien), so war das Afrikageschäft
für sie kein Hauptgeschäft und so verschwand der Handel dorthin in Nebensätzen
oder Fußnoten und in dem Rohmaterial in den Firmenarchiven und ist deshalb nur
ansatzweise ,,greifbar".
Unter diesen Umständen ist der Textilhandel mit Ostafrika recht gut dokumentiert, er
erreichte allerdings auch ein selbst für europäische Verhältnisse ansehnliches Aus-
maß. Die Rolle der Bekleidung für Ostafrika wurde hauptsächlich von Ethnologen
untersucht, die sich dann zusätzlich Fragen der Herstellung, Musterbildung (Dessin-)
und anderem zuwandten, doch auch die Industrie selber, z.B. die Firma van Vlissin-
gen, gab Jubiläumsbücher heraus, so dass die Branche ansatzweise bekannt wurde.
(26) Das gilt jedoch nur für die niederländische Textilindustrie, die aus anderen Län-
dern Europas sind leider viel schlechter bekannt, hier gibt es, wenn überhaupt, nur
sehr spärliche, weit verstreute Hinweise, so z.B. für die Textilindustrie der Schweiz.
(27)
Den Rahmen der Entwicklungen steckten die politischen Veränderungen in Europa
und Ostafrika ab. Die Hinrichtung Buschiris und die Einnahme Lindis waren der
Schlußpunkt des sogenannten AraberAufstands (18881890). (Somit konnte
Reichskommissar Wissmann wieder für einigermaßen friedliche Handelsstraßen ga-
rantieren). (28)
Zur gleichen Zeit klärten das deutsche Reich und Großbritannien die letzten Gebiets-
streitigkeiten in Ostafrika. Im HelgolandZanzibarVertrag gab das deutsche Reich
Ansprüche auf Zanzibar und das Sultanat von Witu auf und erhielt dafür Helgoland.
Fast gleichzeitig wurde das gesamte Festlandsküstengebiet des Sultanates Zanzibar
an die deutsche Kolonialgesellschaft (Deutsch-Ostafrikanische Aktiengesellschaft
DOAG) abgegeben. (29) Das brachte der DOAG allerdings wenig, denn der Araber
10
Aufstand hatte die Grenzen dieser Gesellschaft zu deutlich aufgezeigt. Das deutsche
Reich übernahm das bisherige DOAGGebiet (und die Abtretungen des Sultanates
Zanzibar) ab 1891 als sogenanntes Schutzgebiet DeutschOstafrika. (30) ,,Erst mit
der Übernahme der Kolonie durch die Deutsche Kaiserliche Verwaltung am 01. Ja-
nuar 1891, begann auch der deutsche Handel auf dem Festland sich auszubreiten."
(31)
So ganz genau war diese Aussage nicht, denn schon 1890 wurde DeutschOstafrika
an das internationale Telegrafennetz angeschlossen (via Zanzibar) (32) und auch die
Deutsche-OstAfrika-Linie (DOAL) lief 1890 erstmalig Ostafrika an. (33) Bis dahin
hatte es nur die immerhin regelmäßig, aber umständliche British India Steam Naviga-
tion gegeben, die eine Verbindung durch den Suez Kanal, aber via Aden, mit Zanzi-
bar (nicht dem Festland) herstellte. (34)
Da die Geschäftsbeziehungen der Firma O`Swald (und erst recht die ihrer Kunden)
sich nicht auf das Gebiet Deutsch-Ostafrikas beschränken, ist es nötig, auch auf
Veränderungen außerhalb des deutschen Kolonialgebietes einzugehen. (1)
Der HelgolandZanzibarVertrag brachte auch dem britischen Kolonialgebiet Sicher-
heit bezüglich ihrer Grenzen und man konnte nun an den Ausbau der Länder (Z,
BEA, Uganda) gehen. Eines der wichtigsten Projekte war die Ugandabahn. Sie ging,
grob gesagt, von Mombasa zu den ostafrikanischen Seen (Kisumu, am VictoriaSee)
und brachte sowohl strategische (schnelle Truppenverlegungen ins unruhige Ugan-
da), als auch handelspolitische Vorteile (Erschließung des Landes). (2) Obwohl
schon 1890 beschlossen, dauerte es mit den Vorarbeiten und der Bereitstellung fi-
nanzieller Mittel allerdings bis 1895, bevor die eigentlichen Arbeiten anfingen. Kisu-
mu, der vorläufige Endpunkt am VictoriaSee, wurde 1901 erreicht, aber schon die
Fertigstellung von Teilstrecken und das dadurch bedingte Wandern der Baustellen-
camps, die vorwiegend von indischen Arbeitern bewohnt waren, zeigte eine entspre-
chende Ausbreitung indischer Händler und mit diesen auch indischer Großhändler,
der Käuferschicht der Firma O`Swald. ,,The trade followed the Railway" wie man in
11
Abänderung eines bekannten Kolonialslogans sagen könnte. (The trade follows the
flag"). (3)
Dieses Abwandern indischer Großhändler nach BEA und die Boomphase Mombasas
zeigten sehr genau, was in Ostafrika allgemein bald geschah. Die Verlagerung des
Handelsgeschehens an die Küste und dann ins Landesinnere und die dadurch be-
dingte Konkurrenz der Küstenstädte, denen Filialgründungen der europäischen Un-
ternehmungen folgen mussten, wollten diese den Anschluss an den Handel nicht
verlieren. Endgültig besiegelt wurde dies durch die Aufnahme Mombasas in den Li-
nienplan der DOAL 1899, die vom Suez Kanal kommend, Mombasa vor Zanzibar
anlief und dadurch die Warensendungen ZanzibarMombasa, die bisherige Regel in
der Warenversorgung (was Firma O`Swald betraf), unrentabel und entbehrlich mach-
te. (4)
Der alte Handel und sein relatives Ende: Ende des Waffenhandels
Der sogenannte AraberAufstand in Ostafrika war der Grund für eine gegen Waffen-
einfuhr und Sklavenausfuhr gerichtete gemeinsame deutsch/englische Seeblockade
der Küste. (1)
Eigentlich war diese Blockade jedoch nur der Höhepunkt der europäi-
schen Bestrebungen gegen den Sklavenhandel. Mit der Einführung respektiver Fest-
legungen der Kolonialgrenzen begannen die ,,Befriedungsaktionen", d.h. die fakti-
sche, gewaltsame Durchsetzung der Kolonialherrschaft und des, bis dato den Afrika-
nern unbekannten, Kolonialrechtes. (2) Dabei waren die Waffen, die bisher von den
Afrikanern zur Jagd, Sklavenjagd, zum Schutz ihrer Äcker (Knall vertreibt Vögel und
Wild) und aus Prestige getragen wurden, ein Ärgernis und teilweise eine Bedrohung
des Kolonialmilitärs. (3) Die Gewehre waren europäischen Ursprungs. Es handelte
sich um alte Waffen der europäischen Armeen und Gendarmerien, die von belgi-
schen Waffenfirmen aufgekauft und in Lüttich demontiert und umgerüstet wurden.
Anschließend baute man sie wieder zusammen (Schloss, Gewehrlauf und Holzteile
12
wie Schaft und Kolben), wobei auf die Besonderheiten des Absatzgebietes (Afrika,
Asien, Lateinamerika zumeist) Rücksicht genommen werden konnte, so durften z. B.
für den ostafrikanischen Markt die Holzteile (Schaft, Kolben) nicht aus mehreren, er-
kennbaren Holzteilen bestehen. (4) Die Umrüstung der Waffen betraf hauptsächlich
den Abfeuerungsmechanismus, d.h. die Waffen wurden von Feuersteinschloss
(Muskete) auf Perkussionsschloss umgerüstet, die Läufe (resp. die Kammer) á la
Minnié aufgebohrt. Die so veränderten Waffen wurden dann von den Handelsfirmen
aufgekauft und exportiert. (5) Da die Waffen praktisch aus aller Herren Länder
stammten und die Umrüstung ihre Qualität ebenfalls nicht unbedingt verbesserte,
auch alle möglichen Waffentypen verwendet wurden, ist eine Aussage über ihre
Qualitäten, wie Haltbarkeit, Zielsicherheit, Feuerkraft resp. Feuergeschwindigkeit
nicht möglich. Aber eine Anfrage des damaligen deutschen Generalkonsuls für Zan-
zibar, Michahelles, nach dem Umfang und dem Grund des Waffenhandels gibt die
Gelegenheit, wenigstens die Menge der Feuerwaffen näher zu bestimmen: Firma
O`Swald hatte, nach eigenen Angaben 1887 21.613 Gewehre und 1888 13.565 Ge-
wehre, dazu 200.000 Pfund gewöhnliches Pulver und 125 Kisten Jagdpulver sowie
750 Pfund Bleikugeln geliefert. Die Firma begründete den Waffenhandel gegenüber
Michahelles mit der Unsicherheit im Inneren Afrikas und ,,der ElfenbeinExport und
der Import von Waren, welche gegen dasselbe umgetauscht werden, sind aber wei-
ters der Haupthandel in der deutschen Interessen Zone." (6)
Diese Einstellung wurde, wie schon eingangs erwähnt, von den Kolonialbehörden
nicht geteilt. Da sie in Zukunft die Sicherheit im Innern der Kolonie zu garantieren
hatten, mussten die Waffen weg, respektive der Waffenhandel unterbunden werden.
Hinzu kam der Punkt, dass laut KongoKonferenz, eigentlich nur Feuersteinschloss-
gewehre, also Musketen, nach Afrika eingeführt werden durften. (7) Es nutzte nichts,
dass Firmen wie O`Swald darauf hinwiesen, dass eventuell durch Lahmlegen des
Zündhütchenhandels die Perkussionswaffen recht schnell nutzlos werden mussten,
(8) ab 1888 bestand ein Waffen- und Munitionsausfuhrverbot für Zanzibar sowie e-
ventuell ein Waffeneinfuhrverbot für die Küste. (9)
13
Da die O`Swalds sich gegenüber der deutschen Regierung nicht bloßstellen wollten,
wiesen sie ihre Faktorei Zanzibar an, sich niemals auf den Schmuggel von Waffen
und Munition einzulassen. (10) Die Reste ihres Waffenlagers gingen teilweise nach
Madagaskar und teilweise an den Reichskommissar Wissmann, der sie anscheinend
an Handelskarawanen weitergeben wollte, um deren Schutz zu sichern, wohl eine
Art Übergangslösung. (11)
Elfenbeinhandel
Mit Beginn einer effektiven Administration, in den 1890ern, wurden Wildjagdgesetze
und schutzgebiete in British East Africa aufgestellt, die große Zeit des Elfenbein-
handels war vorüber. Im deutschen Schutzgebiet wurden ab 1896 Wildschutzgesetze
und gebiete eingeführt. (1) Als dann auch noch der belgische Kongo, der den Tran-
sithandel über Deutsch-Ostafrika fürchtete, ,,Denn der Weg auf dem Kongo zur Küs-
te war viel länger und teurer als der bis zum indischen Ozean," (2) alles tat, eine
,,chinesische Mauer" für den Kongo an den Seen zu errichten, war der Elfenbeinhan-
del endgültig erledigt.
Schon bevor diese staatlichen Eingriffe den Elfenbeinhandel quasi ,,amtlich" beende-
ten, hatte sich die Firma O`Swald halb und halb aus dem Elfenbeingeschäft zurück-
gezogen. Auslöser dafür war ein anderes Hamburger Geschäft, die Firma Heinrich
Ad. Meyer. (3)
Die 1864 gegründete Firma Heinrich Ad. Meyer war ein reiner Elfenbeinverarbei-
tungsbetrieb mit einer in HamburgHarburg beheimateten Fabrik, in der Gebrauchs-
gegenstände aus Elfenbein hergestellt wurden, u.a. Elfenbeinplättchen für Klaviertas-
ten, Billardbälle u. ä. ,,Das Geschäft ist das einzige, in seiner Art, welches, unabhän-
gig vom englischen Markte, seinen Bedarf an Rohmaterial zumeist direkt importiert.
Es rüstet dementsprechend selbständige Karawanen mit bis zu 600 Trägern für das
Innere Afrikas aus und unterhält an den Hauptsammelplätzen eigene Aufkäufer." (4)
14
Insgesamt ist die Firma an drei Plätzen in Ostafrika nachweisbar. In Tabora (bis
1886), Bagamoyo und Zanzibar. (5) Da sie nur am Elfenbeineinkauf interessiert ist,
wird sie, wenn überhaupt, als halbe Konkurrenz betrachtet. (6) Das erlaubt es ihr, im
Konkurrenzkampf und im politischen Geschehen eine relativ neutrale Haltung einzu-
nehmen und mit den Handelsfirmen, insbesondere Firma O`Swald eng zusammen
zu arbeiten.(7) Da die Firmen O`Swald, Hansing und die DOAG bis zum Ausbau der
Schiffslinien auf Segler mit ihrer unregelmäßigen Fahrzeit und etwa seit Eröffnung
des Suez Kanals auf vergleichsweise spärliche Dampferkontakte angewiesen waren
und die Bankkontrakte entsprechend lange Zeiten in Anspruch nahmen, arbeiteten
sie als Merchantbanker, d. h. ihr Geschäft war eine Mischung aus Im- und Export,
Reederei- und Bankwesen. (8) Im Rahmen ihrer Bankkontakte transferierten
O`Swalds die nötigen Gelder für Firma Meyer nach Zanzibar resp. wiesen ihr Zanzi-
bar Kontor an, sie den dortigen H. A. Meyer Agenten auszuzahlen. Das von O`Swald
erteilte Accreditiv für Firma Meyer lag bei 40.000 ZanzibarDollars. (9) Zusätzlich
kann man annehmen, dass die MeyerAgenten ihre Tauschwaren (für die Karawa-
nen) wohl in O`Swalds Faktorei kauften.
Die Firma H. A. Meyer stieß bei ihren Geschäften auf Probleme, die eigentlich erst in
einer späteren Periode ostafrikanischen Kolonialhandels üblich wurden. Da sie eine
Firma war, die sich auf ein Handelsgut, Elfenbein, beschränkte, konnten ihre Agen-
ten sich umfassend auf diesen Artikel vorbereiten, den Handel mit ihm quasi zur
,,Wissenschaft" erheben. (10) Dazu kamen ihre genauen Absatzmarktkenntnisse (die
mit den Erfordernissen ihrer Fabrik deckungsgleich waren) und da der Zwischenhan-
del via Londoner oder Antwerpener Auktion ausgeschaltet war, wahrscheinlich ein
guter (d.h. hoher) Aufkaufpreis, den ihre Konkurrenz nicht anlegen konnte.
Andererseits waren ihre Filialen sehr teuer (Unterhaltskosten), da die Agenten keine
Möglichkeit hatten, durch anderweitige Geschäfte die Kosten zu senken (obwohl das
ansatzweise versucht wurde. (11) Ein spezielles Problem ergab sich dadurch, dass
die Agenten der Firma Meyer im Landesinnern die ersten Europäer waren, die sich
dort einrichteten und damit den arabisch/swahilischen Zwischenhandel direkt bedroh-
15
ten. Darin vergleichbar mit der Stellung der DOAG, deren Etablierung ja auch ein
Grund für den AraberAufstand war, wurde die exponierte Faktorei (besser Ankauf-
stelle) der Firma Meyer in Tabora angegriffen, deren Leiter Giesecke ermordet. (12)
Auch der Faktorei Bagamoyo war kein langes Bestehen beschieden. Geplant und
wohl auch errichtet wurde die Faktorei 1890 resp. kurz danach. (13) Aber schon
1892 schreibt der Zanzibar Faktoreileiter der Firma O`Swald an sein Stammhaus:
,,Heinrich Ad. Meyer gibt seine BagamoyoFiliale auf, weil zu kostspielig und wenig
zweckhabend". (14)
Es blieb also nur Zanzibar, das als Hauptim-, wie Exporthafen auch der beste Platz
sowohl für Aufkäufe als auch zur Ausrüstung von Handelskarawanen war. Trotzdem
schien sich eine eigene Faktorei, d.h. eigene Gebäude, Hof, Lager etc. nicht zu
rechnen, wenn auch, allerdings nur vage, einmal von einem Haus der Firma H. A.
Meyer die Rede ist. Wesentlich häufiger allerdings sind Erwähnungen in den Akten
der Firma O`Swald, denen zufolge Firma O`Swald der Firma H. A. Meyer nicht nur
(bis 1886) ein Accreditiv über 40.000 ZanzibarDollar erteilte, sondern auch deren
Agenten in der O`Swaldschen Faktorei beherbergte, ihnen Lagerräume und Arbeiter
zur Verfügung stellte. (15) Es ist anzunehmen, dass die Meyer´schen Agenten ihrer-
seits die Ausrüstung resp. die Tauschwaren für evtl. ,,Aufkaufkarawanen" bei Firma
O`Swald kaufen. Da die Firma O`Swald ihr aufgekauftes Elfenbein an die großen
Elfenbeinauktionen nach London und Antwerpen schickten (16), war es ihnen wohl
ganz angenehm, statt das manchmal unkalkulierbare Auktionsrisiko einzugehen, lie-
ber einen bescheidenen, aber kalkulierbaren Gewinn via Firma Meyer zu bekommen.
Dieser Vorteil wurde allerdings durch das Verhalten der Firma H. A. Meyer teilweise
ausgeglichen. Wahrscheinlich zogen die Agenten der Firma Meyer durch Beobach-
tungen innerhalb der O`Swaldschen Faktorei zuviel Nutzen, insbesondere im Hin-
blick auf evtl. Geschäftsausdehnungen in Richtung Muschelhandel u. ä., so dass
Firma O`Swald überlegte, den wohl unterbrochenen Elfenbeinhandel wieder aufzu-
nehmen. (17) Dazu kam es nicht, aber die schlechten Erfahrungen, die Firma
O`Swald mit Firma H. A. Meyer machte, zeigten noch lange Wirkung, speziell, was
16
das Wohnen von Vertretern anderer Firmen in der Zanzibar Faktorei der Firma
O`Swald betraf. (18)
Das weitere Schicksal der Firma Heinrich Ad. Meyer zeigt den Niedergang des El-
fenbeinhandels in Zanzibar. Nach der Aufgabe des Accreditives 1886 (19) nahm
Firma O`Swald noch Wechsel der Firma Meyer, aber in verringertem Masse, etwa für
M. 40.000 p.a.. (20) Das entsprach offenbar dem geringeren Elfenbeingeschäft in
Zanzibar (21), stand doch im deutschen Kolonialblatt 1900 zum Thema Elfenbein:
,,Es ist auch im letzten Jahr der Antheil DeutschOstafrikas zu Gunsten des briti-
schen Gebiets zurückgegangen, eine Erscheinung, welche mit dem Fortschreiten der
Ugandabahn und der steigenden Bedeutung Mombasas zusammenhängt". (22)
1898 hat die Firma Meyer nur noch einen Mann auf Zanzibar, (23) 1902 gibt sie die
Niederlassung ganz auf. (24) Sie hat statt dessen eine Agentur vergeben, d.h. je-
manden (in diesem Fall eine Firma) für ihre Rechnung und in ihrem Namen Elfenbein
aufkaufen lassen. Da diese Firma Müller Devers sich ebenfalls aus Zanzibar zu-
rückzieht, geht die Agentur an die Zanzibarfiliale von Firma Hansing über. (25)
Schon vorher, um 1894/95, hatte sich Firma O`Swald von Firma H. A. Meyer ge-
trennt (26) und wäre danach frei gewesen, den Elfenbeinhandel wieder aufzuneh-
men. Es dauerte bis 1903, bis sich die Zanzibarfiliale wieder mit dem Gedanken be-
schäftigte, eventuell Elfenbein aufzukaufen. Ein erster ernsthafter Interessent für ei-
nen Elfenbeinlieferkontrakt hielt allerdings den Anforderungen der Firma O`Swald
bezüglich Seriosität und Bonität nicht stand, die Firma Freudenberg in Colombo wur-
de vom Stammhaus O`Swald abgelehnt, ihr Angebot an den indischen Kaufmann A.
D. Visram weitergeleitet. (27) Kurz danach wurde das Angebot einer US
amerikanischen Firma, der Wood Brook Co., akzeptiert, für sie kommissionsweise
Elfenbein anzukaufen. Allerdings war es hierbei für Firma O`Swald nicht nur interes-
sant, einen Einblick in das Elfenbeingeschäft zu bekommen, aus dem sie ja 1908
schon recht lange heraus waren, sie wollten auch und das war wohl ihr Hauptgrund,
einen Partner für den US-Fellmarkt (Ziegen- und Schaffelle, anderswo kaum kosten-
deckend zu verkaufen) bekommen. Eine erste Versuchsladung zusammenzustellen
17
dauerte allerdings zu lange, in den USA fielen zwischenzeitlich die Elfenbeinpreise
und so fand die endlich angelangte Sendung O`Swalds nicht die Zustimmung der
Firma Wood Brock Co., das Geschäft zerschlug sich und Firma O`Swald stellte das
Elfenbeingeschäft endgültig ein. (28)
Ende des Kauri Muschel Geschäftes
Der Handel mit KauriMuscheln wurde von der Firma O`Swald nicht verändert. Wie
schon zu Beginn des KauriMuschelHandels, um 1850, war es meist ein Platzhan-
del, d. h. in Zanzibar wurden die Muscheln angeliefert und dort, in O`Swalds Fakto-
rei, gereinigt (gewaschen und getrocknet) und ausgesucht. (1) Gehandelt wurden in
Ostafrika die ,,unechten Kauris" (2), Cypraea annulus (3), als Maßeinheit beim Ein-
kauf galt ein arabisches Hohlmass, die Jissla (oder Djizzla). (4) An sich wurden Kau-
ris das ganze Jahr über gehandelt, als Höhepunkt galt die Zeit des Nordostmonsuns,
von Oktober bis April (5) (Auslieferung der Kauris nach Zanzibar von den Sammel-
plätzen via Lamu wohl per Dhau, also Segelschiff).
Das Waschen und Auslesen der Kauris war nicht nur arbeitszeit- und platzaufwendig,
sondern führte auch zum ersten und bis zum Ersten Weltkrieg einzigen Arbeitskampf
von einheimischen Arbeitern der O`Swaldschen Zanzibarfaktorei. Die im Kaurihof
beschäftigten Frauen streikten, als ihnen Mitte 1902 zugemutet werden sollte, ihre
tägliche Arbeitszeit um eine Stunde zu verlängern, d.h. ihr Feierabend sollte von
17.00 Uhr auf 18.00 Uhr verlegt werden. (6)
Dies geschah am Ende der O`Swaldschen Kauri-Handelszeit (vielleicht gerade des-
wegen). Die ZanzibarKauris wurden in den 1860er Jahren im Gebiet Lagos
Abeokuta gehandelt (wo Firma O`Swald dann auch kurzzeitig eigene Faktoreien hat-
te, diese aber 1870 an Firma Gaiser Witt verkaufte (7) und dann denen Kauris lie-
ferte) und erreichten um 1890 Togo und das Yoruba Land. (8) Neben dem Lieferkon-
trakt mit Firma Gaiser Witt (oder auch danach) erreichte Firma O`Swald 1899 ein
18
Auftrag aus Liverpool, der zur Probe ca. 1.200 Sack Kauris umfasst. (9) Auftraggeber
war die englische Firma John Holt Co. Ltd., mit der Firma O`Swald dann bis zum
Ende des KaurisHandels zusammenarbeitete. 1902 ergab sich durch Nahrungs-
mangel im Süden (von Zanzibar aus gesehen!) ein letzter KauriBoom, da um Nah-
rungsmittel kaufen zu können, viel gesammelt und angeboten wurde. Das ergab na-
türlich niedrige Ankaufspreise durch Überangebot an Kauris. (10) Schon 1903 jedoch
brach der Absatzmarkt weg, Kauris gingen als Ware nicht mehr, die Firma verfügte
nur noch über geringe Restlager, die 1904 endgültig unverkäuflich wurden, als die
Regierung in Westafrika (wohl Nigeria) die Einfuhr von Kauris verbot. (11)
Der Niedergang der Kauri,,Währung" in den hier hauptsächlich interessierenden
Gebieten Gold- und Elfenbeinküste sowie dem Oilriver (heutige Staatsgebiete Gha-
na, Togo, Nigeria, Dahome) begann bereits ab den 1850er Jahren. (12) Die Ursa-
chen, die zum Verfall der Kauri,,Währung" geführt haben sind in den verschiedenen
Gebieten nicht einheitlich, hängen aber offenbar mit der Einführung des ,,legitimate
trade" zusammen, d.h. mit der Umstellung von Sklavenhandel auf legitimen Handel
mit Landesprodukten. Das bedeutete eine Umstellung der bisherigen Tauschwaren
(z. B. brauchte man nicht mehr so viele Waffen etc.) z.T. auch eine Umstellung auf
neue Verkäuferschichten, die wie die Krobos, aus religiösen Gründen nur Kauris als
,,Geld" akzeptierten. (13) Offenbar wurden große Mengen Kauris speziell zum Palm-
öleinkauf importiert, die aber nicht alle entweder gehortet oder zur Produktionsaus-
weitung verwendet werden konnten. (14) Das daraus resultierende Überangebot an
Kauris führte, wie das ja auch mit anderen Währungen geschieht, zur Inflation. (15)
In der Phase effektiver kolonialer Machtergreifung verschärfte sich das Währungs-
problem zusätzlich. Die für die Kolonialverwaltungen nötigen Polizei- und Militärgrup-
pen mussten entlohnt werden, was zumeist in Münz- und Papiergeld der jeweiligen
Kolonialmacht geschah, es kam also Hartgeld in zunehmendem Masse auf die Märk-
te der Kolonien. (16) Dass die neu eingeführte Hüttensteuer zuerst auch in Kauris
gezahlt werden konnte, hatte zur Folge, dass sich große Mengen Kauris bei den un-
teren Verwaltungseinheiten anhäuften (Distriktsebene) und so örtlich zur Kauri
19
Inflation, d.h. zur Wechselkursverschlechterung Kauris gegen europäisches Hartgeld,
führten. (17)
Alle diese Erfahrungen führten bei den verschiedenen Kolonialbehörden (deutsche,
englische, französische) zu Einsichten, die wohl von dem britischen Kolonialpolitiker
F. Lugard am knappsten und besten formuliert wurden: ,,The caurie will always re-
main (as it does in India to this day) a medium of exchange for every small values,
but it is most eminently desirable that it should be replaced for higher values by metal
coins on account of (a) the bulk and weight and the great time taken in counting, (b)
the wastage invalved by breakage, leakage of bags etc., and (c) ist fluctuating value."
(18) Die logische Folge war eine erhebliche Einschränkung des KauriImports, re-
spektive ein Einfuhrverbot wie das bereits oben erwähnte, das dann natürlich auch
zur Einstellung des KauriGeschäftes der Firma O`Swald 1904 führte.
Das Ende des Orseille Handels
Der Begriff Orseille hat seit den Zeiten der Firma O`Swald einen Bedeutungswandel
erfahren, so dass es nötig ist, zu definieren, was hier gemeint ist. Das DTVLexikon,
Ausgabe 1972 (1) definiert Orseille als ,,roter Pflanzenfarbstoff aus verschiedenen
Flechten (Rocella, Leconora, Ochrolechia u.a.); heute nicht mehr verwendet"; wäh-
rend Paul Heichels Afrika Lexikon 1885 noch behauptet: ,,Orseilleflechte, eine Färbe-
flechte, welche ein schönes Violett, das Archil, giebt ...Die Nachfrage im Handel ist
so groß, daß England allein mehr als 25.000 Zentner jährlich einführt." (2) Diese
Flechten wurden von der Firma O`Swald aufgekauft, in grobe und feine Orseille sor-
tiert, gereinigt und zu Ballen gepresst, wozu man einiger Platz in der Faktorei benö-
tigte. (3)
Die Firma O`Swald begann schon früh, um 1853, mit dem OrseilleHandel (4), der
einen raschen Aufschwung nahm und offenbar ein recht großes Netz an Lieferver-
trägen und Aufkäufen erforderte, das von Mocambique bis zur Benadirküste (heuti-
20
ges Somalia) reichte (5). Eine erste Einschränkung des Orseilleabsatzes gab es um
1878, als das Stammhaus der Firma O`Swald nach Zanzibar berichten musste, dass
ein neues Konkurrenzprodukt zur Orseille entwickelt worden war, das Anilin.
Anilin (Aminobenzol) ist ein Bestandteil des Steinkohlenteers und Ausgangsstoff für
eine ganze Reihe von Farbstoffen. (6) Dieser durch die chemische Industrie gefertig-
te Farbstoff ließ sich, ohne wachstumsbedingte Schwankungen und lange Transpor-
te, im deutschen Reich billiger herstellen als Orseille, weshalb es mit dieser langsam
zu Ende ging. 1888 musste Firma O`Swald aus Kostengründen das Orseille-
Geschäft mit der BenadirKüste aufgeben. Obwohl 1899 noch alle europäischen
Firmen Orseille aufkauften und exportierten, musste das Stammhaus der Zanzibar-
Faktorei schon 1903 mitteilen, dass es keinen Bedarf für Orseille mehr gebe. (7)
1904 brauchte die Zanzibar-Faktorei den bisher für Orseille verplanten Platz für an-
dere Geschäfte und auch ein letztes Projekt 1908, bereits gereinigte Orseille anzu-
kaufen, hatte keinen Erfolg mehr, die Orseille war endgültig von den Anilinfarben
verdrängt worden. (8)
Familiengeschichte O`Swald
Anfang der 1890er Jahre befand sich die Firma Wm. O`Swald Co., welche 1831
durch William O`Swald senior (17981859) gegründet worden war, in den Händen
der zweiten Familiengeneration.
Albrecht Percy O`Swald (18311899) und William Henry O`Swald (18321932) teil-
ten sich die Leitung der Firma; wobei Albrecht die Führungsrolle innerhalb der Firma
übernahm, während William sich eher um Hamburg und dessen politische Belange
kümmerte, wobei er seine politischen Aufgaben im Vergleich zu den Firmengeschäf-
ten in den Vordergrund stellte. Dieses politische Wirken kam der Firma indirekt zugu-
te.
21
Siebenundzwanzigjährig erlebte William 1859 seinen ersten großen politischen Er-
folg in Zanzibar, wo er in der Faktorei des väterlichen Betriebes beschäftigt war. Ihm
gelang der Abschluss eines Handelsvertrages mit dem Sultan von Zanzibar. (1)
Heimgekehrt setzte er seine Karriere fort, wurde 1866 Kommerzdeputierter und Mit-
glied der Deputation für Handel und Schiffahrt, ein Jahr darauf Mitglied der Bürger-
schaft, von 1869 bis 1912 gehörte er dem Senat Hamburgs an, aus dessen Reihen
man ihn zweimal zum Bürgermeister von Hamburg wählte, was ungewöhnlich war
und den sonst in Hamburg üblichen Regeln nicht entsprach.
Sein politisches Hauptinteresse lag in der Sicherung von Hamburgs Stellung im Au-
ßenhandel. Sein Kampf um den Zollanschluss Hamburgs, die Elbevertiefung und
Verbesserung der Kaianlagen, sowie der Köhlbrandvertrag, der eine Ausweitung des
Freihafengebietes brachte, belegen dies.
Ehrungen blieben nicht aus, so wurde einer der Hafenkais O`Swaldkai genannt und
1914 taufte HAPAG einen Dampfer auf den Namen William O`Swald. (2) Während
dieser Zeit war Albrecht Percy O`Swald die eigentliche ,,Seele" des Geschäftes. Wie
William verbrachte auch Albrecht einige Zeit in der Faktorei Zanzibar, nach seiner
Rückkehr übernahm er den Hauptteil der Arbeit in der Firma, um seinen Bruder zu
entlasten. Daneben fand er noch Zeit für eine Reihe von unterschiedlich bedeuten-
den Ehrenämtern und Aufsichtsratsposten. Eines der wichtigsten war sicher das des
Generalkonsuls von Zanzibar, welches er ab 1888 innehatte, wie auch der Aufsichts-
ratposten bei der Deutschen Bank. Nicht so bedeutend und weniger einflussreich für
eine das Familienunternehmen unterstützende Politik, waren hingegen die Aufsichts-
ratsitze bei der HamburgAmerikaLinie (ab 1876), der Deutschen Dampfschiffsree-
derei und der Seemannsschule. (3)
Die Werdegänge beider Brüder unterschieden sich wenig von denen anderer hanse-
atischer Kaufleute, die in den gleichen Gegenden handelten, wie z.B. Adolph Woer-
mann und Justus Strandes. (4) Eine Häufung von Aufsichtsrats- und/oder
Senatsposten, wie auch Reichstagsmandate und andere Meriten waren quasi ein
Muss für die Gesellschaftsschicht der sie angehörten. Graduelle Unterschiede
22
die Gesellschaftsschicht der sie angehörten. Graduelle Unterschiede bestanden nur
in Anzahl, Ausrichtung (Wirtschaft, Politik, Soziales, Historisches) und Erfolg.
Ebenfalls recht ,,hanseatisch" war die Reaktion der Brüder auf die Ereignisse, die mit
Beginn der ,,deutschen kolonialen Epoche" eintraten. (5)
Zwar hatten die O`Swald einen relativen Einfluss auf den Sultan von Zanzibar, wie
auch durch die zeitweise Übernahme von Konsularposten auf die Zanzibarpolitik an-
derer Staaten (hauptsächlich KuKMonarchie und Italien) (6), doch blieben sie, nicht
zuletzt aus Rücksichtnahme auf ihre eigenen Handelsinteressen, nahezu strikt neut-
ral.
Diese Nichtparteinahme bewiesen sie u. a. in Hamburg dadurch, soweit dies für den
Senator William O`Swald möglich war, dass sie sich nicht in der Deutschen Kolonial-
gesellschaft und dem Deutschen Flottenverein engagierten, im Burenkrieg für die
Neutralität des Deutschen Reiches eintraten und an ihre Faktorei in Zanzibar strikte
Order erteilten, sich in Fragen der Grenzziehung DeutschOstafrikas zurückzuhalten.
(7)
Auch in der Beziehung zu Peters und der späteren DeutschOstafrikanischen
Gesellschaft (DOAG) bemühten die O`Swalds sich um Neutralität. Ihre Distanz ging
soweit, keine Geldsendungen für Peters übernehmen zu wollen. Um jedoch für ihren
Dampfer Fracht zu erhalten, übernahmen sie die Spedition für ihn. (8)
Wissmann hingegen war offenbar ein Mann, der sich mit den O`Swalds zu verständi-
gen wusste. Nach anfänglichem Zögern (sie wollten Sicherheiten) waren sie bereit,
seine Expedition mit Geld zu versorgen, d.h. über die Deutsche Bank übernahmen
sie einen kleineren Teil der Geldüberweisungen. Einen größeren Betrag erledigte der
Hauptkonkurrent der Firma O`Swald auf Zanzibar, die deutsche Firma Hansing
Co., in Zusammenarbeit mit einer englischen Bank.
Die Verbindung O`Swald/Wissmann wurde weiter ausgebaut, bis hin zu einer ge-
meinsamen Reise von Wissmann und Alfred O`Swald zu verschiedenen Küstenplät-
zen DeutschOstafrikas im Januar/Februar 1890. (9)
23
Die Haltung der O`Swalds und anderer Kaufleute zum HelgolandZanzibarVertrag
hätte von stark kolonialistisch gesinnten Kreisen als antideutsch aufgenommen
werden können, da aber der große Einfluss Englands auf Zanzibar den O`Swalds gut
bekannt war, konnten sie die Vereinbarung nur billigen. (10)
1894 wurde die Firma O`Swald in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt
(11) und die Söhne von William und Albrecht als Gesellschafter mit aufgenommen,
womit die dritte Generation O`Swald in die Firmenleitung aufrückte. All diese Famili-
enmitglieder hatten auf einer der Faktoreien der Firma in Ostafrika und Madagaskar
gelernt, bzw. eine Faktorei geleitet.
Ein Sohn Albrechts, William O`Swald (18591888) starb vor der Umwandlung der
Firma auf Zanzibar. Von ihm wurde die einzige Plantage der Firma, die Plantage Ol-
ga gegründet.
Die verbliebenen Söhne waren Ernst Alfred O`Swald (18611929), Albrecht William
O`Swald (1861-?) und Henry O`Swald (18691938), der allerdings erst 1901 als Er-
satz für den verstorbenen Albrecht Percy O`Swald Gesellschafter wurde. (12) Auch
diese Generation blieb der Firmenpolitik und hanseatischen Traditionen treu. Es be-
fand sich jedoch niemand mehr vom Format eines William Henry O`Swald unter ih-
nen.
Ernst Alfred O`Swald, der Sohn Albrecht O`Swalds, leitete die Faktorei Nossi Be län-
gere Zeit und wurde nach seiner Rückkehr Mitglied der Bürgerschaft und Finanzde-
putation. Wie sein Vater war er Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank und im
Vorstand vieler gemeinnütziger Unternehmen. (13) 1891 erhielten er und Albrecht
William O`Swald, der Sohn Senator O`Swalds, Prokura für die Firma. Albrecht war
zwischen 1884 und 1890 Agent der Firma in Zanzibar und wurde nach dieser Zeit
Mitglied der Handelskammer und Aufsichtratsmitglied der Norddeutschen Versiche-
rungsgesellschaft. (14)
Von allen O`Swalds der dritten Generation scheint Henry O`Swald, Bruder von Alb-
recht William, am wenigsten an den Firmengeschäften beteiligt gewesen zu sein.
Sein Hauptwirkungskreis lag in Madagaskar, dessen Konsul er war. (15)
24
Jeder der ,,jungen Herren" der Firma hatte einen Sohn, welcher bei Eintritt in die Fir-
ma (etwa kurz vor Beginn des Weltkrieges) die Familiengeschäfte in der vierten Ge-
neration weiterführte. Der Erste Weltkrieg führte jedoch zu einem Bruch in dieser
Kontinuität, da zwei der Vettern O`Swald während seines Verlaufes starben. Ihren
Vätern und dem verbleibenden jungen O`Swald fiel die schwere Aufgabe zu, die Fir-
ma wieder aufzubauen, die durch den Krieg und den Verlust der Faktoreien stark
geschwächt war. (16)
Schiffsverkehr: Firma O`Swald eigene Reederei
Es gehört zu den ganz simplen Tatsachen im Geschäftsleben eines Kaufmannes,
dass man Käufer und Waren zusammenbringen muss, um Umsatz zu erzielen. Da
die Waren in Europa hergestellt wurden, die Käufer sich aber in Afrika befanden, war
ein Seetransport unumgänglich. Schiffslinien existieren noch nicht, also blieb nur,
Schiffe entweder zu chartern oder selbst als Reeder zu agieren. Deswegen baute die
Firma O`Swald, ähnlich wie andere deutsche Handelsfirmen, etwa Vietor, Herts und
Woermann, ihre eigene Flotte von Segelschiffen auf, die allerdings, im Gegensatz
etwa zur Firma Woermann, bei der diese Geschäftssparte zur Hauptbeschäftigung
wurde (1), immer nur ,,Dienerin am Gesamtwerk" (2) war.
Dass vorerst nur Segelschiffe für die Firma fuhren, obwohl schon erste Dampfschiffe
zur Verfügung standen, als die Firma sich Zanzibar und Madagaskar als Arbeitsge-
biet aussuchte (ab 1845), liegt wohl einerseits an den hohen Kosten, Segler waren
vorerst billiger und andererseits an der noch nicht ausgereiften Technik. Es war ein-
fach noch nicht ökonomisch, für den Transport solcher Güter, wie O`Swalds sie
brauchten, Dampfschiffe einzusetzen. (3) Vorläufig fuhren Segelschiffe für die Firma
von Europa aus nach Ostafrika, Madagaskar und (hauptsächlich mit Kauri
Muscheln) zu der relativ kurzlebigen LagosFiliale (18531870) in Westafrika (4) und
von da mit Palmöl und ähnlichem nach Europa.
25
In der LagosFaktorei gab es 1862 eine durch die dortige Geschäftslage bedingte
Veränderung. Die bisher am Strand (Bucht) gelegene Faktorei wurde nach Lagos
Stadt verlegt. Das bedeutete für den Gütertransport der Firmen, dass eine Sandbank
(Barre) zu überqueren war, wollte man die Handelsgüter vom Schiff zur Faktorei
bringen bzw. Produkte von dort zum Schiff. Da ein Transport mit Kanus der Firma zu
gefährlich schien (zu häufige Verluste durch Umschlagen?), wurde von der damals
modernsten technischen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, dem Dampfschiff. Ein
größeres Wagnis war damit nicht verbunden, da englische Unternehmer schon 1861
bewiesen hatten, dass es möglich war, die Barre mit Dampfschiffen zu überwinden.
Firma O`Swald orderte auf der Hamburger ReiherstiegWerft einen Dampfer, um so
schneller, kostengünstiger und wohl auch mit weniger Personal ihre Waren und Pro-
dukte über die Barre zu bekommen. (5) Das Schiff, die ,,Tender", ein 105 BRT gro-
ßer, eiserner Schraubendampfer mit einer 15 PS starken Maschine, wurde am
19.05.1862 angekauft. (6) Im Gegensatz zu dem englischen Schiff, das noch einen
Schaufelradantrieb hatte und deshalb Probleme aufwarf (7), schien die ,,Tender" ei-
nige Wochen lang gut zu funktionieren, doch hatte man den offenbar recht häufigen
Fehler begangen, den Heizkessel mit salzigem Seewasser zu speisen (Dampferzeu-
gung), was ihn binnen kurzer Zeit schrottreif werden ließ. (8) Der Ersatz des kaputten
Kessels gestaltete sich recht schwierig, da fast alle technischen Hilfsmittel in Lagos
fehlten, d.h. es bestand noch keine technische Infrastruktur, wie Reparaturwerften
oder ähnliches. Die weitere Tätigkeit der ,,Tender" muss O`Swald allerdings über-
zeugt haben, da bereits 1867/68 ein neues Schiff von der ReiherstiegSchiffswerft
und Kesselschmiede angekauft wurde, die ,,Tornado". Sie war um einiges größer als
die ,,Tender" und hatte eine mehr als das Doppelte leistende Dampfmaschine von 35
PS und kann deshalb schon eher als die ,,Tender", die Hieke auch einen Schoner mit
Hilfsmaschine nennt, als Dampfschiff bezeichnet werden. Die ,,Tornado" hatte ähnli-
che Aufgaben wie die ,,Tender", jedoch sollte sie neben dem Be- und Entladen von
Segelschiffen auch als Schlepper dienen und die Umgebung von Lagos und Palma
erforschen. (9)
26
Der Besitz und Betrieb dieser relativ kleinen Dampfschiffe machten aus der Firma
O`Swald noch keine Experten für die Dampfschifffahrt, aber es waren die ersten
Kontakte geknüpft worden, die es der Firma ermöglichten, einem Wunsche des da-
maligen Sultans von Zanzibar, Seyd Modjid, nach einem Dampfschiff nachzukom-
men. Ab 1867 war der Sultan Besitzer der ,,Star", eines eisernen Schraubendampfers
von 153 BRT, der ebenfalls von der Reiherstieg-Werft gebaut wurde. Offenbar waren
die Leistungen der ,,Star" zufriedenstellend, denn O`Swald vermittelte dem Sultan
von Zanzibar noch zwei weitere Schiffe und es wurden Pläne gemacht, allerdings
nicht ausgeführt, um weitere Schiffe zu bauen resp. zu erwerben. (10)
Auch die eigene Dampferflotte der Firma O`Swald wurde vergrößert, jedoch nicht
nur, weil die Dampfschiffe im Betrieb der Firma ihre Eignung nachwiesen. Ab 1870
war die Zeit der großen HandelshausFlotten auch in Afrika vorbei. Die Entwicklung
der Dampfschifffahrt hatte zu windunabhängigen, ökonomisch nutzbaren Schiffen
geführt, die Eröffnung des SuezKanals den Weg nach Ostafrika verkürzt und das
Bedürfnis der kolonialen Metropolen, allen voran London, nach schnellen Postver-
bindungen mit den Kolonien, führten zur Gründung subventionierter Schiffspostlinien.
Da Firma O`Swald zudem ab 1870 den Handel mit Westafrika weitestgehend aufgibt
und seine dortige Faktorei verkauft, stößt sie gleichfalls nach und nach auch alle für
den dortigen Handel benötigten Schiffe ab. (11) Was noch bleibt, ist der Bedarf der
Firma an Transportkapazität für die Route EuropaZanzibarMadagaskar und retour.
Dafür boten sich zwei Möglichkeiten an, die beide von der Firma genutzt wurden:
Erstens Versand durch die sich immer weiter entwickelnden Postliniendampfer und
zweitens Aufbau einer eigenen (Dampf-) Transportkapazität. Der Versand per ,,Mail",
d.h. mit den Postdampfern, wurde etwa ab 1878 angefangen. Versandt wurden
hauptsächlich teurere Produkte wie Elfenbein, Nelken und Kautschuk, alles andere
geht bis 1883 noch per Segelschiff nach Europa bzw. Ostafrika. (12) Ab 1883 steht
der Firma dann ihr erstes größeres Dampfschiff zur Verfügung, der beim Vulcan in
Stettin gebaute, 683 t große Dampfer ,,Zanzibar". (13)
27
Mit der Indienststellung der ,,Zanzibar" wurde das Transportwesen der Firma neu ge-
ordnet: Höherwertige Waren und Produkte, die die zur der Zeit noch recht hohen
Dampfschiffslinienfrachten verkraften konnten, gehen per ,,Mail", die anderen Waren
und Produkte kamen mit der ,,Zanzibar" oder, falls eine günstige Charter möglich war,
evtl. auch per Segler. Zusätzlich nimmt die ,,Zanzibar" auch Güter die für Amerika
bestimmt sind mit, entweder nach London (falls es über 200 t Ladung sind) oder
nach Hamburg, wo sie dann auf HAPAG Schiffe umgeladen werden. (14) Eine Fahrt
der ,,Zanzibar" EuropaOstafrikaMadagaskar und retour dauerte etwa 120 Tage,
davon rund 30 Liegetage, also die Zeit zum Be- und Entladen. Da jeder Tag die Fir-
ma etwa M 520,40 kostete, versteht man die Mahnungen des Stammhauses, die
Liegezeiten kurz zu halten und wenn möglich, noch mehr zu verkürzen. (15) Um
stets volle Ladung zu haben, wenigstens von Europa aus, sollte verstärkt von Ham-
burg aus verschifft werden, und es wurden Pläne untersucht, dann allerdings verwor-
fen, die ,,Zanzibar" auch auf Trampfahrt an die indische Küste zu schicken, um in
Calcutta Reis zu holen. Diese Pläne scheiterten dann an den zu hohen Kosten. (16)
Mehr Erfolg hatte ein anderer Plan. Um die teuren Linientickets zu sparen, hatte die
,,Zanzibar" immer ein paar Kabinen für zahlende Gäste resp. Firmenangehörige frei,
die auf ihr zu den Faktoreien fuhren oder auch zurück nach Europa. Um den eigenen
Leuten, speziell im für Europäer mörderischen Klima Zanzibars, den Aufenthalt an-
genehmer zu machen, was dann zu weniger Arztkosten und Erholungsurlauben in
Europa führen sollte, richtete die Firma eine Art Kurzurlaubssystem ein. Firmenmit-
arbeiter gingen in Zanzibar an Bord und fuhren mit bis Madagaskar und zurück, so
dass sie eine Zeitlang aus dem Inselklima hinaus in das gesündere Meeresklima
kamen. (17)
Der eigentliche Zweck der Firmenreederei war aber der Wettbewerbsvorteil, der sich
aus dem Betrieb eines eigenen Dampfschiffes ergab. Dieser war besonders groß bei
den geringwertigen Massengütern, den sogenannten ,,Bulk Artikeln" oder ,,Füllarti-
keln", die die Firma O`Swald billiger transportieren konnte als die auf die Linienree-
dereien angewiesene Konkurrenz. (18) Der zweite Vorteil, der wohl bis zum Aus-
28
bruch des Ersten Weltkrieges erhalten blieb, war die stetige Verbindung nach Mada-
gaskar zu den dortigen Faktoreien der Firma. Wer die Akten O`Swalds daraufhin
durchsieht, stellt fest, dass etwa ab 1890, als die Firma wegen gesunkener Linien-
frachten und Konkurrenzdruck sowie vermehrtem Angebot an Liniendampfern in
Ostafrika auch Füllartikel per Mail schicken musste (19), Ostafrika zwar angelaufen
wird, aber insgesamt mehr Zeit und Frachtraum für Madagaskar reserviert wurde. Ab
1905 herrschte im Stammhaus sogar die Ansicht: ,,Der Dampfer rentiert sich fast nur
durch unser Ostküstengeschäft, speziell ausgehend. Heimgehend trägt die Westküs-
te etwas dazu bei. Bei den ausgehenden Zanzibarund MombasaFrachten könnte
die Reederei nicht bestehen." (20)
Ein weiterer, nur schlecht einschätzbarer, Vorteil ergab sich aus der bloßen Existenz
der ,,Zanzibar", aus der Sicht der Linienreedereien ein unabhängiger Außenseiter,
der immerhin in der theoretischen Lage wäre, das Preis- und Fahrplangefüge der
Reedereien zu stören. Diese Einschätzung zusammen mit der Stellung der Firma als
einem der größten Handelshäuser Ostafrikas war es wohl, die die Reeder veranlass-
te, die ,,Zanzibar" als ,,Konferenzschiff" anzuerkennen. (21)
Dass die Nutzung eines Dampfschiffes für O`Swald gewinnbringend war, belegt nicht
zuletzt auch die Haltung der Firma beim Verlust der ,,Zanzibar" 1898 an der Ostküste
Zanzibars. Der Dampfer wurde durch einen größeren Neubau ebenfalls ,,Zanzibar"
genannt (900 t Schiff) ersetzt, dessen Stapellauf am 24.08.1899 verrät, dass ein Er-
satz der alten ,,Zanzibar" schon geplant war. Diese größere ,,Zanzibar" wurde 1911
durch ein um etwa 40% größeres Dampfschiff ersetzt, die dritte und letzte ,,Zanzibar".
Um für ein so großes Schiff auch entsprechend viel Ladung zu haben, wurde der
Fahrplan ausgedehnt und die Firma versuchte sich Aufträge für Massengüter zu ver-
schaffen, so z.B. Kohlen für den Bahnbetrieb. (22) Als das 1.225 t - Schiff 1916 ver-
kauft wurde, war das das Ende einer Kaufmannsreederei, die im Laufe ihres Beste-
hens 45 Schiffe bauen ließ und einer der letzten derartigen Geschäftszweige war,
wenn auch stets auf der Höhe der damaligen Technik. (23)
29
Die Entwicklung der Schiffslinien
Die ersten Schiffslinien wurden im Geschäftsgebiet der Firma O`Swald nach der Er-
öffnung des Suez Kanals 1869 eingerichtet. Es gab zwar Vorläufer, doch die dienten
hauptsächlich der Postbeförderung. (1) Auch die in den siebziger Jahren des 19.
Jahrhunderts gegründeten Liniendienste wurden noch häufig wegen der für die Post-
beförderung gezahlten Subventionen eingerichtet, doch beförderten sie daneben
schon mehr und mehr Fracht. Anfänglich waren diese Linien kaum mehr als Zweigli-
nien, die den Anschluss Zanzibars und einiger weniger ostafrikanischer Häfen an die
großen internationalen Linien besorgten, so löschten z. B. die von Europa nach A-
sien (China, Japan) fahrenden Schiffe der P O Line in Aden Post und Fracht für
Zanzibar, die dann die British India Steam Navigation Company nach Zanzibar be-
förderte. Eine ähnliche Route wurde von Südafrika (Kap der guten Hoffnung, Port
Natal) aus eingerichtet. (2) Diesen Stichrouten folgten bald direkte Verbindungen
Europa/Ostafrika und retour, die erste war die vom französischen Staat subventio-
nierte Linie des Marseiller Handelshauses Regis, die von Frankreich aus erst Zanzi-
bar und dann die ostafrikanische Küste anlief. Zur gleichen Zeit nahm die Union Line
von England aus die Route um das Kap der guten Hoffnung nach Zanzibar. (3) Im
Laufe der Zeit erwies es sich, dass Verbindungen nach Zanzibar und Ostafrika zu
einem akzeptablen Geschäft wurden, zumal die Kolonialregierungen ihre Subventio-
nen für einen regelmäßigen Postverkehr koloniales MutterlandKolonie und retour
erhöhten und das geschäftliche Risiko für die Linienbetreiber so verringerten. Mit der
Ausweitung der Kolonialwirtschaft erweiterte sich auch das Liniennetz, weshalb z. B.
1883 der neue Vertrag der englischen Regierung mit der British India Steam Naviga-
tion Comp. nun auch ostafrikanische Küstenorte umfasste, in denen sich englische
Vizekonsulate befanden. 1885 eröffnete die Messagerie Maritime eine Direktlinie
FrankreichZanzibar, die einmal im Monat über Mocambique, Mayotta, Majango
nach Nossi Bé führte. Auch Fahrten über Tamatave nach Zanzibar waren vorgese-
hen. Ab 1888 fuhr die Linie von Marseille aus nach Zanzibar. (4)
30
Nach 1890 verdichtete sich das Liniennetz weiter, als die Deutsche-Ost-Afrika-Linie
(D.O.A.L.) ihren regelmäßigen Dienst aufnahm. 1890 folgte der Austria Lloyd und
1910 nahm die italienische Servisi Marittimi einen Liniendienst von Italien via Mom-
basa, Kismayu, Benadir nach Zanzibar und retour auf. (5)
Etwa gleichzeitig mit der Zunahme der Linien im Verkehr EuropaOstafrika stieg
auch die Verkehrsdichte, d.h. die Anzahl der Schiffe pro Linie und etwas weniger
schnell die Anzahl der angelaufenen Häfen. Um die Übersicht nicht ganz zu verlie-
ren, soll das hier nur an einem Beispiel aufgezeigt werden, an der Schiffslinie, mit der
die Firma O`Swald die meisten Transportgeschäfte machte, mit der DOAL. (6)
Als die DOAL 1890 ihren Liniendienst aufnahm waren drei Routen geplant: Die
Hauptroute, sie führte von Hamburg aus über einen holländischen oder belgischen
Hafen, Lissabon, Neapel, Port Said (Suezkanal), Aden, Zanzibar, Daressalam, Mo-
cambique, Delagoabay und zurück, sowie zwei Nebenrouten. Die erste führte von
Zanzibar aus nach Bagamoyo, Sadani, Pangani, Tanga oder Daressalam, Pemba,
Mombasa und Lamu retour, die zweite von Zanzibar nach Kilwa, Lindi, Ibo, Quelima-
ne, Chiloune und Inkambane. Die Hauptroute sollte einmal monatlich befahren wer-
den, ebenso die zweite Nebenroute, während die erste Nebenroute zweimal pro Mo-
nat bedient werden sollte. Der Abschluss des HelgolandZanzibar-Vertrages machte
es jedoch nötig, die Routenführung noch einmal abzuändern, so dass die kolonial-
englischen Häfen Lamu, Pemba und Mombasa nicht mehr angelaufen und Daressa-
lam vor Zanzibar bedient wurde. ,,Im Jahre 1892 wurden die Fahrten auf der Hauptli-
nie ohne Erhöhung der Subventionen bis Durban ausgedehnt; Die Abfahrten erfolg-
ten ab 1896 dreiwöchentlich und ab 1889 zweiwöchentlich. Seit dem Jahre 1892 ex-
pedierte die DOAL auch regelmäßig einige Dampfer auf der Strecke Ostafrika
Bombay". (7) 1900 wurde zwischen der DOAL und dem deutschen Reich ein neuer
Subventionsvertrag geschlossen.
,,Die neue Hauptlinie hatte zweiwöchentliche Rundfahrten um ganz Afrika auszufüh-
ren, und zwar abwechselnd in westlicher und östlicher Richtung. Die westliche Linie
ging über Las Palmas, Kapstadt, Port Elizabeth und East London durch den Suezka-
31
nal zurück, die östliche Linie durch den Suezkanal über Ostafrika nach den Städten
des Kaplandes und von da durch den Atlantischen Ozean wieder nach Hamburg.
Außer dieser Hauptlinie wurde eine Zwischenlinie mit vierwöchentlichen Abfahrten
eingerichtet, deren Schiffe von Hamburg über Neapel durch den Suezkanal bis Beira
liefen und auf der Heimfahrt dieselben Häfen wie auf der Ausreise zu bedienen hat-
ten." (8) Die Hauptlinie war größtenteils für Passagiere, die Zwischenlinien eher für
Frachtbeförderung gedacht. Die Bombay Linie wurde, ohne an den Subventionen
beteiligt zu werden, ebenfalls in das neue Abkommen einbezogen. Sie hatte monat-
lich einmal Pangani und Bagamoyo, auf Ersuchen des kaiserlichen deutschen Gou-
vernements auch andere deutschostafrikanische Plätze anzulaufen, da die
Deutsch-OstafrikanischenPlätze nicht schlechter gestellt sein sollten als die briti-
schen und portugiesischen Plätze Ostafrikas. Für alle diese Änderungen wurde aller-
dings auch die Subventionssumme deutlich erhöht. Sie stieg von M 600.000,- auf M
1.350.000,--. (9)
Die nächsten schwerwiegenden Veränderungen fanden 1907 statt. Diesmal ging es
nicht um neue Fahrpläne: die Hauptlinie verkehrte ost- wie westwärts mit dreiwö-
chentlichem Abstand. Die Zwischenlinie wurde mit größeren Dampfern zur reinen
Post- und Frachtlinie, die ab jetzt sechswöchentlich verkehrte und die Bombay Linie
1014täglich mit Einbeziehung der Seychellen, sondern auch um eine Umgestaltung
innerhalb des Reedereibetriebes. Das wurde durch Sonderwünsche der kaiserlich
deutschen Regierung ausgelöst, die Veränderungen des Fahrplanes aufgrund des
Subventionsvertrages zustimmen musste und als Preis dafür die Einbeziehung
DeutschSüdwestafrikas in das Liniennetz wollte.
Künftig sollte die DOAL also alle sechs Wochen abwechselnd Lüderitzbucht und
Swakopmund anlaufen, was eine Einigung oder einen Konkurrenzkampf mit der
Woermannlinie, für die diese Häfen ureigenstes Fahrwasser waren, bedingte. ,,In An-
passung an die neue Lage schloß darum die Deutsche OstAfrikaLinie am 09. No-
vember 1907 einen Vertrag mit der WoermannLinie und der HamburgAmerika-
Linie, die wenige Monate zuvor eine Betriebsgemeinschaft eingegangen waren. In
32
diesem Vertrag verbanden sich die drei Reedereien zum Betrieb der Hauptlinie ge-
mäß den Bestimmungen des Subventionsvertrages.(10) Die beiden neuen Linien
lieferten drei Dampfer zum Betrieb der Hauptlinie, so dass die DOAL drei ihrer
Dampfer zurückziehen und zum Betrieb der Bombaylinie abstellen konnte. Schon im
März 1908 wurde die am 09.11.1907 getroffene Vereinbarung erweitert durch den
Beitritt der Hamburg Bremer Afrika Linie, eines Zweigbetriebes des Norddeutschen
Lloyd, der ebenfalls den Betriebsgemeinschaftsvertrag unterzeichnete. 1909 endlich
wurde aus der Betriebsgemeinschaft ein Bündnis aller grossen Reedereien Ham-
burgs und Bremens, es kam zur Gründung der ,,ReedereienVereinigung G.m.b.H."
(11)
Aber es gab ja nicht nur die Konkurrenz innerhalb der Reedereien des deutschen
Reiches, auch ausländische Reedereien liefen von Europa aus Häfen in Ostafrika
an, betrieben Linienverkehr im indischen Ozean und erreichten Zanzibar, von wo aus
Waren im altvertrauten Dhauverkehr an die Deutsch Ostafrikanischen Häfen geliefert
werden konnten und zwar zu sehr günstigen Preisen. (12) Die italienischen, briti-
schen und französischen Linien hatten ähnliche Verbindungsaufgaben (Mutter-
land/Kolonie) wie die DOAL und waren deshalb entweder gar nicht oder nur sehr
schwer aus dem Wettbewerb zu drängen. Auf der Suche nach Alternativen konnte
man auf Erfahrungen zurückgreifen, die nur wenig früher, um 1875, an der indischen
Küste gemacht wurden, als man die sogenannte Konferenz für den Teehandel resp.
transport GroßbritannienCalcutta entwickelte. (13)
Erste Absprachen zwischen der DOAL und der englischen Union Line fanden 1895
statt, mit dem Resultat, dass die Union Line Zanzibar als Anlaufhafen aufgab. (14)
Aber erst nach 1900 war der Konkurrenzkampf der vielen Linien so gross geworden,
dass sich die Konferenzlösung, d.h. eine Art Kartell, als einfachste und ökonomisch
effektivste Lösung zunehmend durchsetzte. Das hiess nun nicht, dass Konkurrenz-
kämpfe ausblieben und sich alles im Gespräch und per Vereinbarung lösen liess,
eher das Gegenteil ist richtig. Auch waren nicht alle Linien gleichzeitig an ein und
derselben Konferenz beteiligt. Anhand der Angaben in einer Geschäftskorrespon-
33
denz die nur marginal an solchen Absprachen beteiligt war, ist es schwer festzustel-
len, wie lange solche Konferenzen hielten, da ja kein Grund besteht, sie zu erwäh-
nen, solange die Sache gut läuft, aber die Anzahl solcher Erwähnungen deutet dar-
auf hin, dass sie häufig gebrochen wurden. Dennoch schienen sie wohl allen Linien
nötig zu sein, wurden sie doch immer wieder erneut eingegangen oder modifiziert.
Der überwiegende Typ der Konferenz in der Ostafrikafahrt war das Frachtratenab-
kommen, eine Art Preiskartell oder Preisbindung. (15) Dagegen gibt es nur relativ
wenig Abkommen, die die Fahrtgebiete einzelner Linien regeln, wenngleich das erste
Abkommen von 1895 auch ein solches ist. (16)
Dem KonferenzSystem auf Dauer fernbleiben zu wollen oder es sogar aktiv zu be-
kämpfen, machte ökonomisch wenig Sinn, wer es versuchte, hatte automatisch einen
Kampf ,,einer gegen alle" zu erwarten, schlimmstenfalls einen Angriff der Konferenz
auf die Haupteinnahmequelle der eigenen Linie. Das passierte zwischen 1890 und
1914 zweimal. Der eine Fall betraf den österreichischen Lloyd; Österreich hatte kei-
nen Kolonialbesitz in Afrika, wohl jedoch ökonomische Interessen. Als Industrieland
war die K.u.K. Monarchie auf Rohstoffimporte angewiesen und ihre Industrie auf Ex-
port, speziell von Emaillewaren, Fezen, Perlen und ähnlichem. Entsprechend groß
war der Druck industrieller Kreise auf den österreichischen Lloyd, eine Linie nach
Ostafrika zu unterhalten, obwohl die wirtschaftlichen Ergebnisse diesen keineswegs
dazu ermutigten. (17)
Als dann die Anstrengungen des österreichischen Lloyd, in Ostafrika einen Linien-
dienst zu unterhalten, zu Frachtkämpfen führten, griff die DOAL auf der Route Triest-
Ostindien mit eigenen Schiffen und extrem niedrigen Frachtraten (Dumping) an. Da
diese Route das Hauptgeschäft des österreichischen Lloyd war, hatte er kaum eine
Wahl: die Konferenz, mit der ,,Speerspitze" DOAL, konnte auf der Hauptroute des
Lloyd für eine empfindliche bis geschäftsbedrohende Konkurrenz sorgen und das
längere Zeit hindurch, während die Ostafrikaroute ein eher ,,ungeliebtes" Kind war.
Der Ostafrikadienst des österreichischen Lloyd wurde aufgegeben. (18)
34
Der zweite Fall lag etwas anders, weshalb er vielleicht auch der bekanntere ist. (19)
Es handelte sich um einen Konkurrenzkampf der Konferenz gegen die sogenannte
MogulLine, eine rein indische Schiffslinie, die vom indischen Subkontinent, d.h. von
der britischen Kronkolonie Indien aus operierte. Als rein indische Linie war es ihr
möglich, an die ethnischen Zusammenhänge zu erinnern, sie rief zum Boykott der
europäischen Linien und damit verbunden zur ausschließlichen Benutzung der einzi-
gen indischen Linie, also ihr, auf. (20) Da viele Inder sich an den Boykott hielten und
es schien, als ob dies auch längere Zeit so bleiben würde, gerieten die europäischen
Linien, speziell im Bombayverkehr, in Bedrängnis. Aber das Hauptgeschäft der Mo-
gulLine war der Transport von muslimischen Pilgern von Indien nach Mekka und
deshalb gab die Linie schnell nach, als die DOAL einen ihrer Dampfer, die ,,Mark-
graf", aus der Bombayschifffahrt holte, um ihn auf der Pilgerroute zu Dumpingprei-
sen einzusetzen.
Dass es bei den Konkurrenzkämpfen, bei denen es zu solchen Maßnahmen wie dem
Einsatz von Konferenzschiffen auf gegnerischen Hauptrouten kam, jedesmal die
DOAL war, die den Dampfer stellte, erklärt sich wohl daraus, dass die DOAL die ein-
zige Reederei war, deren Hauptgeschäft in der Ostafrikafahrt lag. Dementsprechend
war natürlich ein Angriff auf das sorgfältig ausbalancierte Tarif- und Routengefüge in
der Ostafrikafahrt ein Angriff auf das Hauptgeschäft der DOAL und somit ein Grund
für die Reederei, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zurückzuschlagen.
Das Verhältnis der Firma O`Swald zur Linienschiffsreederei allgemein und der DOAL
insbesondere war sehr vielschichtig. Schon vor der Gründung der DOAL hatte die
Firma erste Erfahrungen mit Linienschiffen gemacht, so kamen z. B. gegen 1878 in
,,günstigen Momenten" auch Verladungen ,,per Mail" vor, also auf Linienschiffen. (21)
Allerdings waren die ersten Erfahrungen der Firma mit der Mail-Verbindung nicht un-
bedingt positiv, die Versendungen mit der französischen Linie beispielsweise ergab
derart beschädigte Waren, dass die Firma auf weitere derartige Geschäfte verzichte-
te, denn auch billigste Frachtraten sind immer noch zu teuer, wenn die Ware am En-
de vom Kunden nicht abgenommen wird. (22) Ähnliches passierte bei Linien, die in
35
Aden oder Bombay umluden, wobei die Waren teilweise vergessen wurden oder in
schlechtem Zustand ankamen und der Firma O`Swald dadurch ein Schaden ent-
stand, den auch billige Frachtraten nicht deckten. (23) Probleme mit der Verladung
von Produkten (in Afrika aufgekaufte, nach Europa zu transportierende Rohstoffe)
wie z.B. hohe Gewichtsverluste durch Verdunstung, Stauprobleme geruchsempfindli-
cher Produkte, Schimmel u. ä. sind bei allen Linienschiffen dann und wann vorge-
kommen und werden besser im Zusammenhang mit dem entsprechenden Kapitel
dieser Arbeit behandelt. (24)
Alle diese Erfahrungen waren mit Gründung und Betriebsaufnahme der DOAL nicht
überwunden und die DOAL war auch nicht die optimale Lösung, aber die verstärkte
Konkurrenz, die gerade auch durch die Mailverbindungen erst entstand, zwang Firma
O`Swald zur weiteren Nutzung von Linien und es gab von Anfang an einige Vorteile,
die für die DOAL sprachen. Die Vorabveröffentlichung der DOALTarife ließ sie zwar
für Artikel aus deutschen Häfen (Hamburg vor allem) unattraktiv sein, aber die Raten
für die Waren aus Rotterdam waren einen Versuch wert. Offenbar bewegte sich aber
noch einiges bis zur tatsächlichen Aufnahme des Liniendienstes, denn im November
1890 bestimmte das Stammhaus der Firma O`Swald, dass alle deutschen, schwei-
zer, österreichischen und holländischen Waren per deutscher Linie, also DOAL, von
resp. via Hamburg nach Zanzibar gehen sollten, andere Linien sollten nur noch ,,im
Notfall" benutzt werden. (25)
Für die Kunden der Firma brachte das allerdings einige Probleme und ihre Be-
schwerden wurden von der Faktorei Zanzibar an das Stammhaus weitergeleitet. So
zögen die Kunden es vor, lieber öfter etwas zu bekommen, statt einer größeren
Menge bei Ankunft jedes DOALDampfers, die Barzahler unter ihnen beklagten sich
über die analog zu großen Mengen anfallenden großen Summen, die sie auf einen
Schlag zu zahlen hätten und allgemein würden durch die plötzlich angelandeten gro-
ßen Mengen Überangebote erzeugt, die die Verkaufspreise senkten. (26) Ähnliches
galt aber sicher auch für die Verwendung eines eigenen Firmenschiffes, wie es die
,,Zanzibar" der Firma O`Swald darstellte, also wird die Klage von der Firma kaum
36
sehr ernst genommen worden sein, obwohl sie einige Probleme, die mit der Verwen-
dung von ,,Mailsteamern" auftraten andeutete. Mit den Linienschiffen war allen Fir-
men die gleiche Ausgangssituation eingeräumt, um ihre Waren nach Afrika zu trans-
portieren und ihre gesammelten bzw. aufgekauften Produkte von dort auszuführen.
Das bedeutete nicht nur, dass nun nach Ankunft eines Dampfers örtliche Waren-
überangebote herrschten, sondern auch, dass die Produktpreise vor Ankunft des
Dampfers in die Höhe gingen, da natürlich alle Kaufleute den von ihnen gebuchten
Frachtraum auch ausnutzen wollten. Zusätzlich konnten nun auch kleine Handelsfir-
men ohne eigene Reederei ihre Geschäfte in Ostafrika machen und für Produkte
längerfristige Handelsverträge abschließen, d.h. einen Industriebetrieb längerfristig
mit Rohstoffen versorgen, was vorher, ohne eigenes Schiff, unmöglich war.
Die Kundschaft der Firma O`Swald reagierte, außer mit Klagen, auch mit einer Um-
stellung ihrer Konsumgewohnheiten resp. ihres Verkaufsgebarens: ,,Bei den vielen
Dampfergelegenheiten jetzt wird es immer schwieriger Ladung resp. Frachtgüter zu
finden, auch ziehen viele Ordergeber es vor, anstatt wie früher große Quantitäten
Waren (wie Getränke, Seife, Steinzeug usw.) auf einmal mit unserem Dampfer anzu-
bringen, sich mit dem Postdampfer monatlich kleine Quantitäten Waren kommen zu
lassen." (27)
Ein derartiges Verhalten bedeutet mehr Arbeit für O`Swald`s Leute vor Ort, die jeden
Auftrag bearbeiten mussten. Neben der Chance, so mehr Versuche zu starten, weni-
ger Quantität bedeutete auch weniger finanzielles Risiko bei Einführung neuer Waren
oder bei Änderungen der Lieferfirmen eingeführter Waren, gab es einen erheblichen
neuen Kostenfaktor, den der Frachtkosten. Hier hatte die Firma O`Swald zwei Vortei-
le, die sie gegenüber der DOAL in Verhandlungen ausspielte: Erstens hatte sie im-
mer noch selber einen, wenn auch begrenzten, Reedereibetrieb und zweitens gehör-
te sie zu den grössten Firmen in Ostafrika, also auch zu den größten Warenempfän-
gern bzw. Produktversendern. Das sicherte der Firma eine gute Ausgangsposition in
Verhandlungen um Frachtratenverminderungen resp. Mengenrabatte. Mit Rücksicht
auf die öffentliche Meinung (die DOAL war eine subventionierte Reederei) und die
37
Konkurrenz, hielt man solche Rabatte möglichst geheim, doch konnten die Faktorei-
en in Ostafrika anhand der Auf- und Verkaufspreise ihrer jeweiligen Konkurrenten
Rückschlüsse auf deren Transportkosten ziehen und auch Außenstehende, wie etwa
die deutschen Pflanzer, die auf die Verbindung per DOAL angewiesen waren, hatten
genug Sachkenntnis, um Rabatte zumindest als sicher anzunehmen. (28) Dieselben
konnten recht beträchtlich werden, so gewährte die DOAL 1892 sowohl der Firma
O`Swald wie auch deren Konkurrenten, die ja teilweise im Vorstand der Linie saßen,
wie z. B. Firma Hansing und schon deshalb schlecht auszuschließen waren, 50%
Rabatt vom ,,gedruckten Preis." (29) Solche Angebote waren von seiten der Linie
immer befristet, weshalb dann auch, von Zeit und Zeit, nachverhandelt werden muss-
te, wobei Firma O`Swald´s Stellung sich eher verbesserte, hing sie doch mit wahrer
,,Nibelungentreue" an der Linie, verpflichtete diese aber auch, ihre Waren und Pro-
dukte unbedingt, auch bei Transportraumknappheit, mitzunehmen und schuf sich so
eine sichere Transportmöglichkeit. (30) Teilweise hatten die Angebote der Linie auch
mit deren Kooperationspolitik zu tun, sie musste die mit anderen Schiffslinien be-
schlossenen Frachtsätze durchsetzen, allerdings waren einige Handelsfirmen mit der
DOAL direkt per Aufsichtsratsmandat, Agenturvertretung in Ostafrika u.ä. verbunden
und ausländische Konkurrenten genossen die Bevorzugungen durch ihre nationalen
Linie. Somit war immer wieder Anlass gegeben, mit der DOAL über Geheimrabatte
und Sonderkonditionen zu verhandeln, um eventuelle Benachteiligungen durch Kon-
kurrenzfirmen und ,,deren" Schiffslinien zu vermeiden. Das war nicht nur einmal er-
folgreich für Firma O`Swald. (31) Speziell im Produktenhandel, also einem Geschäft,
in dem alle größeren Händler in Ostafrika arbeiteten, insgesamt aber nur eine be-
grenzte Menge Abnehmer wie Industriebetriebe und/oder Auktionsplätze standardi-
sierte, nach Qualitäten geordnete Rohstoffe ankauften, war der einzelne Händler auf
jede Möglichkeit angewiesen, Geld zu sparen. Das eingesparte Geld konnte dann in
höhere Ankaufspreise investiert und die Konkurrenz so aus dem Markt gedrängt
werden. So konnte man dann auch seine eigenen Lieferverträge erfüllen oder als
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832491932
- ISBN (Paperback)
- 9783838691930
- DOI
- 10.3239/9783832491932
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Philosophie und Geschichtswissenschaft, Historisches Seminar
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Dezember)
- Note
- 3,0
- Schlagworte
- kolonialgeschichte firmengeschichte revolution welthandel imperialismus
- Produktsicherheit
- Diplom.de