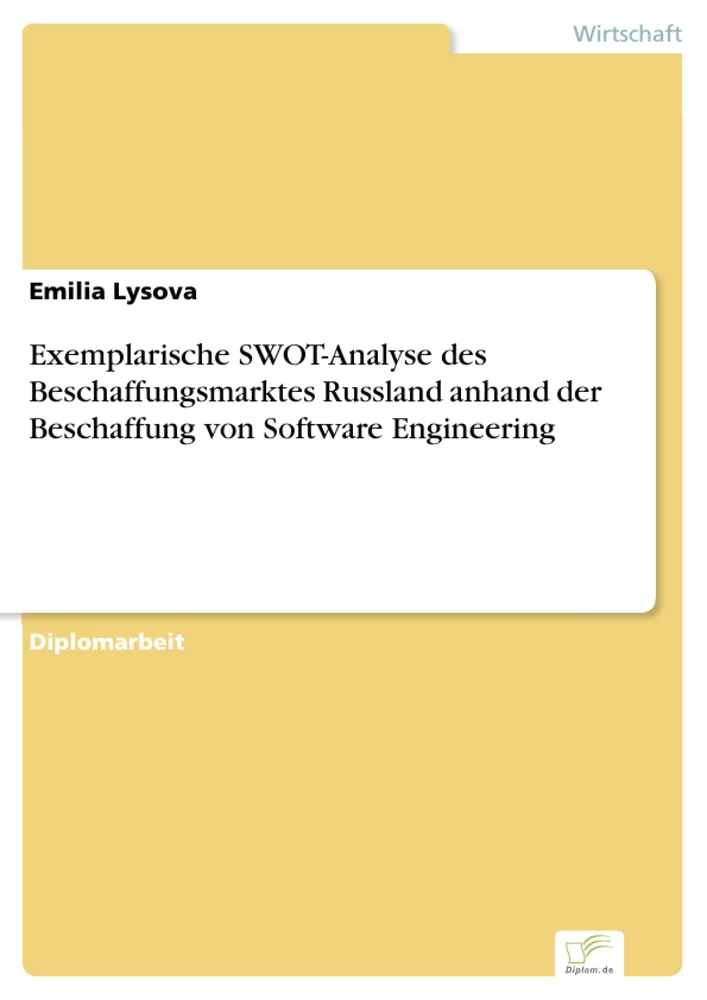Exemplarische SWOT-Analyse des Beschaffungsmarktes Russland anhand der Beschaffung von Software Engineering
©2004
Diplomarbeit
98 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In Deutschland nimmt der Kostendruck auf die IT-Leistungen erheblich zu, andererseits liegen die Personalkosten weit über dem weltweiten Durchschnitt. Gleichzeitig können manche Anforderungen an bestimmte Qualifikationen gar nicht mehr allein lokal gedeckt werden. Neben der Produktion und dem Marketing gewinnen nun andere Bereiche, unter anderem das internationale Beschaffungsmanagement an Bedeutung. In dieser Situation werden immer mehr Unternehmen die Möglichkeiten der Beschaffung der unterschiedlichen IT-Produkte in Niedriglohnländern (z.B. Russland) wahrnehmen.
Seit Beginn der 90er Jahre entwickeln sich in der Russischen Föderation Tausende kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Preisvorteile gegenüber westlichen Informatikern begünstigen die Entwicklung der Ost-West-Kooperationen, wobei es nicht unbedingt eine Minderung der Qualität bedeutet. Wer frühzeitig diese Chancen erkennt und nutzt, kann erfolgreich expandieren. Russland als Lieferant von hochwertigen Softwareprodukten ist heutzutage immer noch ein Geheimtipp.
Diese Diplomarbeit zielt auf die Bestimmung und Bewertung des Potentials des Landes Russland als eine Grundlage für Beschaffungs- und Kooperationsentscheidungen deutscher Unternehmen und Organisationen. Russland wirkt immer noch instabil und macht einen sehr großen Umstrukturierungsprozess durch. Niedrige Produktivität, wirtschaftliche Instabilität, mangelnde Termintreue, langsame Reformen, Kriminalität und Korruption, sowie Rechtsunsicherheit können im Einzelfall die Kostenvorteile aufwiegen.
Außerdem ist die Beschaffung von Marktinformationen ungleich schwieriger als in nahezu allen anderen Märkten. Somit stellt sich natürlich die Frage, inwieweit hier die Risiken oder die Chancen überwiegen. Dafür wird eine SWOT-Analyse des Beschaffungsmarktes durchgeführt.
Die SWOT-Analyse umfasst eine Chancen-Risiko-Analyse (Opportunities-Threats) des Marktes und eine Stärken-Schwächen-Analyse (Strength-Weakness) des Unternehmens. Die Chancen und Risiken werden den Stärken und Schwächen gegenübergestellt. Für die Strategiefestsetzung sind Chancen und Stärken zu nutzen, Risiken und Schwächen aber zu minimieren bzw. zu unterdrücken.
Mit der Arbeit wird versucht nicht nur dem offensichtlichen Informationsbedarf im Westen entgegenzukommen, sondern auch eventuell existierende Vorurteile kritisch zu beleuchten und positive sowie negative Aspekte des […]
In Deutschland nimmt der Kostendruck auf die IT-Leistungen erheblich zu, andererseits liegen die Personalkosten weit über dem weltweiten Durchschnitt. Gleichzeitig können manche Anforderungen an bestimmte Qualifikationen gar nicht mehr allein lokal gedeckt werden. Neben der Produktion und dem Marketing gewinnen nun andere Bereiche, unter anderem das internationale Beschaffungsmanagement an Bedeutung. In dieser Situation werden immer mehr Unternehmen die Möglichkeiten der Beschaffung der unterschiedlichen IT-Produkte in Niedriglohnländern (z.B. Russland) wahrnehmen.
Seit Beginn der 90er Jahre entwickeln sich in der Russischen Föderation Tausende kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Preisvorteile gegenüber westlichen Informatikern begünstigen die Entwicklung der Ost-West-Kooperationen, wobei es nicht unbedingt eine Minderung der Qualität bedeutet. Wer frühzeitig diese Chancen erkennt und nutzt, kann erfolgreich expandieren. Russland als Lieferant von hochwertigen Softwareprodukten ist heutzutage immer noch ein Geheimtipp.
Diese Diplomarbeit zielt auf die Bestimmung und Bewertung des Potentials des Landes Russland als eine Grundlage für Beschaffungs- und Kooperationsentscheidungen deutscher Unternehmen und Organisationen. Russland wirkt immer noch instabil und macht einen sehr großen Umstrukturierungsprozess durch. Niedrige Produktivität, wirtschaftliche Instabilität, mangelnde Termintreue, langsame Reformen, Kriminalität und Korruption, sowie Rechtsunsicherheit können im Einzelfall die Kostenvorteile aufwiegen.
Außerdem ist die Beschaffung von Marktinformationen ungleich schwieriger als in nahezu allen anderen Märkten. Somit stellt sich natürlich die Frage, inwieweit hier die Risiken oder die Chancen überwiegen. Dafür wird eine SWOT-Analyse des Beschaffungsmarktes durchgeführt.
Die SWOT-Analyse umfasst eine Chancen-Risiko-Analyse (Opportunities-Threats) des Marktes und eine Stärken-Schwächen-Analyse (Strength-Weakness) des Unternehmens. Die Chancen und Risiken werden den Stärken und Schwächen gegenübergestellt. Für die Strategiefestsetzung sind Chancen und Stärken zu nutzen, Risiken und Schwächen aber zu minimieren bzw. zu unterdrücken.
Mit der Arbeit wird versucht nicht nur dem offensichtlichen Informationsbedarf im Westen entgegenzukommen, sondern auch eventuell existierende Vorurteile kritisch zu beleuchten und positive sowie negative Aspekte des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9189
Lysova, Emilia: Exemplarische SWOT-
Analyse des Beschaffungsmarktes Russland anhand der Beschaffung von Software
Engineering
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Universität zu Köln, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis... II
Gliederung ...III
Verzeichnis der Abbildungen für den Text ...IV
Verzeichnis der Tabellen für den Text... V
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen ...VI
Haupttext ...1-64
Literaturverzeichnis ... VIII
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
für den Anhang...XXII
Anhang... XXIII
Eidesstattliche Versicherung ... XXXI
Lebenslauf...XXXII
III
Gliederung
1. Einleitung... 1
2. SWOT-Analyse und Internationale Beschaffung... 3
2.1. Motive für die Internationale Beschaffung... 3
2.2. SWOT-Analyse als Beschaffungsmarktanalyse... 6
2.2.1. Terminologie ... 6
2.2.2. Beschaffungsmarktspezifische Chancen-Risiken-Analyse... 8
2.2.3. Interne unternehmensspezifische Stärken-Schwächen-Analyse ... 13
2.3. Vor- und Nachteile der Anwendung einer SWOT-Analyse in der
Internationalen Beschaffung... 14
3. Russland als Beschaffungsmarkt des Software Engineering ... 16
3.1. Externe Analyse... 16
3.1.1. Analyse der Umfeld- und allgemeinen Rahmenbedingungen... 16
3.1.1.1. Natürlich-geographische Umwelt ... 16
3.1.1.2. Politisch-rechtliche Umwelt ... 18
3.1.1.3. Makroökonomische Umwelt ... 24
3.1.1.4. Soziokulturelle Umwelt ... 30
3.1.1.5. Technologische Umwelt ... 33
3.1.1.6. Marktbesonderheiten ... 35
3.1.2. Analyse der aufgabenspezifisch relevanten Kriterien ... 37
3.1.2.1. Software Engineering in Russland Marktüberblick ... 37
3.1.2.2. Chancen der russischen Softwareindustrie... 43
3.1.2.3. Probleme der Branche... 51
3.2. Interne Stärken- und Schwächenanalyse der Deutschen
Unternehmen... 57
4. Zusammenfassung und Ausblick ... 62
IV
Verzeichnis der Abbildungen für den Text
Abb. 1: Dynamik der Russischen Softwareexporte
40
Abb. 2: Kundenherkunft der russischen Software
Engineering
41
Abb. 3: Technisches Humankapitalpotential in
Russland
45
Abb. 4: Geplante Zertifizierungen russischer
Softwareanbieter
48
Abb. 5: Risiken, die deutsche Unternehmen bei den
osteuropäischen IT-Anbietern sehen
56
V
Verzeichnis der Tabellen für den Text
Tab. 1: Umweltinformationen
16
Tab. 2: Entscheidungssituationsabhängige
Makrokriterien
12
Tab. 3: Ausgewählte Wirtschaftsindikatoren
2001-2005
26
VI
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Abb.
Abbildung
Amcham
American Chamber of Commerce in Russia
Anm.
Anmerkung
APKIT
Information&Computer
Technologies Industry Association
Aufl.
Auflage
BA
Beschaffung Aktuell
BERI
Business Environment Risk Index
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BITKOM
Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V.
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CMM
Capability Maturity Model
CPI
Corruption Perception Index
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
d.h.
das heißt
Diss.
Dissertation
OECD
Organisation for Economic
Cooperation and Development
evtl.
eventuell
f.
folgende (Seite)
FATF
Financial Action Task Force
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Fort-Ross
Information Technology Services
ff.
fortfolgende
H.
Heft
HB
Handelsblatt
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg.
Herausgeber
Jg.
Jahrgang
VII
IuK
Informations- und Kommunikationstechnologie
IT
Informationstechnologie
KPRF
Kommunistische Partei der RF
LETI
Leningrader Elektrotechnisches Institut
LITMO
Leningrader Institut für Feinmechanik und Optik
MechMath
Mechanisch-Mathematische Fakultät
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
Nr.
Nummer
o. J.
ohne Jahresangabe
o. O.
ohne Ortsangabe
o. V.
ohne Verfasser
RF
Russische Föderation
RTSI
Russian Trade System Index
Russoft
National Software Developers Association
RZB
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
S.
Seite
SD
Software Development
SW
Software
SWOT
Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats
u. a.
unter anderem
UdSSR
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
UNDP
Unided Nations Development Programme
UVI
Unternehmensverband Informationssysteme e.V.
usw.
und so weiter
VdW
Verband der Deutschen Wirtschaft in der RF
Verf.
Verfasser
Vgl.
vergleiche
WTO
World Trade Organization
- 1 -
1. Einleitung
Die Softwareindustrie ist die Wachstumsindustrie des 21.
Jahrhunderts, und ihre Produkte Software und Programmier-
dienstleistungen - haben sich als die Schlüsseltechnologien
etabliert. Software ist notwendiger Bestandteil moderner
Maschinen, Grundlage einer effizienten, computergestützten
Verwaltung, und sie steuert sowohl Atomkraftwerke als auch
Kinderspielzeug. Die rasante Entwicklung der Software-
Technologien in Europa hat zu einem großen Mangel an
qualifizierten IT-Spezialisten geführt.
1
Der Wettbewerb hat
sich in den letzten Jahren auch drastisch verschärft. Jedes
Unternehmen
ist
einem
steigendem
Leistungs-
und
Kostendruck
ausgesetzt.
Zur
Sicherung
der
Unternehmensexistenz
sind
die
Möglichkeiten
zur
Absatzsteigerung begrenzt.
2
In Deutschland nimmt der
Kostendruck auf die IT-Leistungen erheblich zu, andererseits
liegen die Personalkosten weit über dem weltweiten
Durchschnitt. Gleichzeitig können manche Anforderungen an
bestimmte Qualifikationen gar nicht mehr allein lokal gedeckt
werden. Neben der Produktion und dem Marketing gewinnen
nun andere Bereiche, unter anderem das internationale
Beschaffungsmanagement an Bedeutung. In dieser Situation
werden immer mehr Unternehmen die Möglichkeiten der
Beschaffung
der
unterschiedlichen
IT-Produkte
in
Niedriglohnländern (z.B. Russland) wahrnehmen. Es zeigt
sich, dass bei den Stundensätzen des SW-Engineerings nahezu
1
Vgl. Stiermann, K./Dietz, U. (Global Sourcing von Software
Engineering 2003), S. 40
2
Vgl. Westermann, H. (Beschaffungkooperation als Mittel
zur Stärkung der Marktposition 1999), S. 32
- 2 -
60 % Einsparungen durch Einsatz von Niedriglohnlieferanten
im Vergleich mit lokalen Lieferanten möglich sind.
3
Seit Beginn der 90er Jahre entwickeln sich in der Russischen
Föderation
Tausende
kleine
und
mittelständische
Unternehmen
im
Bereich
der
Informations-
und
Kommunikationstechnologie.
Preisvorteile
gegenüber
westlichen Informatikern begünstigen die Entwicklung der
Ost-West-Kooperationen, wobei es nicht unbedingt eine
Minderung der Qualität bedeutet. Wer frühzeitig diese
Chancen erkennt und nutzt, kann erfolgreich expandieren.
4
Russland als Lieferant von hochwertigen Softwareprodukten
ist heutzutage immer noch ein Geheimtipp
.5
Zwar beziehen Großkonzerne wie DaimlerChristler, Debis,
Siemens oder SAP schon seit vielen Jahren Software als
Zulieferteile für ihre Produkte aus Russland, doch im
weltweiten Maßstab beträgt der Anteil der deutschen Firmen
an dem wachsenden Software-Zuliefergeschäft der russischen
IT-Industrie gerade einmal 13 %.
6
Diese Diplomarbeit zielt auf die Bestimmung und Bewertung
des Potentials des Landes Russland als eine Grundlage für
Beschaffungs- und Kooperationsentscheidungen deutscher
Unternehmen und Organisationen. Russland wirkt immer
noch
instabil
und
macht
einen
sehr
großen
Umstrukturierungsprozess durch. Niedrige Produktivität,
wirtschaftliche Instabilität, mangelnde Termintreue, langsame
Reformen,
Kriminalität
und
Korruption
7
sowie
Rechtsunsicherheit können im Einzelfall die Kostenvorteile
aufwiegen.
Außerdem
ist
die
Beschaffung
von
3
Vgl. Stiermann, K./Dietz, U. (Global Sourcing von Software
Engineering 2003), S. 40
4
Vgl. Westermann, H. (Beschaffungkooperation als Mittel
zur Stärkung der Marktposition 1999), S. 32
5
Vgl. Höfling, J. (http:// www01.sillicon.de/cpo/hgr-wipo
/detail.php?nr =11713&directory=hgr-wipo 2003) am
05.12.03
6
Vgl. ebenda
7
Vgl. Schröder, H./Höhmann, H. (Russland unter neuer
Führung 2001), S. 133
- 3 -
Marktinformationen ungleich schwieriger als in nahezu allen
anderen Märkten. Somit stellt sich natürlich die Frage,
inwieweit hier die Risiken oder die Chancen überwiegen.
Dafür wird eine SWOT-Analyse des Beschaffungsmarktes
durchgeführt. Die SWOT-Analyse umfasst eine Chancen-
Risiko-Analyse (Opportunities-Threats) des Marktes und eine
Stärken-Schwächen-Analyse
(Strength-Weakness)
des
Unternehmens. Die Chancen und Risiken werden den Stärken
und
Schwächen
gegenübergestellt.
Für
die
Strategiefestsetzung sind Chancen und Stärken zu nutzen,
Risiken und Schwächen aber zu minimieren bzw. zu
unterdrücken. Mit der Arbeit wird versucht nicht nur dem
offensichtlichen
Informationsbedarf
im
Westen
entgegenzukommen, sondern auch eventuell existierende
Vorurteile kritisch zu beleuchten und positive sowie negative
Aspekte des Austausches mit Russland herauszuarbeiten.
Dabei werden neben juristischen, wirtschaftspolitischen,
organisations-technischen
auch
kulturelle
oder
mentalitätsbezogene Aspekte mitberücksichtigt.
2. SWOT-Analyse und Internationale
Beschaffung
2.1. Motive für die Internationale Beschaffung
In
der
betriebswirtschaftlichen
Literatur
wird
die
internationale Beschaffung durch zweifaches Überschreiten
der (System-) Grenze gekennzeichnet: die Grenze des
Systems Unternehmung und die Grenze von zwei oder
mehreren Ländern.
8
Die meisten Autoren begrenzen sich
8 Vgl. Gruschewitz, A. (Gobal Sourcing-Konzeption einer
inter-nationalen Beschaffungsstrategie 1993), S. 36; Mair,
F. (Strategische Global Sourcing 1995), S. 161; Schröder,
- 4 -
jedoch auf den ländergrenzüberschreitenden Charakter,
9
denn
es ist problematisch, die internationale Beschaffung von der
internationalen Fertigung abzugrenzen.
10
Im Rahmen des
Internationalen Einkaufs obliegt es der Beschaffung, zur
Erreichung strategischer Ziele im Sinne einer langfristigen
Sicherung des Unternehmenserfolges und der Schaffung von
Wettbewerbsvorteilen einen Betrag zu leisten.
11
Zu diesem
Zwecke ist von ausländischen Ressourcen ein effizienter
Gebrauch
zu
machen.
12
Der
Ausbau
der
Beschaffungsaktivitäten von Unternehmen kann mit den
verschiedensten Motiven verbunden sein.
13
Das häufigste genannte Motiv ist die Möglichkeit eines
preisgünstigeren Bezugs als auf Europäischen Märkten. Der
Grund dafür sind die niedrigen Arbeitskosten. Denn bekannte
deutsche
Wettbewerbsvorteile
wie
Zuverlässigkeit,
Flexibilität oder die gute Infrastruktur können die Nachteile
bei den Fertigungskosten oft nicht mehr aufwiegen.
14
Um im
Wettbewerb bestehen zu können, müssen die deutschen
Unternehmen Kostensenkungsmaßnahmen ergreifen.
Im Rahmen strategischer Beschaffungsentscheidungen wird
der Bezugspreis nicht einziges Kriterium sein. Vielmehr
interessieren
Möglichkeiten
einer
technologischen
Zusammenarbeit über europäische Grenzen hinweg sowie das
in starkem Maße durch den Technologiestandard der
M.
(Internationales
Beschaffungsmarketing
der
Industrieunternehmung 1993), S. 36 f
9
Vgl. Arnold, H. (Materialwirtschaft und Einkauf 1996), S.
24; Bedacht, F. (Global Sourcing 1995), S. 13; Menze, T.
(Strategisches
internationales
Beschaffungsmarketing
1993), S. 170
10
Vgl. Arnold, U (Global Sourcing 1990), S. 55
11
Vgl. Arnold, U. (Global Sourcing 1990), S. 55 ff.
12
Vgl. Fagan, M.L. (Global Sourcing 1991), S. 21
13
Anm. d. Verf.: Für eine ausführliche Darstellung
internationaler Beschaffungsmotive vgl. Piontek, J.
(Global Sourcing 1997), S. 27 ff.
14
Vgl. Little, A.D. (Management der Lernprozesse 1995), S.
104
- 5 -
Zulieferer determinierte Qualitätsniveau der zu beschaffenden
Objekte.
15
Als
wichtiges
Motiv
sind
die
Verbesserung
der
Produktqualität
der
Beschaffungsobjekte
und
die
Vergrößerung der Kongruenz der eigenen Produkte mit den
Ansprüchen der Abnehmer zu nennen.
16
Die Qualität der
Waren eines Zulieferers wird durch dessen Technologiestand
sowie durch seine persönliche Einstellung und die seiner
Mitarbeiter bestimmt. Dabei sind die Qualitätsunterschiede
sowohl auf objektiv als auch auf subjektiv bedingte Ursachen
zurückzuführen.
17
.
Die Personalressourcen des Beschaffungsmarktes können
eine entscheidende Rolle für Internationale Beschaffung
spielen.
18
Es können manche Anforderungen an bestimmte
Qualifikationen gar nicht allein lokal gedeckt werden.
19
Als weiteres Motiv ist die geographische und kulturelle Nähe
zu dem Lieferantenland zu nennen. Wichtig könnte auch die
Möglichkeit
der
Zeitersparnis
sein.
Durch
die
Zeitverschiebung zwischen Auftraggeber und Ausführendem
(z.B. +10,5 h zwischen den USA und Deutschland) wird ein
Arbeitstag von 24 h möglich.
Ein wichtiger Anreiz im Ausland zu beschaffen ist die
strategische
Überlegung,
die
bei
der
Beschaffung
gesammelten Erfahrungen dafür zu nutzen, zu einem späteren
Zeitpunkt diesen Absatzmarkt zu erschließen.
Gelegentlich wird als Grund für eine internationale
Beschaffung
die
Intensivierung
des
europäischen
15
Anm. d. Verf.: Es darf jedoch nicht von einem generellen
techno-logischen Know-how-Transfer vom ausländischen
Zulieferer zum Hersteller ausgegangen werden. Vielmehr
kann dieser Know-how-Transfer durchaus auch in
umgekehrte Richtung verlaufen, vgl. Arnold, U (Global
Sourcing 1990), S. 40
16
Vgl. Piontek, J. (Global Sourcing 1997), S. 32
17
Vgl. Westermann, H. (Gewinnorientierter Einkauf 1982), S.
128
18
Vgl. Piontek, J. (Global Sourcing 1997), S. 32
19
Vgl. Stierman, K. ( Global Sourcing von Software
Engineering 2003), S. 40
- 6 -
Wettbewerbs
angeführt.
20
Preisgünstigere
Angebote
ausländischer
Zulieferer
jedoch als Druckmittel auf
europäische Lieferanten zu benutzen, widerspricht der
strategischen Komponente der Internationalen Beschaffung
im Sinne einer langfristig anzustrebenden Zusammenarbeit
der Vertragspartner. Diese Überlegung ist somit als bewusst
in die Entscheidungsfindung einzubeziehender Parameter
abzulehnen.
21
Bei vielen Autoren werden die Sicherheitsmotive erwähnt
solche
wie Erhöhung der Versorgungssicherheit durch
Verbreitung
der
Lieferantenbasis,
Kompensation
von
Wechselkursschwankungen
oder
Verteilung
von
Standortrisiken (Streiks, politische Unruhen etc).
22
Welches Motiv jeweils im Vordergrund steht, ist von der
Konstellation der internen und externen Kontextfaktoren
abhängig. Im Zusammenhang mit den strategischen
Zielsetzungen der internationalen Beschaffung ist eine Reihe
von Zielkonflikten denkbar, auf deren Minimierung bei der
Ausgestaltung der Strategie zu achten ist. So können etwa die
Ziele untereinander oder mit den Basis-Zielen des
Unternehmens in einem konfliktären Verhältnis stehen.
23
2.2. SWOT-Analyse als Beschaffungsmarktanalyse
2.2.1. Terminologie
Die vermehrt strategische Ausrichtung der Planung in allen
Unternehmensbereichen erfordert den Einsatz einer Reihe
strategischer Analyse- und Planungsmethoden. Dabei werden
20
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 1995), S.
216
21
Vgl. Sauer, J.D. (Das Exportverahalten von Handwerk-
betrieben 1991), S. 30
22
Vgl. Bedacht, F. (Global Sourcing 1995), S. 51
23
Vgl. Koppelmann , U. (Beschaffungsmarketing 2000), S. 106
- 7 -
insbesondere SWOT-Analysen zunehmend als Grundlage der
Strategieformulierung in der Beschaffung eingesetzt.
24
Die
(externe) Umweltanalyse steckt durch Ermittlung der Chancen
und Risiken den Möglichkeitsraum der Strategieplanung ab.
Demgegenüber stellt eine (interne) Stärken/Schwächen-
Analyse fest, welche Aktivitäten im Rahmen der betrieblichen
Ressourcensituation für das Unternehmen sinnvoll sind. Mit
der SWOT-Analyse wird schließlich die Verbindung von
unternehmensinternen
und
externen
Faktoren
vorgenommen.
25
Chancen/Risiken-Analyse und Stärken/
Schwächen-Analyse werden regelmäßig parallel durchgeführt
und in ihren unternehmensindividuellen Zusammenhängen
dargestellt.
26
Der Begriff kommt aus dem Englischen und
setzt sich zusammen aus den Wörtern Strengths (Stärken),
Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und
Threats (Risiken). Die Aufgabe dieser Analyse ist es, das
Entscheidungsfeld im Strategieprozess einzuengen, indem
beispielsweise anschaulich gemacht wird, wo die Chancen
vielleicht die Ressourcen des Unternehmens überschreiten
oder mit dem Ressourcenprofil nicht vereinbar sind.
27
Für die
Strategiefestsetzung sind Chancen und Stärken zu nutzen,
Risiken und Schwächen aber zu minimieren bzw. zu
unterdrücken.
28
Während Stärken und Schwächen durch
Aktionen im eigenen Unternehmen beeinflusst werden
können, sind Unternehmen bei den Chancen und Risiken von
externen Faktoren getrieben, deren Beeinflussung nicht oder
nur bedingt möglich ist.
24
Vgl. Westermann, H. (SWOT-Analyse im Einkauf 1999),
S. 54
25
Vgl. Andrews, K.R. (The Concept of Corporate Strategy
1987), S.33
26
Vgl. Westermann, H. (SWOT-Analyse im Einkauf 1999), S. 54
27
Vgl. Boutellier, R./Wagner, S/Wehrli, H. (Beschaffung
2003), S. 108
28
Vgl. Andrews, K.R. (The Concept of Corporate Strategy
1987), S. 98
- 8 -
2.2.2. Beschaffungsmarktspezifische Chancen-
Risiken-Analyse
,,Die Umweltbedingungen der Beschaffungsmärkte gewinnen
durch die zunehmenden Internationalisierungstendenzen im
strategischen
Beschaffungsmarketing
an
Bedeutung."
29
Beschaffungskonstellationen sind Gegebenheiten, Zustände,
die das Beschaffungshandeln beeinflussen.
30
Erst die
detaillierten Kenntnisse der Beschaffungskonstellationen
erlauben, dass echte Chancen rechtzeitig genutzt und Risiken
durch Präventivmassnahmen vermindert oder gar in eine
Chance verwandelt werden können.
31
Unter einem Risiko
wird die Gefahr einer negativen Zielabweichung und unter
einer Chance die Möglichkeit einer positiven Zielabweichung
verstanden.
32
Die Umwelt umfasst im Fall der internationalen Beschaffung
zum einen das Land und zum anderen die einzelnen
Lieferanten. Um das Entscheidungsfeld abzugrenzen und
übersichtlich zu gestalten, können gleich am Anfang mit Hilfe
eines Negativ-Kataloges solche Länder ausgeschlossen
werden, die gewisse Kriterien nicht erfüllen.
33
Diese
Restriktionen werden vom Management situationsspezifisch
bestimmt und sind allgemeiner Natur. Die Bewertung des
Negativ-Katalogs sollte mit leicht und kostengünstig
beschaffbaren Informationen möglich sein.
34
Bei einer
solchen Vorgehensweise besteht jedoch die Gefahr, dass die
Unternehmung vorschnell und kurzsichtig interessante
29
Meissner, H. (Strategisches internationales Marketing
1995), S. 114
30
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000), S. 86
31
Vgl. Stahl, W. (Risiko- und Chancenanalyse im Marketing 1992), S. 32
32
Vgl. Braun, H. (Risikomanagement 1984), S. 27; Härterich,
S. (Risiko Management von industriellen Produktions-
risiken 1987), S. 18
33
Vgl. Schneider, D./Müller, R. (Datenbankgestützte Markt-
selektion 1989), S. 20
34
Vgl. ebenda, S. 24
- 9 -
Möglichkeiten auslässt. Wenn also Zweifel hinsichtlich der
Wirksamkeit der Restriktionen auftauchen, dürfte es
sinnvoller sein, ein
Land in die weitere Analyse
hineinzunehmen. Wenn dieser Markt tatsächlich nicht wichtig
sein sollte, wird er bei den nächsten Analyseschritten
ausgeschieden. Die übrig gebliebenen Länder werden mit
Hilfe weiterer Umweltkriterien analysiert.
35
Die Unterteilung der Umweltstruktur erfolgt hinsichtlich des
Grades der Verflechtung von Unternehmen und Umwelt.
36
Dabei kann eine Unterteilung in enge und weite
Unternehmensumwelt vorgenommen werden.
37
In der
Literatur
wird
oft
von
Rahmenbedingungen
der
unternehmerischen Tätigkeit, generellen Umweltfaktoren und
der Makroumwelt gesprochen. In dieser Arbeit werden diese
Begriffe synonym verwendet. Hierunter sind alle ,,generellen
Bedingungen in einem geographischen Raum zu verstehen,
die für eine größere Anzahl von Unternehmungen mit
unterschiedlichen Sachzielen gelten und die Möglichkeiten
der Bildung bestimmter Sachziele sowie die Durchführung
strategischer Verhaltensweisen im Einzelfall beeinflussen".
38
Viele Autoren der betriebswirtschaftlichen Literatur befassen
sich mit der Unterteilung der generellen Unternehmensumwelt
nach den Einflussfaktoren, die auf ein Unternehmen
einwirken können. Zur Differenzierung werden in der
betriebswirtschaftlichen Literatur häufig politisch-rechtliche,
ökonomische, technologische, sozio-kulturelle und natürliche
Kriterien genannt, die sowohl Risiken als auch - Chancen sein
können (vgl. Tab. 1).
35
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000), S.
216 f.
36
Vgl. Dill, W.R. (Environment as an influence on
Managerial Autonomy 1958), S. 409 ff.
37
Vgl. Wiedermann, K. (Marketingumwelt 2000), S. 186 ff.
38
Kubicek, H./Thom, N. (Betriebliches Umsystem 1976), Sp.
3988
- 10 -
Tab. 1: Umweltinformationen
Umweltbereiche
Indikatoren
Naturgegebener Bereich
Geographische Lage, Klima,
Anfälligkeit bezüglich
Umweltkatastrophen
Politischer und rechtlicher Bereich
Politische Stabilität,
Regierungswechsel, Anfälligkeit
bezüglich militärischer Konflikte und
Unruhen, Enteignung und
Verstaatlichung, Arbeits- und
Sozialrecht, Rechtssystem,
Handelsrecht insbesondere
Exportbestimmungen, Privatrecht,
Mitglied von Wirtschafts- oder
politischen Blöcken
Ökonomischer Bereich
Wirtschaftssystem, Bruttosozialprodukt,
Inflationsrate, Zinsentwicklung,
Wechselkursstabilität,
Korruptionsanfälligkeit,
Außenhandelsvolumina, Verschuldung
Technologischer/technischer Bereich
Technologisches Produktionsniveau,
Produktionsmittelverfügbarkeit,
Innovationsgrad, Umwelttechnologie,
Kommunikations- und
Informationstechnologie
Soziokultureller Bereich
Sprache, Mentalität,
Nationalbewusstsein, Religion
Wertvorstellungen, Ausbildungssystem, -
niveau, Gesundheitswesen, öffentliche
Sicherheit, Normen, soziokulturelle
Distanz zum Abnehmerland
Quelle: Heuer, M. (Kontrolle und Steuerung der
Materialwirtschaft
1988),
S.
173;
Meissner,
H.G.
(Strategisches Internationales Marketing 1995), S. 28 f.;
Ulrich, H. (Unternehmungspolitik 1989), S. 64; Wirth, W.
(Umweltanalyse
und
Umweltausrichtung
durch
Entscheidungs-verteilung
1980),
S.
12;
Hall,
R.H.
(Organizations 1972), S. 298; Bleicher, K. (Unternehmungs-
entwicklung und organisatorische Gestaltung 1979), S. 13 f.
(Eigene Darstellung)
Die Umweltstrukturierung, an der sich die Aufteilung der
Makrokriterien
orientiert,
soll
durch
die
Merkmale
,,Entscheidungssituationsunabhängigkeit"
und
,,Entscheidungssituationsabhängigkeit"
gekennzeichnet
- 11 -
werden.
39
Als entscheidungssituationsunabhängig werden im
Folgenden die Kriterien bezeichnet, die den Bezug der
notwendigen
Beschaffungsobjekte
verhindern
könnten.
Hierbei ist es für den Beschaffer nicht relevant, um was für
ein Beschaffungsobjekt es sich handelt und unter welchen
Bedingungen er es beziehen könnte. Vorrangig ist, wie groß
die Gefahr ist, das Objekt gar nicht, verspätet oder
unvollständig zu erhalten.
40
Diese Kriterien beziehen sich
demnach auf Risikoaspekte.
41
Das Risiko birgt die Gefahr,
,,einen unerwünschten Zustand zu realisieren"
42
oder ,,in
Bezug auf eine bestimmte Zielsetzung eine falsche
Entscheidung zu treffen".
43
Das Landesrisiko setzt sich aus
den vorgenannten Risiken (vgl. Tab. 1) zusammen, die jeweils
unterschiedlich bewertet werden.
44
Das Beispiel eines
mehrdimensionalen quantitativen Länderbeurteilungskonzept
ist BERI (Business Environment Risk Index)
45
(siehe
Anhang).
Entscheidungssituationsabhängige Makrokriterien werden in
Bezug auf die jeweilige Entscheidungssituation relevant. Es
handelt sich vielmehr um Makrokriterien, die in Abhängigkeit
von einem spezifischen Bezugsobjekt und der damit
verbundenen Beschaffungssituation vermehrt oder vermindert
beachtet werden müssen.
46
Die situationsspezifisch relevanten
Kriterien
lassen
sich
in
kostenabhängige
und
in
leistungsabhängige
Indikatoren
unterteilen.
47
Eine
Zusammenfassung beider Kriteriengruppen ist in Tab. 2
dargestellt.
39
Vgl. Brodersen, K. (Beschaffungsmarktwahl 2000), S. 158 f.
40
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000
), S. 217
41
Vgl. ebenda, S. 218
42
Stahl, W. (Risiko- und Chancenanalyse im Marketing 1992), S. 14
43
Vgl. Balleis, S. (Die Bedeutung politischen Risiken 1984), S. 85
44
Vgl. Meissner, H.G. (Strategisches Internationales Marketing 1995), S. 45
45
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000
), S. 223
46
Vgl. Schöllhammer, H. (Internationale Standortwahl 1989), Sp. 1960
47
Vgl. Eger, M./Zurlino, F. (Potentiale sind noch nicht ausgereizt 1999), S. 34
- 12 -
Tab.2: Entscheidungssituationsabhängige Makrokriterien
kostenabhängige Kriterien
leistungsabhängige Kriterien
Arbeitskräftekosten
Logistikkosten
Produktionskosten
Kapitalkosten
Kommunikationskosten
Managementkosten
Umweltschutzkosten
Usw.
Arbeitsleistung
Technologieleistung
Logistikleistung
Normenidentität
Kommunikationsleistung
Bildungsniveau
Wirtschaftsfreundlichkeit
Kapitalverfügbarkeit
Managementleistung
Usw.
Quelle: Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000), S.218
Als Mikrokriterien können Machtaspekte herangezogen
werden.
48
Dabei soll Macht definiert werden als die Chance
eines Individuums oder einer Mehrzahl von Individuen den
eigenen Willen in einem Gemeinschaftshandeln auch gegen
den Widerstand anderer daran Beteiligter durchzusetzen.
49
Die Macht ergibt sich nicht allein aus dem Spannungsfeld der
Angebots- und Nachfragekonkurrenz, sondern ist auch
unternehmens- und produktgebunden.
50
Sie betreffen neben
der unterschiedlichen Unternehmensgröße von Lieferant und
Beschaffer auch die Höhe des Informationsvorsprungs und ein
möglicherweise größeres Entwicklungspotential.
51
Außerdem
sind ebenfalls Eintrittsbarrieren aufgrund von Know-how oder
Kapitalbedarf sowie Produktbesonderheiten
oder eine
Produkteinzigartigkeit zu beachten, die eine intensive
Zusammenarbeit
zwischen
Lieferant
und
Beschaffer
notwendig machen.
52
48
Vgl. Koppelmann, U. (Beschaffungsmarketing 2000), S. 219
49
Vgl. Weber, M. (Wirtschaft und Gesellschaft 1964), S. 678
50
Vgl. Brodersen, K. (Beschaffungsmarktwahl 2000), S. 189
51
Vgl. Geck, P./Petry, G. (Nachfragemacht gegenüber
Zulieferern 1983), S. 4
52
Vgl. Brodersen, K. (Beschaffungsmarktwahl 2000), S. 190
- 13 -
2.2.3. Interne unternehmensspezifische Stärken-
Schwächen-Analyse
Neben den Marktpotentialen sind im nächsten Schritt die
Unternehmenspotentiale für die Erarbeitung strategischer
Alternativen zu berücksichtigen. Basis hierfür bildet eine
systematische Stärken-Schwächen-Analyse, die als Erfassung
und Bewertung der Ressourcen eines Unternehmens zu
verstehen ist. Eine Unternehmensanalyse kann, wie auch die
Umweltanalyse, in einzelne Subsysteme unterteilt werden. Je
nach
Analyseschwerpunkt
können
das
die
Unternehmenspolitik, Führung und Leitung aber
auch
einzelne Abteilungen und Funktionsbereiche (Lieferung,
Produktion, Beschaffung etc.) sein. Leistungsstärken und
Mängelbereiche können nicht absolut verstanden werden. Es
sind relative Größen, nämlich in Bezug auf die in der
Umweltanalyse herausgearbeiteten Branchenergebnisse.
53
Die
Stärken zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, die
Marktchancen zu nutzen beziehungsweise den Marktrisiken
zu entgehen. Die Ermittlung der Stärken und Schwächen kann
grundsätzlich entweder auf der Grundlage subjektiver
Einschätzungen oder anhand nachprüfbarer Daten erfolgen.
54
In der Regel bietet sich ein kombiniertes Vorgehen in der
Weise an, dass, ohne großen Aufwand möglich, nachprüfbare
Daten und ansonsten subjektiv gewonnene Daten zugrunde
gelegt werden.
53
Vgl. Rüdiger, H. (Management 1993), S. 285
54
Vgl. Westermann, H. (SWOT-Analyse im Einkauf 1999),
S. 55
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832491895
- ISBN (Paperback)
- 9783838691893
- DOI
- 10.3239/9783832491895
- Dateigröße
- 806 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Dezember)
- Note
- 2,7
- Schlagworte
- global sourcing osteuropa einkauf
- Produktsicherheit
- Diplom.de