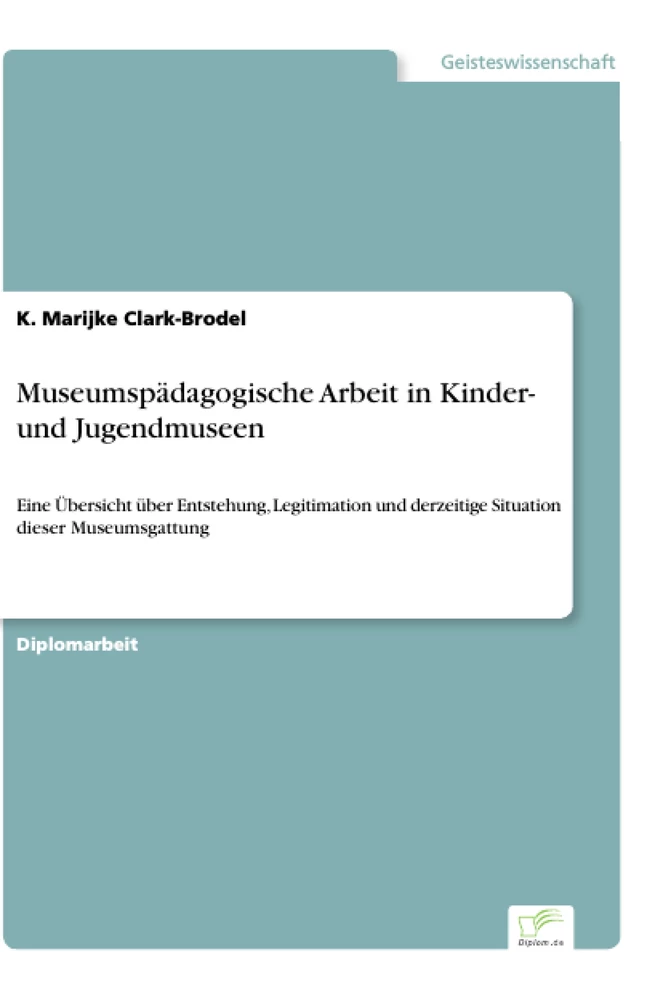Museumspädagogische Arbeit in Kinder- und Jugendmuseen
Eine Übersicht über Entstehung, Legitimation und derzeitige Situation dieser Museumsgattung
©2005
Diplomarbeit
142 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung der Kindermuseen verstärkt. Erst im Januar 2004 wurde das bisher neueste und modernste Kindermuseum, das Atlantis, in Duisburg eröffnet.
Schon vor meinem Studium habe ich in der Phänomenta in Lüdenscheid, einer Ausstellung, die sich mit physikalischen Phänomenen befasst, ein Praktikum absolviert. Des Weiteren habe ich unterschiedliche Kindermuseen und Science Center in Deutschland besucht, wie z.B. das MachMit Museum in Aurich, das MitMach Museum in Minden und das Universum Bremen. Dieses Praktikum, die Besuche der Science Center und Kindermuseen hier in Deutschland und die Erfahrungen, die ich bei Besuchen von Kindermuseen (z.B. das Children´s Museum of Indianapolis) und Science Centern (z.B. das Franklin Institut in Philadelphia, Pennsylvania und das Science Center in Hartford, Connecticut) während verschiedener USA-Aufenthalte gesammelt habe, haben mich sehr fasziniert und ich habe mich von da an verstärkt für das Thema Kinder- und Jugendmuseen interessiert. Im Sommersemester 2004 habe ich das Seminar Kindermuseen bei Angela Kahre an der Universität Bielefeld besucht und mich entschlossen für die Diplomarbeit dieses Gebiet auszuwählen.
Material- und Informationssuche:
Zunächst habe ich mich bemüht Literatur zu diesem Thema zu finden. Da es in der Universitätsbibliothek nur wenig Literatur zu diesem speziellen Thema gibt, habe ich meine Suche auch auf die Fernuniversität Hagen und über die Fernleihe auf weitere Bibliotheken ausgedehnt. Zusätzlich habe ich im Internet nach Webseiten über Kindermuseen gesucht, um diese zu bitten mir neue praxisorientierte Materialien zukommen zu lassen und um weitere Informationen zu erhalten.
Da der Ursprung der Kindermuseen in den USA liegt, habe ich mich auch an amerikanische Einrichtungen gewandt. Über das Internet bin ich auf Webseiten von Kindermuseen in Europa gestoßen, die ich ebenfalls angeschrieben habe.
Der Fragebogen (in einer englischsprachigen und einer deutschsprachigen Variante), den ich, hauptsächlich per Email an die Museen geschickt habe, um Ihnen das Zusammensuchen von Informationen zu erleichtern, findet sich im Anhang A.
Rücklauf der Museen:
Viele der angeschriebenen Kindermuseen haben mir schon innerhalb der ersten zwei Wochen nach Versand der Fragebögen geantwortet. Einige haben mir lediglich den ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt, andere haben mir ganze Publikationen und viele Flyer und weitere […]
In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung der Kindermuseen verstärkt. Erst im Januar 2004 wurde das bisher neueste und modernste Kindermuseum, das Atlantis, in Duisburg eröffnet.
Schon vor meinem Studium habe ich in der Phänomenta in Lüdenscheid, einer Ausstellung, die sich mit physikalischen Phänomenen befasst, ein Praktikum absolviert. Des Weiteren habe ich unterschiedliche Kindermuseen und Science Center in Deutschland besucht, wie z.B. das MachMit Museum in Aurich, das MitMach Museum in Minden und das Universum Bremen. Dieses Praktikum, die Besuche der Science Center und Kindermuseen hier in Deutschland und die Erfahrungen, die ich bei Besuchen von Kindermuseen (z.B. das Children´s Museum of Indianapolis) und Science Centern (z.B. das Franklin Institut in Philadelphia, Pennsylvania und das Science Center in Hartford, Connecticut) während verschiedener USA-Aufenthalte gesammelt habe, haben mich sehr fasziniert und ich habe mich von da an verstärkt für das Thema Kinder- und Jugendmuseen interessiert. Im Sommersemester 2004 habe ich das Seminar Kindermuseen bei Angela Kahre an der Universität Bielefeld besucht und mich entschlossen für die Diplomarbeit dieses Gebiet auszuwählen.
Material- und Informationssuche:
Zunächst habe ich mich bemüht Literatur zu diesem Thema zu finden. Da es in der Universitätsbibliothek nur wenig Literatur zu diesem speziellen Thema gibt, habe ich meine Suche auch auf die Fernuniversität Hagen und über die Fernleihe auf weitere Bibliotheken ausgedehnt. Zusätzlich habe ich im Internet nach Webseiten über Kindermuseen gesucht, um diese zu bitten mir neue praxisorientierte Materialien zukommen zu lassen und um weitere Informationen zu erhalten.
Da der Ursprung der Kindermuseen in den USA liegt, habe ich mich auch an amerikanische Einrichtungen gewandt. Über das Internet bin ich auf Webseiten von Kindermuseen in Europa gestoßen, die ich ebenfalls angeschrieben habe.
Der Fragebogen (in einer englischsprachigen und einer deutschsprachigen Variante), den ich, hauptsächlich per Email an die Museen geschickt habe, um Ihnen das Zusammensuchen von Informationen zu erleichtern, findet sich im Anhang A.
Rücklauf der Museen:
Viele der angeschriebenen Kindermuseen haben mir schon innerhalb der ersten zwei Wochen nach Versand der Fragebögen geantwortet. Einige haben mir lediglich den ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt, andere haben mir ganze Publikationen und viele Flyer und weitere […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9028
Brodel, Marijke: Museumspädagogische Arbeit in Kinder- und Jugendmuseen -
Eine Übersicht über Entstehung, Legitimation und derzeitige Situation dieser
Museumsgattung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Universität Bielefeld, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
1
To touch is to explore,
to explore is to discover,
to discover is to learn.
2
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung ...4
1.1.
Material- und Informationssuche ...4
1.2.
Rücklauf der Museen...5
1.3.
Aufbau der Arbeit ...5
2. Traditionelle Museen...9
2.1.
Begriffsbegrenzung und Funktionen traditioneller Museen...9
2.2.
Historische Entwicklung...10
2.3.
Museumspädagogik ...11
2.3.1.
Historische Entwicklung...11
2.3.2.
Versuch einer Begriffsbegrenzung ...13
2.3.3.
Heutige Situation der Museumspädagogik ...14
3. Kinder- und Jugendmuseen ein Überblick über Entstehung, Situation und
Legitimation...16
3.1.
Was ist ein Kinder- und Jugendmuseum? Begriffsbegrenzung im Unterschied
zum traditionellen Museum ...16
3.1.1.
Typen von Kinder- und Jugendmuseen...20
3.1.2.
Ziele und Aufgaben ...21
3.1.3.
Theoretische Wurzeln der Grundkonzeptionen der Kinder- und
Jugendmuseen...24
3.2.
Vorstellung und Entwicklung der ersten Kindermuseen...33
3.3.
Entwicklung und Situation der Kinder- und Jugendmuseen in Deutschland ...35
3.4.
Legitimation von Kinder- und Jugendmuseen...38
3.4.1.
Kinder- und Jugendmuseen als alternative Bildungsstätte? ...40
3.4.2.
Der umstrittene Museumsbegriff ...43
3.4.3.
Der Wandel der Kindheit ...45
3.4.4.
Das Spiel der Kinder...47
3.5.
Umsetzung der Museumspädagogik in Kinder- und Jugendmuseen...50
3.5.1.
Museumspädagogische Praxis ...50
3.5.2.
Partizipation der Kinder und Jugendlichen...60
3.5.3.
Ehrenamtliche und Praktikanten...61
4. Kinder- und Jugendmuseen in den USA und in Deutschland ...64
3
4.1.
Pädagogik der Kinder- und Jugendmuseen in den USA ...64
4.1.1.
Allgemeine Situation ...64
4.1.2.
Phoenix Family Museum ...66
4.1.3.
Arizona Museum for Youth...68
4.1.4.
Children's Museum of Houston...69
4.2.
Pädagogik der Kinder- und Jugendmuseen in Deutschland ...74
4.2.1.
allgemeine Situation ...74
4.2.2.
Jugend Museum Schöneberg...75
4.2.3.
Kinderreich des Deutschen Museums ...77
4.2.4.
Labyrinth Kindermuseum Berlin ...79
4.2.5.
Miraculum MachMit Museum Aurich...81
4.2.6.
Mobiles Kindermuseum Vahrenwald ...83
4.3.
Pädagogik der Kinder- und Jugendmuseen weltweit...84
4.4.
Eigene Überlegungen zu möglichen Leitkriterien für museumspädagogische
Arbeit in Kinder- und Jugendmuseen...85
5. Konzeptionelle Entwicklung einer Ausstellung zum Thema ,,Familie"...89
5.1.
Konzept ...93
5.2.
Didaktische Überlegungen...95
5.3.
Mögliche Anwendungszwecke ...98
6. Schlussbemerkungen ...102
Literaturverzeichnis ...105
Danksagungen...111
Anhang...115
4
1.
Einführung
In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung der Kindermuseen verstärkt. Erst im Januar
2004 wurde das bisher neueste und modernste Kindermuseum, das Atlantis, in Duisburg
eröffnet.
Schon vor meinem Studium habe ich in der Phänomenta in Lüdenscheid, einer
Ausstellung, die sich mit physikalischen Phänomenen befasst, ein Praktikum absolviert.
Des Weiteren habe ich unterschiedliche Kindermuseen und Science Center in Deutschland
besucht, wie z.B. das MachMit Museum in Aurich, das MitMach Museum in Minden und
das Universum Bremen. Dieses Praktikum, die Besuche der Science Center und
Kindermuseen hier in Deutschland und die Erfahrungen, die ich bei Besuchen von
Kindermuseen (z.B. das Children´s Museum of Indianapolis) und Science Centern (z.B.
das Franklin Institut in Philadelphia, Pennsylvania und das Science Center in Hartford,
Connecticut) während verschiedener USA-Aufenthalte gesammelt habe, haben mich sehr
fasziniert und ich habe mich von da an verstärkt für das Thema Kinder- und Jugendmuseen
interessiert. Im Sommersemester 2004 habe ich das Seminar ,,Kindermuseen" bei Angela
Kahre an der Universität Bielefeld besucht und mich entschlossen für die Diplomarbeit
dieses Gebiet auszuwählen.
1.1.
Material- und Informationssuche
Zunächst habe ich mich bemüht Literatur zu diesem Thema zu finden. Da es in der
Universitätsbibliothek nur wenig Literatur zu diesem speziellen Thema gibt, habe ich
meine Suche auch auf die Fernuniversität Hagen und über die Fernleihe auf weitere
Bibliotheken ausgedehnt. Zusätzlich habe ich im Internet nach Webseiten über
Kindermuseen gesucht, um diese zu bitten mir neue praxisorientierte Materialien
zukommen zu lassen und um weitere Informationen zu erhalten.
Da der Ursprung der Kindermuseen in den USA liegt, habe ich mich auch an
amerikanische Einrichtungen gewandt. Über das Internet bin ich auf Webseiten von
Kindermuseen in Europa gestoßen, die ich ebenfalls angeschrieben habe.
5
Der Fragebogen (in einer englischsprachigen und einer deutschsprachigen Variante), den
ich, hauptsächlich per Email an die Museen geschickt habe, um Ihnen das
Zusammensuchen von Informationen zu erleichtern, findet sich im Anhang A.
1.2.
Rücklauf der Museen
Viele der angeschriebenen Kindermuseen haben mir schon innerhalb der ersten zwei
Wochen nach Versand der Fragebögen geantwortet. Einige haben mir lediglich den
ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt, andere haben mir ganze Publikationen und viele
Flyer und weitere Materialien zukommen lassen. Manche Museen haben sich bei mir dafür
entschuldigt, dass sie zu wenig Zeit und Personal hätten, um mir Informationen zu
schicken, die meisten haben sich aber gar nicht auf meine Anfrage gemeldet.
Von den insgesamt 238 weltweit angeschriebenen Museen haben mir 34 den Fragebogen
ausgefüllt zurückgeschickt. Bei diesen Museen, die im Anhang aufgelistet sind, möchte ich
mich gerne für ihre Hilfsbereitschaft und die reichlichen Materialien bedanken.
Sehr interessant fand ich den Hinweis des Universums Bremen und der Phänomenta
Lüdenscheid, dass sie kein (Kinder-)Museum seien, sondern ein Science Center.
Obwohl Science Center nach dem ,,Hands on!" Prinzip, welches ich im Verlauf dieser
Arbeit noch näher erläutern werde, verfahren, lassen sie sich nicht in die Kategorie
Museum einordnen, sondern bilden ihre eigene Kategorie. Zielgruppe der Science Center
sind nicht ausschließlich Kinder und Jugendliche und die Angebote sind auch nicht, sieht
man von möglichen Überschneidungen mal ab, an den Bedürfnisse und Interessen dieser
orientiert. Vielmehr wollen die Science Center interessierte Jugendliche, Erwachsene und
Schulklassen ansprechen. Sie haben den Bedarf frühzeitig erkannt und eine Nische für sich
erobert. Dass ein Bedarf vorhanden war und immer noch ist, lässt sich davon ableiten, wie
viele Erwachsene man, auch ohne Kinder, in Kinder- und Jugend museen antrifft und wie
gut auch bei ihnen das Prinzip des ,,Hands on! " ankommt.
1.3.
Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über das Feld der Kinder- und Jugend museen,
ihrer Entwicklung und ihrer Praxis zu geben.
6
Das Thesenpapier zur Zukunftskonferenz ,,Kommunale Jugendhilfe in Bonn: Quo Vadis?"
am 09. März 2001 fasst die wichtigsten Punkte eines Kinder- und Jugendmuseums in sechs
Thesen zusammen (Anhang B):
·
,,Investitionen in die Kinder und Jugendlichen sind unumgänglich, da sie die auf sie
zukommenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse bewältigen,
gestalten und lenken werden müssen und dazu Kraft, Mut, Fantasie, Visionen,
Kenntnisse, Fähigkeiten, Prozesse in ihrer Vernetztheit zu denken und
Selbstvertrauen benötigen werden.
·
Ein möglicher Ort, den jungen Menschen in seiner Entwicklung zu stärken, ist das
Kinder- und Jugendmuseen, ein integrativer Kultur-, Lern- und Freizeitort für
Kinder, Jugendliche und Familien.
·
Gegenstand sind ,die Dinge, die die Welt bedeuten', Phänomene aus Kunst und
Kultur, Technik, Geschichte und Natur.
·
Ziel wie Methode ist neben den musealen Prinzipien des Sammelns, Ordnens,
Erforschens und Bewahrens: wahrnehmen ,mit allen Sinnen' spielend erkennen
selber schaffen und das in seiner Ganzheit und Unmittelbarkeit, also das Begreifen
der Welt nach dem Vermittlungsprinzip ,hands-on'.
·
Kinder- und Jugendmuseen sind Schnittstelle zwischen Kindergärten, Schulen
sowie den anderen städtischen Jugendeinrichtungen: sie bieten ein
Präsentationsforum und die Möglichkeit, interaktive Erlebnisausstellungen aus der
Kinder- und Jugendmuseumsszene zugänglich zu machen.
·
Kinder- und Jugendmuseen verstehen sich nicht als Konkurrenz zu den
bestehenden Museen mit ihren museumspädagogischen Angeboten, sondern durch
ihren besonderen Ausgangspunkt als Bereicherung der Kinder- und Jugendszene."
Die genannten Punkte finden sich in dieser Arbeit wieder und werden in verschiedenen
Kapiteln ausführlicher erläutert.
Nach einer Einführung ins Thema (Kapitel 1) geht es zunächst darum die historische
Entwicklung der traditionellen Museen im Allgemeinen und die Museumspädagogik
darzustellen (Kapitel 2).
Im dritten Kapitel wird der klassische Museumstyp vom Typ der Kindermuseen
abgegrenzt und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten dargestellt. Darauf folgend werden
7
die verschiedenen Typen von Kinder- und Jugendmuseen näher erläutert und ihre Ziele
und Aufgaben vorgestellt.
Des Weiteren werden die theoretischen Wurzeln der Grundkonzeptionen der Kinder- und
Jugendmuseen beschrieben und nun auch die Entwicklung der ersten Kindermuseen
zunächst in den USA und dann in Deutschland dargestellt.
Ich werde mich mit der Frage beschäftigen, warum es überhaupt Kinder- und
Jugendmuseen gibt und ob diese unter einem pädagogischen Hintergrund als alternative
Bildungsstätten gelten können und was für eine Legitimation sie haben.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Praxis der Kinder- und Jugendmuseen. Hierzu werde ich
zunächst theoretisch die Vermittlungsmethoden der Museen, also z.B. Ausstellungen,
Führungen, Arbeitsblätter, Schulprogramme, Demonstrationen, Workshops sowie die
,,Museen auf Rädern" und die Partizipation der Kinder, beleuchten, bevor ich im vierten
Kapitel die Praxis einzelner Museen aus Deutschland und den USA genauer vorstellen
werde.
Wie die Konzeption eines Kindermuseums vonstatten gehen kann, möchte ich im fünften
Kapitel anhand eines praktischen Beispiels erläutern. Im oben erwähnten Seminar wurde
der Gruppe die Aufgabe gestellt, zu einem von sechs verschiedenen Themen (Familie,
Labyrinth, Formen und Farben, Fliege n, Fließen, Zeit) ein Konzept für ein Kindermuseum
zu entwickeln. Da ich zu der Gruppe gehöre, die das Thema ,,Familie" übernommen hat,
werde ich unser Vorgehen, als eine Möglichkeit des Herangehens, exemplarisch vorstellen.
Zum Abschluss meiner Arbeit werde ich zusammenfassend die Bedeutung der Kinder- und
Jugendmuseen in der heutigen Zeit beschreiben und auf meine Erfahrungen eingehen
(Kapitel 6).
8
Impressionen 1
9
2.
Traditionelle Museen
Um zu erklären, was das Spezifische eines Kinder- und Jugendmuseums ist und wodurch
es sich von traditionellen Museen abgrenzt, ist es wichtig zunächst auf die traditionellen
Museen, ihre Aufgaben und Ziele und ihre historische Entwicklung einzugehen.
In diesem Kapitel werde ich mich hauptsächlich auf die Ausführungen von Schreiber
(1998) beziehen, da mir diese als am schlüssigsten erscheinen.
2.1.
Begriffsbegrenzung und Funktionen traditioneller Museen
Das Museum ist in seiner Funktion zunächst eine am Objekt orientierte Institution, ein
Ausstellungsort von Sammlungen (vgl. Schreiber 1998, S. 7). Bis heute steht der im 19.
Jahrhundert erhobene Bildungsanspruch der Museen zur Debatte. Schreiber (1998, S. 8)
bezeichnet das Museum in diesem Zusammenhang als ,,soziales Gedächtnis" oder
,,kollektive Erinnerung".
Zu den klassischen Aufgaben eines Museums gehören das Sammeln, das Bewahren, das
Erforschen, das Ausstellen und das Vermitteln. Je nach Museumsgattung werden diese
Aufgaben unterschiedlich stark gewichtet.
Das Sammeln war schon in der Frühzeit ein wichtiger Bestandteil des Lebens, da es dem
Überleben diente. In der auch als ,,Jäger und Sammler" bezeichneten Gemeinschaft von
Menschen sammelten schon die Frauen Früchte und Holz, um das Überleben ihres
Stammes zu sichern. Später ging man zur Bevorratung über (vgl. Museumsmagazin 2004,
S. 7). Auch die Vorläufer der heutigen Museen, die fürstlichen Kunstkammern, und die
Kuriositätenkabinette und Schatzkammern, waren Sammlungen, die einer kleinen Elite
zugänglich waren. Heute gibt es ebenfalls noch Museen, die aus privaten Sammlungen
entstanden sind, wie z.B. das Bananenmuseum von Bernhard Steilmacher an der Ostsee
(vgl. Baukhage 2004, 7, S. 72).
In den Museen wird das Sammeln als systematisches Zusammentragen von Kulturgütern
angesehen (vgl. Jacobs 1995, S 57). Ziel dieser Tätigkeit ist es das Erbe der Menschheit
und der Natur zu bewahren.
10
Als bewahrenswert gelten grundsätzlich Kostbarkeiten materieller und ideeller Art. Daher
gehört das Bewahren der Objekte vor Verlust und Verfall zu den wichtigsten Aufgaben des
Museums (vgl. Museumsmagazin 2004, S. 27).
Die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit den Objekten und Abteilungen
eines Museums ist ebenfalls Grundlage der Ausstellungstätigkeit.
Die Aufgaben Ausstellen und Vermitteln werden häufig zusammengefasst und sind das
Ergebnis des Sammelns, Bewahrens und Forschens. Auch die Museumspädagogik fällt in
diesen Bereich.
2.2.
Historische Entwicklung
Die antike Vorform der Museen ist das ,,mouseion", der Palast des Ptolomäus, der im
dritten Jahrhundert v. Chr. in Alexandria entstanden ist, welches eine Antikensammlung
und eine Bibliothek beherbergte. Der Bildungsgedanke stand bei dieser Museums-Vorform
im Vordergrund (vgl. Schreiber 1998, S. 9).
Im Gegensatz dazu dienten die Schatz- und Reliquienkammern des Mittelalters lediglich
zur Präsentation von Sammlungen (ebd.). Die Besitzer wollten nicht bilden, sondern ihren
eigenen Reichtum und ihre Macht demonstrieren.
Erst in der Renaissance trat der Bildungsgedanke wieder stärker in den Vordergrund. Zu
den Naturalienkabinetten, Kunst- und Wunderkammern in dieser Zeit waren der Adel und
die Gelehrtenschaft die einzigen zugelassenen Besucher (ebd.), die breite Öffentlichkeit
hatte keinen Zutritt.
Im Zeitalter der Aufklärung und der Französischen Revolution wurden ,,Sammlungen als
potenzielle Orte der Bildung nun auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" (vgl.
Schreiber 1998, S. 9).
Im 19. Jahrhundert waren die öffentlichen Museumsgründungen in Deutschland
hauptsächlich auf fürstliche Bestrebungen zurückzuführen. Im Mittelpunkt standen dabei
vor allem die Kunstmuseen, die ,,nicht mehr Vorbilder für Künstler und Bildungselemente
für eine kleine geistige Elite darstellten, sondern [...] als ,Tempel der Kunst und der
Musen' angesehen wurden, in denen die Kunstwerke einen Wert an sich erhielten"
11
(Schreiber 1998, S. 10). Neben diesen Kunsttempeln etablierten sich ab Mitte des 19.
Jahrhunderts auch naturwissenschaftliche und bürgerliche Museen, die im Sinne von
Lehrmittelsammlungen aufgebaut und nach didaktischen Gesichtspunkten gegliedert
waren.
Die Volksbildungsbewegung forderte allerdings 1880 eine Vermittlungsarbeit für die
breite Öffentlichkeit. Als Reaktion darauf gab es zunehmend Angebote für die
Arbeiterschicht und die Beschriftung der Ausstellungsstücke wurde selbstverständlicher
(vgl. Schreiber 1998, S. 11). 1903 manifestierte sich die Forderung nach einer öffentlichen
und allgemeingültigen Bildungsfunktion der Museen in der Konferenz ,,Museen als
Volksbildungsstätten". Die Teilnehmer setzten sich für die bildungspolitische Nutzung des
Museums ein und forderten eine Erziehung breiterer Schichten im Museum (vgl. Schreiber
1998, S. 11).
2.3.
Museumspädagogik
2.3.1.
Historische Entwicklung
Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre wurde der Einbezug von Kindern und
Jugendlichen in die Bildungsarbeit der Museen durch kleinere Projekte erprobt. Ein unter
diesem Aspekt zu nennender Name ist der Alfred Lichtwarks (1852-1914), der Leiter der
Hamburger Kunsthalle war und sich kritisch mit der damaligen Situation der Museen
auseinander gesetzt hat. Seine Forderung war die ästhetische Erziehung von Kindern.
Schon 1897 hielt er dialogische Führungen mit Schulklassen ab, die der Übung der
Betrachtung von Kunstwerken dienten. Grundlage dieser Führungen war jedoch nicht die
Aneignung von Wissen, sondern die Ausbildung der Fähigkeit Kunstwerke zu betrachten
(vgl. Schreiber 1998, S. 11f).
Eine weitere wichtige Person ist Oskar von Miller (1855-1934). Er gründete von 1903 bis
1906 das ,,Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik" in
München. In diesem Museum versuchte er von Beginn an die öffentlichen
Bildungsbestrebungen zu verwirklichen und die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Museum zu fördern. In diesem Sinne führte von Miller ab 1906 eine Ermäßigung des
Eintritts für Schulklassen ein und bot ab 1907 Fortbildungsprogramme für
Berufsschullehrer auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet an (vgl. Schreiber 1998,
12
S. 12f). 1910 wurde das Führungsprogramm dann auch auf die fünften bis achten Klassen
ausgeweitet.
Zusammen mit dem Reformpädagogen Georg Kerschensteiner (1854-1932) erarbeitete von
Miller ein Konzept für ein Museum, welches als Stätte der Belehrung für das ganze Volk
dienen sollte. Durch die geistige Nähe zur Theorie des erfahrungsbezogenen Lernens nach
John Dewey fließen auch erlebnishafte Vermittlungsmethoden, ,,die nicht nur zu isolierten
Betrachtungen, sondern darüber hinaus zur Erkenntnis von Wirkungszusammenhängen
befähigen" (Schreiber 1998, S. 13) sollen, in das Konzept ein. Daraus ergaben sich
museumspädagogische Maßnahmen, wie die gezielte Auswahl, Gliederung und
Verknüpfung der einzelnen Objekte anstelle eines ,,je mehr, desto besser" - Denkens. Es
wurden einfache Versuchseinrichtungen installiert, welche die Besucher, meist durch
Knopfdruck, selbstständig bedienen konnten. Zusätzlich wurden Texterläuterungen,
Schautafeln, pädagogisch-didaktische Hilfsmittel (z.B. aufgeschnittene und bewegliche
Modelle) zur Erläuterung einzelner Arbeitsgänge angebracht. Weitere
museumspädagogische Maßnahmen waren ein regelmäßiges Führungsangebot, schriftliche
Führer, Plakatankündigungen und die Einrichtung einer Bibliothek (vgl. Schreiber 1998, S.
13f).
Sowohl Lichtwarks als auch von Millers Beispiele zeigen den Beginn einer Entwicklung
von museumspädagogischen Aktivitäten.
Im Nationalsozialismus wurden diese Bestrebungen jedoch unterbrochen, da die
Kulturpolitik zu Propagandazwecken ,,gleichgeschaltet" wurde (vgl. Schreiber 1998, S.
15).
In den ersten zwei Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg war die Konzentration auf die
Wiederherstellung und Ergänzung der Sammlungen gerichtet. Erst die sogenannte
,,Museumskrise" und die reformpädagogischen Bestrebungen der 60er Jahre dienten als
,,Ausgangspunkt für eine erneute Besinnung auf die Bildungs- und Vermittlungsaufgaben
des Museums" (Schreiber 1998, S. 16).
Sowohl die reformpädagogischen Bestrebungen, die nach neuen Lernformen und
Lernräumen im außerschulischen Bereich suchten, als auch das Museumswesen, welches
sich durch die Öffnung nach außen steigende Besucherzahlen erhoffte, trieben diese
Entwicklung voran.
13
In den folgenden Jahren etablierte sich die Museumspädagogik durch die Gründung
verschiedener museumspädagogischer Zentren und Dienste (vgl. Schreiber 1998, S. 17)
immer mehr und ist heute oft ein fester Bestandteil der Museen.
2.3.2.
Versuch einer Begriffsbegrenzung
Die Museumspädagogik vermittelt zwischen den musealen Objekten und ihrer Bedeutung
und dem Besucher.
Man kann daher ein didaktische s Dreieck aufzeigen, ähnlich dem in der Schule
verwendeten:
Abbildung 1
(in Anlehnung an Schreiber 1998, S. 20 und von Freymann 1988, S. 14)
Ziele dieses Vermittlungsprozesses ist das Aufbereiten und Anbieten von Informationen,
die dem Laien das Objekt verständlich machen, Interesse bei ihm wecken und Denk- und
Lernprozesse anstoßen (vgl. von Freymann 1988, S. 25). Die Museumspädagogik geht
demnach über das reine Vermitteln von Informationen hinaus und will auch die Erziehung,
Bildung und Sozialisation des Menschen verfolgen (vgl. Schreiber 1998, S. 20).
Weschenfelder/Zacharias (1981, S. 13) sehen die Museumspädagogik daher als eine
,,Erziehung auf das Museum hin, im Museum, durch das Museum und vom Museum
ausgehend".
Besucher (ist meist
freiwillig im Museum
und bringt eigene
Erwartungen
und Interessen mit)
Exponat (Ausstellungsgegenstand, welcher der Vermittlung bedarf)
Museumspädagoge
(unmittelbares
Handeln, tritt als
Vermittler auf)
14
Grundsätzlich kann man die Museumspädagogik als Entwicklung von didaktisch
interessanten Vermittlungsangeboten sehen, die einmal die mediale und einmal die
personelle Vermittlung umfassen (vgl. Jacobs 1995, S. 59). Unter medialer Vermittlung
versteht man nach Jacobs (1995, S. 59) Schausammlungen, Ausstellungen,
Objektbeschriftungen, grafische Darstellungen, Fotos, Videos, Filme, inszenierte
Spielräume sowie Kataloge und Informationsblätter. Personelle Vermittlung umfasst die
Bereiche Führungen, Demonstrationen, Spiele, Projekte, Exkursionen, Kurse und
weiterführende Veranstaltungen (ebd.).
Diese Unterschiede finden sich auch in einem Teilsystem der Pädagogik: der Didaktik,
oder genauer der Museumsdidaktik. Weschenfelder und Zacharias (1981, S. 15f) sehen
zwei Anwendungsbereiche der Didaktik im Museum. Zum einen die Ausstellungs- und
Präsentationsdidaktik und zum anderen die Didaktik der Museumspädagogik.
Die Ausstellungs- und Präsentationsdidaktik betrifft Überlegungen vor allem in den
Aufgabenfeldern Bilden und Vermitteln im Bereich der Präsentation von Objekten und
Informationen. Sie betrifft nur nicht-absichtvolles pädagogisches Handeln.
Im Gegensatz dazu sind ,,Überlegungen zu allen Situationen personaler Vermittlung und
absichtsvollen pädagogischen Handelns im Museum" (Weschenfelder/Zacharias 1981, S.
16) als eigentliche Didaktik der Museumspädagogik zu sehen.
2.3.3.
Heutige Situation der Museumspädagogik
Nach Schreiber (1998, S. 18) befindet sich die heutige Museumspädagogik ,,auf der Suche
nach einer auf den eigenständigen Lernort Museum ausgerichteten Didaktik, die sich von
der schulischen Orientierung und Ausrichtung löst". Museumspädagogische Angebote
müssen sich nicht nur an den Interessen der Zielgruppe orientieren, sondern auch das
Museum als Teil der Freizeitindustrie ausrichten.
Die Museumspädagogik ringt jedoch immer noch um Anerkennung bei der Mitsprache der
allgemeinen Museumsarbeit und bei der finanziellen Förderung. Oftmals wird die
Museumspädagogik als Mittel zum Zweck angesehen, um rückläufigen Besucherzahlen
entgegenzuwirken (vgl. Schreiber 1998, S. 19).
Eine Verbesserung dieser Situation is t in Zukunft anzustreben. Meines Erachtens tragen
gerade die Kinder- und Jugendmuseen dazu bei, da sie ein mögliches Modell der
Umsetzung liefern und Raum bieten, um neue Konzepte auszuprobieren.
15
Impressionen 2
16
3.
Kinder- und Jugendmuseen ein Überblick über
Entstehung, Situation und Legitimation
Dieses Kapitel soll einen Überblick geben über das Spektrum der Kinder- und
Jugendmuseen.
Zunächst sollen die Kinder- und Jugendmuseen abgegrenzt werden von den traditionellen
Museen, um anschließend die verschiedenen Typen darzustellen und ihre Aufgaben und
Ziele zu beschreiben.
Ein weiterer Aspekt ist die Entstehung dieser Museumsgattung in den USA und in
Deutschland. Die Frage, welche Legitimation Kinder- und Jugendmuseen haben und wie
die Umsetzung der Museumspädagogik in diesen aussehen kann, wird ebenfalls erläutert.
3.1.
Was ist ein Kinder- und Jugendmuseum? Begriffsbegrenzung im
Unterschied zum traditionellen Museum
Zurzeit gibt es noch keine allgemeingültige Definition, was ein Kinder- und
Jugendmuseum ist und was es ausmacht.
Die freie Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/kindermuseum) beinhaltet
jedoch einen Beitrag, in dem das Kindermuseum folgendermaßen definiert wird:
,,Ein Kindermuseum [Hervorheb. im Original] ist ein ,Welterforschungsort', der auf die
Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten ist. Ziel ist, mittels ,Learning by doing' und
,Hands on' die Neugier und Kreativität der Kinder zu wecken."
Wenngleich einige der wichtigen Aspekte eines Kinder- und Jugendmuseums aufgegriffen
werden, ist dieser Versuch einer Definition sehr offen gehalten, was aber auch dem Wesen
der Kinder- und Jugendmuseen entspricht. Kein Kinder- und Jugendmuseum gleicht dem
anderen, sie alle haben unterschiedliche Ansätze, thematische Gewichtungen und
Organisationsformen und stellen somit eine Vielfalt und Offenheit dar, ,,die dem
Selbstverständnis der Institution als eigenständiger Kulturort entspricht" (Schreiber 1998,
S. 21).
Gemeinsam ist den Kinder- und Jugend museen aber ihre Orientierung an den Besuchern
und ihr Ziel Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Kultur, Wissenschaft und Technik
zu verschaffen (vgl. König 2002, S.93) und ihnen direkte Erlebnisse und Erfahrungen zu
ermöglichen (vgl. Kolb 1983, S. 20).
17
Die deutsche Bezeichnung ,,Kinder- und Jugendmuseum" entstand aus dem
amerikanischen Begriff ,,Children's Museum". Jedoch ist dieses keine korrekte
Übersetzung und führt vielfach zu Missverständnissen, wie z.B. der Annahme, dass dort
Kindheit thematisiert wird oder der doch sehr ironischen Annahme, dass Kinder ausgestellt
werden. Durch den Genitiv drückt der amerikanische Begriff aus, dass das Museum ein
Museum der Kinder ist, was auch die korrekte Übersetzung wäre, da die Zielgruppe der
Kinder und Jugendlichen ein Hauptkriterium dieser Museumsgattung ist. Ihre Konzeption
richtet sich nämlich nicht nach übergeordneten Themengebieten aus, sondern vor allem
nach ihrer Zielgruppe, der vier bis 14-Jährigen, die nicht nur als Einzelpersonen, sondern
auch im Gruppenverband und in Begleitung von Erwachsenen bzw. Eltern und
Geschwistern angesprochen werden (vgl. Schreiber 1998, S. 21).
Während sich die traditionellen Museen in Kategorien wie Heimatmuseum,
Naturkundemuseum, Kunstmuseum etc. einordnen lassen, erstreckt sich die Vielfalt der
Themen der Kinder- und Jugendmuseen von Phänomenen der Natur über historische und
gegenwärtige Alltagskultur, Kunst, Wissenschaft und Technik bis hin zu Problemfeldern
wie z.B. Ökologie und Dritte Welt (vgl. Liebich 1995, S. 152).
Den Kinder- und Jugendmuseen geht es dabei vor allem darum, die kindlichen Interessen
und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufzugreifen und die
Ausstellungsthemen nach ihren Seh- und Lerngewohnheiten zu planen. Diese besondere
Zielgruppe steht hier im Mittelpunkt, während die traditionellen Museen sich an ihren
Themen und Sammlungen orientieren.
Die Themen im Kinder- und Jugendmuseen werden nach den Interessen der Kinder und
Jugendlichen ausgesucht und so aufgebaut, dass sie dem Entwicklungs stand der jeweiligen
Zielgruppe entsprechen (vgl. Kolb 1983 S. 18ff). Meist wird nämlich nicht die gesamte
Zielgruppe mit einem Thema angesprochen, sondern eine kleine Teilgruppe, was
besonders auf das Alter zurückzuführen ist, denn es ist sehr schwierig ein Thema so
aufzubereiten, dass sich sowohl die Vierjährigen als auch die Vierzehnjährigen gemäß
ihren Interessen und ihrem Entwicklungsstand angesprochen fühlen. Diesen Konflikt löst
das Kindermuseum des historischen Museums in Frankfurt z.B. durch Ausstellungen, die
abwechselnd schwerpunktmäßig für die jüngeren und die älteren Kinder und Jugendlichen
gestaltet werden.
Zum Teil werden die Ausstellungsthemen direkt von den Kindern und Jugendlichen
ausgesucht und mit vorbereitet und auch das Rahmenprogramm richtet sich teilweise nach
den Vorschlägen der Zielgruppe. In den Bemühungen der Kinder- und Jugendmuseen die
18
Kinder und Jugendlichen in die Planung und Durchführung mit einzubeziehen, wird
deutlich, dass diese sich in ihren Bedürfnissen und Erwartungen ernst genommen fühlen
sollen (vgl. König 2002, S. 93).
Im Vordergrund stehen im Kinder- und Jugendmuseum nicht die Objekte, sondern vor
allem die Tätigkeiten und das eigene Handeln. Von den Aufgaben der Museen liegt der
Schwerpunkt jener Museen auf dem Vermitteln und Bilden (vgl. Schreiber 1998, S.22).
Im Unterschied zu den traditionellen Museen, die ihre Objekte in Ausstellungen nach
wissenschaftlichen Kriterien gliedern und präsentieren und versuchen die Vergangenheit
darzustellen, arbeiten Kinder- und Jugendmuseen vorrangig programmorientiert.
Ausstellungsobjekte werden nach den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen und nach ihrem Entwicklungsstand ausgewählt. Inhaltlich und thematisch
wird ein enger Bezug zur lebensweltlichen Erfahrung hergestellt (vgl. Schreiber 1998,
S. 23f). Dieser Bezug zur alltäglichen Lebenswelt und zu aktuellen Phänomenen schlägt
sich auch in den Ausstellungstiteln nieder. So wurde z.B. die Ausstellung über Probleme
von Personen mit Behinderungen ,,What if you couldn´t..." genannt und nicht ,,Problems
of disabled people in our world". Kinder und Jugendliche fühlten sich dadurch persönlich
angesprochen, das Thema wurde somit für sie interessanter und sie konnten selbst erleben,
wie es ist eine Behinderung zu haben und die Probleme der jeweiligen Behinderungen in
unserer Welt durch eigenes Ausprobieren erfahren.
Die Kinder- und Jugendmuseen gehen von der Gegenwart aus, weil diese für die Kinder
und Jugendlichen eine vertraute Basis darstellt, von der aus sie an die Vergangenheit oder
die Zukunft bzw. an andere Kulturen und alles, was dem Kind fremd ist, herangeführt
werden können. Die Aneignung dieser fremden Themen geschieht durch das Spiel bzw.
den handelnden Umgang mit den Dingen (vgl. Kolb 1983, S. 27).
Während traditionelle Museen häufig als Ort der Beschaulichkeit und Stille beschrieben
werden, bezeichnet Popp (1993, S. 6) die Kinder- und Jugendmuseen als ,,Ort zwischen
Kindergarten und Disneyland", in dem ,,Spiel- und Lernsituationen für Kinder, Jugendliche
und Eltern so angeboten [werden], daß Lernen Spaß macht". Lernen soll hier ein Lernen
mit allen Sinnen sein, das Kinder- und Jugendmuseum ein lebendiges Experimentier- und
Erfahrungsfeld, welches versucht die Welt für die Kinder verständlicher zu machen. Das
dahinterstehende Konzept ist das des entdeckenden Lernens, des ,,Learning by doing" bzw.
19
der Handlungsorientierung. Dies alles sind Schlagwörter für die vorherrschenden
Vermittlungsmethoden in Kinder- und Jugendmuseen. Wissen soll auf spielerische und
interaktive Art und Weise vermittelt werden (vgl. König 2002, S. 9) und nicht durch reine
Wissensvermittlung im Sinne des Frontalunterrichts.
König (2002, S. 93) führt des Weiteren aus, dass die Kinder- und Jugendmuseen als
außerschulische Bildungsorte neue Lernformen und erfahrungen bieten, welche den
Anspruch haben ,,Erkenntniswerte" mit ,,Erlebniswerten" zu verbinden. Der Begriff
Edutainment, der sich aus den Begriffen ,,Entertainment" für Unterhaltung und
,,Education" für Bildung zusammensetzt, beschreibt dies am treffendsten.
,,Die vorherrschende Form von Lernen und Erfahrung [...] ist die tätige, und nach
Möglichkeit selbstbestimmte Aneignung durch die Besucher selbst." (Liebich 1995, S. 148
[Hervorheb. im Original]). Ziel ist es durch die praktischen Tätigkeiten das Interesse der
Kinder und Jugendlichen zu wecken und sie an die Thematik heranzuführen. Der
unmittelbare Kontakt zu den Objekten soll ein spielerisches Lernen auslösen und die
Möglichkeit bieten eigene Entdeckungen und Erfahrungen zu machen (vgl. Schreiber
1998, S.24).
Zur besseren Übersicht habe ich noch einmal die wichtigsten Kriterien der Kinder- und
Jugendmuseen in einem Schaubild zusammengestellt:
Abbildung 2
Kinder- und
Jugendmuseen
Übergeordnetes Ziel:
Kindern und Jugendlichen die Welt näher bringen und sie ihnen
verständlicher machen.
Schwerpunkt:
Vermitteln & Bilden
Orientierung an
der Zielgruppe
Konsequente Orientierung
an den Interessen und
Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen
Partizipation bei der
Planung und Gestaltung
von Ausstellungen
Kinder und Jugendliche
stehen im Mittelpunkt
Selbstbestimmter und
handlungsorientierter
Umgang mit den Dingen
Verknüpfung zwischen
Lernen und Unterhaltung
Interaktiv gestaltete
Mitmach-Ausstellungen
20
Hands on!
Da besonders auch der Hands on! - Ansatz eine der verbreitetesten Methoden der
Vermittlung in Kinder- und Jugendmuseen ist, werde ich diesen hier noch genauer
erläutern.
Der methodische Ansatz des Hands on!, also des Anfassen und Begreifens, leitet sich aus
der Zielgruppenorientierung der Kinder- und Jugendmuseen ab und unterscheidet sich sehr
wesentlich von dem rezeptiven Ansatz der traditionellen Museen. Besucher werden bei
diesem Ansatz dazu aufgefordert sich durch Partizipation und Interaktion an der
Ausstellung zu beteiligen.
Viele der traditionellen Verbote in Museen sind in den Kinder- und Jugendmuseen
aufgehoben. Die Kinder und Jugendlichen können alles berühren, sich frei bewegen, was
auch das Toben mit einbindet, und werden auch nicht dazu angehalten still zu sein.
Das Museumspersonal ist beim Prozess des Entdeckens und Lernens als Helfer und
Animateur gefragt, welcher auf Objekte aufmerksam machen, Fragen beantworten und
Informationen und Aktivitäten anbieten soll (vgl. Schreiber 1998, S.25).
Kinder und Jugendliche sollen nach Schreiber (ebd., S. 31) durch den selbstbestimmten
und handlungsorientierten Umgang mit den Dingen begreifen, wie etwas funktioniert und
die Zusammenhänge in der Welt verstehen lernen.
Im Laufe der Zeit wurde dieser Ansatz durch das Schlagwort ,,Minds on!" erweitert, da
Anfassen alleine den Kindern und Jugendlichen nicht bei der Verständlichmachung der
Welt hilft und auch keine Qualität darstellt (vgl. König 2002, S. 98f). Erst wenn ,,Hands
on!" und ,,Minds on!" kombiniert werden, wird der Doppeldeutigkeit des Begriffs
,,Begreifen" Rechnung getragen.
3.1.1.
Typen von Kinder- und Jugendmuseen
In Deutschland gibt es viele verschiedene Typen von Kinder- und Jugendmuseen.
Zum einen gibt es Kinder- und Jugendmuseen, die an andere traditionelle Museen
angegliedert sind. Meistens sind diese thematisch, verwaltungstechnisch und finanziell mit
dem Hauptmuseum verbunden (vgl. Schreiber 1998, S. 112). Zu dieser Kategorie gehören
z.B. das Kindermuseum des Historischen Museums in Frankfurt, das Kinderreich des
Deutschen Museums München und das Jugend Museum Schöneberg.
21
Des Weiteren gibt es mobile Kinder- und Jugendmuseen. Diese haben außer Verwaltungs-,
Büro- oder Lagerräumen keine festen Räumlichkeiten, in denen Ausstellungen oder
Aktivitäten durchgeführt werden könnten (vgl. Schreiber 1998, S. 113). Das Mobile
Kindermuseum FZH Vahrenwald und das Museum unterwegs Meißen e.V. arbeiten z.B.
nach diesem Prinzip und fahren mit ihren Ausstellungen zu den Besuchern.
Zur dritten Gruppe, der temporär arbeitenden Kinder- und Jugendmuseen, gehören alle
Initiativen, die zunächst durch Ausstellungen in angemieteten Räumlichkeiten auf sich
aufmerksam machen bzw. ihr Konzept in der Praxis erproben wollen (vgl. Schreiber 1998,
S. 113). Die Initiative Kindermuseum Bielefeld e.V. fällt in diese Kategorie, ebenso wie
die Initiative Kinder- und Jugendmuseum Bonn e.V..
Neben diesen drei Gruppen gibt es nach Schreiber (1998, S. 113) noch die eigenständigen
Kinder- und Jugendmuseen, die über eigene Räumlichkeiten verfügen und sich unabhängig
von anderen Einrichtungen verwalten. Das Atlantis in Duisburg und das Labyrinth
Kindermuseum Berlin gehören in diese Kategorie.
Obwohl auch die Science Center nach ähnlichen Prinzipien wie die Kinder- und
Jugendmuseen arbeiten, sind sie nicht den Museen zuzurechnen, da es ihnen eher um die
Veranstaltung unterhaltender Aktivitäten geht, während die Museen einen Bildungs- bzw.
Ästhetikanspruch haben. In den Science Centern, von denen es mittlerweile weltweit mehr
als 400 gibt, wird versucht ein modernes Museumskonzept umzusetzen, welches die
Besucher zu eigenständige n und spielerischen Experimentieren anregen soll, um ihnen so
technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Phänomene nahe zu bringen
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Science_Center).
Als erstes Science Center wurde 1969 das Exploratorium in San Francisco eröffnet. In
Deutschland sind besonders das Universum Bremen und die Phänomenta bekannt. Letztere
ist sogar in vier Orten vertreten: Flensburg, Lüdenscheid, Peenemünde und Bremerhaven.
3.1.2.
Ziele und Aufgaben
Übergeordnetes Ziel der Kinder- und Jugendmuseen ist es Kindern und Jugendlichen einen
Zugang zu Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik zu ermöglichen (vgl. König 2002, S.
9), um ihnen so die Welt begreifbarer und verständlicher zu machen. Ihre Hauptaufgabe
liegt somit im Bereich der Bildung und Vermittlung von Wissensinhalten.
22
Die Museen wollen den Kindern und Jugendlichen aber auch den Familien ein Angebot
machen ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Gleichzeitig wollen sie auch eine Begegnungs-
und Kommunikationsstätte sein. Daher reagieren sie mit ihrem Programm und ihren
Ausstellungen ebenso auf aktuelle lebensweltliche Ereignisse als auch auf das kommunale
Geschehen. Sie wollen einen Rahmen schaffen, indem Kinder und Jugendliche dem, ihnen
zunächst Unbekannten, begegnen können und sich auf eine spielerische Art und Weise
selbsttätig damit auseinander setzen können (vgl. Schreiber 1998, S. 34f). Innerhalb dieses
Rahmens können die Kinder und Jugend lichen ihre praktischen und problemlösenden
Fähigkeiten erproben und ein kreatives Denken entwickeln (vgl. Kolb 1983, S. 75).
Nach Kolb (ebd., S. 74f) wollen die Kinder- und Jugendmuseen durch ihre Angebote die
Entwicklung von Wertschätzung an Kunst, Handwerk und Wissenschaft fördern. Ebenfalls
sollen individuelle, vielleicht bisher unentdeckte, Talente und Interessen der Kinder und
Jugendlichen entwickelt und diese zu permanenten Hobbys gemacht werden.
Indirekt führt dies auch zu einer Verhinderung der Jugendkriminalität, da Kinder und
Jugendliche, die ein oder mehrere Hobbys haben, denen sie nachgehen können, seltener
straffällig werden (vgl. ebd., S. 74f). Natürlich darf man dabei nicht vernachlässigen, dass
Kriminalität ein multikausales Problem ist und daher viele Ursachen haben kann.
Durch die Integration der Kinder und Jugendlichen bei der Ausstellungsvorbereitung und
auch im handelnden Umgang mit den Dingen selbst, werden ihre Neugier und ihre
Kreativität gefördert. Gleichze itig werden Freiräume geschaffen in denen sie sich entfalten
und verwirklichen können (vgl. König 2002, S. 38).
Zusammenfassend kann man sagen, Kinder und Jugendliche sollen in diesen Museen ihre
eigene und fremde Kulturen kennen lernen, auf Zusammenhänge in Wissenschaft und
Technik aufmerksam gemacht werden und diese begreifen, um so einen Zugang zur Welt
der Erwachsenen zu bekommen und sich in dieser zurechtzufinden (vgl. Schreiber 1998, S.
35).
Neben dieser Aufgabe haben es sich die Kinder- und Jugendmuseen teilweise auch zur
Aufgabe gemacht die Schulen und andere Bildungseinrichtungen in ihrem Bildungsauftrag
zu unterstützen, sei es durch die speziell vorbereiteten Besuche im Museum oder die
mobilen Angebote der Museen, mit denen sie direkt in die Schulen gehen können. Die
Ausstellungen und das Rahmenprogramm werden des Weiteren meist interdisziplinär und
nicht nach einzelnen Themengebieten gestaltet mit dem Ziel die Anknüpfungspunkte zur
gesamten Umwelt exemplarisch zu erfassen (vgl. Schreiber 1998, S. 36).
23
Kinder- und Jugendmuseen gewinnen nach König (2002, S. 38) immer mehr an Bedeutung
und werden zu wichtigen Erlebnis- und Erfahrungsorten, die sich die Aufgabe gesetzt
haben, Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten Erfahrungen zu machen, die
frühere Generationen ganz natürlich in ihrem sozialen Umfeld machen konnten (auf diesen
Punkt gehe ich in einem späteren Kapitel ausführlicher ein und werden ihn daher an dieser
Stelle nicht behandeln). Natürlich können sie kein Ersatz für die unmittelbaren
Erfahrungen sein, aber dennoch bieten sie eine Kompensationsform, die Schulen so nicht
leisten können.
Laske (1992, S. 96) beschreibt treffend, was der Unterschied zwischen dem Lernen in
einem Kinder- und Jugendmuseum und dem Lernen in der Schule ist: ,,Wieviel Chancen
stecken unter Umständen in einer Pädagogik, die andersherum anfängt, die nicht mit dem
Kopf erklärt, was man vielleicht fühlt oder riecht, sondern die eben erst einmal fühlt,
riecht, hört oder be-greift, um dann dadurch zu sehen und zu begreifen und erklärt zu
bekommen."
Des Weiteren berichtet sie von Berichten vieler Lehrer und Lehrerinnen, die bemerken,
dass während der museumspädagogischen Programme häufig diejenigen Schülerinnen und
Schüler aufblühten und allen überlegen waren, die im Schulunterricht zu den
Schlusslichtern gehören.
Grundsätzlich müssen sich Kinder- und Jugendmuseen nach den Bedürfnissen ihrer
Zielgruppe, den Besuchern zwischen vier und 14 Jahren, richten und für diese erreichbar
und attraktiv sein. Des Weiteren sollten sie ein Ausstellungsort für Kinder und auch von
Kindern sein, da die Mitgestaltung enorm wichtig ist, um nicht nur eine Bildungsstätte,
sondern auch eine Freizeitstätte zu sein (vgl. Bochning 1997, S. 91).
Abschließend kann man die Ziele und Aufgaben in dem Wahlspruch des Phoenix Family
Museums zusammenfassen:
"A place where children play to learn and grown-ups learn to play!"
24
3.1.3.
Theoretische Wurzeln der Grundkonzeptionen der Kinder- und
Jugendmuseen
In diesem Kapitel habe ich die Theorien einzelner Pädago gen und Psychologen, auf deren
Erkenntnisse die Grundkonzeptionen der Kinder- und Jugendmuseen zurückgehen, kurz
zusammengefasst. Diese Auflistung ist keineswegs vollständig, sondern gibt lediglich eine
Auswahl derjenigen Personen an, die man als grundlegend für die Theorien der Kinder-
und Jugendmuseen bezeichnen kann. Die Liste lässt sich um viele moderne Pädagogen,
Psychologen und andere ergänzen.
Zu jedem der vorgestellten Personen gebe ich einen kurzen Überblick über ihre Theorie,
um diese dann im Anschluss auf das Kindermuseum und seine Arbeit zu beziehen.
John Dewey
Abbildung 3
1
Der Amerikaner John Dewey (1859-1952) ist heutzutage vor allem bekannt im
Zusammenhang mit dem Schlagwort ,,Learning by doing".
Der Fachausdruck ,,Learning by doing" wurde von Robert Baden-Powell, dem Gründer der
Pfadfinderbewegung, geprägt. John Dewey gilt jedoch als wesentlicher Begründer dieses
Ansatzes, in dem er Handlungsorientierung und Erfahrungsorientierung verknüpft hat (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Learning_by_Doing).
Die Entwicklung dieses Erziehungsgedankens hat sich im Laufe seines Lebens aus der
Erfahrung entwickelt, dass er eine Beeinflussung seiner Persönlichkeit eher durch
Personen und Situationen als durch Bücher wahrgenommen hat.
Er gelangte zu der ,,Überzeugung, dass die bestehenden Erziehungsmethoden [...] nicht in
Übereinstimmung waren mit den psychologischen Prinzipien einer normalen
Entwicklung." (Krenzer 1984, S. 140). Diese Überzeugung führte zu dem Verlangen nach
einer Schule, die ,,psychologische Prinzipien des Lernens mit dem Prinzip der
1
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:John_Dewey.jpg
25
kooperativen Zusammenarbeit" (ebd.) vereinen soll. Da für Dewey die Erziehung eine
Entwicklung von, durch und für Erfahr ung ist, sollte es in dieser Schule primär nicht um
die Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern um die Vermittlung
von Erfahrungen gehen, eben dem so oft zitierten ,,Learning by doing" (vgl. Krenzer 1984,
S.141ff).
Das von Dewey entwickelte ,,Learning by doing" ist heute noch immer ein Grundgedanke
aller Kinder- und Jugendmuseen. In jedem dieser Museen findet man Möglichkeiten aktive
Erfahrungen durch Ausprobieren und Experimente zu machen, aus denen man etwas für
sein eigenes Leben und Lernen mitnehmen kann. Die Kinder und Jugendlichen werden so
immer wieder neu zum Staunen gebracht. Die Themen dort sind des Weiteren eingebunden
in einen übergeordneten Kontext, der dem Ziel dient, die Zusammenhänge der Welt
verständlich zu machen (vgl. Schreiber 1998, S.42).
Celestine Freinet
Abbildung 4
2
Der Pädagoge Celestine Freinet (1896-1966) hat sein Leben lang an der inneren Reform
der Schule und des Unterrichts gearbeitet. Schlagwörter sind in diesem Zusammenhang
Freiarbeit, Gesamtunterricht, Gruppenunterricht und die Orientierung der Schularbeit an
den Interessen des Kindes (vgl. Koch 2000, S. 146).
Auch Freinets Ideen begründen sich, ebenso wie Deweys, aus eigenen Erfahrungen.
Freinets Erfahrungen in der Schule mit der Kargheit der Räume, dem autoritären Umgang
der Lehrer mit den Schülern und den eintönigen Unterrichts- und Lernmethoden, ließen ihn
schon früh den Schulbesuch und das Lernen als unangenehm empfinden (vgl. Koch 2000,
S. 147). In seiner Rolle als Lehrer versuchte er demnach die Schule räumlich und inhaltlich
zu öffnen. In seinem Unterricht, der häufig im Freien stattfand, lernten die Kinder durch
Beobachtung und nicht aus Büchern.
2
Quelle: http://aks-info.bei.t-online.de/leit.html
26
Die Druckerei und die Klassenkorrespondenz sind zwei der bekanntesten Elemente der
Erneuerung der pädagogischen Praxis durch Freinet. Die Kinder lernten durch die
Klassendruckerei ,,nicht nur lesen und schreiben, sondern wurden auch motiviert, sich
schriftlich auszudrücken und sich gut verständlich mitzuteilen." (Koch 2000, S. 152). Bei
der Herstellung der Klassenzeitung mussten die Kinder nicht nur Einzelleistungen bringen,
sondern es wurde auch erwartet, dass sie die Fähigkeit entwickelten sich in der Gruppe mit
den unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen des Einzelnen auseinander zu setzen.
Die Rolle des Lehrers spielte eine untergeordnete Rolle. Auch er hatte bei entscheidenden
Abstimmungen nur eine Stimme und war den Schülern gleichwertig (vgl. Koch 2000, S.
153).
Für die Betrachtung der Freinet-Pädagogik in Verbindung mit der Praxis in den heutigen
Kinder- und Jugendmuseen ist besonders Freinets Aufteilung der Schule in acht Ateliers
von Bedeutung.
Es gab vier Ateliers für elementare Arbeiten:
,,1. Atelier: Feldarbeit, Tierzucht;
2. Atelier: Schmiede und Schreinerei;
3. Atelier: Spinnerei, Weberei, Nähwerkstatt, Küche, Hauswirtschaft;
4. Atelier: Bau, Mechanik, Handel." (Koch 2000. S. 154)
Um den Schülern die Vermittlung mit dem Handwerkszeug zu ermöglichen, ist es nötig,
dass der Lehrer selbst sich die Informationen darüber besorgt bzw. die Arbeiter und
Handwerker in die Schule einlädt. Dadurch wird die ,,Verbindung von Schule und Leben,
Lehrern und Eltern [...] zusätzlich gestärkt." (Koch 2000, S. 154).
Außer den vier Ateliers für elementare Arbeiten gibt es noch vier weitere Ateliers für
differenziertere soziale und intellektuelle Beschäftigungen:
,,5. Atelier: Forschung, Wissen, Dokumentation;
6. Atelier: Experimentieren;
7. Atelier: Kreativität, graphischer Ausdruck und Kommunikation;
8. Atelier: Kreativität, künstlerischer Ausdruck und Kommunikation." (Koch 2000,
S. 154)
Im 5. Atelier befindet sich eine von den Kindern selbst erstellte Dokumentensammlung. Es
gibt dort Lexika, eine kleine Arbeitsbibliothek, Landkarten, Schallplatten, Filme etc..
Beim Experimentieren geht es um Botanik und Zoologie und um chemische und
physikalische Vorgänge. Die Kinder finden hier z.B. Aquarien und Terrarien, Mikroskope
und alles was sie benötigen um chemische und physikalische Grundlagenexperimente
27
durchzuführen. Die beiden letztgenannten Ateliers beschäftigen sich mit der
Schuldruckerei, verschiedenstem Lese- und Schreibmaterial und mit Gesang, Musik,
Theater und Puppenspiel.
Auch in den Kinder- und Jugendmuseen wird versucht die Welt (der Erwachsenen) für die
Kinder verständlich und sie durch Demonstrationen und Workshops begreifbar zu machen.
Die Kreativität und der Facettenreichtum der durchaus sehr unterschiedlichen Konzepte
der Kinder- und Jugend museen lassen sich in den Ateliers nach Freinet wiederfinden.
Themen der Kinder- und Jugendmuseen sind z.B. Alltagsgegenstände, Musik, Theater,
physikalische Phänomene, Natur und Umwelt etc..
Schaut man sich die Prinzipien der Freinet-Pädagogik an, die Ingrid Dietrich in ihrem
Buch ,,Handbuch Freinet-Pädagogik" zusammengefasst hat, kann man klare
Übereinstimmungen mit der Praxis der Kinder- und Jugend museen finden. So z.B. das
Recht der Schüler auf ihren eigenen Lernprozess und die Selbstbestimmung des eigenen
Lernrhythmus (vgl. Dietrich 1995, S. 27). Auch die Kinder- und Jugendmuseen lassen dem
Individuum die Freiheit zu entscheiden, welche Themen für es von Bedeutung sind und mit
welchen es sich auseinandersetzen möchte. Hier soll das Lernen ebenso wie in der Freinet-
Pädagogik ,,kein Zwang sein, der mit Verdruß und Ärger verbunden ist, sondern Lernen
soll Freude machen und mit Erfolgserlebnissen verbunden sein." (Dietrich 1995, S. 27).
Als letztes Beispiel möchte ich die Anleitung zu eigenen Fragestellungen und kritischen
Untersuchungen nennen, die dem Kind helfen sollen eige nständiges Denken zu lernen.
Dieser Punkt taucht in vielen Konzepten der Kinder- und Jugendmuseen ebenso auf, wie in
Dietrichs Liste der Prinzipien der Freinet-Pädagogik.
Wie hier an einigen Beispielen gezeigt wurde, kann man sagen, dass viele Prinzipien der
Freinet-Pädagogik auch in der Arbeit der Kinder- und Jugend museen umgesetzt werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832490287
- ISBN (Paperback)
- 9783838690285
- DOI
- 10.3239/9783832490287
- Dateigröße
- 34.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Oktober)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- kindermuseum children museum pädagoge museumspädagogik science center
- Produktsicherheit
- Diplom.de