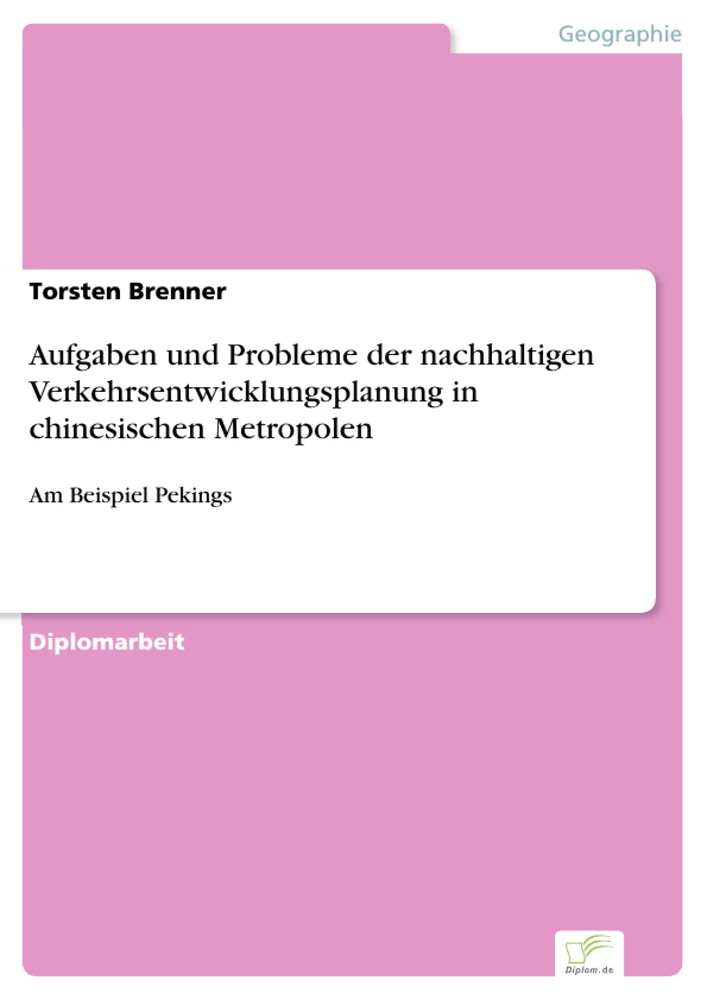Aufgaben und Probleme der nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplanung in chinesischen Metropolen
Am Beispiel Pekings
©2004
Diplomarbeit
202 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
China ist ein schlafender Drache, lasst ihn schlafen, denn wenn er sich erhebt, erzittert die Welt. (Napoléon Bonaparte)
Nach 30-jähriger Planwirtschaft, welche nach der Gründung der Volksrepublik China die wirtschaftliche Vitalität des Landes erheblich behinderte, wurde nach dem Tod Mao Zedongs eine umfassende Reformierung des Wirtschaftssystems unter dem Banner einer Sozialistischen Marktwirtschaft in China eingeleitet. Der schrittweise Übergang zu einer immer stärkeren marktwirtschaftlichen Orientierung und die Öffnung des Landes für ausländische Investitionen hat erhebliche wirtschaftliche Wachstumskräfte im Land freigesetzt.
Die Volksrepublik China hat sich inzwischen zur weltweit sechstgrößten Volkwirtschaft und zur fünftgrößten Exportnation entwickelt. Mit der weltweit zweitgrößten Devisenreserve von über 316 Mrd. US-Dollar ist China zu einer ernstzunehmenden Größe in der Weltwirtschaft und Weltpolitik geworden. Ausländische Investoren haben allein im Jahr 2003 fast 500 Mrd. US-Dollar in der Volksrepublik China investiert. Im Jahr 2003 verzeichnete die Volksrepublik China ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 9,1% gegenüber dem Vorjahr. Für 2004 ist trotz der Rückschläge durch die Vogelgrippe SARS ein weiteres Wachstum von 9,5% prognostiziert. Mit einem Bruttosozial-produkt von 1,16 Billionen USDollar liegt sie damit weltweit auf dem 6. Rang zwischen Frankreich und Italien.
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist der mittlerweile erwachte Drache, mit einem Pro-Kopf-Einkommen von knapp über 1000 US-Dollar pro Jahr, weiterhin auch das weltweit größte Entwicklungsland. Im Stadt-Land-Vergleich ist nach wie vor ein gravierendes Einkommensgefälle zu verzeichnen. In China leben 1,29 Milliarden Menschen auf einer Fläche von rund 9,6 Mio. Quadratkilometern. Dies entspricht etwa 20% der Erdbevölkerung. Das derzeitige Bevölkerungswachstum liegt bei 0,6%, was einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 7,2 Mio. Menschen entspricht.
Kennzeichnend für die Volksrepublik China ist auch eine sehr ungleiche Verteilung der Bevölkerungsdichten. Kaum besiedelte, ländliche und strukturell unterentwickelte Regionen im westlichen Hinterland stehen einem küstennahen Streifen von Ballungsgebieten mit modernen Großstädten als wirtschaftliche Zentren des Landes gegenüber. Hier leben 39% der Gesamtbevölkerung lebt auf weniger als 6% der Landesfläche. Die Bevölkerungsdichte in den Agglomerationsräumen beträgt durchschnittlich 700, in […]
China ist ein schlafender Drache, lasst ihn schlafen, denn wenn er sich erhebt, erzittert die Welt. (Napoléon Bonaparte)
Nach 30-jähriger Planwirtschaft, welche nach der Gründung der Volksrepublik China die wirtschaftliche Vitalität des Landes erheblich behinderte, wurde nach dem Tod Mao Zedongs eine umfassende Reformierung des Wirtschaftssystems unter dem Banner einer Sozialistischen Marktwirtschaft in China eingeleitet. Der schrittweise Übergang zu einer immer stärkeren marktwirtschaftlichen Orientierung und die Öffnung des Landes für ausländische Investitionen hat erhebliche wirtschaftliche Wachstumskräfte im Land freigesetzt.
Die Volksrepublik China hat sich inzwischen zur weltweit sechstgrößten Volkwirtschaft und zur fünftgrößten Exportnation entwickelt. Mit der weltweit zweitgrößten Devisenreserve von über 316 Mrd. US-Dollar ist China zu einer ernstzunehmenden Größe in der Weltwirtschaft und Weltpolitik geworden. Ausländische Investoren haben allein im Jahr 2003 fast 500 Mrd. US-Dollar in der Volksrepublik China investiert. Im Jahr 2003 verzeichnete die Volksrepublik China ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 9,1% gegenüber dem Vorjahr. Für 2004 ist trotz der Rückschläge durch die Vogelgrippe SARS ein weiteres Wachstum von 9,5% prognostiziert. Mit einem Bruttosozial-produkt von 1,16 Billionen USDollar liegt sie damit weltweit auf dem 6. Rang zwischen Frankreich und Italien.
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist der mittlerweile erwachte Drache, mit einem Pro-Kopf-Einkommen von knapp über 1000 US-Dollar pro Jahr, weiterhin auch das weltweit größte Entwicklungsland. Im Stadt-Land-Vergleich ist nach wie vor ein gravierendes Einkommensgefälle zu verzeichnen. In China leben 1,29 Milliarden Menschen auf einer Fläche von rund 9,6 Mio. Quadratkilometern. Dies entspricht etwa 20% der Erdbevölkerung. Das derzeitige Bevölkerungswachstum liegt bei 0,6%, was einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 7,2 Mio. Menschen entspricht.
Kennzeichnend für die Volksrepublik China ist auch eine sehr ungleiche Verteilung der Bevölkerungsdichten. Kaum besiedelte, ländliche und strukturell unterentwickelte Regionen im westlichen Hinterland stehen einem küstennahen Streifen von Ballungsgebieten mit modernen Großstädten als wirtschaftliche Zentren des Landes gegenüber. Hier leben 39% der Gesamtbevölkerung lebt auf weniger als 6% der Landesfläche. Die Bevölkerungsdichte in den Agglomerationsräumen beträgt durchschnittlich 700, in […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9019
Brenner, Torsten: Aufgaben und Probleme der nachhaltigen Verkehrsentwicklungs-
planung in chinesischen Großstädten - am Beispiel Pekings
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Technische Universität Berlin, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Abstract
1
Abstract
This thesis deals with the requirements and problems posed by
the current situation in Chinese metropolis with regard to a sus-
tainable traffic development planning under the circumstances of
the rapid economic and urban growth of the recent years. At pre-
sent already, the fast progressing motorization of the population
burdens the existing urban traffic systems to their limit and thus
requires sustainable and quickly realizable solutions. This thesis
focuses on the analysis of the existing problems, examines the
most recent planning as well as the solutions provided by the local
players and describes approaches for action in terms of urban and
traffic planning.
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Anforderungen und
Problemen, welche die aktuelle Situation in chinesischen Metropo-
len an eine nachhaltige Verkehrsentwicklungsplanung unter den
Bedingungen des rasanten Wirtschafts- und Städtewachstums der
letzten Jahre stellt. Die schnell voranschreitende Motorisierung der
Bevölkerung belastet schon heute bestehende, städtische Ver-
kehrssysteme bis an ihre Grenzen und erfordert zukunftsfähige
und schnell realisierbare Lösungskonzepte. Diese Arbeit analysiert
die Ausgangsproblematik, untersucht die jüngere Planungsweise
und Konzepte der lokalen Akteure und beschreibt Handlungsan-
sätze in stadt- und verkehrsplanerischer Hinsicht.
Danksagung
2
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich all jenen danken, die durch ihre fachli-
che und persönliche Unterstützung, ihre Anregungen und Diskus-
sionen zu dieser Diplomarbeit beigetragen haben.
Besonderer Dank gebührt meinem Vater, der mir einen Peking-
Aufenthalt für die Recherche vor Ort ermöglicht hat.
Außerdem danke ich Herrn Sun Changning, der mich während
meines Aufenthalts in Peking begleitet und fachkundig geführt hat.
Ich danke Herrn Ing. Zheng Meng vom Beijing Municipal Institute
of City Planning & Design für unser fachliches Gespräch und die
freundliche Überlassung zahlreicher Unterlagen.
Mein Dank gilt außerdem der Ingenieurgesellschaft Dr. Brenner +
Münnich mbH für die Überlassung zahlreicher Unterlagen und dort
insbesondere Frau Hongfang Zhao und Herrn Bei für die Überset-
zung meiner zahlreichen chinesischsprachigen Texte.
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit...5
2
Die Stadt Peking und ihre verkehrlichen Probleme ...12
3
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings ...16
3.1
Stadtentwicklung...16
3.1.1
Die traditionelle chinesische Stadt ...17
3.1.2
Entwicklungen im 20. Jahrhundert ...22
3.1.3
Entwicklungen in Folge der wirtschaftlichen Liberalisierung...27
3.2
Mobilität und Verkehr ...33
3.2.1
Motorisierung, Mobilität und Verkehrsaufkommen...33
3.2.2
Verkehrsangebote und Verkehrsinfrastruktur ...40
3.3
Vergleiche mit Großstädten westlicher Industrieländer ...46
3.4
Folgerungen...50
4
Zustandsbeschreibung am Beispiel des Zhongguancun Science & Technology Parks,
Haidian District, Peking...52
4.1
Hinweis ...52
4.2
Bedeutung, Lage und Merkmale des Beispielraums und Einordnung in das
Gesamtverkehrssystem Pekings ...52
4.3
Struktur und Flächennutzung...61
4.4
Zustandsbeschreibung der Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrsablaufes ...65
4.4.1
Straßennetzstruktur und Gestaltung ...65
4.4.2
Anlagen des ruhenden Verkehrs ...73
4.4.3
Öffentliches Verkehrsangebot und Abwicklung des öffentlichen Personenverkehrs
77
4.4.4
Verkehrsaufkommen und Verkehrsablauf des straßengebundenen Verkehrs ...87
4.4.5
Organisation und Steuerung des straßengebundenen Verkehrs...100
4.5
Auswirkungen auf Kapazität und Auslastung der Verkehrssysteme ...103
4.6
Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl und das Verkehrsverhalten ...105
5
Prognosen zukünftiger Entwicklungen...107
5.1
Tendenzen zukünftiger Stadt- und Bevölkerungsentwicklung Pekings ...107
5.2
Prognosen für die verkehrliche Entwicklung Pekings ...113
5.3
Risiken der künftigen Entwicklungen ...120
6
Handlungskonzepte lokaler Akteure ...123
6.1
Administrative Strukturen und Zuständigkeiten ...123
6.2
Ziele, Leitbilder und Konzepte der Stadt- und Verkehrsplanung ...127
6.2.1
Grundsätzliches Planungsverständnis ...127
6.2.2
Übergeordnete Ziele und Leitbilder...129
6.2.3
Konzeptionelle Umsetzung und reale Planungspraxis...133
6.3
Verdeutlichung am Beispiel des Zhongguancun Science & Technology Parks, Haidian
District, Peking...135
6.3.1
Entwicklungsziele...135
6.3.2
Masterplan ...136
6.3.3
Fachpläne und Teilkonzepte ...141
6.3.4
Wirkungsprognosen und Zielerreichung ...149
7
Bewertung und Handlungserfordernisse...153
7.1
Vorbemerkung ...153
7.2
Problemwahrnehmung und Planungsverständnis ...154
7.3
Administrative Defizite und interdisziplinäres Planen ...156
7.4
Wirkungsbasierende Planungsmethoden ...157
7.5
Verdeutlichung am Beispiel des Zhongguancun Science & Technology Parks, Haidian
District, Peking...158
7.5.1
Festlegung von Planungsrichtwerten und Wirkungszielen ...158
Inhaltsverzeichnis
4
7.5.2
Abstimmung der Verkehrsplanung mit der Stadt-entwicklungs- und der
Flächennutzungsplanung ...161
7.5.3
Erfordernisse bei der Entwicklung und Entwurfsgestaltung des Straßennetzes.162
7.5.4
Weiterentwicklung und Betrieb des öffentlichen Verkehrssystems...164
7.5.5
Maßnahmen im Bereich des ruhenden Verkehrs ...167
7.5.6
Erfordernisse bezüglich der Verkehrssteuerung, des Verkehrsmanagements, der
Bereitstellung von Verkehrsinformationen und der Beeinflussung der Verkehrsnachfrage169
7.5.7
Erforderliche Veränderungen im Verkehrsverhalten, Verkehrsüberwachung...175
8
Zusammenfassende Folgerungen und Empfehlungen ...176
I. Abbildungsverzeichnis ...178
II. Tabellenverzeichnis...180
III. Abkürzungsverzeichnis ...181
IV. Literaturverzeichnis und Linkverzeichnis...182
V. Stichwortverzeichnis ...194
VI. Erklärung...200
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
5
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
,,China ist ein schlafender Drache, lasst
ihn schlafen, denn wenn er sich erhebt,
erzittert die Welt."
1
(Napoléon Bonaparte)
Nach 30-jähriger Planwirtschaft, welche nach der Gründung der
Volksrepublik China
2
die wirtschaftliche Vitalität des Landes er-
heblich behinderte, wurde nach dem Tod Mao Zedongs
3
eine um-
fassende Reformierung des Wirtschaftssystems unter dem Banner
einer ,,Sozialistischen Marktwirtschaft"
4
in China eingeleitet. Der
schrittweise Übergang zu einer immer stärkeren marktwirtschaftli-
chen Orientierung und die Öffnung des Landes für ausländische
Investitionen hat erhebliche wirtschaftliche Wachstumskräfte im
Land freigesetzt.
Die Volksrepublik China hat sich inzwischen zur weltweit sechst-
größten Volkwirtschaft und zur fünftgrößten Exportnation entwi-
ckelt. Mit der weltweit zweitgrößten Devisenreserve von über 316
Mrd. US-Dollar ist China zu einer ernstzunehmenden Größe in der
Weltwirtschaft und Weltpolitik geworden.
5
Ausländische Investoren
haben allein im Jahr 2003 fast 500 Mrd. US-Dollar in der Volksre-
publik China investiert. Im Jahr 2003 verzeichnete die Volksrepu-
blik China ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 9,1%
gegenüber dem Vorjahr. Für 2004 ist trotz der Rückschläge durch
die Vogelgrippe SARS ein weiteres Wachstum von 9,5% prognos-
1
Napoléon Bonaparte, nach der Lektüre des Reiseberichtes des ersten offiziel-
len, königlich englischen Gesandten, Lord Macartney, nach China [1793]
2
Am 1. Oktober 1949
3
Mao Zedong (* 26. Dezember 1893 in Shaoshan (Hunan), 9. September
1976 in Peking) war Führer der kommunistischen Partei Chinas. Laut Maos Wi-
derspruchstheorie sollte eine andauernde Kulturrevolution zum Kommunismus
führen.
4
Definition: "Wirtschaftssystem, in dem ein marktwirtschaftliches Allokations-
system mit sozialistischem Eigentum an den Produktionsmitteln und einer inten-
siven Marktregulierung durch den Plan oder über kooperative Absprachen ver-
bunden wird." (Quelle: Böwer, Uwe: Die Außenwirtschaftspolitik der VR China)
5
Quelle: Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland: China Fakten.
Webseite.
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
6
tiziert.
6
Mit einem Bruttosozial-produkt von 1,16 Billionen US-
Dollar liegt sie damit weltweit auf dem 6. Rang zwischen Frank-
reich und Italien.
7
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist der mittlerweile erwachte
Drache, mit einem Pro-Kopf-Einkommen von knapp über 1000
US-Dollar pro Jahr, weiterhin auch das weltweit größte Entwick-
lungsland. Im Stadt-Land-Vergleich ist nach wie vor ein gravieren-
des Einkommensgefälle zu verzeichnen. In China leben 1,29 Milli-
arden Menschen auf einer Fläche von rund 9,6 Mio. Quadratkilo-
metern. Dies entspricht etwa 20% der Erdbevölkerung. Das der-
zeitige Bevölkerungswachstum liegt bei 0,6%, was einem jähr-
lichen Bevölkerungszuwachs von 7,2 Mio. Menschen entspricht.
8
Abbildung 1 Bevölkerungsdichte Chinas
Quelle:
Demographia-Online
6
Prognose: Goldman Sachs Research Inc.
7
Quelle: Ipos.de; Außenwirtschaftsportal des Bundesministeriums für Wirt-
schaft
8
Quelle: DSW-Datenreport "Weltbevölkerung 2003"; Weltbevölkerungsbericht
2003
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
7
Kennzeichnend für die Volksrepublik China ist auch eine sehr un-
gleiche Verteilung der Bevölkerungsdichten. Kaum besiedelte,
ländliche und strukturell unterentwickelte Regionen im westlichen
Hinterland stehen einem küstennahen Streifen von Ballungs-
gebieten mit modernen Großstädten als wirtschaftliche Zentren
des Landes gegenüber. Hier leben 39% der Gesamtbevölkerung
lebt auf weniger als 6% der Landesfläche. Die Bevölkerungsdichte
in den Agglomerationsräumen beträgt durchschnittlich 700, in den
Innenstadtbereichen Pekings bis zu 11.500, Einwohnern pro
Quadratkilometer während im gesamten Landesdurchschnitt 135
Personen pro Quadratkilometer gezählt werden. In den monofunk-
tionalen und dichtest besiedelten, städtischen Wohngebieten
Shanghais und Pekings, werden Spitzenwerte von 60.000 bis
90.000 Einwohner pro Quadratkilometer erreicht.
Heute, nach einer rasanten Wachstumsphase, verfügt China über
die vier Megastädte Chongquin, Shanghai, Peking und Tianjin
9
, 17
Städte zwischen 4 bis 9 Mio. Einwohner, sowie über 141 Städte
zwischen einer bis 4 Mio. Einwohnern.
Abbildung 2 Die größten Städte Chinas (1999)
Quelle: WirtschaftsWoche, Sonderausgabe China Nr. 1 vom 02.10.2003.
9
Peking: 13.900.000 Ew., Shanghai 16.870.000 Ew., Tianjin 9.480.000 Ew.
(Quelle: United Nations Population Devision: World Urbanization Prospects: The
2003 Revision)
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
8
Insbesondere die alten küstennahen Agglomerationen erlangten
im Zuge der wirtschaftlichen Modernisierung und der Öffnung des
Landes neue Bedeutung und erfuhren ein enormes Wachstum.
Die durch die städtische Bevölkerungsentwicklung hervorgerufe-
nen vielfältigen Probleme haben die chinesische Administration
veranlasst, nach einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Leitbild
für die urbane Entwicklung Ausschau zu halten. Dies war umso
mehr nötig, da bis 2020 die Mehrheit der chinesischen Bevölke-
rung in Städten leben soll. Von der chinesischen Regierung wird
die Verstädterung als wirksame Methode eingeschätzt, die Pro-
bleme der Arbeitslosigkeit und der erheblichen Einkommensunter-
schiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung zu lösen.
Die Urbanisierung als Prozess der Ansiedlung größerer Teile der
Bevölkerung in den Städten und der Bau einer darauf abgestimm-
ten Infrastruktur steht als strategisches Entwicklungsziel weit oben
auf der Agenda der chinesischen Regierung. Das zurzeit geltende
Entwicklungsleitbild stellt das Paradigma der ,,Metropolitan Interlo-
cking Region" dar, dem das Ziel zugrunde liegt, ein relativ stabiles
System von Marktorten, Klein- und Mittelstädten
10
Abbildung 3 Konzept der Metropolitan Interlocking Region
Quelle: Dr. Brenner + Münnich
10
In chinesischen Dimensionen.
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
9
in einer metropolitanen Großregion zu bilden, das auf engen Aus-
tausch- und Pendlerbeziehungen beruht und massive Land-Stadt-
Wanderungen zumindest innerhalb der Region vermeiden soll.
Die stürmische wirtschaftliche Entwicklung in der Volksrepublik
China hat naturgemäß das Gesicht vieler großer chinesischer
Städte radikal verändert. Den raschesten Wandel haben dabei
sicherlich die Städte Shanghai, Peking und Guangzhou
durchlaufen.
Auch wenn der Grad der Motorisierung in chinesischen Großstäd-
ten noch weit unter dem westlicher Metropolen liegt, führen die
enormen Nutzungsdichten innerhalb der Städte zu einem
Verkehrsaufkommen, das schon heute höher liegt als das in vielen
Großstädten westlicher Industrienationen. Obwohl es in ganz
China weniger Pkw gibt als im Großraum Los Angeles, gehört
Peking zu den weltweit am stärksten durch Luftschadstoffe ver-
schmutzten Städte. Neben der hohen Fahrzeugdichte gehören die
schlecht ausgerüsteten Fahrzeuge und die Qualität der Kraftstoffe
zu den Ursachen dieser Verschmutzungen.
Es ist Ziel der städtischen Regierung, bis zu den Olympischen
Spielen 2008 in Peking, die Messwerte für Schwefeldioxid,
Stickstoffoxid und Kohlenmonoxid auf die Standards der Weltge-
sundheitsorganisation WHO zu senken. Im Verkehrssektor sollen
nicht nur schärfere Abgasnormen nach der Euronorm III
11
durch-
gesetzt werden, sondern auch der heute erheblich funktional
beeinträchtigte Verkehrsfluss soll verbessert werden und der
Anteil des öffentlichen Verkehrs am täglichen Verkehrsgeschehen
wesentlich vergrößert werden. Denn trotz eines massiven
Ausbaus der Straßennetze in den vergangenen Jahren führt die
oft chronische Überlastung der Verkehrsinfrastruktur zu erhebli-
11
Europäischer Abgasstandard, der insbesondere in Bezug auf die NOx-
Emissionen gegenüber der geltenden Euronorm II verschärft wird. In Europa
noch nicht verpflichtend eingeführt.
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
10
chen Mobilitätseinschränkungen, die allein durch die weitere
Optimierung des Verkehrsnetzes nicht bewältigt werden können.
Die Dringlichkeit einer nachhaltigen, integrierten und nicht nur auf
den Pkw-Verkehr ausgerichteten Verkehrsentwicklungsplanung
wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass allein
in Peking mehr als 1.000 private Personenkraftwagen täglich neu
zugelassen werden und die chinesische Regierung eine weitere
Urbanisierung anstrebt.
In dieser Diplomarbeit soll auf die Probleme und Anforderungen
an eine nachhaltige und zukunftsfähige Verkehrsentwicklungs-
planung für chinesische Großstädte eingegangen werden und die-
se beispielhaft anhand des Zhongguancun Science & Technology
Parks im Haidian-District der chinesischen Hauptstadt Peking ana-
lysiert werden.
Das Zentralgebiet des Zhongguancun Science & Technology
Parks besitzt eine der höchsten Flächennutzungsdichten in ganz
China und konzentriert auf einer Fläche von 75 km² mit rund
200.000 zugelassenen Fahrzeugen rund 15% des Kraftfahrzeug-
bestandes der Stadt Peking. Das Beispielgebiet ist daher in ge-
wisser Weise prototypisch für die Entwicklungen, die sich zukünf-
tig in anderen chinesischen Verdichtungsregionen fortsetzen wer-
den.
Im Verlauf dieser Arbeit werden, nach einer Einführung in die
Stadt- und Verkehrsentwicklung der Stadt Peking und des Bei-
spielgebietes, die aktuelle verkehrliche Situation und die Planun-
gen und Handlungskonzepte lokaler Akteure im Beispielraum des
Haidian-Districts untersucht. Es werden Defizite analysiert, Hand-
lungserfordernisse aufgezeigt und diese vor dem Hintergrund der
unterschiedlichen Planungsphilosophien chinesischer und westli-
cher Planer bewertet. Abschließend werden Ansätze für eine
Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
11
nachhaltige und stadtgerechte Verkehrsentwicklung in Peking auf-
gezeigt.
Die Stadt Peking und ihre verkehrlichen Probleme
12
2 Die Stadt Peking und ihre verkehrlichen Probleme
Die Stadtentwicklung von chinesischer Metropolen der letzten
beiden Jahrzehnte ist einen historisch beispiellosen Prozess, der
nur in Superlativen fassbar ist.
Der Urbanisierungsboom und die Gleichzeitigkeit der Modernisie-
rungsprozesse sind mit der sogenannten ,,Industriellen Revolution"
in Europa nicht mehr vergleichbar und setzen das gewohnte
Vorstellungsvermögen sowie kommunale Planungsinstrumente
außer Kraft:
Der letzte Generalplan Pekings für die Zeit von 1991-2010 entwor-
fen, prognostizierte für 2010 eine Einwohnerzahl von 12,5 Mio.,
ein Wert, der allerdings schon Mitte der 1990er Jahre erreicht war.
Die Stadt Peking hat derzeit ca. 14 Mio. Einwohner und umfasst
eine Fläche von 16.800 km². Der urbane Stadtbereich umfasst
Fläche von 747,8 km², zählt 8,6 Mio. Einwohner und weist eine
Dichte von 11.520 Einwohner pro Quadratkilometer auf.
12
Die
Innenstadtbereiche auf einer Fläche von 87,1 km² weisen eine
Bevölkerungsdichte von durchschnittlich 30.500 Einwohner / km²
auf und beheimaten etwa 2,7 Millionen Einwohner Pekings.
13
Die
Stadt Peking ist damit weltweit die achtgrößte Metropole und
außerdem das administrative, politische und kulturelle Zentrum
des Landes.
Die Hauptstadt Chinas repräsentiert die chinesische Geschichte,
die feudale Vergangenheit und die kommunistische Tradition e-
benso wie ein kometenhaftes Wachstum mit all seinen Schatten-
seiten.
Das nachfolgende Satellitenbild zeigt die Stadt Peking in der Aus-
dehnung von 2001. Der größte Durchmesser beträgt 50 km.
12
Zum Vergleich: durchschnittliche Bevölkerungsdichte in Berlin 2.812 Ew./km².
13
Quelle: Demographia-Online, Beijing Population & Density 2003.
Die Stadt Peking und ihre verkehrlichen Probleme
13
Abbildung 4 Satellitenbild Peking 2001
Quelle: Boston University, Department of Geography
Ein Blick auf die Straßen der heutigen Stadt Peking offenbart ei-
nes der bedeutendsten und augenscheinlichsten Probleme dieser
rasanten Entwicklung:
Der Um- und Ausbau des historischen Straßennetzes und die
Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur konnte, trotz großer
Anstrengungen in den letzten Jahren, mit steigendem Wachstum,
Bevölkerungsdichte und der Zunahme der Motorisierung nicht
Schritt halten.
Die Stadt befindet sich im Dauerstau und trotzdem werden täglich
in der Stadt rund 1000 Autos neu zugelassen. Mangelnde Ausbil-
dung der jährlich etwa 350.000 Fahranfänger und geringe allge-
meine Verkehrsdisziplin, sowie das weitgehende Fehlen einer
technisch hochwertige, den westlichen Standards entsprechen-
den, Verkehrssteuerung führen zu einem erheblichen Chaos auf
Pekings Straßen.
Der öffentliche Personenverkehr in Peking ist chronisch überlaste-
te und basiert in weiten Teilen der Stadt nur auf Bussen, welche
die Probleme des übrigen Kfz-Verkehrs teilen.
Die Stadt Peking und ihre verkehrlichen Probleme
14
Würde man selbst die heutigen, schon kritischen Zustände noch
als geradezu erträglich hinnehmen wollen, so würden sich die ver-
kehrlichen Probleme durch die weiter zunehmende Motorisierung,
das fortgesetzte Anwachsen der Großstadt Pekings und die weiter
vorangetriebene Verdichtung der innerstädtischen Nutzungsinten-
sitäten in den nächsten Jahren derart verschärfen, dass Peking
unweigerlich der Verkehrskollaps droht.
Die nachfolgende Karte dienen zur Orientierung in der Stadt
Peking.
A
bb
ild
un
g
5
S
ei
te
1
5
Q
ue
lle
:
gr
oß
e
K
ar
te
: B
ei
jin
g
To
ur
is
t M
ap
kl
ei
ne
K
ar
te
n:
In
te
rn
et
Ü
be
rs
ic
ht
sk
ar
te
Pe
ki
ng
Ü
be
rs
ic
ht
sk
ar
te
Pe
ki
ng
Ü
be
rs
ic
ht
sk
ar
te
Pe
ki
ng
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
16
3 Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsent-
wicklung Pekings
3.1 Stadtentwicklung
Viele chinesische Großstädte sind heute in ihrer Struktur und Er-
scheinung durch drei entscheidende Entwicklungsepochen
geprägt worden, deren Spuren sich vielfach auch noch im moder-
nen Stadtbild wiederfinden lassen.
Älteste heute noch im Stadtbild erkennbare Entwicklungs-
strukturen sind die traditionellen Elemente der vormodernen
chinesischen Stadt aus der Kaiserzeit, welche sich heute im
Grundriss der Innenstädte, der Anlage zentraler Achsen und in
erhaltenen Einzelgebäuden manifestiert. Auch wenn die heutigen
Innenstädte fast vollständig mit moderner Architektur überbaut
wurden, sind die historischen Straßenzüge vielfach erhalten.
Heute sind diese oft engen Straßen und Gassen, die das unter-
geordnete, feinverteilende Straßennetz bilden, mit eine Ursache
für die verkehrlichen Probleme.
Von der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 bis zum
Beginn der Reformen 1978 war der sozialistische Städtebau
vorherrschend und prägte die Gestalt der Metropolen in China in
architektonisch-städtebaulicher und siedlungsstruktureller Hinsicht
maßgeblich.
Die moderne Stadtentwicklung in chinesischen Metropolen
begann ab ca. 1985 nach dem Vorbild westlicher, hauptsächlich
amerikanischer Großstädte.
In den folgenden drei Abschnitten werden diese drei maßgebli-
chen Phasen der chinesischen Stadtentwicklung erläutert und am
Beispiel der Stadt Peking konkretisiert.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
17
3.1.1 Die traditionelle chinesische Stadt
14
Die ersten Stadtgründungen im Bereich des heutigen China datie-
ren aus der Zeit um 2000 v.Chr. im Bereich der inneren Mongolei.
Einfluss auf die heutige Stadtgestalt der Metropolen an der Ost-
küste des Landes haben jedoch erst die Gründungen aus der chi-
nesischen Kaiserzeit mit Beginn der Qin-Dynastie (221-202
v.Chr.).
Während der chinesischen Kaiserzeit wurden die Städte unter
strenger Beachtung einer ,,kosmo-energetischen" Symbolik nach
konfuzianischer Philosophie gebaut. Strenge Geometrie und ein
festgelegtes, hierarchisch strukturiertes Muster bildeten die Grund-
lage der Stadtgrundrisse. Wichtigstes philosophisches Merkmal
des vormodernen chinesischen Städtebaus war die stetige Erhal-
tung des Gleichgewichts zwischen dem Kosmos (kreisförmiger
Himmel) und der Erde (quadratische Elemente) und die hierarchi-
sche Strukturierung des Stadtraumes.
Der Mikrokosmos Stadt wurde als Abbild des Makrokosmos ange-
legt und sollte die Ordnung von Gesellschaft und Universum
wiederspiegeln. Wie in vielen Bereichen des traditionellen chinesi-
schen Lebens, spielte auch in der Stadtgestalt der Kräftedualis-
mus der kosmischen Kräfte Yin und Yang
15
eine entscheidende
Rolle. Kreis, Achsen und Rechteck bildeten die Grundelemente
der frühen, chinesischen Stadtplanung. Bis heute sind Axialität,
Symmetrie und der strengen Orientierung an den Himmels-
richtungen erkennbare Gestaltungsmerkmale der Geomantik
16
.
14
Taubmann, Wolfgang: Die chinesische Stadt in Geographische Rundschau
45/1997; Blotevogel, Hans-Heinrich: Skript zur Lehrveranstaltung Stadtge-
ographie.
15
Yang: "Banner, die im Winde wehen". Eine der beiden unmittelbar aus dem
einen Absoluten hervorgehenden Kräfte nach der Philosophie des ,,Tai Chi Tu".
Bedeutung "Region des Lichtes". Yin: "wolkig, bedeckt". Die gegensätzliche
Kraft. Bedeutung "Region der Dunkelheit". (Quelle: Prignitz, E.: Feng Shui Lexi-
kon)
16
Geomantik (chinesische Naturphilosophie): Der Kräftedualismus (Yin-Yang)
wird auf den Raum übertragen: z.B. Himmelsrichtungen: Nord = weiblich, pas-
siv, dunkel, Süd = männlich, aktiv, hell.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
18
Gleichzeitig spiegelte die innere Gliederung der Stadt den
hierarchischen, von der konfuzianischen Gesellschaftslehre
17
abgeleiteten, kaiserzeitlichen Gesellschaftsaufbau wieder, dessen
Mittelpunkt der Kaiser als ,,Himmelssohn" bildete. Zentraler Ort in
der historischen chinesischen Stadt war der Palast des Kaisers
oder des regional herrschenden Fürsten, um den sich in recht-
eckiger Anordnung die Wohnviertel von Beamten und Palastbe-
diensteten und mit zentral-peripherem Sozialgefälle die Quartiere
der restlichen Bevölkerung anschlossen. Die chinesischen Städte
der Kaiserzeit waren Ausdruck und Stütze der feudalen
Gesellschaftsordnung. Im Vergleich zu europäischen
mittelalterlichen
18
Städten war das von Handel und Handwerk
lebende Bürgertum sozial unterprivilegiert.
Wichtigster vormoderner Stadttypus war die ,,Chinesische Kreis-
stadt", welche von einer kreisförmigen oder elliptischen Mauer mit
vier nach den Himmelsrichtungen orientierten Toren umgeben
war. Zwei zentrale Straßenzüge schnitten sich in Nord-Süd- und
Ost-West-Orientierung, von den vier Stadttoren ausgehend, auf
einem dem Palast vorgelagerten Platz. Der Lehre der Geomantik
folgend, waren die wichtigsten Gebäude an der Südachse
angelegt, während weniger angesehene Nutzungen, wie
beispielsweise der Handel, sich an der im Norden gelegen Achse
befanden.
17
Angesichts des politischen und sozialen Chaos seiner Zeit entwickelte der
Philosoph Kong Qiu (551-479 v. Chr.) ein Modell für ein geordnetes und re-
spektvolles Zusammenleben der Menschen und insbesondere für eine mora-
lisch unanfechtbare und fürsorgliche Herrschaft. Der Konfuzianismus verband
die konfuzianische Staats- und Sozialethik mit kosmologischen Spekulationen:
Natur und Geschichte sind danach eng miteinander verflochten, und der
Mensch (insbesondere der Kaiser) ist für den geordneten Verlauf der Gescheh-
nisse in Natur und Gesellschaft verantwortlich. Es entstand ein System der Ab-
hängigkeit zwischen Kosmos und Menschenwelt, in den Naturkatastrophen als
Strafe des Himmels für unmoralischen Handeln und ungewöhnliche Geschehnis-
se im natürlichen Wettlauf auf bevorstehende Ereignisse in Staat und Gesell-
schaft schließen ließen. (Quelle: Duan, Lin: Konfuzianische Ethik und Legitima-
tion der Herrschaft im alten China.)
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
19
Die typischen inneren Elemente der ,,Chinesischen Kreisstadt"
waren neben dem Palast, das Yamen
19
als Sitz der kaiserlichen
siegelführenden Beamten und die zahlreichen Tempel.
Abbildung 6 Innere Stadt Pekings während der Ming- und Qing-
Dynastie
Quelle: Housing A Billion, Volume III Document, Housing Renewal in Beijing Observa-
tion and Analysis.
Neben der zur Verteidigung konzipierten äußeren Stadtmauer
waren die einzelnen Stadtbezirke mit Mauern voneinander
getrennt, welche die hierarchische Strukturierung verdeutlichen
sollte. Die Palastanlagen verfügten oft über eine eigene, innere
massive Mauer mit Türmen und Verteidigungsanlagen.
Die grundlegende Struktur und Philosophie der traditionellen
chinesischen Stadtentwicklung änderte sich trotz wechselnder
Dynastien, während des 2133 Jahre andauernden chinesischen
18
Im Gegensatz zu China setzte die Verstädterung in Europa erst im Mittelalter
ein.
19
Das Yamen war als Gerichts- und Amtssitz im feudalen China wichtigste Insti-
tution der städtischen Verwaltung.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
20
Kaiserreichs nur geringfügig. Bis zum Ende des Kaiserreiches mit
der Abdankung des letzten Kaisers Pu Yi im Jahr 1912 und der
Ausrufung der Republik
20
waren in China über 2000 Stadtgrün-
dungen nach konfuzianischer Ordnung entstanden.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1949 verstärkten sich die
Einflüsse europäischer Länder und Bautraditionen in den Städten
der chinesischen Ostküste. Insbesondere in den Vertragshafen-
Städten
21
wie Shanghai oder Guangzhou und den Kolonialgebie-
ten Hongkong (Großbritannien), Macau (Portugal), Tsingtau
(Deutschland) oder Port Arthur (Russland) wurden die Städte von
ausländischen Einflüssen geprägt. Die Stadt Peking war trotz
einer Besetzung durch die Japaner in den Jahren 1937-45 kaum
fremden Einflüssen unterworfen und hat daher ihren rein chinesi-
schen Charakter behalten.
Peking wurde während der westliche Zhou-Dynastie (1100 v.Chr.
bis 770 v.Chr.) unter dem Namen ,,Ji" gegründet. ,,Ji" war für über
1000 Jahre das Handels- und Kulturzentrum im Norden Chinas.
Im frühen 10. Jahrhundert wurde ,,Ji" unter dem neuen Namen
,,Yanjing" neben ,,Kaifeng" die zweite Hauptstadt der
Liao-Dynastie. Von 1115 bis 1911 war Peking mit kurzen
Unterbrechungen die Hauptstadt der Kin-, Yuan-, Ming- und
Qing-Dynastien und erhielt den Namen Beijing
22
(Peking). Der
Ausbau zur Reichshauptstadt des großchinesischen Reiches
begann 1421 unter dem Ming-Kaiser Yong Le, nachdem der Hof
aus Nanking
23
nach Peking zurückgekehrt war.
20
Nicht zu verwechseln mit der Gründung der Volksrepublik China 1949.
21
Vertragshäfen-Städte: Städte mit Konzessionsgebieten ausländischer Han-
delsniederlassungen ab 1842 und ausgeprägten ausländischen Wohngebieten.
Sie bildeten die Kristallisationspunkte für die spätere Herausbildung moderner
Cities nach westlichem Muster. Beispiele sind Shanghai, Guangzhou, Kanton
oder Tientsin.
22
Beijing: ,,Nördliche Hauptstadt"
23
Nanking (Nánjing: ,,Südliche Hauptstadt"): Während der Sechs Dynastien
(220-589 n.Chr.), der südlichen Song-Dynastie (1127-1279 n.Chr.), und zu Be-
ginn der Ming-Dynastie (1368) war Nanjing Hauptstadt von China.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
21
Die Palastanlagen der ,,Verbotenen Stadt" bildeten das
hierarchische und geographische Zentrum Beijings und war
wichtigste Element der damaligen Stadtentwicklung. Im Jahr 1270
hatte die Stadt bereits 1,2 Mio. Einwohner und war eine der
weltweit größten Städte der damaligen Zeit. Nach dem Sturz des
letzten Kaisers wurde 1912 Nanjing erneut Hauptstadt der
Republik China. Erst 1949 mit der Gründung der sozialistischen
Volksrepublik China erhielt Peking seinen Status als Hauptstadt
zurück.
Neben den Hutong-Siedlungen
24
, den traditionelle Wohnhof-
Quartiere im zentralen Bereich der Stadt sind die axialen Haupt-
straßen auch heute noch stadtbildprägend. Die Ost-West-Achse
stellt auch im heutigen Peking eine der wichtigsten städtischen
Straßenzüge dar.
24
Das Wort Hutong leitet sich vom mongolischen Wort für ,,Brunnen" ab. Es
bezeichnet die Gasse zwischen den traditionellen U-förmigen, aneinandergebau-
ten, innerstädtischen Hof-Häusern. Jedes dieser Häuser verfügte ursprünglich
über einen Brunnen im Innenhof.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
22
3.1.2 Entwicklungen im 20. Jahrhundert
25
Von 1949 bis zum Beginn der Reformen 1978 wurde in China
sozialistischer Städtebau unter dem Slogan ,,Konsumentenstädte
in Produzentenstädte" praktiziert. Einerseits war der Maoismus
26
stadtfeindlich, andererseits betrieb die Regierung eine
Industrialisierung nach sowjetischem Vorbild, um den Widerspruch
zwischen der entwickelten Küstenregion und dem rückständigen
Hinterland zu überwinden. Insbesondere der Aufbau der Schwer-
industrie führte zu einem enormen Wachstum und
gravierendem Funktionswandel in den Städten insbesondere im
Norden und im Landesinneren.
Schon im 1. Fünfjahresplan wurde eine größere Zahl von Binnen-
städten zu sogenannten ,,Schlüsselindustriezentren" ernannt und
entsprechend ausgebaut. Die ersten dieser Städte waren Cheng-
du, Lanzhou und Taiyuan. So entstand allmählich ein im Vergleich
zum Zustand vor 1949 ,,ausgeglicheneres" Städte-System mit
einer signifikanten Zunahme der Beschäftigtenzahlen und der
Stadtbevölkerung im Hinterland. Die Kehrseite der staatlichen
Industrieförderung war eine Vernachlässigung des Wohnungsbaus
und der Infrastruktur. So flossen in den Jahren 1958 bis 1976 80%
aller staatlichen Investitionen in den Aufbau der staatseigenen
Industrie. Zwar wurde weiterhin Wohnraum in den Städten kosten-
los als Versorgungsleistung der staatseigenen Betrieben zur Ver-
fügung gestellt, diese wurden in Qualität und Größe jedoch an die
zur Verfügung stehenden Mittel angepasst.
In den vorhandenen Wohnungen herrschte, bei einer Wohnfläche
von 3,7 m² pro Bewohner, bedrückende Enge.
27
25
Sierig, Jörg (1995): Stadt- und Siedlungsplanung in der Volksrepublik China.
Stuttgart: IRB Verlag
26
Maoismus: Nach seinem zentralen Akteur Mao Zedong benannte Periode
permanenter Revolution in China zwischen 1949 und 1976.
27
1965: durchschnittlich 3,7m² Wohnfläche pro Person (1991: 6,9 m²) in Pe-
king (Quelle: Blotevogel: Skript Stadtgeographie, a.a.O.)
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
23
Abbildung 7 Typischer Wohnungsbau in Peking 1960-1970
Quelle: Housing A Billion, Volume III Document, Housing Renewal in Beijing
Observation and Analysis.
Unter Mao Zedong wurde Peking zum politischen und kulturellen
Zentrum des modernen China ausgebaut. Auch in Peking
orientierte man sich, wie in allen chinesischen Großtädten, zu die-
ser Zeit am Städtebau der Sowjetunion und baute nach dem Mus-
ter sowjetischer Planstädte strikt gegliederte Arealen für Industrie,
Universitäten, ausländische Botschaften, Wohnen und andere
Nutzungen. Fünf- bis siebengeschossige Wohnungssiedlungen,
Ministerien und Behörden entstanden im Bereich der Altstadt und
in den westlichen Außenbezirken.
1953 wurden die ersten Entwürfe vorgelegt, welche Planungen für
einen Zeitraum von zwanzig Jahren vorsahen. Demnach sollte das
Stadtgebiet bei einer maximalen Bevölkerung von fünf Millionen
Einwohnern auf eine Fläche von 600 km² erweitert und die
Außenbezirke mit einem Industriegürtel umgeben werden.
Zwischen der Altstadt und den Industriezonen waren durch Grün-
zonen abgetrennte Wohngebiete geplant. Ein Netz aus Ringstras-
sen und strahlenförmigen Magistralen wurde als Erschließung
vorgeschlagen. Am ,,Platz des himmlischen Friedens" sollte das
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
24
neue Regierungszentrum in unmittelbarer Nähe zum Palast ent-
stehen.
Während die Entwürfe von 1953 noch mehrmals unter der Leitung
wechselnder sowjetischer Experten überarbeitet wurden, erfolgte
gleichzeitig der Beginn der bauliche Umsetzung.
Im Jahr 1957 wurde ein ,,vorläufiger Generalplan für Peking"
vorgelegt. Die Umgestaltung der Altstadt, bei der jedes Jahr eine
Millionen Quadratmeter Fläche im Altbaubestand abgerissen und
durch doppelt soviel Wohn- und Nutzfläche in Neubauten ersetzt
werden sollten, sollte planmäßig innerhalb von zehn Jahren abge-
schlossen werden. Obwohl diese Kahlschlagsanierung nicht in
ihrer geplanten Vollständigkeit ausgeführt wurde, hatte sie enor-
men Einfluss auf das Gesicht der Stadt.
Die Gebietsreform von 1958 erweiterte das Stadtgebiet auf 16.800
Quadratkilometer und zog die Revision des Generalplanes nach
sich. Um die Kernstadt zu entlasten, verlegte man die städtebauli-
che Entwicklung auf Satellitenstädte. Die Industrialisierung nun
wurde massiv umgesetzt.
Die prägnanteste städtebauliche Umgestaltung im Innenstadtbe-
reich stelle die Erweiterung des 800 Meter langen ,,Platz des
himmlischen Friedens" dar, der die Einheit und den revolutionären
Charakter des Landes mit der Gedenksäule für die Volkshelden
und später dem Mao-Mausoleum repräsentierte und als öffentli-
cher Versammlungsort diente. Mit einer Fläche von 50ha ist er der
größte umbaute, innerstädtische Platz der Welt.
28
Die "Große Hal-
le des Volkes" und das Geschichts- und Revolutionsmuseum flan-
kieren den Platz im Westen und Osten.
28
Zum Vergleich: Die Fläche des Altexanderplatzes beträgt 3ha.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
25
Abbildung 8 Platz des Himmlischen Friedens
Quelle:
eigene
Fotografie
Der Ausbau der in Ost-West Richtung verlaufenden Chang'an-Jie
setzte der imperialen, kaiserzeitlichen Nord-Süd Achse eine von
repräsentativen Hotels, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäu-
den gesäumte Achse entgegen und symbolisierte den Bruch mit
der Zeit kaiserlicher Herrschaft. Diese Achse stellte die
Verbindung des Regierungszentrums mit den Industriegebieten in
den westlichen und östlichen Vororten dar.
Der Bruch mit der Sowjetunion Anfang der sechziger Jahre, die
chinesische Agrarkrise und die Kulturrevolution führten zu einer
Stagnation des städtischen Wachstums. 1967 wurde die Umset-
zung des Generalplanes abgebrochen und 1968 das Stadtpla-
nungsamt geschlossen. Die sechziger Jahre kennzeichneten will-
kürliche Abrisse in der Altstadt und der Ansiedlung von umweltbe-
lastenden Industriegebieten in Wohngegenden, da eine steuernde
Instanz fehlte.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
26
Als Hauptstadt der Volksrepublik China hat die Stadt Peking einen
großen Bedeutungszuwachs im zentralistischen Staat erfahren.
Dies zeigt sich auch durch das seit 1949, trotz zwischenzeitlicher
Stagnation, anhaltende Wachstum der Stadt.
Die folgende Abbildung verdeutlich die Entwicklung der urbanisier-
ten Flächen Pekings in den Jahren 1951 bis 1991.
Abbildung 9 Verstädterung Pekings 1951 bis 1991
Quelle: Housing A Billion, Volume III Document, Housing Renewal in Beijing
Observation and Analysis.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
27
3.1.3 Entwicklungen in Folge der wirtschaftlichen
Liberalisierung
Seit der wirtschaftlichen Liberalisierung in der Volksrepublik China
ändert sich das Gesicht der chinesischen Städte mit zunehmender
Geschwindigkeit. Eine schnell wachsende Wirtschaft, der stetige
Zuwachs der städtischen Bevölkerung, enorme in- und
ausländische Investitionen, das Entstehen eines Dienstleistungs-
sektors und die mit dem Einkommen gestiegenen Ansprüche an
die Qualität des Wohnraumes haben zu einem gigantischen
Bau- und Expansionsboom in den Städten geführt.
Mangel an innerstädtischem Baugrund wird durch den Bau von
Wolkenkratzern und Hochhäusern kompensiert. Selbst jüngere
Gebäude mit niedriger Nutzungsdichte müssen zugunsten hoch-
verdichteter Bebauungen weichen. In einigen Stadtteilen Shang-
hais oder Pekings sind kaum noch Gebäude zu entdecken, deren
Entstehung länger als fünfzehn oder zwanzig Jahre zurückliegt.
Abbildung 10 Moderne Hochbauten in Peking
Quelle:
eigene
Fotografien
Städtebaulich und stadtplanerisch orientiert sich das moderne
China nun an autogerechten US-Metropolen wie Los Angeles oder
Housten.
Ende der siebziger Jahre nahm das wiedereröffnete Stadtpla-
nungsamt die Ausarbeitung eines Generalplanes wieder auf. Das
politische Bekenntnis zu Wirtschaftsreformen und einer Öffnungs-
politik begünstigte neue Ansätze in der Stadtplanung. Die Indust-
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
28
riestruktur sollte reguliert und vorrangig die Dienstleistungs-,
Kultur- und Wirtschaftsbereich gefördert werden. Erstmals wurde
auch der Denkmalschutz des Altstadtensembles diskutiert.
In dem 1983 ratifizierten Generalplan (1982-2000) wurden die
Schwerpunkte auf den Wohnungsbau, Dienstleistung und den
Ausbau des Straßennetzes gelegt. Die Altstadtsanierung wird als
Modernisierungsprozess begriffen, bei dem etwa drei Viertel der
Altstadt als abrissreif eingestuft wurde.
Abbildung 11 Hutong-Siedlung und Altstadtbereiche in Peking
Quelle:
eigene
Fotografien
Während des beginnenden Baubooms in den achtziger Jahren
wurden der 3. und 4. Stadtstraßenring realisiert und es entstehen
innerhalb des dritten Straßenrings acht- bis dreizehnstöckige
Wohnhochhäuser rund um die Altstadt herum.
Abbildung 12 Hochverdichtetes Wohnen in Peking
Quelle:
eigene
Fotografien
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
29
Nachdem schon in den neunziger Jahren die im Generalplan von
1983 kalkulierte Einwohnerzahl von fünf Millionen für das
Stadtgebiet und zehn Millionen für das Verwaltungsgebiet erreicht
waren, wurde ein neuer Generalplan für den Zeitraum von 1992
bis 2010 ausgearbeitet. In diesem Masterplan wurde das Stadtge-
biet auf eine Fläche von 660 Quadratkilometern ausgedehnt und
14 Satellitensiedlungen für jeweils 400.000 Einwohner geplant.
Abbildung 13 Satellitenstädte für die Wohnbevölkerung
Quelle:
eigene
Fotografien
Der tertiäre Sektor beansprucht mit Handel, Banken und
gigantischen Dienstleitungs-Neubauten den städtischen Raum
und es wurden mehrere über das Stadtgebiet verteilte Business
Districts deklariert, in welchen sich teilweise streng nach Bran-
chen getrennt Unternehmen ansiedeln sollten.
Als Sonderwirtschaftszonen
29
mit steuerlichen Vergünstigungen
für neu gegründete Unternehmen oder Firmen aus staatlich
29
Sonderwirtschaftszonen dienen vor allem der Förderung der Außenwirtschaft
und der Gewinnung ausländischen Kapitals und Know-Hows und bieten auslän-
dischen Investoren ein unternehmerfreundliches Umfeld mit Steuervergünsti-
gungssätzen für Auslandsbeteiligungen und Joint-Ventures. Neben den Sonder-
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
30
bevorzugten Sparten erfreuen sich diese Bereiche hoher Beliebt-
heit. Büroleerstand ist in Peking nahezu unbekannt und selbst
Wohnungen werden als Büroflächen vermietet.
Prominentestes und zugleich gigantischstes Beispiel für eine sol-
che innerstädtische Wirtschaftszone ist der momentan in der Pla-
nung befindliche ,,Central Business District". Mit einer Fläche von
vier Quadratkilometern entsteht er zentral in unmittelbarer Nähe
zur Stadtmitte.
Abbildung 14 Ansicht des geplanten Central Business Districts
Quelle: Beijing Central Business District, Imagebroschüre
Die Erschließung solch großflächiger Neubaugebiete in Innen-
stadtlage führt dazu, dass die über Jahrzehnte vernachlässigte
Sanierung der historischen Gassen und Hofhausquartiere der
Kernstadt (Hutongs) mit der Tabula-Rasa-Methode nachgeholt
wird. Städtische, Jahrhunderte alte Einzigartigkeit wird durch eine,
in allen Städten und Stadtteilen ähnliche, Stahl- und Glas-
Architektur ersetzt.
Heute scheint die Dynamik des kommerzialisierten Immobilien-
marktes zum Schrittmacher für den Umbau der Altstadt und die
Stadtentwicklung Pekings geworden zu sein, dem die städtische
Generalplanung lediglich noch hinterherhinkt. Durch die vom städ-
tischen Wirtschaftsboom in Gang gesetzte außerplanmäßige
Zuwanderung war bereits Mitte der neunziger Jahre die im Gene-
wirtschaftszonen bestehen zollfreie Zonen wie Shanghai-Waigaoqiao zur Förde-
rung des Im- und Exporte.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
31
ralplan von 1993 für 2010 erwartete Einwohnerzahl von 12,5 Milli-
onen erreicht.
Die unterschätzte Zunahme des Individualverkehrs hat alle Projek-
tionen zur Makulatur werden lassen. In vielen Bereichen ersetzt
Krisenmanagement heute die Vorgaben des Generalplans.
Nachfolgend ist auf einer Karte die Straßennetzstruktur des
Hauptstraßennetzes Pekings mit seinen Schnellstraßen-Ringen
dargestellt.
A
bb
ild
un
g
15
S
ei
te
3
2
Q
ue
lle
:
K
ar
te
ng
ru
nd
la
ge
: D
r.
B
re
nn
er
+
M
ün
ni
ch
Fo
to
s:
e
ig
en
e
Fo
to
gr
af
ie
n
Pe
ki
ng
s
R
in
gs
tr
aß
en
ne
tz
un
d
se
in
e
ve
rk
eh
rli
ch
e
Si
tu
at
io
n
4
1
1
2.
R
ing
3.
R
ing
4.
R
ing
5.
R
ing
(m
ittl
erw
eil
e
fer
tig
ge
ste
llt)
2
2
3
3
4
5
5
M
au
ts
ta
tio
n
am
B
ad
al
in
g-
E
xp
re
ss
w
ay
B
au
st
el
le
fü
r
ei
ne
V
er
bi
nd
un
g
zw
is
ch
en
3
. u
nd
4
. R
in
g
(d
ur
ch
e
in
W
oh
ng
eb
ie
t)
S
ta
uz
us
ta
nd
a
uf
d
em
4.
R
in
g
S
ta
uu
ng
en
a
uf
d
em
2
. R
in
g
S
ta
dt
st
ra
ße
m
it
A
bz
w
ei
gu
ng
au
f d
en
3
. R
in
g
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
33
3.2 Mobilität und Verkehr
3.2.1 Motorisierung, Mobilität und Verkehrsaufkommen
In den vergangenen Jahren hat sich der Grad der Motorisierung in
China aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen drastisch
erhöht. Mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum, dem
Entstehen einer urbanen Mittelschicht und den fallenden Automo-
bilpreisen nach Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation WHO,
wuchs der chinesische Automobilmarkt rapide an.
Für Millionen Chinesen ist ein Auto erschwinglich geworden und
heute boomt der Automobilmarkt in China wie in keinem anderen
Land der Erde. Allein im Jahr 2003 wurden in ganz China
4,5 Millionen Neuwagen verkauft.
30
Die folgende Abbildung zeigt
die Entwicklung des chinesischen Automobilmarktes in den Jahren
1990 bis 2003.
Abbildung 16 Absatz von Personenkraftwagen in China
Quelle: WZB: China Automobilmarkt der Zukunft?
30
Quelle: Xinhua News Agency / Reuters
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
34
Wurde in den 1990er Jahren der überwiegende Teil von
Personenkraftwagen in China noch an Flottenbetreiber wie
Taxiunternehmen, Regierungsstellen und Institutionen verkauft, so
lag bereits 2002 der Großteil des Absatzes bei privaten Käufern.
Das Gros der privaten Autokunden stammt aus der vom
zunehmenden Wohlstand wachsenden Mittelschicht in den
Städten im Osten des Landes und verfügt über einem Einkommen
von über 5.000 Euro pro Jahr.
31
Das durchschnittliche Monatseinkommen der Stadtbevölkerung
Chinas beträgt heute umgerechnet etwa 850 Euro. Für knapp ein
dreiviertel des Jahreseinkommen, etwa 7.500 Euro, lässt sich das
chinesische ,,Einstiegsauto", der ,,Geely" erwerben.
32
Trotz dieses
vergleichsweise niedrigen Einstiegspreises ist ein Pkw für die
Mehrzahl der Chinesen nach wie vor unerschwinglich. Die folgen-
de Abbildung zeigt die immer noch vorhandene Kluft zwischen
dem landesdurchschnittlichen Jahreseinkommen und dem durch-
schnittlichen Anschaffungspreis eines Pkw.
Abbildung 17 Vergleich des durchschnittlichen Jahreseinkommens pro
Kopf und dem durchschnittlichen Preis eines Fahrzeuges
Quelle: Goldman Sachs, Marktanalyse China (2003)
31
WZB (2004): China Automobilmarkt der Zukunft?
32
ZDF Online: Herr Li kann sich ein Auto kaufen vom 8.6.2004.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
35
Mit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WHO sind die
Barrieren für den Kauf ausländischer Fahrzeuge niedriger gewor-
den und die Möglichkeiten der Finanzierung oder des Leasing
erstmals entstanden. Die Senkung von Einfuhrzöllen und Einfuhr-
quoten für ausländische Kraftfahrzeuge wurden gesenkt und er-
möglichen den wohlhabenden Käuferschichten den Zugang zum
internationalen Automobilmarkt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen für den chine-
sischen Automobilmarkt nach dem Beitritt zur WHO.
Tabelle 1 Veränderung der Rahmenbedingungen auf dem chinesischen
Automobilmarkt nach WTO-Beitritt
Quelle: WZB (2004): China Automobilmarkt der Zukunft?
Ausländische Fahrzeuge sind wegen ihrer hohen Qualität als Sta-
tussymbol in China sehr geschätzt. Unter ihnen dominieren be-
sonders deutsche Marken wie Volkswagen und Audi oder Fahr-
zeuge des französischen Herstellers Peugot den Markt und das
Straßenbild.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
36
Das nachstehende Bild zeugt von chinesischer Initiative, ,,deut-
sche Autos" selbst zu nachzubauen.
33
Abbildung 18 Mercedes-Benz-VW-Golf-Mix
Quelle:
eigene
Fotografien
Trotz immer noch hoher finanzieller Belastungen ist auch für die
chinesische Mittelschicht das Automobil zum Statussymbol, Aus-
druck für Unabhängigkeit und Individualität und insbesondere das
unverkennbare Symbol für das Streben nach Wohlstand und Fort-
schritt geworden. Dabei gilt für chinesische Kfz-Kunden weniger
die Stärke der Motorisierung als vielmehr die hochwertige und
technisch moderne Ausstattung des Fahrzeuges als erstrebens-
wert.
Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Fahrzeugbe-
standes in vier asiatischen Metropolen in Vergleich. Man erkennt
die spät einsetzende Motorisierung in China und den schnellen
Anstieg des Fahrzeugbestandes in Peking und Shanghai.
33
siehe auch: Deggerich, Markus (2003): Volkswagen-Republik auf der Über-
holspur. China macht automobil. In: Der Spiegel vom 13.11.2003
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
37
Abbildung 19 Entwicklung des Fahrzeugbestandes in asiatischen Groß-
städten 1960 bis 2000 (in 1000 Fahrzeugen)
Quelle: Kebin, He (2003): A Comparative Study on Urban Transport System and Related
Environmental Impact in Asian Mega-cities. Peking, China: Tsinghua Tsinghua Univer-
sity.
Wer in China noch kein Auto besitzt, träumt davon: Jede zehnte
Familie an Chinas Ostküste möchte sich im kommenden Jahr ein
Auto kaufen und die Unternehmensberatung Roland Berger prog-
nostizierte ab 2005 ein jährliches Wachstum von 21% für das
Kleinwagensegment am chinesischen Markt.
34
Steigender Wohlstand und verlockende Finanzierungs- und
Kreditangebote machen diesen Traum für eine immer größere Be-
völkerungsschicht möglich.
Ein weiterer Antrieb für die steigende Motorisierung sind staatliche
Förderungen. Neben der IT- und Elektroindustrie gilt in China auch
die Automobilindustrie als neue Schlüsselindustrie. Reduzierte
Abgaben und Steuern, sowie die Möglichkeit zur Finanzierung von
Autokäufen sollen das Automobil für breite Massen erschwinglich
machen und den Markt weiter ankurbeln. Obwohl die Verfügbar-
keit von Kraftfahrzeugen im Landesdurchschnitt mit 8 Kfz pro 1000
34
Quelle: Bahner, E. und Steffen Range (2003): Mit der Ananas in die Rush-
Hour. Chinas Automobilmarkt.
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
38
Einwohner
35
im Vergleich zu den Industrienationen
36
immer noch
gering ist, bietet sich innerhalb der Städte und der küstennahen
Agglomerationsräume bereits jetzt ein Bild von Massen-
motorisierung und überfüllten Stadtstraßen, welches dem Ver-
gleich mit westlichen Metropolen in nichts nachsteht.
Die ungleiche Einkommensverteilung zwischen städtischen und
ländlichen Regionen und die hohe urbanen Nutzungs- und Bevöl-
kerungsdichten führten hier zu einem wesentlich höheren Grad
der Motorisierung und einer erheblichen, auf die Fläche
bezogenen, Fahrzeugdichte.
Allein in Peking werden täglich mehr als 1000 Personenwagen
neu zugelassen und in Betrieb genommen. Im April 2004 waren in
Peking bereits über 2,4 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen und
bis 2008 werden 3,5 Millionen Zulassungen in der Hauptstadt
erwartet.
37
Während die Motorisierung der Bevölkerung in Peking Anfang
2002 noch bei 180 Pkw pro 1000 Einwohner
38
lag, wird sie bis
Ende 2004 auf etwa 300 Pkw / 1000 Ew. angestiegen sein.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre
sorgte auch für eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens
innerhalb der Bevölkerung. Privatunternehmen ermöglichen neue
Einkommens- und Karrieremöglichkeiten für die arbeitende,
städtische Bevölkerung. Für den beruflichen Aufstieg in einem der
neuen privaten Unternehmen werden heute oft lange Wege in
Kauf genommen. Ungenügende öffentliche Verkehrsmittel und
Benzinpreise um 32 Cent pro Liter stellen für Pendler keinen An-
35
Quelle: Spiegel Online Worldfacts-Jahrbuch 2003;
http://www.spiegel.de/jahrbuch/0,1518,CHN,00.html
36
Zum Vergleich: Die Motorisierung in Deutschland beträgt im Bundes-
durchnschnitt 541 Pkw je 1000 Einwohner. (Quelle: Bundesumweltamt, Um-
weltdaten Deutschland Online)
37
Quelle: Chinatoday.com, 14. Mai 2004
38
Quelle: Demographia-Online
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
39
reiz dar, bei der Fahrt zur Arbeit auf ihr neues Automobil zu ver-
zichten.
Durch die gestiegene Mobilität der städtischen Bevölkerung und
die noch ungebrochene Begeisterung für den Kfz-Verkehr entsteht
zwangsläufig ein höheres innerstädtisches Verkehrsaufkommen.
Obwohl den größten Zuwachs am Modal Split der motorisierte In-
dividualverkehr erfahren hat, ist auch der öffentliche Personenver-
kehr nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Ausdehnung der
Städte angestiegen. Die Nachfrage übersteigt in vielen Stadtge-
bieten Pekings die Kapazitäten und erfordert den Einsatz der Bus-
se im Kolonnenverkehr auf ein und der selben Buslinie. Wer es
sich leisten kann, steigt auf den Pkw um.
Auch wenn es in ganz China insgesamt weniger Pkws gibt als im
Großraum Los Angeles, ist das Land bereits heute der weltweit
zweitgrößte CO²-Verursacher und chinesische Metropolen
gehören weltweit zu den am stärksten von Luftverschmutzung
betroffenen Städten.
39
Tabelle 2 Anteile des Kfz-Verkehrs als Verursacher von Luftverschmut-
zungen
Source: World Bank Report. "Vehicular Air Pollution: Experience from Seven Latin
American Urban Cities", 1997. Daten über Beijing stammen aus dem Report ,,China's
Strategies for Controlling Motor Vehicle Emissions", 1997.
39
WZB (2004): China Automobilmarkt der Zukunft?
Merkmale der bisherigen Stadt- und Verkehrsentwicklung Pekings
40
Die obige Tabelle zeigt den Anteil des Kfz-Verkehrs als Verur-
sacher von Luftverschmutzung in mehreren Städten. Deutlich ist
der Zuwachs in Peking zwischen 1992 und 1995 zu erkennen.
3.2.2 Verkehrsangebote und Verkehrsinfrastruktur
Die Stadt Peking verfügt heute neben Shanghai über die
modernste Verkehrsinfrastruktur Chinas. Seit den 1980er Jahren
sind gewaltige Investitionen in das Straßennetz und die öffentli-
chen Verkehrsangebote der chinesischen Hauptstadt geflossen
und Anstrengungen unternommen worden, diese westlichen
Standards und der gestiegenen Nachfrage anzupassen.
Dennoch weist das heute vorhandene Straßenverkehrssystem
immer noch Lücken und vor allem Mängel hinsichtlich seiner
Leistungsfähigkeit auf. Die zwölfspurige Hauptachse Pekings ist
die historische Ost-West-Achse, welche direkt am Kaiserpalast
und der Verbotenen Stadt das Zentrum Pekings schneidet. Diese
pachtvoll ausgebaute Achse bildet sich aus der Fuximenwai Dajie,
der Xichang'an Jie und der Donchang'an Jie und beherbergt ne-
ben dem ehemaligen Palast alle wichtigen Ämter und Institutionen
des chinesischen Staates. Als einzige ununterbrochene Ost-West-
Achse Pekings bildet sie das Rückgrad des straßengebundenen
Stadtverkehrssystems.
Mit der Ausdehnung des Stadtgebietes wurden mittlerweile fünf
stadtautobahnähnliche, konzentrische Ringe um das Zentrum der
Stadt gebaut. Der erste Ring entstand auf dem Bereich der
ehemaligen inneren Stadtmauer während der Mao-Ära.
Tangentiale Ausfallstraßen verbinden die Ringe in nordöstlicher,
nordwestlicher, westlicher, südwestlicher, südlicher, südöstlicher
und östlicher Richtung. Besonders zwischen dem zweiten und
dritten Ring im Süden, sowie dem dritten und vierten Ring im
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832490195
- ISBN (Paperback)
- 9783838690193
- DOI
- 10.3239/9783832490195
- Dateigröße
- 9.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Berlin – Architektur Umwelt Gesellschaft, Stadt- und Regionalplanung
- Erscheinungsdatum
- 2005 (September)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- stadtentwicklung motorisierung urbanisierung bevölkerungswachstum asien
- Produktsicherheit
- Diplom.de