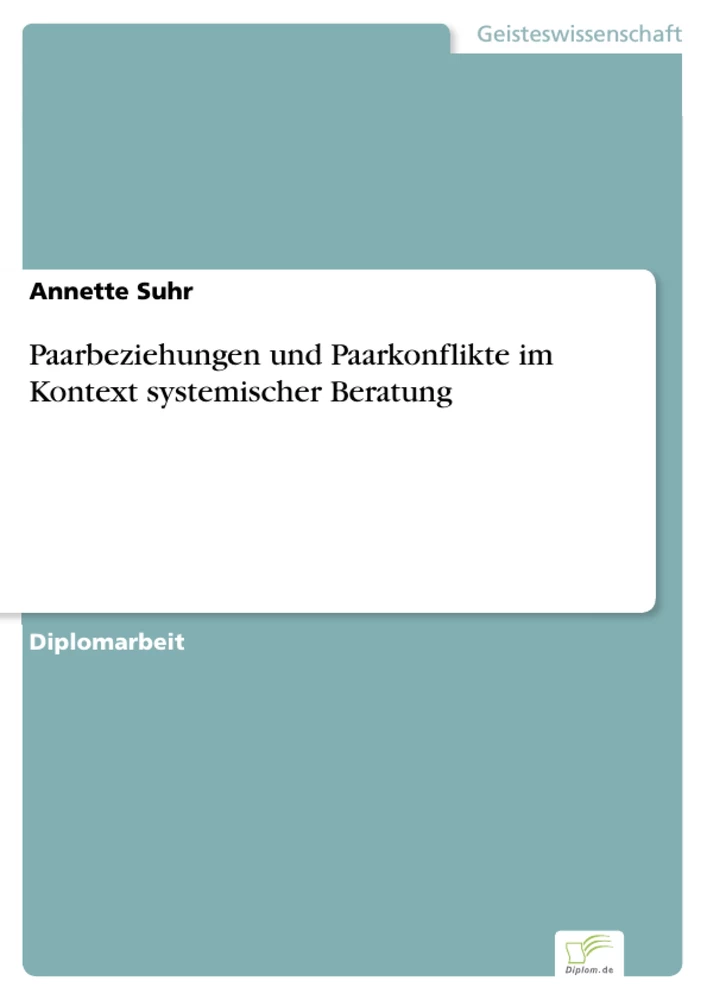Paarbeziehungen und Paarkonflikte im Kontext systemischer Beratung
©2005
Diplomarbeit
101 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Paarbeziehungen und Paarkonflikten im Kontext systemischer Beratung. Meine Intention ist es zum einen darzustellen, wie heutige Partnerschaften gestaltet werden, welche Phasen sie durchlaufen und welche Konfliktmuster für viele Paarbeziehungen kennzeichnend sind. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, auf welche Weise sich die systemische Beratung mit diesen Konflikten auseinandersetzt und welche Möglichkeiten sie für Paare bietet, ihre Beziehung auf eine Weise fortzuführen, dass der Wunsch nach Verbundenheit, Loyalität, Beständigkeit und Liebe bei gleichzeitiger Individualität und persönlicher Identitätsentwicklung (zumindest annähernd) erfüllt wird.
Der Leser soll durch diese Arbeit einen Eindruck und ein Gefühl für systemische Beratung bekommen. Mir ist bewusst, dass ich natürlich nicht alle Aspekte und Methoden systemischer Therapie berücksichtigen kann, da sonst der Rahmen der Arbeit gesprengt würde, ich erhebe hier also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Arbeit werden jedoch die meiner Meinung nach wichtigsten Aspekte von Paarbeziehungen, systemischer Theorie und Beratung aufgeführt und ausführlich und nachvollziehbar dargestellt.
Gang der Untersuchung:
Ich habe mich dazu entschlossen, die Arbeit in die drei große Themenblöcke Paarbeziehungen, Systemische Theorie, Modell einer systemischen Therapie zu gliedern. Der dritte Block kann sozusagen als Summe aus dem ersten und zweiten gelten, da er die beiden ersten Themen in sich vereint.
Der erste Block befasst sich ausschließlich mit Paarbeziehungen, systemische Beratung wird hier vorerst ausgeklammert. Es geht darum, einen Einstieg in das Thema zu bekommen, indem einerseits ein Überblick darüber gegeben wird, welchem gesellschaftlichen Wandel Partnerschaften in den letzen Jahrzehnten unterworfen waren, andererseits werden die vier Phasen einer Ehe mit ihren typischen Krisen, sowie die Grundstrukturen problematischer Beziehungen dargestellt.
Der zweite Block thematisiert ausschließlich die systemische Theorie und stellt die theoretischen Konstrukte unabhängig von Paarbeziehungen dar. Bedeutungsrelevante Begriffe der Theorie werden definiert, es wird auf die Konzepte der Autopoiese und Kybernetik eingegangen und Luhmanns Vorstellung von Systemtheorie wird erläutert. Anschließend nähern wir uns dem Thema systemischer Beratung, indem die Kernbegriffe Realität, Kausalität, Sprache und Rekursivität, sowie das […]
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Paarbeziehungen und Paarkonflikten im Kontext systemischer Beratung. Meine Intention ist es zum einen darzustellen, wie heutige Partnerschaften gestaltet werden, welche Phasen sie durchlaufen und welche Konfliktmuster für viele Paarbeziehungen kennzeichnend sind. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, auf welche Weise sich die systemische Beratung mit diesen Konflikten auseinandersetzt und welche Möglichkeiten sie für Paare bietet, ihre Beziehung auf eine Weise fortzuführen, dass der Wunsch nach Verbundenheit, Loyalität, Beständigkeit und Liebe bei gleichzeitiger Individualität und persönlicher Identitätsentwicklung (zumindest annähernd) erfüllt wird.
Der Leser soll durch diese Arbeit einen Eindruck und ein Gefühl für systemische Beratung bekommen. Mir ist bewusst, dass ich natürlich nicht alle Aspekte und Methoden systemischer Therapie berücksichtigen kann, da sonst der Rahmen der Arbeit gesprengt würde, ich erhebe hier also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Arbeit werden jedoch die meiner Meinung nach wichtigsten Aspekte von Paarbeziehungen, systemischer Theorie und Beratung aufgeführt und ausführlich und nachvollziehbar dargestellt.
Gang der Untersuchung:
Ich habe mich dazu entschlossen, die Arbeit in die drei große Themenblöcke Paarbeziehungen, Systemische Theorie, Modell einer systemischen Therapie zu gliedern. Der dritte Block kann sozusagen als Summe aus dem ersten und zweiten gelten, da er die beiden ersten Themen in sich vereint.
Der erste Block befasst sich ausschließlich mit Paarbeziehungen, systemische Beratung wird hier vorerst ausgeklammert. Es geht darum, einen Einstieg in das Thema zu bekommen, indem einerseits ein Überblick darüber gegeben wird, welchem gesellschaftlichen Wandel Partnerschaften in den letzen Jahrzehnten unterworfen waren, andererseits werden die vier Phasen einer Ehe mit ihren typischen Krisen, sowie die Grundstrukturen problematischer Beziehungen dargestellt.
Der zweite Block thematisiert ausschließlich die systemische Theorie und stellt die theoretischen Konstrukte unabhängig von Paarbeziehungen dar. Bedeutungsrelevante Begriffe der Theorie werden definiert, es wird auf die Konzepte der Autopoiese und Kybernetik eingegangen und Luhmanns Vorstellung von Systemtheorie wird erläutert. Anschließend nähern wir uns dem Thema systemischer Beratung, indem die Kernbegriffe Realität, Kausalität, Sprache und Rekursivität, sowie das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9012
Suhr, Annette: Paarbeziehungen und Paarkonflikte im Kontext systemischer Beratung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Universität Bielefeld, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Paarbeziehungen und Paarkonflikte im Kontext systemischer Beratung
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einleitung
1
2. Paarbeziehungen
3
2.1
Der gesellschaftliche Wandel von Paarbeziehungen und seine Auswirkungen 4
2.2
Die Phasen einer Ehe mit ihren typischen Krisen
9
2.2.1
Die Phase der stabilen Paarbildung
11
2.2.2
Die Aufbau- und Produktionsphase der Ehe
12
2.2.3
Die Krise der mittleren Jahre
14
2.2.4
Die Altersehe
16
2.3
Grundstrukturen problematischer Beziehungen
18
2.3.1
Das Kollusionskonzept
18
2.3.2
Der zwischenmenschliche Teufelskreis
21
3. Systemische
Theorie
24
3.1
Die Bedeutung der Systemtheorie in anderen Disziplinen und ihre
Übertragung auf die systemische Therapie
26
3.2
Definitionen bedeutungsrelevanter Begriffe
28
3.2.1
Systeme
28
3.2.2
Subsysteme
29
3.2.3
Grenzen
30
3.2.4
Regeln
30
3.3
Das Homöostase-Konzept
31
3.4
Die Theorie autopoietischer Systeme
31
3.5
Systemtheorie nach Niklas Luhmann
33
3.6
Kybernetik der Beziehungen
35
3.7
Kernbegriffe systemischer Beratung
38
3.7.1
Realität
38
3.7.2
Kausalität
39
3.7.3
Sprache und Rekursivität
41
3.7.4
Problemverständnis
43
Seite
3.8
Diskurs: Der Familientherapeutische Ansatz des Mailänder Teams
45
3.8.1
Geschichtliche Entwicklung
46
3.8.2
Theoretische Annahmen
48
3.8.3
Struktur des Therapieprozesses
50
4.
Modell einer systemischen Therapie
52
4.1
Grundhaltung des Therapeuten
52
4.1.1
Neutralität
53
4.1.2
Neugier
55
4.1.3
Ressourcenorientierung
56
4.1.4
Erweiterung der Möglichkeiten
56
4.1.5
Verantwortung des Therapeuten
57
4.1.6
Therapeut- Klienten Beziehung
59
4.2
Techniken der systemischen Paartherapie
62
4.2.1
Diagnose
64
4.2.1.1
Aufnahmephase/Erstgespräch
64
4.2.1.2
Genogrammarbeit
66
4.2.1.3
Teufelskreise erkennen
72
4.2.2
Therapeutische Methoden
75
4.2.2.1
Hypothesenbildung
75
4.2.2.2
Systemisches Fragen
77
4.2.3
Systemische Interventionen
83
4.2.3.1
Skulpturen
84
4.2.3.2
Paradoxe Ansätze
86
4.2.3.3
Hausaufgaben
88
4.2.4
Abschluss der Beratung
89
5.
Fazit
91
Literaturverzeichnis
94
1
,,Jeder Fluss will zum Meer"
(Afrikanische Weisheit)
1. Einleitung
,,Danach gefragt, was im Leben Glück oder Unglück, Wohl oder Wehe, Gelingen oder
Misslingen am stärksten bestimmt habe, antworten die weitaus meisten, die auf ein
längeres Leben zurückschauen, es sei die Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer tieferen
Wünsche in Liebe und Partnerschaft gewesen" (Struck 2004, S. 1015, a.a.O.).
Dies macht deutlich, dass Paarbeziehungen anscheinend für sehr viele Menschen zu den
wichtigsten Beziehungen im Erwachsenenalter zählen. Der Wunsch nach einer erfüllten
Partnerschaft entspringt Struck (2004, a.a.O.) zufolge dem Urbedürfnis nach
Verbundenheit, Loyalität, Beständigkeit und Liebe, wobei verbindliche
Ausgestaltungsformen von Familiarität und Partnerschaft seiner Meinung nach losgelöst
von Erfindungen der Gesellschaft oder Kirche existieren.
Dennoch haben vielfältige gesellschaftliche Veränderungen dazu geführt, dass die
praktische Umsetzung dieses Wunsches, also die Gestaltung einer erfüllten
Partnerschaft, immer schwieriger wird bzw. größere soziale Kompetenzen erfordert als
noch vor einigen Jahrzehnten.
Unter anderem führt die heutige große Fülle an verschiedenen gesellschaftlich
akzeptierten Formen des Zusammenlebens von Mann und Frau (z.B. mit/ohne
Trauschein, mit/ohne Kinder, etc.) häufig zu großen Unsicherheiten, die mit einer
Überforderung einhergehen, für sein Leben eine passende Entscheidung zu fällen und
diese auch in die Tat umzusetzen. Die zunehmende Individualisierung und
Pluralisierung erhöhen die Unsicherheit, wie genau Beziehungen gestaltet werden
können und führt Paare auf der Suche nach Antworten in
Partnerschaftsberatungsstellen, wo sie sich Unterstützung in der Bewältigung ihrer
Konflikte erhoffen (vgl. Sanders 2004, a.a.O.).
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Paarbeziehungen und Paarkonflikten im Kontext
systemischer Beratung. Meine Intention ist es zum einen darzustellen, wie heutige
Partnerschaften gestaltet werden, welche Phasen sie durchlaufen und welche
Konfliktmuster für viele Paarbeziehungen kennzeichnend sind. Zum anderen wird der
Frage nachgegangen, auf welche Weise sich die systemische Beratung mit diesen
2
Konflikten auseinandersetzt und welche Möglichkeiten sie für Paare bietet, ihre
Beziehung auf eine Weise fortzuführen, dass der o.g. Wunsch nach Verbundenheit,
Loyalität, Beständigkeit und Liebe bei gleichzeitiger Individualität und persönlicher
Identitätsentwicklung (zumindest annähernd) erfüllt wird.
Der Leser soll durch diese Arbeit einen Eindruck und ein Gefühl für systemische
Beratung bekommen. Mir ist bewusst, dass ich natürlich nicht alle Aspekte und
Methoden systemischer Therapie berücksichtigen kann, da sonst der Rahmen der Arbeit
gesprengt würde, ich erhebe hier also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser
Arbeit werden jedoch die meiner Meinung nach wichtigsten Aspekte von
Paarbeziehungen, systemischer Theorie und Beratung aufgeführt und ausführlich und
nachvollziehbar dargestellt.
Ich habe mich dazu entschlossen, die Arbeit in die drei große Themenblöcke
Paarbeziehungen, Systemische Theorie, Modell einer systemischen Therapie zu
gliedern. Der dritte Block kann sozusagen als ,,Summe" aus dem ersten und zweiten
gelten, da er die beiden ersten Themen in sich vereint. Die Arbeit endet mit einem
abschließenden Fazit.
3
,,Nur wer sich ändert, bleibt sich treu"
(Wolf Biermann)
2. Paarbeziehungen
Befasst man sich mit der Frage, warum Männer und Frauen miteinander Beziehungen
eingehen, heiraten und vielleicht eine Familie gründen, stellt man fest, dass sie sich
nicht allgemeingültig beantworten lässt, sondern vor allem zeitlich - genauer
eingegrenzt werden muss.
Dem Paartherapeuten Jürg Willi (2004) zufolge kam es in den letzten Jahrzehnten zu
einem umfassenden Wandel in der Bedeutung und Umsetzung von Zweierbeziehungen.
Die Veränderung war eine so umfassende, wie es sie in Jahrhunderten zuvor nie
gegeben hatte und wurde Kernpunkt des revolutionären gesellschaftlichen Umschwungs
nach 1968. Tradition wurde von Individualisierung abgelöst, Zweck- bzw.
Vernunftehen traten zugunsten von Liebesehen in den Hintergrund bzw. verschwanden
völlig aus unserer Kultur.
Anders war dies in der vorindustriellen Zeit, als Paarbeziehungen - man spricht besser
von Ehe, denn nur so waren partnerschaftliche Beziehungen zwischen Männern und
Frauen möglich - einen rein funktionalen Anspruch hatten. Die Ehe war kein
Versprechen zwischen zwei Individuen, sondern ließ sich eher als Vertrag zwischen
zwei Familien beschreiben, die nach ökonomischen Gesichtspunkten geschlossen
wurde. Einerseits waren die Zwänge gerade bei viel Besitz besonders hoch, da
Produktion und Versorgung vorrangig waren, andererseits war eine auf diese Weise
eingegangene Ehe von hoher Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit gekennzeichnet,
da durch den Erhalt der Ehe das Ansehen des Hofes und durch Nachkommen seine
Weiterführung in die nächste Generation gewährleistet wurde (ders.).
Mit zunehmender Industrialisierung rückte die beschriebene Zweckehe in den
Hintergrund. Ehe wurde weniger kollektiv aufgefasst, als vielmehr personal definiert
und der Weg zu einer auf Liebe und Partnerschaft basierenden Paarbeziehung wurde
beschritten. Da die Ehe nun nicht mehr auf ,,handfesten" Fundamenten wie Besitz
aufgebaut wurde, sondern auf ,,wackeligeren" Beinen wie ,,Liebe" stand, erforderte dies
größere individuelle und gemeinsame Anstrengungen. Die Zahl der Eheschließungen
4
stieg dennoch seit Ende des 19. Jahrhunderts bis 1950 kontinuierlich an. In der heutigen
nachindustriellen Zeit wird der Partnerschaft eine höhere Wertschätzung
entgegengebracht als je zuvor und die Liebe ist der Herkunft überlegen (vgl. Willi
2004).
An dieser Stelle könnte auf die Frage ,,Was ist Liebe?" eingegangen werden, da sie
doch anscheinend den einzigen Grund für das Eingehen, bzw. Fortführen einer
Paarbeziehung darstellt. Da Ausführungen in der Richtung den Rahmen der Arbeit
jedoch sprengen würden, nenne ich nur einige Schlagwörter. Diese entstammen aus
einer Gesamtzahl von 90 verschiedenen Aspekten, die von Befragten zum Thema Liebe
in einer Untersuchung von Fehr und Russel (1991) genannt wurden. Hierzu zählen
Glück, Vertrauen, Akzeptanz, Offenheit, sich um den anderen sorgen, Sexualität, Opfer,
Verständnis. Hofer (2002) betont, dass eine Partnerschaft, die auf diesen Begriffen
aufbaut, mehr Beziehungsarbeit und Pflege verlangt, als eine Partnerschaft, wie sie in
der vorindustriellen Zeit herrschte
Ist es dieser Faktor, der zu einem Rückgang der Eheschließungen seit 1950 führte? Wie
lassen sich die stetig steigenden Scheidungszahlen erklären? Was hat sich verändert, so
dass Paartherapie ein eigener Berufszweig geworden ist? Welche Veränderungen haben
zur heutigen Situation von Paaren geführt?
2.1 Der gesellschaftliche Wandel von Paarbeziehungen und seine Auswirkungen
Im Folgenden möchte ich einen kurzen Rückblick über den gesellschaftlichen Wandel
in den letzten 30 bis 40 Jahren darstellen, infolgedessen sich die Bedeutung von
Paarbeziehungen drastisch geändert und zu ihrer heutigen Situation geführt hat.
Die ,,Reform" der Paarbeziehungen wird unterteilt in drei Bereiche (Sexualleben,
Struktur von Partnerschaft, Geschlechterrolle) dargestellt. Auf diese Weise wird es
ermöglicht, die unterschiedlichen Differenzierungen zu erkennen, ihren wechselseitigen
Einfluss nachzuvollziehen und den Umschwung am Ende in seiner Gesamtheit zu
begreifen.
Wenn nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die Ausführungen auf das Werk von
Jürg Willi ,,Psychologie der Liebe" (2004).
5
Durch die Einführung der ,,Pille" in den 60er Jahren wurde das Sexualleben von
Männern und Frauen radikal revolutioniert, da das neue Verhütungsmittel eine bisher
nicht gekannte sexuelle Freiheit ermöglichte. Bald entstand aus dieser Freiheit jedoch
ein Zwang sich sexuell frei zu geben und stets sexuell verfügbar zu sein. Der sexuelle
Leistungsdruck, der durch die neuen Freiheiten entstand, wurde für beide Geschlechter
immer größer. Lebte man diese Freiheiten nicht aus, wurden die repressive Erziehung
der Eltern und die triebfeindliche kirchliche Moral als Begründung herangezogen. Mit
der gelockerten Sexualmoral veränderte sich auch die Einstellung zur Treue und
Monogamie. Vor allem Männer wurden als nicht monogam veranlagt beschrieben,
äußere Treue garantiere keine innere Treue, deshalb sollte man lieber ehrlich und
authentisch mit seiner Sexualität umgehen sie also offen ausleben. Sexuelle
Außenbeziehungen, Partnertausch, Gruppensex und offene Ehen wurden auch in den
Medien - als natürlich bezeichnet. Freiheit in jeglicher Form war, Willi zufolge, das
Schlagwort zu dieser Zeit.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob Willi diese Entwicklung nicht zu sehr
verabsolutiert und auf alle sozialen Schichten bezogen hat. Vielmehr müsst man sich die
Frage stellen, ob diese Entwicklung in diesem Ausmaß nicht überwiegend Mitglieder
des sog. Bildungsbürgertums und weniger kleinbürgerliche Schichten betroffen hat.
Dies ist allerdings nicht Thema dieser Arbeit und wird daher nicht weiter ausgeführt.
Im Laufe der 80er Jahre ging der sexuelle Hedonismus zurück bzw. verschwand ganz.
Frauen lernten, dass zu einer sexuellen Freiheit auch gehört, nein zu sagen ohne deshalb
als verklemmt zu gelten. Paarbeziehungen waren zunehmend von sexueller Exklusivität
geprägt und Untreue wurde besonders von Frauen als Trennungsgrund angesehen.
Besonders die 90er Jahre zeichnen sich durch eine romantische Vorstellung von
Beziehung aus, die sich von der hedonistischen Idee, die noch wenige Jahre zuvor
herrschte, völlig abwendete. Als Grund für diesen Wandel ließe sich vielleicht die Angst
vor Aids anführen. Diese monokausale Erklärung wäre jedoch für einen so umfassenden
Umschwung zu einfach. Verständlicher wird er jedoch im Kontext der Entwicklungen
im Bereich der Partnerschaft und Geschlechterrolle.
Aufgrund der neuen sexuellen Freiheiten Ende der 60er Jahre rückten die traditionellen
Ehevorstellungen Willi zufolge in den Hintergrund und es wurde mit neuen Formen des
partnerschaftlichen Zusammenlebens experimentiert. Die individuelle
Entscheidungsfreiheit gewann an Bedeutung.
6
Infolge dieser Entwicklung änderte sich auch das Ansehen von Scheidungen und damit
die Scheidungsquote. In den 50er und zu Beginn der 60er Jahre (und natürlich davor)
wurde eine geschiedene Ehe als gescheiterter Lebensentwurf bezeichnet. Es bestand
eine Korrelation mit psychischen Störungen wie Depressionen, Alkoholismus und
Suizid, da Scheidungen einer hohen Diskriminierung unterworfen waren. Dies änderte
sich im Laufe der 70er Jahre und Scheidungen bekamen eine andere Bedeutung.
Besonders für Frauen wurden sie zum Ausdruck ihrer Emanzipation, Unabhängigkeit
und Freiheit. Im Umkehrschluss bedeutete das für die Ehe, dass sie als Zeichen für
Abhängigkeit, Bequemlichkeit oder Gewohnheit angesehen wurde und somit eine
Entwertung erfuhr. Diese Neubewertung äußerte sich vor allem im Rückgang der
Eheschließungen und gleichzeitigem Anstieg der Ehescheidungen. Ähnlich wie die
Entwicklung im Bereich des Sexuallebens setzte sich auch diese Bewegung in den 80er
Jahren nicht durch, die Ehe wurde wie viele andere partnerschaftliche Lebensformen
gesellschaftlich angenommen und als Ausdruck persönlicher Freiheit gewertet.
Die Scheidungsrate hat zwar kontinuierlich zugenommen, jedoch ist sie nicht mehr
Ausdruck der Emanzipation der Frau und erst recht kein Hinweis mehr auf einen
gescheiterten Lebensplan. Willi zufolge lässt sie sich von der Bedeutung her vielmehr
gleichsetzen mit der Kündigung eines Jobs, der aufgegeben wird, wenn er einem nicht
mehr zusagt. Da heutige Beziehungen auf Liebe aufgebaut werden, führt deren Fehlen
schnell zur Trennung und Scheidung, da weder gesellschaftliche, religiöse oder
ökonomische Zwänge die Beziehung zusammenhalten (vgl. Willi 2004).
Dass die Ehe trotz dieser Entwicklung weiterhin eine bevorzugte Form des
Zusammenlebens darstellt, zeigen die hohen Wiederverheiratungsziffern nach einer
Scheidung (1989 lagen sie bei 67%) (vgl. Hofer 2002). Um dieses Phänomen zu
beschreiben spricht man von ,,Serieller Monogamie". Eine Partnerschaft wird
eingegangen, man lebt in dieser Beziehung monogam, trennt sich wieder und geht nach
einiger Zeit eine neue monogame Beziehung ein (vgl. Hofer 2002). Enge Beziehungen
haben ihren Stellenwert also nicht verloren, aber die Einstellung zur Einmaligkeit der
Ehe hat sich geändert.
Willi (2004) beschreibt, dass mit den Entwicklungen im Sexualleben und in der Struktur
der Partnerschaft auch eine Änderung der Geschlechterrollen einherging. Das Modell
der Kleinfamilie, die unabhängig von der Herkunftsfamilie ihr Leben lebt, setzte sich
erst in der Zeit der Industrialisierung durch. Durch die klare Aufgabenverteilung der
7
Geschlechter - Männer sind mit ihrer Erwerbstätigkeit für die finanzielle Sicherung der
Familie zuständig, Frauen kümmern sich um Haushalt und Kinder - war die
Kleinfamilie selbständig und nach außen abgegrenzt.
Die zunehmende Technologie, die viele Erleichterungen im Haushalt mit sich brachte,
führte jedoch dazu, dass es für viele Frauen immer schwieriger wurde ihre Rolle als
Hausfrau mit Sinn zu füllen. Die Benachteiligung gegenüber Männern wurde für sie
deutlicher und der Kampf um Gleichberechtigung begann vor allem im beruflichen
Bereich. In den 70er Jahren besserten sich die Ausbildungs- und Berufschancen für
Frauen, so dass sie ihren Lebensweg nicht mehr nur in der Versorgung des Haushalts
und der Familie sahen. Durch diese Entwicklung verringerte sich die finanzielle
Abhängigkeit vom Partner und ökonomische Zwänge fielen als Grund für das
Fortführen einer Ehe weg (vgl. Willi 2004).
Das gestiegene Bildungsniveau von Frauen und die damit einhergehenden längeren
Ausbildungszeiten wirkten sich auch auf das Heiratsalter und die Familienbildung aus.
Waren Mitte der 60er Jahre 75% der 25jährigen Frauen verheiratet, so waren es 30
Jahre später weniger als 40% (vgl. Hill und Kopp 1997, in: Hofer 2002). Investieren
Frauen viel Zeit und Energie in ihre berufliche Ausbildung, so soll diese natürlich auch
genutzt werden und nicht direkt in Ehe und Familie führen. Durch die
Gleichberechtigung in der Ausbildung von Männern und Frauen wird von Frauen im
Falle einer Ehe und Familiengründung ein größeres Opfer verlangt als von Männern.
Trotz der Rollenangleichung der Geschlechter hat sich die traditionelle Arbeitsteilung
innerhalb der Ehe kaum geändert. Den Frauen wird immer noch die Aufgabe der
Kindererziehung zugeschrieben, die häufig nicht mit einer gleichzeitigen beruflichen
Verwirklichung zu vereinbaren ist. An dieser Stelle möchte ich anmerken, das es sich
hier nur um eine Darstellung von Familie handelt und es aufgrund der Pluralisierung
von Lebensformen natürlich auch andere (wenn auch seltener vorkommende) Modelle
gibt.
Die gesellschaftlich voll anerkannte nichteheliche Lebensgemeinschaft stellt besonders
für junge (noch) kinderlose Paare eine attraktive Alternative zur Ehe dar, die den Vorteil
relativ geringer ,,exit costs" (Hill und Kopp1997, in: Hofer 2002) im Falle einer
Trennung mit sich bringt und dennoch eine hohe Verbindlichkeit ermöglicht, die auf
Liebe beruht.
Durch den Wegfall traditioneller Milieus und der gleichzeitigen Zunahme von
Individualisierung und partnerschaftlichen Lebensformen haben sich Paarbeziehungen
8
zunehmend als Ort individueller Entwicklung herausgebildet. Waren die Lebenswege
von Männern und Frauen und die Inhalte von Paarbeziehungen bis in die 60er Jahre
hinein noch weitgehend vorbestimmt - der Mann als Ernährer der Familie, die Frau als
Hausfrau und Mutter - öffnet die Pluralisierung für junge Menschen in der heutigen Zeit
eine große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten. Diese erstrecken sich, um nur einige zu
nennen, auf Beruf, Lebensort, Partnerwahl und Beziehungsgestaltung. Der Soziologe
Gross bezeichnet diese Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, die unsere heutige Gesellschaft
kennzeichnet als Multioptionsgesellschaft (vgl. Welter-Enderlin 1996).
Innerhalb von Partnerschaften führte der Wegfall gesellschaftlicher Normen und Werte
und der dazugehörigen Rollenvorschrift, die früher das Verhalten bestimmte, dazu, dass
Paare heute eigenverantwortlich ihre Beziehung gestalten und in dauernder
Verhandlung darüber stehen. Diese Verhandlungen lassen sich Willi zufolge unter dem
Prinzip Eigennutz zusammenfassen. Er versteht hierunter, dass sich nur die
Lebensregeln durchsetzen, die der Selbstverwirklichung im Liebes- und Familienleben
beider Partner dienlich sind.
Eigennutz wird jedoch nicht mit Egoismus gleichgesetzt, da es um die Partnerschaft
geht und sich als Anpassungsvorteil nur das erweisen kann, was der Partnerschaft
Nutzen bringt und ihr Gedeihen fördert. Sexuelle Treue wird beispielsweise wieder als
Wert einer Beziehung anerkannt und akzeptiert. Sie hat sich als (Über-)Lebensvorteil
erwiesen und wird aus diesem Grund in Beziehungen erwartet. Werte, die vor der
sexuellen Revolution für Beziehungen galten, haben auch heute wieder Gültigkeit.
Jedoch nicht aufgrund vorgeschriebener Moralvorstellungen, sondern weil sie sich in
Beziehungen durchgesetzt haben und Menschen diese Werte für ihre Partnerschaft
selber festgelegt haben. Willi zufolge hat sich eine ,,Beziehungsethik" (2004, S. 69)
entwickelt, die den Platz kirchlicher und staatlicher Moralvorschriften eingenommen
hat. Werte, die sich nicht bewähren verschwinden wieder, unabhängig von den
Anstrengungen die vorher unternommen wurden, um sie überhaupt durchzusetzen. Mit
der Beziehungsethik lassen sich auch der verantwortungsvollere Umgang mit der
Sexualität, der hohe Stellenwert von Liebe und Zärtlichkeit in Beziehungen, sowie ein
freundschaftlicherer Umgang im Falle einer Trennung oder Scheidung erklären. All
diese Werte, die infolge der sexuellen Revolution in den 70er Jahren an Bedeutung
verloren hatten, bzw. gegen die angekämpft wurde, sind in heutigen Beziehungen
wichtiger denn je.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus nun für die Beziehungsgestaltung?
9
Durch die Zunahme an Wahlmöglichkeiten und der Freiheit sein Leben und seine
Beziehung individuell zu gestalten, wird zwar die Entfaltung des eigenen Potenzials
begünstigt, jedoch erhöht sich auch der Leistungsdruck auf das einzelne Individuum.
Richtig- oder Falsch-Bewertungen können nur aus dem eigenen subjektiven Befinden
heraus vorgenommen werden, die Orientierung an kirchlichen, gesetzlichen oder
moralischen Normen trägt weniger dazu bei (vgl. Willi 2004).
In Beziehungen wird Menschen ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität
abverlangt - Fähigkeiten, die die Individualität fördern, für die es jedoch keine
allgemein anerkannten Entwürfe gibt. Als Konsequenz für Paarbeziehungen ergibt sich
aus der Diskrepanz zwischen hohen Individualisierungszielen und geringer Erfahrung
mit dem Erreichen dieser, dass Regeln des Zusammenlebens ständig neu erfunden und
verhandelt werden müssen und nicht festgelegt sein dürfen. Dieser Vorstellung von
stetigem Wandel steht häufig der widersprüchliche Anspruch von gleich bleibender
romantischer Verliebtheit gegenüber, wie sie in den Anfängen einer Beziehung
vorkommt. Da aber niemand weiß, wie dieser Zustand konstant gehalten werden kann
und wie der enorme Druck, der durch den Anspruch hervorgerufen wird, auszuhalten
ist, steht die Partnerschaft zur ständigen Diskussion (vgl. Welter-Enderlin 1992).
Der Wandel, dem eine Beziehung und vor allem die Ehe unterliegt, der eine ständige
Anpassung und Flexibilität der einzelnen Partner erfordert und dessen Phasen jeweilige
Krisen mit sich ziehen, wird im folgenden Kapitel ausführlicher dargestellt.
2.2 Die Phasen einer Ehe mit ihren typischen Krisen
Willi (1997) zufolge werden Beziehungen häufig mit dem Anspruch eingegangen, dass
der anfängliche Zustand von ,,rosaroter" Verliebtheit ewig andauern müsse und dieses
Gefühl ein Qualitätsmerkmal der Beziehung sei. Dieser Zustand beschreibt jedoch nur
eine Phase in der Partnerschaft, die von relativ kurzer Dauer ist und die früher oder
später von einer anderen Phase abgelöst wird. Beziehungen sind kein statisches Gebilde,
welches über Jahre in einem gleich bleibenden Zustand verharrt, sondern sie lassen sich
vielmehr als Prozess beschreiben, der einem ständigen Wandel unterworfen ist. Viele
Krisen einer Partnerschaft entstehen gerade durch das Festhalten an einer Phase, welche
häufig aus Angst der Partner entsteht, sich in den Prozess hineinzubegeben und
,,mitzuschwingen". Sie fürchten beispielsweise den Verlust des Gefühls der
10
Verliebtheit, das sie ja überhaupt erst als Paar zusammengebracht hat. Jede Phase
verlangt eine Neudefinition der Beziehung, die nur zustande kommen kann, wenn man
bereit ist, sich von alten Definitionen zu lösen bzw. sie zu modifizieren. Der Übergang
von einer zur nächsten Phase wird häufig als krisenhafte Zeit erlebt, die Angst erzeugt.
Viele Paare versuchen deshalb sich dieser Dynamik zu entziehen, indem sie ihre
Beziehung im Idealisierungszustand erhalten wollen und Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten, die sie als einzelne Individuen identifizieren, aus dem Weg
zu gehen versuchen. Gerade dieses Vermeidungsverhalten führt in eine Krise und häufig
zum Ende der Partnerschaft, da das kommunikative Auseinandersetzen mit dem Partner
gestört wird und die Liebe nicht mehr gedeihen kann.
Führt bei einer Partnerschaft das Vermeiden von Konflikten zu größeren Konflikten oder
sogar zur Beendigung der Partnerschaft, führt in anderen Beziehungen genau das
gegenteilige Verhalten zum gleichen Ergebnis. Jürg Willi (1997) beschreibt dieses
Verhalten als ,,Tendenz zur Flucht nach vorn" (S. 31). Viele Paare wissen sowohl um
die Prozesshaftigkeit einer Beziehung, als auch darum, dass Konflikte zu einer
Partnerschaft dazugehören und ausgetragen werden sollten. Ein Großteil ihrer
Kommunikation dreht sich darum, mögliche ,,Konfliktherde" direkt auszudiskutieren
und zu bereinigen. Meinungsverschiedenheiten können oft nicht ausgehalten und
akzeptiert werden, sondern sollen ,,geklärt" werden, damit das Gefühl von Trennung
innerhalb der Partnerschaft gar nicht erst aufkommt.
Beide beschriebenen Strategien haben also trotz unterschiedlicher Herangehensweise
das gleiche Ziel: Trennendes in der Partnerschaft zu vermeiden und den Zustand der
anfänglichen Symbiose beizubehalten. Aus beiden Strategien folgt häufig auch das
gleiche Endergebnis - eine Zunahme der Konflikte, da die Partnerschaft in ihrer
Dynamik gestört wird (vgl. Willi 1997).
Im Folgenden werden die einzelnen Phasen einer Paarbeziehung dargestellt, die
Prozesshaftigkeit wird verdeutlicht und die Krisen, die oftmals charakteristisch für die
einzelnen Phasen sind, werden herausgearbeitet. Die Titel der verschiedenen Phasen
sind Willis Werk ,,Die Zweierbeziehung" (1997) entnommen.
11
2.2.1 Die Phase der stabilen Paarbildung
Beginnen Jugendliche sich für das andere Geschlecht zu interessieren und gehen
Beziehungen ein, so sind diese oft noch stark narzisstisch geprägt und weisen eine hohe
Inkonstanz auf. Jugendliche wechseln ihre Partner häufig und der Partner wird weniger
um seiner selbst Willen geliebt, sondern viel mehr aufgrund des Gefühls, welches er in
einem selbst hervorruft. Die Fähigkeit, einen anderen Menschen für sich zu erobern,
steigert das Selbstwertgefühl und unterstützt einen jungen Menschen in seiner
Identitätsbildung. Der Test des eigenen ,,Marktwertes" verhilft dazu die eigenen
Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen und sich durch die Reaktionen des Partners
seiner eigenen Qualitäten und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden. Wenn sich die
Identität weitestgehend herausgebildet hat, der Adoleszente sich und seine Rollen kennt
und sich ein Gefühl innerer Kontinuität eingestellt hat, verlieren Beziehungen ihren
selbstbezogenen Charakter und der Wunsch nach einer dauerhaften intimen
Partnerschaft wächst (vgl.Willi 1997).
Es geht darum, sich in seiner intimsten Persönlichkeit erkannt zu fühlen (vgl. Willi
2004) und durch dieses Verstanden- und Angenommenwerden zu persönlichen
Wachstumsschüben angeregt zu werden (vgl. Cöllen 1984).
Doch nicht nur das Gefühl, in seinem individuellen Wachstum unterstützt zu werden,
beflügelt einen Menschen, sondern auch die Überzeugung, seinem Partner ebenso die
Möglichkeit zu bieten. Zu dem Gefühl der geistigen Verbundenheit kommt noch die
sexuelle Anziehungskraft, so dass Verliebte nach ständigem Körperkontakt streben.
Eine Beziehung, die sich in der ersten Phase der Verliebtheit befindet, weist einen
symbiotischen Charakter auf, der der Mutter-Kind-Symbiose ähnlich ist. Diese enge
Verbindung dient jedoch keinem Selbstzweck, sondern bereitet das Individuum auf
neue Lebensaufgaben vor (vgl. Cöllen 1984) und gibt der Partnerschaft eine
gemeinsame Basis, auf der eine gemeinsame Welt aufgebaut werden kann (vgl. Willi
2004). Wie auch das Kind sich irgendwann aus dieser Symbiose lösen wird, kann auch
eine Beziehung diese enge Kongruenz nicht ewig aufrechterhalten.
Durch die Tatsache, dass in einer Beziehung zwei unterschiedliche Individuen
aufeinander treffen, treten Differenzen und Meinungsverschiedenheiten auf, die die
Chance zur eigenen Persönlichkeitsentfaltung und Individuation innerhalb einer
Partnerschaft bieten. Es geht hier um die Fähigkeit zur Abgrenzung bei gleichzeitiger
Hingabe. Cöllen (1984) zufolge prallen in dieser Phase also zwei dynamische
12
Entwicklungen aufeinander. Zum einen geht es um das Erlernen von Partnerschaft als
Lebens- und Liebesgemeinschaft, zum anderen um die individuelle
Persönlichkeitsentwicklung. Das eigenständige Hinaustreten aus der Symbiose ist
besonders schwierig und schmerzhaft, wenn diese sehr eng war und von den Partnern
als Qualitätsmerkmal der Beziehung gewertet wurde. Differenzen werden nicht als
notwendiger Vorgang wahrgenommen, der Chancen bietet, sondern werden als
Liebesverlust und Bedrohung für die Beziehung empfunden (vgl. Cöllen 1984).
Vertrauen, Flexibilität und Anpassungsvermögen sind hier besonders wichtig, um die
Beziehung in die nächste Phase zu geleiten (vgl. Willi 2004).
2.2.2 Die Aufbau- und Produktionsphase der Ehe
Diese Phase bezieht sich auf die ersten Ehejahre und ist meist von einer hohen Aktivität
gekennzeichnet. Diese umfasst unter anderem die Identitäts- und Rollenfindung als
Ehepaar und die Schaffung eines eigenen Raumes in der Gesellschaft (vgl. Willi 1997).
Während in der Verliebtheitsphase die gemeinsamen Visionen des Paares oft einen
utopischen Charakter aufweisen (vgl. Willi 2004), geht es nun um die Realisierung
konkreter Ziele (vgl. Willi 1997). Die Schaffung eines eigenen Heimes, die berufliche
Karriere und die Familienplanung stehen im Vordergrund.
Diese Anforderungen können das Paar zu Höchstleistungen antreiben und es in ihrer
gemeinsamen Identität festigen und zusammenschweißen. Jedoch birgt diese Phase auch
viele Gefahren und Schwierigkeiten. Besonders die Themen ,,Karriere" und ,,Kinder"
können die Ehe in eine Krise hineinführen (vgl. Willi 1997). Durch hohe berufliche
Anforderungen leidet die Ehe, da kaum noch Zeit und Energie für sie aufgebracht
werden kann. Beide Partner möchten sich selbstverwirklichen und die Partnersolidarität,
unter der Cöllen (1984) das gemeinsame Eintreten für die Interessen des anderen
versteht, kommt oft zu kurz.
Wird in dieser Phase eine Familie gegründet, bedeutet das besonders für die Frau eine
große Umstellung. Sie muss für eine vorübergehende Zeit ihre berufliche Tätigkeit
aufgeben oder zumindest einschränken, sich in wirtschaftliche Abhängigkeit des
Mannes begeben und gleichzeitig den Binnenraum der Familie aufbauen (vgl. Welter-
Enderlin 1992). Es kommt zu einer meist unerwarteten Retraditionalisierung der
Partnerschaft, die sich mit zunehmender Ehedauer stabilisiert und eine wachsende
13
Unzufriedenheit der Frau mit sich ziehen kann (vgl. Papastefanou/Hofer 2002, a.a.O.).
Diese neue Rolle in ihrer Persönlichkeit zu integrieren und trotz der Abhängigkeit vom
Mann innerlich autonom zu bleiben, um das für die Beziehung notwendige Maß an
Selbständigkeit zu erhalten, gestaltet sich für Frauen als sehr schwierig und macht sie
verletzlich.
Die veränderte Rollenverteilung wirkt sich jedoch auch auf den Mann aus. Die
Anforderungen an ihn steigen, da er nun meistens Alleinverdiener in der Familie ist und
damit eine größere (finanzielle, existentielle) Verantwortung trägt. Er möchte sich
einerseits nicht vom Beruf vereinnahmen lassen, sondern sich auch der Familie widmen,
andererseits möchte er aber seine Karriere verfolgen- eine Zwickmühle, die
Schwierigkeiten hervorrufen kann.
Beide Partner leiden darunter, ihre ursprünglichen modernen Vorstellungen den
traditionellen Zwängen unterordnen zu müssen. Die Spannungen zwischen
Partnerschaft, Kindern und Beruf sind die häufigsten Gründe, die dazu beitragen, dass
Ehen zerbrechen (vgl. Welter-Enderlin 1992). Durch die Doppelbelastung, denen
Männer und Frauen ausgesetzt sind, werden Bindungselemente wie Zärtlichkeit und
Zeit füreinander haben häufig vernachlässigt, und die Ehezufriedenheit kann sich
vermindern. Die anfängliche sorglose Verliebtheit wird vermisst und es kommt in dieser
Phase besonders oft zu Untreue, die dem Wunsch nach schneller konfliktfreier
Entspannung entspringt und mit der Vorstellung einhergeht, die eigene Persönlichkeit
durch neue Liebe zu stärken (vgl. Cöllen 1984).
Mit all diesen genannten Problemen sieht sich nahezu jede Partnerschaft konfrontiert
und es verlangt viel Durchhaltevermögen und den flexiblen Wechsel zwischen
Individualisierung und Partnersolidarität, um die gemeinsamen Lebensaufgaben und die
damit einhergehenden Krisen zu meistern und sich seinen ursprünglichen Lebensplan zu
erfüllen (ders.).
Trotz der vielfältigen Differenzen ist das Risiko einer Trennung in dieser Phase nicht
höher als sonst, da diese Möglichkeit, angesichts des Ernstes und der Größe der
gemeinsamen Aufgaben, in den Hintergrund tritt (vgl. Willi 1997).
14
2.2.3 Die Krise der mittleren Jahre
Der Aufbau einer Familie und beruflichen Stellung von dem die letzte Phase
gekennzeichnet war, ist in der Phase der Lebensmitte weitestgehend abgeschlossen. Die
Kinder wachsen heran und werden zunehmend unabhängiger von ihren Eltern. Äußere
Ziele, deren Erreichung das Paar bisher zusammengehalten hat und die für
Gemeinsamkeiten sorgten, fallen zunehmend weg und hinterlassen Willi (1997) zufolge
ein Gefühl von Leere.
Gleichzeitig ist es jedoch meiner Meinung nach auch gerade diese gemeinsam
bewältigte Vergangenheit, die ein Paar in dieser Zeit zusammenhält.
Die Tatsache, die Mitte seines Lebens erreicht zu haben, führt dazu, dass in dieser Zeit
Bilanz gezogen wird, der Lebensplan überprüft und vielleicht der Wunsch nach
grundlegender Änderung verspürt wird (vgl. Cöllen 1984). Hat man seine persönlichen
Interessen jahrelang der Familie und dem Partner untergeordnet, ist man jetzt häufig
nicht mehr bereit dazu, sondern möchte die verpassten und geopferten Lebenschancen
nachholen.
Inhaltlich unterscheiden sich hier die Situationen von Männern und Frauen. Männer, die
in dieser Phase ihre beruflichen und persönlichen Ziele noch nicht erreicht haben,
schieben die Schuld häufig ihrer Ehe und damit ihrer Partnerin zu. Sie fühlen sich durch
sie in ihrer Entwicklung eingeengt und versuchen gerade dann auszubrechen, wenn die
Frau die Rolle des Sündenbocks nicht annimmt. Unter anderem führt oft dieses
subjektiv wahrgenommene Unverständnis seitens der Partnerin dazu, dass Männer eine
Außenbeziehung eingehen.
Doch auch beruflich erfolgreiche Männer geraten in eine Krise, die mit der Frage
einhergeht, ob sich die ganzen Anstrengungen auch wirklich gelohnt haben oder man
nicht andere Lebensmöglichkeiten dadurch verpasst hat. Auch die Angst vor dem
Älterwerden führt bei Männern nicht selten zu einer Außenbeziehung. Gerade eine
jüngere Geliebte vermittelt dem Mann das Gefühl, noch einmal selbst als Junger von
vorne beginnen zu können. Aufgrund von finanziellen und wirtschaftlichen Zwängen
oder aus der Verantwortung der Kinder gegenüber, verbleiben Männer vielleicht
dennoch in der Ehe und versuchen möglicherweise eine dauerhafte Dreiecksbeziehung
einzugehen. Allerdings kann es auch vorkommen, dass das Vorhandensein einer
Geliebten den Mann wieder darauf besinnt, was er mit seiner Partnerin schon alles
15
erlebt und aufgebaut hat und er die Ehe und Familie wieder als etwas Sinnvoll-
Bestätigendes wahrnimmt (vgl. Willi 1997).
Willi beschreibt hier nur den Mann als potentiellen Fremdgänger, ich möchte darauf
hinweisen, dass Frauen diesen Weg natürlich auch einschlagen können.
Durch die vorhergehenden Ausführungen könnte der Eindruck entstehen, das vor allem
Männer in dieser Lebensphase aus ihrer Ehe ausbrechen möchten. Die
Scheidungsstatistik spricht jedoch dagegen. Sie weist gerade die Frauen als die
treibende Kraft aus (vgl. Cöllen 1984). Die Frage, ob diese Tatsache dafür spricht, dass
für Frauen die Phase der mittleren Jahre von größeren Schwierigkeiten geprägt ist, oder
ob sie einfach ,,mutiger" als Männer sind, lässt sich nicht beantworten.
Trotzdem kann man feststellen, dass das Leben von Frauen in dieser Phase von
größeren Umbrüchen betroffen ist, als das der Männer. Selbst wenn sie schon seit
einiger Zeit wieder in den Beruf eingestiegen sind, oder ihn vielleicht nie aufgegeben
haben, so waren sie bisher mehr als der Mann mit der Kindererziehung beschäftigt. Eine
Aufgabe, die mit zunehmendem Alter der Kinder entfällt und eine Lücke hinterlässt. Da
Frauen in dieser Altersphase als weniger attraktiv als Männer betrachtet werden und die
Wechseljahre Frauen ihre körperlichen Veränderungen deutlich vor Augen führen,
besteht die Gefahr, das sie das Gefühl haben, ihre besten Jahre verpasst bzw. der
Familie geopfert zu haben (vgl. Willi 1997). Da Kinder in einer Ehe oft eine
verbindende Funktion zwischen den Ehepartnern einnehmen, jetzt aber erwachsen und
unabhängig werden, müssen andere Bindeglieder ihre Position einnehmen (gemeinsame
Interessen, Hobbys,...).
Die Elternbeziehung rückt in den Hintergrund und der Stellenwert der Paarbeziehung
gewinnt wieder an Bedeutung (vgl. Cöllen 1984). Aufgrund dieses Wandels erhöht sich
häufig die Ehezufriedenheit. Der Auszug der Kinder entlastet die Eltern, da sie nun von
den Pflichten und der Verantwortung der Kinder gegenüber weitestgehend befreit sind
und sich diesbezügliche partnerschaftliche Spannungen lösen (vgl. Papastefanou/Buhl
2002, a.a.O.).
Die Phase der mittleren Jahre ist davon geprägt, anstelle der äußeren Zielorientierung
eine Wertorientierung innerhalb der Paarbeziehung zu finden und die
Persönlichkeitsentfaltung trotz fehlender äußerer Ziele gemeinsam weiterzuverfolgen.
Gelingt dies nicht, ist der Fortbestand der Ehe bedroht und es kann zur Trennung oder
Scheidung kommen (vgl. Cöllen 1984).
16
Die Lebensmitte ist also von einem großen Umbruch geprägt, in dem allerdings eine
große Chance zur persönlichen Reifung liegt. Inhaltslos gewordene
Lebensgewohnheiten können aufgegeben werden, der Mut zur Veränderung stärkt das
Selbstvertrauen (ders.) und ,,man sieht zwar die Fehler, die man aneinander und
miteinander begangen hat, sieht, dass diese Fehler Konsequenzen hatten, die teilweise
nicht mehr rückgängig zu machen sind, lernt aber auch, sich gegenseitig in einer
tieferen Weise zu verstehen und damit sich mit sich selbst und dem Partner zu
versöhnen" (Willi 1997, S. 45). Dieser Versöhnungsprozess kann einer Partnerschaft
dazu verhelfen, den Wert ihrer Beziehung wieder anzuerkennen und die Beziehung in
die nächste Phase zu geleiten.
2.2.4 Die Altersehe
Diese letzte Phase einer Ehe beginnt ungefähr mit der Pensionierung einer oder beider
Partner. Die Anpassung an die neue Lebenssituation wird häufig als schwierig erlebt,
selbst wenn die Pensionierung gewünscht und an große Erwartungen gekoppelt ist.
Hausfrauen fällt es schwer, sich an die ständige Anwesenheit des Mannes zu gewöhnen
und beklagen die Einmischung des Partners in ihre Domäne (vgl. Zank 2002, a.a.O.).
Willi (1997) zufolge können sie die Pensionierung des Mannes auch als positiv
empfinden, weil sich das Gleichgewichtsverhältnis zu ihren Gunsten verschiebt, da sich
der Mann nun in derselben Position wie sie befindet.
Sind beide Partner einer Berufstätigkeit nachgegangen, so scheidet der häufig ältere
Mann früher aus dem Berufsleben aus. Der Status- und Rollenverlust wird ihm in dieser
Situation besonders deutlich und kann zu Aggressionen und Neid auf die Partnerin
führen (vgl. Zank 2002, a.a.O.). Sind dann beide Partner pensioniert, ist das
Gleichgewicht in der Ehe wiederhergestellt (vgl. Willi 1997) und besonders durch die
erhöhte Zuwendung der Frau dem Partner gegenüber, intensiviert sich die
Paarbeziehung (vgl. Zank 2002, a.a.O.). Der Wegfall bisher wichtiger Lebensinhalte
kann als Chance genutzt werden, die neu gewonnene freie Zeit und Energie zur
Vertiefung und Erneuerung der Beziehung einzusetzen. Verschüttete oder verloren
geglaubte Gefühle können auf diese Weise wieder reaktiviert werden (vgl. Cöllen
1984).
17
Studien ergeben, dass Paare zwischen 63 und 65 Jahren ein hohes Ausmaß an ehelicher
Zufriedenheit zeigen. Dieses Ergebnis könnte dadurch erklärt werden, dass negativ
verlaufende Partnerschaften schon zu einem früheren Zeitpunkt geschieden werden.
Jedoch ist auch festzustellen, dass sich Männer und Frauen zunehmend nach
langjähriger Ehe von ihrem Partner scheiden lassen. 9% aller Scheidungen werden nach
mehr als 25 Ehejahren eingereicht (vgl. Zank 2002, a.a.O.).
Anhand der dargestellten Phasen wurde deutlich, dass es sich bei der Ehe nicht um
einen Zustand, sondern um einen Prozess handelt. Bei der inhaltlichen Darstellung der
Phasen erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da diese meiner Meinung nach
aufgrund der Vielfalt des Lebens auch nicht möglich ist. Es gibt zwar viele
Abweichungen von den Phasen, dennoch wird jedes Paar im Verlauf seiner Beziehung
viele Krisen durchstehen müssen, die an bestimmte Lebensphasen gebunden sind. Die
daraus resultierenden Probleme sind allen Zweierbeziehungen gemeinsam und kaum
vermeidbar.
Diese Regelhaftigkeit zeigt, dass Paare es hier nicht mit neurotisch bedingten, aus der
Kindheit herrührenden Konflikten zu tun haben (vgl. Cöllen 1984), sondern mit
notwendigen und unumgänglichen Spannungen und Krisen, die mit jeder Ehe
einhergehen (vgl. Willi 1997). Jede Phase trägt zur individuellen Entwicklung der
Partner und der Partnerschaft bei, so dass sich die gemeinsame Basis verbreitert und
sich die Paarbeziehung intensiviert (vgl. Cöllen 1984). Die Krisen können als
Bereicherung oder als Überforderung angesehen werden (vgl. Willi 1997), vermieden
werden können sie aber nicht nur überwunden (vgl. Cöllen 1984). Diese
Herausforderung verlangt von Männern und Frauen sowohl ein hohes Maß an
Flexibilität und Anpassung als auch das Wissen um diese Phasen und ihre Krisen, um
sie einordnen zu können und nicht als Zeichen einer schlechten Partnerschaft zu werten.
18
2.3 Grundstrukturen problematischer Beziehungen
Befasste sich das letzte Kapitel mit meist unumgänglichen Phasen und Krisen, die jede
längere Beziehung oder Ehe durchläuft, so werden jetzt typische Muster dargestellt, die
sich bei vielen Paaren aufdecken lassen, die zur Bewältigung ihrer Beziehungsprobleme
therapeutische oder beraterische Hilfe in Anspruch nehmen. Zunächst wird das
Kollusionskonzept nach Jürg Willi dargestellt. Dieses wird nur kurz angerissen, da es
sich nicht um ein typisch systemisches Modell handelt. Meiner Meinung nach spielt es
jedoch auch im Zusammenhang mit Systemischer Paartherapie eine bedeutende Rolle,
da es in engem Zusammenhang mit dem Teufelskreismodell verstanden werden kann.
Dieses systemische Modell, welches von Christoph Thomann und Friedemann Schulz
von Thun in ihrem Werk ,,Klärungshilfe 1" (2003) beschrieben wird, wird anschließend
ausführlich dargestellt.
2.3.1 Das Kollusionskonzept
,,Definition der Kollusion: (colludere (lat.), zusammenspielen; collude (engl.), in
heimlichem Einverständnis sein). Unbewusste und uneingestandene Komplizenschaft
im Zusammenspiel von Partnern. Sie dient der Verwirklichung unreifer
Liebessehnsüchte und sichert gleichzeitig die Abwehr der damit verbundenen Ängste.
Die Kollusion vermittelt ein Gefühl von spezieller Nähe und Unentbehrlichkeit
füreinander. Sie mobilisiert hohe Entwicklungsmotivationen und verhilft manchen
Personen, sich überhaupt eine Liebesbeziehung zuzutrauen. Eine Kollusion wird
dadurch pathologisch, dass sie zu einer Verpflichtung auf eine Beziehungsform wird,
aus der es kein Entrinnen gibt und die keine weiterführende Entwicklung und
Veränderung zulässt. Die Delegation von Persönlichkeitsanteilen auf den Partner
erweist sich als Übergriff auf dessen persönliche Integrität und Autonomie" (Willi 2004,
S. 210).
Diese Definition fasst das umfangreiche Kollusionskonzept sehr prägnant zusammen,
bedarf aber ausführlicherer Erklärungen.
Das Eingehen einer Liebesbeziehung ist verknüpft mit einer Fülle von Erwartungen,
Hoffnungen und Sehnsüchten, die man an den Partner richtet und die häufig dem
Wunsch entspringen, unerfüllte Kindheitswünsche nachzuholen und die damaligen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832490126
- ISBN (Paperback)
- 9783838690124
- DOI
- 10.3239/9783832490126
- Dateigröße
- 733 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2005 (September)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- kollusionskonzept autopoietische systeme mailänder team teufelskreise genogrammarbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de