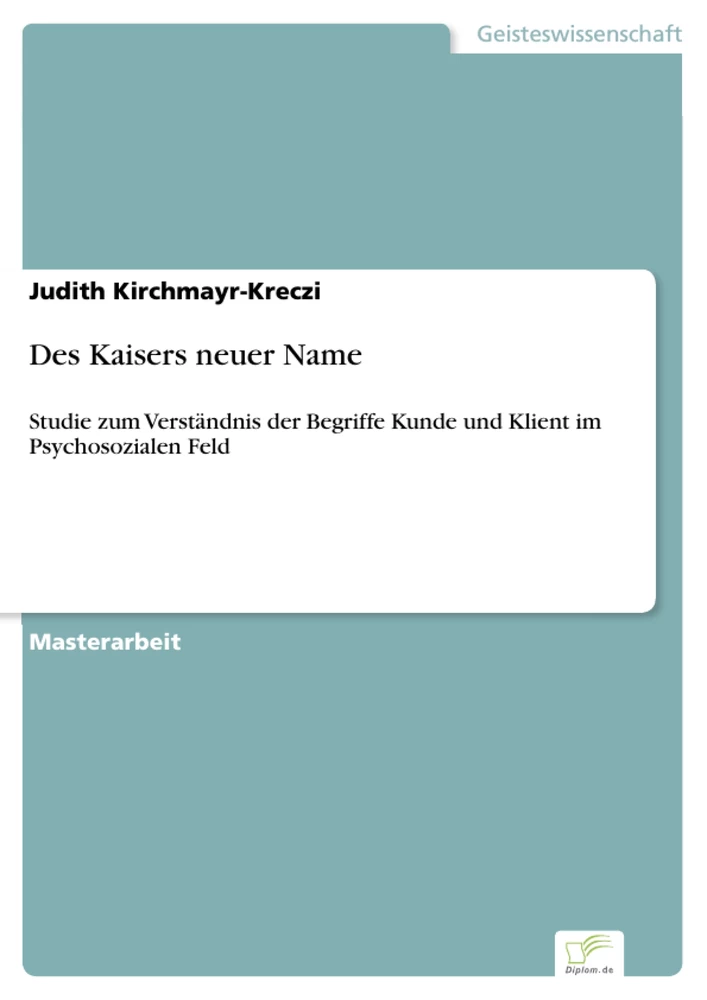Des Kaisers neuer Name
Studie zum Verständnis der Begriffe Kunde und Klient im Psychosozialen Feld
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung und das Verständnis der Begriffe Kunde und Klient im Psychosozialen Feld. Zugrunde liegt die These, dass der Klientenbegriff im Rahmen fachspezifischer Forschung und Lehre professionell geformt wurde und für die Arbeit im psychosozialen Feld Sinn stiftende und für das konkrete berufliche Handeln Orientierung bietende Bezüge und Bedeutungsgebungen erfahren hat. Der Kundenbegriff aus der Wirtschaftswelt ist hingegen bei jedem Einzelnen in sozialem Wildwuchs entstanden und bietet den Mitarbeitern im Psychosozialen Feld keine adäquaten Sinn und Orientierung bietenden Bezüge.
Im theoretischen Teil werden dazu der aktuelle sozialpolitische und sozialwissenschaftliche Diskurs abgebildet und Fragestellungen für die empirische Untersuchung entwickelt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen die inneren Bilder und Bezüge von Mitarbeiterinnen im Psychosozialen Feld hinsichtlich der Einschätzung bzw. Zuschreibung von persönlichen Eigenschaften, Motivationen für die Annahme von Hilfe, Beziehungsqualitäten in der helfenden Beziehung und der Handlungsspielräume in Krisensituationen bei Kunden und Klienten.
Einleitung:
Die vorliegende Arbeit untersucht ein Thema, das in den letzten Jahren die Arbeit im psychosozialen Feld zunehmend beeinflusst und häufig, heftig und kontrovers in Praxis und Theorie diskutiert wird: Die Verwendung der Begriffe Kunde/ Kundin beziehungsweise Klient/ Klientin für die Adressaten psychosozialer Leistungen.
Nun könnte man - vor allem wenn man den komplexen Anforderungen der Arbeit im psychosozialen Feld mit wenig Erfahrung gegenübersteht berechtigter weise fragen, ob Kunde oder Klient nicht eine triviale Angelegenheit sei? Sollte nicht die dahinter stehende Dienstleistung das Bedeutsame sein? Und was ist kritikwürdig an der Verwendung eines Begriffs, der allgemein als zeitgemäß empfunden wird und der stärker werdenden Dienstleistungsorientierung in der Sozialen Arbeit entspricht?
Die Fragestellung ist aus meiner Sicht nicht trivial, sondern aus vielerlei Gründen komplex und aktuell. Ich versuche mit der vorliegenden Arbeit zu zeigen, dass es Sinn macht, zum besseren Verständnis der beiden Begriffe und einer eigenständigen Definition des Kundenbegriffs in der psychosozialen Arbeit einen weiterführenden Beitrag zu leisten.
Es mag für psychosoziale Fachkräfte bekannt klingen und ist eine der neurologisch bestens belegten Erkenntnisse aus der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis:
1 Theoretische Bezüge
1.1 Einleitung
1.1.1 Innere Bilder und Vorstellungen als handlungsleitende Motive
1.1.2 Der Klientenbegriff ist professionell geformt
1.1.3 Der Kundenbegriff aus der Wirtschaftswelt ist ungeeignet
1.2 Definitorische Aspekte von Klient und Kunde
1.2.1 Der Begriff Klient
1.2.2 Der Begriff Kunde
1.2.3 Adressatenbegriffe in relevanten Gesetzen
1.3 Exkurs: Vom Wohlfahrtsstaat zur postmodernen Sozialarbeit
1.3.1 Psychosoziale Arbeit heute
1.4 Klient und Kunde im Sozialwissenschaftlichen Diskurs
1.4.1 Psychosoziale Arbeit ist polyvalent
1.4.2 Soziale Arbeit als Dienstleistung – tatsächlich eine mächtige Idee?
1.5 Der Kunde als „besonderer Klient“
1.5.1 Kritische Aspekte: Die Sehnsucht nach dem mündigen Klienten
1.5.2 Ressourcenreiche Aspekte: Kunden und Nicht-Kunden
1.6 Unterschiede Kunde / Klient – Zusammenfassung
2 Die empirische Untersuchung
2.1 Zielsetzung und Thesenentwicklung
2.2 Erhebungsdesign
2.2.1 Definition der Grundgesamtheit
2.2.2 Erstellung der Stichprobe
2.3 Deskriptive Ergebnisse
2.4 Prüfung der Forschungshypothesen
2.4.1 Klient und Kunde im Eigenschaftsprofil
2.4.2 Die Bedeutung von Beziehungsqualitäten
2.4.3 Adressatenbegriffe im psychosozialen Feld
2.4.4 Erläuterung von Fachbegriffen in Aus- und Fortbildung
2.4.5 Motivation bei Kunden und Klienten
2.4.6 Handlungsmöglichkeiten in Krisensituationen
2.5 Diskussion
3 Verzeichnisse
3.1 Literatur
3.2 Tabellen
3.3 Abbildungen
3.4 Anhang: Fragebogen
Erklärung
1 Theoretische Bezüge
1.1 Einleitung
1.1.1 Innere Bilder und Vorstellungen als handlungsleitende Motive
Die vorliegende Arbeit untersucht ein Thema, das in den letzten Jahren die Arbeit im Psychosozialen Feld[1] zunehmend beeinflusst und häufig, heftig und kontrovers in Praxis und Theorie diskutiert wird:
Die Verwendung der Begriffe Kunde/ Kundin beziehungsweise Klient/ Klientin[2] für die Adressaten Psychosozialer Leistungen.
Nun könnte man - vor allem wenn man den komplexen Anforderungen der Arbeit im Psychosozialen Feld mit wenig Erfahrung gegenübersteht – berechtigter weise fragen, ob „Kunde oder Klient“ nicht eine triviale Angelegenheit sei? Sollte nicht die dahinter stehende Dienstleistung das Bedeutsame sein? Und was ist kritikwürdig an der Verwendung eines Begriffs, der allgemein als zeitgemäß empfunden wird und der stärker werdenden Dienstleistungsorientierung in der Sozialen Arbeit entspricht?
Die Fragestellung ist aus meiner Sicht nicht trivial, sondern aus vielerlei Gründen komplex und aktuell. Ich versuche mit der vorliegenden Arbeit zu zeigen, dass es Sinn macht, zum besseren Verständnis der beiden Begriffe und einer eigenständigen Definition des Kundenbegriffs in der Psychosozialen Arbeit einen weiterführenden Beitrag zu leisten.
Es mag für psychosoziale Fachkräfte bekannt klingen und ist eine der neurologisch bestens belegten Erkenntnisse aus der Hirnforschung, wenn Gerhard Hüther (2004,S.9) sagt: „ ( ... ) es (ist) alles andere als belanglos, wie die inneren Bilder beschaffen sind, die sich ein Mensch von sich selbst macht, von seinen Beziehungen zu anderen und zu der ihn umgebenden Welt. ( ... ). Es gibt Bilder, aus denen Menschen Mut, Ausdauer und Zuversicht schöpfen, und es gibt solche, die Menschen in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung stürzen lassen.“
Auch Laucken (1973,S.152ff) konnte in seiner Studie über Naive Verhaltenstheorien zeigen, wie sehr Gefühle Motivdispositionen aktualisieren können.
Das Entstehen und Wirken von inneren Bildern als „handlungsleitende, Orientierung bietende innere Muster“ (Hüther 2004,S.16) ist auch Gegenstand der aktuellen Diskussion in der zunehmend systemisch geprägten Diskussion um die Rolle der Psychosozialen Arbeit in der Postmodernen Gesellschaft.
„Wenn etwa beobachtet wird, wie das Bild, das sich eine Sozialarbeiterin von einem Klienten macht, entstanden ist, könnte deutlich werden, dass es von ihren theoretischen Vorentscheidungen, von ihrer emotionalen und psychischen Verfassung oder von ihren eigenen Erfahrungen abhängig ist. Dieses Bild erscheint, postmodern ausgedrückt, als ein ästhetisch konstruiertes Muster, das mehr über uns selbst, über unser Denken und Fühlen aussagt, als über den Klienten“ (Kleve 1999,S.103).
Es macht in der täglichen Arbeit mit Menschen - psychischen und sozialen Systemen - einen Unterschied, ob ein Begriff, der als Benennung für den Hauptgegenstand meiner Arbeit dient, bzw. wie noch zu sehen sein wird, in hohem Maß die Beziehung definiert, einfach gesagt, emotional positiv oder negativ besetzt ist.
So stehen im Zentrum dieser Arbeit die Fragen:
- Wie sehen die aktuellen inneren Bilder, die sich Theoretiker und Praktiker von Kunden und von Klienten machen, aus?
- Welche Vorstellungen haben diese Professionellen von Eigenschaften, Beziehungsqualitäten, Motivationen, Handlungsmöglichkeiten im alltäglichen Umgang mit ihren Klienten – und mit Kunden?
- Sind die Vorstellungen ähnlich oder stark unterschiedlich?
- Welche Chancen / Ressourcen werden in der Psychosozialen Arbeit mit dem Kundenbegriff verbunden?
- Wie könnte eine Sinn stiftende Verwendung des Kundenbegriffs aussehen?
Um der Aktualität sowie der Natur des Themas Rechnung zu tragen, habe ich bei der Wahl und der Darstellung der Literatur versucht, den derzeitigen sozialpolitischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs zu spiegeln und mich dabei vor allem an Beiträge aus den letzten 5 – 7 Jahren gehalten.
Bemerkenswert erscheint in der Auseinandersetzung mit theoretischen Aspekten insgesamt, dass der Begriff Kunde, wo er in der Literatur gut geheißen wird, ohne weitere Diskussion einfach verwendet wird. Wo er als problematisch gesehen wird, steht er in der Regel unter Anführungszeichen und wird fast ausschließlich kritisch-ablehnend diskutiert. Differenzierte befürwortende Verwendungen des Kundenbegriffs finden sich nur vereinzelt in systemischen und vorwiegend psychotherapeutischen Ansätzen (vgl. deShazer 1989, Hargens 1993, Vogel 1997).
1.1.2 Der Klientenbegriff ist professionell geformt
In 12 Jahren beruflicher Praxis als Diplomsozialarbeiterin und weiteren 15 Jahren als Supervisorin, Beraterin und Lehrbeauftragte in Psychosozialen Fachausbildungen bin ich auf mannigfache Bezeichnungen für die Adressaten von Sozialen Leistungen im engeren und weiteren Sinn gestoßen: Klienten, Ratsuchende, Betreute, Bewohnerinnen, Kids, Alte Menschen, Behinderte, Adressaten, Verpflichtete, Parteien, Jugendliche, Menschen mit Handicap,
Der Begriff Klient tauchte immer wieder als Sammelbegriff, als generelle Bezeichnung für die Adressaten von psychosozialen Leistungen auf. Er bildete - und bildet mir auch heute noch - einen positiv konnotierten und Sinn stiftenden Teil einer gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion der höchst multiprofessionellen Mitarbeiterlandschaft im Psychosozialen Feld.
Die mit dieser gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion verbundenen Aspekte, vielfach auch die Nachteile und Gefahren wurden und werden in den Sozialwissenschaften untersucht. Es besteht darüber ein lebhafter wissenschaftlicher Diskurs (vgl. etwa Knieschewski 1978, Friedrich 2001, Ritscher 2002, Haupert 2003) der meiner Erfahrung nach von den Praktikern in Aus- und Weiterbildungen bereitwillig wahrgenommen und z.B. auch in supervisorischer Fallarbeit klärend und nährend verarbeitet wird.
Die mit dem Klientenbegriff verbundenen inneren Bilder und Assoziationen wurden in reflektorisch kontrollierten Ausbildungssituationen und spezifischen fachlichen Kontexten erworben und geformt.
Sie stellen handlungsleitende und identitätsbildende innere Landkarten für den professionellen, ethisch korrekten Umgang mit den in der psychosozialen Arbeit bedeutsamen Herausforderungen dar: Etwa für die Bedeutung der Helferrolle, den Umgang mit Macht und Abhängigkeit, Nähe und Distanz, Zwang, Krisen, aber auch Empathie, Authentizität, Selbstbestimmung, Ressourcen, Motivation und Entwicklung.
1.1.3 Der Kundenbegriff aus der Wirtschaftswelt ist ungeeignet
Mit dem vehementen Platzgreifen von Management-Ideen in der Leitung und Organisation Sozialer Einrichtungen und der damit verbundenen Einführung und Umsetzung von unterschiedlichsten Qualitätsmanagement-Konzepten (vgl. etwa Friedrich 2001, Schubert/Zink 2001) schleust sich ein neuer bisher nur im wirtschaftlichen Kontext geläufiger Begriff in Theorie und Praxis der Psychosozialen Arbeit ein: Der Kunde, die Kundin.[3]
„Ich weiß gar nicht genau, wer jetzt meine Kunden sein sollen. Gesetzlich muss ich das Kindeswohl im Auge haben – aber sind die Minderjährigen dann meine Kunden? Oder deren Eltern, die mein Eingreifen gar nicht gut heißen? Oder die Lehrer, die sich über die Verhaltensauffälligkeiten beschweren? Oder die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft, wo ich das Kind unterbringe? Oder die Pflegschaftsrichterin, der ich die Entscheidung vorbereite?“ (Sozialarbeiterin / Jugendwohlfahrt).
„Wenn unsere Alten Menschen jetzt Kunden sind – muss ich dann die, die mehr bezahlen können, auch besser behandeln? Das ist doch absurd!“
(Altenfachbetreuer / Seniorenheim).
„Wir müssen unsere Klienten jetzt als Kunden sehen – aber was heißt denn das, wenn einer voll zugedröhnt randaliert und andere Bewohner zusammenschlägt. Den muss ich doch stoppen dürfen!“ (Sozialarbeiter / Obdachloseneinrichtung).
„Was ist, wenn ein Klient den Kontakt mit uns gar nicht will? Einen Kunden muss ich doch gehen lassen, wenn er nichts kaufen will. Bei uns ist es aber oft so, dass wir etwas von den Leuten wollen - wollen müssen.“
(Mitarbeiterin / Sozialpädagogische Familienhilfe).
Diese Aussagen – sinngemäß und verdichtet wiedergegeben – zeigen die Verwirrung und die Unsicherheit, die mit der unreflektierten Verwendung des Kundenbegriffs derzeit ausgelöst werden.
Die These ist, dass für die Verwendung des Begriffs Kunde in der Psychosozialen Arbeit (noch) keine konstruktiven „handlungsleitenden Orientierung bietenden inneren Muster“ (Hüther 2004,S.16) zur Verfügung stehen.
Die einfache Übernahme des Begriffs aus den wirtschaftsbezogenen Management-Lehren erzeugt Unsicherheit und Verwirrung – und für die Psychosoziale Arbeit ungeeignete Assoziationen und Vorstellungen über die eigene Identität und Handlungsfähigkeit als professionelle Helferin.
Der Begriff Kunde bietet den professionellen Helfern als Vorstellungsfeld lediglich an, was bei jedem Einzelnen in „sozialem Wildwuchs“ – also unkontrolliert, höchstpersönlich und unreflektiert – im Laufe seines Lebens als Kundenerfahrung verankert wurde: Erinnerungen und Vorstellungen über gute oder schlechte Bedienung, Werbegeschenke, Geburtstagskarten, Terminerinnerungen, gute oder schlechte Ware, Reklamationssituationen, etc. Keineswegs kann – wie später noch gezeigt wird - ein so übernommener Kundenbegriff der Komplexität der Anforderungen in der Psychosozialen Arbeit gerecht werden (vgl. Merchel 2001,S.39f, Pfeiffer-Schaupp 1999,S.230f).
Der Kundenbegriff in der Psychosozialen Arbeit braucht meiner Ansicht nach ein im gemeinsamen Diskurs von Theoretikerinnen und Praktikern erarbeitetes Sinn stiftendes Bedeutungsfeld, eine eigenständige Definition.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dazu einen Beitrag zu leisten.
1.2 Definitorische Aspekte von Klient und Kunde
1.2.1 Der Begriff Klient
Etymologisch leitet sich das Wort Klient aus dem lateinischen cliens – der Hörige ab. Das seit dem 16. Jhdt. bezeugte Wort bezeichnete . „ (...) den sich an einen Patron schutzeshalber anschließenden, also den Schutzbefohlenen einer Sippe. Das Verhältnis des Schutzbefohlenen (...) zum Patron wurde mit „la clientela“ bezeichnet“ (Duden-Etymologie 1989,S.351).
„Das Lateinische cliens gehört wahrscheinlich zu dem mit dt. lehnen urverwandtem Verb ... und bedeutet dann „jemand, der Anlehnung gefunden hat“ (ebd.).
Mit dem Begriff Klient wird seit jeher vorrangig ein Beziehungsverhältnis ausgedrückt, nicht eine Person bzw. ihre Eigenschaften beschrieben. Dies findet sich in den Definitionen in Fachwörterbüchern durchgehend widergespiegelt:
So weisen Kreft-Mielenz (1996,S.367) darauf hin, dass in Kontexten von Sozialarbeit davon auszugehen ist, „...dass Äquivalenz strukturell nicht erreicht werden kann, weil Klienten zu Äquivalenzleistungen nicht in der Lage sind ... Klient zu werden und Klient zu sein bedeutet, in komplexen, defizitären Situationen sich bewegen müssen.“
Das Wörterbuch der Sozialarbeit und Sozialpädagogik (Schwendke 1997,S.253) weist in diesem Zusammenhang auf die terminologische Veränderung der meisten Begriffe der sozialen/sozialpädagogischen Fachsprache im Zuge der Modernisierung und Professionalisierung hin und definiert Klienten als „Hilfsbedürftige, Ratsuchende, Personen, die Betreuung, Beratung und Hilfe von SA/SP[4] in Anspruch nehmen“.
Die Schwierigkeit der Definition „(...) geht vor allem (auf) die unterschiedlichen Auffassungen und Positionen zur Rolle und Funktion des ‚Objektes’ sozialpädagogisch/sozialarbeiterischer Praxis zurück, die sich in vielerlei Adressaten-Definitionen niederschlägt, so in pathologischen und medizinischen, bürokratischen, (päd-)agogischen, sozial-ethischen, administrativ oder juristisch definierten“(Schwendtke 1997, S.254). Das Verhältnis Sozialarbeiter/Klient weist laut Schwendtke die Beziehung als eine mit einem professionellen Status aus und impliziert gleichzeitig eine einseitige Abhängigkeit. Der Begriff Klient wird „somit (...) durch den komplementären Gegenbegriff (bestimmt): professioneller Berufsvertreter, Experte, Vertreter des akademischen Berufs,...“
Hier wird eine wechselseitige Abhängigkeit deutlich: Wie Identität, Auftrag und Handlungsspielraum des Mitarbeiters im Psychosozialen Feld beschaffen sind, hängt nicht nur mit seinem Beruf und dem institutionellen Auftrag, sondern eben auch mit der (Eigen-)Art seiner Klientinnen zusammen. Was in Psychotherapie und Beratung schulenübergreifend als entscheidender Wirkfaktor (vgl. etwa Frauchinger 2004, Hain 2001) genannt wird, liegt im Klientenbegriff bereits explizit definiert vor: Die Bedeutung der Einzigartigkeit und Unaustauschbarkeit der helfenden Beziehung, die Personalität.
1.2.2 Der Begriff Kunde
Kunde leitet sich aus Mittel- und Althochdeutschen Worten für „Bekannter, Einheimischer“ ab. Seit dem 16. Jhdt. bezeichnet er speziell „der in einem Geschäft (regelmäßig) Kaufende“ (Duden-Etymologie 1989,S.394). Als weitere Bedeutungen nennt der Duden demonstrativ: Bursche, Schelm, Nachricht, Botschaft, Wissenschaftliche Kenntnis, Lehre und eine Reihe davon abgeleiteter Begriffe wie z.B. Erkundung, Ankündigung, Erkundigung, Kündigung, Kundschaft.
Der Begriff Kunde ist in seiner Bedeutungsgebung seit jeher vielfältig und abhängig von den Kontexten, in denen er verwendet wurde.
Er definiert sich über Aktivitäten mehr als er eine Beziehung definiert: Knauers Wörterbuch der Synonyme (Raduszweit/Spalier 1984,S.315) schlägt zum Begriff Kunde vor: Käufer, Abnehmer, Verbraucher, Bezieher, Konsument, Interessent, Auftraggeber, Kundschaft, und Nachricht.
Der Begriff Kunde hat in der Psychosozialen Arbeit keine tradierte und somit auch keine entsprechend reflektierte Bedeutung – so z.B. findet sich der Begriff in etwa 5 Jahre alten Fachwörterbüchern (noch) nicht. Lediglich das Fachlexikon der Sozialen Arbeit (Wolf 2002, S.594) nennt kommentarlos den Begriff der „Kundenorientierung“ und gibt Querverweise auf Verwaltungsmodernisierung und Sozialmarketing.
Kreft-Mielenz (1996,S.367f) führen unter dem Stichwort „Klient“ aus, dass es in der Sozialen Arbeit schwer sei, den Klienten als Kunden zu verstehen, da die Adressaten meist als „unfreiwillige Kunden“ Dienstleistungen erhalten, selbst mitarbeiten müssen, schlechte Leistungen kaum ablehnen können, bessere Leistungen nicht einklagen können, Zahler und Nutzer nicht identisch sind. Sie kommen zu dem kritisch formulierten Schluss:
„ Die Entwicklung eines Adressatenverständnisses i. S. des ‚Kunden’ wird in Theorie und Praxis der Sozialarbeit vernachlässigt, wenn nicht sogar bewusst vermieden. Hier werden erhebliche Modernisierungsdefizite für die Konzeption von SozArb. in einer weit gehend ökonomisch orientierten Dienstleistungsgesellschaft deutlich.“
1.2.3 Adressatenbegriffe in relevanten Gesetzen
Da in Österreich weite Teile der Psychosozialen Arbeit sozialstaatlich geregelt sind, erscheint es an dieser Stelle relevant, welche Bezeichnungen der Gesetzgeber in den einschlägigen Gesetzen als Bezeichnungen für die Betroffenen vorsieht.
Die Gesetze, mit denen Behandelnde und Beratende Berufe geregelt werden – das Ärztegesetz (BGBl. I Nr 169 / 1998), das Psychotherapiegesetz (BGBl. Nr. 361 / 1990), das Psychologengesetz (BGBl. Nr. 360 / 1990), die Gewerbeordnung (BGBl. Nr. 194 / 1994)[5], das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (BGBl. Nr. 108 / 1997) das Zivilrechts-Mediationsgesetz (BGBl. I Nr. 29 / 2003), das Jugendwohlfahrtsgesetz (BGBl. Nr. 161 / 1989), sprechen überwiegend von Patienten und Klienten, aber auch etwa von Ratsuchenden, Parteien, von Menschen mit Erkrankungen und Störungen, von Minderjährigen, Tatopfern und Zeugen.
Der Kundenbegriff wird nicht verwendet.
Dies legt die Vermutung nahe, dass eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Begriff Kundin in der Psychosozialen Arbeit auch auf juristischer Basis noch aussteht.
1.3 Exkurs: Vom Wohlfahrtsstaat zur postmodernen Sozialarbeit
Um die Forderung nach der Verwendung des Kundenbegriffs auf gesellschaftlicher Ebene nachvollziehen zu können, erscheint es notwendig, den Strukturwandel zur modernen Dienstleistungsgesellschaft skizzenhaft darzustellen. Er bildet die Hintergrunderzählung einer Entwicklung, die – was die Praxis der Psychosozialen Arbeit betrifft – mehr und mehr spürbar wird.
Betrachtet man die Entwicklung der Erwerbsarbeit, so „ ...(stehen) die reifen Industrieländer an einer Wendemarke wie die Agrargesellschaften beim Übergang zur Industriegesellschaft“ (Hengsbach 2003,S.50). Hengsbach sieht die Arbeit / Dienstleistung am Menschen als die Arbeit der Zukunft: „In der Industriewirtschaft nämlich waren Qualifikationen wie das Zählen, Wiegen, Messen gefragt, in der kulturellen Dienstleistungsgesellschaft ist die Kompetenz des Heilens, Beratens und Spielens wichtiger“ (ebd.S.52).
Dieser Wandel war begleitet von der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates.
„Mit der Berufung auf ‚Wohlfahrt’ wandelte sich der Legitimationsgrund staatlicher Souveränität: Rechtfertigte sich der absolute Souverän seine Macht als göttliche Gnade, so verstand sich sein aufgeklärter Erbe als ‚erster Diener des Staates’ im Dienste des Wohls aller Bürgerinnen und Bürger. ‚Wohlfahrt’ konkretisierte sich nun in der Einheit von Wohlstand, Gerechtigkeit und Sicherheit. Der neue Herrschaftsanspruch einer ‚guten Polizey’ war die öffentliche ‚Sorge’ für das ‚Wohl und Wehe’ der Untertanen“ (Pankoke 2003,S.304).
Die Arbeiterbewegung brachte zunächst eine Absicherung der Standardrisiken hervor: Krankenversicherung und Alterssicherung, Arbeitslosenversicherung. „ Nur zögernd engagierte sich der Wohlfahrtsstaat (...) nun auch für Familienprobleme, Wohnungsfragen, Gesundheitsprobleme. (...) Die auf Absicherung des Lebensstandards zielende wohlfahrtsstaatliche Daseinsvorsorge wurde nun ergänzt durch die Sicherung und Förderung der Qualität des Lebens“ (ebd.S.306).
Zunehmend gerät der Wohlfahrtsstaat nicht nur unter finanziellen Druck. In der Postmodernen Gesellschaft verlieren bewährte Solidaritäten familiärer, verwandtschaftlicher aber auch unternehmerischer Art ihren sozialen Rahmen. Pankoke spricht von den aktuellen Problemen des Wohlfahrtsstaats als „Problemlagen eines wohlfahrtsstaatlichen Pauperismus“[6], in denen bei den Verantwortlichen Sorge besteht, „immer mehr Fälle fallen lassen (zu) müssen“ (ebd.S.307).
Mit den äußeren Bedingungen veränderte sich auch das gesellschaftliche Verständnis von Identität und Identitätsbildung.
„Identität hat aufgehört, das ‚Gegebene’ zu sein, ein Produkt der ‚göttlichen Kette des Seins’. Statt dessen ist sie seit Anbruch der Moderne ein ‚Problem’, eine individuelle Aufgabe. (...) In seiner klassisch modernen Form bestand das Problem der Identität für die meisten Männer und Frauen in der Notwendigkeit, aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln ihre sozialen Positionen zu besetzen, eher durch Leistung und Aneignung als durch ererbten Besitz. Es galt ein Ziel abzustecken – ein Modell der gewünschten Identität zu entwickeln und dann ein Leben lang verbissen an der durch das Ziel vorgegebenen Reiseroute festzuhalten“ (Baumann 1998,S.27f).
Lebensentwürfe dieser Art werden heute angesichts der allzeit- und allerorts gültigen Forderung nach Flexibilität und Mobilität mehr und mehr zum Problemfall.
Baumann (1998, S.26) definiert als kennzeichnend für die Postmoderne: „Die Politik der Bewegungen wird durch die Politik der Kampagnen ersetzt, die auf sofortige Ergebnisse abzielen und sich nicht um langfristige Folgen kümmern; das Verlangen nach dauerndem (ewigem!) Ruhm weicht dem Interesse an öffentlicher Berühmtheit (...) jene Identitäten, die dazu ausersehen waren, gewissenhaft errichtet zu werden und das ganze Leben zu bestehen, werden durch Identitäts-Bausteine ersetzt, die unverzüglich montiert und wieder abgerissen werden können.“
Keupp (2002,S.63ff) definiert Identität als „Selbstnarration“, als erzählende Antworten auf die Frage „Wer bin ich?“ , in denen subjektiver Sinn in Bezug auf die eigene Person kreiert wird. Er sieht diese persönlichen Texte eingebettet, bzw. untergebracht in maßgeblich zwei größere kulturelle Erzählungen, die er kritisch erläutert.
Die eine sieht den Menschen der „schönen neuen Welt“ als modular gestaltbares Wesen, flexibel, anpassungsfähig an äußere Standardisierungen und funktional brauchbar in einer „Netzwerk-Gesellschaft“. Dafür ist mentale und körperliche „Fitness“ – die Fähigkeit, sich in schnell wechselnden Strukturen, Werten und Kontexten zu bewegen und das Erlernen des Vermeidens von Festlegungen- das Ausschlag gebende Merkmal.
Die andere Meta-Erzählung nimmt dem Menschen die Auseinandersetzung mit der realen komplizierten Welt ab, indem sie angesichts aktueller Problemlagen auf „uralte unhintergehbare Wahrheiten, Ordnungen und Kräfte“ verweist. Der Mensch müsse diese anerkennen und ihnen zustimmen, Widerstand führe zu weiterem Leid.
Keupp spricht davon, „wie weit und mit welchen Kosten sich das Subjekt in seiner alltäglichen Identitätsarbeit seinen Identitätsprojekten annähern kann“ und folgert: “Gelungene Identität ermöglicht dem Subjekt das ihm eigene Maß an Kohärenz, Authentizität, Anerkennung und Handlungsfähigkeit. Wie diese Modi in der Regel aber in einem dynamischen Zusammenhang stehen, weil beispielsweise Authentizität und Anerkennung in Widerstreit geraten können, ist gelungene Identität in den allerseltensten Fällen ein Zustand der Spannungsfreiheit“ (ebd.S.67).
Was Baumann auch als die „Postmoderne Dekonstruktion der Unsterblichkeit“ (1998,S.26) bezeichnet, geht sozialpolitisch mit der Forderung nach Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger – „Eigenverantwortlichkeit als Erhaltung der Fähigkeit, seinen Verpflichtungen nachzukommen (...) die Versorgung von Selbstversorgungsunfähigen (gehört) zu diesen Pflichten“ (Schefczyk 2003,S.60) einher. Dass der Staat für seine Bürger sorgt, ist ein Trugschluss: „Letztendlich sind es die Bürgerinnen und Bürger, die füreinander etwas tun und leisten“(ebd.S.59). Sache des Staates ist es, sich Mittel für Soziale Leistungen dort zu besorgen, wo Bürger erfolgreich Verantwortung übernehmen und die Sozialgesetzgebung so zu gestalten, dass sie sozial und ethisch erfüllbar bleibt, und das gelingt nur, wenn persönliche Autonomie und Eigenverantwortung genügend Raum gegeben wird.
Der Sozialstaat wandelt sich heute von „ ...wohlfahrtstaatlicher Gewährleistung (providing) zur Ermöglichung (enabling, empowerment) aktiver Solidarität...“ (Pankoke 2003,S.308).
Vor diesem Hintergrund sind die aktuellen sozialstaatlichen Versuche, aus Klienten Kunden machen zu wollen, nur zu verständlich:
Wenn der aus tradierten Herrschaftsstrukturen entwickelte Wohlfahrtsstaat Klienten mit lebenslangen Klienten-Identitäten und den damit verbundenen Kosten produziert, steht das in krassem Widerspruch zu den Anforderungen einer globalisierten Gesellschaft, die Flexibilität und den konstruktiven Umgang mit sozialer Komplexität als (über-)lebensnotwendig einfordern muss.[7]
1.3.1 Psychosoziale Arbeit heute
Mutig und visionär positioniert Kleve (1999) Soziale Arbeit in der modernen Gesellschaft als eigene Wissenschaft und beschreibt sie als „bereits funktional ausdifferenziertes (sekundäres) Funktionssystem der Gesellschaft“ (S.185ff).
Eine bedeutsame Unterscheidung bilden dabei die Konzepte von Sozialer Integration / Desintegration versus Exklusion / Inklusion. Während Soziale Integration auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ( z.B. Familie, Schicht) , also auf eine „Lebenswelt“ verweist, beschreibt Inklusion die Möglichkeit, bzw. in der modernen Gesellschaft auch die Notwendigkeit, an mehreren Funktionssystemen bzw. Organisationen zugleich teilzunehmen. Um gut leben zu können, kann und muss sich der Mensch heute individuell - und eben nicht mehr normativ in seine Familie/Sippe/Gemeinde integriert - körperlich und psychisch, finanziell, bildungsmäßig, spirituell, politisch so ausrichten, dass er bei den von ihm als relevant ausgewählten Funktionssystemen Inklusion erreicht.
Soziale Arbeit ist „grundsätzlich problemorientiert, d.h. sie bezieht sich auf sozial problematisierte Exklusionen“ (Kleve 1999,S.275) und ihre Funktion ist:
1. Exklusionsbegrenzung – etwa die Unterstützung von Armen, Arbeits- und Obdachlosen mit Mitteln aus der Sozialhilfe
2. Exklusionsverwaltung – etwa in der Betreuung von Langzeitarbeitslosen, und /oder in der Inklusionsvermittlung – etwa die Ermöglichung der Wieder-Teilnahme am Arbeitsmarkt sowie in der
3. Exklusionsvermeidung – etwa die vielfältigen Angebote psychosozialer Beratung, wie z.B. Suchtberatung oder Erziehungsberatung.
Die Arbeit im psychosozialen Feld ist nach Kleve (ebd.) Gerechtigkeitsarbeit in mehrfachem Sinn: sie verschafft Menschen mit ihren Bedürfnissen Gehör, wo diese in ihrer Artikulation unterdrückt werden, sie befriedigt stellvertretend Bedürfnisse (nach Kontakt, Achtung, Status, Beziehung, aber auch z.B. Wohnung und Versorgung) wo sie im primären Funktionssystem nicht möglich ist. Insofern unterscheidet sich die moderne Soziale Arbeit radikal von wohlfahrtsstaatlichen Konzepten der Norm - Abweichung mit folgender Integrationsarbeit: es sind nun so viele Normen denkbar „wie es passende Lebensentwürfe gibt“ (ebd. S.308).
Ausdruck finden diese Entwicklungen in der Idee des derzeit in der Psychosozialen Arbeit immer öfter geforderten Konzeptes von „Empowerment“, das im Unterschied zu den tradierten Konzeptionen – so sehen es jedenfalls seine Befürworterinnen – wie etwa „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Eigenverantwortlichkeit, Eigeninitiative, Eigenmotivation und Selbstermächtigung von Klientinnen stärker betont.[8]
„In dem Maße in dem die eigene Lebensgeschichte nicht mehr von Herkunft, Familie, langfristigen Bindungen und fest gefügten sozialen Strukturen bestimmt wird (...) erscheint es glaubhaft, den einzelnen auch für das Gelingen oder Scheitern seines oder ihres Lebens verantwortlich zu machen“ (Günther 2002,S.118). Günther bezeichnet diese aktuelle Verwendung des Verantwortungsbegriffes als inflationär, da offen bleibt „welche Möglichkeiten, Kompetenzen, Charaktereigenschaften, welche Voraussetzungen der Selbststeuerung und Selbstkontrolle, welche internen und externen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Person in geforderter Weise von ihrem Können und ihrer eigenen Initiative auch erfolgreich Gebrauch machen könnte“ und es bleibt offen „ob es sich bei diesen Voraussetzungen um ein schon tatsächlich vorhandenes und nur wieder zu aktivierendes Vermögen geht, oder ob dieses Vermögen erst erzeugt werden muss“ (ebd.S.120f).
Wenn Eigenverantwortung einfach zugewiesen oder geradezu erzwungen wird, bleibt dem Betroffenen „nur die Alternative, sich dem zu unterwerfen und die Ideale der eigenverantwortlichen Lebensführung repressiv zu internalisieren oder sich äußerlich anzupassen“ (ebd.S.122).
Der Empowerment-Anspruch in der Psychosozialen Arbeit gerät in Gefahr, eine Paradoxie zu erzeugen: Was Eigenverantwortung garantieren soll, kann nur als Disziplinierung erfahren werden und würde damit doch nur wieder die bekannten Klientifizierungsprozesse erzeugen.
1.4 Klient und Kunde im Sozialwissenschaftlichen Diskurs
1.4.1 Psychosoziale Arbeit ist polyvalent und fordert ein differenziertes Menschenbild
Nach Kleve (1999,S.17f) ist die postmoderne Soziale Arbeit strukturell ambivalent, bzw. polyvalent – mehr- und vieldeutig, mehr- und vielwertig, voll von Uneindeutigkeiten, Unbestimmbarkeiten, Widersprüchlichkeiten, paradox in psychischen, sozialen bzw. kommunikativen Verhältnissen und deren Beobachtung.
„Eine ambivalente Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Beobachtung einer Situation, eines Ereignisses, einer Handlung, einer gesellschaftlichen Praxis zwei oder mehr gegensätzliche, sich widersprechende Blickpunkte, Beobachtungen bzw. Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen gleichermaßen plausibel erscheinen“ (ebd.S.22).
Wenn etwa eine Klientin nach erfolgter Beratung nicht mehr wiederkommt, können die Helfer nicht wissen, ob das – auch sozialstaatlich geforderte Ziel, nämlich dass sich die Klientin fürderhin selbst helfen kann – erreicht wurde oder nicht. Das Nicht-wieder-kommen einer Klientin kann gleichermaßen Erfolg oder Misserfolg bedeuten - ganz abgesehen von der Unmöglichkeit, hier zeitliche, persönlichkeitsbezogene oder diagnostische Standards heranzuziehen zu können.
Mit der so formulierten Notwendigkeit, mit Polyvalenzen umgehen zu können, benennt Kleve m.E. punktgenau jenes Unbehagen, das Menschen, die im psychosozialen Feld arbeiten, verspüren, wenn sie angehalten sind, den Kundenbegriff kritiklos zu übernehmen: Das Verhältnis von Verkäufer und Kunde ist nicht strukturell ambivalent, sondern reziprok, eindeutig benennbar und im positiven Fall auch widerspruchsfrei. Das Verhältnis von Klient und Helfer – auch das beste! - beschreibt seit jeher eine komplementäre Beziehung und all ihre Ambivalenzen und Einzigartigkeiten.
Im Zentrum der Kritik stehen neben der dargestellten als unangemessen zu verwerfenden Komplexitätsreduktion psychosozialer Arbeit, die durch die Anwendung kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Grundprinzipien entsteht, auch die Ungleichheit in der Klienten-Helfer Beziehung.
Schon Knieschewski (1978,S.40ff) diskutierte ausführlich die Unmöglichkeit reziproker Beziehungen zwischen Klientinnen und ihren Helfern. Er schrieb dem beruflichen Selbstbild professioneller Helfer darüber hinaus durchwegs eine defizitäre und laienhaft pathologisierende Sichtweise in Bezug auf ihre Klienten zu (ebd.S.171ff). Er nannte „die Zuweisung einer durch einseitige Abhängigkeit beschreibbaren Rolle (...) über die ein ‚professional’ gegenüber dem Adressaten seines beruflichen Handelns verfügen kann“, Klientifizierung (ebd.S.9). „Klienten werden gemacht“ postulierte Knieschwski und kritisierte vor allem die bis dato noch weit gehend unbedeutende Situationsdefinition durch Klienten selbst.
Seine Untersuchungen führten in den folgenden Jahren zu einem differenziertem Problembewusstsein in der Theorie, aber auch in Ausbildung und reflektorischer Praxis professioneller Helferinnen. Der weiteren Ausdifferenzierung des Problems folgten, vor allem über die Auseinandersetzung mit systemischen Konzepten in der Sozialen Arbeit, neue und ressourcenreichere Beschreibungen und Interpretationen der Klient-Helfer-Beziehungen.
„Für die Struktur der Beziehung zwischen Beratern und Klienten ist eine deutliche Asymmetrie charakteristisch, die sich schon in den Begriffen ‚Ratsuchende’ und ‚Ratgeber’ zeigt. Diese Asymmetrie betrifft verschiedene Dimensionen: die Beraterinnen verfügen über ein spezifisches Fachwissen, sie haben eine größere Distanz zum Problem und sind damit nicht in gleicher Weise betroffen wie die Klienten und sie verfügen über umfassende Kenntnisse über Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten“ (Rauchfleisch 2001,S.36).
Mit dem gesellschaftlich und gesetzlich geforderten Ende der autoritär-kustodialen Fürsorge (vgl. Ritscher 2002, Vogel 1997) wird die Abkehr von der „Fremddefinition eines psychischen und materiellen Bedürfnisses durch professionelle Expertinnen“ (Ritscher 2002, S.188) angesagt. Die Adressatinnen psychosozialer Leistungen sollen nunmehr ihren individuellen Bedarf an Dienstleistungen professionellen psychosozialen Einrichtungen in Auftrag geben. Inwieweit solche Ansprüche möglicherweise von vorneherein aporetisch sind, zeigt die in dieser Untersuchung wiederkehrende Kritik am „Kunden(un)wesen“. Dabei wird wohl gesehen, dass die Kundenmetapher mit ihren Schlagwörtern Kundenorientierung, Dienstleistungsmanagement und Bedarfsorientierung konstruktives Potential in sich birgt. Merchel (2001,S.40f) spricht von „einer positiven strategischen Bedeutung“ des Kundenbegriffs, der die Aufmerksamkeit auf verschiedene aktuelle Notwendigkeiten in der Sozialen Arbeit lenkt. So sei es etwa notwendig, sich Adressatenwünsche stärker bewusst zu machen, die Selbstbezüglichkeit der Institutionen kritisch zu diskutieren, professionelle Denk- und Handlungsmuster zu überprüfen und die beim Kunden ankommende Qualität bzw. die Transparenz der Leistung zu fokussieren.
„Eine wichtige strategische Wirkung im Hinblick auf die Durchsetzung von Reformen im Bereich sozialer Dienste“ schreiben auch Frerichs, Naegele und Reichert (2003,S28f) dem Kundenbegriff zu, da er mit der Idee für Innovation und Reform besser verknüpft sei als der Klientenbegriff und bei den Trägern notwendige Anstöße zu Reformen bewirke. Mit dem Begriff Klient seien noch immer die überholten Strukturen eines Fürsorgeapparates mit „unmündigen, dankbaren Nehmern“ assoziiert. Die Nachfrager sozialer Dienstleistungen seien heute kritischer und wählerischer, was die Qualität der Leistungen, die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit betreffe.
Ähnlich formuliert es Ritscher (2002,S.188): „Die Intention dieser Begriffsbildung halte ich für gerechtfertigt, den Begriff selbst für problematisch.“ Kunde lässt sich vom Kontext des freien Marktes nicht trennen und beschreibt jemanden, der eine Ware erwirbt. Die Auftragsbeziehung in der psychosozialen Arbeit ist dagegen immer interaktiv, von den gesellschaftlichen Aufträgen, Zielsetzungen und Ressourcen der Einrichtungen und Helferinnen nicht zu trennen. Ritscher sieht daher den Wandel im von Adressatinnen mit monologischer Beziehung zu helfenden Experten, die Bedürfnisse ihrer Adressaten definieren, hin zu „primären Auftraggeberinnen“ die in einer zirkulär - dialogischen Beziehung Angebot und selbst bestimmten Bedarf aushandeln.[9]
Kühn (2000,S.348) schreibt den Zielgruppen der Sozialen Arbeit nur kleine Teile von Kundeneigenschaften, wie Souveränität der Entscheidung, eigene Finanzmitttel, Marktein- und übersicht, Kundenmacht, zu. Die Fokussierung auf den Kunden- und Dienstleistungsbegriff „mit eher partnerschaftlichen, gleichberechtigten und nicht diskriminierenden und abwertenden Leistungszielen“ (ebd.S.355) problematisiert Klientenbeziehungen. Klienten sind Koproduzenten der Leistung, „ihre Kooperationsfähigkeit und –willigkeit muss erst gefördert werden“ (ebd.S.348).
Auch Pfeiffer-Schaupp (1999,S.212) beschreibt die „Geschäftsführung ohne Auftrag“ als Grundproblem sozialpsychiatrischer Arbeit.
Der Kundenbegriff aus der Wirtschaftswelt erfasst nicht – wie in der psychosozialen Arbeit erforderlich – den ganzen Menschen. „Nicht die humanspezifischen Aspekte stehen im Vordergrund, sondern letztlich die daraus folgende Kaufentscheidung. Damit wird das Ganze des Menschen reduziert auf einen Willlensakt, zu dem er möglichst oft gebracht werden soll, gleichgültig, ob er ihn in seiner Entwicklung weiterführt oder nicht. Der Kundenbegriff beschränkt Menschsein auf die sachhaft-gebrauchende Komponente...“ (Friedrich 2001,S.303f). So sind „die Adressaten sozialer Organisationen bedeutend mehr als nur Kunden; das Leben ist weit mehr als Konsum“ (ebd.). Der Konsum oder Einkauf einer noch so qualitativ hochwertigen Dienstleistung genügt nie dem ethischen Verständnis und Anspruch psychosozialer Arbeit, den ganzen Menschen ernst zu nehmen und ihn bis in die existenzielle Betroffenheit hinein zu verstehen.
Friedrich sieht den Kundenbegriff hier völlig fehl am Platz und meint, „dass er, wo er verwendet wird, auf einen sehr unreflektierten Gebrauch von wirtschaftswissenschaftlichem Vokabular, wenn nicht gar auf einen Abschied von berufsethischen Grundsätzen der Sozialen Arbeit schließen lässt“ (ebd.).
Die Bezeichnung Kunde täuscht über Konsumenten-Assoziationen Einfachheit und Klarheit in einer Beziehung vor, die meist gar nicht anders sein kann als komplementär und komplex.
Es wundert an dieser Stelle nicht, wenn Menschen im Psychosozialen Feld einen Begriff bevorzugen, der die Komplexität ihrer professionellen Beziehung (vielleicht auch mahnend) deutlich macht.
1.4.2 Soziale Arbeit als Dienstleistung – tatsächlich eine mächtige Idee?
Die Verwendung des Kundenbegriffs in der psychosozialen Arbeit ist eng mit der Hereinnahme von Management-Konzepten, -Ideen, -Ansprüchen und Begrifflichkeiten in die Soziale Arbeit verbunden. Sie wird von den Professionellen theoretisch und praktisch widersprüchlich aufgenommen und diskutiert. Den Tenor der Diskussion drückt ein Gedanke Zygmunt Baumanns (1995,S.179) über manche Soziologen der Moderne aus: Es besteht Gefahr „dass die Ideen der Mächtigen für mächtige Ideen gehalten werden“.
Marianne Meinhold (2002,S.21) spricht in Bezug auf Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit von einem „heimlichen Lehrplan“: Seit jeher war die Diskussion zum Thema Qualitätsmanagement von widersprüchlichen, ja unverträglichen Argumentationslinien bestimmt. „Da werden zum einen Sparzwänge angeführt, zum anderen wird mit der Notwendigkeit des Verbraucherschutzes für Klienten argumentiert; die Eindämmung einer Anspruchsinflation wird ebenso für erforderlich gehalten wie die Souveränität der Nutzer; die einen erwarten Arbeitserleichterungen durch mehr Effizienz, die anderen befürchten überflüssige Mehrarbeit durch eine wachsende Bürokratie, die Standardisierung von Abläufen interpretieren die einen als Rückfall in die Taylorisierung der Arbeitswelt, während die anderen in der Betrachtung der Mitarbeiterzufriedenheit eine zunehmende Humanisierung des Arbeitslebens zu erkennen glauben. Schließlich bedeutet ‚Total Quality Management’ für die einen die Fähigkeit zur kontinuierlichen Selbstverbesserung, während sich darin für die anderen die destruktive Totalität naiven Fortschrittsglaubens ausdrückt.“ Für Meinhold ist die leitende Theorie a priori verborgen und hängt an jenen, die Qualitätsmanagement für ihren individuellen Bereich entwickeln.
Wenn soziale Einrichtungen heute um ihren Fortbestand kämpfen müssen, so geschieht dies immer mit dem Ziel „den ‚Adressaten bestmögliche Hilfe zuteil werden zu lassen und dem Menschen als Ganzheit gerecht zu werden“ (Friedrich 2001,S.311f). Der „soziale Markt wird nicht von expansiver Selbstbehauptung, sondern von Sorge um Selbsterhaltung bestimmt“ (ebd.).
Marktwirtschaftliche Strategien sind darauf gerichtet, sich Konkurrenten gegenüber zu behaupten. „Dieses Bild von Strategie muss diejenigen skeptisch stimmen, die sich für das ‚Soziale’ einsetzen, also für das, was einschließt und nicht ausschließt, für das, was Ungleichheit ausgleicht, für das, was dem Schwächeren (evtl. auch gegenüber dem Stärkeren) hilft, für das, was sich oft genug gegen ungerechte Strukturen der Marktwirtschaft wendet, für das, was für die Armen und nicht für die Reichen ist, etc“ (ebd.). Nicht das betriebswirtschaftliche Denken an sich sei in diesem Zusammenhang verwerflich, sondern manche Zwecke, für die es eingesetzt werden kann.
Diese Angst der unreflektierten Übernahme marktwirtschaftlicher Prinzipien ist angesichts vereinzelt sichtbarer erster Auswüchse im sozialen Qualitätsmanagement verständlich.
Wenn zum Beispiel in Bereichen „die bislang den Prinzipien von Personalität und Professionalität verpflichtet waren und damit weit gehend außerhalb ökonomischer Rationalitätskriterien agierten (...) nun (...) Standardisierungs- und Normierungsverfahren eingeführt (werden), die aus der herkömmlichen industriellen Produktion von Massengütern bekannt sind. Makabres Ergebnis dieses Standardisierungswahnsinns sind etwa nach Minuten geordnete Anweisungen für die Pflege alter Menschen“ (Haupert 2004,S.147). Ökonomische Kontrollstrategien steigern nicht die Effizienz der Dienstleistung, sondern erhöhen die Möglichkeiten bürokratischer Kontrolle.
„Den Beteiligten Abwehr oder Sabotage, Verbohrtheit und Engstirnigkeit zu unterstellen, heißt die Eigenart sozialer Systeme (...) zu verkennen.“ kritisiert auch Vogel (1997,S.259) die neue Zweck-Rationalität in der Sozialen Arbeit.
„Mit Kundenorientierung, wie sie heute durch betriebswirtschaftlich inspirierte Vorstellungen auch für den Sozialbereich gefordert wird, sind nur die ökonomistisch verengten und marktformenden Bedürfnisse gemeint“ (Staub-Bernasconi 2004,S.1). Professionelle Soziale Arbeit stütze sich dagegen auf eine wissenschaftlich abgestützte Bedürfnistheorie, die auch nach den psychischen und sozialen Folgen von Nicht-Befriedigung oder Überbefriedigung von Grundbedürfnissen fragt.
In der Dienstleistungsorientierung besteht nach Haupert (2003,S.158) die Gefahr, dass der Klient zum Opfer der Marktlogik wird und gänzlich seine Autotomie verliert. Es entsteht „eine besondere Art des ‚double bind’, der die Klienten der Kapitallogik unterwirft, deren objektives Opfer sie sind. Damit verdoppelt sich dann der Klientifizierungs- und Kolonialisierungsprozess. Die Professionellen werden nun unter dem Diktat der Kapitallogik und im Mantel der ‚Kundenorientierung’ zu ‚Agenten des Kapitals’, die ‚ehemaligen Klienten’, nun ‚Kunden’ genannt, zu Opfern. Bekanntlich unterstellt die Strukturlogik des Kapitals ja den ‚mündigen, freien, vertragsfähigen und –willigen’ Menschen der Moderne, der, ungebunden und frei aller ständischen Fesseln in freier Assoziation Verbindungen eingeht und löst, die einzig und allein seinem und nicht dem Gemeinwesen dienen.“ Genau diese Konditionen vermag ein Klient, eben weil er sich im Klientenstatus befindet, gerade nicht zu erbringen. Mit dem ‚Dienstleistungsparadigma’ wird gegen den Klienten und gegen ein aufklärerisches Menschenbild gearbeitet“(ebd.).
Haupert (2003,S.124) kritisiert die „extreme Vereinfachung“ die die Dienstleistungsorientierung mit sich bringt: „Der Klient (des) Professionellen wird zum Konsumenten, entweder als Kunde oder als Nutzer.(...) sowohl Kunde als auch Nutzer werden nicht in ihrer Personalität, sondern über ihre Funktionalität wahrgenommen“ (ebd.).
Der als Kunde erkannte Mensch muss (aus)wählen. „Wer nicht anders als wählen kann, von dem kann man logischerweise sagen, dass er wählen muss.“ sagt Gronemeyer (2000,S.80f) treffend und zeigt, dass wir als Kunden in den meisten Fällen das Wort wählen durch auswählen ersetzen müssen. „Der Auswählende bedient sich aus einer Palette von fertigen Versatzstücken als die sich ihm die Welt präsentiert und kann sich demzufolge nur das aussuchen, was ihm offeriert wird“ (ebd.).
Mit dem Platzgreifen des Dienstleistungsgedankens in der psychosozialen Arbeit ist eine steigende Effizienzorientierung und das Zunehmen institutionell vorgeschriebener Kurzberatungen bzw. -behandlungen zu erwarten. Dies wird die Aushandlungs- und Flexibilitätsspielräume verringern. (Nestmann/Sickendiek, 2002,S.174f). Es wird als paradox gesehen, dass dort von Kunden die Rede ist, wo Hilfesuchende gemeint sind: „Dieser Kunde wird möglicherweise in Zukunft vermehrt etwas zu bezahlen haben, auf das er immer weniger Einfluss hat. Und auch der Anbieter wird über formalisierte und rationalisierte Logiken in seinen Spielräumen eingeschränkt“ (ebd.).
Bei der Beurteilung der Qualität psychosozialer Dienstleistungen wird deutlich, dass die kundenorientierte Sichtweise (gleichgesetzt mit der Erfüllung von Kundenwünschen) zu kurz greift. Schubert (2001,S.3) schlägt daher eine gemeinsame Schnittmenge zwischen wert-, kunden- und expertenorientierter Sichtweise als Handlungsrahmen für das Management sozialer Organisationen vor.
„Soziale Dienstleistungen bilden insofern wiederum einen Sonderfall, als eine ausschließliche Definition und Bewertung der Dienstleistungsqualität durch die ‚Kunden’ in der Form eines Abgleichs zwischen Erwartungen und wahrgenommenen Leistungen der Realität nur in Teilen gerecht wird. Zum einen können in vielen Fällen neben der Frage der inhaltlichen Angemessenheit der erbrachten Dienstleistungen auch wesentliche Determinanten von Servicequalität wie Zugänglichkeit, Kompetenz, Freundlichkeit, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, oder Offenheit nicht oder nur eingeschränkt beurteilt bzw. wahrgenommen werden. Zum anderen handelt es sich in der Regel um öffentliche Dienstleistungen, deren Rahmenbedingungen in Form von rechtlichen Normen und zur Verfügung stehenden Ressourcen stark von sozialpolitischen Faktoren beeinflusst werden. Es existieren keine oder nur eingeschränkte Wahlmöglichkeiten bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Daraus ergibt sich, dass die Bestimmung der Qualität sozialer Dienstleistungen nicht ohne die Einbeziehung gängiger Expertenmeinungen und die Verbindung zu den verfügbaren Ressourcen auskommt“ (ebd.S.107). So entstehen die heutigen „Mindeststandards“ psychosozialer Versorgung in der Schere zwischen Kostendämpfung und versuchter Beibehaltung bisheriger Qualität.
Eine mit dem Kundenbegriff und Kundenorientierung verbundene Gefahr kann darin gesehen werden, dass im Zuge von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen eine weitere Standardisierung von „Hilfepaketen“ entsteht, die den jeweils aktuellen individuellen Problemlagen von Klienten und ihren damit verbundenen Bedürfnissen weder hinsichtlich der zeitlichen noch der inhaltlichen Unterschiede / Bedarfe gerecht werden können.
[...]
[1] Die Begriffe Psychosoziales Feld /Psychosoziale Arbeit umfassen hier definitorisch in Anlehnung an Rauchfleisch (2001) die multiprofessionelle Betreuung, Beratung und Behandlung in Sozial- und Gesundheitswesen, den traditionellen Arbeitsfeldern von Sozialarbeit, Sozialpsychiatrie, Sozialpädagogik und Heil- und Sonderpädagogik. Psychosoziale Beratung nimmt den Menschen in seiner personalen und sozialen Ganzheit wahr und unterscheidet sich damit grundsätzlich von z.B. Unternehmensberatung oder Farb-Typenberatung.
[2] Ab hier verwende ich im Sinne einer gendergerechten Schreibweise weibliche und männliche Formen abwechselnd.
[3] So erschien z.B. 2004 der Abschlussbericht einer von der Abteilung Sozialplanung des Landes OÖ eingerichteten „Projektgruppe Paradigmenwechsel“. Darin findet sich eine Auseinandersetzung mit dem Kundenbegriff, die erkennen lässt, dass das Land OÖ in Hinkunft wünscht, dass der Klientenbegriff durch den Kundenbegriff ersetzt wird.
Die Vorgehensweise der Projektgruppe zur Definition des Kundenbegriffs geht dabei von einer Beschreibung im „Ökonomischen Sinn“ aus und versucht dann eine Rückbindung auf den Sozialen Bereich. Unklar bleibt der Versuch der Umdefinition von Klienten zu Kunden dort, wo es um gesetzlich sanktionierte, notwendige Formen konkreten psychosozialen Handelns geht, nämlich: Handeln bei Gefahr im Verzug, Zwangsmaßnahmen, Selbst- und Fremdgefährdung und bei akuten Krisen. Was genau mit den so definierten Nicht-Kunden in diesen Situationen geschehen soll und was dabei den Unterschied zu Kunden ausmacht, wird (leider) nicht näher beschrieben.
[4] Sozialarbeit/Sozialpädagogik, d. Verf.
[5] Regelt das konzessionierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung
[6] Pauperismus beschreibt das Phänomen der Verelendung breiter Unterschichten, nicht mehr als vorübergehende Notlage, sondern als Lebenslage, auch in intellektueller und psychischer Hinsicht. (URL: www.geschichtsforum.de, 11.12.04)
[7] Schon längst entscheidet auch in Österreich die Politik internationaler Konzerne (etwa im Wege der Abwanderung von Produktionsbetrieben in den europäischen Osten bzw. China) mit an einem Gutteil der sozialen Problemlagen.
[8] Empowerment bedeutet übersetzt „Ermächtigung“ und meint in einer intrapersonalen Dimension die Art und Weise, „wie Menschen über sich selbst denken, wie sie ihre Einflussmöglichkeiten und Fähigkeiten bezogen auf einen bestimmten Bereich ihres Lebens wahrnehmen, wie sie ihre Handlungs- und Bewältigungsstrategien einschätzen und ob sie bereit und motiviert sind, aktiv Verantwortung zu tragen und Einfluss zu nehmen“ (Nestmann / Sickendiek, 2002,S.178). In einer interaktionalen Dimension meint Empowerment „ein kritisches Bewusstsein über die Macht- und Verfügungsstrukturen der eigenen Lebenswelt, ein Verständnis von Normen und Werten in einem bestimmten Kontext“ (ebd.).
[9] Die vom Land OÖ als Paradigmenwechsel postulierte Neugestaltung der Auftragsentwicklung im psychosozialen Bereich zwischen Klientinnen und Anbietern wurde bereits „tetralogisch“ – also unter Miteinbeziehung von Klienten/Kunden sowie Kunden- bzw. Uservertreterinnen erstellt. (Abschlussbericht der Projektgruppe Paradigmenwechsel 2004, Linz, Amt der OÖ Landesregierung)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832489885
- ISBN (Paperback)
- 9783838689883
- DOI
- 10.3239/9783832489885
- Dateigröße
- 612 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Donau-Universität Krems - Universität für Weiterbildung – Umwelt- und Medizinische Wissenschaften, Psychosoziale Medizin
- Erscheinungsdatum
- 2005 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- therapie sozialarbeit beratung sozialpädagogik dienstleistung
- Produktsicherheit
- Diplom.de