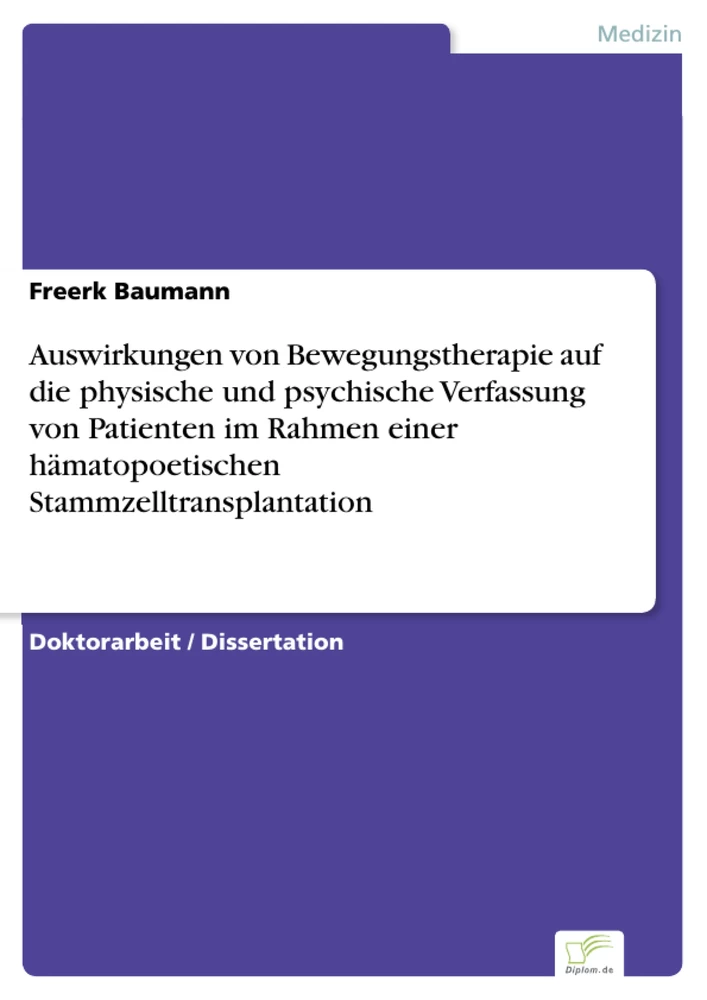Auswirkungen von Bewegungstherapie auf die physische und psychische Verfassung von Patienten im Rahmen einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation
©2005
Doktorarbeit / Dissertation
334 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Eine hämatopoetische Stammzelltransplantation (SZT) bedeutet für den Patienten immer einen tief greifenden Einschnitt in sein Leben und es zeigen sich umfassende negative Folgen, die einer intensiven Rehabilitation bedürfen. Bewegung und Sport können hier, wie verschiedene Studien bei Krebspatienten gezeigt haben (Kapitel 3.3.2), diese Auswirkungen lindern. Gegenwärtig existieren jedoch kaum Forschungsergebnisse und Konzepte zu gezielten bewegungstherapeutischen Programmen in der Akut- wie auch Rehabilitationsklinik, die SZT-Patienten einbinden. Empfehlungen, begründete Kontraindikationen und Trainingsdefinitionen zu bewegungstherapeutischen Maßnahmen bei SZT fehlen fast vollständig.
Um die Durchführbarkeit und den Einfluss von bewegungstherapeutischen Maßnahmen schon während der gesamten stationären Phase einer Transplantation zu überprüfen, wurde eine randomisierte, kontrollierte Studie in der Klinik für Knochenmarktransplantation in Idar-Oberstein erhoben. Zur Diskussion stand die Frage, ob durch ein gezieltes bewegungstherapeutisches Training über die komplette Phase der SZT den schwerwiegenden Folgen einer Transplantation begegnet und zudem die Auswirkungen des Bewegungsmangels vermieden werden konnten. Dies hätte für die Patienten eine verbesserte Mobilität, eine größere Unabhängigkeit und demnach eine höhere Lebensqualität zur Folge.
Dazu wurde ein spezielles Trainingskonzept, das sogenannte Brückenmodell, für SZT-Patienten erstellt (Kapitel 4.2.2.1):
Das Brückenmodell beschreibt die individuelle Form der Bewegungstherapie für alle SZT-Patienten während der gesamten stationären Behandlung, die die physiologische, psychische und psychosoziale Ebene des Trainierenden positiv beeinflusst, um die im Rahmen der Transplantation zwangsläufig eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu überbrücken und dadurch nicht nur die negativen ganzheitlich-komplexen Folgen von Bewegungsmangel zu vermeiden, sondern auch die Motivation zur aktiven Teilnahme am Genesungsprozess in der stationären und post-stationären Phase zu fördern.
Es wurde hypothetisch davon ausgegangen, dass ein bewegungstherapeutisches Programm für SZT-Patienten deren Ausdauer und Kraft erhält, die Hämatopoese und Lungenfunktion fördert, den BMI, die Muskelmasse, den Karnofsky-Index und die Auswirkungen einer Cortisonbehandlung positiv beeinflusst, die Schmerzmedikation mindert und die Lebensqualität bzw. die subjektive Befindlichkeit verbessert (Kapitel […]
Eine hämatopoetische Stammzelltransplantation (SZT) bedeutet für den Patienten immer einen tief greifenden Einschnitt in sein Leben und es zeigen sich umfassende negative Folgen, die einer intensiven Rehabilitation bedürfen. Bewegung und Sport können hier, wie verschiedene Studien bei Krebspatienten gezeigt haben (Kapitel 3.3.2), diese Auswirkungen lindern. Gegenwärtig existieren jedoch kaum Forschungsergebnisse und Konzepte zu gezielten bewegungstherapeutischen Programmen in der Akut- wie auch Rehabilitationsklinik, die SZT-Patienten einbinden. Empfehlungen, begründete Kontraindikationen und Trainingsdefinitionen zu bewegungstherapeutischen Maßnahmen bei SZT fehlen fast vollständig.
Um die Durchführbarkeit und den Einfluss von bewegungstherapeutischen Maßnahmen schon während der gesamten stationären Phase einer Transplantation zu überprüfen, wurde eine randomisierte, kontrollierte Studie in der Klinik für Knochenmarktransplantation in Idar-Oberstein erhoben. Zur Diskussion stand die Frage, ob durch ein gezieltes bewegungstherapeutisches Training über die komplette Phase der SZT den schwerwiegenden Folgen einer Transplantation begegnet und zudem die Auswirkungen des Bewegungsmangels vermieden werden konnten. Dies hätte für die Patienten eine verbesserte Mobilität, eine größere Unabhängigkeit und demnach eine höhere Lebensqualität zur Folge.
Dazu wurde ein spezielles Trainingskonzept, das sogenannte Brückenmodell, für SZT-Patienten erstellt (Kapitel 4.2.2.1):
Das Brückenmodell beschreibt die individuelle Form der Bewegungstherapie für alle SZT-Patienten während der gesamten stationären Behandlung, die die physiologische, psychische und psychosoziale Ebene des Trainierenden positiv beeinflusst, um die im Rahmen der Transplantation zwangsläufig eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu überbrücken und dadurch nicht nur die negativen ganzheitlich-komplexen Folgen von Bewegungsmangel zu vermeiden, sondern auch die Motivation zur aktiven Teilnahme am Genesungsprozess in der stationären und post-stationären Phase zu fördern.
Es wurde hypothetisch davon ausgegangen, dass ein bewegungstherapeutisches Programm für SZT-Patienten deren Ausdauer und Kraft erhält, die Hämatopoese und Lungenfunktion fördert, den BMI, die Muskelmasse, den Karnofsky-Index und die Auswirkungen einer Cortisonbehandlung positiv beeinflusst, die Schmerzmedikation mindert und die Lebensqualität bzw. die subjektive Befindlichkeit verbessert (Kapitel […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8967
Baumann, Freerk T.: Auswirkungen von Bewegungstherapie auf die physische und
psychische Verfassung von Patienten im Rahmen einer hämatopoetischen
Stammzelltransplantation
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Deutsche Sporthochschule Köln, Dissertation / Doktorarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
III
Hierdurch versichere ich eidesstattlich, dass ich die eingereichte Dissertationsschrift
selbstständig und nur unter Benutzung der angegebenen Quellen angefertigt habe.
Sie hat noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen. Wörtlich
übernommene Textstellen, auch Einzelsätze oder Teile davon, sind als Zitate kennt-
lich gemacht. Das gleiche gilt auch für beigelegte Zeichnungen und Darstellungen.
______________________
Freerk T. Baumann
IV
WtÇ~átzâÇz
WtÇ~átzâÇz
WtÇ~átzâÇz
WtÇ~átzâÇz
atv{ wÜx|x|Ç{tÄu}ù{Ü|zxÜ mx|à wxá fv{tyyxÇá äÉÇ j|ááxÇ âÇw zx|áà|zxÅ ^tÑ|àtÄ zxu{Üà xá WtÇ~ éâ átzxÇ? tÄÄ wxÇ}x@
Ç|zxÇ? w|x á|v{ wâÜv{ \{Ü fx|Ç âÇw gâÇ |Ç wtá j|Ü~xÇ éâÜ extÄ|á|xÜâÇz wxÜ äÉÜÄ|xzxÇwxÇ W|ááxÜàtà|ÉÇááv{Ü|yà x|Çzx@
uâÇwxÇ {tuxÇA
Wt áx|xÇ äÉÜ tÄÄxÅ w|x ctà|xÇàxÇ zxÇtÇÇà? É{Çx w|x w|x Xå|áàxÇé w|xáxÜ hÇàxÜáâv{âÇz ~x|Çx áÉÄv{x ãùÜxA `x|Çx {É{x
TÇÇxÜ~xÇÇâÇz Åv{àx |v{ wxÅ ùÜéàÄ|v{xÇ W|Üx~àÉÜ wxÜ ^`g@^Ä|Ç|~ \wtÜ@buxÜáàx|Ç [xÜÜÇ cÜÉyA WÜA
WÜA TåxÄ TA YtâáxÜ tâááÑÜxv{xÇ? wxÜ wâÜv{ áx|Ç uxÅxÜ~xÇáãxÜà |ÇÇÉätà|äxá XÇztzxÅxÇà wxÇ ZÜâÇwáàx|Ç éâ wxÅ
cÜÉ}x~à zxÄxzà {tàA fx|ÇxÅ ~ÉÅÑxàxÇàxÇ ùÜéàÄ|v{xÅ cxÜáÉÇtÄ u|Ç |v{ wtÇ~utÜ yÜ w|x zxwâÄw|zx |ÇàxÇá|äÅxw|é|Ç|áv{x
_x{Üx? w|x |v{ ux| |{ÇxÇ zxÇÉáá? wt áx|xÇ zxÇtÇÇà YÜtâ UtátÜt? TÇzxÄ|~t? Xät? kxÇ|t? f|ÅÉÇ? `|v{txÄ?
[tÇá}Üz? WÉÅ|Ç|~ âÇw iÄtwtÇA X|Ç zÜÉxá _Éu zx{à tÇ wtá cyÄxzxÑxÜáÉÇtÄ wxÜ ^`g@fàtà|ÉÇ GF? wtá
|ÅÅxÜ wâÜv{ x|Çx uxãâÇwxÜÇáãxÜàx TÜà âÇw jx|áx wxÇ ctà|xÇàxÇ ZxuÉÜzxÇ{x|à? f|v{xÜ{x|à âÇw mâäxÜá|v{à áv{xÇ~àA
_âwã|z ^Ütâà áx| zxwtÇ~à tÄá áx{Ü {|ÄyÜx|v{xÜ TÇáÑÜxv{ÑtÜàÇxÜ |Ç etÇwÉÅ|á|xÜâÇzá@ âÇw TâáãxÜàâÇzáyÜtzxÇ áÉã|x
hÄÜ|v{ buxÜáà yÜ Ñáçv{ÉÉÇ~ÉÄÉz|áv{x hÇàxÜÜ|v{àâÇzA
X|ÇxÇ {xÜéÄ|v{xÇ WtÇ~ Ü|v{àx |v{ tÇ w|x ]Éá°@VtÜÜxÜtá@fà|yàâÇz? tÇ w|x fàxytÇ@`ÉÜáv{@fà|yàâÇz âÇw tÇ wxÇ
^`g@YÜwxÜäxÜx|Ç \wtÜ@buxÜáàx|Ç xAiA ;}xàéàM YÜwxÜäxÜx|Ç _àéxÄáÉÉÇ xAiA< yÜ w|x zÜÉéz|zxÇ y|ÇtÇé|xÄ@
ÄxÇ mâãxÇwâÇzxÇ âÇw w|x ~ÉÅÑÄ|~tà|ÉÇáÄÉáx? âÇuÜÉ~Ütà|áv{x mâátÅÅxÇtÜux|àA
Wxá jx|àxÜxÇ Åv{àx |v{ w|x áàâwxÇà|áv{xÇ [|Äyá~Üùyàx wxá \Çáà|àâàá yÜ ex{tu|Ä|àtà|ÉÇ âÇw Ux{|ÇwxÜàxÇáÑÉÜà ]tÇ~t?
a|Çt? `|Üt âÇw a|vÉÄx Ç|v{à äxÜzxááxÇ? w|x Å|Ü |ÅÅxÜ Å|à äxÜÄùááÄ|v{xÜ gtà éâÜ fx|àx áàtÇwxÇA VÉÜwâÄt atàâáv{
zxu{Üà x|Ç WtÇ~xáv{Ç yÜ |{Üx |ÇàxÇá|äx Äx~àÉÜzÜtÑ{|áv{x atv{{|ÄyxA
`x|ÇxÇ à|xyxÇ WtÇ~ Ü|v{àx |v{ tÇ Åx|Çx ãâÇwxÜutÜx YtÅ|Ä|x? ãÉ |v{ äÉÜ tÄÄxÅ Åx|Çx {xÜéxÇázâàx `âààxÜ âÇw Åx|ÇxÇ
Ä|xuxÇ itàxÜ {xÜäÉÜ{xux? É{Çx w|x |v{ Ç|v{à ãùÜxA
\Å UxáÉÇwxÜxÇ áÑÜxv{x |v{ tÇ w|xáxÜ fàxÄÄx [xÜÜÇ cÜÉyA WÜA ^Ätâá fv{Äx? Åx|ÇxÅ ã|ááxÇáv{tyàÄ|v{xÇ YÜwxÜxÜ?
`xÇàÉÜ âÇw WÉ~àÉÜätàxÜ x|ÇxÇ zÜÉxÇ WtÇ~ tâá? wxÜ wâÜv{ áx|Çx tâxÜÉÜwxÇàÄ|v{x hÇàxÜáààéâÇz? áx|Çx ux|áÑ|xÄÄÉáx
[|Çztux âÇw áx|Çx |ÅÅxÜãù{ÜxÇwx [|ÄyáuxÜx|àáv{tyà w|xáx TÜux|à xÜáà ÅzÄ|v{ zxÅtv{à {tàA
V
\Ç `xÅÉÜ|tÅ aÉÜuxÜà
\Ç `xÅÉÜ|tÅ aÉÜuxÜà
\Ç `xÅÉÜ|tÅ aÉÜuxÜà
\Ç `xÅÉÜ|tÅ aÉÜuxÜà
VI
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Inhalt
Seite
1
Einleitung
1
2
Medizinische Grundlagen
4
2.1
Das Blut- und das lymphoretikuläre System
4
2.1.1
Leukämie
5
2.1.2
Maligne Lymphome
7
2.1.3
Multiples Myelom (Plasmozytom)
8
2.1.4
Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
9
2.1.5
Myeloproliferative Erkrankungen
10
2.1.6
Immundefekt
11
2.1.7
Solide Tumore
11
2.2
Stammzelltransplantation
13
2.3
Komplikationen und Folgen einer SZT
14
2.3.1
Graft versus Host Disease (GvHD)
15
2.3.2
Physische Komplikationen
16
2.3.2.1
Autologe Transplantation und körperliche Leistungsfähigkeit
17
2.3.2.2
Allogene bzw. autologe Transplantation und körperliche
Leistungsfähigkeit
18
2.3.2.3
Körperliche Leistungsfähigkeit bei allogener und autologer
Transplantation im Vergleich
22
2.3.3
Psychische und psychosoziale Komplikationen
23
2.3.3.1
Psychische und psychosoziale Komplikationen nach autologer
Transplantation
24
2.3.3.2
Psychische und psychosoziale Komplikationen nach allogener
bzw. autologer Transplantation
25
2.3.3.3
Psychische und psychosoziale Komplikationen autologe und
allogene Transplantation im Vergleich
30
VII
3
Bewegung und Krebs
35
3.1
Allgemeine Trainingsprinzipien
36
3.1.1
Bewegungstherapie
36
3.1.2
Sporttherapie
36
3.1.2
Physiotherapie
37
3.1.3
Aerobes Ausdauertraining
37
3.2
Adaptationsprozesse
39
3.2.1
Adaptation
39
3.2.2
Adaptationsprozesse durch allgemeine Bewegungstherapie
39
3.2.3
Adaptationsprozesse durch rehabilitatives Ausdauertraining
40
3.2.4
Adaptationsprozesse durch Physiotherapie
40
3.2.5
Adaptationsprozesse durch Bewegungsmangel
40
3.3
Geschichtliche Entwicklung von Bewegungstherapie in der
Krebsbehandlung
42
3.3.1
Bewegung und Krebsprävention
42
3.3.2
Bewegung in der Krebsbehandlung
50
3.3.2.1
Bewegung in der Krebsbehandlung Deutschland
50
3.3.2.2
Bewegung in der Krebsbehandlung Ein internationaler
Überblick USA
55
3.3.2.3
Bewegung in der Krebsbehandlung Ein internationaler
Überblick Asien
60
3.3.2.4
Bewegung in der Krebsbehandlung Ein internationaler
Überblick Europa
63
3.3.3
Rehabilitation und Stammzelltransplantation weltweit
66
3.3.4
Ziele und Hypothesenbeschreibung
74
4
Methodik
76
4.1
Probanden
76
4.2
Bewegungstherapeutische Trainingsprogramme
83
4.2.1
Bewegungstherapeutisches Programm der Kontrollgruppe
83
4.2.2
Bewegungstherapeutisches Programm der Trainingsgruppe
86
4.2.2.1
Das Brückenmodell
86
VIII
4.2.2.2
Das Bewegungstherapeutische Alltagstraining (BA)
90
4.2.2.3
Aerobes Ausdauertraining
95
4.3
Testverfahren / Evaluation
98
4.3.1
Physiologische Untersuchungen
98
4.3.1.1
Ausdauertest
98
4.3.1.2
Krafttest
101
4.3.1.3
Lungenfunktionsprüfung
103
4.3.2
Hämatologische Untersuchungen
105
4.3.3
Ergänzende physiologische Untersuchungen
107
4.3.4
Physiologische Untersuchungen über den gesamten
stationären Verlauf
110
4.3.5
Psychische und psychosoziale Untersuchungen
114
4.3.5.1
Erfassung der Lebensqualität
114
4.3.5.2
Erfassung der momentanen Befindlichkeit
117
4.4
Das bewegungstherapeutische Studiendesign und seine
Wirkungsmechanismen
118
4.5
Verstorbene Patienten
121
4.6
Randomisierung
121
4.7
Statistik
122
4.8
(Exkurs) - Erfassung bewegungstherapeutischer Aktivitäten
in bundesdeutschen KMT-Kliniken (2002)
124
5
Ergebnisse
126
5.1
Ausdaueruntersuchungen
126
5.1.1
Entwicklung der submaximalen Ausdauerleistungsfähigkeit
in der Trainingsgruppe
127
5.1.2
Entwicklung der submaximalen Ausdauerleistungsfähigkeit
in der Kontrollgruppe
128
5.1.3
Submaximale Ausdauerleistungsfähigkeit der Trainings- und
Kontrollgruppe im Vergleich
128
5.1.3.1
Belastbarkeit (in Watt) der Trainings- und Kontrollgruppe im
Vergleich
129
IX
5.1.3.2
Ausdauerbelastungszeit der Trainings- und Kontrollgruppe
im Vergleich
130
5.1.3.3
Relative Belastbarkeit der Trainings- und Kontrollgruppe
im Vergleich
133
5.1.4
Trainingsintensitäten (in Watt) über die stationäre Phase
137
5.2
Kraftuntersuchungen
138
5.2.1
Entwicklung der Kraft in der Trainingsgruppe
138
5.2.2
Entwicklung der Kraft in der Kontrollgruppe
139
5.2.3
Kraftentwicklung von Trainings- und Kontrollgruppe im
Vergleich
140
5.2.4
Kraftentwicklung bei Geschlechterverteilung
141
5.3
Lungenfunktion
142
5.3.1
Lungenfunktion in der Trainingsgruppe
143
5.3.2
Lungenfunktion in der Kontrollgruppe
143
5.3.3
Lungenfunktion von Trainings- und Kontrollgruppe im
Vergleich
144
5.3.4
Pneumonie in der Trainings- und Kontrollgruppe
147
5.4
Hämatologische Untersuchungen
148
5.4.1
Leukozyten
149
5.4.2
Hämoglobin
149
5.4.3
Thrombozyten
150
5.4.4
Engraftment
151
5.5
Ergänzende physiologische Untersuchungen
151
5.5.1
Körpergewicht
152
5.5.2
Body-Mass-Index (BMI)
153
5.5.3
Oberschenkelumfang
154
5.5.4
Karnofsky-Index
156
5.6
Physiologische Untersuchungen über den gesamten
stationären Verlauf
157
5.6.1
Gewichtsentwicklung
157
5.6.2
Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentrate
158
5.6.3
GvHD
159
5.6.4
Komplikationen
160
5.6.5
Schmerzmedikation
161
X
5.6.6
Cortison
162
5.6.6.1
Cortison in Korrelation zur Kraftentwicklung
162
5.6.7
Entlassungstag
164
5.7
Psychische und psychosoziale Untersuchungen
166
5.7.1
Lebensqualität
166
5.7.1.1
Vergleich der Lebensqualität zwischen Trainings- und
Kontrollgruppe an ausgewählten Tagen
167
5.7.1.2
Lebensqualitätsentwicklung von Tag 6 bis zur Entlassung
179
5.7.2
Befindlichkeit
183
5.8
Verstorbene Patienten
194
5.8.1
Kraft und Überleben
196
5.8.2
Lebensqualität und Befindlichkeit
197
5.8.2.1
Lebensqualität der während der Transplantationsphase
verstorbenen Patienten
197
5.8.2.2
Befindlichkeit der während der Transplantationsphase
verstorbenen Patienten
199
5.9
(Exkurs) - Bewegungstherapeutische Aktivitäten von
stationären Patienten in deutschen KMT-Kliniken (2002)
201
6
Diskussion
210
6.1
Methodendiskussion
211
6.1.1
Probanden
211
6.1.2
Bewegungstherapeutische Trainingsprogramme
213
6.1.3
Brückenmodell
215
6.1.4
Bewegungstherapeutisches Programm der Kontrollgruppe
217
6.1.5
Bewegungstherapeutisches Alltagstraining (BA)
217
6.1.6
Aerobes Ausdauertraining
220
6.2
Testverfahren / Evaluation
223
6.2.1
Physiologische Untersuchungen
223
6.2.1.1
Ausdauertest
223
6.2.1.2
Krafttest
225
6.2.1.3
Lungenfunktionsprüfung und hämatologische Untersuchungen
226
6.2.3
Ergänzende physiologische Untersuchungen
227
XI
6.2.4
Physiologische Untersuchungen über den gesamten
stationären Verlauf
227
6.2.5
Psychische und Psychosoziale Untersuchungen
228
6.2.5.1
Erfassung der Lebensqualität
229
6.2.5.2
Erfassung der momentanen Befindlichkeit
231
6.3
Gesamtfazit der Methodendiskussion
233
6.4
Ergebnisdiskussion
234
6.4.1
Das Training im Brückenmodell mit SZT-Patienten
234
6.4.2
Entwicklungen der Ausdauerleistungsfähigkeit in der Trainings-
und Kontrollgruppe
236
6.4.3
Entwicklungen der Kraft in der Trainings- und Kontrollgruppe
239
6.4.4
Lungenfunktion
240
6.4.5
Hämatologische Untersuchungen
242
6.4.6
Weitere physiologische Untersuchungen
243
6.5
Psychische und psychosoziale Untersuchungen
248
6.5.1
Lebensqualität
249
6.5.2
Befindlichkeit
253
6.6
Verstorbene Patienten
255
6.7
Gesamtfazit der Ergebnisdiskussion
260
7
Trainingsempfehlungen für stationär aufgenommene
Patienten im Rahmen einer hämatopoetischen
Stammzelltransplantation
261
8
Zusammenfassung und Ausblick
267
Literatur
273
Anhang
296
XII
Anmerkungen zur Dissertationsschrift:
In der vorliegenden Dissertationsschrift wurde das Regelwerk der neuen Recht-
schreibung berücksichtigt. Zudem hat der Verfasser ausschließlich von der männli-
chen Form der Anrede oder Beschreibung Gebrauch gemacht. Dies begründet sich
sicherlich nicht durch ein emanzipatorisches Desinteresse des Autors, sondern diese
verwendete Methode der Niederschrift soll konstitutiv einen ungehinderten Lesefluss
ermöglichen
1 Einleitung
Zurzeit erkranken in Deutschland jedes Jahr etwa 394.700 Menschen neu an
Krebs. Dabei ist in den letzten 20 Jahren eine leicht steigende Inzidenzrate, aber
auch eine kontinuierlich sinkende Mortalität zu verzeichnen [Arbeitsgemeinschaft
Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland 2004, 12]. Einschneidende
medizinische Fortschritte in der Onkologie haben in den letzten Jahrzehnten dazu
geführt, dass die Diagnose ,,Krebs" heute nicht mehr ausschließlich Hoffnungslo-
sigkeit und Tod bedeutet. Vielmehr können Maßnahmen ergriffen werden, die zur
Verlängerung des Lebens und sogar zur Heilung führen. Damit die erreichte
Quantität auch mit einer Qualitätsverbesserung einhergeht, sind supportive The-
rapien notwendig, um die psychischen und physischen Einschränkungen des Er-
krankten zu mindern, Begleiterkrankungen zu vermeiden und auf diese Weise die
Lebensqualität zu verbessern.
Körperliche Aktivitäten sind wichtige therapeutische Anwendungen, die in der Re-
habilitation onkologischer Patienten immer noch nicht selbstverständlich sind. Die
ersten Erfahrungen mit bewegungstherapeutischen Interventionen in der Nach-
sorge und Rehabilitation bei Patienten, die an Krebs erkrankt sind, wurden in
Deutschland vor etwa 25 Jahre gemacht. 1980/81 entstanden die ersten Krebs-
nachsorge-Sportgruppen in der Bundesrepublik. Beim Landessportbund Nord-
rhein-Westfalen und an der Deutschen Sporthochschule Köln wurden parallel und
unabhängig voneinander Sportgruppen für Frauen nach Brustkrebs gegründet. In
einer ersten Studie auf dem Gebiet der Bewegungstherapie in der Onkologie, un-
tersuchten Jochheim und Schüle [Schüle 1983] an der Deutschen Sporthochschu-
le Köln die Einflüsse körperlicher Aktivitäten in der Rehabilitation bei Mamma-Ca-
Patientinnen. Die Ergebnisse waren positiv und es zeigte sich, dass Bewegung
einen positiven Effekt auf die körperliche und psychische Konstitution der Patien-
tinnen hatte.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
2
Durch diese und weitere Studien [Dimeo et al. 1996b; Mock et al. 1994] erhielt die
Bewegungstherapie in der onkologischen Behandlung einen wachsenden Stellen-
wert. So verfolgt sie die Ziele, die physischen, psychischen und psychosozialen
Ebenen des Patienten positiv zu beeinflussen.
Die Ergebnisse der wenigen, vorhandenen bewegungstherapeutischen Studien
lassen den frühen Einsatz körperlicher Aktivität bei der stationären Behandlung
und in der Rehabilitation von Krebskranken notwendig erscheinen. Sie belegen
nicht nur die positiven Effekte gezielter Bewegungstherapie, sondern auch, dass
diese während der Erkrankung und deren Behandlung möglich ist und keine nega-
tiven Auswirkungen hat. Frühere Vermutungen, dass gezielte und kontrollierte
Bewegung für den Betroffenen eine erhöhte gesundheitliche Gefahr bedeute und
erst bei einer vollständigen Remission mit rehabilitativen Maßnahmen begonnen
werden dürfe, sind widerlegt [Dimeo et al. 1996b; Andrykowski et al. 1989].
Im Jahre 1845 wurde in der Literatur erstmals eine Leukämie beschrieben. Vir-
chow verwendete die Umschreibung ,,Weißes Blut" und bezeichnete damit die ty-
pische Morphologie des Krankheitsbildes [Virchow 1875]. Leukämien und
Lymphome nehmen heute zusammen genommen in der Häufigkeit der verschie-
denen Krebsformen in Deutschland den fünften Platz bei den Männern (7,3 Pro-
zent) und den dritten Platz bei den Frauen (6,5 Prozent) ein [Arbeitsgemeinschaft
Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland 2004, 9]. Mit der Knochen-
marktransplantation (KMT) bzw. Stammzelltransplantation (SZT)
1
wurden
Therapieformen entwickelt, die selbst bei den bösartigsten hämatologischen und
lymphatischen Erkrankungen zur Heilung führen können. 2002 unterzogen sich in
der Bundesrepublik Deutschland 3617 Patienten einer SZT [Gratwohl et al. 2004].
Allerdings liegen zurzeit nur wenige wissenschaftliche Erfahrungen mit bewe-
gungstherapeutischen Maßnahmen bei einer SZT vor, insbesondere fehlen noch
weitestgehend Daten über Umsetzung, Risikofaktoren und Ergebnisse der Thera-
piekonzepte.
In der vorliegenden, randomisierten Studie sollte der Einfluss von bewegungsthe-
rapeutischen Aktivitäten auf die physische, psychische und psychosoziale Ebene
1
,,SZT" umschreibt die Knochen- wie auch Stammzelltransplantation (vgl. Kapitel 2.1.9)
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
3
des Patienten über die gesamte akute Phase einer SZT untersucht werden. Ziel
war es, nicht nur die Möglichkeit der Durchführung therapeutischer Maßnahmen
unter Chemotherapie und Isolation zu belegen, sondern darüber hinaus die Aus-
wirkungen von Bewegungsmangel zu vermeiden, transplantationsbedingte Kom-
plikationen zu mindern und auf diese Weise die Lebensqualität der Erkrankten zu
verbessern.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
4
2 Medizinische Grundlagen
Die medizinische Behandlung bösartiger hämatologischer und lymphatischer Er-
krankungen umfasst komplexe immun-, chemo- und radiotherapeutische Modalitä-
ten. Im folgenden Kapitel werden die medizinischen Grundlagen einer SZT und die
sich daraus entwickelnden Folgen für den Patienten auf physischer, psychischer
und psychosozialer Ebene näher beschrieben und erläutert.
2.1 Das Blut- und das lymphoretikuläre System
Die menschlichen Blutzellen unterteilen sich in drei Zellreihen. Dazu zählen die
roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die Blutplättchen (Thrombozyten) und drei
Arten von weißen Blutkörperchen (Leukozyten), nämlich die Granulozyten, die
Lymphozyten und die Monozyten. Diese Zellen entwickeln sich aus Stammzellen
im Knochenmark, die die Fähigkeit besitzen, sich zu vermehren und zu differenzie-
ren. Neuproduktion und Verlust bzw. Abbau der Blutzellen halten sich in der Regel
die Waage. Die Erythrozyten sind die wichtigsten Sauerstoffträger und enthalten
das Hämoglobin (roter Blutfarbstoff). Das Hämatokrit bestimmt den Erythrozyten-
volumenanteil. Die Thrombozyten sind verantwortlich für die Blutgerinnung, wäh-
rend die Leukozyten an den Abwehrmechanismen im Rahmen des Immunsystems
beteiligt sind: Granulozyten und Monozyten reagieren im Rahmen einer Immun-
abwehr mit einer unspezifischen Immunantwort, während Lymphozyten eine spe-
zifische Abwehr gegen Antigene zeigen [Beutel und Ganser 2000, 3f].
Die nachstehend beschrieben Krankheitsbilder werden nach folgendem Schemata
vorgestellt:
Definition/Klassifikation > Klinik > Diagnostik > Therapie > Prognose
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
5
2.1.1 Leukämie
Definition/Klassifikation: Leukämien werden je nach Klassifikation definiert. Die
wichtigste Klassifikation erfolgt nach morphologischen, zytochemischen, histologi-
schen und immunzytologischen Kriterien in vier Gruppen: akute und chronische,
die jeweils weiter in lymphatische und myeloische Leukämien unterteilt werden
Leukämien beschreiben eine Gruppe von Erkrankungen, die durch die Ansamm-
lung unreifer Formen von Leukozyten in Knochenmark und Blut charakterisiert
sind. Kennzeichnend ist die Verdrängung der normalen Hämatopoese. [Begemann
und Begemann-Deppe, 38ff].
Klinik: Es kommt im Rahmen der Zellansammlung im Knochenmark und Blut zu
einer Infiltration abnormer Zellen in verschiedene Organe (z.B. Leber, Milz, Ge-
hirn, Meningen, Lymphknoten, Haut oder Hoden) und zu einer Knochenmarkinsuf-
fizienz (z.B. Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie) [Begemann und Bege-
mann-Deppe, 38ff].
Akute Leukämien sind in der Regel aggressive Erkrankungen, die durch eine
massive Akkumulation von frühen Knochenmark-Vorläuferzellen (Blasten) charak-
terisiert sind. Der Patient zeigt dann Symptome wie Müdigkeit, Blässe, Dyspnoe,
Infektionen, Blutungen, Lymphadenopathie, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Sehstörungen etc. Definitionsgemäß liegt der Blastenanteil im Knochenmark bei
einer akuten Leukämie über 20 Prozent (WHO-Klassifikation). Die Art der Blasten
führt zu einer weiteren Unterscheidung zwischen einer akuten myeloischen Leu-
kämie (AML) oder einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) [Hoffbrand et al.
2003, 161ff].
Chronische Leukämien unterscheiden sich von den akuten Leukämien durch ihre
langsamere Progression. Es kommt zu einer Akkumulation reifer leukozytärer
Formen, die allerdings nicht funktionell sind. Die klinischen Symptome sind Ge-
wichtsverlust, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Nachtschweiß, Milzvergröße-
rung, Blässe, Dyspnoe, Tachykardie, Blutungen etc [Begemann und Begemann-
Deppe, 109ff].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
6
Diagnostik: Zur genauen Diagnostik und Klassifikation der Leukämie erfolgt eine
Blutuntersuchung und eine Knochenmarkpunktion. Unter dem Mikroskop und mit
weiteren speziellen Verfahren wie Chromosomenanalyse, immunologische, zyto-
chemische und genetische Untersuchungen ist eine differenzierte Diagnostik
möglich [Hoffbrand et al. 2003, 161ff].
Therapie: Die akuten Leukämien führen unbehandelt innerhalb weniger Wochen
zum Tod. Die Behandlung erfolgt durch Kombinationschemotherapien und auch
durch Bestrahlungen. Bei Hoch und Höchstrisikopatienten nach kompletter 1. Re-
mission sowie in der 2. Remission bei normalem Risiko kommt eine allogene SZT
in Frage und wird je nach individueller Situation abgeklärt. Fehlt ein Spender, kann
in erster Remission eine autologe SZT durchgeführt werden [Preiß et al. 2002, 3].
Eine SZT kommt bei Erwachsenen bis zum 60. Lebensjahr mit einer CML in Be-
tracht. Eine allogene SZT ist bei ca. 70% der CML-Patienten möglich [Preiß et al.
2002, 32]. Eine SZT bei CLL-Patienten ist eher selten, da diese chronische,
lymphatische Leukämie in erster Linie ältere Menschen betreffen, für die eine
Transplantation nicht mehr in Frage kommt. Betroffene mit einer CLL werden je
nach Stadium der Erkrankung behandelt [Begemann und Begemann-Deppe,
121ff].
Prognose: Inzwischen überleben 70-90 Prozent der Kinder eine ALL, während die
Heilungsrate bei Erwachsenen signifikant abfällt und im Alter über 65 Jahren bei
nur noch 5 Prozent liegt. Nach fünf Jahren überleben 40% aller Erwachsenen eine
ALL und 30% eine AML. Bei Kleinkindern ist die Überlebenschance ebenfalls ge-
ring. Es können etwa 50 Prozent der Kinder und jüngere Erwachsenen eine Lang-
zeitheilung erwarten [Preiß et al. 2002, 3, 18].
In etwa 50 Prozent der Fälle wird die Diagnose bei den chronischen Leukämien
zufällig gestellt. Die mittlere Überlebenszeit beträgt für diese Gruppe der Leukä-
mien drei bis fünf Jahre [Begemann und Begemann-Deppe, 109ff].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
7
2.1.2 Maligne Lymphome
Definition/Klassifikation: Die Unterteilung der malignen Lymphome erfolgt in Hodg-
kin-Lymphome (Morbus Hodgkin) sowie Non-Hodgkin-Lymphome [Schneider und
Szanto 1997, 171].
,,Morbus Hodgkin ist eine maligne lymphatische Systemerkrankung, die histolo-
gisch durch wenige Tumorzellen (Hodgkin-Zellen und mehrkernige Sternberg-
Reed-Riesenzellen) sowie Granulationsgewebe gekennzeichnet ist" [Heinz und
Lange 2002, 398].
,,Non-Hodgkin-Lymphome sind Neoplasien des lymphatischen Gewebes, ausge-
hend vom B-Zell-System oder T-Zell-System. Nach klinischem Verlauf wird zwi-
schen hoch-malignen und niedrig-malignen Lymphomen unterschieden" [Finke
2002a, 410].
Klinik: Lymphome sind eine Gruppe von Erkrankungen, die durch veränderte
Lymphozyten verursacht werden. Diese sammeln sich in den Lymphknoten an und
bringen sie zum Anschwellen. Mitunter ist es möglich, dass die veränderten Lym-
phozyten ins Blut übertreten oder andere Organe infiltrieren. Es zeigen sich häufig
folgende Symptome: Vergrößerungen der Lymphknoten und Milz, Fieber (sub-
febrile Temperaturen), Gewichtsabnahme, Nachtschweiß, Schwäche, Appetitlo-
sigkeit etc [Schneider und Szanto 1997, 171].
Diagnostik: Die genaue Diagnose und Klassifikation erfolgt nach einer histologi-
schen Untersuchung eines exstirpierten Lymphknotens. Die Unterscheidung von
Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphom basiert auf dem histologischen
Nachweis von Reed-Sternberg(RS)-Zellen. Sind diese Zellen nachweisbar, so
geht man von Morbus Hodgkin aus [Diehl und Pfreundschuh 1997, 534ff].
Therapie: Aufgrund des hohen Risikos von Zweitkarzinomen vor allem bei jünge-
ren Patienten, gilt die Devise: So wenig Therapie wie möglich und nur so viel The-
rapie wie nötig. Die medizinischen Strategien zur Behandlung maligner Lymph-
omen umfassen Strahlentherapie und Chemotherapie. Bei hochmalignen Lymph-
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
8
omen kommt eine SZT als Behandlungsmaßnahme in Frage [Preiß et al. 2002,
23].
Prognose: Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt je nach Alter, Stadium der Erkran-
kung und Histologie zwischen 50 und 90 Prozent. Bei den Non-Hodgkin-
Lymphomen liegt das Langzeit-Überleben bei 45 Prozent [Diehl und Pfreundschuh
1997, 534ff].
2.1.3 Multiples Myelom (Plasmozytom)
Definition/Klassifikation: ,,Das Plasmozytom ist ein niedrig malignes Non-Hodgkin-
lymphom mit klonaler Expansion terminal differenzierter B-Lymphozyten (Plasma-
zellen). Charakteristisch sind Bildung monoklonaler Immunglobuline (,,Parampro-
tein"), Osteolysen, Nierenfunktionsstörung und Immundefizienz" [Finke 2002b,
464].
Die Stadieneinteilung (I bis III + B) erfolgt nach Durie und Salmon und klassifiziert
nach Befallsmuster sowie Zytologie der Plasmazellen und seine Auswirkungen auf
Blutbild, Knochen und Nierenfunktion [Preiß et al. 2002, 37].
Klinik: Beim multiplen Myelom handelt es sich um eine starke Ansammlung von
malignen Plasmazellen im Knochenmark, die sich dort unkontrolliert vermehren.
Im Rahmen des erhöhten manifestierten Anteils im Knochenmark (meist über 20
Prozent) kommt es häufig zu Knochenläsionen und demzufolge zu pathologischen
Knochenfrakturen. So lässt sich das klinische Bild mit Knochenschmerzen, Anä-
mie, Infektionen, Blutungsneigungen, Niereninsuffizienz etc beschreiben [Schnei-
der und Szanto 1997, 167ff].
Diagnostik: Die diagnostischen Maßnahmen bei Verdacht auf Multiples Myelom
umfassen Labor, Histologie und Bildgebung. Die Diagnosekriterien sind der histo-
logische Plasmozytomnachweis in der Gewebebiopsie, über 30% Plasmazellen im
Knochenmark und monoklonales Paraprotein im Serum [Finke 2002b, 466].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
9
Therapie und Prognose: Aktuell scheint es so, dass selbst eine Stammzelltrans-
plantation diese Erkrankung nur aufhalten, jedoch nicht heilen kann [Hoffbrand et
al. 2003, 185ff]. Die mittlere Überlebenszeit beträgt 40 Monate bei therapeutischen
Interventionen durch hochdosierte Chemotherapie, Strahlentherapie, Operation
und weiteren spezifischen Medikamenten [Preiß et al. 2002, 37].
2.1.4 Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
Definition: ,,Das myelodysplastische Syndrom ist eine klonale Erkrankung mit
Transformation einer frühen hämatopoetischen Vorläuferzelle (Stammzelle) und
dadurch bedingter Störung von Proliferation, Differenzierung und Apoptose (pro-
grammierter Zelltod). Betroffen sind meist mehrere Zellreihen" [Lübbert und Lin-
demann 2002, 371].
Klassifikation und Klinik: Die Klassifizierung erfolgt nach zytologischen Gesichts-
punkten (WHO-Schema). Bei dieser erworbenen Erkrankung ist die Vermehrung
und Differenzierung hämatopoetischer Stammzellen gestört. Dadurch kommt es
schließlich zu einer ineffektiven Hämatopoese. Mögliche Symptome sind Anämie,
Infektionen oder Neigung zu Blutungen oder Hämatomen. Die Erkrankung entwi-
ckelt sich verhältnismäßig langsam und wird meist zufällig entdeckt [Hoffbrand et
al. 2003, 185ff).
Diagnostik: Das MDS ist nach zytogenetischen Gesichtspunkten noch keine Leu-
kämie. Häufig (zu 50 Prozent) geht diese Erkrankung in eine AML über. Die Ätio-
logie ist weitgehend ungeklärt. Es werden Labor und Knochenmarkuntersuchun-
gen (mit Ausstrich, Histologie und Immunzytologie) zur Diagnostik eines MDS he-
rangezogen [Lübbert und Lindemann 2002, 373].
Therapie und Prognose: Die mittlere Überlebenszeit bei Erkrankten mit einem
MDS schwankt je nach Klassifikation zwischen 9 und 49 Monaten. Durch eine
allogene SZT ist ein kurativer Ansatz möglich. Etwa 40% überleben langfristig. Ist
kein passender Spender vorhanden, kommt eine intensive Chemotherapie und
autologe SZT in Betracht [Preiß et al. 2002, 27].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
10
2.1.5 Myeloproliferative Erkrankungen
Definition/Klassifikation: ,,Die myeloproliferativen Syndrome sind eine Gruppe klo-
naler hämatopoetischer Stammzellerkrankungen mit Veränderungen der myeloi-
schen Zellreihe. Definitionsgemäß werden folgende Erkrankungsbilder zu den my-
eloproliferativen Syndromen gezählt: Chronische myeloische Leukämie, Poly-
cythämia vera, Essentielle Thrombozytose und Osteomyelofibrose" [Waller und
Lange 2002, 378].
Diese Gruppe der chronisch myeloproliferativen Erkrankungen zeigen fließende
Übergänge untereinander [Preiß et al. 2002, 30].
Klinik: Myeloproliferative Erkrankungen beschreiben Störungen der Knochenmark-
stammzellen, die durch eine klonale Vermehrung bzw. Ansammlung einer oder
mehrerer blutbildender Zellreihen im Knochenmark und häufig auch in Leber und
Milz charakterisiert sind. Es ist keine leukämische Erkrankung, in der es zu einer
Blasten-Ansammlung kommt. Vielmehr dominieren eine oder mehrere Zellreihen,
die sich unkontrolliert ausbilden und je nach betroffener Zellreihe unterschiedliche
Symptome ausbilden [Begemann und Begemann-Deppe, 129].
Diagnostik: Je nach Einzelfall erfolgt die Diagnostik unterschiedlich und stellt sich,
da es sich um atypische Erkrankungen handelt, als außerordentlich schwierig dar.
In manchen Fällen kann ein klare Diagnose nur durch Verlaufsbeobachtung und
wiederholte Knochenmarkdiagnostik sowie klinische und weitere Laborparameter
gestellt werden.
Therapie und Prognose: Die Therapie zur Behandlung myeloproliferativer Erkran-
kungen umfasst den Einsatz von Zytokinen (Bsp.: Interferon) und/oder Zytostatika.
Durch eine allogene SZT ist eine langfristige Heilung erreichbar. Zahlen zur ge-
nauen Prognose zu definieren ist nicht möglich, da sich die Verläufe der Erkran-
kungen über Jahre und Jahrzehnte erstrecken können [Preiß et al. 2002, 30].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
11
2.1.6 Immundefekt
Klassifikation und Klinik: Sehr selten wird ein angeborener oder erworbener Im-
mundefekt diagnostiziert, der letztlich zu einem kompletten Defekt der Hämato-
poese, also zu schweren Anämien führen kann. Patienten mit Immundefizienz
neigen weiter zu erhöhter Infektanfälligkeit [Rosen 1995, 258].
Diagnostik: Um einen Immundefekt zu diagnostizieren, müssen umfangreiche ge-
netisch-chromosomale Untersuchungen erfolgen.
Therapie und Prognose: Hier bietet sich als einzige Alternative zur ,,Heilung" die
Stammzelltransplantation an [Ostendorf et al. 1997, 222ff].
2.1.7 Solide Tumore
Klassifikation und Klinik: Die gebräuchlichste Tumorklassifikation erfolgt nach dem
TNM-System (UICC). Einzelne Entitäten (zum Beispiel Hoden-CA) haben zusätzli-
che Klassifikationen [Schölmerich et al. 1999, 110f].
Die Klinik bei soliden Tumoren fällt je nach Lokalisation, Ausbreitung und Größe
unterschiedlich aus. Aufgrund der enormen Vielfalt solider Tumoren wird an dieser
Stelle nicht näher auf klinische Merkmale eingegangen, sondern auf weiterführen-
de Literatur verwiesen [Schölmerich et al. 1999, 107ff].
Diagnostik: Die diagnostischen Verfahren richten sich in erster Linie nach den kli-
nischen Befunden bzw. Zufallsbefunden. Auch in diesem Zusammenhang besteht
eine große Auswahl diagnostischer Maßnahmen, die sich an den verschiedenen
Entitäten orientiert. Angesichts der Fülle an diagnostischen Möglichkeiten wird hier
ebenfalls auf weiterführende Literatur verwiesen [Preiß et al. 2002, 73ff].
Therapie: Im Rahmen der Therapie solider Tumore wird immer häufiger, neben
OP, Chemotherapie und Bestrahlung, auch das Prinzip der autologen Transplan-
tation angewandt. Im Mittelpunkt der Behandlung stehen insbesondere Mamakar-
zinome und Weichteilkarzinome. Bei Keimzelltumoren ist die autologe Transplan-
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
12
tation inzwischen etabliert [Trenschel et al. 2001, 1292]. Durch eine autologe
Transplantation, sorgt die Reinfusion eigener hämatopoetischer Stammzellen im
Anschluss an den Chemo-Zyklus dafür, dass der Patient nach den chemothera-
peutischen Interventionen schneller aus dem Zelltief (Aplasie) kommt. Das beugt
Infektionen und weitere Folgeerkrankungen vor [Hoffbrand et al. 2003, 99ff].
Prognose: Die mittlere Überlebenszeit (fünf Jahre) bei Krebs mit soliden Tumoren
erstreckt sich von sehr günstigen Raten (Lippenkrebs (93 Prozent), Melanom der
Haut (89 Prozent)) über sehr ungünstige Raten (Speiseröhrenkrebs (acht Pro-
zent), Lungenkrebs (13 Prozent)) [Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsbezogener
Krebsregister in Deutschland 2004, 12].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
13
2.2 Stammzelltransplantation
Einige der oben genannten aggressiven Erkrankungen, wie auch andere weiter
unten aufgeführte Störungen des hämatopoetischen Systems, sind zum heutigen
Zeitpunkt nur durch eine so genannte Stammzelltransplantation ,,heilbar". Der Beg-
riff ,,Stammzelltransplantation" (SZT) beschreibt sowohl die Knochenmarktrans-
plantation (KMT), bei der es sich um die Entnahme von Stammzellen aus dem
Knochenmark handelt, als auch die periphere Blutstammzelltransplantation
(PBSZT), bei der die Stammzellen aus dem peripheren Blut gesammelt werden.
Bei diesem Verfahren wird das Immunsystem und das hämatopoetische System
des Patienten durch Bestrahlung und Chemotherapie zunächst destruiert (Konditi-
onierung). Diese Systeme werden danach durch die Stammzellen des Spenders
ersetzt (Transplantation). Bis die neuen Stammzellen erfolgreich angewachsen
sind und mehr als 1.000 Leukozyten gebildet haben (Engraftment), vergehen ca.
zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit befinden sich die Patienten unter keimfreien
Bedingungen in der Aplasie. Die SZT kann autolog (eigene Stammzellen des
Spenders) als auch allogen (fremde Stammzellen) erfolgen [Begemann und Be-
gemann-Deppe 2000, 77ff].
Ob eine Transplantation sinnvoll ist oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren
wie Schweregrad der Erkrankung, Remission, Alter, allgemeiner Zustand und von
der Verfügbarkeit des Spenders ab. Bei folgenden Erkrankungen wird eine autolo-
ge und/oder allogene SZT in Erwägung gezogen:
AML oder ALL
CML
Andere maligne Erkrankungen des Knochenmarks
Schwere Anämien
Erbliche Erkrankungen und Störungen in der Hämatopoese
Andere schwere, erworbene Knochenmarkerkrankungen
Solide Tumoren
[Trenschel et al. 2001, 1289; Hoffbrand et al. 2003, 99ff].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
14
2.3 Komplikationen und Folgen einer SZT
In diesem Kapitel werden die möglichen akuten sowie langfristigen Komplikationen
und Folgen einer SZT beschrieben. Dabei wird im Rahmen der Präsentation der
verschiedenen Studien und Untersuchungen im Allgemeinen auf eine chronologi-
sche Zeitfolge geachtet. Entsprechende maßgebende Zeitangaben sind fett ge-
kennzeichnet.
Das Verfahren einer allogenen Transplantation, bei dem Stammzellen von einer
Person gewonnen und einer fremden infundiert werden, ist mit einer beträchtlichen
Morbidität (vgl. Kapitel 2.3.2) und Mortalität verbunden. Die Prognose des Patien-
ten ist in erster Linie von Art, Schwere und Status der Erkrankung abhängig und
kann stark variieren. So überleben nur etwa 20 Prozent der Patienten mit malig-
nen hämatologischen Erkrankungen ohne komplette Remission drei Jahren nach
allogener SZT [Tabata et al. 2002]. Bei kompletter Remission erhöhen sich die
Überlebenschancen deutlich. Über 80 Prozent der Patienten mit bestimmten
Lymphomen können nach autologer Transplantation geheilt werden [Trenschel et
al. 2001, 1291]. Bensinger et al. [2001] ermittelten eine Überlebenszeit von 54 bis
66 Prozent auf zwei Jahren bei kompletter Remission. Das krankheitsfreie Überle-
ben beläuft sich in diesem Zeitraum nur auf 45 bis 65 Prozent.
Erste Komplikationen stellen sich bei den Patienten schon durch toxische Reakti-
onen im Rahmen der Konditionierung (aggressivste Chemotherapie und Bestrah-
lung) ein. Weiterhin besteht die Gefahr der immunologischen Inkompatibilität von
Spender und Patient, die sich als Immunschwächung, Abstoßungsreaktion
(GvHD) oder als Transplantatversagen zeigen kann [Ostendorf et al. 2003, 222ff].
Diese Komplikationen und die Tatsache, dass die Patienten über mehrere Wo-
chen das Zimmer nicht verlassen dürfen (Isolation), gehen immer mit einer Immo-
bilität und den daraus resultierenden typischen Folgen des Bewegungsmangels
einher. Dies führt schließlich zu einer weiteren Verschlechterung des Krankheits-
bildes [Bartsch et al. 2000].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
15
2.3.1 Graft versus Host Disease (GvHD)
Die GvHD (Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion) ist die schwerste Komplikation im
Rahmen einer allogenen SZT. Diese Reaktion wird durch die Immunzellen (T-
Lymphozyten) des Spenders verursacht, die gegen Gewebe des Wirts reagieren.
Um die Möglichkeit dieser Abstoßungsreaktion möglichst gering zu halten oder
sogar zu vermeiden, ist eine GvHD-Prophylaxe in Form von immunsuppressiven
Medikamenten notwendig.
Man unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen GvHD. Die akute
GvHD tritt in den ersten 100 Tagen nach der Transplantation auf und zeigt sich
gewöhnlich an Haut, Gastrointestinaltrakt und Leber. Der Patient reagiert dann mit
Rötung, Abschuppung, Blasenbildung (Haut) sowie mit Bauchschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen und Blutungen aus dem Darm (Gastrointestinaltrakt) oder Müdig-
keit und Ikterus (Leber). Die GvHD kann je nach Schwere tödlich verlaufen. In der
Regel wird die akute GvHD mit hohen Dosen Kortikosteroiden (Kortison) behan-
delt, die normalerweise gut ansprechen. Entsprechend der Definition wird eine
GvHD nach dem 100. Tag chronisch und entwickelt sich gewöhnlich aus einer
akuten GvHD. Zusätzlich zu den Reaktionen der akuten GvHD sind nun auch Ge-
lenke, Tränendrüsen und andere seröse Oberflächen betroffen. Generell ist das
Immunsystem beeinträchtigt und dadurch das Infektionsrisiko erhöht. Es können
auch Abstoßungsreaktionen an der Lunge auftreten [Hochhaus und Hehlmann
2001, 78ff].
Ein kompatibler Spender ist entscheidend für das Überleben und die
Komplikationsrate von Patienten nach SZT. Eine fremd-allogene Transplantation
bedeutet in diesem Zusammenhang im Vergleich zur familiär-allogenen ein
deutlich höheres Risiko. Die Morbidität steigt mit zunehmend unterschiedlicher
Histokompatibilität von Spender und Empfänger [Hoffbrand et al. 2001, 530].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
16
2.3.2 Physische Komplikationen
Es können sich noch eine Fülle weiterer Schwierigkeiten durch eine Stammzell-
transplantation für den Patienten ergeben. Dazu zählen vor allem bakterielle, vira-
le und Pilzinfektionen, die in der frühen Phase nach der Transplantation häufig
auftreten. Bestimmte Infektionen können tödlich verlaufen und müssen dement-
sprechend rechtzeitig behandelt werden. Zu den weiteren schweren Komplikatio-
nen zählen akute Blutungen, Transplantatversagen, hämorrhagische Zystitis,
Pneumonie, Venenverschlusskrankheiten, Herzversagen etc. Häufig treten in der
stationären Phase auch Übelkeit und Erbrechen, Schleimhautentzündungen,
Durchfall, Blasenentzündungen, Haarausfall, Lungenentzündungen sowie Schädi-
gungen an Leber, Herzmuskel und Gastrointestinaltrakt auf [Begemann und Be-
gemann-Deppe 2000, 81].
Die Freiburger Klinik für Tumorbiologie (TuBi) stellte im Jahre 2000 eine Studie
vor, in der die häufigsten Komplikationen nach einer Knochenmarktransplantation
beschrieben wurden
2
. So beobachtete man in erster Linie ausgeprägte Schwä-
chen der Bein- und Hüftmuskulatur, Schmerzen in Knien und Hüftgelenken sowie
Rückenschmerzen. Von 1993 bis 1997 untersuchte das Institut 348 Patienten auf
Komplikationen nach dem stationären Aufenthalt. Von den untersuchten Personen
litten 28 Prozent an degenerativen Muskelerkrankungen (Muskelmyopathien) und
28 Prozent an Polyneuropathien. Die meisten Patienten (28 Prozent) begannen
die Rehabilitationsphase 50 bis 100 Tage nach der Transplantation. 27 Prozent
fanden sich nach 100 bis 365 Tagen in der Rehabilitationsklinik ein.
Durch den langen stationären Aufenthalt in der Regel sechs bis acht Wochen bei
komplikationslosem Verlauf und der damit verbundenen Isolation leiden die Pati-
enten unter einem eingeschränkten Aktionsradius, der zu allgemeinen negativen
Folgen des Bewegungsmangels (Co-Morbidität) führen kann [Baumann 2001, 24].
Dieses umfassende Bild an physischen Komplikationen bedeutet für die meisten
Patienten eine erhebliche Einbuße ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit [Bartsch
et al. 2000].
2
Vorgestellt auf einem Symposium am 13./14.04. 2000 an der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
17
2.3.2.1 Autologe Transplantation und körperliche Leistungsfähig-
keit
Im Folgenden werden die Einflüsse einer autologen Transplantation auf die kör-
perliche Leistungsfähigkeit beschrieben.
Vose untersuchte die langfristigen Folgen autologer SZTs und berichtet, dass 58
Prozent von 54 Patienten 30 Monate nach der Transplantation in ihren physischen
Aktivitäten vermindert sind [Vose 1992].
50 Prozent der Patienten klagen auch zwei bis drei Jahre nach der Transplanta-
tion über schwere Fatigue. Mehr als 30 Prozent haben sexuelle Störungen [Knobel
et al. 2000; Hjermstad et al. 1999a; Watson et al. 1999; Whedon et al. 1995].
In Norwegen verglich man eine repräsentative Gruppe der Durchschnittsbevölke-
rung mit 38 Patienten, deren autologe Transplantation schon vier bis sechs Jah-
re zurücklag. Es zeigt sich nicht nur, dass das Fatigue-Syndrom signifikant häufi-
ger in der Patienten-Gruppe auftritt, sondern auch, dass Frauen stärker betroffen
sind als Männer. Auch klagen mehr Frauen als Männer über körperliche Schwä-
che [Knobel et al. 2000; Andrykowski et al. 1999; Hjermstad et al. 1999(a)].
Etwa ein Drittel der autolog Transplantierten klagt über eine starke Abnahme ihrer
Leistungsfähigkeit und die Hälfte über verminderte Freizeitaktivitäten [Watson et
al. 1999].
Tabellarischer Überblick
In Tabelle 1 sind die in diesem Kapitel 2.3.2.1 beschriebenen Studien zum besse-
ren Überblick und Vergleich aufgeführt.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
18
Komplikation
Autor [Pub. J.]
Phys. Aktivitä-
ten
Schwere Fatigue
Sexuelle Stö-
rungen
Verminderte
Freizeitaktivitä-
ten
Andrykowski et al. [1999]
Nach 4-6 J. Frauen
stärker betroffen als
Männer
Nach 4-6 J. Frauen
stärker betroffen als
Männer
Hjermstad et al. [1999]
Nach über 1 J. 24-
30% keine Aktivitäten
Vose et al. [1992]
Nach 30 M. bei 58%
vermindert
Nach 30 M. 40%
Watson et al. [1999]
Nach 5 J. ein Drittel
starke Abnahme
Nach 2-3 J. 50%
Nach 2-3 J. über 30% Nach ca. 5 J. über
50%
Whedon et al. [1995]
Nach 37 M. 50%
Nach 37 M. 30%
Tabelle 1 : Übersicht über post-stationäre Auswirkungen von autologer SZT auf körperliche
Leistungsfähigkeit (M.= Monate, J.= Jahre)
2.3.2.2 Allogene bzw. autologe Transplantation und körperliche
Leistungsfähigkeit
Grundsätzlich sind die negativen Auswirkungen von autologen wie auch allogenen
Transplantationen noch nicht ausreichend erforscht. Schon vorhandene Studien
zeigen deutliche Schwierigkeiten der Patienten mit ihrer Reintegration in das all-
tägliche Leben, mit ihrer Rückkehr zur Arbeit und sie geben intensivste Schlaf-
probleme an. Frauen berichten in mehreren Studien über größere Probleme mit
Fatigue und Sexualität als Männer [Carlson u. MacRae 2002].
Fatigue
Etwa 70 Prozent der Patienten klagen nach der Chemotherapie über Müdigkeit
und Abgeschlagenheit, das sogenannte Fatigue-Syndrom [Dimeo et al. 1996].
Dieses Syndrom zeigt sich schließlich in einer Verminderung des Leistungsver-
mögens, so dass schon alltägliche Tätigkeiten, wie Treppen steigen oder Spazie-
ren gehen für viele eine außergewöhnliche Anstrengung bedeutet. Viele Patienten
können so ihre gewohnten Freizeit- und Arbeitsaktivitäten nicht wieder aufnehmen
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
19
und erleben nach ihrem Klinikaufenthalt eine zunehmende Isolation. Die Bewälti-
gung des für sie normalen Alltagslebens ist kaum mehr möglich, und es entsteht
ein Teufelskreis: Durch die verminderte Aktivität, aufgrund der niedrigen Belast-
barkeit, herrscht ein Bewegungsmangel vor, der wiederum zu weiterer Leistungs-
einbuße führt [Dimeo et al. 1996].
Fatigue ist das am meisten verbreitete Problem unter den Überlebenden nach ei-
ner Krebsbehandlung [Winningham et al. 1994].
Ein halbes Jahr nach der Transplantation klagen immer noch 50 Prozent der Pa-
tienten über Fatigue. Dieses Ergebnis deckt sich in etwa mit der Befragung direkt
nach der Entlassung. Nach einem Jahr kann beobachtet werden, dass etwa ein
Drittel (38 Prozent) der Betroffenen unter dem Fatigue-Syndrom leidet [Baker et al.
1999].
Baker et al. [2003] erkannten in einer Studie mit 99 Patienten, dass zwei Drittel der
Erkrankten ein Jahr nach der Transplantation unter dem Fatigue-Syndrom leiden.
13 Prozent sehen das sogar als schwerwiegendes Problem an.
Kraftverlust und Leistungsfähigkeit
Direkt nach der Entlassung zeigen nach einer Studie (n=84) von Baker et al. et-
wa ein Drittel der SZT-Patienten physische Einschränkungen, vor allem Kraftver-
lust [Baker et al. 1999]. Zu diesem Zeitpunkt berichten signifikant viele SZT-
Patienten über verminderte funktionale Fähigkeiten, die sich in den darauf folgen-
den sechs Wochen wieder bessern [Hacker und Ferrans 2003].
Hinterbuchner [1979] untersuchte bei stationär liegenden Krebspatienten die Leis-
tungseinbußen durch passive Mobilisation im Rahmen krankengymnastischer
Maßnahmen. Diese Maßnahmen erhalten zwar die Beweglichkeit, jedoch können
durch diese therapeutische Formen Leistungseinbußen von 30 Prozent beobach-
tet werden.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
20
Die Folgen der Krebsbehandlung im Rahmen einer Transplantation können sich
auch in einer verschlechterten Lungenfunktion, in chronischen Kardiomyopathien
und in neurologischen Störungen zeigen [Dimeo et al. 1996]. Diese Verkettungen
führen unweigerlich zu weiteren Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit.
Nach einer Studie mit 156 Langzeitüberlebenden, bei denen die Transplantation
mindestens ein halbes Jahr zurücklag, wurde nach den größten Einschränkungen
aus physischer wie auch aus psychischer Sicht gefragt. Die Patienten nennen den
physischen Bereich am häufigsten. So liegen die größten Probleme darin, dass
die Erkrankten anfälliger für physische Erkrankungen werden. Weiter geben die
Patienten an, dass sie zur Durchführung anstrengender Sportarten Defizite in
Energie und Ausdauer haben [Somerfield et al. 1996].
In einer weiteren Studie mit 84 Patienten (ein halbes Jahr nach der Transplantati-
on) klagen mehr als 50 Prozent über Kraftverluste, ein Drittel über andere körperli-
che Beeinträchtigungen, ein Drittel über anhaltende gesundheitliche Probleme und
ein Drittel über Unfruchtbarkeit und sexuelle Störungen. Diese Ergebnisse decken
sich annähernd mit der Befragung direkt nach der Entlassung. Bei der nächsten
Befragung der Patienten nach einem Jahr kann nun beobachtet werden, dass
etwa ein Drittel unter dem Gefühl körperlicher Beeinträchtigungen (31 Prozent)
leidet, 27 Prozent gaben weiter anhaltende gesundheitliche und 17 Prozent ex-
treme physische Probleme an [Baker et al. 1999].
Ein Jahr nach der Transplantation zeigt sich gemeinhin ein schlechteres körperli-
ches Befinden und ein reduzierter physischer Allgemeinzustand [Kopp et al. 1998].
Baker et al. [2003] erforschten bei 99 Patienten, dass 62 Prozent der Erkrankten
ein Jahr nach der Transplantation unter Kraftverlust leiden. Dieser gehört im Rah-
men der Patienten-Befragung zu den am häufigsten genannten Problemen.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
21
Spätkomplikationen
In einer weiteren Untersuchung berichten Patienten, deren Transplantation mehr
als drei Jahre zurücklag, über Schwierigkeiten, körperliche Aktivitäten (76 Pro-
zent) durchzuführen, 63 Prozent haben Probleme in der Sexualität, 78 Prozent
fühlen sich ständig müde und 51 Prozent zeigen Schlafprobleme [Andrykowski et
al. 1995].
Van Bömmel [1995, 77] untersuchte die Spätkomplikationen von 70 Patienten
mehr als drei Jahre nach der Transplantation: 55 Prozent entwickeln eine chroni-
sche GvHD, die sich vor allem an Haut, Leber, Mundschleimhaut, Augen, Intesti-
naltrakt und Lunge manifestiert. Pulmonologische Auffälligkeiten zeigen 33 Pro-
zent der Patienten, während bei 23 Prozent sogar Kurzatmigkeit diagnostiziert
wird. 27 Prozent klagen über Schwäche und/oder Schmerzen an Stütz- und Be-
wegungsapparat und bei 14 Prozent der Patienten wird eine mäßige bis starke
Osteoporose festgestellt.
Vier Jahre nach der Transplantation berichten Patienten über eine allgemein gute
körperliche Verfassung, die sich langsam weiter verbessert. Es verbleibt allerdings
eine kleine Anzahl an ,,Rest-Schwierigkeiten", wie Infektionsanfälligkeit und noch
vereinzelt verbliebene körperliche Einschränkungen [Bush et al. 2000].
Tabellarischer Überblick
In Tabelle 2 sind die in diesem Kapitel 2.3.2.2 beschriebenen Studien zum besse-
ren Überblick und Vergleich aufgeführt.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
22
Komplikation
Autor [Pub. J.]
Körperliche
Schwäche
Fatigue
Kraftverluste
Sexuelle Prob-
leme
Andrykowski et al. [1995]
Nach 3 J. 76%
Nach 3 J. 78%
Nach 3J. 63%
Baker et al. [1999]
Nach 6 M. über ein
Drittel - Nach 1 J. etwa
ein Drittel
Nach 6 M. über 50% -
Nach 1 J. über ein
Drittel
Ein Drittel aller Pat.
nach Entlassung -
Nach 6 M. über 50%
Nach 6 M. über ein
Drittel
Baker et al. [2003]
Nach 1 J. 62%
Nach 1 J. zwei Drittel
Carlson/MacRae [2002]
Frauen größere Prob-
leme als Männer
Frauen größere
Probleme als Männer
Dimeo et al. [1996]
70% nach Chemo
Hacker/Ferrans [2003]
Signifikant viele Pat.
nach Entlassung
Kopp et al. [1998]
Nach 1 J. schlechter
und eingeschränkter als
nach Entlassung
Van Bömmel [1995]
Nach über 3 J. ein
Drittel
Winningham et al. [1994]
Größtes Problem
unter Überlebenden
nach SZT
Tabelle 2 : Übersicht über post-stationäre Auswirkungen von autologer und allogener SZT
auf körperliche Leistungsfähigkeit (M.= Monate, J.= Jahre)
2.3.2.3 Körperliche Leistungsfähigkeit bei allogener und autologer
Transplantation im Vergleich
Während der stationären Zeit besteht in der physischen Konstitution kein Unter-
schied zwischen den autolog und den allogen Transplantierten. Die meisten Sym-
ptome sind: Fieber, Mundschmerzen, Gewichtsverlust, Übelkeit und Erbrechen,
Verlust des Geschmacksinns, Haarverlust, Fatigue, Müdigkeit und Schlaflosigkeit.
Verbesserungen sind kurz vor der Entlassung zu erkennen [Zittoun 1999].
Etwa zwei Jahre nach der Transplantation zeigen sich in vielen Studien bei den
physischen Einschränkungen zwischen allogen und autolog Transplantierten keine
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
23
signifikanten Unterschiede mehr [Andrykowski et al. 1999; Fromm et al. 1996; Lit-
wins et al. 1994; Jenkins et al. 1991].
Andere Studien kommen da jedoch zu einem anderen Ergebnis. So fanden Zittoun
et al. [1997] bei 98 Probanden vier Jahren nach der SZT heraus, dass die allogen
Transplantierten in einer schlechteren körperlichen Verfassung sind als die auto-
log Transplantierten. Sie haben größere Schwierigkeiten einen längeren Spazier-
gang zu machen, die Hausarbeit durchzuführen und befinden sich in einer
schlechteren körperlichen Konstitution.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Andrykowski et al. [1995], die 209 Patienten
(54 Prozent autolog und 46 Prozent allogen transplantiert) 41 Monate nach
Transplantation befragten. Die allogen Transplantierten geben größere Einschrän-
kungen in der körperlichen Arbeit und im Freizeitverhalten sowie häufiges Auftre-
ten von Übelkeit, Juckreiz und Schleimhautentzündungen an. Weiter klagen sie
auch mehr über Appetitlosigkeit und schlechtes körperliches Wohlbefinden [Kopp
et al. 1998].
Allogen Transplantierte haben nach der Transplantation über einen langen Zeit-
raum eine noch deutlich schlechtere physische Konstitution als autolog transplan-
tierte Betroffene [Carlson u. MacRae 2002]. Sie erholen sich auch nicht so schnell
von den sich durch die Transplantation verursachten Problemen. So spüren auto-
log Transplantierte eine schnellere Verbesserung in der Bewältigung des alltägli-
chen Lebens, in den Freizeitaktivitäten, in der Sexualität sowie in der Schmerz-
und Schlafsymptomatik [Yano et al. 2000].
2.3.3 Psychische und psychosoziale Komplikationen
Inzwischen existieren vereinzelt Studien, die sich mit der Lebensqualität transplan-
tierter Patienten auseinandersetzen. Auch entstanden größere und umfassendere
Studien, die den genauen Einfluss einer SZT auf die psychische und psychosozia-
le Verfassung des Patienten untersuchen [Carlson und MacRae 2002]. Jedoch
sind die Konsequenzen einer Transplantation auf die Lebensqualität noch nicht
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
24
ausreichend ermittelt, vor allem nicht der Vergleich zwischen allogen und autolog
Transplantierten [Carlson und MacRae 2002].
2.3.3.1 Psychische und psychosoziale Komplikationen nach auto-
loger Transplantation
Die größten psychischen Schwierigkeiten erleben Patienten um den Tag+5 nach
der Transplantation. Hier befindet sich der kritische Punkt, an dem die höchsten
Schmerz-, Angst- und Depressionswerte gemessen werden. Alle Patienten nutzen
zu diesem Zeitpunkt inadäquate Bewältigungsstrategien und haben so nur eine
kleine Möglichkeit, den Schmerz zu kontrollieren [Gaston-Johansson et al. 1992].
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Grassi et al. [1996], die herausfanden, dass die
Patienten schon zwei Tage vor stationärer Aufnahme bis zur Entlassung unter
hohem psychischen Stress leiden. Die Hälfte der hier 49 Befragten zeigen sogar
psychopathologische Auffälligkeiten. Allerdings nehmen die Angstwerte zur Ent-
lassung um die Hälfte und die Depressionswerte um ein Drittel ab. Wettergren et
al. [1999] können in diesem Zusammenhang in ihrer Studie zeigen, dass Angst
und Depression eng miteinander verstrickt sind und daher psychologische Hilfe für
die Betroffenen notwendig ist. Verglichen mit Patienten, die eine ambulante auto-
loge Transplantation erfuhren, konnte zu stationär autolog Transplantierten in der
Lebensqualität kein Unterschied erkannt werden [Summers et al. 2000].
In den ersten Monaten nach Entlassung haben SZT-Patienten mit verschiedenen
psychischen und psychosozialen Schwierigkeiten zu kämpfen. So zeigen sich bei-
spielsweise Probleme mit der Arbeitsstelle, in der Familie, im Freundeskreis etc.
Nach einem Jahr ist nach einer Befragung von Chao [1992] das Fatigue-Syndrom
das größte Problem, dennoch ist die Lebensqualität-Rate zu diesem Zeitpunkt
recht hoch, denn 88 Prozent der 59 Patienten gaben gute Werte an. Eine Studie
von Whedon et al. [1995] zeigt, dass 43 Prozent der 29 Befragten ein Jahr nach
der Transplantation negativen Stress aufgrund von sexuellen Störungen angeben.
93 Prozent beklagen durch die Erkrankung ausgelöste familiäre Probleme. Frauen
empfinden einen stärkeren Verlust in der sozialen und kognitiven Rolle als Männer
[Knobel 2000].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
25
Nach einer Befragung von 50 Patienten, 30 Monate nach der Transplantation,
würden 96 Prozent unter den gleichen Umständen den Weg der SZT noch einmal
gehen. Im Allgemeinen wird ein positives Bild vorgezeichnet. Die meisten haben
wieder zu arbeiten begonnen und leben einen normalen Lifestyle. Probleme exis-
tieren in erster Linie in der Sexualität [Vose 1992].
2.3.3.2 Psychische und psychosoziale Komplikationen nach allo-
gener bzw. autologer Transplantation
Es existieren in der gegenwärtigen Literatur einige Studien, die sich mit psychi-
schen und psychosozialen Komplikationen nach einer SZT befassen. Häufig sind
dabei autolog und allogen Transplantierte trotz der unterschiedlichen Transplanta-
tionstechniken in Untersuchungen zusammengefasst.
Lebensqualität
86 allogen und autolog Transplantierte, wurden in einer Studie vor, während und
nach der stationären Phase psychologisch untersucht. Die Lebensqualität wird
zur Entlassung als ,,schlecht" angegeben, während sie sich innerhalb von 100 Ta-
gen verbessert. Es kann ein Zusammenhang zwischen Depressionen und
schlechter Lebensqualität hergestellt werden [McQuellon et al. 1998]. Ähnliches
fanden auch Zittoun et al. [1999] heraus. Es zeigt sich, dass psychologische Vari-
ablen mit der Lebensqualität korrelieren. Für das Fatigue-Syndrom wurden die
gleichen Ergebnisse ermittelt.
Bereits kurz vor der stationären Aufnahme kann eine verminderte Lebensqualität
nachgewiesen werden [Hacker et al. 2003]. Ein Jahr nach der Transplantation
geben die meisten Patienten in einer weiteren Untersuchung (n=41) eine über-
durchschnittlich gute Lebensqualität an, trotz andauernder physischer Schwierig-
keiten [Saleh et al. 2001].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
26
Es berichten Zittoun et al. [1999] in ihrer Studie mit 178 transplantierten Patienten,
dass durch psychologische Interventionen kein Effekt auf die Lebensqualität
nachgewiesen werden konnte.
Von guter bis exzellenter Lebensqualität sprechen drei Jahre nach der Transplan-
tation 90 Prozent der Befragten (n= 125). Diese können psychische Problem sehr
gut bewältigen. Eine kleine Gruppe ist dazu allerdings nicht in der Lager und es
sind zumeist Patienten, die schon vor der Transplantation ,,psychisch labil" sind
[Broers et al. 2000].
415 Patienten konnten vier Jahre nach der Transplantation durchweg eine stabile,
verbesserte Lebensqualität bescheinigen. Trotz verschiedener Schwierigkeiten
berichten sie über ein positives Lebensgefühl. Sorgen haben die Patienten über
ihre Gesundheit und beschreiben ihre Anfälligkeiten gegenüber Krankheiten [Bush
et al. 2000].
Psychischer Stress
Die Patienten empfinden über die ersten 100 Tage nach einer SZT den gleichen
Stressfaktor, der sich nach einem Jahr langsam verringert, so dass schließlich
etwa 20 Prozent starke psychische Probleme angeben [McQuellon et al. 1998].
Den größten psychischen Stress erfahren die Patienten ein bis zwei Tage vor der
Transplantation [Broers et al. 2000; Fife et al. 2000]. Der niedrigste Stressfaktor
kann dann drei bzw. zwölf Monate nach der Transplantation gemessen werden.
Generell kann gesagt werden, dass sich Stress schon vor der stationären Auf-
nahme entwickelt und über die gesamte stationäre Phase der Transplantation bei-
behalten wird [Fife et al. 2000]. Vier Jahre nach der Transplantation empfinden
SZT-Patienten nur noch einen niedrigen Stressfaktor [Bush et al. 2000].
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
27
Psychosoziale Faktoren
Die Unterstützung der Familie spielt in den ersten zwölf Monaten eine entschei-
dende Rolle. Es zeigt sich, dass sich Patienten schneller und besser erholen,
wenn eine geordnete familiäre Struktur existiert [Fife et al. 2000].
Nach einer Befragung von 84 Patienten im ersten Jahr nach der Transplantation,
kommen in einer Untersuchung mit 84 Patienten die Autoren zum Schluss, dass
die Genesung ein langwieriger Prozess ist. So werden psychosoziale Probleme
wie Reintegrationsprobleme in sozialen Beziehungen (33 Prozent), Arbeit (23 Pro-
zent) und Familie (31 Prozent) direkt nach der stationären Entlassung analysiert.
Nach sechs Monaten verändert sich die Situation, so dass die Probleme mit der
Reintegration in Arbeit (13 Prozent), Familie (24 Prozent) und Gesellschaft (19
Prozent) sich grundlegend bessern. Nach einem Jahr schließlich, geben 27 Pro-
zent Finanzprobleme und 25 Prozent Jobprobleme an. Innerhalb des ersten Jah-
res nach SZT kann eine Verlagerung der Probleme von der psychischen auf die
psychosoziale Ebene beobachtet werden. Es ist möglich, den gesamten Entwick-
lungsprozess durch Seelsorge, Selbsthilfegruppen, und andere Maßnahmen posi-
tiv zu unterstützen [Baker et al. 1999].
Angst und Depressionen
Baker et al. [2003] publizierten eine Studie mit 99 Patienten, die frühestens sechs
Monate nach Entlassung zur psychologischen Befragung eingeladen wurden. Die
Resultate zeigen, dass sich die Befürchtungen der Patienten in erster Linie auf die
plötzliche Rückkehr ihrer Erkrankung konzentrieren, gefolgt von allgemeinen Zu-
kunftsängsten und dem Gefühl der Überforderung in sexueller Hinsicht.
Die Ergebnisse von Baker et al. [1999] gründen sich auf eine Untersuchung mit
254 Patienten, von denen 25 vor, während und nach der Transplantation psychi-
sche und soziale Interventionen erhalten haben. Diese Gruppe war besser auf
eine SZT vorbereitet, besaß weniger Probleme und gab einen geringeren Angst-
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
28
faktor an. Allerdings kann kein signifikanter Unterschied, sondern nur positive
Tendenzen zugunsten der Interventionsgruppe erkannt werden [Perry 2000].
Direkt nach der Entlassung werden psychische Probleme wie Zukunftsängste
(54 Prozent) und Depressionen (24 Prozent) beobachtet. Nach sechs Monaten
verändert sich die Situation, so dass sich Zukunftsängste (35 Prozent) legen, aber
Depressionen (29 Prozent) zunehmen. Nach einem Jahr schließlich, geben 27
Prozent der Befragten Zukunftsängste und 13 Prozent Depressionen an [Baker et
al. 1999].
Größere negative Störungen in der Familie und sozialem Gefüge können zwei
Jahre nach der Transplantation beobachtet werden. Es zeigt sich, dass psychi-
sche Erkrankungen mit Depressionen korrelieren [Jenkins et al. 1991].
Tabellarischer Überblick
In Tabelle 3 sind die in diesem Kapitel 2.3.3.2 beschriebenen Studien zum besse-
ren Überblick und Vergleich aufgeführt.
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
29
Komplik.
Autor [Pub. J.]
Psychischer Stress Psychosoziale Prob-
leme
Ängste / Depression
Lebensqualität
Baker et al. [1999]
Nach Entlassung 24%
Reintegrationsprobleme in
Arbeit (23%), soziale Bezie-
hungen (33%), Fami-
lie(31%) nach 6 M. Arbeit
(13%), soz. Bez. (19%),
Familie (24%) nach 1 J.
Finanz- (27%) und Jobprob-
leme (25%) In 1 J. Verla-
gerung der psychischen auf
psychosoziale Probleme
Nach Entlassung 54%
Zukunftsängste, 24%
Depression nach 6 M.
35% Zukunftsängste, 29%
Depressionen nach 1 J.
Zukunftsängste (27%),
Depressionen (13%)
Baker et al. [2003]
Nach 6 M. größte Sorge vor
Rezidiv
Broers et al. [2000]
Größten psychischen Stress
wenige Tage vor SZT
nach 3 J. gute Bewältigung
von psychischem Stress
Nach 3 J. 90% gute bis
exzellente LQ
Bush et al. [2000]
Nach 4 J. positive Laune
und geringer Stressfaktor
Nach 4 J. stabile und gute
LQ
Fife et al. [2000]
Größten psychischen Stress
1-2 Tage vor SZT nied-
rigster Stressfaktor 3-12 M.
nach SZT Stress vor
Aufnahme bleibt über
gesamte stat. Phase
Hacker et al. [2003]
Kurz vor stat. Aufnahme
verminderte LQ
Jenkins et al. [1991]
Nach 2 J. größere negative
Störungen in Familie und
sozialem Gefüge
Psychische Erkrankungen
korrelieren mit Depressio-
nen
McQuellen et al. [1998]
Über 100 Tage nach SZT
gleich hoher Stressfaktor
Verbesserung nach 1 Jahr,
dann 20% starke psychi-
sche Probleme
Hohe Korrelation zw. De-
pression und LQ
Zur Entlassung schlecht -
Verbesserung nach 100
Tagen
Perry [2000]
Psychotherapie vor, wäh-
rend und nach SZT zeigt
tendenziell weniger Proble-
me und geringeren Angst-
faktor
Saleh et al. [2001]
Nach 1 J. überdurchschnitt-
lich gute LQ
Zittoun et al. [1999]
Psychologische Variablen
und Fatigue assoziieren mit
LQ psychologische Inter-
vention zeigen keinen
signifikant positiven Effekt
Tabelle 3 : Übersicht über akute sowie post-stationäre Auswirkungen von autologer bzw.
allogener SZT auf die psychische und psychosoziale Ebene des Patienten (M.= Monate, J.=
Jahre, %-Zahl bezieht sich auf die Patienten)
Bewegungstherapie im Rahmen einer SZT
____________________________________________________________________________________
30
2.3.3.3 Psychische und psychosoziale Komplikationen autologe
und allogene Transplantation im Vergleich
Im folgenden Kapitel werden die psychischen bzw. psychosozialen Komplikatio-
nen der allogenen mit der autologen SZT verglichen.
Lebensqualität
Im ersten Jahr nach der Transplantation zeigen autolog Transplantierte ein bes-
seres emotionales Wohlgefühl, weniger Appetitlosigkeit und eine generell bessere
Lebensqualität. Allogen Transplantierte geben größere Einschränkungen in der
Lebensqualität an [Kopp et al. 1998].
Frauen berichten in diesem Zeitraum über mehr Probleme in der Lebensqualität
und Sexualität als Männer [Hjermstad et al. 1999a, Watson et al. 1999]. Nach über
einem Jahr können allerdings nach Hjermstad et al. [1999b] keine Unterschiede
mehr in der psychischen oder psychosozialen Verfassung zwischen den beiden
Patienten-Gruppen erkannt werden.
Zittoun et al [1997] kommen jedoch zu anderen Ergebnissen und konnten in der
Lebensqualität signifikante Unterschiede zwischen allogen und autolog Transplan-
tierten nachweisen. 53 Monate nach SZT wurden diesbezüglich 98 AML-
Patienten befragt. Die allogen Transplantierten geben schlechtere Werte an und
es zeigen sich signifikante Unterschiede auch in der sexuellen Aktivität und im
Verlust der Libido zugunsten der autolog Transplantierten.
In einer anderen großen Studie (n=415) konnten allerdings keine Unterschiede in
der Lebensqualität zwischen den beiden hier zu vergleichenden Gruppen beo-
bachtet werden. Über vier Jahre hinweg wurde jährlich die Lebensqualität bewer-
tet und erkannt, dass sie sich beide Gruppen über diesen Zeitraum langsam
verbessern [Bush et al. 2000].
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832489670
- ISBN (Paperback)
- 9783838689678
- DOI
- 10.3239/9783832489670
- Dateigröße
- 4.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – Sportwissenschaften, Rehabilitation und Behindertensport
- Erscheinungsdatum
- 2005 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- knochenmark transplantation therapie rehabilitation krebs
- Produktsicherheit
- Diplom.de