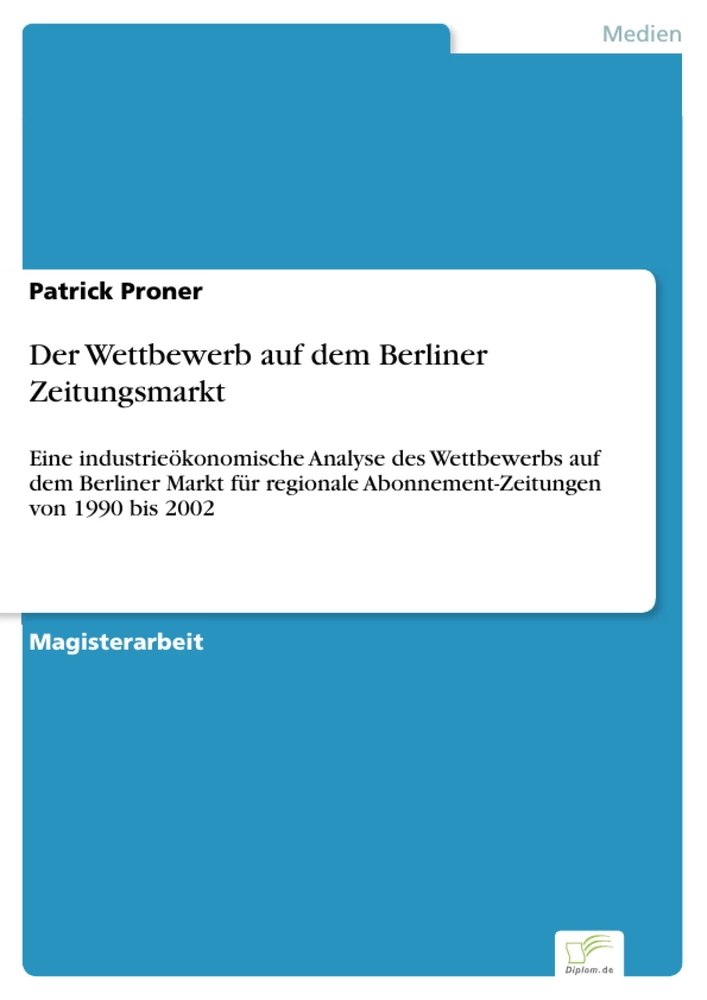Der Wettbewerb auf dem Berliner Zeitungsmarkt
Eine industrieökonomische Analyse des Wettbewerbs auf dem Berliner Markt für regionale Abonnement-Zeitungen von 1990 bis 2002
©2004
Magisterarbeit
350 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Im Juni 2002 erwarb die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck den Berliner Verlag von Gruner+Jahr, einem seiner langjährigen Konkurrenten auf dem Berliner Markt für regionale Abonnement-Zeitungen. Dies war der Beginn einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung, die bis heute nicht abgeschlossen ist und in deren Folge unter anderem die Novellierung des Pressefusionsgesetzes vorgesehen ist.
Bis zu diesem Verkauf hatten die auf dem Berliner Zeitungsmarkt tätigen Verlage mit dem Einsatz zahlreicher Marketinginstrumente versucht, ihren Marktanteil zu Lasten der Konkurrenten auszubauen, was von Beteiligten und externen Beobachtern als Berliner Zeitungskrieg und Berliner Haifischbecken bezeichnet wurde. Die Arbeit untersucht diesen zum Teil ruinösen Wettbewerb, dessen dauerhaft unbefriedigende Ergebnisse letztendlich dazu führten, dass einer der Wettbewerber, Gruner+Jahr, aus dem Markt austrat.
Gang der Untersuchung:
Die Untersuchung beginnt zeitlich mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 und schließt mit dem Verkauf des Berliner Verlages an Holtzbrinck ab. Diese Abgrenzung wird bewusst gewählt, um sich auf die marktwirtschaftlichen anstelle der noch laufenden kartellrechtlichen Ereignisse zu fokussieren. Unter Berücksichtigung der dynamischen Veränderung der Marktstruktur ist das Ziel der Untersuchung die Analyse des Marktverhaltens und der damit erzielten Ergebnisse. Die sich aus diesem Untersuchungsziel ableitenden Fragestellungen lauten wie folgt:
Marktstruktur: Welche Voraussetzungen hatten die Zeitungen im Wettbewerb? Wie waren der Leser- und Anzeigenmarkt strukturiert und wie veränderten sie sich? Welche Leser- und Anzeigenstrukturen hatten die einzelnen Blätter?
Marktverhalten: Welche Strategien setzten die Zeitungen auf dem Lesermarkt und den Anzeigenmärkten ein? Welche Rolle spielten im Einzelnen die Wettbewerbsparameter Preis, Qualität und Innovation sowie Vertrieb und Werbung?
Marktergebnis: Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ergebnisse wurden auf dem Lesermarkt und den Anzeigenmärkten erzielt?
Den theoretischen Rahmen der Untersuchung bildet das Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma (SVE) der Industrieökonomie. Dieses wird zunächst anhand seiner einzelnen Parameter (Marktstruktur, Marktverhalten, Marktergebnis) diskutiert. Hierbei wird festgestellt, dass es sich um keinen einseitigen Ursache-Wirkungs-Prozess von der Struktur zum Ergebnis hin handelt, sondern dass sich die drei Parameter […]
Im Juni 2002 erwarb die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck den Berliner Verlag von Gruner+Jahr, einem seiner langjährigen Konkurrenten auf dem Berliner Markt für regionale Abonnement-Zeitungen. Dies war der Beginn einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung, die bis heute nicht abgeschlossen ist und in deren Folge unter anderem die Novellierung des Pressefusionsgesetzes vorgesehen ist.
Bis zu diesem Verkauf hatten die auf dem Berliner Zeitungsmarkt tätigen Verlage mit dem Einsatz zahlreicher Marketinginstrumente versucht, ihren Marktanteil zu Lasten der Konkurrenten auszubauen, was von Beteiligten und externen Beobachtern als Berliner Zeitungskrieg und Berliner Haifischbecken bezeichnet wurde. Die Arbeit untersucht diesen zum Teil ruinösen Wettbewerb, dessen dauerhaft unbefriedigende Ergebnisse letztendlich dazu führten, dass einer der Wettbewerber, Gruner+Jahr, aus dem Markt austrat.
Gang der Untersuchung:
Die Untersuchung beginnt zeitlich mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 und schließt mit dem Verkauf des Berliner Verlages an Holtzbrinck ab. Diese Abgrenzung wird bewusst gewählt, um sich auf die marktwirtschaftlichen anstelle der noch laufenden kartellrechtlichen Ereignisse zu fokussieren. Unter Berücksichtigung der dynamischen Veränderung der Marktstruktur ist das Ziel der Untersuchung die Analyse des Marktverhaltens und der damit erzielten Ergebnisse. Die sich aus diesem Untersuchungsziel ableitenden Fragestellungen lauten wie folgt:
Marktstruktur: Welche Voraussetzungen hatten die Zeitungen im Wettbewerb? Wie waren der Leser- und Anzeigenmarkt strukturiert und wie veränderten sie sich? Welche Leser- und Anzeigenstrukturen hatten die einzelnen Blätter?
Marktverhalten: Welche Strategien setzten die Zeitungen auf dem Lesermarkt und den Anzeigenmärkten ein? Welche Rolle spielten im Einzelnen die Wettbewerbsparameter Preis, Qualität und Innovation sowie Vertrieb und Werbung?
Marktergebnis: Welche kurz-, mittel- und langfristigen Ergebnisse wurden auf dem Lesermarkt und den Anzeigenmärkten erzielt?
Den theoretischen Rahmen der Untersuchung bildet das Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma (SVE) der Industrieökonomie. Dieses wird zunächst anhand seiner einzelnen Parameter (Marktstruktur, Marktverhalten, Marktergebnis) diskutiert. Hierbei wird festgestellt, dass es sich um keinen einseitigen Ursache-Wirkungs-Prozess von der Struktur zum Ergebnis hin handelt, sondern dass sich die drei Parameter […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8964
Proner, Patrick: Der Wettbewerb auf dem Berliner Zeitungsmarkt - Eine
industrieökonomische Analyse des Wettbewerbs auf dem Berliner Markt für regionale
Abonnement-Zeitungen von 1990 bis 2002
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Magisterarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Autorenprofil
Patrick Proner, M.A.
Am Linsenberg 23 | 55131 Mainz
E-Mail:
proner@gmx.de
1997-1999
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der DG BANK, Deutsche
Genossenschaftsbank eG; Frankfurt am Main
2000-2005
Studium der Publizistik, Betriebswirtschaftslehre und Politikwis-
senschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der
Universidad de Navarra in Pamplona, Spanien
2005
Abschluss
als
Magister
Artium
Seit März 2005
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienwirtschaft,
Institut für Publizistik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Praktika bei SAT.1, BBDO Consulting und forum GmbH marketing + communicati-
ons; Studenten-Trainee bei der DZ BANK, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
AG
Kurzdarstellung
Diese Arbeit untersucht den Wettbewerb auf dem Berliner Markt für regionale
Abonnement-Zeitungen im Zeitraum 1990 bis 2002. Der relevante Markt um-
fasst die Zeitungen Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung und Der Tagesspie-
gel. Den Kern der Untersuchung bildet die Darstellung des Marktverhaltens.
Anhand des Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigmas der Industrieökonomie
wird der Einsatz der Wettbewerbsparameter Preis, Qualität und Innovation so-
wie Vertrieb und Werbung analysiert. Zentrale Fragestellungen sind hierbei:
Welche Marktstrukturen führten auf Teilmärkten, wie dem Leser- oder dem An-
zeigenmarkt zu bestimmten Verhaltensweisen? Welche Wettbewerbsparameter
wurden eingesetzt? Um welche Art von Strategie handelte es sich? Zu welchem
Marktergebnis führten die Verhaltensweisen?
Quellen der Untersuchung sind Fachliteratur, die Sekundäranalyse statistischen
Datenmaterials sowie am offenen Leitfaden geführte Interviews mit ehemaligen
oder aktuellen Führungskräften der drei Zeitungen respektive ihrer Verlage.
Die Untersuchung zeigt, dass die Zeitungen im Wettbewerbsprozess unter-
schiedliche Voraussetzungen hatten, sich unterschiedlich verhielten und unter-
schiedliche Ergebnisse erzielten. Dabei nahm der intensive Einsatz der Wett-
bewerbsparameter teilweise destruktive Ausmaße an. Eine wesentliche Er-
kenntnis für den Lesermarkt ist, dass Erfolg oder Misserfolg zu großen Teilen
von der Leserstruktur der einzelnen Zeitungen abhingen. Für den Anzeigen-
markt lässt sich zum einen feststellen, dass die starren Strukturen der Rubrik-
märkte zu einem teilweise ruinösen Preiskampf geführt haben. Zum anderen
lässt sich konstatieren, dass Veränderungen in der Marktstruktur durch den effi-
zienten Einsatz von Innovationen und Anzeigen-Kombinationen herbeigeführt
werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
1
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis...5
Tabellenverzeichnis ...6
Abkürzungsverzeichnis...7
I. Einleitung...9
II. Theoretischer Teil ...11
1. Das Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma ...11
1.1 Marktstruktur ...15
1.1.1 Marktabgrenzung ...15
1.1.2 Marktform...19
1.1.3 Marktphasen ...20
1.1.4 Marktschranken ...22
1.2 Marktverhalten ...23
1.2.1 Preiswettbewerb ...27
1.2.1.1 Preisstarrheit ...33
1.2.1.2 Ruinöser Preiskampf ...34
1.2.2 Qualitäts- und Innovationswettbewerb ...37
1.2.3 Vertriebs- und Werbewettbewerb ...42
1.3 Marktergebnis ...43
2. Grenzen des SVE-Paradigmas...44
3. Zusammenfassung ...45
III. Empirischer Teil ...47
1. Der relevante Markt...48
2. Die Akteure ...51
2.1 Berliner Morgenpost ...51
2.2 Berliner Zeitung ...55
2.3 Der Tagesspiegel...59
Inhaltsverzeichnis
2
3. Die soziodemographische Entwicklung Berlins ...62
3.1 Bevölkerungszahlen ...62
3.2 Einkommen ...63
3.3 Alter ...66
3.4 Bildung ...67
4. Intermediärer Wettbewerb...68
4.1 Print ...69
4.1.1 Überregionale Tageszeitungen und Kaufzeitungen ...69
4.1.2 Sonstige Printobjekte ...71
4.2 Online ...74
4.3 Hörfunk und Fernsehen ...76
5. Generelle Marktentwicklung ...77
5.1 Lesermarkt ...77
5.1.1 Auflage...77
5.1.2 Reichweite ...82
5.1.2.1 Haushaltsnettoeinkommen ...83
5.1.2.2 Alter ...86
5.1.2.3 Bildung ...88
5.2 Anzeigenmarkt...90
5.2.1 Überregionales Anzeigengeschäft ...90
5.2.2 Lokales und Rubrik-Anzeigengeschäft...94
5.3 Fazit ...96
6. Preiswettbewerb ...99
6.1 Lesermarkt ...99
6.1.1 Abonnementpreis...99
6.1.2 Einzelverkaufspreis...106
6.1.2.1 Werktagsausgaben ...107
6.1.2.2 Samstagsausgaben...112
6.1.2.3 Sonntagsausgaben ...114
Inhaltsverzeichnis
3
6.2 Anzeigenmarkt...115
6.2.1 Anzeigenpreise ...115
6.2.2 Immobilienmarkt ...119
6.2.2.1 Marktstruktur ...119
6.2.1.2 Marktverhalten...121
6.2.1.3 Marktergebnis...124
6.2.2 Kfz-Markt ...126
6.2.2.1 Marktstruktur ...126
6.2.2.2 Marktverhalten...127
6.2.2.3 Marktergebnis...129
6.2.3 Stellenmarkt ...131
6.2.3.1 Marktstruktur ...131
6.2.3.2 Marktverhalten...132
6.2.3.3 Marktergebnis...134
6.3 Fazit ...134
7. Qualitäts- und Innovationswettbewerb ...138
7.1 Lesermarkt ...138
7.1.1 Montags- und Sonntagsausgaben ...138
7.1.1.1 Marktstruktur ...138
7.1.1.2 Marktverhalten...139
7.1.1.3 Marktergebnis...140
7.1.2 Bezirksausgaben ...144
7.1.2.1 Marktstruktur ...144
7.1.2.2 Marktverhalten...145
7.1.2.3 Marktergebnis...146
7.1.3 Relaunches ...147
7.1.3.1 Marktstruktur ...147
7.1.3.2 Marktverhalten...147
7.1.3.3 Marktergebnis...151
7.1.4 Sonstige Innovationen ...154
Inhaltsverzeichnis
4
7.2 Anzeigenmarkt...155
7.2.1 Tabellenanzeigen ...155
7.2.2 Anzeigenkombinationen...156
7.3 Fazit ...158
8. Vertriebs- und Werbewettbewerb ...160
8.1 Zustellerwettbewerb...160
8.2 Freiexemplare ...161
8.3 Sonstiger Verkauf...164
8.4 Sonstige Vertriebs- und Werbemaßnahmen ...166
8.5 Fazit ...168
IV. Erkenntnisse ...169
Literaturverzeichnis ...175
Anhang ...189
A. Chronologie...190
B. Tabellen ...198
C. Interviewleitfaden und Interviews ...246
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
5
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1: Modell der strukturalistischen Hypothese des SVE-Paradigmas... 13
Abb. 2: Modell der behaviouralistischen Hypothese des SVE-Paradigmas ... 14
Abb. 3: Die Kreuzpreiselastizität ... 16
Abb. 4: Zweidimensionales Marktformenschema nach Scherer ... 20
Abb. 5: Idealtypischer Zusammenhang zwischen Marktphase, Marktform,
Aktionsparametern und Gewinnraten ... 21
Abb. 6: Wettbewerbsstrategien, Rolle der Konkurrenz und mögliche Wirkungen ... 24
Abb. 7: Die Preiselastizität der Nachfrage... 28
Abb. 8: Die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion nach Gutenberg ... 29
Abb. 9: Der Tausender-Kontakt-Preis ... 30
Abb. 10: Die Anzeigen-Auflagen-Spirale... 31
Abb. 11: Der Produktlebenszyklus von Zeitungen... 39
Abb. 12: Der dynamische Wettbewerbsprozess nach Arndt... 41
Abb. 13: Beteiligungsverhältnisse des Ullstein-Verlages 2002 ... 54
Abb. 14: Beteiligungsverhältnisse des Berliner Verlages 2002... 58
Abb. 15: Beteiligungsverhältnisse des Verlags Der Tagesspiegel 2002 ... 61
Abb. 16: Entwicklung der Bevölkerung mit einem HHNE ab 3.000 DM ... 64
Abb. 17: Entwicklung der GfK-Kaufkraftindices je Einwohner... 65
Abb. 18: Entwicklung der Bevölkerung zwischen 14-49 Jahre ... 67
Abb. 19: Entwicklung der Anzeigen-Marktanteile Berliner Abo- und Kaufzeitungen ... 71
Abb. 20: Entwicklung der verkauften Auflage... 78
Abb. 21: Entwicklung der Auflagen-Marktanteile ... 81
Abb. 22: Entwicklung des bereinigten LpA-Wertes für Gesamt-Berlin ... 82
Abb. 23: Affinitätsindices: ,,HHNE ab 3.000 DM" ... 84
Abb. 24: Affinitätsindices: ,,Alter: 14-49 Jahre" ... 86
Abb. 25: Affinitätsindices: ,,Bildung: Abitur/Studium" ... 88
Abb. 26: Entwicklung des Anzeigenvolumens... 92
Abb. 27: Entwicklung der Anzeigen-Marktanteile ... 95
Abb. 28: Inflationsbereinigte Entwicklung der Abonnementpreise ... 100
Abb. 29: Abonnementpreise 2000/01 im überregionalen Vergleich ... 101
Abb. 30: Mittelfristige Abo-Preiselastizitäten ... 103
Abb. 31: Entwicklung des Abo-Umsatzes pro Jahr... 105
Abb. 32: EV-Anteile an der verkauften Auflage im Vergleich... 106
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
6
Abb. 33: Jährlich durchschnittlicher EV-Preis... 108
Abb. 34: Kurzfristige EV-Preiselastizitäten ... 109
Abb. 35: Jährlich durchschnittliche Entwicklung des EV-Preises... 113
Abb. 36: Entwicklung der Anzeigen-Grundpreise ... 116
Abb. 37: Entwicklung der Seitenpreise... 117
Abb. 38: Veränderung der TKP... 118
Abb. 39: Wachstumsraten des Immobilienmarktes bis 1998 ... 120
Abb. 40: Wachstumsraten des Kfz-Marktes bis 1998... 127
Abb. 41: Wachstumsraten des Stellenmarktes 1995 bis 2003... 131
Abb. 42: Entwicklung der Stellenmarktpreise ... 133
Abb. 43: Entwicklung der bereinigten LpA-Werte für West-Berlin... 151
Abb. 44: Entwicklung der bereinigten LpA-Werte für Ost-Berlin ... 153
Abb. 45: Entwicklung der Freiexemplare im Jahresdurchschnitt ... 162
Abb. 46: Entwicklung des ,,Sonstigen Verkaufs" im Jahresdurchschnitt ... 165
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Marktanteilsentwicklung im Segment ,,HHNE ab 3.000 DM"... 85
Tab. 2: Marktanteilsentwicklung im Segment ,,Alter: 14-49 Jahre"... 87
Tab. 3: Marktanteilsentwicklung im Segment ,,Bildung: Abitur/Studium"... 89
Tab. 4: Entwicklung der Marktanteile auf dem Anzeigenmarkt ... 94
Tab. 5: Kurz- und mittelfristige Preis- und Kreuzpreiselastizität... 110
Tab. 6: Anteile des Immobilienmarktes am Gesamt-Anzeigenvolumen 1998/99 ... 120
Tab. 7: EV-Auflage der Samstags- und Sonntagsausgaben ... 125
Tab. 8: Verkaufte Wochenendauflage vor und nach Verlegung der Rubrikmärkte ... 142
Abkürzungsverzeichnis
7
Abkürzungsverzeichnis
4c
vierfarbig
Abb.
Abbildung
Abo
Abonnement
AG.MA
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
ASV
Axel-Springer-Verlag
Aufl.
Auflage
BDZV
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger
BGH
Bundesgerichtshof
BKA
Bundeskartellamt
BL
Bundesländer
BZV
Berliner Zeitungsvertrieb GmbH
bzw.
beziehungsweise
d.h.
das heißt
Di
Dienstag
DM
Deutsche Mark
et al.
et alii (und andere)
EV
Einzelverkauf
f.
folgende Seite
FAB
Fernsehen aus Berlin-Brandenburg
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
ff.
folgende Seiten
Fr
Freitag
FSB
Freier Sender Berlin
G+J
Gruner + Jahr
GfK
Gesellschaft für Konsumforschung
GMZ
Gesellschaft für Medien-, Druck- und Zeitungsbeteiligungen
HHNE
Haushaltsnettoeinkommen
IVW
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern
k.A.
keine Angabe
Abkürzungsverzeichnis
8
Kap.
Kapitel
LpA
Leser pro Ausgabe
LpN
Leser pro Nummer
MAZ
Märkische Allgemeine Zeitung
Mi
Mittwoch
Mio.
Millionen
Mo
Montag
Mrd.
Milliarden
ORB
Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg
PAF
Preis-Absatz-Funktion
PNN
Potsdamer Neueste Nachrichten
S.
Seite
Sa
Samstag
SMA
Sowjetische Militär-Administration
So
Sonntag
SVE
Struktur-Verhalten-Ergebnis
s/w
schwarz-weiß
SZ
Süddeutsche Zeitung
Tab.
Tabelle
TEUR
Tausend Euro
TKP
Tausender-Kontakt-Preis
Tsd.
Tausend
u.a.
unter anderem
USP
Unique Selling Proposition
VA
Verbreitungsanalyse der IVW
vgl.
vergleiche
WLK
Weitester Leserkreis
ZAW
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft
z.B.
zum Beispiel
ZMG
Zeitungs Marketing Gesellschaft
I. Einleitung
9
I. Einleitung
Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands entstand so-
wohl eine politisch als auch wirtschaftlich neue Einheit. Die wirtschaftliche Ein-
heit wurde durch einen neuen Absatzmarkt charakterisiert, der von westdeut-
schen Unternehmen schnell erschlossen wurde, da diese sich durch seine Be-
arbeitung ein Wachstum versprachen. Dies traf auch auf Medienunternehmen
zu: Die führenden westdeutschen Zeitungsverlage beteiligten sich an ostdeut-
schen Zeitungshäusern mit dem Ziel, neue Absatzmärkte und Wirkungsfelder
zu erschließen (vgl. Grubitzsch 1990, S. 145). Nach der Umbruchphase zu Be-
ginn der 90er Jahre etablierten sich in den neuen Bundesländern weitestge-
hend westliche Marktstrukturen. Dies bedeutete einen Rückgang der publizisti-
schen Einheiten sowie die Etablierung von Gebietsmonopolen oder duopolen
(vgl. Schütz 1993, S. 169).
Eine Ausnahme bildete der Berliner Zeitungsmarkt: Hier entstand durch die Zu-
sammenführung der beiden Stadthälften im Bereich der regionalen Abonne-
ment-Zeitungen ein Oligopol. Innerhalb dieses Oligopols kam es zu einem
,,Spiel der Konzerne" (von Viereck, S. 315), das zum einen aus marktwirtschaft-
lichen Motivationen zum anderen aus Prestigegründen geführt wurde.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Wettbewerbs auf dem Berliner
Markt für regionale Abonnement-Zeitungen im Zeitraum 1990 bis 2002. Den
Kern bildet die Darstellung des Marktverhaltens. Dabei werden die Strategien
der Zeitungen und der Einsatz der Wettbewerbsparameter Preis, Qualität und
Innovation sowie Vertriebs- und Werbemaßnahmen untersucht. Die Darstellung
ihres Einsatzes soll die Dynamik von Aktion und Reaktion der Wettbewerber
aufzeigen. Zentrale Fragestellungen zur Untersuchung des Marktverhaltens
sind: Welche Marktstrukturen führten auf Teilmärkten, wie dem Leser- oder dem
Anzeigenmarkt, zu bestimmten Verhaltensweisen? Welche Wettbewerbs-
parameter wurden eingesetzt? Um welche Art von Strategie handelte es sich?
Zu welchem Marktergebnis führten die Verhaltensweisen?
I. Einleitung
10
Die theoretische Grundlage für die Untersuchung des Wettbewerbs bildet das
Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma der Industrieökonomie. Es wird in Teil II
der Arbeit vorgestellt und besagt, dass sich die Marktstruktur, das Marktverhal-
ten sowie das Marktergebnis gegenseitig beeinflussen und simultan zu betrach-
ten sind. Den drei Parametern des Modells werden Merkmale für die Analyse
eines Marktes zugeordnet. Diese werden näher erläutert und es wird ihre Rele-
vanz für den Zeitungsmarkt dargestellt.
Der empirische Teil der Arbeit untersucht den Wettbewerb auf dem Berliner Zei-
tungsmarkt. Nach der Darstellung der Marktstruktur und der generellen Markt-
entwicklung werden die Verhaltensweisen der Wettbewerber und der Einsatz
der diversen Marktinstrumente untersucht. Aufgrund der Einzigartigkeit des Ber-
liner Zeitungsmarktes ist eine qualitative Anlage der Untersuchung erforderlich.
Daher wird als Forschungsmethode die Fallstudienmethode angewendet, deren
Einsatz eine Methodentriangulation vorsieht.
1
Diese Arbeit beinhaltet die Aus-
wertung von Fachliteratur, die Sekundäranalyse statistischen Datenmaterials
sowie am offenen Leitfaden geführte Interviews mit ehemaligen oder aktuellen
Führungskräften des Ullstein-Verlags, des Berliner Verlags und des Verlags Der
Tagesspiegel.
1
Zur Anwendung der Fallstudienmethode als Forschungsmethode siehe u.a. Hamel (1993), Yin
(1994) und Stake (1995). Zur Fallstudienmethode als Lehrmethode siehe u.a. McNair (1954),
Kosiol (1957), Perlitz/Vassen (1976), Kaiser (1983) und Harling/Akridge (1998).
II. Theoretischer Teil / II.1. Das SVE-Paradigma
11
II. Theoretischer Teil
Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich mit dem der Untersuchung des
Berliner Zeitungsmarktes zugrunde liegenden Modell. Dies ist das aus der In-
dustrieökonomie stammende Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigama. Bei der
Betrachtung dieses Modells werden die einzelnen Parameter - Marktstruktur,
Marktverhalten und Marktergebnis sowie die ihnen zugrunde liegenden
Merkmale erläutert.
1. Das Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma
,,Wettbewerb liegt vor, wenn mehrere Interessenten das gleiche Ziel verfolgen,
es aber nicht gleichzeitig erreichen können." (Olten 1998, S. 13). Wirtschaftli-
cher Wettbewerb entsteht, wenn Unternehmen auf einem Markt durch bestimm-
te Aktivitäten einen größeren Erfolg als die Konkurrenz erzielen wollen (vgl. Ol-
ten 1998, S. 14). Das Ziel dieser Arbeit ist, das Verhalten der Wettbewerber auf
einem konkreten Markt zu untersuchen.
Es bieten sich viele theoretische Ansätze an, um den Wettbewerb auf einem
Markt zu analysieren. Sie werden unter dem Begriff ,,Wettbewerbstheorie" sub-
sumiert. Die Vielzahl der Theorien, die sich hinter dem Begriff verbirgt, er-
schwert einen Vergleich der mit ihrer Hilfe gewonnenen Ergebnisse. Darüber
hinaus entstehen leicht Missverständnisse in Bezug auf die Terminologien der
einzelnen Ansätze (vgl. Mantzavinos 1994, S. 13). Da eine Besprechung aller in
Frage kommenden Theorien und ihre Anwendung den Rahmen sprengen wür-
de, beschränkt sich diese Untersuchung bewusst auf einen theoretischen An-
satz.
2
2
Für eine umfassende Diskussion wettbewerbstheoretischer Ansätze und betriebswirtschaftli-
cher Strategielehre siehe Sjurts (2000).
II.1. Das SVE-Paradigma
12
Einen geeigneten Ansatz zur Analyse des Marktverhaltens bietet das Struktur-
Verhalten-Ergebnis-Paradigma (SVE-Paradigma) der Industrial Organization
(Industrieökonomie). Es geht zurück auf die Arbeiten von Chamberlin und Ma-
son (1938) und wurde entwickelt, um die Vorgänge innerhalb einer Branche
erklären zu können.
3
Während des Untersuchungsprozesses werden den ein-
zelnen Parametern des Paradigmas statistisches Datenmaterial zugeordnet und
die Vorgänge anhand einer Fallstudie verdeutlicht (vgl. Mantzavinos 1994, S.
23f.). Tirole stellt heraus, dass der Ansatz, marktstrategisches Verhalten an-
hand einer Fallstudie zu untersuchen, im Bereich der Industrieökonomie weit
verbreitet ist:
,,Because of unsatisfactory data, many applied researchers are paying more attention to the
development of evidence on firm and industry behavior and performance through detailed case
studies of firms or industries." (Tirole 1989, S. 4).
Die Industrieökonomie hat sich von einer traditionellen zu einer neuen Form
entwickelt. Die traditionelle Industrieökonomie zeichnete sich durch einen struk-
turalistischen Ansatz aus, der durch Mason und im späteren Verlauf durch Bain
(1951) geprägt wurde. Diesem Ansatz lag die Überlegung zugrunde, dass sich
Marktergebnisse direkt aus der Marktstruktur ableiten lassen. Innerhalb dieser
Kausalkette wurde das Marktverhalten (Conduct) als ein Glied gesehen, das
zwangsläufig aus der Struktur resultiert, jedoch keinen zusätzlichen Erklä-
rungswert bietet (vgl. Knieps 2001, S. 59; Sjurts 2000, S. 24).
3
Parallel dazu wurde das SVE-Paradigma in der Wettbewerbspolitik als Instrument im Rahmen
des ,,workable competition"-Ansatzes (funktionsfähiger Wettbewerb) eingesetzt, der durch Clark
(1939) geprägt wurde. Dieser Umstand führte dazu, dass die Ansätze in der Literatur häufig
vermischt und verwechselt wurden, obwohl sie grundlegend verschiedene Zielsetzungen ha-
ben: Während der funktionsfähige Wettbewerb die wettbewerbspolitisch erwünschte Form einer
Konkurrenzsituation untersucht und normativ geprägt ist, wendet sich die Industrieökonomie
den tatsächlichen Wettbewerbsprozessen zu (vgl. Mantzavinos 1994, S. 23f.).
II.1. Das SVE-Paradigma
13
Abb. 1: Modell der strukturalistischen Hypothese des SVE-Paradigmas
Quelle: Knieps 2001, S. 59
Die strukturalistische Hypothese wurde kritisiert, weil sie neben der Vernachläs-
sigung des Verhaltens als Erklärungsvariable mögliche Rückkopplungseffekte
nicht beachte, wodurch eine Statik des Modells entstünde. In der Realität seien
die Beziehungen zwischen den drei Parametern viel komplexer und von dyna-
mischer Natur (vgl. Knieps 2001, S. 61f.).
Grundlegender Baustein der Neuen Industrieökonomie ist der behaviouralisti-
sche Ansatz, der diesen Anforderungen an das Modell gerecht wird. Der An-
satz, dem spieltheoretische Überlegungen zugrunde liegen, wurde unter ande-
rem von Scherer und Tirole geprägt (vgl. Scherer 1970). Das Modell geht von
rational handelnden Entscheidungsträgern aus, die Annahmen über das Verhal-
ten der Konkurrenten treffen und diese in das eigene Entscheidungskalkül mit
einbeziehen (vgl. Huber 1999, S. 11f.).
Diesem Ansatz zufolge ergeben sich die Marktstruktur, das Marktverhalten so-
wie das Marktergebnis simultan. Die Marktstruktur ist somit nicht starr, sondern
variabel und kann Veränderungen unterliegen, die auf das Verhalten oder das
Ergebnis zurückzuführen sind. Gleichzeitig entsteht ein Erklärungsansatz für
das Marktverhalten: Es wird sowohl durch die Struktur als auch durch das vor-
läufige Ergebnis beeinflusst. Mit der Beachtung der Rückkopplung wird die Dy-
namik des Wettbewerbsprozesses berücksichtigt. Einen zusätzlichen Stellen-
wert erhält das Marktumfeld, wodurch neben endogenen auch exogene Variab-
len in Betracht gezogen werden (vgl. Knieps 2001, S. 61f.).
4
4
Zu beachten ist, dass das Modell von Scherer, der das SVE-Paradigma um Rückkopplungsef-
fekte ergänzt hat, zunächst keine direkte Wirkung des Marktergebnisses auf das Verhalten so-
wie die Struktur in Betracht zieht (vgl. Scherer 1970, S. 5).
Marktergebnis
Marktverhalten
Marktstruktur
II.1. Das SVE-Paradigma
14
Abb. 2: Modell der behaviouralistischen Hypothese des SVE-Paradigmas
Quelle: Knieps 2001, S. 62
Den vier Parametern dieses Paradigmas liegen zahlreiche Merkmale zugrunde,
die je nach Untersuchung und Autor variieren. Grundlegendes Kriterium für die
Erfassung der Marktstruktur ist die Marktabgrenzung, die nach unterschiedli-
chen Kriterien (räumlich, zeitlich, sachlich) erfolgen kann. Sie gibt im weiteren
Aufschluss über die Marktform (Anzahl der Anbieter), die Marktkonzentration
(Marktanteil, der auf eine bestimmte Anzahl von Anbietern entfällt) und die Ent-
wicklungsphase des Marktes bzw. Produktes. Darüber hinaus zieht sie eventu-
ell bestehende Marktschranken in Form von Eintritts- und Austrittsbarrieren in
Betracht (vgl. Scherer 1970, S. 5; Schmidt 2001, S. 55f.).
Das Marktverhalten beinhaltet die Intensität des Einsatzes verschiedener Mar-
ketinginstrumente und Aktionsparameter, mit denen strategische Unterneh-
mensziele verfolgt werden. Die verschiedenen Parameter können generell in
quantitative und qualitative Instrumente eingeteilt werden. Während die Analyse
des quantitativen Instrumentariums den Einsatz des Preises untersucht, bein-
halten qualitative Instrumente alle Parameter, die nicht dem Preis zuzuordnen
sind, wie z.B. Produktqualität, Innovationen oder Vertriebs- und Werbemaß-
nahmen (vgl. Nieschlag et al. 1997, S. 153). Je nach Marktstruktur und erziel-
tem Ergebnis ist mit dem Einsatz dieser Instrumente ein bestimmtes Reakti-
onsmaß der Konkurrenz verbunden.
Die Marktergebnisse werden in der Regel durch Kennzahlen, wie Umsatz, Ge-
winn und Rentabilität beschrieben und in Relation zu den Wettbewerbern inter-
pretiert.
Marktergebnis
Marktverhalten
Marktstruktur
Marktumfeld
II.1. Das SVE-Paradigma
15
Das Marktumfeld beinhaltet den gesetzlichen Rahmen des Wettbewerbs sowie
das generelle Geschäftsverhalten in Form von Branchenregeln, die beispiels-
weise durch eine gemeinsame Branchenorganisation festgelegt werden. Im
weiteren Verlauf werden die einzelnen Parameter erläutert und ihre Implikatio-
nen für den Zeitungsmarkt generell sowie für regionale Abonnement-Zeitungen
aufgezeigt.
1.1 Marktstruktur
Zentrale Voraussetzung für eine industrieökonomische Analyse der Marktstruk-
tur ist die Marktabgrenzung (vgl. Czygan/Kallfaß 2003, S. 283). Durch sie erhält
man Ansatzpunkte und Kriterien für die Bestimmung der Marktform, der Markt-
konzentration und der Marktphase sowie Informationen über mögliche Markt-
schranken.
1.1.1 Marktabgrenzung
Bei der Abgrenzung des Marktes stellt sich die Frage nach dem relevanten
Markt bzw. welche Produkte in die Marktdefinition miteinbezogen werden sol-
len. Generell sollten ,,im relevanten Markt alle Produkte enthalten sein, die ein
Unternehmen in seiner Entscheidungsfreiheit [...] beeinflussen" (Knieps 2001,
S. 49). Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Produkten können je-
doch weitreichend sein und den Rahmen einer Analyse sprengen. Daher müs-
sen Kriterien gefunden werden, anhand derer sich ein Markt eingrenzen lässt.
Zur Beantwortung der Frage des relevanten Marktes wird der Wettbewerb in
räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht unterschieden. Die räumliche Di-
mension bezieht sich auf die geographische Verbreitung von Produkten. Eine
Untersuchung des Berliner Zeitungsmarktes würde nach diesem Kriterium alle
Zeitungen in die Analyse miteinbeziehen, die in Berlin angeboten werden. Pro-
dukte unterscheiden sich in einer zeitlichen Hinsicht, wenn sie zu verschiede-
II.1. Das SVE-Paradigma
16
nen Zeitpunkten verfügbar sind, wie z.B. Tages- und Wochenzeitungen. Die
sachliche Dimension bezieht sich auf die Art der gehandelten Produkte. Darun-
ter wird definiert, wie homogen eine Produktgruppe ist und wie geeignet sie ist,
ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen. Die Grenzen dieser Dimension sind
schwerer zu bestimmen als die der geographischen und zeitlichen. Es wird imp-
liziert, dass diese Produkte in einer engeren Konkurrenzbeziehung zueinander
stehen als zu anderen Produkten und somit untereinander leichter substituier-
bar sind (vgl. Wied-Nebbeling 2004, S. 13f.).
Ein Maß für die Homogenität der Produkte und die Stärke ihrer Interdependenz
ist die Kreuzpreiselastizität. Sie beschreibt das Verhältnis der relativen Men-
genänderung eines Gutes (x
i
) zur relativen Preisänderung eines konkurrieren-
den Gutes (p
j
). Anders ausgedrückt: Wie verhält sich die Nachfrage nach Pro-
dukt i, wenn sich der Preis von Produkt j verändert? Je höher die Kreuzpreis-
elastizität ist, desto homogener sind die Produkte und desto schneller weichen
die Nachfrager bei einer Preiserhöhung auf das andere Produkt aus (vgl.
Knieps 2001, S. 49).
Abb. 3: Die Kreuzpreiselastizität
Quelle: Wied-Nebbeling 2004, S. 15
An dieser Art der Marktabgrenzung wird kritisiert, dass es sich um einen künst-
lichen Eingriff handelt: Es wird angenommen, dass nahe verwandte Produkte
gehandelt werden, die in keinem anderen Konkurrenzverhältnis zu anderen
Produkten stehen. In der Realität gibt es jedoch keine klaren Substitutionsgren-
zen und die betrachteten Teilmärkte sind in keinem Fall zusammenhangslos
(vgl. Richter 1954, S. 60). So konkurrieren im intramediären Wettbewerb alle
Medien untereinander um das Geld- und Zeitbudget des Rezipienten (vgl. Pi-
Kreuzpreiselastizität
(x
i
,p
j
) =
Preisänderung j (in %)
Mengenänderung i (in %)
II.1. Das SVE-Paradigma
17
card 2002, S. 49).
5
Darüber hinaus wird zum einen kritisiert, dass der Wert der
Kreuzpreiselastizität empirisch schwer zu bestimmen sei, zum anderen, dass
dem Preis eine zu hohe Bedeutung zukomme. Bei heterogenen Gütern könne
die Ursache einer Mengenänderung jedoch nicht allein auf den Preis zurückge-
führt werden (vgl. Nieschlag et al. 1997, S. 39). Knieps konstatiert, dass die
Höhe der Elastizität vom Preisniveau abhängt: Bei einem hohen Preis des Pro-
duktes i wären die Produkte i und j stärker substituierbar als bei einem niedri-
gen Preis von i (vgl. Knieps 2001, S. 49). Darüber hinaus wird angemerkt, dass
kein Grenzwert für die erforderliche Höhe der Elastizitäten angegeben werden
kann (vgl. Wied-Nebbeling 2004, S. 15).
Eine Besonderheit des Zeitungsmarktes ist die hohe Produkt- und Markentreue
der Konsumenten, die als Leser-Blatt-Bindung bezeichnet wird. Diese entsteht
nach Kantzenbach/Greiffenberg neben der vertikalen Qualitätsstufe (räumliche,
sachliche und zeitliche Differenzierung) durch eine horizontale Qualitätsstufe,
die Aspekte wie die politische Richtung eines Blattes oder objektive Kriterien
wie die Zitierhäufigkeit in anderen Medien beinhaltet (vgl. Kantzenbach/Greif-
fenberg 1980, S. 195). Ein Grund für die Lesertreue kann auch die Vertrautheit
des Lesers mit seinem Medium, sowie die Scheu vor als hoch eingeschätzten
Such- und Wechselkosten sein. Diese Bindung beruht demnach auf psycholo-
gischen, sozialen, emotionalen und rationalen Faktoren und ist Grundlage für
eine länger andauernde Beziehung zwischen Medium und Rezipienten. Dar-
über hinaus erlaubt der hohe Heterogenitätsgrad der Zeitungen im Lesermarkt
eine preisliche Differenzierung der Produkte, die zu einer verstärkten Intranspa-
renz des Marktes führt und somit die Produkt- und Markentreue zusätzlich er-
höht (vgl. Heinrich 1994, S. 233). Durch den hohen Heterogenitätsgrad der Zei-
tung und die daraus resultierende Bindung des Lesers erscheint daher die
Kreuzpreiselastizität als Kriterium für den Lesermarkt nicht ausreichend.
5
Aufgrund der sachlichen, räumlichen und zeitlichen Differenzierung der Mediengattungen ist
der intermediäre Wettbewerb sowohl auf dem Rezipienten- als auch auf dem Werbemarkt -
jedoch begrenzt (vgl. Picard 2002, S. 150f.).
II.1. Das SVE-Paradigma
18
Aufgrund der praktischen Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Elastizitäten
substituierbarer Produkte, wird bei der Ermittlung des Homogenitätsgrades von
Produkten auf das ,,Konzept der funktionalen Austauschbarkeit von Gütern aus
der Sicht des verständigen Verbrauchers" (Heinrich 1994, S. 56) respektive das
Bedarfsmarktkonzept (vgl. Sjurts 1996a, S. 3) zurückgegriffen. Es beruht auf
Befragungen und logischen Überlegungen im Hinblick auf die Eigenschaften
der relevanten Produkte und ihrer Verwendungszwecke. ,,Danach bilden jene
Produkte einen sachlich relevanten Markt, die sich in ihren Eigenschaften und
ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck so ähnlich sind, daß sie aus Sicht
des Verbrauchers als kurzfristig substituierbar angesehen werden." (Sjurts
1996a, S. 3). Dadurch wird bei der Frage nach dem relevanten Markt nicht al-
lein die Produktgruppe, sondern auch das Spektrum möglicher Verhaltenswei-
sen von Anbietern und Nachfragern miteinbezogen (vgl. Heinrich 1994, S. 56).
Zeitungen werden grundsätzlich anhand von drei Kriterien unterschieden: Nach
ihrer Erscheinungshäufigkeit, ihrer Vertriebsform und ihrem Verbreitungsgebiet
(vgl. Wirtz 2003, S. 133). Daraus ergeben sich folgende relevante Märkte (vgl.
Heinrich 1994, S. 250f.):
·
Regionale und lokale Abonnement-Tageszeitungen
·
Überregionale Abonnement-Tageszeitungen
·
Straßenverkaufszeitungen
·
Wochenzeitungen
·
Sonntagszeitungen
Der Markt für regionale Abonnement-Tageszeitungen zeichnet sich hauptsäch-
lich durch seine geographische Fokussierung aus, da diese Zeitungsgattung in
erster Linie regional gebundene Informationsbedürfnisse befriedigt. Überregio-
nale Zeitungen befriedigen weniger regionale Informationsbedürfnisse, sondern
richten ihre Informationen sachspezifisch auf die Sparten Politik, Wirtschaft und
Kultur aus und unterscheiden sich somit zu regionalen Abonnement-Zeitungen
in räumlicher und sachlicher Hinsicht. Straßenverkaufszeitungen charakterisiert,
II.1. Das SVE-Paradigma
19
dass ihr Leserstamm weniger gefestigt ist als der von Abonnement-Zeitungen.
Da sie sich in einer täglichen Konkurrenzsituation befinden, gestalten sie ihren
Inhalt und ihre Aufmachung sensationeller. Man kann auch davon ausgehen,
dass sie in einem anderen Rahmen konsumiert werden als Abonnement-
Zeitungen und somit einem anderen Zweck dienen. Sie unterscheiden sich da-
her in sachlicher Hinsicht. Durch ihre wöchentliche Erscheinungsweise differen-
zieren sich Wochen- und Sonntagszeitungen im Vergleich zur Tageszeitung in
zeitlicher und sachlicher Hinsicht (vgl. Heinrich 1994, S. 250f.).
1.1.2 Marktform
Zur Systematisierung von Marktstrukturen wird allgemein das Marktformen-
schema von Stackelberg angewandt. Es unterscheidet Anbieter und Nachfrager
nach ihrer Anzahl in ,,ein Großer wenige Mittlere viele Kleine", woraus neun
Marktformen hervorgehen (vgl. Olten 1998, S. 59). Da man auf Zeitungsmärk-
ten von einer polypolistischen Nachfragerstruktur des Lesermarktes und einem
zumindest weiten Oligopol auf dem Werbemarkt ausgehen könne, sei lediglich
die Zahl der Anbieter zu unterscheiden. Die daraus resultierenden Marktformen
sind auf Angebotsseite das Monopol, das Oligopol und das Polypol (vgl. Sjurts
1996a, S. 10).
Ein Modell, das die Anzahl der Anbieter sowie die Art des Produktes berück-
sichtigt, ist das ,,zweidimensionale Marktformenschema" nach Scherer (Scherer
1970, S. 10). Es bietet sich im Rahmen einer Analyse von Medienmärkten an,
weil Medienunternehmen grundsätzlich auf zwei Märkten tätig sind: Dem Rezi-
pientenmarkt und dem Werbemarkt. Auf dem Rezipientenmarkt stellt das Me-
dienprodukt grundsätzlich ein heterogenes Gut dar, da es sich z.B. durch sei-
nen Inhalt oder seiner Aufmachung von Konkurrenzprodukten unterscheidet.
Auf dem Werbemarkt agiert es in der Regel als homogenes Gut, da sich Anzei-
genräume lediglich durch ihren Preis differenzieren. Ausnahmen von dieser
Regel bilden verschiedene Teilmärkte diverser Mediengattungen, wie z.B. Rub-
rikmärkte bei Tageszeitungen.
II.1. Das SVE-Paradigma
20
Die Einteilung nach diesen Kriterien ist sinnvoll, da sich die Verhaltensweisen
der Wettbewerber je nach Marktform unterscheiden. Abb. 4 zeigt die aus den
Parametern ,,Anzahl der Anbieter" und ,,Art des Produkt" entstehenden Markt-
formen.
Abb. 4: Zweidimensionales Marktformenschema nach Scherer
Art des Produktes
Ein Anbieter
Wenige Anbieter
Viele Anbieter
Homogen
Reines
Monopol
Homogenes
Oligopol
Reiner Wettbewerb
Heterogen
Reines
Monopol
Heterogenes
Oligopol
Monopolistischer
Wettbewerb
Quelle: Scherer 1970, S. 10
1.1.3 Marktphasen
Neben der Anzahl der Anbieter und dem Homogenitätsgrad der angebotenen
Produkte hat auch die Marktphase als Teil der Marktstruktur einen wesentlichen
Einfluss auf das Verhalten der Wettbewerber. Seit dem Vorschlag von Heuss
(1965) werden Marktphasen gewöhnlich in Einführungsphase, Expansionspha-
se, Ausreifungsphase und Stagnations- bzw. Rückbildungsphase unterschieden
(vgl. Olten 1998, S. 62).
Das zentrale Problem der Einführungsphase besteht in der Generierung von
Nachfrage. Durch den Innovationsvorsprung des Unternehmens kommt es
kurzfristig zu einer monopolartigen Situation, die mit einer geringen Wettbe-
werbsintensität, hohen Marktpreisen und einer steigenden Gewinnrate verbun-
den ist. Während der Expansionsphase steigt die Bedeutung des Produktes an.
Es treten Wettbewerber im Rahmen eines weiten Oligopols auf, wodurch die
Wettbewerbsintensität durch den Einsatz der verschiedenen Marketinginstru-
mente steigt. Die Marktpreise sinken tendenziell und die Wettbewerber errei-
chen ihr Gewinnmaximum. Im Rahmen der Ausreifungsphase sind erste Sätti-
gungseffekte des Marktes erkennbar. Dadurch entsteht eine hohe Wettbe-
II.1. Das SVE-Paradigma
21
werbsintensität, die durch stark sinkende Marktpreise und abnehmende Ge-
winnraten gekennzeichnet ist, die bis zum Verlust führen können. In der Regel
sind die Rationalisierungsmaßnahmen der Unternehmen ausgeschöpft und es
kommt zu Konzentrationsprozessen, die zu einem engen Oligopol führen. Stag-
niert der Markt oder bildet er sich zurück - in Form einer negativen Veränderung
des Marktvolumens (vgl. Göttgens 1996, S. 9) - kann die Wettbewerbsintensität
sinken oder steigen, je nachdem welche Strategie (defensiv oder offensiv) die
Unternehmen im engen Oligopol verfolgen (vgl. Schmidt 2001, S. 61).
Abb. 5: Idealtypischer Zusammenhang zwischen Marktphase, Marktform, Aktionsparametern
und Gewinnraten
Marktphase
Marktform
Aktionsparameter
Gewinnraten
Experimentierphase
Monopol des Innova-
tors
Produkt, Werbung
Steigend
Expansionsphase
Weites Oligopol oder
Polypol
Preis, Qualität, Wer-
bung, Service
Steigend bis zum
Höhepunkt
Ausreifungsphase
Oligopol
Preis, Qualität, Wer-
bung, Service
Abnehmend
Stagnations- bzw.
Rückbildungsphase
Enges Oligopol
Qualität, Werbung,
Service
Abnehmend, evtl.
Verlust
Quelle: Schmidt 2001, S. 61
Marktstagnation und Marktschrumpfung können verschiedene Ursachen haben:
Sie können soziodemographischer Art sein, wenn sich beispielsweise die Ge-
samtbevölkerungszahl, die Höhe des verfügbaren Einkommens oder der Trend
zur Haushaltsbildung ändert. Darüber hinaus kann eine Marktsättigung einge-
treten sein, so dass kein Mehrabsatz je Periode stattfindet. Auch Substitutions-
produkte und technologische Entwicklungen können Ursachen für eine Rück-
entwicklung eines Marktes sein. Damit verbunden kann ein Wertewandel im
Rahmen einer Verschiebung der Präferenzstruktur der Kunden stattgefunden
haben (vgl. Göttgens 1996, S. 13). Analog zur Entwicklungsphase des Marktes
kann der Lebenszyklus eines Produktes bzw. einer Zeitung betrachtet werden
(siehe Kap. 1.2.2).
II.1. Das SVE-Paradigma
22
1.1.4 Marktschranken
Bevor ein Unternehmen in einen Markt eintreten oder aus einem Markt austre-
ten kann, muss es häufig Marktschranken überwinden. Der Marktzutritt kann
durch die Gründung eines neuen Unternehmens oder durch die Erweiterung der
Produktpalette, sowie die geographische Ausdehnung eines bereits etablierten
Unternehmens erfolgen. Gründe für den Marktaustritt können neben der Ein-
stellung der Produktion oder dem Verlassen eines Vertriebsgebietes die Einstel-
lung der unternehmerischen Tätigkeit sein. Marktschranken in Form von Hin-
dernissen, die den Ein- oder Austritt erschweren, können ökonomischer oder
politischer Natur sein (vgl. Olten 1998, S. 64f.).
Bei den Austrittsbarrieren können ökonomische, strategische und emotionale
Hindernisse unterschieden werden. Ökonomische Austrittsbarrieren beruhen
auf finanziellen Hemmnissen, wie langlebige oder spezialisierte Aktiva und da-
mit verbundene hohe Fixkosten, die bei einer Liquidation zu geringen Erlösen
führen würden (vgl. Porter 1999, S. 112f.). Strategische Barrieren können ge-
geben sein, wenn eine Geschäftseinheit aus einem übergeordneten strategi-
schen Blickwinkel wichtig für die Gesamtunternehmung ist. Selbst bei einem
finanziellen Verlust kann eine strategische Geschäftseinheit interessant für das
Unternehmen sein, wenn sie zum übergeordneten Unternehmenserfolg beiträgt.
Emotionale Barrieren berücksichtigen keine rationalen Erwägungen und basie-
ren auf einer ,,Verpflichtung des Managements gegenüber einer Geschäftsein-
heit". Weitere Barrieren können rechtlich-politische, soziale und gesellschaftli-
che Gründe sein (vgl. Göttgens 1996, S. 18).
II.1. Das SVE-Paradigma
23
1.2 Marktverhalten
Das Marktverhalten wird sowohl durch die Marktstruktur sowie das bislang er-
zielte Marktergebnis beeinflusst. Es wird durch den Einsatz der verschiedenen
Marketinginstrumente sowie das Ausmaß von Aktion und Reaktion der Markt-
teilnehmer determiniert.
Im Rahmen der Marktstruktur hat die Marktform wesentlichen Einfluss auf das
Verhalten der Wettbewerber. Im oligopolistisch organisierten Markt ist die wich-
tigste Zielgröße der Marktanteil. Im Monopol spielt er keine Rolle, da der Mono-
polist per Definition einen Marktanteil von 100 Prozent hat, im Polypol spielt er
eine untergeordnete Rolle, da sein Rückgang vorausgesetzt die Verluste
betreffen alle im gleichen Maße - für den einzelnen Anbieter eher klein ausfällt.
Im Oligopol verteilen sich jedoch Anteilsverluste, die durch Anteilsgewinne ei-
nes Anbieters entstehen, nur auf eine geringe Zahl von Marktteilnehmern, wo-
durch absatzpolitische Veränderungen deutlich zu spüren sind (vgl. Olten 1998,
S. 61).
Das Dilemma von Unternehmen in oligopolistischen Märkten liegt in den entge-
gen gesetzten Zielsetzungen: Zum einen wollen sie Marktkämpfe vermeiden, da
ein Wettbewerbskonflikt zwischen annähernd gleich starken Kontrahenten rui-
nöse Ausmaße annehmen kann. Zum anderen wollen sie sich besser positio-
nieren als ihre Wettbewerber, um Marktanteile und somit zusätzliche Gewinne
zu erzielen. Unternehmen wollen demnach einen destabilisierenden und kost-
spieligen Wettbewerbskonflikt vermeiden und gleichzeitig andere Unternehmen
übertreffen (vgl. Porter 1983, S. 126ff.). Um dieses ambivalent anmutende Ziel
zu erreichen, kann ein Unternehmen grundsätzlich zwischen kompetitiven und
kooperativen Wettbewerbsstrategien wählen. Dabei können kompetitive Strate-
gien aggressiver, nicht-aggressiver oder defensiver Natur sein (siehe Abb. 6).
II.1. Das SVE-Paradigma
24
Abb. 6: Wettbewerbsstrategien, Rolle der Konkurrenz und mögliche Wirkungen
Quelle: Porter 1983, S. 130ff.
Die Wahrnehmung der Wettbewerber entscheidet, um was für eine Strategie
des agierenden Unternehmens es sich handelt. Wird eine Maßnahme als ag-
gressiv empfunden, kommt es in der Regel zu Reaktionen der Konkurrenz. Der
Erfolg einer aggressiven Strategie hängt davon ab, wie wahrscheinlich, wie
schnell, wie effektiv und wie hart die Reaktion der Konkurrenz ausfallen wird.
Das agierende Unternehmen muss sich vorab überlegen, ob es gegebenenfalls
die Reaktionen der Wettbewerber beeinflussen kann (vgl. Porter 1983, S. 135).
Hat ein Wettbewerber gegenüber seinen Konkurrenten einen deutlichen Markt-
anteilsvorsprung bei Zeitungen z.B. in Form von verkaufter Auflage oder eine
hohe Anzahl rubrizierter Anzeigen - hat dies Einfluss auf seine Marktmacht.
Diese kann er dazu nutzen, um aggressive Strategien durchzuführen ohne be-
fürchten zu müssen, dass seine Konkurrenten adäquat reagieren. Er kann z.B.
als Marktführer im Rubrikmarkt den Anzeigenpreis in einem gewissen Rahmen
erhöhen, ohne Verluste in der Anzeigenzahl befürchten zu müssen und somit
seinen Anteil am Marktvolumen ausbauen. Handelt es sich um stagnierende
oder schrumpfende Märkte, kann das ganze Marketinginstrumentarium einge-
setzt werden, um den Wettbewerber zu verdrängen. Das Marktverhalten kann
durch eine aggressive Preispolitik, ein hektisches Agieren der Marktteilnehmer,
Strategie
Aggressiv
Wettbewerbs-
konflikt
Reaktion der
Konkurrenz
Nicht-aggressiv
Eigene
Ergebnis-
verbesserung
Keine Reaktion
der Konkurrenz
Beteiligung der
Konkurrenz
Eigene und
Branchen-
ergebnis-
verbesserung
Kooperativ
Vermeidung
Wettbewerbs-
konflikt
Defensiv
Aktion der
Konkurrenz
II.1. Das SVE-Paradigma
25
eine häufige Anpassung der Marketinginstrumente, sowie eine abnehmende
Kooperationsbereitschaft gekennzeichnet sein (vgl. Göttgens 1996, S. 13).
Eine nicht-aggressive Strategie liegt vor, wenn die Wettbewerber kaum Notiz
von ihr nehmen, sie sich bei ihrem Einsatz nicht von ihr betroffen oder bedroht
fühlen oder ihre Ergebnisse - gemessen an ihren eigenen Kriterien - kaum be-
einträchtigt werden. Eine von der Konkurrenz als nicht-aggressiv wahrgenom-
mene Strategie führt bei erfolgreicher Durchführung in der Regel zu einer ein-
seitigen Ergebnisverbesserung des agierenden Unternehmens. Sie kann aber
gleichzeitig eine Gesamtverbesserung der Branche beinhalten, wenn die Stra-
tegie darin besteht, eine bis dahin für alle geschäftsschädigende Maßnahme,
z.B. in Form einer schlechten Werbekampagne, die eine negative Wirkung auf
die gesamte Branche hat, einzustellen. Dieser Fall wird in Abb. 6 durch die ge-
strichelte Linie dargestellt (vgl. Porter 1983, S. 132f.).
Kooperative Strategien haben das Ziel, durch Beteiligung der Wettbewerber, ein
für alle vorteilhafteres Ergebnis zu erzielen. Dabei ist die Wirkung der Maßnah-
men auf jeden einzelnen Konkurrenten einzuschätzen, d.h. keiner sollte über-
proportional von einer Kooperation profitieren. Im Gegensatz dazu sollten auch
die möglichen Vorteile eines Wettbewerbers beachten werden, die er realisieren
kann, wenn er nicht kooperiert (vgl. Porter 1983, S. 132).
Eine Strategie ist defensiv, wenn sie auf kompetitive Aktionen der Wettbewer-
ber reagiert oder diese von vornherein nicht zulässt. Der aggressiv agierende
Konkurrent soll diszipliniert und ein Wettbewerbskonflikt vermieden werden. Der
Einsatz einer defensiven Strategie kann dadurch verhindert werden, dass das
Unternehmen die Bedrohung zu spät wahrnimmt, es nicht schnell genug eine
geeignete Gegenmaßnahme einleiten kann, die Vergeltung nicht ,,zielgenau
konzentriert" werden kann (wenn z.B. Teilmärkte nicht isoliert behandelt werden
können) oder eine Vergeltungsmaßnahme mit einer Schädigung des eigenen
Geschäfts verbunden ist (vgl. Porter 1983, S. 136f.). Es kann passieren, dass
Maßnahmen, die eine nicht-aggressive Intention haben, als Angriff verstanden
II.1. Das SVE-Paradigma
26
werden. In diesem Fall muss das agierende Unternehmen Marktsignale aus-
senden, um sich verständlich zu machen (vgl. Porter 1983, S. 134).
Um die genannten Wettbewerbsstrategien erfolgreich durchführen zu können,
stehen Unternehmen Marketinginstrumente zur Verfügung, die in vielfältiger
Weise eingesetzt werden können. Ihr Einsatz dient dazu, sich von den Konkur-
renten zu differenzieren und den Kunden von der eigenen Leistung zu überzeu-
gen bzw. sich an den Bedürfnissen des Kunden zu orientieren. Die Parameter
Price (Preis), Product (Produktqualität), Promotion (Werbung) und Place (Ver-
trieb) lassen sich je nach eingesetzter Strategie in einem Marketing-Mix kombi-
nieren (vgl. Nieschlag et al. 1997, S. 153).
Die Strategie- und Instrumentenwahl ist darüber hinaus von der Art des Gutes
abhängig: Handelt es sich um ein homogenes Gut, sind also keine Qualitätsun-
terschiede erkennbar, kommt dem Preis eine herausragende Stellung zu. Bei
heterogenen Gütern werden neben dem Preis dementsprechend weitere Para-
meter eingesetzt (vgl. Aberle 1992, S. 14). Da es sich bei Abo-Zeitungen um
heterogene Güter handelt, werden bei der Betrachtung der Konkurrenzsituation
neben dem Preiswettbewerb - der auch als quantitative Konkurrenz bezeichnet
wird (vgl. Richter 1954, S. 68) - der Qualitäts- und Innovationswettbewerb sowie
der Vertriebs- und Werbewettbewerb mit einbezogen, die unter Nichtpreiswett-
bewerb oder qualitative Konkurrenz subsumiert werden (vgl. Aberle 1992, S.
14).
Im folgenden werden die Wettbewerbsparameter und ihre Wirkung auf dem Zei-
tungsmarkt vorgestellt. Im Rahmen des Instrumentes Preis wird die Bedeutung
für den Leser- und den Anzeigenmarkt erklärt, sowie die für Medien spezifische
Verflechtung von Preis- und Qualitätswettbewerb dargestellt. Darüber hinaus
werden Spezialfälle des oligopolistischen Preiswettbewerbs wie Preisstarrheit
und der ruinöse Preiskampf näher erläutert. Die Darstellung des Nichtpreiswett-
bewerbs bezieht sich, wie bereits erwähnt, auf die Parameter Qualität und Inno-
vation sowie Vertrieb und Werbung.
II.1. Das SVE-Paradigma
27
1.2.1 Preiswettbewerb
Innerhalb des Marketing-Mix ist der Preis der am leichtesten zu beurteilende
Parameter, da er von Natur aus quantifizierbar ist. Der Preis ist schnell und ef-
fektiv einsetzbar, dem entsprechend wird ihm eine schnelle Wirkung in Form
einer Nachfrageelastizität zugesprochen. Die Höhe des Preises ist nicht eindi-
mensional festgelegt, sondern kann durch Preisaktionen zeitlich, durch Rabatte
mengenmäßig oder durch zusätzliche Leistungen bei gleichem Preis indirekt
differenziert werden (vgl. Brühwiler 1989, S. 16).
Auf einem Markt mit heterogener oligopolistischer Konkurrenz wird in der Regel
eine Preisfixierung angenommen: Der Anbieter setzt seinen Preis fest, während
die Käufer die Menge bestimmen (vgl. Bartmann et al. 1999, S. 161). Aufgrund
der hohen absatzpolitischen Reaktionsverbundenheit im Oligopol der engen
Beziehung zwischen Aktionen und Reaktionen der Wettbewerber wird dar-
über hinaus angenommen, dass eine Preisänderung die Konkurrenz dazu ver-
anlasst, die Preise ebenfalls zu verändern. Einen Spezialfall stellt die Annahme
dar, dass die Konkurrenz nur auf eine Preissenkung, nicht jedoch auf eine
Preiserhöhung eines Anbieters reagiert (vgl. Olten 1998, S. 60; Bartmann et al.
1999, S. 50).
Bei der Preisbildung von Zeitungen muss zwischen Leser- und Anzeigenmarkt
unterschieden werden. Als Faustregel gilt, dass die Erlöse regionaler Abonne-
ment-Zeitungen zu zwei Dritteln über die Werbeeinnahmen und zu einem Drittel
über die Vertriebseinnahmen erfolgen (vgl. Heinrich 1994, S. 210f.). Die Preis-
findung orientiert sich am Wettbewerb, an der Nachfrage und an den Betriebs-
kosten. Die wettbewerbsorientierte Preissetzung geschieht in der Regel durch
die Anpassung des Preises am Marktführer (vgl. Wirtz 2003, S. 173). Die Orien-
tierung an der Nachfrage geschieht über die Preiselastizität. Sie sagt aus, in
welchem Maße sich eine Preisänderung auf die eigene Nachfrage auswirkt (vgl.
Albarran 1996, S. 19).
II.1. Das SVE-Paradigma
28
Abb. 7: Die Preiselastizität der Nachfrage
Quelle: Albarran 1996, S. 19
In der Regel hat die Preiselastizität ein negatives Vorzeichen, da eine Preiser-
höhung gewöhnlich zu einer Verringerung der Nachfrage führt. Je höher der
Wert für die Preiselastizität ausfällt, desto preissensitiver sind die Leser. Ist der
Wert >1, spricht man von einer elastischen, ist er <1 von einer unelastischen
Nachfragereaktion. Ist der Wert =1, entspricht die Mengenänderung der Preis-
änderung und die Nachfrage ist einheitselastisch (vgl. Albarran 1996, S. 20).
6
Bei der Frage nach der Preisbildung auf dem Vertriebsmarkt kann das Guten-
berg-Modell der doppelt geknickten Preis-Absatz-Funktion herangezogen wer-
den. Normalerweise wird es nur im Rahmen eines monopolistischen Wettbe-
werbs angewandt, das von vielen Anbietern eines heterogenen Gutes ausgeht
(siehe Kap. 1.1.2). Grundlegende Annahme ist, dass die Verbundenheit der
Anbieter innerhalb einer polypolistischen Marktstruktur aufgrund ihrer jeweils
kleinen Marktanteile gering ist. Das Modell lässt sich auf diese Untersuchung
übertragen, weil es sich bei Abo-Zeitungen um ein sehr heterogenes Gut han-
delt, d.h. es wird angenommen, dass die Anbieter ihren Preis in einem be-
stimmten Rahmen variieren können, ohne Leser an sich oder an die Konkur-
renz zu verlieren. Analog können sie ihre Auflage durch eine geringe Preisän-
derung nicht einfach ausweiten. Die Zeitungen können demnach in einem ge-
wissen Rahmen preispolitisch agieren, ohne dass sich die Marktanteile in grö-
ßerem Umfang verändern (vgl. Wied-Nebbeling 2004, S. 102).
6
Doyle schlägt vor, bei der Ermittlung der Preiselastizität nicht die Ausgangswerte als Grundla-
ge für die Berechnung der Mengen- und Preisänderung zu nehmen, sondern den Mittelwert aus
neuem und altem Preis (bzw. alter und neuer Auflage) zu verwenden. Er begründet dies damit,
dass es bei der Berechnung zu unterschiedlichen Elastizitätswerten kommt, je nachdem, ob die
Veränderung nach oben oder nach unten stattgefunden hat (Doyle 2002, S. 131f.). Diese Arbeit
kommt dem Vorschlag nach.
Preiselastizität
(x,p) =
Preisänderung (in %)
Auflagenänderung (in %)
II.1. Das SVE-Paradigma
29
Gutenbergs Modell zeigt, dass jeder Anbieter innerhalb einer bestimmten Preis-
lage über einen monopolistischen Preisbereich verfügt. Die Größe dieses
Preisbereichs hängt vom akquisitorischen Potenzial der Zeitung ab. Darunter
sind alle Faktoren zu verstehen, die ihre ,,Anziehungskraft" bzw. ihren USP für
die Stammkunden ausmachen (vgl. Wied-Nebbeling, S. 114f.). Für Zeitungen
sind diese Faktoren z.B. ihre Qualität oder ihr Image. Dem entsprechend müss-
te die Zeitung mit den qualitativ anspruchsvollsten Lesern ihren Preis am
stärksten variieren können, ohne Leser zu verlieren. Abb. 8 zeigt den Verlauf
der doppelt geknickten Preis-Absatz-Funktion.
Abb. 8: Die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion nach Gutenberg
Quelle: Wied-Nebbeling 2004, S. 117
Für den Anzeigenmarkt lässt sich anhand der Preiselastizität die gleiche Aus-
sage treffen wie für den Lesermarkt. Als Preismaßstab wird anstelle des absolu-
ten Preises jedoch der Tausender-Kontakt-Preis (TKP) eingesetzt. Das ist der
Preis, den ein werbetreibendes Unternehmen für einen bestimmten Anzeigen-
raum bezahlen muss, um eine Kontaktwahrscheinlichkeit mit eintausend Lesern
zu erhalten. Sinkt die Reichweite, steigt bei konstantem Anzeigenpreis der TKP,
wodurch die Nachfrage nach dem Werberaum nachlässt. Dem entsprechend
nimmt die Nachfrage zu, wenn bei konstantem Anzeigenpreis die Reichweite
steigt (vgl. Schumann/Hess 2002, S. 44).
Unterer Grenzpreis
Oberer Grenzpreis
PAF
i
Monopolistischer
Preisbereich
Preis
Menge
II.1. Das SVE-Paradigma
30
Abb. 9: Der Tausender-Kontakt-Preis
Quelle: Schumann/Hess 2002, S. 44
Der Anzeigenmarkt besteht aus verschiedenen Teilmärkten, die differenziert auf
Preisänderungen reagieren. Während für das überregionale Anzeigengeschäft
Homogenitätsannahmen getroffen werden können und somit eine stärkere
Preissensibilität der Werbekunden angenommen werden kann, ist der Rubri-
kenmarkt aufgrund seiner Intransparenz heterogen und somit relativ preisro-
bust. Sowohl für gewerbliche als auch private Kleinanzeigen ist die Resonanz
auf eine Anzeige der entscheidende Wert.
Die Resonanz basiert auf Erfahrungswerten früherer Anzeigenschaltungen. Ha-
ben sich diese Erfahrungswerte über einen längeren Zeitraum bewährt, werden
Rubrikmärkte bestimmter Zeitungen auch aus Gewohnheit belegt. Daher gilt: Ist
eine Zeitung Marktführer in einem Rubrikenmarkt, gilt sie quasi als institutionali-
siert. Obwohl sie vielleicht eine Veränderung in ihrer Reichweite erfahren hat,
kann sie ihren Marktanteil annähernd beibehalten, weil die Anzeigenkunden
zum einen daran gewöhnt sind, in ihr zu inserieren, zum anderen, weil Rubrik-
anzeigen gesuchter Lesestoff sind. Dieser Umstand macht eine Zeitung relativ
unempfindlich gegenüber Preis- und Qualitätsmaßnahmen der Konkurrenten
und gibt ihr die Möglichkeit, ihre Preise erhöhen zu können, ohne eine hohe
Nachfrageelastizität befürchten zu müssen. Dem entsprechend ist das Guten-
berg-Modell auch auf Zeitungen anwendbar, die in einem rubrizierten Teilmarkt
Marktführer sind.
Bezieht man sich jedoch auf das überregionale Anzeigengeschäft, stellt der An-
zeigenraum einer Zeitung ein homogenes Gut dar: ,,Entscheidungsrelevant für
die Plazierung einer Anzeige ist allein die Reichweite des Mediums in der jewei-
ligen Zielgruppe." (Sjurts 1996b, S. 58). Aufgrund der Verbundproduktion für
TKP =
Reichweite
Anzeigenpreis
*
1.000
II.1. Das SVE-Paradigma
31
den Leser- und den Anzeigenmarkt entsteht eine gegenseitige Wirkung zwi-
schen der Qualität einer Zeitung und ihres Anzeigenvolumens. Der Effekt wird
als Anzeigen-Auflagen-Spirale bezeichnet. Abb. 10 stellt die wechselseitige
Wirkung dieser beiden Parameter dar.
Abb. 10: Die Anzeigen-Auflagen-Spirale
Quelle: Kantzenbach/Greiffenberg 1980, S. 199
Steigt die Auflage bzw. die Reichweite einer Zeitung, sinkt ihr TKP. Dadurch
bietet sie ihren Anzeigenraum im Preiswettbewerb mit anderen Zeitungen güns-
tiger an. Aufgrund des niedrigeren Preises steigt die Nachfrage nach ihrem
Werberaum, was als Mengeneffekt bezeichnet wird. Die Zeitung kann nun, z.B.
im Rahmen der nächsten Preisliste, einen Preiseffekt realisieren, indem sie den
TKP wieder an den Ausgangswert heranführt. Dies impliziert eine Erhöhung des
Anzeigen-Grundpreises bzw. des Seitenpreises. Durch das höhere Anzeigenvo-
lumen und den höheren Anzeigenpreis steigen Umsatz und Gewinn. Dieser
kann in die Qualität der Zeitung investiert werden, indem z.B. weitere Redakteu-
re eingestellt werden. Durch die höhere Qualität der Zeitung steigt langfristig die
Auflage, was sich wiederum auf den TKP auswirkt (vgl. Heinrich 1994, S. 212f.).
Medienprodukte haben in der Regel einen hohen Fixkostenanteil. Daher kön-
nen Zeitungen durch eine hohe Auflage die Kosten pro Exemplar effektiv sen-
ken. Dieser Effekt wird als Fixkostendegression (economies of scale) bezeich-
Anzeigenmarkt
Lesermarkt
Qualitäts-
wettbewerb
Höheres
Anzeigenvolumen
Preis-
wettbewerb
Steigende Umsätze
und Gewinne
Auflagen-
steigerung
Kosten-
degression
II.1. Das SVE-Paradigma
32
net (vgl. Owers et al. 1998, S. 19). Die dadurch entstehenden Einsparungen
können genutzt werden, um den Anzeigenraum günstiger anzubieten und somit
ein höheres Anzeigenvolumen zu generieren oder um direkt in die Qualität des
Blattes zu investieren. Durch diesen Mechanismus kann es zur Vormachtstel-
lung einer Zeitung kommen: Die einsetzende Spiralbewegung ist Ursache für
die oft beobachtbare Monopolstellung eines Blattes oder die klare Unterschei-
dung zwischen Erst- und Zweitzeitung im Duopol (vgl. Picard 1998, S. 113f.).
Zu beachten ist, dass der Prozess natürlichen Grenzen unterliegt, da die
Grenzkosten - der Kostenzuwachs für ein zusätzlich produziertes Exemplar -
wachsen und ab einem bestimmten Punkt die Erlöse übersteigen. Darüber hin-
aus sind Qualität und Auflage nicht beliebig erweiterbar (vgl. Nieschlag et al.
1997, S. 351f.; Czygan/Kallfaß 2003, S. 298).
Neben einem positiven Effekt kann bei der Anzeigen-Auflagen-Spirale auch der
umgekehrte Fall eintreten: Durch ein Absinken der Auflage steigt der TKP, wo-
durch das Anzeigenvolumen und die daraus resultierenden Erlöse sinken. Da-
durch fehlen der Zeitung die Mittel für die Investition in die redaktionelle Quali-
tät, was sich langfristig negativ auf die Auflage auswirkt (vgl. Rickens 1999b, S.
112). Das Schema der Anzeigen-Auflagen-Spirale gilt teilweise auch für den
Rubrikmarkt. Inserieren mehr Personen in der Zeitung, kann sie ihre Auflage
steigen, weil Anzeigen oftmals gesuchter Lesestoff sind.
Im folgenden werden Spezialfälle des Preiswettbewerbs, die Preisstarrheit und
der ruinöse Preiskampf, dargestellt. Kollusive Preisstrategien werden nicht be-
achtet, da zum einen kartellrechtliche Fragstellungen nicht Gegenstand der Ar-
beit sind und darüber hinaus von einem kompetitiven Markt ausgegangen wird,
auf dem Kooperationen jeder Art die Ausnahme darstellen.
II.1. Das SVE-Paradigma
33
1.2.1.1 Preisstarrheit
Aufgrund der Reaktionsverbundenheit in oligopolistischen Märkten kann in der
Realität häufig eine defensive Strategie in dem Sinne beobachtet werden, dass
die Preise einer Starrheit unterliegen und über relativ lange Zeiträume konstant
bleiben (vgl. Schmidt 2001, S. 62). Ein Grund dafür ist die Unsicherheit in Be-
zug auf die Reaktion der Konkurrenz. Die Konstanz des Preises soll einen
Wettbewerbskonflikt vermeiden. Ein weiterer Grund ist die Unsicherheit im Hin-
blick auf die Reaktion der Käufer: Unternehmen befürchten, durch häufige
Preisänderungen ihre Kunden zu verunsichern und sie zu veranlassen, zu ei-
nem anderen Anbieter zu wechseln. Darüber hinaus wird die häufige Einfüh-
rung neuer Preise gescheut, da sie mit Zusatzkosten in Form von Ausgaben für
Preislisten und Kommunikationsaufwand verbunden sind (vgl. Bartmann et al.
1999, S. 207f.).
Differenziert man Preissenkungen und Preiserhöhungen, finden sich weitere
Gründe für eine Preisstarrheit: Wettbewerber reagieren stärker auf Preissen-
kungen eines Anbieters als auf Erhöhungen. Die Reaktion könnte so stark aus-
fallen, dass sie in einen Preiskampf mündet. Weiterhin spricht gegen Preissen-
kungen, dass der Markt ,,verdorben" werden kann, indem sich die Kunden an
die niedrigen Preise gewöhnen und bei zukünftigen Erhöhungen preissensibler
reagieren. Generiert eine Preissenkung wiederum keine deutlich stärkere Nach-
frage, verliert das Unternehmen neben Marktanteilen auch Gewinneinnahmen.
Gegen Preiserhöhungen auf oligopolistischen Märkten spricht unter anderem,
dass sie zur Abwanderung der Nachfrage zur Konkurrenz oder zu Substituten
führen können (vgl. Bartmann et al. 1999, S. 208).
Die Folge von Preisstarrheit ist, dass den anderen Marketinginstrumenten eine
stärkere Bedeutung zukommt, wodurch die Markttransparenz verringert wird
(vgl. Bartmann et al. 1999, S. 208). Wird der Preis nicht organisiert geändert,
d.h. ohne eine illegale Absprache zwischen den Wettbewerbern, geschieht die
Änderung häufig im Rahmen einer Anpassung am dominierenden Preisführer.
II.1. Das SVE-Paradigma
34
Seine Dominanz kann darauf beruhen, dass er der kostengünstigste Anbieter
ist oder den betreffenden Teilmarkt dominiert. So bestimmt z.B. der Marktführer
auf dem Rubrikenmarkt die Preise für rubrizierte Anzeigen. Die Wettbewerber
können ihren Preis jedoch auch am barometrischen Preisführer ausrichten.
Dieser wird exogen bestimmt, indem sich die Wettbewerber implizit darauf eini-
gen, der Preispolitik dieses Unternehmens zu folgen. Die Rolle des barometri-
schen Preisführers kann wechseln (vgl. Wied-Nebbeling 2004, S. 238).
1.2.1.2 Ruinöser Preiskampf
Ursachen aggressiver Wettbewerbsmaßnahmen können allgemein Kostener-
höhungen oder ein Nachfragerückgang sein. Ziel ist der Gewinn von Marktan-
teilen, um die eigene Gewinnsituation zu verbessern. Wird der Preis als Instru-
ment eingesetzt, sehen die aggressiven Handlungen in der Regel direkte Preis-
senkungen vor. Je nach Strategie oder Marktbeschaffenheit können jedoch
auch indirekte Preissenkungen oder sogar Preiserhöhungen kämpferisch ein-
gesetzt werden. Kommt es zu einer kämpferischen Auseinandersetzung mit
dem Ziel, seinen Marktanteil massiv zu Lasten des Konkurrenten auszubauen,
spricht man von Verdrängungswettbewerb (vgl. Bartmann et al. 1999, S. 209f.).
Der Begriff ,,ruinöser Wettbewerb" hat einen Preisbezug: In der Wirtschaft wird
darunter in der Regel ein Preisverfall verstanden, durch den lediglich minimale
Gewinne oder sogar Verluste realisiert werden. Aufgrund der geringen Ein-
kommen finden keine Investitionstätigkeiten statt und es kommt zu einem Aus-
scheiden von Anbietern. Dadurch entsteht eine Marktunterversorgung, die ei-
nen überproportionalen Preisanstieg zur Folge hat. Letztendlich ist der End-
verbraucher das Opfer des ruinösen Wettbewerbs (vgl. Tolksdorf 1971, S. 29).
In der Literatur wird das Problem des ruinösen Wettbewerbs aus zwei Perspek-
tiven betrachtet: Zum einen als marktstrategischer Kampf, zum anderen als
verzögerter Anpassungsprozess (vgl. Tolksdorf 1971, S. 30f.). Die beiden Per-
spektiven seien hier kurz vorgestellt:
II.1. Das SVE-Paradigma
35
Der marktstrategische Kampf - ,,cutthroat competition" - wird von Machlup als
die Ausübung aggressiver Strategien innerhalb eines Oligopols bezeichnet. Die
oligopolistische Marktform ist Voraussetzung für die Verfolgung dieser Strate-
gien, da ein bestimmtes Maß an Marktmacht zur Realisierung nötig ist:
,,Ruinöse Konkurrenz kann niemals unter Polypolbedingungen entstehen, sie setzt stets ein
beträchtliches Maß an Monopolmacht seitens einiger der Konkurrenten voraus und es geht
nicht um größere Umsätze, sondern darum, den Konkurrenten kleinzukriegen." (Machlup 1966,
S. 357).
Nach Krelle kann eine ruinöse Wettbewerbsstrategie durch Konkurrenten ver-
folgt werden, die innerhalb eines Duopols mit ihrer Position unzufrieden sind
und den anderen vollständig aus dem Feld verdrängen wollen, obwohl sie ne-
beneinander existieren könnten (vgl. Krelle 1961, S. 307). Arndt zufolge besteht
die Zielsetzung des marktstrategischen Kampfes in erster Linie nicht im Erwerb
eines größeren Marktanteils, sondern in der Verdrängung von neuen Wettbe-
werbern oder nachahmenden Konkurrenten:
,,Die ,Störenfriede' werden dann solange in den Verkaufspreisen unter- und in den Einkaufsprei-
sen [...] überboten, bis sie ausscheiden und sich bei potentiellen Konkurrenten die Erfahrung
durchsetzt, daß infolge der Reaktionen der Altunternehmen ein erfolgreicher Start nicht möglich
ist." (Arndt 1966, S. 57).
Ruinöser Wettbewerb als verzögerter Anpassungsprozess entsteht nach Kay-
sen/Turner durch einen allgemeinen Nachfragerückgang. Dabei ist die Oligopol-
form keine notwendige Voraussetzung. Vielmehr ist der Prozess ein Resultat
von Überkapazitäten, wodurch hohe Fixkosten nicht abgebaut werden können.
Um den Absatz zu erhöhen und somit die Fixkosten zu senken, unterbieten sich
die Anbieter in ihrem Preisniveau:
,,Given slack demand, or overexpansion of capacity, the incremental cost of production may fall
far below total unit cost. [...] In a competitive industry, this generates strong pressures toward
price cutting, and price may be expected to fall to incremental cost." (Kaysen/Turner 1965, S.
195f.).
II.1. Das SVE-Paradigma
36
Reynolds konstatiert, dass Preissenkungen in ruinösen Wettbewerbsprozessen
der Hoffnung entsprächen, kurzfristige Gewinne durch eine überproportionale
Absatzausweitung zu erhöhen und somit den Liquiditätsstatus zu verbessern.
Eine Verdrängung der Wettbewerber sei nicht das Ziel (vgl. Reynolds 1940, S.
736, zitiert nach: Tolksdorf 1971, S. 33).
Den Perspektiven liegen unterschiedliche Ursachen für den ruinösen Einsatz
des Preises zugrunde: Während beim marktstrategischen Kampf der Preis ein-
gesetzt wird, um andere Wettbewerber vom Markt zu verdrängen bzw. sie zu
ruinieren, wird der Preis beim Anpassungsprozess als Mittel zur Erhöhung des
Absatzes genutzt. Aufgrund der gegenseitigen Preisunterbietung wird das In-
strument wirkungslos und führt sowohl die Wettbewerber als auch den Markt in
den Ruin.
Da die Begriffe ,,ruinöser Wettbewerb" und ,,ruinöser Preiskampf" häufig syn-
onym verwendet werden, ist eine Differenzierung nötig, um den Einsatz weiterer
Marketinginstrumente zu beachten. Brühwiler unterscheidet daher zwischen
ruinösem Preiskampf, Verdrängungswettbewerb und generell destruktivem
Marktverhalten:
,,Ruinöser Preiskampf herrscht, wenn in einer Branche oder einem Marktbereich übersteigerter
Gebrauch des Preisinstrumentariums einerseits sukzessiv sinkende Preise und abnehmende
Gewinnmargen und andererseits eine einseitige Entwicklung von Markt und Marketing zur Fol-
ge hat." (Brühwiler 1989, S. 23).
Indizien eines ruinösen Preiskampfes sind Marktdruck und wirkungsloser In-
strumenteneinsatz. Marktdruck in Form von Marktsättigung ist dabei notwendi-
ge, aber nicht hinreichende Bedingung für ruinösen Wettbewerb, denn es kann
zu einer natürlichen Anpassung der Preise kommen, ohne dass Elemente des
ruinösen Wettbewerbs auftreten (vgl. Brühwiler 1989, S. 45). Ein wirkungsloser
Instrumenteneinsatz ist dadurch charakterisiert, dass die obere Wirkungs-
schwelle erreicht wurde und ein erhöhter Aufwand keine weiteren Effekte erzielt
(vgl. Brühwiler 1989, S. 130).
II.1. Das SVE-Paradigma
37
,,Der Verdrängungswettbewerb geht in seiner Wirkung weiter als der ruinöse Preiskampf, indem
die Entwicklung hin zum Austritt einzelner Unternehmen aus dem Markt zielt. [...] (Er) schliesst
auch mehr Instrumente mit ein, als der ruinöse Preiskampf." (Brühwiler 1989, S. 24f.).
Weitere Instrumente im Verdrängungswettbewerb können eskalierende Leis-
tungen, Technologiewettbewerb oder Verdrängungskommunikation in Form von
Werbeschlachten sein (vgl. Brühwiler 1989, S. 25). Allerdings bleibt der Einsatz
des Preises in Form von ,,predatory pricing" die wichtigste ,,Waffe" im Verdrän-
gungswettbewerb (vgl. Aberle 1992, S. 63f.)
Destruktives Marktverhalten muss weder die Verdrängung eines Konkurrenten
zum Ziel haben noch alleine aus einem Preiskampf bestehen. Es bezieht sich
auf das ,,ganze Spektrum der Marketinginstrumente und Marktbeziehungen"
und ist durch deren wirkungslosen Einsatz gekennzeichnet (Brühwiler 1989, S.
24). Die Arbeit folgt den Definitionen Brühwilers und unterscheidet ruinösen
Preiskampf, Verdrängungswettbewerb und destruktives Marktverhalten.
1.2.2 Qualitäts- und Innovationswettbewerb
Der Wettbewerbsparameter Produktqualität bezieht sich auf die Weiterentwick-
lung und Verbesserung bestehender Produkte. Diese kann mit Innovationen
erreicht werden. Unternehmen in einem heterogenen Oligopol setzten häufig
auf die qualitative Verbesserung ihrer Produkte, da sie in der Regel keine un-
mittelbar spürbare Auswirkung auf die Wettbewerber und somit keine sofortige
Reaktion zur Folge hat. Der Fokus auf die Qualität kann zu einer stärkeren He-
terogenität des Marktes führen, was einen größeren Spielraum im Preiswettbe-
werb zulässt. Darüber hinaus kann Qualität jedoch auch den Preis als zentrales
Instrument substituieren (vgl. Schmidt 2001, S. 63f.).
Produkte können nach dem Zeitpunkt ihrer Qualitätsbewertung in Inspektions-,
Erfahrungs- und Vertrauensgüter unterschieden werden. Bei Inspektionsgütern
kann die Qualität des Produktes vor dessen Konsum bewertet werden. Für die
werbetreibende Wirtschaft stellt der Anzeigenraum einer Zeitung ein Inspekti-
II.1. Das SVE-Paradigma
38
onsgut dar, da vor seinem Erwerb auf der Basis von Media-Daten Aussagen
über quantitative und qualitative Reichweiten getroffen werden können. Im Ge-
gensatz dazu stellt die Zeitung für den Leser ein Erfahrungsgut dar, da er sich
erst nach Erwerb des Produktes von ihrer Qualität überzeugen kann. Kann ein
Leser die Qualität einer Zeitung auch nach deren Erwerb nicht feststellen, weil
er nicht weiß, ob die in ihr enthaltenen Aussagen richtig sind, nimmt sie den
Charakter eines Vertrauensgutes an (vgl. Sjurts 2002, S. 10f.).
Obwohl Produkte in verschiedene Qualitätsklassen eingestuft werden, besteht
die Schwierigkeit in der Definition von Qualität (vgl. Homburg 2003, S. 178). Im
Medienbereich werden eine ökonomische und eine publizistische Qualität un-
terschieden. Der Qualitätswettbewerb beinhaltet demnach alle Maßnahmen, um
sowohl die ökonomische als auch die publizistische Qualität zu verbessern.
Die ökonomische Qualität beinhaltet die Befriedigung der subjektiven und indi-
viduellen Konsumpräferenzen der Nachfrager (vgl. Heinrich 1994, S. 93). Der
Grad der Zielerreichung kann bei der ökonomischen Qualität anhand der
Marktanteile bei verschiedenen, z.B. nach soziodemographischen Merkmalen
eingeteilten Mediennutzern ermittelt werden:
,,Der Erfolg von Printunternehmen hängt [...] im wesentlichen davon ab, ob es gelingt, durch
thematische Kompetenz und die Integration des marketingpolitischen Instrumentariums attrakti-
ve Leserpotentiale zu schaffen, die mit den werblichen Zielgruppen übereinstimmen." (Wirtz
2003, S. 170).
Das bedeutet, dass die Produktqualität einer Zeitung nicht nur anhand der Le-
serbedürfnisse, sondern auch vor dem Hintergrund der Zielgruppen-
Kontaktbedürfnisse der Werbewirtschaft entwickelt wird (vgl. Wirtz 2003, S.
170). Die publizistische Qualität orientiert sich an den objektiven Kriterien Ak-
tualität, Relevanz, Richtigkeit und Vermittlung der Informationen (vgl. Heinrich
1994, S. 93).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832489649
- DOI
- 10.3239/9783832489649
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Sozialwissenschaften, Publizistik
- Erscheinungsdatum
- 2005 (August)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- medien marketing berliner morgenpost tagesspiegel struktur-verhalten-ergebnis-paradigma
- Produktsicherheit
- Diplom.de