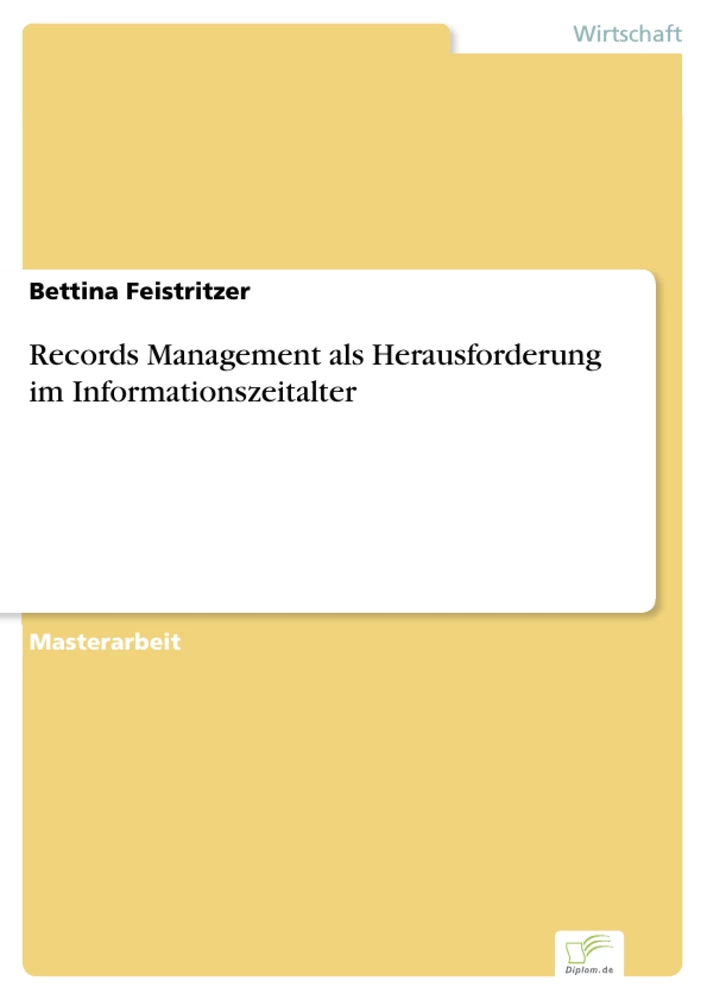Records Management als Herausforderung im Informationszeitalter
©2005
Masterarbeit
139 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Records Management ist im Grunde ein alter Hut. Doch während sich das professionelle Records Management in den USA bereits als wirkungsvolles Instrument zur Bewältigung der Informationsflut und daraus resultierender Probleme etabliert hat, ist das Konzept gerade auch in der deutschen Privatwirtschaft weitestgehend unbekannt. Die klassische Schriftgutverwaltung gilt hierzulande vielmehr als notwendiges Übel denn als profitables Instrument des E-Business.
Kein Zweifel: Der Einzug des Informationszeitalters hat unser Leben nachhaltig verändert. Wir alle müssen uns über kurz oder lang damit abfinden, dass elektronische Informationen zunehmend unseren privaten wie auch unseren geschäftlichen Alltag dominieren. Insbesondere Unternehmen sehen sich derzeit mit dem Problem konfrontiert, dass neben Papierakten vermehrt elektronische Geschäftsunterlagen zu verwalten sind, für die sich die althergebrachten Methoden nur bedingt oder gar nicht eignen. Das zunehmende Interesse an Dokumenten-Management-Systemen (DMS) zeigt, dass der Einsatz innovativer Instrumente an Bedeutung gewinnt, doch gerade DMS-Projekte werfen u. a. die Frage auf, wie sich eine Einführung auf die bisherige Schriftgutverwaltungs- und Archivierungspraxis auswirken wird.
Ein Grundproblem von DMS stellen die unterschiedlichen Interessen der Anwendergruppen dar. In den meisten Unternehmen steht verständlicherweise die (gemeinsame) Bearbeitung bzw. der Austausch aktueller Dokumente im Vordergrund und nicht die Langzeitaufbewahrung inaktiver Dokumente. Eine enorme Masse intern erzeugter oder von außen eingegangener Informationen erschwert die Ausfilterung der richtigen Geschäftsunterlagen, um diese für die Zukunft zu sichern. Gerade unter diesem Aspekt ist die bislang übliche rückwirkende Archivierung nahezu unmöglich geworden.
Es muss also andere Mittel und Wege geben. Die Arbeit möchte unter anderem auch eine Antwort auf die Frage liefern, ob und inwieweit sich Records Management als Schlüssel zur Beherrschung der heutigen Informationsflut bzw. als Vorstufe für eine professionelle Archivierung eignet. Fakt ist, dass eine mangelhafte Steuerung des Informationszugriffs nicht nur den Geschäftsbetrieb behindert, sondern letztlich auch den unternehmerischen Erfolg gefährdet. Dass die Zerstörung geschäftskritischer Unterlagen sogar das völlige Aus bedeuten kann, dürfte sich inzwischen auch in deutschen Kreisen herumgesprochen haben. Vorsorgemaßnahmen zur Sicherung von […]
Records Management ist im Grunde ein alter Hut. Doch während sich das professionelle Records Management in den USA bereits als wirkungsvolles Instrument zur Bewältigung der Informationsflut und daraus resultierender Probleme etabliert hat, ist das Konzept gerade auch in der deutschen Privatwirtschaft weitestgehend unbekannt. Die klassische Schriftgutverwaltung gilt hierzulande vielmehr als notwendiges Übel denn als profitables Instrument des E-Business.
Kein Zweifel: Der Einzug des Informationszeitalters hat unser Leben nachhaltig verändert. Wir alle müssen uns über kurz oder lang damit abfinden, dass elektronische Informationen zunehmend unseren privaten wie auch unseren geschäftlichen Alltag dominieren. Insbesondere Unternehmen sehen sich derzeit mit dem Problem konfrontiert, dass neben Papierakten vermehrt elektronische Geschäftsunterlagen zu verwalten sind, für die sich die althergebrachten Methoden nur bedingt oder gar nicht eignen. Das zunehmende Interesse an Dokumenten-Management-Systemen (DMS) zeigt, dass der Einsatz innovativer Instrumente an Bedeutung gewinnt, doch gerade DMS-Projekte werfen u. a. die Frage auf, wie sich eine Einführung auf die bisherige Schriftgutverwaltungs- und Archivierungspraxis auswirken wird.
Ein Grundproblem von DMS stellen die unterschiedlichen Interessen der Anwendergruppen dar. In den meisten Unternehmen steht verständlicherweise die (gemeinsame) Bearbeitung bzw. der Austausch aktueller Dokumente im Vordergrund und nicht die Langzeitaufbewahrung inaktiver Dokumente. Eine enorme Masse intern erzeugter oder von außen eingegangener Informationen erschwert die Ausfilterung der richtigen Geschäftsunterlagen, um diese für die Zukunft zu sichern. Gerade unter diesem Aspekt ist die bislang übliche rückwirkende Archivierung nahezu unmöglich geworden.
Es muss also andere Mittel und Wege geben. Die Arbeit möchte unter anderem auch eine Antwort auf die Frage liefern, ob und inwieweit sich Records Management als Schlüssel zur Beherrschung der heutigen Informationsflut bzw. als Vorstufe für eine professionelle Archivierung eignet. Fakt ist, dass eine mangelhafte Steuerung des Informationszugriffs nicht nur den Geschäftsbetrieb behindert, sondern letztlich auch den unternehmerischen Erfolg gefährdet. Dass die Zerstörung geschäftskritischer Unterlagen sogar das völlige Aus bedeuten kann, dürfte sich inzwischen auch in deutschen Kreisen herumgesprochen haben. Vorsorgemaßnahmen zur Sicherung von […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8942
Feistritzer, Bettina: Records Management als Herausforderung im Informationszeitalter
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Hochschule der Medien (ehem. Hochschule für Druck und Medien Stuttgart (FH)),
MA-Thesis / Master, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Kurzfassung
2
Kurzfassung
Im Zuge des fortschreitenden Informationszeitalters bekommt ein traditionelles Arbeits-
gebiet frischen Aufwind: Das Records Management. Ging es bei der klassischen
Schriftgutverwaltung vorwiegend um die Organisation papiergebundener Unterlagen
und Informationen, so ist im Rahmen von E-Business und E-Government das Mana-
gement medienübergreifender 'Records' in den Vordergrund gerückt. Zunehmend e-
lektronisch gestützte Transaktionen haben zu einer Koexistenz hybrider Geschäftsun-
terlagen geführt, deren Handhabung sich als echte Herausforderung für Organisatio-
nen des öffentlichen und privaten Sektors erweist.
Diese Arbeit liefert neben einer allgemeinen Einführung in das professionelle Records
Management auch den Versuch einer Positionierung, zudem skizziert sie die Entwick-
lungen auf internationaler Ebene. Weitere Schwerpunkte bilden die Herausforderun-
gen, mit denen sich insbesondere die deutsche Privatwirtschaft konfrontiert sieht. Die
Frage nach möglichen Umsetzungsstrategien für Unternehmen schließt die Lücke zwi-
schen Theorie und Praxis und ermöglicht einen kritischen Ausblick.
Schlagwörter: Dokumentenmanagement, Elektronischer Geschäftsverkehr, Informati-
onsmanagement, Informationszeitalter, Privatwirtschaft, Schriftgutverwaltung.
Abstract
Keeping pace with the developments of the information age, new perspectives are
opening up for a traditional activity: that of Records Management. Whereas classical
administration of printed and written matter concerned in the main the organization of
paper documents and information, in the framework of e-commerce and e-government,
management of records transcending specific media has come to the fore. The in-
crease in volume of electronically based transactions has led to a mix of hybrid busi-
ness documents that proves to be a real challenge to those charged with records ad-
ministration in the private and public sectors.
Apart from a general introduction to professional Records Management, this paper also
presents an approach to positioning while outlining developments internationally. Also
dealt with are the challenges that the German private sector, in particular, sees itself
confronted with. Issues of feasible implementation strategies in business esta-
blishments close the gap between theory and practice and permit a critical review of
future prospects.
Keywords: document management, electronic commerce, information age, information
management, private sector, records management.
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung ... 2
Abstract... 2
InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis... 3
Abbildungsverzeichnis... 6
Tabellenverzeichnis... 7
Abkürzungsverzeichnis... 8
Vorwort ...10
1
Einführung... 12
1.1
Zielgruppe ... 13
1.2
Zielsetzung... 13
1.3
Aufbau der Arbeit ... 14
2
Grundlagen... 15
2.1
Definitionen ... 15
2.1.1
Schriftgut und Schriftgutverwaltung ... 15
2.1.2
Dokument... 16
2.1.3
Akte... 16
2.1.4
Aktenführung... 17
2.1.5
Record ... 18
2.1.6
Records Management... 19
2.2
Begriffliche Abgrenzungen... 20
2.2.1
Records - Dokumente ... 21
2.2.2
Akten - Schriftgut ... 21
2.2.3
Schriftgutverwaltung - Records Management... 21
3
Positionierung... 25
3.1
Einbindung in übergeordnete Management-Konzepte ... 25
3.1.1
Informationsmanagement ... 25
3.1.2
Wissensmanagement ... 27
3.1.3
Qualitätsmanagement... 29
3.2
Einbindung in technologische Gesamtkonzepte ... 30
3.2.1
Document Related Technologies... 31
3.2.2
Enterprise Content Management ... 32
3.2.3
Information Lifecycle Management ... 35
3.3
Zusammenspiel mit verwandten Technologien... 39
3.3.1
Dokumentenmanagement... 40
Inhaltsverzeichnis
4
3.3.2
Vorgangsbearbeitung / Workflow... 43
3.3.3
Elektronische Archivierung ... 44
4
Professionelles Records Management ... 49
4.1
Merkmale ... 49
4.2
Aufgaben und Funktionen... 50
4.3
Nutzen und Ziele... 52
4.4
Anwendungsgebiete ... 56
4.5
Anforderungen ... 57
4.5.1
Qualitative Ansprüche... 58
4.5.2
Organisatorische Anforderungen ... 59
4.5.3
Technologische Anforderungen ... 60
4.6
Instrumente ... 63
4.6.1
Gesetze... 63
4.6.2
Strategien und Policies ... 64
4.6.3
Aussonderungssysteme... 65
4.6.4
Organisationsvorschriften und Ordnungssysteme ... 67
4.6.5
Aktenpläne ... 69
4.6.6
Metadaten ... 70
4.6.7
Verfahrensstandards... 73
4.6.8
Records-Management-Systeme ... 73
4.7
Zusammenfassung ... 74
5
Internationale Entwicklungstendenzen ... 76
5.1
Sektorale Ausdehnung... 76
5.2
Geographische Verbreitung ... 77
5.2.1
USA... 77
5.2.2
Europa ... 79
5.3
Regulative Vorgaben ... 79
5.3.1
E-Government... 81
5.3.2
E-Business... 82
5.4
Professionalisierung... 83
5.4.1
Annäherung klassischer und moderner Berufsbilder ... 83
5.4.2
Records Management als interdisziplinäre Aufgabe... 85
5.4.3
Berufsbild Records Manager ... 86
5.4.4
Records Manager als Wegbereiter der Archivierung ... 87
5.4.5
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten... 87
5.5
Marktentwicklung ... 89
5.5.1
Rückblick... 89
5.5.2
Aktuelle Markteinschätzung ... 90
5.5.3
Marktprognosen ... 91
Inhaltsverzeichnis
5
6
Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für die deutsche
Privatwirtschaft ... 93
6.1
Ausgangsposition... 93
6.2
Externe Einflussfaktoren ... 95
6.2.1
Globalisierung und technologischer Wandel... 95
6.2.2
Normative Einflüsse ... 98
6.3
Interne Einflussfaktoren ... 101
6.3.1
Kulturelle Faktoren... 102
6.3.2
Organisatorische und technische Faktoren ... 103
6.4
Einführungshilfen ... 108
6.4.1
Records-Management-Programme ... 108
6.4.2
DIRKS-Methodologie ... 113
7
Resumee und Ausblick ... 117
Anhang A: Wichtige RM-Internetadressen (international) ... 120
A.1 Anlaufstellen und Publikationen ... 120
A.2 Ausgewählte RM-Software von DMS-/CMS-Anbietern... 121
Anhang B: Die 10 Merksätze des VOI für die Revisionssichere Archivierung... 122
Glossar... 123
Quellenverzeichnis ... 130
Abbildungsverzeichnis 6
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Moderne Aktenführung über den gesamten Lebenszyklus (Quelle:
Staatsarchiv St. Gallen 2004)... 18
Abbildung 2: Records Management im konzeptionellen Rahmen (in Anlehnung an
Chell & Zawiyah 1999) ... 19
Abbildung 3: Document Related Technologies (in Anlehnung an Kampffmeyer
2003a) ... 32
Abbildung 4: ECM-Segmente (in Anlehnung an Zöller 2004) ... 33
Abbildung 5: ECM-Komponenten gemäß AIIM (Quelle: Kampffmeyer 2004c) ... 34
Abbildung 6: Dokumenten-/Informations-Lebenszyklus und Archivierung (Quelle:
Kampffmeyer 2003d) ... 38
Abbildung 7: Technologien rund um das Records Management (in Anlehnung an
Beach 2004) ... 39
Abbildung 8: ECM-Komponenten: Records Management (Quelle: Kampffmeyer
2004c) ... 52
Abbildung 9: Nutenpotenziale von Records Management (in Anlehnung an Braun
und Reitze 2004) ... 54
Abbildung 10: Anwendungsgebiete des Records Management (Quelle: COI 2003) ... 56
Abbildung 11: Informationsmodell gemäß ISO 15489 (in Anlehnung an Schaffroth
2002) ... 58
Abbildung 12: RM-Instrumente im Überblick (in Anlehnung an Schaffroth 2004)... 63
Abbildung 14: Integration von RM-Policy und E-Mail-Policy ... 65
Abbildung 15: Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung von Quellen (Quelle:
www.horison.com) ... 66
Abbildung 16: 3-Stufenmodell eines Metadatenschemas (in Anlehnung an Toebak
2001) ... 72
Abbildung 17: Bestandteile des professionellen Records Managements (Quelle:
Reitze 2003) ... 75
Abbildung 18: Berufe im Umfeld des Records Management ... 84
Abbildung 19: Interne Einflussfaktoren von Records Management (Quelle: Smith
2004 ) ... 101
Abbildung 20: Bausteine einer modernen E-Business-Architektur (in Anlehnung an
Reitze 2003b) ... 107
Abbildung 21: Projektablauf nach DIRKS auf Basis der ISO 15489 ... 114
Tabellenverzeichnis
7
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Klassische Schriftgutverwaltung und modernes Records Management
im Vergleich... 24
Tabelle 2: DMS versus RMS (in Anlehnung an Fresko & Waldron 2001)... 41
Tabelle 3: Schichtenmodell des Records Management (Quelle: Knappe 2003)... 42
Tabelle 4: Archivierungsformen (in Anlehnung an Kampffmeyer 2003a)... 45
Tabelle 5: Anforderungen an das professionelle Records Management (in
Anlehnung an Schaffroth 2002 und Kampffmeyer 2003b) ... 57
Tabelle 6: Anforderungen an ein RMS (Quelle: DIN ISO 15489-1) ... 60
Tabelle 7: Funktions-Checkliste eines DMS/RMS (Quelle: Toebak 2002)... 62
Tabelle 8: Rahmenbedingungen für die moderne Schriftgutverwaltung (Quelle:
Staatsarchiv St. Gallen 2004)... 68
Tabelle 9: Ausgewählte Standards im RM-Umfeld (Quelle: Kampffmeyer 2004e) ... 80
Tabelle 10: Deutsche Gesetze im RM-Umfeld (in Anlehnung an Dänzer 2004)... 100
Tabelle 11: Erfolgsstrategien der RM-Etablierung (in Anlehnung an Langemo
2002) ... 111
Tabelle 12: Stufenplan nach der DIRKS-Methodologie (in Anlehnung an
Burgwinkel & Armbruster 2004)... ............ 115
Abkürzungsverzeichnis 8
Abkürzungsverzeichnis
AO Abgabenordnung
AIIM
The Association for Information and Image Management
ARMA
Association of Records Managers and Administrators
BCM
Business Continuity Management
BPM
Business Process Management
BPR
Business Process Reengineering
COLD
Computer Output on Laser Disc
CRM
Certified Records Manager
DMS
Document Management System
DoD
Department of Defense
DOMEA
Dokumentenmanagement und Archivierung im elektronisch gestützten
Geschäftsgang
DVD
Digital Versatile Disc
E-Mail Electronic
Mail
ECM(S)
Enterprise Content Management (System)
EDRM
Electronic Document and Records Management
EDM
Engineering Data Management (auch: Electronic Document Manage-
ment)
ERP
Enterprise Resource Planning
GDPdU
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GOBS
Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme
HSM
Hierarchical
Storage
Management
ICR
Intelligent Character Recognition
ICRM
Institute of Certified Records Manager
ILM
Information Lifecycle Management
IM Informationsmanagement
IRS Information-Retrieval-System
IT Informationstechnologie
IuD
Information und Dokumentation
Abkürzungsverzeichnis 9
IuK
Information und Kommunikation
IuKT
Informations- und Kommunikationstechnologien
NARA
National Archives and Records Administration
OAIS
Open Archiving Information System
OCR
Optical Character Recognition
OM(S)
Output Management (System)
QM Qualitätsmanagement
PDM
Procuct Data Management
RM Records
Management
RMS Records-Management-System
RMP Records-Management-Programm
SEC
Securities and Exchange Commission
SOA/SOX Sarbanes-Oxley-Act
TQM
Total Quality Management
WCM(S)
Web Content Management (System)
WM Wissensmanagement
WORM
Write Once Ready Multiple times
Vorwort
10
Vorwort
Records Management ist im Grunde ein "alter Hut". Während die klassische Schriftgut-
verwaltung in den Köpfen der meisten Unternehmer und Mitarbeiter als notwendiges
Übel verankert ist, gilt das moderne Records Management in Expertenkreisen als ein
äußerst profitables Instrument des Informationszeitalters. Umso erstaunlicher, dass
das dahinter liegende Konzept in Deutschland bislang weitestgehend unbekannt ist!
Die Motivation für eine intensive Auseinandersetzung mit Records Management resul-
tiert aus meiner Arbeit als Leiterin einer innerbetrieblichen Informationsabteilung und
hier insbesondere aus meiner Zuständigkeit für das Zentralarchiv. Wie alle anderen
Unternehmen sehen auch wir uns mit dem Problem konfrontiert, dass neben Papierak-
ten vermehrt elektronische Geschäftsunterlagen zu verwalten sind, für die sich die alt-
hergebrachten Methoden nur bedingt oder gar nicht eignen. Zudem wirft die bevorste-
hende Einführung eines Dokumenten-Management-Systems die Frage auf, wie sich
dies auf den Archivierungsablauf auswirken wird.
Archivierung war und ist insofern eine undankbare Aufgabe, als sie das letzte Glied in
einer langen Kette betrieblicher Abläufe bildet. Ein Grundproblem stellen dabei die un-
terschiedlichen Interessen der Anwendergruppen dar. In den meisten Unternehmen
steht verständlicherweise die (gemeinsame) Bearbeitung bzw. der Austausch aktueller
Dokumente im Vordergrund und nicht die Langzeitaufbewahrung inaktiver Dokumente.
Eine enorme Masse intern erzeugter oder von außen eingegangener Informationen
erschwert die Ausfilterung der "richtigen" Geschäftsunterlagen, um diese für die Zu-
kunft zu sichern. Gerade unter diesem Aspekt ist die bislang übliche rückwirkende Ar-
chivierung nahezu unmöglich geworden.
Es muss also andere Mittel und Wege geben. Ich hoffe, dass es mir mit der vorliegen-
den Arbeit gelungen ist, das Wesen von Records Management zu erfassen und unter
anderem auch eine Antwort auf die Frage zu liefern, ob und inwieweit sich dieser An-
satz als Schlüssel zur Beherrschung der heutigen Informationsflut und somit auch als
Vorstufe für eine professionelle Archivierung erweisen kann.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den beiden Personen bedanken, die mir das Stu-
dium überhaupt ermöglicht haben: Unser Personalleiter war so freundlich, mich von der
Kernzeitenregelung zu befreien, damit ich während des Semesters an den Vorlesun-
gen teilnehmen konnte. Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Erstkorrektor und da-
maligen Studiengangleiter, Wolfgang von Keitz, der mir trotz voller Berufstätigkeit zur
Teilnahme am Aufbaustudiengang IWM riet weder er noch ich selbst konnten wissen,
ob ich dieser Belastung gewachsen sein würde. Last but not least ein herzliches "Mer-
ci" an Sabine Lonien, die sich freundlicherweise bereit erklärte, als externe Expertin die
Zweitkorrektur zu übernehmen.
"Quod non est in actis,
non est in mundo."
(Was nicht in Akten steht,
existiert nicht.)
Lateinisches Sprichwort
1 Einführung
12
1 Einführung
Kein Zweifel: Der Einzug des Informationszeitalters hat unser Leben nachhaltig verän-
dert. Nach Kampffmeyer (2003e, S. 3) müssen wir alle uns über kurz oder lang damit
abfinden, dass digitale Informationen zunehmend den privaten wie auch den geschäft-
lichen Alltag dominieren:
Unternehmen, Behörden und die Gesellschaft sind von der ständigen
Verfügbarkeit elektronischer Information inzwischen existentiell abhän-
gig.
Eine mangelhafte Steuerung des Informationszugriffs behindert nicht nur den Ge-
schäftsbetrieb, sondern gefährdet letztlich auch den unternehmerischen Erfolg. Dass
die Zerstörung geschäftskritischer Unterlagen sogar das völlige Aus bedeuten kann,
dürfte sich inzwischen auch in deutschen Kreisen herumgesprochen haben. Vorsor-
gemaßnahmen zur Sicherung von Informationen sind ergo unerlässlich. Dazu bedarf
es allerdings eines Verfahrens, das den Umgang mit elektronischen, aber auch mit den
verbleibenden analogen Unterlagen regelt.
Hybride Informationsbestände sind fürwahr nichts Neues. Dennoch fehlt es in den
meisten Organisationen an verbindlichen Vorgaben hinsichtlich ihrer Handhabung.
Stattdessen liegt das Prozedere häufig im individuellen Ermessen des Mitarbeiters.
Dies gilt insbesondere auch für die Ablage: Weit und breit führen willkürlich entstande-
ne digitale Datensammlungen ein Paralleldasein zu dem nach wie vor vorhandenen
Papierchaos. Die aus dieser Koexistenz resultierende, teils redundante Informations-
masse erschwert die einheitliche Verwaltung in ganz erheblichem Maße.
Klassische Papierunterlagen liegen in der Praxis mehr oder minder sorgfältig präpariert
vor. Ihr Zugriffskomfort hängt maßgeblich von den jeweiligen Ablagegepflogenheiten
ab. Mancherorts existieren zentrale Registraturen oder Archive zum Zwecke der Akten-
verwaltung. Digitale Informationen wiederum verteilen sich in der Regel über die ge-
samte Organisation. Ihre Ablage erfolgt in vielen Fällen ohne Rücksicht auf Relevanz
und/oder Lebensdauer, nicht selten kommt es zu einer uneinheitlichen Speicherung
auf lokalen Festplatten oder Netzlaufwerken und auf verschiedenen Datenträgern. Von
diesen verstreuten Beständen finden sich im Zuge der allgemein üblichen Datensi-
cherung lediglich die im Netz abgelegten Informationen auf Langzeitspeichern wieder.
Medienbrüche gehören im betrieblichen Alltag längst zur Tagesordnung. Heute wettei-
fern stattliche Papierberge mit ständig überquellenden Mailpostfächern oder interes-
santen Websites um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter. Die daraus resultierende
Desorientierung ist nur eine von zahlreichen Folgen ständiger Reiz- und Informations-
überflutung. Kampffmeyer (2003c, S. 5) beschreibt diesen Zustand sehr treffend:
So erleben wir gegenwärtig quasi gleichzeitig eine "Information Divide",
ein sich öffnendes "Information Gap" und einen "Information Overflow".
1 Einführung
13
Das Phänomen der in geradezu beängstigendem Maße ansteigenden Dokumenten-
und Informationsflut ist selbst in fortschrittlichen Umgebungen präsenter denn je. In
Bezug auf ein Unternehmen bedeutet die Teilung in informationsreiche und informati-
onsarme Individuen (Information Divide), dass nicht jedem Mitarbeiter die für ihn rele-
vanten Informationen zur Verfügung stehen. Mit Information Overflow ist die schiere
Masse an wertvollen, aber auch überflüssigen Informationen gemeint, während das
Gefühl des Mangels (Information Gap) nicht zuletzt aus fehlenden Strategien und Me-
chanismen resultiert, was wiederum den Informationszugriff erschwert. Der Kampf um
das Bewahren und schnelle (Wieder-)Auffinden unternehmensrelevanten Wissens hat
begonnen, doch bislang konnten selbst ausgereifte Informations- und Kommunikations-
technologien nur wenig ausrichten.
Das Erfolgsrezept kann folglich nicht (nur) aus dem Einsatz innovativer Technologien
bestehen, sondern muss weitaus mehr umfassen. Tatsächlich gibt es mittlerweile eine
ganze Reihe neuer Strategien und Konzepte, die sich hinter zum Teil wenig aussage-
kräftigen Akronymen und Schlagworten verbergen. Eines davon ist das hierzulande
bislang weitgehend unbekannte Records Management (RM). Ob und wie ein Unter-
nehmen das Informationsparadoxon mit Hilfe dieses Ansatzes überlisten kann und
inwieweit klassische Verfahren auf die veränderten Rahmenbedingungen des Informa-
tionszeitalters übertragbar sind, ist Thema der vorliegenden Arbeit.
1.1 Zielgruppe
Im Hinblick auf den beruflichen Hintergrund der Verfasserin handelt es sich bei den
nachfolgenden Ausführungen gewissermaßen um eine Gesamtschau über das weite
Feld des Records Managements. Das in diesem Rahmen erlangte Wissen dient in ers-
ter Linie persönlichen bzw. innerbetrieblichen Erkenntnissen und Zwecken. Die Dar-
stellungen eignen sich jedoch nicht nur als Einstiegslektüre für den Arbeitgeber der
Verfasserin, sondern dürften zudem durchaus auch für andere, gegenüber innovativen
Themen aufgeschlossene Unternehmen sowie für Beschäftigte aus dem informations-
wirtschaftlichen und -wissenschaftlichen Sektor von Interesse sein.
1.2 Zielsetzung
Records Management gehört zu den Begleiterscheinungen des fortschreitenden Infor-
mationszeitalters. Wer sich heute mit diesem Thema befasst, betritt auf den ersten
Blick ein wohlbekanntes Terrain; bei näherer Betrachtung erweist es sich schließlich in
mehrfacher Hinsicht als Neuland. Als aus der klassischen Schriftgutverwaltung hervor
gegangenes Arbeitsgebiet zielt dieser Ansatz seinerseits auf die Verwaltung und Abla-
ge von Informationen ab im Unterschied zu seinem Vorläufer versteht sich "echtes"
Records Management jedoch als gewinnbringendes Instrument und nicht als eine auf-
erlegte Pflichtübung.
1 Einführung
14
Die wachsende Komplexität neuer Konzepte im Umfeld des Informationsmanagements
verlangt Organisationen eine hohe Flexibilität ab. Professionelles Records Manage-
ment ist ein gerade auch in der deutschen Privatwirtschaft weitestgehend unerprobter
Ansatz. Ein wichtiges Anliegen ist deshalb der Versuch einer Sensibilisierung für die
veränderte Rolle der Schriftgutverwaltung. Zu diesem Zweck sind die Vermittlung von
Basisinformationen sowie eine Positionierung des Records Managements unerlässlich.
Mit den hieraus gewonnenen Informationen möchte die Verfasserin u. a. auch eine
solide Ausgangsbasis für betriebsinterne Überlegungen bezüglich der Initiierung eines
RM-Projekts schaffen.
Die Frage, ob es sich bei Records Management tatsächlich um eine Herausforderung
im positiven Sinne handeln könnte, lässt sich nicht einfach mit einem klaren Ja oder
Nein beantworten. Um beurteilen zu können, inwieweit es mit Hilfe moderner RM-Stra-
tegien und -Maßnahmen möglich ist, der heute vorherrschenden Informationsüberflu-
tung und Medienvielfalt Herr zu werden, ist das Verständnis verschiedener, ineinander
greifender Sachverhalte erforderlich möge die vorliegende Arbeit einen kleinen Bei-
trag zur Erhellung dieser Zusammenhänge leisten.
1.3 Aufbau der Arbeit
Records Management steckt hierzulande noch in den Kinderschuhen. Unter diesem
Blickwinkel führt Kapitel 2 zunächst einige Grundlagen in Form von Begriffsdefinitionen
und -abgrenzungen ein. Sehr wichtig für das Gesamtverständnis ist Kapitel 3, denn es
greift verschiedene übergeordnete Management- und Technologiekonzepte auf und
nimmt den Versuch einer Positionierung von Records Management vor. Zur Abrundung
steht das Zusammenspiel von RM-Tools mit verwandten Technologien im Fokus.
Kapitel 4 ist vollständig dem professionellen Records Management gewidmet. Hierbei
geht es nicht nur um Merkmale und Anforderungen, sondern vor allem auch um die zur
Verfügung stehenden Instrumente, die die Einführung von Records Management im
Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen des Informationszeitalters erleich-
tern sollen. Im Anschluss skizziert Kapitel 5 verschiedene Entwicklungstendenzen auf
internationaler Ebene und thematisiert am Rande auch die Berufs- und Weiterbil-
dungssituation im Umfeld der modernen Schriftgutverwaltung. Das Kapitel schließt mit
einem kurzen Blick auf die derzeitigen Marktgegebenheiten.
Kapitel 6 fokussiert schließlich die Herausforderungen an die deutsche Privatwirtschaft,
die eine Beschäftigung mit Records Management sinnvoll, wenn nicht gar unerlässlich
erscheinen lassen. Dieses Kapitel weist einen wenn auch geringfügigen Praxisbezug
auf, indem es einschlägige Handlungsmöglichkeiten vorstellt. Den Abschluss bildet Ka-
pitel 7 mit einer Zusammenfassung und einem persönlichen Ausblick der Verfasserin.
2 Grundlagen
15
2 Grundlagen
Die babylonische Sprachverwirrung im Umfeld des Informationsmanagements (IM)
nimmt stetig zu. In Deutschland ist das Records Management gerade auch auf Grund
begrifflicher Unklarheiten "noch nicht so recht en vogue" (Kampffmeyer 2004b). Hinge-
gen ist der Umgang mit Geschäftsunterlagen und deren Ablage weder für die Leitung
noch für die Mitarbeiter eines Unternehmens etwas Neues im Gegenteil: Die Schrift-
gutablage war längst vor Einzug des Informationszeitalters ein (wenn auch ungeliebter
und häufig in seiner Bedeutung unterschätzter)
1
Bestandteil der Bürokommunikation.
Worin also liegen die Unterschiede zwischen der traditionellen Schriftgutverwaltung
und dem modernen Records Management? Mit dieser Frage beschäftigt sich das zwei-
te Kapitel im Anschluss an einige grundlegende Begriffserläuterungen.
2.1 Definitionen
Beim Einstieg in das Records Management sieht sich der Leser nicht nur mit einer
sehr komplexen Thematik konfrontiert, es tun sich zudem auch beträchtliche sprachli-
che Barrieren auf. Besonders IT-Laien stehen recht ratlos vor diesem verwirrenden
Begriffschaos, das als eine unmittelbare Folge des technologischen Fortschritts ent-
standen ist. Um für die vorliegende Arbeit ein einheitliches Verständnis zu erzeugen,
erfolgt vorab eine Definition einzelner Begriffe, die sowohl aus der klassischen Schrift-
gutverwaltung wie auch aus dem Records Management bzw. Dokumentenmanage-
ment stammen und die zumindest teilweise synonym verwendet werden.
2.1.1 Schriftgut und Schriftgutverwaltung
Schriftgut im klassischen Sinne bedeutet nichts anderes als die Gesamtheit aller aus
einer Geschäftstätigkeit erwachsenden Unterlagen, und zwar unabhängig davon, auf
welchem Material eine Aufzeichnung erfolgt. Der historische Ursprung der Schriftgut-
verwaltung reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück (Schockenhoff 2003, S. 5). Schon
damals ging es nicht nur um das Ordnen und Nachweisen
2
, sondern auch um die Auf-
bewahrung und Bereitstellung sowie die Aussonderung von Schriftstücken.
3
Damals wie heute geschah und geschieht das Ordnen von Schriftgut bekanntlich durch
die Zusammenstellung ausgewählter Schriftstücke.
4
Im Gegensatz zu früheren Jahr-
hunderten haben sich jedoch die Medien verändert, auf denen Informationen vorliegen.
Bereits bei der traditionellen Schriftgutverwaltung, mit der hier die bislang übliche Ak-
1
[Anm. d. Verf.]
2
Gemeint ist hier das Nachweisen im Sinne von Registrieren.
3
Vgl. hierzu auch Kapitel 4.6.3.
4
Siehe Abschnitt 2.1.3.
2 Grundlagen
16
tenführung (engl.: Recordkeeping) in Papierform gemeint ist, erfolgte eine Trennung
von Schriftstücken mit geringem bzw. kurzlebigem Wert von jenen mit dauerhaftem
Wert. Dies erfolgte mittels intellektueller Begutachtung sowie unter Zuhilfenahme di-
verser Ordnungssystematiken. Allerdings war diese Aufgabe im Industriezeitalter we-
sentlich einfacher zu bewältigen als heute.
Gemäß Büttner (1990, S. 472) bilden Schriftgut und Schriftgutverwaltung das zentrale
Element innerbetrieblicher bzw. innerbehördlicher Informationssysteme. Nach seiner
Auffassung sind sie Gegenstand einer besonderen Methodenlehre, die darauf abzielt,
Schriftstücke und Inhalte in besonderer Weise zweck- und zielorientiert zu betrachten,
zu bewerten, zuzuordnen, zu speichern oder zu vernichten.
Dabei stellt Büttner vier Thesen zur Schriftgutverwaltung auf: Zum einen ist Schriftgut-
verwaltung für ihn "eine willentliche eindimensionale, eng zweckrationale Form der
Dokumentation". Zum zweiten bildet die Funktion oder Aufgabe, aus der sich Zweck-
bezogenheit und -rationalität bestimmen, das Grundelement jeder Ordnung von
Schriftgut. Die dritte These besteht in der Aussage, dass Schriftgut einer ständigen
Wertbeurteilung bzw. einem ständigen Wertwandel unterliegt, der wiederum in Ord-
nungs- und Organisationsmaßnahmen des Schriftguts umgesetzt werden kann. Nicht
zuletzt ist die traditionelle Schriftgutverwaltung sachbestimmt (ebenda).
2.1.2 Dokument
Der Begriff Dokument besitzt in der deutschen Umgangssprache eine andere Bedeu-
tung als in der Informationsverarbeitung, in der Regel weist er einen konkreten Bezug
zu papiergebundenen Aufzeichnungen auf.
5
Häufig wird unter einem Dokument auch
ein Schriftstück mit einer hohen inhaltlichen Qualität und einer rechtlichen Bedeutung
im Sinne einer Urkunde verstanden. Ein "elektronisches Dokument" hingegen um-
schreibt im Grunde alle Arten schwach oder unstrukturierter Informationen, die in ei-
nem Datenverarbeitungssystem eine geschlossene Einheit bilden und in Form von
Dateien bzw. digitalen Objekten
6
vorliegen (Kampffmeyer 2003b, S. 11).
2.1.3 Akte
Unternehmen wie öffentliche Verwaltungen pflegen die für ihren Zuständigkeitsbereich
relevanten Geschäftsdokumente in Form von Akten abzulegen. Eine Akte lässt sich als
"Einheit von Dokumenten gleicher Betreffe, Korrespondenzpartner und Schriftgutarten
in einer Registratur bzw. in einem Archiv" bezeichnen (Schockenhoff 2003, S. 9). Ihre
Kennzeichnung erfolgt gewöhnlich mittels Aktenzeichen oder Signatur (ebenda, S. 4).
Akten sind somit Sammlungen von Geschäftsinformationen, in der zusammengehörige
Informationen strukturiert und gebündelt zur Verfügung gestellt werden.
5
Eine weitere Ableitung ist die Bezeichnung Dokumentation, hierbei handelt es sich um eine
Zusammenstellung von Dokumenten zu einem bestimmten Sachverhalt..
6
Gescannte Dokumente, Textverarbeitungsdateien, Tabellenkalkulationsdateien usw.
2 Grundlagen
17
Analog zur Definition der Schriftgutverwaltung handelt es sich bei der Aktenbildung um
das geordnete Zusammenstellen von Schriftstücken, die für die Bearbeitung eines Vor-
gangs erforderlich sind (ebenda, S. 9). In ihrer Gesamtheit bilden Akten somit gewis-
sermaßen die Grundvoraussetzung für die Nachweisbarkeit von Geschäftsprozessen.
Bislang erfolgte die Aktenbildung bzw. -führung weitestgehend in Papierform, im Zuge
der fortschreitenden Digitalisierung erlangt die digitale Aktenführung eine immer grö-
ßere Bedeutung. Heute lassen sich drei verschiedene Aktentypen unterscheiden:
Konventionelle Akten
Hybridakte
Digitale Akte
Der gängigste Typus sind sicherlich die konventionellen Papierakten. Sie liegen ent-
weder in Form von Handakten einzelner Sachbearbeiter oder als zentral geführte Ak-
ten in einer Registratur oder einem Archiv vor. Papierakten variieren hinsichtlich ihres
Inhalts und Umfangs und können folglich auch aus mehreren Bänden bestehen.
Hybridakten hingegen stellen eine Mischform aus Print- und elektronischen Dokumen-
ten dar. Diese Aktenform entspricht den Ansprüchen einer modernen Aktenverwaltung
insofern, als bei der heutigen Vorgangsbearbeitung zwar nach wie vor papiergebunde-
nes Schriftgut vorhanden ist, dieses ist jedoch gemeinsam mit den verstärkt auf-
tretenden digitalen Unterlagen in eine gemeinsame Akte zu überführen.
Digitale Akten wiederum bestehen ausschließlich aus elektronischen Dokumenten und
setzen eine vollständige Digitalisierung der analogen Geschäftsunterlagen voraus. Im
Grunde handelt es sich bei digitalen Akten um ein Bestandsverzeichnis verschiedener
Informationsobjekte, wobei die einzelnen Aktenbestandteile aus Datenhaltungs- oder
Bearbeitungsgründen auf unterschiedlichen Servern abgelegt sein können. Es existiert
also lediglich eine Struktur der Akte, welche die Verweise auf die eigentlichen Doku-
mente enthält (Knappe 2003, S. 9).
2.1.4 Aktenführung
Nach Schaffroth (1996, S. 15) ist unter Aktenführung die systematische und vollständi-
ge Erstellung bzw. Aufzeichnung von Geschäftsunterlagen sowie deren Ablage nach
einem geregelten Verfahren zu verstehen:
Denn Unterlagen, die ,spontan' und vielleicht auch zufällig in einem Be-
arbeitungsprozess erstellt wurden, sind dadurch allein noch nicht zuver-
lässige und authentische, d. h. nachweisbare oder beweiskräftige Zeug-
nisse.
Da Unterlagen im Sinne von Akten letztlich Handlungen oder Fakten in schriftlicher
Form repräsentieren, sollten sie einen nachweisfähigen Charakter haben. Geschäfts-
unterlagen sind infolgedessen nicht zwangsweise mit Akten gleichzusetzen, um sie als
2 Grundlagen
18
solche aufzeichnen zu können, müssen sie die wichtigsten Kriterien Zuverlässigkeit
und Authentizität
7
besitzen. Eine Unterlage wird somit erst dann zur Akte, wenn diese
Mindestanforderungen durch die Aktenführung erfüllt sind (ebenda, S. 16f). Dazu ge-
hört heute wesentlich mehr als das bloße Ablegen von Dokumenten: "Eine Aktenfüh-
rung, die ihren Namen verdient, ermöglicht die Verfügbarkeit der Unterlagen über den
gesamten Lebenszyklus" (Staatsarchiv St. Gallen 2004, S. 1). Folgende Skizze möge
dies verdeutlichen.
8
Abbildung 1: Moderne Aktenführung über den gesamten Lebenszyklus
(Quelle: Staatsarchiv St. Gallen 2004)
2.1.5 Record
Der Begriff Record stammt ursprünglich aus dem Angloamerikanischen, im deutschen
Sprachgebrauch sind hierfür Bezeichnungen wie Aufzeichnung, Niederschrift, aber
auch Akte oder Unterlage üblich (o. V. 2004). Unter diesem Aspekt handelt es sich also
lediglich um ein Synonym der bereits definierten Begriffe Akten bzw. Schriftgut, im Sin-
ne des modernen Records Managements können Records jedoch sowohl in Papier-
form wie auch elektronisch vorliegen. Für den RM-Experten Bischof (2003, S. 6) der
international tätigen Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) sind Re-
cords
alle im Rahmen der Geschäftstätigkeit erstellten, genutzten und bewirt-
schafteten Informationen, d.h. die Gesamtheit der Informationsressour-
cen einer Verwaltung bzw. eines Unternehmens.
7
Echtheit, vgl. hierzu auch Kapitel 4.5.
8
Vgl. hierzu auch das Lebenszyklus-Modell in Abbildung 6 (Kapitel 3.2.3).
Erstellen / Empfangen
Registrieren
Ablegen
Aufbewahren
Verwenden
Aussondern/Anbieten
Aktenbildung
Aktenverwaltung
Aussonderung/Archivierung
2 Grundlagen
19
Da der Begriff Informationsressource sehr vage ist, sei an dieser Stelle ergänzt, dass
damit die Vielzahl unterschiedlicher Informationsarten und -typen wie beispielsweise
Papierakten, E-Mails, Datenbankeinträge oder Daten aus Spezialapplikationen gemeint
ist, aber auch und dies wird sich als besonderes Kennzeichen des Records Manage-
ments herausstellen Kontext- und Prozessinformationen.
9
Eine sehr ähnliche, jedoch mehr auf den Inhalt der Informationen bzw. Unterlagen ab-
zielende Definition liefert Kampffmeyer (20003b, S. 44), demnach ist ein Record
eine aufbewahrungspflichtige oder aufbewahrungswürdige Aufzeich-
nung, die einen rechtlichen, kaufmännischen oder ähnlich gelagerten
Sachverhalt nachvollziehbar und nachprüfbar dokumentiert.
2.1.6 Records Management
Records Management ist ein Gebiet, das durchaus Berührungspunkte mit anderen
Disziplinen aufweist. Entsprechend vielfältig sind auch hier die Definitionsversuche.
Diese hängen zum einen von der jeweiligen Sichtweise ab, zum anderen unterliegen
sie angesichts der sich laufend verändernden Rahmenbedingungen im Informations-
zeitalter dem Zwang einer permanenten Anpassung.
Das Verständnis von Records Management hängt demzufolge stark von der individuel-
len Perspektive ab, wie das nachfolgende Schaubild verdeutlicht.
10
Abbildung 2: Records Management im konzeptionellen Rahmen
(in Anlehnung an Chell & Zawiyah 1999)
Die offizielle Definition gemäß der deutschen Norm zur Schriftgutverwaltung klingt et-
was umständlich. Nach DIN ISO 15489-1 (2002, S. 8) handelt es sich beim modernen
Records Management um eine
9
Vgl. hierzu Kapitel 4.1.
10
Vgl. hierzu auch Kapitel 5.4 ff.
Definition von
Records Management
Archivarische
Perspektive
Informations-
Management-
Perspektive
Informations-
technologische
Perspektive
2 Grundlagen
20
als Führungsaufgabe wahrzunehmende effiziente und systematische
Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbe-
wahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut einschließlich der
Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Infor-
mationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten.
Glücklicherweise finden sich in der Fachliteratur inzwischen auch einige etwas ein-
prägsamere Definitionen. Nach Bischof (et al 2003, S. 6) stellt Records Management
ein Verfahren dar, das Organisationen bei der Bereitstellung und optimalen Nutz-
barmachung ihrer analogen und digitalen Geschäftsunterlagen gemäß deren Lebens-
zyklus unterstützt und das zudem eine professionelle Archivierung gewährleistet.
Schaffroth (2003a, S. 1) setzt Records Management kurzerhand mit der Aktenführung
gleich.
Halstenbach (2004, S. 1) wiederum übersetzt Records Management seinerseits mit
"Aufzeichnungsverwaltung" und macht damit einmal mehr deutlich, dass es beim Re-
cords Management nicht nur um die Verwaltung einzelner Dokumente, sondern einer
Sammlung von Einzelinformationen im Sinne von Akten geht. Ausführlichere Informati-
onen liefert ein eigens dem Wesen des professionellen Records Managements gewid-
metes Kapitel.
11
2.2 Begriffliche Abgrenzungen
Um die verschiedenen Begriffe im Umfeld der Schriftgutverwaltung voneinander abzu-
grenzen, bietet sich die Zuhilfenahme einschlägiger Normen an. Diese tragen der
wachsenden Bedeutung des Records Management Rechnung. So handelt es sich bei
der bereits erwähnten Norm zur Schriftgutverwaltung (DIN ISO 15489) um das deut-
sche Pendant des bereits im Jahr 2001 publizierten internationalen Standards ISO
15489.
Auch der zugehörige Fachbericht wurde inzwischen an die hiesigen Rahmen-
bedingungen angepasst.
12
Im Grunde stellt die deutsche Fassung eine weitestgehend unveränderte Ableitung aus
der internationalen Version dar, bei einem Vergleich fällt lediglich ein Unterschied so-
fort ins Auge: Die Fachtermini Record bzw. Records Management kommen hier nicht
vor, stattdessen verwendet die DIN-Norm die in der deutschen Sprache etablierten
Begriffe Akten bzw. Schriftgut sowie Schriftgutverwaltung.
11
Vgl. hierzu Kapitel 4 , insbesondere die Abschnitte 4.2 u. 4.3.
12
Die Norm umfasst zwei Teile: Teil 1: "ISO 15489-1 (2001): Information and documentation
Records management. Part 1: General." Teil 2: "ISO/TR 15489-2 (2001): Information und
Dokumentation Records management. Part 2: Guidelines (Technical Report)".
2 Grundlagen
21
2.2.1 Records - Dokumente
Eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis von Records Management ist
die Unterscheidung von Records und Dokumenten. Hierbei ist insbesondere das Wis-
sen wichtig, dass die Verwaltung von Records auf gesetzlichen und/oder organisati-
onsinternen Vorschriften basiert.
13
Bei einem Dokument ist dies zunächst nicht der Fall.
Records sind demzufolge hinsichtlich ihrer Aufbewahrung, Zugriffskontrolle und ihrer
Vernichtung gesondert zu handhaben. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Kon-
trolle eines Dokuments vom jeweiligen Benutzer auf das Unternehmen übergehen
muss, sobald ein Dokument als Record deklariert wird: "Documents are owned by peo-
ple, but records are owned by organizations " (Schaffroth 2003b, S. 11).
Der Inhalt eines Records darf ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geändert werden und
wird nunmehr als so genannter permanenter Aktivposten behandelt, der aus rechtli-
chen Gründen und/oder auf Grund guter Geschäftspraktiken aufzubewahren ist (Do-
cumentum 2004).
2.2.2 Akten - Schriftgut
Gemäß Definitionsteil der DIN ISO 15489-1 (2002, S. 8) gibt es keine Unterscheidung
mehr zwischen Akten und Schriftgut, vielmehr umschreibt die Norm beides zusammen-
fassend
als Nachweise und/oder Informationen von Organisationen oder Perso-
nen aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtungen oder ihrer Geschäfts-
vorgänge erstellte, empfangene oder aufbewahrte Unterlagen.
In Anlehnung an diese Definition werden die Begriffe Akten, Schriftgut, Records sowie
Geschäftsunterlagen auch in dieser Arbeit synonym im Sinne moderner Records ver-
wendet.
2.2.3 Schriftgutverwaltung - Records Management
Analog zur Unterscheidung zwischen Schriftgut und Records ist auch eine Abgrenzung
zwischen klassischer Schriftgutverwaltung und modernem Records Management mög-
lich und gleichzeitig hilfreich für das Verständnis des neuen Ansatzes.
14
Auf einen kur-
zen Nenner gebracht, basiert Records Management im Grunde auf dem Erkennen,
Benennen und Beheben von Mängeln der traditionellen Schriftgutverwaltung bei
gleichzeitiger Nutzung ihrer Vorzüge.
13
Vgl. hierzu auch Kapitel 5 ff.
14
An dieser Stelle werden nur die wichtigsten Unterschiede genannt, nähere Informationen zu
den Eigenheiten des professionellen Records Managements behandelt Kapitel 4.
2 Grundlagen
22
Klassische Schriftgutverwaltung
Ein großes Handicap der klassischen Schriftgutverwaltung war und ist sicherlich ihr
schlechtes Image. Nach Schaffroth (1999b, S. 1) machen sowohl Unternehmen wie
auch öffentliche Verwaltungen bis heute den Fehler, dass sie diese Aufgabe vernach-
lässigen und die Schriftgutverwaltung dem Einzelnen überlassen. Eine systematische
Aufzeichnung erfolgt ebenso selten wie die planmäßige Bewirtschaftung der Unter-
lagen über den gesamten Geschäftszyklus. Zum Teil werden Geschäftsunterlagen oh-
ne Berücksichtigung administrativer oder gesetzlicher Auflagen vernichtet; das Gegen-
teil, nämlich alle Unterlagen mit einem "open end" zu versehen und bar jeder Systema-
tik aufzubewahren, kann gerade auch angesichts des dafür erforderlichen (Speicher-
)Platzbedarfs ebenfalls keine angemessene Lösung sein.
Die Folgen sind teils lästig, teils riskant: Unterlagen sind nur noch mit einem erheb-
lichen Suchaufwand oder schlimmstenfalls gar nicht mehr auffindbar, die Beweis-
qualität beim professionellen Records Management ist hier von Evidence die Rede
ist unzureichend und birgt erhebliche Geschäftsrisiken (ebenda).
Es wurde bereits angesprochen, dass der Zwang zum Umgang mit einer dramatisch
steigenden Menge an elektronischen und nicht-elektronischen Geschäftsunterlagen
zunimmt. Die Unterscheidung unternehmensrelevanter und nicht-relevanter Informa-
tionen wird immer mühsamer und zeitaufwändiger. So ist die in der klassischen
Schriftgutveraltung übliche, am jeweiligen Inhalt und Zweck orientierte Informations-
verwaltung ein sehr schwieriges Unterfangen geworden. Gerade auch die sich aus-
breitende Ablösung der traditionellen Ein- und Ausgangspost durch elektronische Mail-
systeme (kurz: E-Mail) sowie die Informationsverfügbarkeit über das Internet machen
allmählich ein Umdenken erforderlich und verlangen nach neuen Methoden.
Analog zur Aktenbildung bei der klassischen Schriftgutverwaltung behelfen sich die
meisten Unternehmen bislang, indem sie digital vorhandene Informationen ausdrucken
und in konventionelle Mitarbeiter- bzw. Abteilungsakten überführen. Im Hinblick auf die
zu bewältigende Masse an Informationen stellt sich jedoch zunehmend die Frage, wie
lange diese Vorgehensweise noch machbar sein wird bzw. welche Alternativen sich
bieten. Doch auch der umgekehrte Fall ist zumindest vorläufig als problematisch einzu-
stufen: Liegen Informationen ausschließlich in elektronischer Form vor, so ist damit zu
rechnen, dass diese auf Grund der sich rasant verändernden Technologien, Speicher-
formate und Medienträger eines Tages nicht mehr lesbar sein werden.
15
15
Vgl. hierzu auch Kapitel 3.3.3.
2 Grundlagen
23
Records Management
Auf welchen Medien auch immer Informationen bzw. Geschäftsunterlagen vorliegen:
Es muss in jedem Fall eine klare Strategie für deren Verwaltung und insbesondere
auch für deren Bewahrung geben. Des Rätsels Lösung kann demzufolge weder in der
klassischen papierorientierten noch zumindest vorläufig in einer ausschließlich digi-
talen Schriftgutverwaltung liegen. Papier dürfte zwar nach wie vor ein (wichtiger) Be-
standteil der Bürokommunikation bleiben, ergänzend müssen jedoch neue Methoden
entwickelt werden, um die wachsende Menge an digitalen Informationen zu verwalten.
Dieser Herausforderung lässt sich mit professionellem Records Management begeg-
nen. Wie bei der traditionellen Schriftgutverwaltung geht es hierbei zunächst darum,
die Spreu vom Weizen zu trennen und Geschäftsunterlagen nach ihrem Lebenszyklus
einzustufen. Auch hier ist es also das Ziel, relevante und nicht (längerfristig) relevante
Informationen differenziert zu betrachten, um sie entweder auszusondern oder gemäß
ihrer Relevanz aufbewahren zu können.
Im Unterschied zu bisher regelt Records Management die Aktenführung nicht nur par-
tiell, sondern organisationsweit und stellt somit eine Führungsaufgabe dar. Vor der
Einführung gilt es klare Regeln zu definieren und diese von entsprechenden Maß-
nahmen flankiert von oben nach unten zu kommunizieren und vor allem auch durch-
zusetzen.
16
Die in der deutschen Norm verwendete Bezeichnung Schriftgutverwaltung ist demnach
etwas unglücklich gewählt, da mit ihr keine fortschrittlichen Assoziationen verbunden
werden. Nur die wenigsten Führungskräfte dürften ohne vorherige Aufklärung ein inno-
vatives Konzept mit diesem doch recht altmodisch anmutenden Titel assoziieren.
Nichtsdestotrotz werden im weiteren Verlauf der Arbeit sowohl die deutschen wie auch
die englischen Begriffe synonym und im Sinne medienübergreifender Geschäftsunter-
lagen verwendet. Auch nach Zöller (2004, S. 12) führt der deutsche Titel insofern ein
wenig in die Irre. Für ihn umschließt Records Management nicht nur die Verwaltung,
sondern auch die Aufbewahrung von Daten und Dokumenten bzw. Aufzeichnungen.
Der wohl größte Vorteil im Vergleich zur klassischen Methode dürfte darin liegen, dass
Records Management nicht nur digitale Informationen, sondern auch auf Papier oder
auf anderen analogen Trägern vorliegende Unterlagen einer gemeinsamen Betrach-
tung unterzieht und auf die Verwaltung dieser so genannten hybriden Bestände abzielt.
Kommt hierfür spezielle Software zum Einsatz, so ist auch vom Elektronischen Re-
cords Management (ERM) die Rede (Kampffmeyer 2003b, S. 46).
Tabelle 1 zeigt die Unterschiede zwischen der klassischen Schriftgutverwaltung und
Records Management nach heutiger Auffassung in einer kurzen Gegenüberstellung.
17
16
Vgl. hierzu Kapitel 4 und hier insbesondere Abschnitt 4.6.
17
Die Tabelle stellt lediglich einen ersten Überblick dar. Auf weitere Kennzeichen des moder-
nen Records Management geht Kapitel 4 im Detail ein.
2 Grundlagen
24
Tabelle 1: Klassische Schriftgutverwaltung und modernes Records Management im
Vergleich
Kriterium
Klassische
Schriftgutverwaltung
Modernes
Records Management
Merkmal
Medienabhängigkeit Medienunabhängigkeit
Bestände
Papiergebundene Akten
Hybride Records
(digital / analog)
Softwareunterstützung
Kein Softwareeinsatz oder
klassische Schriftgutver-
waltungs-Systeme
Dokumenten-/ Records-
Management-Systeme
Findmittel
Ablagepläne
Aktenverzeichnisse
Findbücher
Aktenpläne
Klassifikationen
Metadaten
Bewertung +
Erschließung
Intellektuelle Bewertung
und Erschließung
Intellektuelle + automatische
Bewertung +
Erschließung
Regelungen
Außerhalb von Registratu-
ren häufig keine Vorgaben,
individuelles Vorgehen
Strenge zentrale Vorgaben
Bewirtschaftung
Retrospektive
Bewirtschaftung
18
Lebenszyklusorientierte
Bewirtschaftung
Organisationsinterne
Etablierung
Mitarbeiter- bzw. bereichs-
spezifische Aufgabe
Führungsaufgabe
Im Hinblick auf die Lässigkeit, mit der die Handhabung interner und externer Unter-
lagen bislang angegangen wurde, ist vor allem Überzeugungsarbeit von Nöten. Es
reicht nicht, dem "Kind" nur einen neuen Namen zu geben. Die Schriftgutverwaltung
muss ein neues Image bekommen. Dies wiederum setzt voraus, dass auf der Füh-
rungsebene ein grundlegendes Umdenken stattfindet. Dabei mag es in der Tat wir-
kungsvoller sein, diese Überzeugungsarbeit unter der erheblich innovativer klingenden
Bezeichnung Records Management anzugehen.
Für den Einstieg ist es hilfreich, Records Management anhand eines übergeordneten
Rahmens zu positionieren bzw. in eine übergeordnete Strategie einzubinden.
18
Unterlagen werden nach ihrer aktiven Phase ("Lebensende") rückwirkend bewirtschaftet.
3 Positionierung
25
3 Positionierung
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IuKT) bieten zweifelsohne
große Potenziale hinsichtlich der Informationsverwaltung. Auf der anderen Seite ver-
stärken sie ihrerseits die Zunahme der Informationsüberflutung auf dramatische Weise.
Abgesehen von sprachlichen Verständnisproblemen scheitern selbst Experten zuwei-
len an der enorm hohen Komplexität bestehender Konzepte und der ihnen zu Grunde
liegenden Technologien.
Auch das Records Management bildet hier keine Ausnahme um zu entscheiden, ob
es sich wieder nur um alten Wein in neuen Schläuchen handelt, ist es erforderlich, Re-
cords Management zunächst in einen größeren Zusammenhang zu stellen und es mit
übergeordneten Konzepten sowie angrenzenden Wissenschaftsdisziplinen und Tech-
nologien in Verbindung zu bringen. Denn wie alle Ansätze, die als Allheilmittel zur Be-
seitigung der negativen Begleiterscheinungen des Informationszeitalters propagiert
werden, stellt das Records Management keine isolierte Lösung oder ein für sich allein
stehendes Konzept dar, stattdessen lässt es sich aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachten.
3.1 Einbindung in übergeordnete Management-Konzepte
Records Management adressiert zunächst zwar die Aktenverwaltung, darüber hinaus
tangiert es aber auch die Organisation von Informationen und Wissen im Allgemeinen.
Zudem weist Records Management Berührungspunkte mit dem internen Qualitätsma-
nagement einer Organisation auf. Eine Abgrenzung zu den übergreifenden Konzepten
des Informationsmanagements (IM), des Wissensmanagements (WM) sowie des Qua-
litätsmanagements (QM) liegt also nahe.
3.1.1 Informationsmanagement
Eine erste Orientierung im Dickicht moderner Management-Konzepte bietet das Infor-
mationsmanagement. Verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen interpretieren es ent-
sprechend der jeweiligen Sichtweise. Hinter Informationsmanagement verbirgt sich
demzufolge eine beachtliche Reihe innovativer Ansätze und eine kaum mehr zu über-
blickende Vielfalt verschiedenster Technologien zur Bewältigung der Informationsflut.
Dennoch oder gerade deshalb eignet sich der IM-Ansatz gut als übergeordneter Rah-
men, um u. a. auch das Records Management zu positionieren.
Etwas verallgemeinernd formuliert, gehören zum Informationsmanagement letztlich alle
Strategien, Maßnahmen und Technologien, die den internen und externen Informa-
tionsfluss verbessern und somit Bestandteil einer übergeordneten IM-Strategie sind.
Informationsflüsse wiederum stehen in engem Zusammenhang mit den Geschäftspro-
zessen. Nach Schaffroth (1999a, S. 5) lassen sich Pannen und Informationslücken nur
3 Positionierung
26
vermeiden, "wenn der Informationsfluss im voraus klar geregelt und strukturiert ist". Für
die Dokumentation dieser Geschäftsprozesse bzw. Informationsflüsse genügt es aller-
dings nicht, lediglich den Inhalt bestimmter Dokumente bzw. Unterlagen festzuhalten
es bedarf zudem weiterer Metadaten
19
, damit Geschäftsunterlagen auch rückwirkend
nachvollziehbar sind. Geschäftsunterlagen als Nachweise betrieblicher Vorgänge ha-
ben folglich stets einen mehrdimensionalen Bezug, welcher für das spätere Rekon-
struieren der jeweiligen Vorgänge bzw. für die Recherche in diesen Geschäftsunterla-
gen relevant sind.
An dieser Stelle ist bietet sich eine weitere Abgrenzung an, die insbesondere im Hin-
blick auf das Verständnis von Records Management eine große Tragweite besitzt.
Informationsmanagement umfasst nach Schaffroth (1996, S. 19) zwei grundlegend
unterschiedliche Ansätze:
Themenorientiertes Informationsmanagement
Vorgangs- oder prozessorientiertes Informationsmanagement
Beim themenorientierten Ansatz geht es vorrangig darum, Informationssammlungen zu
bilden, die aus einzelnen, von Autoren verfassten Dokumenten bzw. Publikationen be-
stehen und die beispielsweise in Form von Datenbanken zur Verfügung gestellt wer-
den.
20
Die Suche in diesen Datenbanken erfolgt anhand formaler, inhaltlicher oder
thematischer Kriterien.
Demgegenüber stehen beim prozessorientierten Informationsmanagement die Ge-
schäftsvorgänge als solche sowie die dazu gehörigen Unterlagen im Mittelpunkt. Just
an diesem Punkt kommt das Records Management ins Spiel: Im Grunde handelt es
sich dabei um nichts anderes als um die Übertragung dieses Ansatzes auf die Organi-
sation von Geschäftsunterlagen in Form einer vorgangsbezogenen Aktenbildung (e-
benda). Prozessorientiertes Informationsmanagement rückt demzufolge den gesamten
Lebenszyklus von vorgangsrelevantem Schriftgut in den Blickwinkel, wobei der Erstel-
lung von Unterlagen insofern eine Schlüsselrolle zukommt, als die Qualität von Infor-
mation im Sinne von Geschäftsunterlagen bereits bei ihrem Erzeugungsprozess fest-
gelegt wird.
21
Im Gegensatz zur Sicherung der Informationsverfügbarkeit, bei der die Verteilung von
Unterlagen im Vordergrund steht, ist die Erstellungsphase deshalb gerade für die Ver-
waltung der Informationen von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund ist es rat-
sam, das betriebliche Informationsmanagement in die Geschäftsprozesse einer Orga-
nisation zu integrieren, wie dies auch beim Records Management der Fall ist
(Schaffroth 2002, S. 3).
19
Daten über Daten [Anm. d. Verf.]. Vgl. hierzu auch Kapitel 4.6.6.
20
Ein Beispiel sind die Literaturdatenbanken externer Datenbankanbieter.
21
Siehe hierzu auch Kapitel 4.5.1.
3 Positionierung
27
Vorgangsorientiertes Informationsmanagement unterstützt somit u. a. auch eine durch-
dachte Aktenführung und schafft auf diese Weise nicht nur die Basis für eine hohe In-
formationsqualität, sondern gleichzeitig die Voraussetzung für eine professionelle Ar-
chivierung von Geschäftsunterlagen am Ende ihres Lebens (ebenda, S. 5).
Die Qualität des Informationsmanagements als Gesamtkonzept lässt sich am besten
durch Führungsvorgaben regeln: Strategische, organisatorische sowie kulturelle Maß-
nahmen wirken willkürlichen Informationsflüssen und Geschäftsprozessen entgegen
und sorgen für Transparenz der gesamten IuK-Infrastruktur. Eine wichtige Vorausset-
zung hierfür ist die Informationskompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters, d. h. die Fä-
higkeit im Umgang mit Information entsprechend den externen Anforderungen und den
internen Zielsetzungen (Schaffroth 2003, S. 3). Diese Anforderungen und Ziele müssen
wiederum zunächst ermittelt und anschließend organisationsweit bekannt gemacht
werden.
Prozessorientiertes Informationsmanagement scheint ein viel versprechender Ansatz
zu sein in der Realität existieren allerdings bislang nur selten adäquate Infrastruktu-
ren, geschweige denn klare Vorgaben, an denen die Mitarbeiter einer Organisation
sich orientieren können. Stattdessen hat sich das betriebliche Informationsmanage-
ment im Zuge des rasanten technologischen Fortschrittes gerade auch in den privat-
wirtschaftlichen Unternehmen mehr oder minder willkürlich entwickelt. Häufig weisen
IM-Konzepte sofern vorhanden eine starke Techniklast auf. Dringend erforderlich
sind deshalb vor allem klare Strategien und entsprechende Reorganisations-
maßnahmen im Sinne einer Überprüfung und ggf. Anpassung der bestehenden Auf-
bau- und Ablauforganisation.
22
3.1.2 Wissensmanagement
Ähnlich wie dies beim Informationsmanagement und anderen Ansätzen der Fall ist,
lässt sich das Konzept des Wissensmanagements nicht ohne erheblichen Aufwand
begreifen.
23
Auch hier liegt die Schwierigkeit im fehlenden einheitlichen Verständnis,
was überhaupt unter Wissensmanagement zu verstehen ist. Es gibt unzählige Ab-
handlungen über dieses Gebiet, darunter auch Berichte über gescheiterte WM-Pro-
jekte. Sie belegen, dass Wissensmanagement kein Garant für den Erfolg einer Organi-
sation sein kann, wenn nicht ein schlüssiges Gesamtkonzept dahinter steht.
Das Wissen des einzelnen Mitarbeiters ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Ressour-
cen privater wie öffentlicher Organisationen wer sein Augenmerk auf die Dokumenta-
tion dieses individuellen Know-Hows richtet, sollte dies nicht als isolierten Prozess an-
gehen, sondern zuvor eine klare Strategie definieren, die auch andere Aspekte ein-
schließt. Unter diesem Aspekt gehört die Wissensbewahrung zu den Kernaufgaben
des Informationsmanagements und ist somit in dieses Konzept zu integrieren.
22
Siehe hierzu auch Kapitel 6.3.2.
23
Eine von zahlreichen Erklärungen findet sich im Glossar.
3 Positionierung
28
Wichtig im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit ist insbesondere, dass einige
Experten im Records Management gewissermaßen einen Wegbereiter für das Wis-
sensmanagement sehen. Nach Schaffroth (2003b, S. 6) besitzt Records Management
durchaus das Potenzial, u. a. auch bei der Wissensbewahrung dienlich zu sein, denn
die bei Geschäftsvorgängen in und mit RMS
24
generierten, gesicherten
und abgelegten Informationen (Records) sind Resultate von wissensba-
sierten Vorgängen (Entscheidungs-, Kommunikations- und Herstellungs-
prozesse) und stellen damit wichtige Wissensressourcen für zukünftige
Prozesse und Geschäftsanforderungen dar.
Für Tombs (2004, S.90) hingegen ist Wissensmanagement bereits ein Relikt aus der
Vergangenheit, während Records Management die Zukunft gehört. Seiner Erfahrung
nach obliegt die Federführung bei WM-Projekten viel zu häufig IT-Spezialisten, die von
sich denken, dass sie sowohl den Informationsbedarf wie auch das Nutzungsverhalten
der verschiedenen Geschäftsbereiche kennen, in Wirklichkeit aber weit davon entfernt
sind. In Tombs' Augen repräsentiert der RM-Ansatz das KISS-Leitbild
25
, welches ver-
spricht, mit vergleichsweise einfachen Mitteln und doch zielstrebig das Ziel einer ver-
besserten Informationsversorgung zu erreichen. Einen Siegeszug für Records Mana-
gement prophezeit Tombs gerade im Hinblick auf das Scheitern komplexer und kost-
spieliger WM-Projekte (ebenda, S. 92):
Possibly RM is filling a void left at an emotional level for senior manage-
ment, returning to fill KM's gap and promises to improve information pro-
vision.
Für andere Experten gehört Wissensmanagement und insbesondere die Bewahrung
des so genannten tacit knowledge also des impliziten Wissens
26
künftig zu den
Aufgaben des Records Managements, denn "capturing knowledge means recording
knowledge" (Sanderson 2001, S.14). Die besondere Herausforderung für den Records
Manager liegt hierbei einerseits in der Entwicklung und Verwaltung völlig neuer Typen
von Records, aber auch in einem frühzeitigen Eingreifen in den Entstehungsprozess
des Wissens (ebenda):
To meet the challenge, records managers may need to move away from
a reactive, traditionally centralised approach, as guardians of centralised
knowledge repositories, towards a more proactive, flexible, devolved,
and human focused approach.
24
RMS = Records-Management-System
25
KISS = Keep it simple and straightforward.
26
Schwer zugängliches, in den Köpfen der Mitarbeiter vorhandenes Wissen, im Gegensatz
zum expliziten, also dokumentierbaren Wissen.
3 Positionierung
29
Es verändert sich infolgedessen nicht nur die Rolle der traditionellen Schriftgutverwal-
ter als solche, sondern in ganz erheblichem Maße auch die Art ihrer Arbeit.
27
Unter
welchem Namen auch immer die Aufzeichnung und Bewahrung von Wissen realisiert
wird Records Management scheint auch in diesem Bereich einen nicht unerheblichen
Beitrag leisten zu können.
3.1.3 Qualitätsmanagement
Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist einer der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren für Unternehmen. Qualitätsmanagement, auch bekannt geworden unter dem
Schlagwort Total Quality Management (TQM), spielt deshalb eine große Rolle hinsicht-
lich der Wettbewerbsfähigkeit. Die meisten Organisationen verfügen inzwischen über
ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein. Nach außen hin drückt sich dies in einer Zertifi-
zierung gemäß den derzeit gültigen Qualitätsnormen aus.
28
Grundgedanke dieser Qualitätsnormen ist die schriftliche Dokumentation aller innerbe-
trieblichen Daten zu Produkten, Dienstleistungen, Abläufen sowie Geschäftspraktiken,
um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren.
Gründe für die zunehmende Wichtigkeit des Qualitätsmanagement sind u. a.:
Gesetzliche Auflagen
Schärferer Wettbewerb
Steigende Qualitätserwartungen des Kunden
Was hat Qualitätsmanagement nun wiederum mit Records Management zu tun? Dafür
gibt es eine recht einfache Erklärung: Im ersten Teil der bereits bekannten RM-Norm
ISO 14589 sind u. a. auch Leitlinien für die Schriftgutverwaltung enthalten. Sie geben
den Rahmen für einen Qualitätsverbesserungsprozess vor, damit dieser den gängigen
Qualitätsstandards entspricht. Hintergrund dafür ist der Gedanke, dass Schriftgut eine
wertvolle Ressource und ein wichtiges Betriebskapital darstellt. Unter anderem ge-
währleistet eine sorgfältig geführte Schriftgutverwaltung, dass Unternehmen ihre
Dienstleistungen mit gleichmäßiger Qualität erbringen können (DIN ISO 15489-1, S. 9).
Nach Wettengel (2001, S. 3) besitzt die ISO 15489 auf Grund der weltweiten Überein-
stimmung ein großes Gewicht:
Organisationen müssen diese Norm respektieren, wollen sie wettbe-
werbsfähig und seriös bleiben. Von besonderer Bedeutung ist dabei,
dass die Norm die Verantwortung der Leitungsebene für die Schriftgut-
verwaltung betont. Führungskräfte in Unternehmen und Behörden müs-
27
Vgl. hierzu die Erläuterungen in Kapitel 5. 5.
28
Gemeint sind hier die beiden QM-Normen "DIN EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme
Anforderungen " sowie "DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme Spezifikatio-
nen mit Anleitung zur Anwendung".
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832489427
- ISBN (Paperback)
- 9783838689425
- DOI
- 10.3239/9783832489427
- Dateigröße
- 952 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule der Medien Stuttgart – Fakultät Information und Kommunikation
- Erscheinungsdatum
- 2005 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- compliance schriftgut archiv informationsmanagement
- Produktsicherheit
- Diplom.de