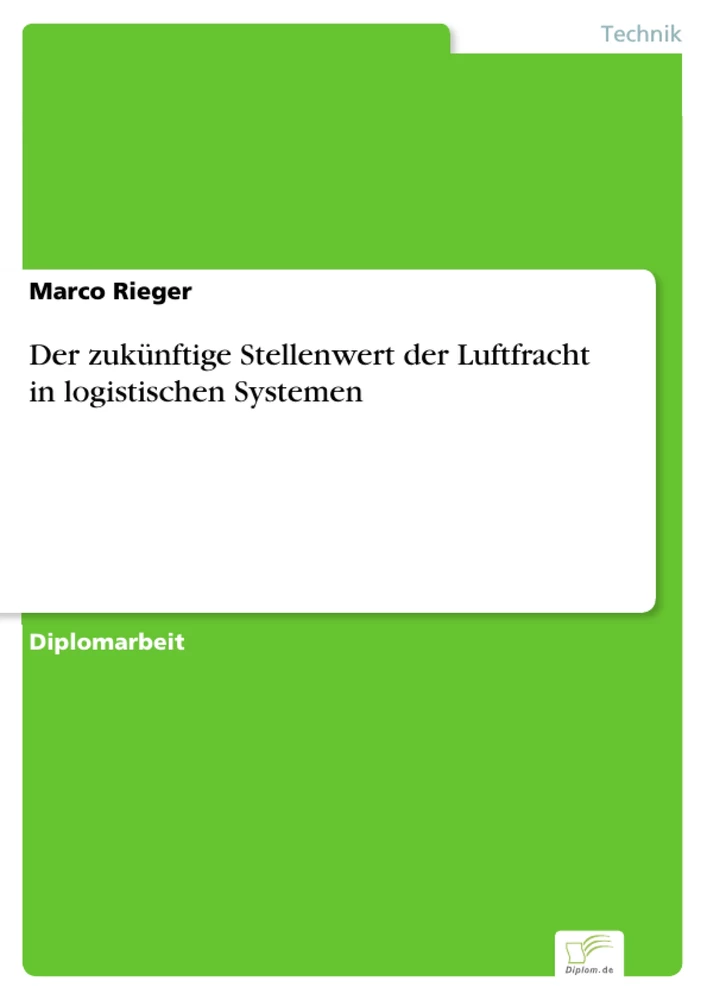Der zukünftige Stellenwert der Luftfracht in logistischen Systemen
©2005
Diplomarbeit
245 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Das Unternehmen Würth ist Weltmarktführer für Montagetechnik und stellt z.B. Schrauben, Dübel, Werkzeuge, Beschläge und vieles mehr her. Die Unternehmensgruppe bestand 2004 aus 300 Gesellschaften in der ganzen Welt. Die größte Gesellschaft ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG mit Sitz in Künzelsau. Von dem dort befindlichen Zentrallager aus werden die Gesellschaften der Unternehmensgruppe in der ganzen Welt mit Nachschub beliefert. Das Zentrallager hält ca. 70.000 Artikel im Sortiment, verfügt über mehr als 100.000 Palettenplätze und 70.000 Behälterstellplätze.
Für den Nachschub der Gesellschaften benutzt Würth alle Transportarten, einschließlich der Luftfracht. Diese wird als strategische Versandart eingesetzt, um einen möglichst maximal hohen Servicegrad aufrecht zu erhalten. Um einen Lager-Leerstand zu verhindern und die Produkte überall auf der Welt zu jeder Zeit verfügbar zu haben, ohne jedoch hohe Bestände vor Ort halten zu müssen, ist die Luftfracht bei der Würth GmbH & Co. KG ein integraler Bestandteil der Logistik. In fast 50 Länder bestehen Luftverkehre, die das Unternehmen mittels Hellmann Logistics und ABX Logistics abwickelt. Nahezu 500 Sendungen pro Jahr mit einem durchschnittlichen Gewicht von 500 Kg pro Sendung werden vom Unternehmen Würth ab dem Flughafen Frankfurt / Main per Luftfracht verschickt, zuzüglich den Expressluftfrachten. Dies ist nur ein Beispiel für ein Unternehmen von vielen international tätigen Unternehmen, welche die Luftfracht zum Transport ihrer Güter auf Märkte in andere Länder oder Kontinente nutzen.
In einer Pressemitteilung vom 02.10.2004 hieß es, dass das globale Luftfrachtaufkommen von DHL Danzas Air & Ocean, ein Logistiktochter-Unternehmen der Deutschen Post, von Anfang Januar 2004 bis Ende August 2004 um 23 Prozent gestiegen sei. Gründe für dieses Wachstum waren unter anderem die Tatsache, dass viele der von den Verladern aufgegebenen Sendungen im Vergleich zu 2003 beim Gewicht und in der Menge zugenommen hätten. Die Märkte in der Region Asien / Pazifik und speziell in China erwiesen sich für das Unternehmen als Wachstumsfaktor, während sich das Luftfrachtaufkommen in Europa stabilisiert habe, hieß es weiterhin.
In einer anderen Pressemitteilung vom Juni 2004 hieß es, dass das Unternehmen Birkart Globistics in 2004 in China drei neue Niederlassungen eröffnete. Das Unternehmen ist in der Abwicklung von Luft- und Seefracht tätig und bietet in China Distributionslogistik, […]
Das Unternehmen Würth ist Weltmarktführer für Montagetechnik und stellt z.B. Schrauben, Dübel, Werkzeuge, Beschläge und vieles mehr her. Die Unternehmensgruppe bestand 2004 aus 300 Gesellschaften in der ganzen Welt. Die größte Gesellschaft ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG mit Sitz in Künzelsau. Von dem dort befindlichen Zentrallager aus werden die Gesellschaften der Unternehmensgruppe in der ganzen Welt mit Nachschub beliefert. Das Zentrallager hält ca. 70.000 Artikel im Sortiment, verfügt über mehr als 100.000 Palettenplätze und 70.000 Behälterstellplätze.
Für den Nachschub der Gesellschaften benutzt Würth alle Transportarten, einschließlich der Luftfracht. Diese wird als strategische Versandart eingesetzt, um einen möglichst maximal hohen Servicegrad aufrecht zu erhalten. Um einen Lager-Leerstand zu verhindern und die Produkte überall auf der Welt zu jeder Zeit verfügbar zu haben, ohne jedoch hohe Bestände vor Ort halten zu müssen, ist die Luftfracht bei der Würth GmbH & Co. KG ein integraler Bestandteil der Logistik. In fast 50 Länder bestehen Luftverkehre, die das Unternehmen mittels Hellmann Logistics und ABX Logistics abwickelt. Nahezu 500 Sendungen pro Jahr mit einem durchschnittlichen Gewicht von 500 Kg pro Sendung werden vom Unternehmen Würth ab dem Flughafen Frankfurt / Main per Luftfracht verschickt, zuzüglich den Expressluftfrachten. Dies ist nur ein Beispiel für ein Unternehmen von vielen international tätigen Unternehmen, welche die Luftfracht zum Transport ihrer Güter auf Märkte in andere Länder oder Kontinente nutzen.
In einer Pressemitteilung vom 02.10.2004 hieß es, dass das globale Luftfrachtaufkommen von DHL Danzas Air & Ocean, ein Logistiktochter-Unternehmen der Deutschen Post, von Anfang Januar 2004 bis Ende August 2004 um 23 Prozent gestiegen sei. Gründe für dieses Wachstum waren unter anderem die Tatsache, dass viele der von den Verladern aufgegebenen Sendungen im Vergleich zu 2003 beim Gewicht und in der Menge zugenommen hätten. Die Märkte in der Region Asien / Pazifik und speziell in China erwiesen sich für das Unternehmen als Wachstumsfaktor, während sich das Luftfrachtaufkommen in Europa stabilisiert habe, hieß es weiterhin.
In einer anderen Pressemitteilung vom Juni 2004 hieß es, dass das Unternehmen Birkart Globistics in 2004 in China drei neue Niederlassungen eröffnete. Das Unternehmen ist in der Abwicklung von Luft- und Seefracht tätig und bietet in China Distributionslogistik, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8913
Rieger, Marco: Der zukünftige Stellenwert der Luftfracht in logistischen Systemen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Fachhochschule Flensburg, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Diplomarbeit
2
Danksagung
Ich möchte mich herzlich bei
Herrn Prof. Dr. Winfried Krieger FH Flensburg
bedanken, der mir die Bearbeitung dieses Themas vorgeschlagen und die
Betreuung dieser Diplomarbeit übernommen hat.
Hauneck, im Februar 2005
______________________
(Marco Rieger)
3
Eidesstattliche Versicherung
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig
verfasst und nur die angegebenen Quellen benutzt habe.
Hauneck, 10.Februar 2005
_____________________
(Marco Rieger)
4
Ich bin darüber informiert, dass die Fachhochschule Flensburg den Titel der
vorliegenden Diplomarbeit veröffentlicht.
Mit der Ausleihe und der Vervielfältigung meiner Diplomarbeit durch Dritte bin
ich nicht einverstanden.
Mit der Weitergabe meiner Anschrift an Dritte im Zusammenhang mit meiner
Diplomarbeit bin ich nicht einverstanden.
Meine Anschrift lautet:
Marco Rieger
Birkenstraße
6
36282
Hauneck
Hauneck, den 10. Februar 2005
___________________
(Marco Rieger)
5
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
8
2. Erläuterung von logistischen Systemen
12
3. Informationen bezüglich der Luftfracht
16
3.1.
Bedeutung
der
Luftfracht
16
3.2. Einflussfaktoren auf das Luftfrachtwachstum
20
3.3. Einteilung des Luftverkehrs
24
3.3.1. Zweckbestimmung des Luftverkehrs
25
3.3.2. Einteilung des Luftverkehrs nach dem Transportgut
26
3.3.3. Luftverkehr unter dem Aspekt der
eingesetzten Flugzeugtypen
27
3.3.4. Abgrenzung des Luftverkehrs nach der Streckenlänge
28
3.3.5. Luftverkehrseinteilung bezüglich der gewährten
Luftfreiheiten
29
3.3.6. Einteilung des Luftverkehrs nach der Regelmäßigkeit
31
3.3.7. Airport-to-Airport und Door-to-Door-Verkehre
32
3.4. Rechtliche Rahmenbedingungen des Luftverkehrs
33
3.5. Organisationen im Luftverkehr
36
3.5.1. Nationale Organisationen in Deutschland
37
3.5.2. Organisationen im europäischen Luftverkehr
39
3.5.3. Internationale Organisationen
41
3.6. Transporthilfsmittel und Transportmittel im Luftfrachtverkehr
43
3.6.1. Transporthilfsmittel
44
3.6.2. Transportmittel
46
3.6.2.1. Passagierflugzeuge mit Frachtraum
47
3.6.2.2. Frachtflugzeuge
48
3.6.2.3. Konventionelle Frachtflugzeuge
51
3.6.2.4. Spezial-Großraumflugzeuge
52
3.6.2.5. Die Idee des Cargolifters als Alternative
54
3.6.2.6. Transportmittel
am Flughafenterminal
56
3.6.3. Umschlag- und Lagereinrichtungen am Flughafenterminal
57
6
3.7. Möglichkeiten des kombinierten Verkehrs in der Luftfracht
59
3.8. Luftfrachtersatzverkehre
61
3.9. Sea- / Air-Verkehre
62
3.10.Die Struktur des Luftfrachtmarktes
65
3.10.1.Die
Angebotsstruktur
des Luftfrachtmarktes
65
3.10.1.1. Konventioneller Luftfrachtverkehr
66
3.10.1.2. Integratoren Luftfrachtdienstleistungen
aus einer Hand
71
3.10.2. Flughäfen und die Entwicklung von
Hub-and-Spoke-Systemen
76
3.10.3. Die bestehende Frachterflotte
83
3.10.4. Bedeutung von Zusammenarbeit / Zusammenschlüssen
im Luftverkehr
87
3.10.5. Neue Vertriebsformen in der Luftfracht
92
3.10.5.1. Das Business Partnership Programm
93
3.10.5.2. Die Time Definite Services
95
3.10.6. Kundenanforderungen im Luftfrachtmarkt
- Nachfrage nach Luftfracht
98
3.10.7. Die Politik
103
3.11. Organisation des Luftfrachtverkehrs
105
3.11.1.
Die
Luftfracht-
Supply-Chain
105
3.11.2. Abfertigung von Luftfrachtsendungen am Flughafenterminal 110
3.11.3. Der interne Transport
114
3.11.4.
Die
Lagerung
116
3.11.5. Problematiken bei der Abfertigung von Luftfrachtsendungen 117
3.12. Informations- und Kommunikationssysteme im Luftfrachtverkehr 118
3.12.1.
TRAXON
120
3.12.2. Tracking und Tracing
121
3.12.3. Internet und E-Commerce-Services in der Luftfracht
123
7
4. Luftfrachtvoraussagen bis zum Jahr 2022
128
4.1. Die Voraussagen des Flugzeugherstellers Boeing
128
4.1.1. Weltüberblick und voraussage
128
4.1.2. Regionale Ergebnisse
142
4.1.2.1. Nordamerika
142
4.1.2.2. Lateinamerika und Nordamerika
145
4.1.2.3. Europa
und
Nordamerika 149
4.1.2.4. Europa
intern
153
4.1.2.5. Der Mittlere Osten
157
4.1.2.6. Afrika
162
4.1.2.7. Asien und Nordamerika
167
4.1.2.8. Europa und Asien
170
4.1.2.9. Asien
intern
174
4.1.2.10. Südwestasien
179
4.1.2.11. Die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten (GUS) 183
4.1.2.12. China-Inland
189
4.1.3. Die zukünftige Entwicklung der Weltfrachterflotte
193
4.2. Voraussagen des Flugzeugherstellers Airbus
198
5. Zusammenfassung und Fazit
209
Abkürzungsverzeichnis 219
Abbildungsverzeichnis 222
Tabellenverzeichnis 226
Literaturverzeichnis 227
Anhang I-XII
8
1. Einleitung
Das Unternehmen Würth ist Weltmarktführer für Montagetechnik und stellt z.B.
Schrauben, Dübel, Werkzeuge, Beschläge und vieles mehr her. Die Unterneh-
mensgruppe bestand 2004 aus 300 Gesellschaften in der ganzen Welt. Die
größte Gesellschaft ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG mit Sitz in Künzelsau.
Von dem dort befindlichen Zentrallager aus werden die Gesellschaften der Un-
ternehmensgruppe in der ganzen Welt mit Nachschub beliefert. Das Zentralla-
ger hält ca. 70.000 Artikel im Sortiment, verfügt über mehr als 100.000 Palet-
tenplätze und 70.000 Behälterstellplätze. Für den Nachschub der Gesellschaf-
ten benutzt Würth alle Transportarten, einschließlich der Luftfracht. Diese wird
als strategische Versandart eingesetzt, um einen möglichst maximal hohen Ser-
vicegrad aufrecht zu erhalten. Um einen Lager-Leerstand zu verhindern und die
Produkte überall auf der Welt zu jeder Zeit verfügbar zu haben, ohne jedoch
hohe Bestände vor Ort halten zu müssen, ist die Luftfracht bei der Würth GmbH
& Co. KG ein integraler Bestandteil der Logistik. In fast 50 Länder bestehen
Luftverkehre, die das Unternehmen mittels Hellmann Logistics und ABX Lo-
gistics abwickelt. Nahezu 500 Sendungen pro Jahr mit einem durchschnittlichen
Gewicht von 500 Kg pro Sendung werden vom Unternehmen Würth ab dem
Flughafen Frankfurt / Main per Luftfracht verschickt, zuzüglich den Expressluft-
frachten.
1
Dies ist nur ein Beispiel für ein Unternehmen von vielen international
tätigen Unternehmen, welche die Luftfracht zum Transport ihrer Güter auf Märk-
te in andere Länder oder Kontinente nutzen.
2
In einer Pressemitteilung vom 02.10.2004 hieß es, dass das globale Luftfracht-
aufkommen von DHL Danzas Air & Ocean, ein Logistiktochter-Unternehmen
der Deutschen Post, von Anfang Januar 2004 bis Ende August 2004 um 23
Prozent gestiegen sei. Gründe für dieses Wachstum waren unter anderem die
Tatsache, dass viele der von den Verladern aufgegebenen Sendungen im Ver-
gleich zu 2003 beim Gewicht und in der Menge zugenommen hätten. Die Märk-
te in der Region Asien / Pazifik und speziell in China erwiesen sich für das Un-
1
Vgl.: o.V., Schrauben in alle Welt, vom 21.10.2004, unter:
http://planet-online.lufthansa-cargo.de/content.jsp?path=0,2,10783,11039
2
Eigener Text
9
ternehmen als Wachstumsfaktor, während sich das Luftfrachtaufkommen in
Europa stabilisiert habe, hieß es weiterhin.
3
In einer anderen Pressemitteilung vom Juni 2004 hieß es, dass das Unterneh-
men Birkart Globistics in 2004 in China drei neue Niederlassungen eröffnete.
Das Unternehmen ist in der Abwicklung von Luft- und Seefracht tätig und bietet
in China Distributionslogistik, Lagerhaltung und umfangreiche Value-added-
Services an.
4
Ein Presseartikel enthielt die Nachricht das beim Aushandeln neuer Verkehrs-
rechte für Frachterrouten nach China im Sommer 2003 seitens der U.S.-
Regierung die amerikanischen Beförderungsunternehmen gleich mehr als die
doppelte Anzahl der verfügbaren Flüge beantragte.
5
Im Oktober 2004 berichten die Medien von einem neuen Luftfracht
Distributionszentrum auf dem Flughafengelände von Shanghai-Pudong seitens
der deutschen Speditionsgruppe Hellmann, die sich von dem neuen Umschlag-
zentrum Wettbewerbsvorteile aufgrund des Standorts im zollfreien Gebiet des
Flughafens erhofft.
6
Doch würde ein Unternehmen an einem Flughafen in ei-
nem fremden Land rund fünf Millionen Euro für ein neues Distributionszentrum
investieren, wenn es nicht zukünftig ein deutlich höheres Frachtaufkommen in
dieser Region erwarten würde ? Was ist also der Grund für die vermehrten In-
vestitionen von speziell Logistikunternehmen der Luftfahrtbranche in der asiati-
schen Region oder von Investitionen im Luftfrachtbereich ? Wie wird die zukünf-
tige Entwicklung der Luftfracht seitens diverser Unternehmen für andere Regio-
nen der Welt außer China eingeschätzt und wie beurteilen Branchen-
Sachkundige die zukünftige Entwicklung?
7
3
Vgl.: o.V., Aufkommen legt bei DHL Danzas Air & Ocean zu, vom 22.10.2004, unter:
http://www.dvz.de/news/content.php?id=6651&qstring=&rubrik=Carrier4
4
Vgl.: o.V., Birkart eröffnet drei neue Niederlassungen in China, vom 28.10.2004, unter:
http://www.mylogistics.net/de/news/print_themen1.jsp?key=news137122
5
Vgl.: o.V., Luftfracht: Nordatlantik im Aufwind, vom 22.10.2004, unter:
http://www.dvz.de/news/content.php?objekt=dvz&rubrik=Carrier4&qstring=
6
Vgl.: o.V., Luftfracht:Hellmann stärkt China-Geschäft, vom 20.10.2004, unter:
http://www.dvz.de/news/content.php?id=6673&qstring=&rubrik=Carrier4
7
Eigener Text
10
Am 15. Juli 2004 wurde davon berichtet, dass die Fluggesellschaft Air France
Cargo eine stetig wachsende Tonnage auf den Direktflügen nach Mittelamerika
zu verzeichnen hat. Täglich fliegt ein Passagierjumbo und dreimal die Woche
ein Langstreckenfrachter B-747-400 ERF von Paris nach Mexiko-Stadt und zu-
rück. Der Frachtdirektor der französischen Fluggesellschaft, Philippe Suman,
berichtet von einem täglich vollen Frachtraum auf den Passagierflügen und ei-
ner Auslastung der Frachtflugzeuge von 70 bis 80 Prozent.
8
In einer Veröffentlichung vom Oktober 2004 wird angegeben, dass Boeing eine
Verdreifachung des Luftfracht-Aufkommens für die nächsten 20 Jahre prognos-
tiziert. Laut Boeing soll die weltweite Flotte von Frachtflugzeugen bis Ende 2023
von 1766 Flugzeugen auf 3456 Maschinen anwachsen. Während bei Boeing
vorrangig Modelle des Typs 747, 767,777,DC-10 und MD-11 als Frachtflugzeu-
ge genutzt werden, wird es bei Airbus die 300-Serie sein.
9
Scheinbar kommen zum Transport von Luftfracht neben Nurfrachtflugzeugen
auch Passagierflugzeuge zum Einsatz und es werden viele verschiedene Flug-
zeugmodelle eingesetzt. Welche Modelle eingesetzt werden, was für grundle-
gende Flugzeugarten zum Transport von Frachtgut von wem eingesetzt werden
und wie die Prognosen über das Luftfrachtwachstum der beiden führenden
Flugzeughersteller Boeing und Airbus genau aussehen, soll im folgenden näher
beleuchtet werden.
Diese Diplomarbeit hat das Ziel eine persönliche Einschätzung aufgrund ver-
schiedener Faktoren über den zukünftigen Stellenwert der Luftfracht in logisti-
schen Systemen abzugeben. Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel zu-
nächst logistische Systeme erläutert. In Kapitel drei soll ein umfangreicher Ü-
berblick über einige Aspekte der Luftfahrt im allgemeinen und der Luftfracht im
besonderen gegeben werden. Dabei sollen u.a. die Bedeutung der Luftfracht
und ihre Einflussfaktoren dargestellt, verschiedene Einteilungen des Luftver-
kehrs vorgenommen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und diversen Orga-
8
Vgl.: o.V., Air France Cargo legt Fokus auf Zentralamerika, vom 22.10.2004, unter:
http://www.dvz.de/news/content.php?id=6267&qstring=&rubrik=Carrier4
9
Vgl.: o.V., Welthandel:Luftfracht im Höhenrausch, vom 02.11.2004, unter:
http://www.diepresse.at/textversion_article.aspx?id=449709
11
nisationen im Luftverkehr untersucht, die Struktur des Luftfrachtmarktes soll
analysiert und die Organisation des Luftfrachtverkehrs dargestellt werden, um
letztlich einen Blick auf die eingesetzten Informations- und Kommunikationssys-
teme im Luftfrachtverkehr zu werfen. Kapitel vier ist dann ausschließlich den
Voraussageergebnissen für die Luftfracht seitens dem Unternehmen Boeing
und dem Unternehmen Airbus gewidmet. Kapitel fünf soll abschließend eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der zuvor erarbeiteten Punkte
und eine persönliche Einschätzung des zukünftigen Stellenwertes der Luftfracht
in logistischen Systemen liefern.
Die vollständige Unterkapitelauflistung ist bitte aus der Gliederung zu entneh-
men. Im Anhang sind abschließend noch einige die Informationen ergänzende
Tabellen vorzufinden.
10
10
Eigener Text
12
2. Erläuterung von logistischen Systemen
In Ökonomien können Systeme der Güterbereitstellung, -verteilung und
verwendung unterschieden werden.
Die Güterbereitstellung geschieht mittels Produktionsprozessen (Gewinnung,
Verarbeitung und Bearbeitung von Gütern) in Unternehmen der Industrie. Die
Güter erfahren hierbei eine qualitative Veränderung. Qualitative Veränderungen
erfolgen auch bei der Güterverwendung, wo Güter in Haushalten, Industrie-,
Handels- oder Dienstleistungsunternehmen durch Konsumtion verbraucht oder
benutzt bzw. abgenutzt werden.
Die Güterverteilung verbindet die Güterbereitstellung mit der Güterverwendung
durch Bewegungs- und Lagervorgänge, wodurch die Güter raum-zeitlich verän-
dert werden.
Systeme zur raum-zeitlichen Güterveränderung nennt man Logistiksysteme und
die in ihnen stattfindenden Prozesse Logistikprozesse. Diese laufen entweder in
sogenannten Logistikunternehmen ab, deren Unternehmenszweck die Raum-
und Zeitüberbrückung ist, oder in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsun-
ternehmen bei denen die beiden Funktionen nur eine Teilaufgabe zur Erfüllung
des eigentlichen Unternehmenszweckes ist. Durch Logistikprozesse entsteht
der Güterfluss, der das System der Güterbereitstellung mit dem System der
Güterverwendung verbindet. Alle drei Systeme sind Rahmenbedingungen un-
terworfen, die auf den Ablauf der Logistikprozesse einen mehr oder weniger
großen Einfluss ausüben, sodass diese sich demnach voneinander unterschei-
den, z.B. ein Land, wo die infrastrukturellen Bedingungen eine schnelle (per
Flugzeug) Güterverteilung ermöglicht hat einen anderen Ablauf von Logistikpro-
zessen als ein Land mit einer langsamen Güteverteilung (per Schiff).
Typisch für Logistiksysteme ist das Ineinandergreifen von Bewegungs- und La-
gerprozessen. Dies kann durch ein Netzwerk dargestellt werden, bei dem Kno-
ten durch Kanten verbunden sind. Man stellt sich jetzt gedanklich vor, dass Ob-
jekte (Energie, Sachgüter, Menschen oder Informationen) entlang der Netz-
werkverbindungslinien vom Anfangspunkt bis zu den Endpunkten bewegt wer-
den. An den Knoten werden die Objekte vorübergehend festgehalten (gespei-
13
chert) oder auf einen anderen durch das Netzwerk führenden Weg gelenkt. Die
diversen Verbindungen zwischen den Knoten (=Kanten) stellen die unterschied-
lichen Möglichkeiten dar, wie ein Objekt durch das Netzwerk bewegt werden
kann. Aufgrund des Netzwerk-Gedankens lassen sich folgende Grundstrukturen
von Logistiksystemen unterscheiden:
Abb. 1: Grundstrukturen von Logistiksystemen
Quelle: Pfohl, H.-Chr., Logistiksysteme; Springer Verlag; 7. Auflage; 2003, S.6
1. Das einstufige System ist dadurch gekennzeichnet, dass die Raum- und
Zeitüberbrückung durch einen direkten Güterfluss zwischen dem Liefer-
punkt, an dem die Güter bereitgestellt werden (=Quelle) und dem Emp-
fangspunkt, an dem die Güter verwendet werden (=Senke) erfolgt. Vor-
teil dieses Systems ist, dass der Güterfluss zwischen Liefer- und Emp-
fangspunkt nicht für zusätzliche Lager- und Bewegungsprozesse unter-
brochen wird.
2. In einem mehrstufigen System wird die Raum- und Zeitüberbrückung
durch einen indirekten Güterfluss zwischen Liefer- und Empfangspunkt
vollzogen. Der Güterfluss ist also wenigstens an einem weiteren Punkt
unterbrochen, an dem dann zusätzliche Lager- und Bewegungsprozesse
stattfinden. Durch den zusätzlichen Unterbrechungspunkt wird der Gü-
terfluss aufgelöst oder konzentriert. In einem Auflösungspunkt (= ,,break-
14
bulk point") treffen die Güter in großen Mengen von einem Lieferpunkt
ein. Dann verlassen sie ihn wieder in kleinen Mengen zu diversen Emp-
fangspunkten. Das Auflösen besteht entweder in einer Verkleinerung der
Mengen eines Gutes oder in einem Aussortieren, wenn der Güterfluss
von einem Lieferpunkt zu einem Auflösungspunkt sich also aus ver-
schiedenen Gütern zusammensetzt. Dieser heterogene Güterfluss wird
dann am Auflösungspunkt in mehrere kleinere homogene Güterflüsse zu
verschiedenen Empfangspunkten aufgelöst. Bei einem mehrstufigen
System kann der Unterbrechungspunkt aber auch ein Konzentrations-
punkt (="consolidation point") sein, in dem Güter gesammelt oder sorti-
mentiert werden. Beim Sammeln werden Güter in kleinen Mengen von
diversen Lieferpunkten im Konzentrationspunkt zu größeren homogenen
Einheiten zusammengefasst. Beim Sortimentieren werden die von ver-
schiedenen Lieferpunkten kommenden diversen Güter am Konzentrati-
onspunkt zu Sortimenten zusammengefasst. Die eingehenden Güter-
flüsse am Konzentrationspunkt sind also homogen, die an die Emp-
fangspunkte ausgehenden Güterflüsse sind heterogen.
3. Bestehen direkte und indirekte Güterflüsse nebeneinander, handelt es
sich um ein kombiniertes System.
Der Vorteil einstufiger Systeme ist die Vermeidung der an den Unterbrechungs-
punkten entstehenden weiteren Logistikprozesse. Voraussetzung ist jedoch ein
schneller Güterfluss bei zwischen Liefer- und Empfangspunkt herrschenden
großen Distanzen, um die Bedarfe am Empfangspunkt rechtzeitig befriedigen
zu können. Ist dies nicht möglich, müssen mehrstufige Systeme eingesetzt
werden. Neben der raum-zeitlichen Veränderung von Gütern mit der damit ver-
bundenen Mengen- und Sortenänderung der Güter gehört es auch zur Funktion
logistischer Systeme die genannten Arten der Gütertransformation zu erleich-
tern, was durch Transport-, Umschlags-, und Lagerprozesse, sowie Verpa-
ckungs- und Signierungsprozesse geschieht. Da jedoch der Güterfluss zwi-
schen Liefer- und Empfangspunkt nicht von allein fließt, müssen Informationen
15
zwischen beiden Punkten ausgetauscht werden. Diese lösen den Güterstrom
vorauseilend aus, begleiten ihn erläuternd und folgen ihm bestätigend oder
nicht bestätigend nach. Logistikprozesse bestehen deshalb aus Güterprozes-
sen und entsprechenden Informationsprozessen. Logistiksysteme erfüllen die-
se Informationsfunktion durch Auftragsübermittlungs- und Auftragsbearbei-
tungsprozesse.
11
11
Vgl. Pfohl, H.-Chr., Logistiksysteme, Springer Verlag; 7. Auflage; 2003, S. 3-9
16
3. Informationen bezüglich der Luftfracht
Aspekte der Luftfahrt im allgemeinen und der Luftfracht im besonderen werden
in diesem Kapitel näher erläutert.
3.1. Bedeutung der Luftfracht
Die Luftfracht wurde erst ab den 1960er Jahren bedeutsam. Zuvor wurde der
Luftverkehr primär zur Passagierbeförderung eingesetzt. Dem Luftfrachtverkehr
wirkten bis dahin auch geringe Ladekapazitäten und damit hohe Beförderungs-
kosten entgegen. Erst durch den Einsatz von Großraumflugzeugen und reinen
Frachtflugzeugen wurde die Luftfracht in den letzten 30 Jahren stärker bean-
sprucht und entwickelte sich von einem Kuppelprodukt zu einem Hauptprodukt
und damit festem Bestandteil weltweiter Logistikkonzepte (siehe Abbildung).
Abb. 2: Die Entwicklung des Luftfracht- und Luftpostaufkommens in Deutschland 1950-1999
Quelle: ADV-Jahresstatistik;Stuttgart;ADV(2000), unter:
http://www.fluglaerm.de/bvf/dairportconcept/dflughafenkonzept.htm#BUNDESREGIERUNG
Grundlage des Luftfrachtwachstums waren neben der technischen Weiterent-
wicklung des Fluggeräts auch neue Beschaffungs- und Absatzkonzepte von
Handel und Industrie. Die Globalisierung der Märkte ermöglicht eine weltweite
Beschaffung, Produktion und Absatz von Waren, wobei Luftfrachtverbindungen
Produktionsstätten in verschiedenen Ländern nach dem ,,Just-in-Time"-Prinzip
versorgen können. Für die sich ständig optimierenden Industrie- und Handels-
17
systeme, die damit verbundene Globalität der Beschaffungs- und Distributions-
netzwerke und die Auswirkungen neuer Informations- und Kommunikations-
technologien wird ein schneller und effizienter Verkehrsträger erforderlich. Viele
Verlader nutzen deshalb besonders für interkontinentalen Transport den Luft-
frachtverkehr aufgrund seiner Schnelligkeit,
Pünktlichkeit, Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Frequenzdichte. Mit dem Luftfrachtverkehr kann auch hochwertigen
und zeitempfindlichen Gütern in geringen Mengen optimal Rechnung getragen
werden. Wie sehr sich die Luftfracht etabliert hat, zeigt folgende Abbildung:
Abb. 3: Das Luftfrachtaufkommen nach Verkehrsgebieten im Jahr 2000
Quelle: in Anlehnung an Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht; Huss Verlag;2.Auflage;2002, S.2
Ein steigendes Frachtaufkommen kann nicht mehr nur durch Kapazitätserhö-
hungen bewältigt werden, sondern auch durch ständige Qualitätsverbesserun-
gen der Dienstleistung ,,Luftfracht". Diese kann in naher Zukunft nicht mehr nur
durch größere Frachtflugzeuge oder den Einsatz einer erhöhten Anzahl von
Flugzeugen erreicht werden, sondern vielmehr durch eine Optimierung der Or-
ganisation der Luftfrachtabwicklung. Hierzu sei insbesondere eine erhöhte Nut-
zung integrierter Transportketten von Versender zu Empfänger mittels der Nut-
zung von Paletten und Containern genannt, sowie verbesserte Informationssys-
teme. Diese lassen die Schnittstellen schneller überwinden und schöpfen die
Schnelligkeit des Lufttransports besser aus.
18
Die Deutsche Lufthansa sieht folgende Entwicklung für den Luftfracht-Logistik-
Markt voraus:
Abb. 4: Die Zukunft des Air Logistics Marktes
Quelle: Grandjot, H-H.,Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag;2.Auflage;2002, S.5
Die Deutsche Lufthansa veröffentlichte 2002 eine Vorschau auf die Perspekti-
ven des internationalen Luftfrachtmarktes mit dem Wachstum der Luftfracht-
segmente General Cargo, Express Cargo und Special Cargo. Aus folgender
Abbildung kann man entnehmen, welche Art von Luftfracht den Markt zukünftig
antreiben wird:
Abb. 5: Die Veränderung der Luftfrachtsegmente
Quelle: Grandjot, H-H.,Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag;2.Auflage;2002, S.6
19
Der Luftfrachtmarkt wird laut dieser Prognose durchschnittlich 1,8 Prozent pro
Jahr und von 2006 bis 2010 um durchschnittlich 5,7 Prozent pro Jahr wachsen.
Das Wachstum der einzelnen Luftfrachtsegmente wird von 2001 bis 2007 un-
terschiedlich prognostiziert. General Cargo wird durchschnittlich 1,3 Prozent,
Express Cargo 12,0 Prozent und Special Cargo 10,0 Prozent pro Jahr wach-
sen. Während die Marktanteile von General Cargo also sinken werden, werden
die Marktanteile von Express Cargo und Special Cargo zunehmen.
12
12
Vgl. Grandjot, H-H.,Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag;2.Auflage;2002, S.1-6
20
3.2. Einflussfaktoren auf das Luftfrachtwachstum
Die Weltluftfrachtentwicklung wird hauptsächlich durch die wirtschaftliche Aktivi-
tät beeinflusst, die in Form des BIP-Wachstums für eine bestimmte Region oder
die gesamte Welt gemessen wird.
Aber auch Aktivitäten von Fluggesellschaften beeinflussen die Entwicklung der
Weltluftfracht, wie z.B. die Akquisition von Flugzeugen und die Ausdehnung des
Service, die besonders günstige Auswirkungen auf den Express- und Klein-
päckchenmarkt hatten.
Faktoren jenseits der Kontrolle von Fluggesellschaften die eine bedeutende
Rolle für das Luftfrachtwachstum spielen sind das Bestandsmanagement,
Techniken, die Globalisierung, die Marktliberalisierung, nationale Entwicklungs-
programme, die anhaltende Einführung neuer für den Lufttransport geeigneter
Güter, die Export-Werbung, neue Handelsbeziehungen, der Ölpreis und die
Ölverfügbarkeit, Deregulierungen, der Expressmarkt, ,,Just-in-time"-Konzepte,
die Zunahme belieferter Regionen, die Auslastung der Spediteure und Verlader
und die Ausbildung der Spediteure, die Marktforschung der Fluggesellschaften
und neue Flugzeugkonstruktionen wie Großraumflugzeuge (,,widebodies"),
Kombi-Frachter und Unterdeck-Stauraum-Gestaltung bei Passagiermaschinen.
Beschränkungen für das Wachstum entstehen hauptsächlich außerhalb der
Airline-Industrie und können das Industriewachstum ebenso behindern. Be-
schränkungen sind z.B. Handelsquoten und verbote, die Neubewertung von
Währungen, Flächen-Arbeits-Ausfälle, die Neuverhandlung beidseitiger Verträ-
ge, Flughafen-Betriebszeiten, der Wettbewerb beim Bodentransport, die Un-
ausgeglichenheit der Güterflüsse zwischen zwei Ländern oder die Verlagerung
von Industriestandorten. Verschiedene Kunden der Lufttransportindustrie und
Politiker sprechen diese Einflussfaktoren immer wieder an mit der Absicht das
Luftfrachtwachstum zu fördern. Verschiedene Punkte, die das weltweite Wirt-
schaftswachstum beeinflussen, können für die Luftfrachtindustrie als günstig
oder ungünstig angesehen werden. Günstig für die Luftfrachtindustrie sind die
asiatische Marktausdehnung, stabile Währungen, Stabilität im Mittleren Osten,
nationale Schuldenmanagementpläne, Übereinkünfte bezüglich der Ölvermark-
21
tung und nachlassende Zinsen. Ungünstig für die Luftfahrtindustrie sind Han-
delsblöcke und Protektionismus, Terrorismus und bewaffnete Konflikte, politi-
sche Unbeständigkeiten, Güterpreisschwankungen, hohe Zinsen und Schul-
denbelastungen.
13
Die vorgenannten Einflussfaktoren auf das Luftfrachtwachs-
tum können aus folgender Abbildung ersehen werden:
Abb. 6: Einflussfaktoren auf das Luftfrachtwachstum
Quelle: The Boeing Company, World Air Cargo Forecast 2004/2005, unter:
http://www.boeing.com/commercial/cargo/WACF_2004-2005.pdf , S.10
vom 20.10.2004
13
Vgl. The Boeing Company, World Air Cargo Forecast 2004/2005, unter:
http://www.boeing.com/commercial/cargo/WACF_2004-2005.pdf , S.10 vom 20.10.2004
22
Gemäß vieler Presseberichte besteht besonders in Deutschland die Thematik
des Nachtflugverbots. Diese Thematik kann einerseits die Deregulierung als
Wachstumsfaktor für das Luftfrachtwachstum berühren, andererseits aber auch
die Flughafen-Betriebszeiten (,,airport curfews"), die das Luftfrachtwachstum
wiederum beschränken.
14
In der Öffentlichkeit werden oft Forderungen nach
weiteren Nachtflugbeschränkungen bis hin zum totalen Nachtflugverbot über
Deutschland wegen der Fluglärmbelästigung seitens der Anlieger von Flughä-
fen laut. Trotzdem ist der Nachtflug ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und für
das Bestehen der Globalisierungsanforderungen unverzichtbar (besonders für
internationale Expressdienstleistungsunternehmen), bringt er doch für Unter-
nehmen erhebliche Zeit- und Kostenvorteile und sichert das wirtschaftliche
Wachstum eines Landes weiterhin ab. Flughäfen in Hamburg, Berlin, Frankfurt,
Hannover, Köln / Bonn, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart sind ange-
schlossen an die von den Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Interna-
tionaler Express- und Kurierdienste eingerichteten europäischen Luftverkehrs-
drehkreuze in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und
Spanien welche diese über hunderte nächtlicher Flüge mit Zielflughäfen auf der
ganzen Welt verbinden. Diese Übernacht-Beförderungen tragen wesentlich zu
der Möglichkeit von JIT-Lieferungen bei und haben durch zusätzliches Fracht-
aufkommen auch positive Effekte auf die Arbeitsplätze an Flughäfen und in de-
ren Umgebung. Wegen der Fluglärmproblematik soll an einigen Flughäfen bei-
spielsweise der ,,Balanced Approach" verfolgt werden, der vor der Einführung
von Betriebsbeschränkungen für Flughäfen zunächst mögliche Verbesserungen
durch die Überprüfung einiger Maßnahmen vorsieht.
15
Am Flughafen München
beispielsweise bestehen Regelungen, dass zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr
keine zusätzliche Flugverbindung mehr aufgenommen werden kann, was den
Flughafen München im Wettbewerb, seine Arbeitsplätze und die Wirtschaft der
ganzen Region erheblich gefährdet. Daher ist eine Änderung der Nachtflugre-
14
Eigener Text
15
Vgl. Detering, Uwe, Expressfracht ist Nachtfracht, unter:
http://www.biek.de/3/5/Internetseite_luftverkehr_1.htm , vom 28.10.2004
23
gelung von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr und von 5.00 Uhr bis 6.00 Uhr beantragt
worden, um diese Nachteile abzuwenden.
16
16
Vgl. o.V., Änderung der Nachtflugregelung sichert Arbeitsplätze, vom 01.11.2004,unter:
http://www.goed-bayern.de/Bereiche/Flughafen/Nachtflugverbot/body_nachtflugverbot...
24
3.3. Einteilung des Luftverkehrs
Luftverkehr soll die Gesamtheit aller Vorgänge sein, die der Ortsveränderung
von Personen, Fracht und Post auf dem Luftweg dienen. Dabei kann der Luft-
verkehr nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:
Abb. 7: Funktionsdiagramm des Luftverkehrs
Quelle: Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.8
Transportart
Zweckbestimmung
Flugzeugart
Streckenlänge
Verkehrsfreiheit
Leistungsspektrum
Regelmäßigkeit
Airport-to-Airport /
Door-to-Door- / son-
stige Produkte
Linien - / Charter-
verkehr
1. 9. Freiheit
Kurz- / Mittel- /
Langstreckenverkehr
Nutzfrachter- /
Belly- Flugzeuge
Personen /Fracht
/Post
Gewerblich /
Nichtgewerblich
Luftverkehr
25
3.3.1. Zweckbestimmung des Luftverkehrs
Der Luftverkehr kann in gewerblichen und nichtgewerblichen Luftverkehr einge-
teilt werden. Gewerblicher Luftverkehr ist die Beförderung von Fluggeräten,
Fracht oder Post gegen Entgelt. Der nichtgewerbliche Flugverkehr ist die un-
entgeltliche Beförderung von Fluggeräten, Fracht oder Post.
26
3.3.2. Einteilung des Luftverkehrs nach dem Transportgut
Man unterteilt den Luftverkehr in Personen-, Fracht- bzw. Post- und Mischflug-
gesellschaften. Personenfluggesellschaften sind Linien- oder Charterfluggesell-
schaften, die nur Personen und deren Reisegepäck bzw. Fracht befördern.
Transportiert eine Luftverkehrsgesellschaft überwiegend Fracht bzw. Post, so
wird sie als Fracht- bzw. Postgesellschaft bezeichnet. Die meisten Fluggesell-
schaften sind als Mischgesellschaften tätig. Bei diesen kann die Fracht ein Ne-
benprodukt oder ein Hauptprodukt sein. Ist die Fracht nur ein Nebenprodukt, ist
die angebotene Frachtkapazität meistens vom Auslastungsgrad des Flugzeu-
ges durch die Passage abhängig. Stellt die Fracht ein Hauptprodukt dar, ist der
Geschäftsbereich der Fracht meist von dem der Passage getrennt. Der Fracht-
abteilung sind dann häufig eigene Abfertigungsanlagen sowie eine eigene Mar-
keting- und Verkaufsorganisation untergeordnet. Beispielsweise spaltete sich
die Lufthansa Frachtorganisation von der Passage ab und gründete zum
01.01.1995 die Lufthansa Cargo AG, um die Kosten zu senken und den Fracht-
bereich flexibler und eigenständiger zu organisieren.
27
3.3.3. Luftverkehr unter dem Aspekt der eingesetzten Flugzeugtypen
Luftverkehrsgesellschaften, die Passagiere befördern, setzen hauptsächlich
Passagierflugzeuge ein, welche die Passagiere im Hauptdeck (main deck) be-
fördern und das Passagiergepäck und zusätzliche Fracht im Unterflurfracht-
raum (lower deck). Solche Flugzeuge nennt man auch Belly-Flugzeuge, da sie
die Fracht im ,,Bauch" (=belly) des Flugzeuges befördern. Für die Luftverkehrs-
gesellschaften ist der zusätzliche Belly-Frachtraum vor allem zum Ausgleich
steigender Betriebskosten und sinkender Tarife im Passagierverkehr dienlich.
Es ist anzunehmen, dass Passagierflüge zwischen Kontinenten heute ohne die
zusätzlichen Einnahmen aus der Belly-Fracht keine Gewinne abwerfen. Luft-
verkehrsgesellschaften, für die die Luftfracht ein Hauptprodukt darstellt, setzen
Belly-Flugzeuge und Nutzfrachter-Flugzeuge ein, bei denen das Main Deck und
das Lower Deck zu reinen Frachträumen umgebaut sind und die daher nur
Fracht befördern. Kombi-Flugzeuge stellen eine Zwischenform der Flugzeugty-
pen dar. Diese stellen sowohl Frachtraum im Lower Deck, als auch Frachtraum
im hinteren Teil des Main Decks bereit. Der Frachtraum im Main Deck wird da-
bei durch stabile Netze vom vorderen Passagierteil getrennt.
28
3.3.4. Abgrenzung des Luftverkehrs nach der Streckenlänge
Hier unterscheidet man Kurz-, Mittel- und Langstreckenverkehre. Es bestehen
jedoch verschiedene Definitionen, die aber lediglich Einteilungsmöglichkeiten
darstellen und nicht verbindlich sind. Nach der Definition von Porger zählen
zum Kurzstreckenverkehr Strecken zwischen 400 und 1000 Km Länge, zum
Mittelstreckenverkehr Strecken zwischen 1.000 und 2.000 Km Länge und zum
Langstreckenverkehr Strecken über 2.000 Km Länge. Hunziker definiert den
Kurzstreckenverkehr bis 2.000 Km, den Mittelstreckenverkehr von 2.000 bis
5.000 Km und den Langstreckenverkehr über 5.000 Km.
29
3.3.5. Luftverkehrseinteilung bezüglich der gewährten Verkehrsfreiheiten
Im Bereich des internationalen Luftverkehrs sind die diversen Überflug- und
Landerechte, die sich einzelne Länder gegenseitig einräumen (= Verkehrs-
freiheiten) bedeutsam. Die ersten fünf Freiheiten wurden bereits 1944 im Chi-
cagoer Abkommen festgelegt, wobei für die Vertragsstaaten dieses Abkom-
mens nur die ersten beiden Freiheiten der Luft allgemein gültig sind. Die restli-
chen drei Freiheiten können von einzelnen Ländern beliebig in bilateralen Ab-
kommen festgelegt werden. Nach dem Chicagoer Abkommen wurden noch die
sechste bis achte Freiheit aufgestellt, die jedoch nicht offiziell anerkannt sind. In
der EU darf jede Luftverkehrsgesellschaft innerhalb des EU-Gebietes Flüge der
fünften Freiheit durchführen. Das Recht Passagiere, Fracht und Post von einem
Platz zu einem zweiten innerhalb des gleichen staatlichen Hoheitsgebietes zu
befördern, ist für alle EU-Luftverkehrsgesellschaften innerhalb der EU ab
01.04.1997 eingeführt worden. Zur Erläuterung der Freiheiten der Luft dienen
folgende Abbildungen:
Abb. 8: Die Verkehrsfreiheiten im Luftverkehr
Quelle: Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.12
1. Freiheit
Das Recht, das Hoheitsgebiet eines fremden Landes zu überfliegen.
2. Freiheit
Das Recht, einen technischen Zwischenstopp in einem fremden Land einzulegen.
3. Freiheit
Das Recht, Passagiere vom Heimatland in ein fremdes Land zu befördern.
4. Freiheit
Das Recht, Passagiere von einem fremden Land in das Heimatland zu befördern.
5. Freiheit
Das Recht, Passagiere zwischen zwei fremden Ländern zu befördern, sofern der Ausgangs- bzw.
Endpunkt der Flugroute im Heimatland liegt.
6. Freiheit
Das Recht, Passagiere zwischen zwei fremden Ländern mit Zwischenstopp im Heimatland zu be-
fördern.
7. Freiheit
Das Recht, Passagiere zwischen zwei fremden Ländern zu befördern.
8. Freiheit (cabotage)
Das Recht, Passagiere innerhalb eines fremden Landes zu befördern, sofern der Ausgangs- bzw.
Endpunkt der Flugroute im Heimatland liegt.
9. Freiheit (stand-alone-cabotage)
Das Recht, Passagiere innerhalb eines fremden Landes zu befördern.
True Domestic
Das Recht, Passagiere innerhalb des eigenen Landes zu befördern.
30
Abb. 9: Freiheiten der Luft
Quelle: Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.13
Heimat-
staat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TD
31
3.3.6. Einteilung des Luftverkehrs nach der Regelmäßigkeit
Hierbei unterscheidet man zwischen Linien-, und Charterluftverkehr, die beide
im Chicagoer Abkommen von 1944 definiert wurden. Der Linienluftverkehr ist
der gesamte planmäßige Luftverkehr, der von Luftfahrzeugen für die öffentliche
Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post durchgeführt wird. Er ist durch
folgende Punkte gekennzeichnet: Gewerbsmäßigkeit, Öffentlichkeit, Regelmä-
ßigkeit, Linienbindung, Betriebspflicht, Beförderungspflicht, Tarifpflicht. Der
Charterverkehr ist als Verkehr, der nicht zum planmäßigen Verkehr gezählt
wird, definiert. Dabei wird ein Flugzeug von der Luftverkehrsgesellschaft einem
Mieter (Charterer) für einen bestimmten Flug, eine bestimmte Zeit oder einen
bestimmten Preis überlassen. Das Risiko der Auslastung wird damit von dem
Beförderungsunternehmen auf den Mieter übertragen. Der Charterluftverkehr ist
wiederum in Vollcharter- und Splitcharterluftverkehr eingeteilt. Beim Vollcharter-
flug nutzt der Charterer den gesamten Laderaum eines Flugzeuges zur Beför-
derung eigener oder fremder Güter für eigene Zwecke. Bei einem Splitcharter-
flug wird der Laderaum auf mehrere Charterer vertraglich aufgeteilt. Deren
Fracht darf jedoch ein tatsächliches Gewicht von 500 Kg nicht unterschreiten.
32
3.3.7. Airport-to-Airport- und Door-to-Door-Verkehre
Normalerweise führen Luftverkehrsgesellschaften Airport-to-Airport-Verkehre
durch, welche ausschließlich eine Luftbeförderungsleistung von Flughafen A
nach Flughafen B beinhaltet. Die Luftverkehrsgesellschaft fungiert dabei nur als
Frachtführer. Die Organisation des Vor- und Nachlaufs und die Nebenleistun-
gen nimmt meist ein vom Versender beauftragter Spediteur wahr. Viele Luftver-
kehrsgesellschaften bieten auch zunehmend Door-to-Door-Verkehre an. Dabei
führt die Luftverkehrsgesellschaft oder der Integratordienst die Transportleis-
tung und alle weiteren nötigen Dienstleistungen aus, um die Ware an den Emp-
fänger auszuliefern. Luftverkehrsgesellschaften erreichen dies durch feste Zu-
sammenarbeit mit Spediteuren. Integratordienste hingegen führen die gesamte
Dienstleistung vom Versender bis zum Empfänger selber aus.
17
Ein Beispiel für
solch einen Integratordienst bietet die Schenker Deutschland AG Deutsch-
lands führender Dienstleister für integrierte Logistik. Sie baute einen eigenen
Shanghai-Express auf, um den Kundenwünschen nach Door-to-Door-
Belieferungen zu dienen. Mit einer festen Charterverbindung liefert das Unter-
nehmen mit einer DC-10 40F zweimal wöchentlich Güter ab Frankfurt / Hahn in
die chinesische Stadt und transportiert am Rückflug Güter zum Flughafen
Hahn. Eine direkte Zustellung von Sendungen direkt ans Montageband kann
auf diese Weise gewährleistet werden, da die Vorläufe zum Flughafen und die
Weiterverteilung ab Flughafen von der Schenker AG perfekt organisiert werden.
Außerdem werden per Flugzeug Anschlussverbindungen ohne Zeitverlust gesi-
chert, so das dieser Door-to-Door-Verkehr innerhalb eines globalen Logistik-
Netzwerkes funktioniert.
18
17
Vgl. Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.8-14
18
Vgl. Obst,Michael, Globales Netzwerk von Haus zu Haus, vom 02.11.2004, unter:
http://www.industrienet.de/O/125/Y/84557/VI/30249620/default.aspx?O=125&Y=8455...
33
3.4. Rechtliche Rahmenbedingungen des Luftverkehrs
Abb. 10: Rechtsvorschriften im Luftverkehr
Quelle: Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.15
Aus obigem Schaubild sind die Rechtsvorschriften ersichtlich, die im Luftver-
kehr gelten.
Das nationale Recht regelt den Luftverkehr innerhalb Deutschlands und betrifft
den internationalen Luftverkehr mit Staaten, deren Verkehre nicht durch ein in-
ternationales Abkommen geregelt sind. Besondere Bedeutung haben das Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG), die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) und die Luftver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO). Weniger bedeutsam sind das Gesetz
über das Luftfahrt-Bundesamt (LBA-Gesetz), die Verordnung über die Betriebs-
dienste der Flugsicherung (FSBetrV) und die Verordnung über die Durchfüh-
rung der Flugplan-koordinierung (FPKV).
34
Das Luftverkehrsgesetz regelt hauptsächlich unter welchen Bedingungen Luft-
verkehr stattfinden darf und Flughäfen und Luftfahrtunternehmen betrieben
werden dürfen. Weiterhin werden Regeln zur Betriebs- und Beförderungspflicht
für Luftfahrtunternehmen, zur Kabotage und zur Haftpflicht der Luftfahrtunter-
nehmen, Straf- und Bußgeldvorschriften, Regelungen zu Luftfahrtdateien und
Übergangsregelungen aufgestellt.
Die Luftverkehrs-Ordnung befasst sich mit den Regeln im Luftverkehr und den
Rechten und Pflichten dessen Teilnehmer.
Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung enthält Regelungen über das Luftfahrt-
gerät, das Luftfahrtpersonal, die Zulassung von Flugplätzen und der Zulassung
von Luftfahrtunternehmen.
Das supranationale Recht regelt den Luftverkehr innerhalb des Gemeinschafts-
gebietes der EU und den Luftverkehr zwischen den Signaturstaaten. Im supra-
nationalen Luftverkehrsrecht sind vor allem Verordnungen, Richtlinien und mul-
tilaterale Abkommen zwischen den Mitgliedern bedeutsam. Die von der EU er-
arbeiteten Verordnungen und Richtlinien gelten für alle Mitgliedsländer als bin-
dendes Recht. Richtlinien geben Ziele vor und überlassen es den Mitgliedsstaa-
ten, diese in national gültiges Recht zu übertragen. Richtlinien und Verordnun-
gen sind für alle Mitgliedsstaaten der EU bindend. Die multilateralen europäi-
schen Abkommen hingegen sind nur für die Mitgliedsstaaten bindend, die sie
auch unterzeichneten.
Das internationale Luftverkehrsrecht regelt den Luftverkehr zwischen den Sig-
naturstaaten. Deutschland hat mit insgesamt 77 Staaten bilaterale Abkommen
unterzeichnet. Darin räumen sich die Vertragspartner vor allem Überflugs-,
Lande- und Beförderungsrechte ein und es werden Haftungsfragen geregelt.
Bei den multilateralen Abkommen wäre zuerst das Chicagoer Abkommen über
die Internationale Zivilluftfahrt von 1944 zu nennen. Darin werden die gegen-
seitige Anerkennung der Lufthoheit eines jeden Landes über seinem Hoheits-
gebiet, Kabotageverbote, die Gleichberechtigung aller Luftfahrzeuge auf Flug-
häfen und die Organisation und die Aufgaben der Internationalen Zivilluftfahrt-
organisation (ICAO = International Civil Aviation Organization) geregelt. Ein
35
weiteres wichtiges multilaterales Abkommen ist das Warschauer Abkommen
von 1929, welches sich vor allem mit Haftungsfragen auseinandersetzt. Das
Warschauer Abkommen wurde im Luftverkehr von dem Montrealer Überein-
kommen ersetzt, welches das Warschauer Abkommen weitestgehend bestätigt,
jedoch mit Änderungen und Ergänzungen versieht.
19
Wesentliche Änderung für
den Transport von Frachtgut sind:
·
Statt eines Luftfrachtbriefes aus Papier kann auch jede andere Art (z.B.
ein elektronischer Luftfrachtbrief) verwendet werden
·
Für den Frachtführer wird eine verschuldensunabhängige, verschärfte
Haftung eingeführt
·
Eine undurchdringbare Haftungsgrenze wird zu Gunsten des Luftfracht-
führers eingeführt.
20
Sonstige Rechtsquellen für den Luftverkehr beinhalten hauptsächlich Gesetze,
Verordnungen und Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter per
Flugzeug.
Je nachdem, welche Abkommen ein Land unterzeichnet hat, kommen ver-
schiedene Gesetze zur Anwendung. Wenn nicht beide Länder die selben Be-
stimmungen anerkannt haben, kommt der ,,kleinste gemeinsame Nenner" zur
Anwendung. Unterliegt beispielsweise ein Land der alten und ein Land der neu-
en Version des Warschauer Abkommens, muss die alte Fassung benutzt wer-
den, da die neue Fassung auf der alten Fassung aufbaut. Hat ein Land nicht
den Vertrag des Warschauer Abkommens unterzeichnet, werden die nationalen
Bestimmungen angewendet.
Haftungs- und Versicherungsbestimmungen im internationalen Luftverkehr gel-
ten hauptsächlich zwischen Signaturstaaten des Warschauer Protokolls und
des Haager Protokolls von 1955. Je nachdem, welche Länder durch die Luftbe-
förderung betroffen sind, gelten unterschiedliche Abkommen und Gesetze.
21
19
Vgl. Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.15-22
20
Vgl. o.V., Montrealer Übereinkommen, vom 21.10.2004, unter:
http:///www.lufthansa-cargo.de/content.jsp?path=0,2,14247,10244,17511
21
Vgl. Grandjot, H-H, Leitfaden Luftfracht, Huss Verlag, 2. Auflage, 2002, S.23-45
36
3.5. Organisationen im Luftverkehr
Man unterscheidet Organisationen im nationalen, europäischen und internatio-
nalen Bereich. Die Organisationen des privatwirtschaftlichen Bereich sind oft
Interessenvertretungen bestimmter Gruppen. Die staatlichen Organisationen
beschäftigen sich hingegen mit der Regelung der Rahmenbedingungen des
Luftverkehrs. Alle Organisationen beschäftigen sich sowohl mit dem Fracht-, als
auch dem Passagierverkehr.
37
3.5.1. Nationale Organisationen in Deutschland
Der Luftverkehr wird in Deutschland auf staatlicher Ebene durch die Luftver-
kehrsverwaltung des Bundes und der Länder geregelt. Im nichtstaatlichen Be-
reich wird der Luftverkehr überwiegend durch die Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Verkehrsflughäfen (ADV) und dem Air Cargo Club Deutschland (ACD)
geregelt.
Die Luftverkehrsverwaltung des Bundes wird vor allem vom Bundesministerium
für Verkehr als oberster Bundesbehörde für die zivile Luftfahrt in Deutschland
durchgeführt, deren Aufsicht alle weiteren Behörden, wie beispielsweise das
Luftfahrt-Bundesamt, unterstellt sind. Hauptaufgaben der Institutionen der Luft-
verkehrsverwaltung des Bundes sind die Genehmigung von Luftfahrtunterneh-
men, die Vorbereitung von Gesetzesentwürfen der Regierung, die Abwicklung
von Luftverkehrsabkommen, die Vertretung Deutschlands in internationalen
Luftverkehrsorganisationen, die Erlaubniserteilung zum Mitführen von Gefah-
rengütern im Frachtbereich, die Flugplankoordination, die Flugsicherung, die
Prüfung und Zulassung von Luftfahrzeugen, die Aufsicht über Luftfahrunter-
nehmen, die Sicherheitsverbesserung im Luftverkehr und Flugunfalluntersu-
chungen.
Die ADV fördert im Mitgliederbereich die Kooperation bei allen Fragen bezüg-
lich des Flughafens in den Bereichen Recht, Wirtschaft, Bau, Betrieb, Technik,
Verkehr, Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Sozialwesen. Sie
erarbeitet weiterhin Studien zur Flughafenplanung und Analysen zur Verkehrs-
entwicklung. In der Politik nimmt sie die Rolle des Bundesverbandes deutscher
Flughäfen ein und fördert die Entwicklung von Flughafensystemen und den
Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur. Sie fungiert beratend bei den für den Luft-
verkehr zuständigen staatlichen Behörden und unterhält im internationalen Be-
reich Beziehungen zu einigen bedeutenden Organisationen.
Der ACD dient vor allem dem Gedankenaustausch zwischen den am Luftfracht-
verkehr Beteiligten in monatlichen Sitzungen und Informationsreisen zur Förde-
rung der Luftfracht und zum Austausch von Fachinformationen.
38
Zu nennen ist noch die BARIG (Board of Airline Representatives in Germany)
die alle Fluggesellschaften vertritt, die am deutschen Markt tätig sind. Sie tritt
für die Verbesserung der wirtschaftlichen und operationellen Bedingungen der
Luftfahrtgesellschaften in Deutschland ein, indem sie sich an allen luftfahrtpoliti-
schen Diskussionen, Gesetzgebungsverfahren, Gebührenänderungen, Nacht-
flugregelungen und weiteren Aktivitäten zur Regulierung der Luftfahrt durch Ko-
operation mit Flughäfen, Luftfahrtbehörden, der Europäischen Kommission und
der Deutschen Flugsicherung, beteiligt.
39
3.5.2. Organisationen im europäischen Luftverkehr
Der europäische Luftverkehr wird auf staatlicher Ebene durch die European
Civil Aviation Conference (ECAC) und der European Organisation for the Safety
of Air Navigation (EUROCONTROL) vertreten. Bei den nichtstaatlichen Organi-
sationen ist die Association of European Airlines (AEA) bedeutsam.
Die ECAC wurde 1955 gegründet und umfasst 38 Mitgliedsländer. Die von der
ECAC getroffenen Entscheidungen müssen durch Entscheidungen der jeweili-
gen Verkehrsministerien in nationales Recht umgesetzt werden, da sie keine
Bindewirkung für die Mitglieder haben. Ziel der ECAC für Europa ist es, einen
sicheren, wirtschaftlichen und umweltgerechten Luftverkehr zu erreichen. Zu
diesem Zweck arbeitet die ECAC eng mit der EU und der ICAO, sowie mit
EUROCONTROL und einigen anderen Organisationen zusammen.
EUROCONTROL wurde 1960 gegründet mit dem Ziel der gemeinsamen Flug-
sicherung des europäischen Luftraums, jedoch konnten in einem zweiten Pro-
tokoll die unterzeichnenden Länder entscheiden, ob sie ihre Zuständigkeit in
diesem Gebiet auf EUROCONTROL übertragen wollten, oder diese Aufgabe
selbst durchführen wollten. Trotz einer teilweise gelungenen Zentralisierung der
Flugsicherung blieb ein hoher Harmonisierungsbedarf aufgrund unterschiedli-
cher nichtkompatibler EDV-Systeme. Zu den Aufgaben dieser Institution gehö-
ren neben der Entwicklung, Harmonisierung und Integration eines einheitlichen
und verknüpften Kontrollsystems für den europäischen Luftraum die Gründung
einer übergeordneten Management-Einheit, die Koordinierungsverbesserung
diverser europäischer Luftraumkontrollen und die Erarbeitung von Prognosen
und Entwicklungsprogrammen.
Die AEA wurde 1973 gegründet und ihre heute 29 Mitglieder sind sowohl Li-
nien- als auch Charterfluggesellschaften. Mitglied kann nur eine Fluggesell-
schaft werden, die in einem der ECAC angeschlossenen Land zugelassen ist
und ein Minimum an Sitz- bzw. Frachtkapazität anbietet. Die AEA ist eine Non-
Profit-Organisation und hat das Ziel die gemeinsamen Interessen der Mitglie-
der, insbesondere gegenüber den Institutionen der Europäischen Gemein-
schaft, der ECAC, der IATA und weiteren Organisationen zu vertreten, die für
40
die AEA-Mitglieder relevante Fragen bearbeiten. Neben der Interessenvertre-
tung der Mitgliedsfluggesellschaften verfolgt die AEA alle politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen im Luftverkehr und nimmt dazu Stellung.
Zu nennen bleibt noch die 1980 gegründete ERA (European Regions Airline
Association), welche die Interessen des regionalen Luftverkehrs in Europa ver-
tritt, indem sie auf gesetzliche und umwelttechnische Regelungen Einfluss aus-
übt, technische Kooperation und Fortschritt fördert und öffentliche sowie politi-
sche Unterstützung zum Erreichen der Ziele versucht zu gewinnen. Ihren Mit-
gliedern wird auf einer Plattform die Möglichkeit der Zusammenarbeit in den
Bereichen Luftsicherheit, Luftverkehrspolitik, Infrastruktur und Umwelt, Instand-
haltung, Betrieb, Versorgung und Logistik angeboten.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832489137
- ISBN (Paperback)
- 9783838689135
- DOI
- 10.3239/9783832489137
- Dateigröße
- 6.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Flensburg – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- flugzeugtyp transportgut luftfrachtmarkt luftfrachtvoraussagen hub-and-spoke-systeme
- Produktsicherheit
- Diplom.de