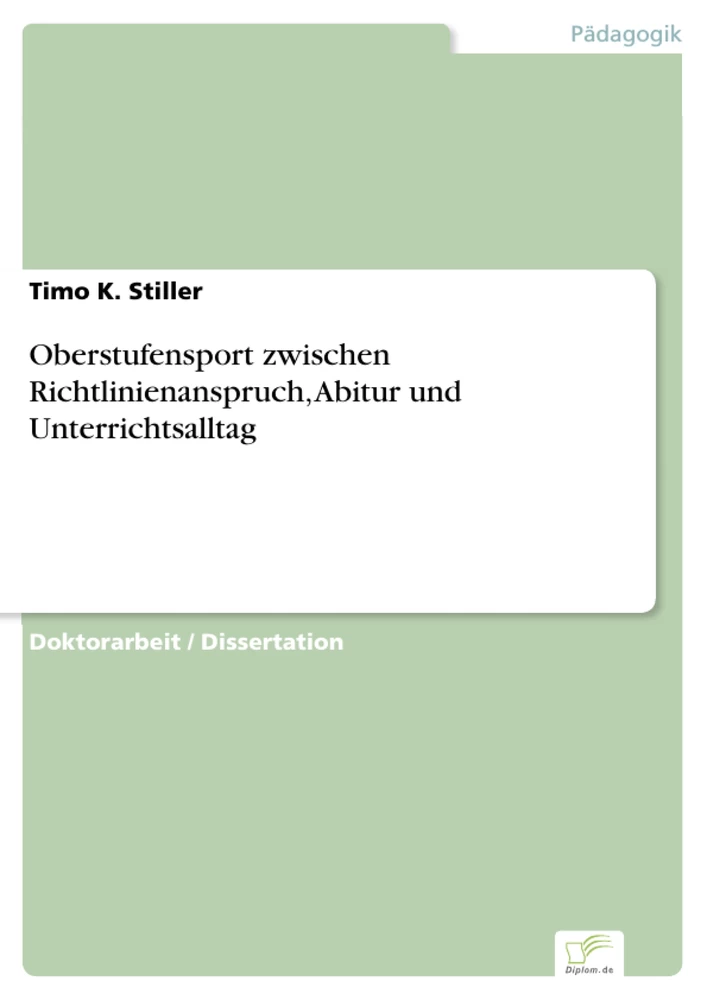Oberstufensport zwischen Richtlinienanspruch, Abitur und Unterrichtsalltag
Zusammenfassung
Betrachtet man die Anforderungen, die seit den letzten dreißig Jahren an oberstufengemäßen und abiturrelevanten Sportunterricht gestellt werden, könnte sich folgender Eindruck verdichten: Je länger die Diskussionen andauern, desto komplexer und anspruchsvoller erscheinen die Anforderungen, denen der Sportunterricht als gleichwertiges Fach im Kanon der Abiturfächer genügen muss.
Sieht sich der Schulsport in den siebziger und achtziger Jahren schwerpunktmäßig einem Qualifikationsauftrag verpflichtet, der sich im Grundkurs auf die Vertiefung und Verbesserung konditioneller Fähigkeiten und technomotorischer Fertigkeiten in ausgewählten Sportarten konzentriert und im Leistungskurs vornehmlich die Vermittlung wissenschaftstheoretischen Fachwissens vorsieht, richtet sich in den neunziger Jahren der Blick zunehmend auf die erzieherischen Potentiale des Sports, um mit ihnen einen entsprechenden Anteil an der Trias der Ziele der gymnasialen Oberstufe leisten zu können.
Analysiert man die Richtlinien und Lehrpläne Sport für Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1999 mit Blick auf die Umsetzung abiturrelevanten Sportunterrichts, verdichtet sich jedoch der Verdacht, allein Lösungen bzw. Umsetzungshilfen auf einer theoretischen Ebene beschrieben zu haben. Eine Anbindung an eine detaillierte Problemsituation aus dem Unterricht, auf welche die empfohlenen Absichten eine konkrete Qualitätsentwicklung darstellen, bleibt hingegen verborgen. Ebenfalls verborgen bleiben jedoch auch vergleichbare Normen und Kriterien der Abiturfähigkeit, welche den Status eines Abiturfaches legitimieren.
Demnach könnte es als folgerichtig bezeichnet werden, dass mit der Einführung der neuen Richtlinien und Lehrpläne das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSWWF) quasi die Konsequenzen aus den fachdidaktischen Versäumnissen zieht und dem Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe eine grundsätzliche Legitimation als viertes Prüfungsfach in der Abiturprüfung abspricht. Gleichzeitig wird dem Fach Sport jedoch die Rücknahme dieses Beschlusses in Aussicht gestellt, falls es innerhalb eines Schulversuchs gelinge, die Abiturfähigkeit des Faches nachzuweisen.
Ausgehend von dem Schulversuch liegt die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Arbeit darin, die Schieflage zwischen theoretischer Fachdiskussion und konkreter Unterrichtssituation auszugleichen.
Diese Zielsetzung ist:
- […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Problemhinführung
1.1 Einleitende Vorbemerkungen
1.2 Zum Aufbau der Arbeit
2 Forschungsstand
2.1 Zwischen Reifezeugnis und Hochschulzugangsberechtigung – die Anforderungen an die gymnasiale Oberstufe und das Abiturexamen
2.1.1 Allgemeine Bildung
2.1.2 Wissenschaftspropädeutik
2.1.3 Studierfähigkeit
2.1.4 Schlüsselqualifikationen
2.2 Der Einfluss der Kmk Beschlüsse auf das Fach Sport seit
2.2.1 Zur Notwendigkeit und Entwicklung neuer Richtlinien und Lehrpläne für das Land Nordrhein-Westfalen im Fach Sport der Sekundarstufe II
2.2.2 Die nordrhein-westfälischen Richtlinien und Lehrpläne Sport von
2.2.3 Die Richtlinien und Lehrpläne Sport von 1999 für die Sekundarstufe II – Gymnasium/ Gesamtschule des Landes Nordrhein-Westfalen
2.3 Die Frage der Gleichwertigkeit des Faches Sport inner- halb des Fächerkanons der gymnasialen Oberstufe
2.4 Der Schulversuch Sport als viertes Fach in der Abiturprüfung und der diesem Versuch zugrunde liegende Erprobungsrahmen
3 Problemstellung
4 Untersuchungsmethodik
4.1 Darstellung bisheriger Untersuchungen zum Unterrichtsgeschehen
4.2 Zur Notwendigkeit einer systemischen Unterrichtsbeobachtung
4.3 Grundlagen einer systemischen Unterrichtsbeobachtung
4.3.1 Zur vorgenommenen System-/ Umweltbestimmung
4.3.2 Probleme des Übergangs von Beobachtung zu Beschreibung
4.4 Darstellung der Beobachtungsmethodik, Entstehung der verwendeten Beobachtungsraster
4.4.1 Zur Bestimmung des Beobachters
4.4.2 Zur Bezeichnung der Unterscheidung (Form der Unterscheidung)
4.4.3 Zur Bestimmung des zu beobachtenden Systems und der dazu- gehörigen Umwelt (Beobachtungsgegenstände)
4.4.4 Zur Gewichtung, Bedeutung verschiedener Umwelten in Bezug auf das System
4.4.5 Zur semantischen Darstellung der Beobachtungen
4.4.6 Darstellung des Beobachtungsrasters für das System Sportstunde
4.4.7 Darstellung des Beobachtungsrasters für die Teilumwelt Klausur und Abiturprüfung
4.4.8 Abschließende graphische Darstellung des Untersuchungsaufbaus
4.4.9 Zur Auswahl der Beobachtungsgegenstände
5 Darstellung ausgewählter Sportstunden und der dazugehörigen Klausuren/ Abiturprüfungen
5.1 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Bm.S.D/E und die dazugehörige Teilumwelt Klausur
5.2 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Dg.S.B und die dazugehörige Teilumwelt Abiturprüfung
5.3 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Kd.S.D/E und die dazugehörige Teilumwelt Klausur
5.4 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Ku.S.A/D/E und die dazugehörige Teilumwelt Abiturprüfung
5.5 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Mm.S.B/A und die dazugehörige Teilumwelt Klausur
5.6 Beobachtungsraster für das System Sportstunde Wh.S.F/D und die dazugehörige Teilumwelt Abiturprüfung
6 Untersuchungsergebnisse
6.1 Zusammenfassung der Beobachtungsgegenstände vor dem Hintergrund der Praxis-Theorie-Verknüpfung
6.1.1 Zu den beschriebenen Systemen Sportstunde
6.1.2 Zu den beschriebenen Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.1.3 Abgleichung der dargestellten spezifischen Strukturen für die Systeme Sportstunde mit den Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.2 Zusammenfassung der Beobachtungsgegenstände vor dem Hin-tergrund der Methoden und Formen selbständigen Arbeitens
6.2.1 Zu den beschriebenen Systemen Sportstunde
6.2.2 Zu den beschriebenen Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.2.3 Abgleichung der dargestellten spezifischen Strukturen für die Systeme Sportstunde mit den Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.3 Zusammenfassung der Beobachtungsgegenstände vor dem Hintergrund der Mehrperspektivität
6.3.1 Zu den beschriebenen Systemen Sportstunde
6.3.2 Zu den beschriebenen Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.3.3 Abgleichung der dargestellten spezifischen Strukturen für die Systeme Sportstunde mit den Teilumwelten Klausur und Abiturprüfung
6.4 Fazit der übergreifenden Zusammenfassung der Beobachtungs- gegenstände und der daraus ableitbaren internen Funktions- logik der fokalen Systeme und Teilumwelten
6.4.1 Zur Funktionslogik des beobachteten Systems Sportstunde
6.4.2 Zur Funktionslogik der beobachteten Teilumwelt Klausur und Abiturprüfung
6.4.3 Graphische Darstellung der System-Umwelt-Interdependenzen
6.5 Aus den Funktionslogiken ableitbare Erkenntnisse mit Blick auf Umsetzung und Umsetzbarkeit der RuL’99 (Erläuterung des Schaubildes)
6.6 Abschließende Diskussion der Untersuchungsergebnisse mit Blick auf die Umsetzbarkeit der RuL’99 im Unterrichtsalltag
6.6.1 Aus den Beschreibungen ableitbare Strukturen und Prinzipien richtliniengemäßen Unterrichts
6.6.2 Thesen zur Realisierbarkeit der RuL’99 innerhalb der Prüfungs- situationen sowie Überlegungen zu Interventionsmöglichkeiten und deren Auswirkungen
6.6.3 Thesen zur Realisierbarkeit der RuL’99 innerhalb der Sportstunden sowie Überlegungen zu Interventionsmöglichkeiten und deren Auswirkungen
6.6.4 Graphische Darstellung der beschriebenen Interventionsmöglichkeit
7 Fazit und Ausblick
8 Literaturverzeichnis
9 Lebenslauf
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die zehn Inhaltsbereiche des Schulsports (Mswwf 1999, XXVII)
Abbildung 2: Parabel von den Blinden und dem Elefant
Abbildung 3: Untersuchungsaufbau
Abbildung 4: Materialien zur Klausur Bm.K.D/E
Abbildung 5: Materialien zur Abiturprüfung Dg.A.D
Abbildung 6: Materialien zur Abiturprüfung Ku.A.A/D/E
Abbildung 7: Materialien zur Abiturprüfung Wh.A.F/D
Abbildung 8: Übersicht der Ergebnisdarstellungen
Abbildung 9: Darstellung der System-Umwelt-Interdependenzen
Abbildung 10: Darstellung der beschriebenen Interventionsmöglichkeit
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Unterschiedliche Modelle einer Praxis-Theorie-Verknüpfung
Tabelle 2: Methoden und Formen selbständigen Arbeitens
Tabelle 3: Pädagogische Perspektiven und sportwissenschaftliche Theorie- bereiche
Vorwort
„Jeder kommt aber einmal an die wesentlichen Punkte einer neuen Technologie und beginnt dann die tatsächlich wichtigen Fragen zu stellen: Was ist das Problem, zu dem diese technische Errungenschaft eine Lösung darstellt? Einmal hat es bei uns tatsächlich solch eine Auseinandersetzung gegeben. Das war während der Debatte, ob Amerika einen Überschall-Jet bauen solle oder nicht. Die Briten hatten einen, die Franzosen hatten einen, und so gab es Diskussionen im Kongress und in der Öffentlichkeit über die Frage, ob Amerika in einen eigenen Überschall-Jet investieren solle. Die Menschen fragten damals tatsächlich: Was ist das Problem, für das ein Überschall-Jet die Lösung darstellt? Die Antwort lautete, so stellte sich heraus, dass man sechs Stunden braucht, um mit einer Boeing 747 von New York nach Los Angeles zu fliegen – mit einem Überschall-Jet dagegen nur drei Stunden. So dachten die Leute, dass es wohl in Ordnung und dies Problem ernst genug sei, solche Investitionen zu rechtfertigen. Aber die Menschen fragten sich, was sie mit den drei Extra-Stunden anfangen würden und die meisten von ihnen sagten: Wir würden fernsehen. Und so bestand die Lösung schließlich darin, Fernseher in die Boeing 747 einzubauen, und wir sparten auf diese Weise Millionen Dollars.“ (Postman 1998, 16)
1 Problemhinführung
1.1 Einleitende Vorbemerkungen
„Was wissen wir eigentlich über ‚unseren‘ Sportunterricht?“ (Brettschneider 1994, 449)
Vor dem Hintergrund umfangreicher Publikationen zum Thema allgemeiner Schulentwicklung sowie Veröffentlichungen zur Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Lehrplänen im Fach Sport sollte eigentlich erwartet werden, einer derartigen, noch dazu von einem Sportpädagogen gestellten Frage eine allein rhetorische Bedeutung zukommen lassen zu dürfen.
Allerdings: Mag die einsetzende Resonanz auf diese Frage eine allein rhetorische Absicht bereits relativieren, dürfte die Tatsache, dass die vorhandenen theoretischen Antwortmöglichkeiten der sportwissenschaftlichen Fachdidaktik anscheinend nur unzureichend an konkrete Unterrichtsgeschehen anzubinden sind, die rhetorische Absicht des Zitats vollends widerlegen. So kommt beispielsweise Scherler zu der Erkenntnis: „Empirische Forschung sei vonnöten, die die konkreten Lehr-, Lernbedingungen aufgreift und zentrale sportdidaktische Fragestellungen zu den Inhalten und den Vermittlungsmethoden in wissenschaftlich gesicherter Weise untersucht“ (Scherler 1995, 55).
Und auch die Tatsache, dass die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaften die Schulsportforschung noch im Jahre 2000 als einen ausbaubedürftigen Bereich bezeichnet und ihr einen eigenen Schwerpunkt widmet (vgl. dvs-Information 15, 2000), lässt die Einsicht reifen, dass Brettschneiders Frage leider nicht als rhetorische Frage verstanden werden darf, sondern einen Forschungs- und Informationsstand hinterfragt, der vor allem in der Verbindung fachdidaktischer Erkenntnisse mit konkreten Unterrichtssituationen einen zwingenden Handlungsbedarf offenbart.
„Wenn es keine Probleme gibt, gibt es auch keine Lösungen.“ (Dewey 1917, zitiert nach Bohnsack 1976, 123)
Mit Blick auf die Gegenüberstellung fachdidaktischer Erkenntnisse bzw. vorhandener Lösungsansätze im Vergleich zu offen bleibenden Fragen zum tatsächlichen Unterrichtsgeschehen bedarf es jedoch anscheinend einer Konkretisierung des geforderten Handlungsbedarfs.
Betrachtet man beispielsweise die Entwicklungen, Forderungen und Empfehlungen zur Umsetzung abiturrelevanten Sportunterrichts, verdichtet sich der Verdacht, tatsächlich allein Lösungen bzw. Umsetzungshilfen auf einer theoretischen Ebene beschrieben zu haben. Eine Anbindung an eine detaillierte Problemsituation aus dem Unterricht, auf welche die empfohlenen Absichten eine konkrete Qualitätsentwicklung darstellten, bleibt hingegen verborgen.
Somit bestünde zwingender Handlungsbedarf darin, darzulegen, inwieweit die permanent mit Anspruch auf Qualitätsentwicklung bzw. -verbesserung weiterentwickelten Absichten und Vorgaben der Richtlinien und Lehrpläne überhaupt noch mit alltäglichen Problemsituationen des Unterrichts in Verbindung gebracht werden können.
Dass die Gefahr einer allein rekursiven Diskussion von theoretischen Lösungsansätzen und geänderten formellen Rahmenbedingungen als ein prinzipielles Phänomen der allgemeinen Schulentwicklung angesehen werden kann, legen die aktuellen Diskussionen bezüglich Auswertung und Auswirkung der Pisa-Ergebnisse nahe[1]. Auf allgemein sportdidaktischer Ebene hat Scherler bereits 1993 in seinem Hauptreferat zum 11. Sportwissenschaftlichen Hochschultag auf die Notwendigkeit hingewiesen, „dass für die Legitimierung des Schulsports zukünftig die ubiquitären Proklamationen von Absichten durch wissenschaftliche Evaluationen über die Wirkungen des Schulsports zu ergänzen seien“ (zitiert nach Friedrich 2000, 7).
Die Forderung einer wissenschaftlichen Evaluation, einer konkreten Beschreibung des Sportunterrichts wird jedoch auch in den nachfolgenden Jahren nicht eingelöst, sodass letztlich im Jahre 1998 offenkundig werden sollte, wie vorausschauend und zukunftsweisend Scherlers Folgerungen für den Sportunterricht waren.
Im Jahre 1998, mit der Einführung der neuen Richtlinien und Lehrpläne Sport für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen (RuL’99), zieht das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Mswwf) quasi die Konsequenzen aus diesem Versäumnis und spricht dem Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe eine grundsätzliche Legitimation als viertes Prüfungsfach in der Abiturprüfung ab[2]. Gleichzeitig wird dem Fach Sport jedoch die Rücknahme dieses Beschlusses in Aussicht gestellt, falls es innerhalb eines Schulversuchs gelinge, die Abiturfähigkeit des Faches nachzuweisen.
Die vorliegende Arbeit wird somit zum einen versuchen, die von den obigen Zitaten abgeleitete Schieflage zwischen theoretischer Fachdiskussion und konkreter Unterrichtssituation auszugleichen.
Zum anderen darf die Arbeit als Teilprodukt des erwähnten Schulversuchs verstanden werden und ist in ihrer Problemstellung aus ihm erwachsen.
Sie ist geprägt von dem Auftrag und Anspruch, die Abiturfähigkeit des Faches Sport zu evaluieren; beeinflusst von den Rahmenvorgaben und Auflagen des Mswwf sowie mit Blick auf mögliche Konsequenzen der Ergebnisse für den zukünftigen Stellenwert des Faches sicherlich auch direkt oder indirekt einem gewissen Druck ausgesetzt, Aussagen über Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Faches treffen zu wollen.
Der erhobene Anspruch einer Verbindung tatsächlichen Unterrichts mit den Vorgaben und Ansprüchen der Richtlinien und Lehrpläne wird somit notwendigerweise weitere interdependente Themenbereiche umfassen:
– Die Bestimmung von Normen und Kriterien für Sportunterricht mit Blick auf die geforderte Abiturfähigkeit sowie
– die Entwicklung von Instrumentarien, mit Hilfe derer sich diese Normen und Kriterien im Sportunterricht bezüglich ihrer Realisierbarkeit beobachten und letztlich für einen externen Rezipienten nachvollziehbar beschreiben lassen.
Auf die Schwierigkeit dieses Vorhabens allein mit Blick auf die zu bestimmenden Normen und Kriterien hat bereits Grupe hingewiesen: „Die schulpädagogische Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass es keine eindeutigen pädagogischen Bewertungskriterien gibt. Zwar ist der außerschulische Sport eine wesentliche Bezugsebene für die schulische Sportentwicklung, von der sie auch profitieren kann; es gibt aber noch keine Maßstäbe dafür, wie man unter erzieherischen Gesichtspunkten mit diesem heute anders gewordenen, anders verstandenen und anders wahrgenommenen Sport umgehen sollte“ (Grupe 2000, 134).
Wie gleichzeitig komplex und weitreichend dieses Vorhaben dann noch vor den allgemeinen Ansprüchen und Anforderungsbereichen eines Abiturfaches, vor allem vor der Folie des geforderten Bildungsauftrags der gymnasialen Oberstufe werden dürfte, verdeutlicht Ehni: „Ein Schüler, der gut unterrichtet und erzogen ist, ist jedoch noch nicht gebildet, sondern allenfalls ausgebildet. Gebildet ist er erst, wenn er das besondere Wissen und Können, das er durch Unterricht erworben hat, auf ein höheres Allgemeines beziehen und das Einzelne in strukturiertem Zusammenhang zum Gesamten sehen kann“ (Ehni 2000, 20).
Unter Berücksichtigung neuerer, erkenntnistheoretischer Ansätze wird dann eine weitere Schwierigkeit zu lösen sein, wie die Umsetzung dieser qualitativen Normen und Kriterien abiturrelevanten Unterrichts letztlich innerhalb eines Unterrichtsgeschehens beobachtbar, vor allem aber beschreibbar werden kann. Hierzu sei einleitend auf Luhmann verwiesen, der bei der Erstellung von Be-obachtungsinstrumentarien zur Bewertung qualitativ vergleichbarer Normen auf das Problem der Subjektivität bzw. Selbstbeobachtung des jeweiligen Beobachters hinweist (vgl. v.a. Luhmann 1982).
In der Absicht, die formellen Anforderungen mit dem Unterrichtsgeschehen zu verbinden, gilt es daher zunächst, die Kriterien der Abituranforderungen sowie die fachdidaktischen Kriterien der Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Sport zu operationalisieren, um dann über eine umfangreiche Unterrichtsbeobachtung zu einer profunden, vor allem aber nachvollziehbaren Situationsbeschreibung des beobachteten Unterrichts zu gelangen. Auf Grundlage dieser Problem beschreibung könnten sich dann möglicherweise Vergleiche mit bereits vorhandenen oder aber daraus resultierenden Lösungsansätzen für einen abiturrelevanten Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe aufzeigen lassen.
1.2 Zum Aufbau der Arbeit
Wie aus dem Inhaltsverzeichnis und den einführenden Vorbemerkungen ersichtlich, orientiert sich die Aufarbeitung des Forschungsstandes zunächst an einem kurzen historischen Abriss der Entwicklungen und Veränderungsbestrebungen fachübergreifender Abituranforderungen. Diese werden in der momentan geltenden Fassung diskutiert, wobei vor dem Hintergrund der fachwissenschaftlichen Diskussion neben einer historischen Darstellung und Nennung dieser Kriterien außerdem versucht wird, diese Ziele hermeneutisch voneinander abzugrenzen und für die weitere Verwendung innerhalb der Arbeit zu operationalisieren.
Ebenfalls an einer historisch-hermeneutischen Darstellung orientierend, werden diese allgemeinen Vorgaben dann mit den landes- und fachspezifischen Richtlinien und Lehrplänen des Sportunterrichts in der gymnasialen Oberstufe für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung gesetzt. Des Weiteren sollte ersichtlich werden, inwieweit die seit 1999 in NRW geltenden Richtlinien und Lehrpläne Sport in einer Linie zu den geltenden ministeriellen Vorgaben gesehen werden können. Auf Grundlage dieser sowohl fachübergreifenden als auch fachspezifischen Vorgaben gilt es dann, Normen und Kriterien für oberstufengemäßen und abiturrelevanten Oberstufensport zu formulieren.
Der sich daran anschließende Hauptteil der Arbeit wird neben einer fundierten Darstellung der verwendeten Beobachtungstheorien eine ausführliche und detaillierte Stundenbeschreibung umfassen, mit der Absicht, die theoretischen Forderungen mit dem beobachteten Unterricht in Verbindung zu setzen.
Aufgrund der qualitativen, subjektorientierten Beschreibung der Beobachtungsgegenstände sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine stringente Trennung zwischen dem Kapitel zur Untersuchungsmethodik, der Darstellung der Beobachtungsgegenstände sowie dem Kapitel der Untersuchungsergebnisse nicht in der traditionell gängigen Form vorgenommen wird. Punkt 5 des Inhaltsverzeichnisses „Darstellung ausgewählter Sportstunden und der dazugehörigen Klausur- und Abiturprüfungen“ wird daher vor allem innerhalb des jeweils formulierten Fazits bereits starke auswertende bzw. bewertende Aspekte beinhalten, die im traditionellen Sinne dem Kapitel der Untersuchungsergebnisse zugeordnet werden könnten.
Die trotzdem vorgenommene Abgrenzung zwischen den Kapiteln 5 und 6 begründet sich dadurch, dass sich die im Kapitel 6 beschriebenen Untersuchungsergebnisse auf Erkenntnisse stützen, welche über die Beschreibung einzelner Beobachtungsgegenstände innerhalb des fünften Kapitels hinausgehen und sich mehr auf übereinstimmende Strukturen der Beobachtungsgegenstände beziehen bzw. möglicherweise den Beobachter befähigen, eine übergreifende Problemsituation aufzudecken.
Mit engem Bezug auf die verwendeten Beobachtungstheorien (Kapitel 4) wird auf Grundlage der konkreten Beschreibungen der Beobachtungsgegenstände (Kapitel 5) somit im sechsten Kapitel beabsichtigt, Strukturen und Funktionsmechanismen zu formulieren sowie Interventionsmöglichkeiten darzustellen, die den beobachteten Unterricht bestimmt haben bzw. zukünftigen Sportunterricht im Sinne der Rahmenvorgaben bestimmen könnten.
Das abschließende Fazit wird die formulierten Anforderungen mit den beschriebenen Beobachtungsergebnissen in Verbindung setzen sowie Aussagen über die Realisierbarkeit, aber auch mögliche Auswirkungen einer Umsetzung dieser Anforderungen auf den alltäglichen Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe erwarten lassen dürfen.
2 Forschungsstand
2.1 Zwischen Reifezeugnis und Hochschulzugangsberechtigung – die Anforderungen an die gymnasiale Oberstufe und das Abiturexamen
Die Frage, nach welchen Organisationsstrukturen, welchen Inhalten und Zielsetzungen die Schüler den Hochschulzugang erreichen sollen, ist seit jeher ein Dauerthema bildungstheoretischer Diskussionen. So fällt bei der Betrachtung der historischen Entwicklung des Gymnasiums auf, dass die Inhalte und Ziele des Gymnasiums zwar stets in einer Verbindung eines Qualifikations- und Erziehungsauftrags gesehen werden, die Gewichtung und die Bedeutung der beiden Komponenten dieses Doppelauftrages jedoch seit nunmehr fast zweihundert Jahren diskutiert werden.
Den Ausgangspunkt dieser Diskussionen sieht Herlitz in der im Jahre 1834 verbindlichen Einführung des Abiturexamens als alleiniger Zugangsvoraussetzung für anschließende berufsqualifizierende und universitäre Studiengänge. Ab diesem Zeitpunkt wandele sich die im neuhumanistischen Verständnis Humboldtscher Prägung geltende Auffassung, Schule als allgemeine Menschenbildung[3] zu verstehen, „in eine ziemlich perfekte Selektionsmaschinerie“ (Herlitz 1982, 98).
1836 kommt der Gymnasialdirektor und preußische Provinzialschulrat C.G. Scheibert zu der Ansicht: „Ein Schüler will ja gar nicht etwas wissen, um es zu wissen, sondern um ein Examen zu machen. Das letzte Ziel seiner Schultätigkeit ist das Abiturientenexamen. Mit dem Reifezeugnis gestempelt, kann er werden, was er will, ohne dieses muss er sein ganzes Jugendleben für verloren achten.“ Eine, die Humboldtschen Bildungsideale berücksichtigend, entmutigende Einschätzung der damaligen Schulsituation.
Umso besorgniserregender jedoch, wenn knapp 150 Jahre später H. v. Hentig dieses Zitat seinem Buch „Die Krise des Abiturs und eine Alternative“ (1980) voranstellt. Ein Hinweis Hentigs, dass sich trotz mehrerer Reformversuche des Abiturs, unzähliger Kmk Beschlüsse sowie Weiterentwicklungen und Fortschreibungen der Richtlinien und Lehrpläne nichts an der Schulsituation geändert hat?
Fakt ist, dass sich das Gymnasium ab 1834 zu einer exklusiven Vergabestelle karrierewirksamer Berechtigungen[4] entwickelt und „zum Dreh- und Angelpunkt einer bedarfsgerechten Auslese potentieller Studierender (wird)“ (Schulz 2000, 182). Zunehmend werden Begriffe wie Studierfähigkeit und Wissenschaftspropädeutik im Sinne von Qualifikationsanforderungen definiert und gewinnen als Grundlage und Maßstab in den weiteren Diskussionen um die inhaltliche und organisatorische Gestaltung des Gymnasiums an Bedeutung. Die Frage jedoch, welche Inhalte unter diesen Begriffen zu verstehen seien und wie diese sichergestellt werden könnten, bleibt weiterhin im Mittelpunkt der Diskussionen.
Hinsichtlich eines ersten Minimalkonsenses von Inhalten und Zielsetzungen der höheren Schulen kann der Tutzinger Maturitätskatalog von 1958 angesehen werden, in dem Vertreter der Hochschulen und der Kultusministerien vom 28. bis 30. April 1958 einen neun Ziffern umfassenden Katalog definieren, der die Studierfähigkeit für alle an Hochschulen angebotenen Fächer sicherstellen soll.
Somit legt dieser Maturitätskatalog zum ersten Mal fest, was unter allgemeiner Hochschulreife zu verstehen ist:
- „einwandfreies Deutsch;
- Verständnis einiger Meisterwerke der deutschen Literatur und einiger grundlegend wichtiger Meisterwerke der Weltliteratur;
- gute Einführung in eine Fremdsprache und erste Einführung in eine zweite Fremdsprache, wobei eine Sprache Latein oder Französisch sein soll;
- Kenntnis der Elementarmathematik;
- in der Physik Einführung in die Hauptphänomene;
- liebhabermäßiges Betrachten der anschaulichen Natur und Zugang zur biologischen Betrachtungsweise;
- Kenntnis und Verständnis für die geschichtliche Situation der Gegenwart seit der französischen Revolution;
- Verständnis für die philosophischen Einleitungsfragen, besonders für die anthropologischen;
- Orientierung über die Christenlehre, die kirchengeschichtlichen Haupter-eignisse und Einführung in die ethischen Grundfragen.“ (Zitiert nach Lange 1993, 31)
Dass dieser Konsens jedoch schon damals nicht als ein gesamtgesellschaftlicher angesehen wird, die Diskussionen hinsichtlich der Gestaltung des Abiturs somit nicht verstummen, lässt sich beispielsweise im Schreiben des Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz an die Wrk-Mitgliedhochschulen vom 22. Juli 1959 nachlesen, mit dem der Maturitätskatalog den Hochschulen übermittelt wurde: „Der Katalog erfüllt den von allen Hochschulen im Gegensatz zu den Philologenverbänden seit 1947 geäußerten Wunsch, die Hochschulreifeprüfung in Gestalt des Abiturs von überflüssigem Stoff zu entlasten[5] und sie durch einen vertieften Unterricht an ausgewählten Stoffen vorzubereiten“.
Somit kann festgehalten werden, dass bereits 1958 das exemplarische Lernen – gegen die Einwände der Philologenverbände – als Basis der allgemeinen Hochschulreife definiert wird. Weiterhin zeigt der Katalog, dass es bereits seit mehr als vierzig Jahren zwischen Ministerium und Hochschulen unstrittig ist, den Auftrag der höheren Schulen nicht allein in einer Vermittlung faktischer Wissensinhalte zu sehen.
In den sechziger Jahren sieht sich dieser Katalog wegen der fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung als auch der fehlenden wissenschaftlichen Abstützung zunehmender Kritik ausgesetzt, die bspw. Roth auf vier Aspekte zusammenfasst:
- eine Diskrepanz zwischen einer wachsenden Zahl von Universitätsdis-ziplinen und dem gymnasialen Fächerkanon;
- der vermeintlich unzureichende Wissensstand der Abiturienten und deren unzureichende Hochschulvorbereitung;
- der Verlust einer übereinstimmenden Vorstellung von Allgemeinbildung;
- eine unzureichende Berücksichtigung gesellschaftspolitisch relevanter Ziele wie z. B. Chancengleichheit, Emanzipation, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Wissenschaftsorientierung. (Vgl. Roth 1991, 375)
Dazu kommt die Einsicht, dass der Kanon eines Minimalkonsenses bzw. – wie Flitner es formuliert – der „Initiationen“[6] systematisch allenfalls noch als Exempel für die Einfachheit von Lösungen genutzt werden könne, aber nicht zur Bestimmung von Studierfähigkeit ausreiche. Im Sinne einer angestrebten Studierfähigkeit sei ein liebhabermäßiges Betrachten der anschaulichen Natur kaum mehr ausreichend, entsprächen die einst formulierten Erwartungen an die Fremdsprachenkompetenz längst nicht mehr dem als notwendig erkannten Standard, gebe der Minimalkonsens zu wenig in der Geschichte vor und entspreche die Christenlehre sicherlich nicht mehr den religionsdidaktischen Erwartungen (vgl. Kmk-Expertenkommission 1995, 77).
Selbst wenn in den späteren Vereinbarungen ein neuer Maturitätskatalog nicht mehr formuliert werden kann, wird das Gymnasium – vor allem im späteren Verlauf dessen Oberstufe – seit 1958 dennoch kontinuierlich verändert, wobei das didaktische Angebot zur Sicherung der Studierfähigkeit in der Folge wesentlich umfassender und komplexer wird.
Als Grundlage der Weiterentwicklung im Bereich der gymnasialen Oberstufe können die aus den Ausschüssen der Kmk und Wrk hervorgegangenen Beschlüsse „Rahmenvereinbarung zur Ordnung des Unterrichts auf der Oberstufe der Gymnasien“ (Saarbrücker Rahmenvereinbarung – Beschluss der Kmk vom 29. September 1960) und die 1961 formulierten „Stuttgarter Empfehlungen zur didaktischen und methodischen Gestaltung der Oberstufe der Gymnasien“ (Beschluss der Kmk vom 28./ 29. September 1961) angesehen werden.
Vor allem mit den Saarbrücker Rahmenvereinbarungen beabsichtigt die Kmk bereits 1960, durch eine „Verminderung der Zahl der Pflichtfächer und die Konzentration der Bildungsstoffe ... eine Vertiefung des Unterrichts [zu] ermöglichen und die Erziehung des Schülers zu geistiger Selbständigkeit und Verantwortung [zu] fördern.“ Die Stuttgarter Empfehlungen ergänzen die Rahmenvereinbarungen durch Hinweise, wie der Schüler der Oberstufe „propädeutisch in wissenschaftliche Arbeitsweisen eingeführt werden soll, um zu lernen, mit Gegenständen und Problemen der Erfahrung, des Erkennens und des Wertens seinem Alter entsprechend selbständig und sachgerecht umzugehen“ (Kmk 1960/61, zitiert nach: Kmk-Expertenkommission 1995, 32).
Als Ergebnis der gesellschaftlichen Kritik an dem Tutzinger Maturitätskatalog sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Saarbrücker Rahmenvereinbarung (1960) und den Stuttgarter Empfehlungen (1961) werden 1969 in der Stellungnahme des Schulausschusses der Wrk Prinzipien formuliert, die unter dem Titel „Kriterien der Hochschulreife“ der Öffentlichkeit vorgelegt werden und in ihren tragenden Prinzipien bis heute die aus Sicht der Hochschulen unverzichtbaren Grundelemente dessen bestimmen, was unter dem angestrebten Ziel der Studierfähigkeit diskutiert wird.
In der einführenden Begründung zu den Kriterien der Hochschulreife formuliert Scheuerl im Jahr 1969 einen Grundgedanken der Reform der gymnasialen Oberstufe mit dem Begriff der „kyklischen Grundbildung“[7]. Dieser geht auf die Gedanken von Flitner zurück und stellt im Kontext der Tutzinger Gespräche eine zentrale Rolle dar. Es wird deutlich, dass weder ein bestimmter inhaltlicher Kanon noch ein zeitlos gültiges Bildungsideal formuliert werden kann. Stattdessen wird versucht, einen Minimalkonsens in Form eines Anforderungsminimums durch die Festlegung kategorialer, formaler und inhaltlicher Ziele sowie der Eröffnung einer Differenzierung nach Intensitätsgraden und Fachrichtungen zu beschreiben (vgl. Wernstedt 1994, 8).
Auch diese Konzentrationstendenzen der Rahmenvereinbarungen bleiben nicht ohne Kritik, die sich auf eine befürchtete Abweichung des Prinzips der notwendigen Allgemeinbildung bezieht, so dass die Kmk mit ihrem Beschluss vom 21. Mai 1970 eine Vereinbarung „im Hinblick auf die Bedeutung der Mathematik und der Naturwissenschaften zur stärkeren Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts in den Gymnasien“ beschließt.
Diese Entwicklung führt bei vielen Schulen zu Reforminitiativen im Bereich der Oberstufe, die mehr oder weniger charakterisiert sind durch die entscheidenden Prinzipien der späteren Kmk-Vereinbarung – wie Ausbau der Wahlfreiheit, Einführung eines Kurssystems, Ausweitung des Fächerkanons – und auf die sich die Kultusminister der Bundesländer hinsichtlich einer Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II am 7. Juli 1972 einigen. Erklärte Absicht der Kmk ist es, „die gymnasiale Oberstufe stärker als bisher sowohl an den Anforderungen einer sich verändernden Gesellschaft als auch an den Bedürfnissen der Heranwachsenden“ zu orientieren, wobei die zunehmende Selbständigkeit des Schülers mit einem wissenschaftsnahen Arbeitsstil und einem überschaubaren Leistungsanspruch verbunden werden soll (Kmk 1972, 11).
Nach übereinstimmender Einschätzung stellt diese Reform der gymnasialen Oberstufe die „entschiedenste Veränderung des Gymnasiums seit seiner Gründung“ dar (Roth 1991, 376). Die Grundintention dieser Vereinbarung besteht darin, dass neben einer Änderung von Unterrichtsinhalten und Arbeitsformen gleichzeitig die gemeinsame Gestalt der Oberstufe in den Ländern der Bundesrepublik gesichert bleiben soll (vgl. Kmk 1972, 13). Auf Grund der Vereinbarung „soll die Stufe des Übergangs in den Bereich der Hochschule so strukturiert werden, dass sowohl eine gemeinsame Grundausbildung für alle Schüler gewährleistet als auch der individuellen Spezialisierung Raum gegeben ist“ (Kmk 1972, 13)[8].
Ansprüche der Gesellschaft und individuelles Bedürfnis sollen durch die Möglichkeit zu freier Kombination von Grund- und Leistungskursen im Pflicht- und Wahlbereich zu ihrem Recht kommen. Mit der Erweiterung des Wahlbereichs, in den neben den bisherigen auch neue Fächer hineingenommen werden, wird beabsichtigt, die Schule „in ein dynamisches Verhältnis zur gesellschaftlichen Wirklichkeit“ eintreten zu lassen (Kmk 1972, 13).
Unterrichtsorganisatorisch wird die Einrichtung von Halbjahreskursen bindend vorgeschrieben, die eine Differenzierung nach Begabung und Leistung ermöglicht. „Das System der Jahrgangsklassen wird in ein System von Grund- und Leistungskursen umgewandelt, das auch jahrgangsübergreifend sein kann. Die Kurse sind themenbestimmt, doch bleiben sie Fächern und den für sie geltenden Lehrplanrichtlinien zugeordnet“ (Kmk 1972, 16).
Bei genauer Analyse dieser Formulierungen wird deutlich, inwieweit die Kmk somit konstituierende Momente aus zwei unterschiedlichen Empfehlungen kombiniert hat. Das Festhalten an dem Gedanken einer Allgemeinbildung mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife basiert auf den Kriterien der Hochschulreife des Schulausschusses der Westdeutschen Rektorenkonferenz von 1969, die in ihren Formulierungen sicherlich als Weiterentwicklung des Tutzinger Katalogs angesehen werden können sowie eine deutliche Nähe zu den Scheuerlschen Gedanken einer kyklischen Grundbildung aufweisen. Das Aufbrechen des Systems von Jahrgangsklassen zugunsten von Kursen basiert auf dem Strukturplan für das Bildungswesen des Deutschen Bildungsrates von 1970. Weitergehend entstammen die Strukturierungsprinzipien „Aufgabenfeld“ und „Kurs“ diesen unterschiedlichen Empfehlungen.
Um einer absoluten Wahlfreiheit entgegenzuwirken und den Ansprüchen der Gesellschaft hinsichtlich einer bei Abiturienten vorauszusetzenden Allgemeinbildung zu entsprechen, bezieht sich die Pflichtbindung nunmehr statt auf Fächer auf drei verschiedene Aufgabenfelder: Das sprachlich-literarische Aufgabenfeld, das gesellschaftliche Aufgabenfeld sowie das mathematisch-naturwis-senschaftlich-technische Aufgabenfeld (Kmk 1972, 14).
Mit dieser Wahlfreiheit wird jedoch ein bis heute andauernder Diskussionsansatz gelegt. Dieser bezieht sich zum einen auf die Forderung der Kmk, mit dem Abitur die Kriterien der Leistungsbewertung an den einzelnen Schulen anzugleichen und damit die Chancengleichheit bei einer der wichtigsten Berechtigungen sicherzustellen, die innerhalb der Schule vergeben werden können, zum anderen auf die Festlegung, anhand welcher Kriterien eine Vergleichbarkeit eingehalten werden kann bzw. welche Inhalte die geforderte Allgemeinbildung und Studierfähigkeit gewährleisten sollen[9].
Angesichts dieser umfassenden Beschlüsse und Forderungen scheint es nur zu verständlich, dass die Diskussionen hinsichtlich Gleichwertigkeit und Abiturfähigkeit der einzelnen Fächer bis heute nicht abgerissen sind. Zu nennen sei in diesem Zusammenhang die Anfang der siebziger Jahre gebildete Arbeitsgruppe „Rahmenabiturprüfungsordnung“ mit dem Auftrag, die Vergleichbarkeit der Leistungsbewertung im Abitur zu verbessern. Als Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe können die Anstöße bezeichnet werden, die zur Entwicklung der 1975 in Kraft tretenden „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ (EPA) führen.
Festzuhalten bleibt: Mit Beginn der Wahlfreiheit wird seit nunmehr über dreißig Jahren versucht, die Anforderungsprofile der Fächer und Aufgabenfelder ihrer Abiturfähigkeit entsprechend darzustellen bzw. Strukturen zu konzipieren, welche die postulierte prinzipielle Gleichwertigkeit rechtfertigt. Im Kern konzentrieren sich diese Diskussionen jedoch vorwiegend darauf, ob es einen Grundbestand an Fächern gibt, der die allgemeine Grundbildung repräsentiert und somit besonders befähigt, ein egal in welches Fachgebiet zielendes, wissenschaftliches Studium aufnehmen zu können.
Dass die prinzipielle Gleichwertigkeit trotz vielfältiger Richtlinien und Lehrplanentwicklungen immer wieder angezweifelt wird, zeigt bspw. eine Äußerung seitens Prof. Kröll, Vizepräsident der Wrk, vom 7.5.1981, der zu dem Ergebnis kommt, dass „die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Fächer im Hinblick auf Studierfähigkeit nicht zu halten“ sei. Somit doch wieder eine Abkehr von dem 1972 eingeführten Kurssystem, eine Rückbesinnung auf einen festgeschriebenen Fächerkanon, im günstigsten Fall mit festgelegten Rahmenvorgaben und Inhalten, die sowohl eine allgemeine Bildung als auch eine Studierfähigkeit, was immer auch darunter zu verstehen ist, sicherstellen?[10]
Ein diesbezüglicher Konsens kann auch in den folgenden Jahren nicht formuliert werden. Was hingegen in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren offensichtlich wird, ist die zunehmende Kritik der Arbeitgeber, der Wirtschaft und der Hochschulen hinsichtlich Modernitätsrückstand oder Substanzverlust der gymnasialen Oberstufe.
Anfang der neunziger Jahre sieht sich die gymnasiale Oberstufe somit einem verstärkten Handlungsbedarf ausgesetzt. Die Hochschullehrer kritisieren die Heterogenität der Vorkenntnisse, bringen Einwände zur Struktur des Wissens seitens der Schüler vor und bemängeln eine übermäßige Spezialisierung, was durchaus als Kritik an den Wahlmöglichkeiten verstanden werden darf. Außerdem fordern die Hochschullehrer eine Verbesserung instrumenteller Kompetenzen (sprachliche Ausdrucksfähigkeit v.a. komplexer Gedankengänge) und sind sich mit Vertretern der Wirtschaftsverbände darüber einig, dass die Abiturienten metakognitive Steuerungsdefizite aufweisen, die sich vor allem auf das selbständige Lernen beziehen. Wesentlichen Handlungsbedarf sehen sämtliche Institutionen weiterhin in der Verbesserung sozialer Kompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Verantwortungsbereitschaft (vgl. Kmk-Ex-pertenkommission 1995, 24).
Als Reaktion dieser Vorwürfe führt die Kmk in den Jahren 1993 bis 1995 in mehreren Grundsatztagungen, insbesondere den sogenannten „Loccumer Gesprächen“[11], einen intensiven Erfahrungsaustausch mit eben diesen Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft, Verbänden der Lehrer-, Eltern-, und Schülerschaft sowie der Schulverwaltung. Es besteht Einvernehmen darüber, dass angesichts veränderter politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa sowie veränderter Aufgaben für Schule, Hochschule und Beruf neue Überlegungen zum gemeinsamen Verständnis der Ziele und Inhalte der gymnasialen Oberstufe erforderlich seien. Wesentliche Anregungen gibt eine von der Kmk gegründete Expertenkommission, deren Vorgaben als Grundlage für die Kmk Beschlüsse vom 1. Dezember 1995 und 25. Oktober 1996 hinsichtlich der Richtungsentscheidungen zur Weiterentwicklung der Prinzipien der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs angesehen werden.
Zur Organisationsstruktur der gymnasialen Oberstufe umfassen die Vorgaben der Kmk-Expertenkommission folgende Eckpunkte:
- Dreizehn Schuljahre stellen die Norm dar für den Abschluss des Gymnasiums bzw. vergleichbarer Schulformen mit dem Abitur; die Verkürzung auf zwölf Jahre ist möglich, wenn ein Mindeststundenumfang gesichert ist.
- Das Kurssystem als organisierendes Prinzip der gymnasialen Oberstufe wird beibehalten. Dazu gehört auch die Differenzierung in Grundkurse und Leistungskurse.
- Die Fächer Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache werden bei der Kurswahl für alle Schüler verpflichtende Auflage. Sie bilden gleichsam den Kern der Grundbildung. Alle Schüler müssen vier Prüfungsfächer im Abitur wählen und darin Prüfungen ablegen.
- Es wird eine Experimentierklausel vereinbart, die es einzelnen Ländern ermöglicht, sich – bei begleitender Evaluation – abweichend zu verhalten und die damit gemachten und verallgemeinerbaren wissenschaftlichen Erfahrungen zu dokumentieren. (Vgl. Kmk-Expertenkommission 1995, 11 ff., 158 ff.)
Im Ergebnis ihrer Beratungen muss die Kmk-Expertenkommission demnach so verstanden werden, dass sich das organisatorische Konzept der reformierten gymnasialen Oberstufe in seiner Zielsetzung und in den tragenden Prinzipien bewährt hat.
Ebenso wie an den Organisationsstrukturen wird auch an der Trias der Ziele der gymnasialen Oberstufe „Vertiefte Allgemeinbildung“, „Wissenschaftspropädeutik“ und „Studierfähigkeit“ festgehalten, wobei jedoch nach Ansicht der Kmk- Expertenkommission in der inhaltlichen Weiterentwicklung dieser Trias der eigentliche Handlungsbedarf einer Revision und Neuorientierung der Beschlüsse von 1972 bestehe (vgl. Kmk-Expertenkommission 1995, 158 ff.).
Die beschriebene massive Kritik durch die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen an dem zu diesem Zeitpunkt fast 25 Jahre alten Konzept versucht die Kommission dahingehend zu entkräften, dass man inmitten allgemeiner Pluralisierung nicht von der Schule verlangen könne, sowohl Gemeinsamkeiten in den Bildungsinhalten als auch Einheitlichkeit in den Werthaltungen hervorbringen zu müssen. Hingegen sollten die Hochschulen lernen, mit der unvermeidlichen Heterogenität zu leben. Die seitens der Wirtschaft und Hochschule vorgebrachten Defizitfeststellungen seien widersprüchlich, die empirische Basis schwach, die Zuschreibung der Ursachen an die gymnasiale Oberstufe fragwürdig und die Kurswahlen seien in Wahrheit schon jetzt ziemlich standardisiert (vgl. Kmk- Expertenkommission 1995, 158 ff.).
War die seit fünfundzwanzig Jahren anhaltende Kritik demnach wirklich unbegründet? Relativieren diese Aussagen der Kmk-Expertenkommission den so vehement geforderten Handlungsbedarf hinsichtlich einer Revision und Neuorientierung der Beschlüsse zur reformierten gymnasialen Oberstufe von 1972? „Wo sind“, wie beispielsweise Trebels fragt, „die Punkte, die Veränderungen bzw. Neubesinnungen erfordern?“ (Trebels 1999, 11).
Wer gehofft hat, die Expertenkommission werde mit zukunftsweisenden, einschneidenden Vorschlägen Entwicklungen zu einer höheren Interdisziplinarität, noch stärkerer Individualisierung, projektorientiertem Arbeiten o.ä. einleiten, wird enttäuscht gewesen sein. Noch enttäuschter ob dieser Regelungen müssen aber die Befürworter früherer Organisationsstrukturen der Oberstufe mit Fächerkanon und Klassenverband gewesen sein.
„Das Ergebnis nimmt sich“, so Huber, „vielmehr aus wie die Konsolidierung eines noch durchaus attraktiven Hauses durch Verstärkung tragender Pfeiler und Öffnung einiger Räume für mehr Licht und Luft. Das ist es wohl auch, nicht mehr und nicht weniger“ (Huber 1996, 45). Angesichts des beschriebenen heftigen Drängens und Drohens seitens der Hochschulen kann dieses Festhalten an den bisherigen Organisationsstrukturen allerdings als alles in allem überraschend bezeichnet werden.
Immerhin, der verpflichtende Fächerkanon ist umfassender geworden. Nun müssen die drei Fächer Deutsch, eine Fremdsprache und Mathematik durchgängig zum Abitur belegt und ihre Ergebnisse in die Gesamtqualifikation eingebracht werden. Früher waren es zwei, wobei im sprachlich-literarischen-künstlerischen Aufgabenfeld Deutsch oder eine Fremdsprache geprüft werden musste. Diese Vorgaben – so unverbindlich sie auf den ersten Blick erscheinen mögen – bringen für die Wahlfreiheit der Schüler doch einige Einschränkungen mit sich, wodurch die Möglichkeiten zur individuellen Profilbildung doch spürbar reduziert werden dürften. Huber verdeutlicht dies an einem Beispiel: „Wer Deutsch als Prüfungsfach wählt, muss nach fortbestehender Vorschrift auch Mathematik prüfen lassen. Wer dann gern noch eine andere Sprache oder Kunst oder Musik wählen würde, könnte eine andere Naturwissenschaft nicht mehr als Prüfungsfach anmelden. Nicht wenige SchülerInnen werden versucht sein, die ohnehin durchgängig belegpflichtigen Fächer zugleich zum Leistungskurs zu machen, sonst laden sie sich Mehrarbeit auf, verhalten sich – rein arbeitsökonomisch gesehen – dumm: die Kurswahlen werden noch eintöniger geraten als jetzt schon“ (Huber 1996, 46).
Die Beschlüsse wirken sich daher durchaus auf die Strukturen der Wahlfreiheit in der gymnasialen Oberstufe aus und zeigen, wenn auch nur ansatzweise und nach eingängiger Analyse der entstehenden Konsequenzen, doch eine richtungsweisende Entwicklung: Weg von einer individuell wählbaren, institutionellen Profilbildung, hin zu einem von außen vorgeschriebenen, verpflichtenden Fächerkanon. Inwieweit dies nun als Zugeständnis einer Nichtaufrechterhaltung der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Fächer gesehen werden darf oder aber als Antwort auf die von der Expertenkommission dargestellten veränderten Aufgaben für Schule, Hochschule und Beruf, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Es bleibt jedoch festzuhalten: Fächer wie Musik, Kunst, Religion und vor allem auch Sport dürften aufgrund der neuen Verbindlichkeit von drei Fächern und der dadurch entstehenden Vorgaben hinsichtlich Kurszusammensetzung im Abitur zunehmend unattraktiv werden – selbst wenn dies nur eine indirekte Folge der Neuerungen darstellt.
So sehr die Kmk-Expertenkommission jedoch auf eine Beibehaltung der grundlegenden strukturellen Festlegungen aus dem Jahre 1972 Wert legt, deutlichen Innovations- bzw. Handlungsbedarf sieht die Kommission – getreu der jahrzehntelangen bildungstheoretischen Diskussion – hinsichtlich der Lernprozesse und Lerninhalte innerhalb der einzelnen Fächer, um eine Qualitätssicherung des Abiturs und eine dementsprechende Studierfähigkeit aufrechterhalten zu können. Zusammenfassend lässt sich festhalten:
- „Durch Beibehaltung des Kurssystems hat die Kmk an dem Prinzip der individuellen Schwerpunktbildung, wodurch die formale Gleichberechtigung aller Fächer weitgehend erhalten bleibt, festgehalten; ebenso wird die Trias der Ziele: Vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik und Studierfähigkeit beibehalten.
- Verstärkter Handlungsbedarf wird in erster Linie in der Weiterentwicklung der Fachcurricula gesehen.
- Dem erzieherischen Aspekt kommt in dem Begriff der Wissenschaftspropädeutik im Vergleich zu früher eine stärkere, der kognitiven Anforderung gleichwertige Bedeutung zu.
- Die erzieherisch bedeutsame Individualisierung des Lernens wird gestärkt, im Unterricht initiierte Lernprozesse erfahren im Hinblick auf eine Schülerorientierung eine Aufwertung.
- Die explizite Gleichsetzung der Erziehungs- und Bildungsaufgabe mit dem Qualifikationsauftrag bedingt eine stärkere Schülerorientierung der Unterrichtsinhalte, wobei dem fächerübergreifenden Unterricht in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zukommt.
- Die Möglichkeit zur Behandlung komplexer Probleme der eigenen Lebenswelt soll im Mittelpunkt des Unterrichts stehen, wodurch die subjektive Bedeutung des Lernens verstärkt wird und somit an die erzieherische Aufgabe der Schule heranrückt.“ (Kmk-Expertenkommission 1995, 58)
In der Folgezeit wird die Gewichtung der einzelnen Aspekte seitens der Kmk weiter ausformuliert. Im Bereich der fachlichen Ziele – der Qualifikationskomponenten (vgl. Schulz 2000, 183) – soll die Vermittlung sogenannter „basaler Fähigkeiten“ eine Aufwertung erfahren, in denen es um Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit in der Muttersprache, um verständiges Lesen fremdsprachlicher wissenschaftlicher Texte und um Verständnis für mathematische Modellbildung und Symbole geht (vgl. Kmk 1999, 3). Eine Formulierung, die – trotz des beschriebenen Festhaltens der prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Fächer – vor allem die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik betreffen dürfte und diese dementsprechend gewichtet. Andererseits nehmen die Kmk Beschlüsse auch immer auf die erzieherischen Aufgaben Bezug, auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen wie „Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit“ (Kmk 1999, 4), deren unmittelbarer Bezug und untrennbare Verbindung zu dem Qualifikationsauftrag immer wieder herausgestellt wird.
In der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ (Beschluss der Kmk vom 7. Juli 1972 i.d.F. vom 16. Juni 2000) heißt es dazu: „Die zu erwerbenden Kenntnisse, Methoden, Lernstrategien und Einstellungen werden über eine fachlich fundierte, vertiefte allgemeine und wissenschaftspropädeutische Bildung und eine an den Werten des Grundgesetzes und der Länderverfassung orientierten Erziehung vermittelt, die zur Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft befähigen.“ Weiter heißt es in der Vereinbarung: „In allen Lernbereichen strebt der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe zugleich mit dem Erwerb eines inhaltlich spezifischen, strukturierten und regelorientierten Wissens die Fähigkeit an, selbständig zu lernen, zu arbeiten und über das eigene Lernen, Denken, Urteilen und Handeln zu reflektieren. Der Unterricht soll geistige Beweglichkeit, Phantasie und Kreativität fördern, wie er Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit und Ausdauer als allgemein wichtige Verhaltensweisen des Lernens und Arbeitens stärken soll“ (Kmk, 2000, 3 ff.). Diese Vereinbarung zeigt, auch schon in der Fassung von 1997, dass im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen neben dem Wissenserwerb ausdrücklich und gleichbedeutend die Vermittlung sozialer Kompetenzen gestellt wird. Legt die 1972er Kmk-Vereinbarung wissenschaftspropädeutisches Lernen vor allem im Sinne kognitiver Anforderungen als den Erwerb materialer und formaler wissenschaftlicher Rationalität aus, beansprucht nun das Verständnis von Wissenschaftspropädeutik den Schüler umfassender – und damit auch erziehender. Solche personalen und sozialen Kompetenzen ergänzen die bisher eher wissensvermittelnde Auslegung von Wissenschaftspropädeutik dahingehend, dass sie nicht allein auf die studienbezogenen Verwendungssituationen beschränkt bleiben, sondern durchaus auch dem erzieherischen Ziel einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung zugerechnet werden können und deshalb auch gerne als Schlüsselqualifikationen bezeichnet werden (vgl. Schulz 2000, 185).
Könnten die dargestellten Überlegungen und Forderungen an die vorliegenden Richtlinien und Lehrpläne demnach als Indiz dafür gesehen werden, den in der Vergangenheit verstärkt auf kognitive Anforderungen konzentrierten Auftrag der gymnasialen Oberstufe wieder mehr unter den beschriebenen Humboldtschen Vorstellungen einer allgemeinen Menschenbildung zu verstehen?
Aufschlussreich zu dieser These mag ein Blick auf die in der Vergangenheit durchgeführten Leistungsüberprüfungen[12] erscheinen, in deren Strukturen und – infolge der negativen Ergebnisse für deutsche Schüler – Veränderungsbestrebungen sich Parallelen zu den beschriebenen Entwicklungen nachzeichnen lassen.
Defizite des Leistungsniveaus deutscher Schüler im internationalen Vergleich sind nicht erst seit der Pisa[13] 2000 Studie bekannt, sondern werden bereits durch eine Anfang der sechziger Jahre durchgeführte und u.a. von Picht (1964) kommentierte Studie offenbar. Zehn Jahre später werden diese schlechten Ergebnisse durch eine von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement initiierte und national vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt durchgeführte Untersuchung bestätigt (vgl. Matthiesen 1974). Als Konsequenz der schlechten Ergebnisse werden jedoch allein Debatten über die Notwendigkeit eines Bildungskanons geführt. Diese werden vor allem seitens der Hochschulen in Zusammenhang mit der nachlassenden Studierfähigkeit eingefordert und orientieren sich inhaltlich verstärkt an den in den Untersuchungen abgefragten Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten der Fächer Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hinsichtlich der Umsetzung sogenannter Schlüsselqualifikationen gibt man sich hingegen optimistisch, diese personalen Kompetenzen – allerdings wohl zu Lasten abprüfbaren Faktenwissens – im Rahmen des allgemeinen Unterrichts den Schülern vermittelt zu haben (vgl. Matthiesen, ebd.).
In den Reaktionen auf die Mitte der neunziger Jahre durchgeführte und für deutsche Schüler ebenfalls sehr schlecht ausfallende Timss[14] -Studie herrscht wiederum Konsens, durch die Ergebnisse der größtenteils naturwissenschaftlich- mathematischen Aufgabenstellungen nur einen Ausschnitt des komplexen schulischen Aufgabenbereichs dargestellt bekommen zu haben. Wiederum besteht Einigkeit darüber, basale Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen – wenn auch nicht durch eine Überprüfung bestätigt – vermittelt zu haben. Und wiederum dient diese Annahme sowohl den Befürwortern des deutschen Schulsystems als Anlass, die Ergebnisse der Timss-Studie zu relativieren, als auch dessen Kritikern, den bereits geforderten Handlungsbedarf einer Intensivierung der naturwissenschaftlich-mathematischen Wissensvermittlung sowie die Formulierung eines Bildungskanons zu unterstreichen (vgl. Blum, Wiegand 1998).
Die Hoffnungen einer geleisteten Vermittlung basaler Kompetenzen sowie die einseitigen Veränderungsbemühungen, den Aspekt der faktischen Wissensvermittlung innerhalb des deutschen Qualifikations- und Erziehungsanspruchs zu stärken, relativieren sich jedoch mit der im Jahre 2000 durchgeführten und 2001 veröffentlichten Pisa-Studie. Pisa vernachlässigt Fragen einer curricularen Validität und konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Erfassung von Basiskompetenzen in variierenden Anwendungssituationen. Kanonbildend ist für Pisa vielmehr der reflexive Zugang zu unterschiedlichen, nicht wechselseitig substituierbaren Modi der Welterfahrung (vgl. Deutsches Pisa-Konsortium 2001, 19). Pisa verwährt sich vehement vor dem Anspruch, einen Horizont moderner Allgemeinbildung vermessen zu haben oder die Umrisse eines internationalen Kerncurriculums vorzugeben (vgl. Deutsches Pisa-Konsortium 2001, 21). Trotzdem ist durch die Überprüfung der notwendigen Basisqualifikationen Lesen, Mathematik und den Naturwissenschaften sowie der Überprüfung fächerübergreifender Kompetenzen wie selbstreguliertes Lernen, Einbeziehung von Problemlösen und Aspekten von Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erstmals ein Feld evaluiert worden, welches dem durch Humboldt vorgezeichneten komplexen Bildungsauftrag sehr nahe kommt (vgl. Tenorth 2000). Die in Pisa offengelegten Defizite bestätigen somit erstmals empirisch den seitens der Kmk-Expertenkommission formulierten Handlungsbedarf, offenbaren den Irrglauben, wenigstens im Bereich der personalen Kompetenzen den gesellschaftlichen Anforderungen an Schule gerecht geworden zu sein, und stützen die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der jeweiligen Fachcurricula.
Aber worin besteht nun konkreter Überprüfungs- bzw. Handlungsbedarf? Welche Konsequenzen können aus den skizzierten Leistungsüberprüfungen sowie den aktuellen Kmk-Beschlüssen, „sowohl erzieherische Aufgaben als auch fachliche und fachübergreifende Ziele zu erfüllen“ (Kmk 1999, 8), formuliert werden, ohne die Gefahr einzugehen, einen Kreis zu den Anfängen jahrzehntelanger Diskussionen geschlossen zu haben?
Im Sinne der geforderten Gleichwertigkeit hat die Kmk-Expertenkommission durch die ausdrückliche Übertragung der Inhaltsebene an die jeweiligen Fächer sicherlich Weitsicht bewiesen. Die Fächer sehen sich der Herausforderung gegenüber, ihren eigenen, spezifischen Beitrag zu leisten, mit dem die Trias der Ziele letztlich in der Gesamtheit aller Fächer als Auftrag der gymnasialen Oberstufe eingelöst wird. In Anbetracht des oft zitierten spezifischen Charakters eines jeden Faches hieße dies dann aber auch, dass der Beitrag eines Faches an der Trias der Ziele durchaus unterschiedlich sein kann.
Analog zur Entwicklung und Rechtfertigung der Aufgabenfelder (vgl. Kmk 1972, 14) steht demnach nicht mehr der Anteil eines jeden Aufgabenfeldes zur Erfüllung der Anforderungen zur Diskussion, sondern jedes Fach müsste sich diesem Anspruch stellen.
Mit der Übertragung der inhaltlichen Bestimmung dieses komplexen Anspruchs an die jeweiligen Fachcurricula hat sich die Kmk somit zwar vordergründig davon befreit, spezifische inhaltliche Vorgaben für ein jedes Fach zu formulieren, entbindet sich jedoch nicht davon, die Grenzen und allgemein notwendigen Bedingungen zur Einlösung der Trias der Ziele „Allgemeine Bildung“, „Wissenschaftspropädeutik“ und „Studierfähigkeit“ abzustecken.
Es kann sicherlich als Versäumnis der fachdidaktischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit bezeichnet werden, einer aufkommenden Vermischung dieser Begrifflichkeiten nicht konsequent entgegengewirkt zu haben, Begriffe wie Bildung oder Erziehung in ihrem allgemeingültigen Verständnis unreflektiert verwendet oder übernommen und so zu einer Aufweichung bzw. Beliebigkeit der inhaltlichen Ziele beigetragen zu haben. Die Kmk nimmt in ihren Beschlüssen zu diesem Problem durch eine inhaltliche Gewichtung der jeweiligen Ziele Stellung (vgl. Kmk-Expertenkommission 1995, 11 ff., 158 ff., dazu kommentierend Schulz 2000, 158) und versucht gleichsam, die fächerübergreifende Gültigkeit dieser Ziele zu wahren.
Im folgenden Kapitel soll dieser Ansatz weiter verfolgt werden. Einerseits in der Gewissheit, eine inhaltliche Begriffsabgrenzung aufgrund der Interdependenz der Ziele in ihrer Gesamtheit nicht vollends aufarbeiten zu können – andererseits mit dem Anspruch, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendeten Begriffe „Allgemeine Bildung“, „Wissenschaftspropädeutik“ und „Studierfähigkeit“ trennscharf voneinander verwenden zu wollen, wird vor der Folie der aktuellen Kmk Bestimmungen, Erkenntnissen aus den aktuellen Leistungsüberprüfungen (Pisa-Studie) sowie fachdidaktischen Definitionsansätzen der letzten dreißig Jahre versucht, die Trias der Ziele der gymnasialen Oberstufe hermeneutisch voneinander abzugrenzen.
2.1.1 Allgemeine Bildung
In der bildungstheoretischen Diskussion ist der Terminus „Allgemeinen Bildung“ wohl derjenige, dessen Bedeutung historisch am längsten und kontroversesten diskutiert wurde und auch noch diskutiert wird.
„Bildung“ oder „Allgemeinbildung“ ist ein entwicklungstheoretischer Begriff. Er bezeichnet eine (pädagogisch gesehen wünschenswerte) Verfasstheit der Person und den dahin führenden Prozess, unabhängig von spezifischen Verwendungssituationen (vgl. Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1988; Hansmann/ Marotzki 1988).
In den sechziger Jahren gilt der Begriff „Bildung“ als zu vage, zu traditionalistisch angegriffen und wird in der Curriculumtheorie ersetzt durch Begriffe wie „Lernen für“ oder „Qualifikationen für“ spätere Zwecke oder Situationen. In den damaligen Richtlinien und Lehrplänen findet sich der Bildungsbegriff in Formeln wie „Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung“ und „Wissenschaftspropädeutik“ wieder, bevor ihn in den achtziger Jahren Pädagogen wie bspw. Klafki erneut verwenden, weil sie für den Prozess und die Förderung der subjektiven Verarbeitung, Integration und Transzendierung all der Umwelt- und Qualifikationsanforderungen einen Zielbegriff brauchen (vgl. Klafki 1985, 12 ff.).
In Anlehnung an Huber (1994) wird im Folgenden exemplarisch allein auf drei wichtige Definitionen des Bildungsbegriffs eingegangen[15].
„Bildung ist zureichend nur definierbar als die vermittelnde Kategorie zwischen den Ansprüchen der objektiven Welt und dem Recht auf Selbstsein des Subjekts, zu dem die Freiheit zu Urteil und Kritik gegenüber allen Lebensbereichen gehört“ (Blankertz 1969, 16/ Blankertz 1974).
„Bildung ist eine Geistesverfassung, Ergebnis eines nachdenklichen Umgangs mit den Prinzipien und Phänomenen der eigenen Kultur“ (Hentig 1980, 109).
„Bildung muss zentral als Selbstbestimmungs- und Mitbestimmungsfähigkeit des einzelnen und als Solidaritätsfähigkeit verstanden werden“ (Klafki 1985, 17).
Steht bei Blankertz der Prozess der Selbstbildung durch Umformung der kulturellen Anforderungen im Vordergrund, verbindet Hentig Bildung mit der Fähigkeit zur Reflexion, einem Nachdenken, das sich aus eigen gemachten Erfahrungen ableiten lässt. Klafki stellt den demokratischen und politischen Aspekt in den Mittelpunkt seiner Definition; Merkmale, die dem weit reichenden Bereich des sozialen Lernens zuzuordnen sind. Gemeinsam ist allen Definitionen jedoch, und hierbei sei auf Parallelen zu dem Tutzinger Maturitätskatalog verwiesen, dass alle drei eine besondere Bedeutung dem Interesse an Aufklärung, Selbsterkenntnis und Selbstfindung des individuellen Subjekts in der Gesellschaft und der Gesellschaft mit ihm zukommen lassen. Weiterhin repräsentieren die ausgewählten Definitionsbeispiele auch dahingehend eine Grundintention, indem für keinen von ihnen das Allgemeine der Bildung durch einen Fächerkanon definierbar ist.
Die Problematik einer klaren Abgrenzung dieses Begriffs wird allerdings dadurch erschwert, dass in der Umgangssprache der allgemeine Bildungsbegriff immer wieder in Verbindung mit dem Wunsch nach einem definierbaren Grundwissen gebracht wird, das sich – allen Definitionen des Bildungsbegriffs zum Trotz – eben doch in erster Linie an einem vorgegebenen Fächerkanon orientiert und sehr starke Affinität zu dem Bergriff Allgemein wissen aufweist[16].
Um Missverständnisse im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorzubeugen, gilt es daher, eine Unterteilung des Bildungsbegriffs „materialer Anspruch der Sache“ (in aktueller Sprache: Wissenschaftsorientierung) sowie ‚formaler Bildungsanspruch der Person“ (in aktueller Sprache: Schülerorientierung) vorzunehmen. Auf eine dritte Unterteilung – die auf Klafki zurückgehende „kategoriale Bildung“ als Verbindung dieser beiden Bereiche im Sinne einer dialektischen Vermittlung der wechselseitigen Verschränkung der legitimen Erwartung von Mensch und Welt, von Wissen und Fähigkeiten – wird in Zusammenhang mit der Bestimmung des Begriffs der Schlüsselqualifikationen noch eingegangen.
In Anlehnung an die oben dargestellten übergeordneten Bildungsdefinitionen von Blankertz, Hentig und Klafki wird der Begriff der „Allgemeinbildung“ in der Folge zwar notwendigerweise im Sinne des materialen, dem gegebenen Wissen verhafteten Bildungsanspruch verstanden, gleichzeitig jedoch immer auch im Sinne des formalen Bildungsanspruchs des Schülers Verwendung finden müssen, der vornehmlich die Vermittlung von subjektiv erwünschten Kompetenzen umfasst und somit starke prozessorientierte Merkmale aufweist.
Die Aufgabe dieser Allgemeinbildung wird dadurch definiert, „die Voraussetzung zu schaffen, die für eine verständige, kritische und selbstdistanzierte Teilhabe am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben angesichts von Normdissens und der Tatsache vielfältiger Traditionen und Kulturen unentbehrlich ist“ (Kmk- Expertenkommission 1995, 72).
Um die umgangssprachlich vorgenommene Gleichsetzung des allgemeinen Bildungsbegriffs mit der Vermittlung produktorientierten, sachbezogenen Wissens entgegenzuwirken, sei an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen: Die in dem Zitat formulierte Aufgabe der allgemeinen Bildung setzt zwar eine Grundbildung – besser Grundwissen – voraus. Andererseits kommt dem formalen, subjektorientierten Bildungsanspruch eine mindestens gleichwertige Bedeutung zu, um sich eigenständig und prozessorientiert eine kritische und selbstdistanzierte Teilhabe zu ermöglichen. Der Bereich der allgemeinen Bildung im Sinne einer produktorientierten Aneignung von faktischem Wissen formuliert lediglich den materialen Anspruch der Sache und wird im Folgenden durch den Begriff „Schulische Grundbildung“ operationalisiert. Schulische Grundbildung wird somit als ein Teil der allgemeinen Bildung angesehen und wird sich durchaus mit Fragen eines Kerncurriculums bzw. eines notwendigen Fächerkanons beschäftigen. „Für diesen Teil[17] der allgemeinen Bildung gibt es, faktisch relativ unbestritten, auch einen international als Kerncurriculum ausgewiesenen Kanon schulischer Ziele und Inhalte. Dieser Kanon umfasst neben den Fächern der grundlegenden Kulturtechniken und Kommunikationsmedien, also der Muttersprache, der Mathematik und einer Fremdsprache, die Naturwissenschaften und historisch-gesellschaftliche Fächer. Erweitert um den Bereich musisch-ästhetischer Bildung bietet dieser Kanon der Grundbildung zugleich die Form, um auf gesellschaftliche Veränderungen und technologischen Wandel pädagogisch begründet zu reagieren“ (Kmk-Expertenkommission 1995, 72).
Für die weitere Begriffsverwendung bleibt somit festzuhalten: Allgemeinbildung bzw. allgemeine Bildung ist ein bedeutender Teil der Inhalte und Ziele der Schule und somit auch der gymnasialen Oberstufe. In Anlehnung an die Definitionen des Bildungsbegriffs von Blankertz, Hentig und Klafki bezeichnet dieser umfassende Terminus jedoch neben einer schulischen Grundbildung auch das breite Spektrum der Vermittlung sogenannter sozialer Kompetenzen, wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit sowie gesellschaftlicher und moralischer Werte bzw. Normen, und ist in seiner charakteristischen Prozesshaftigkeit auf Bereiche der ganzen gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgerichtet[18]. Das im alltäglichen Sprachgebrauch und leider auch des Öfteren in der einschlägigen Fachliteratur übliche Verständnis von allgemeiner Bildung im Sinne eines produktorientierten Kanons faktischer Wissensinhalte wird im weiteren Verlauf der Arbeit als schulische Grundbildung operationalisiert, die zwar als unverzichtbarer Teil der allgemeinen Bildung und Voraussetzung zur Entwicklung der geforderten Schlüsselqualifikationen angesehen wird, jedoch nicht auf diese reduziert bleibt. Die Expertenkommission verweist in ihren Empfehlungen explizit darauf: „Nach den Inhalten und Zielsetzungen lassen sich in diesem Kanon der Grundbildung immer noch die klassischen Komponenten der Bestimmung allgemeiner Bildung erkennen, sollen sie doch die Schüler auf staatsbürgerliches Handeln vorbereiten und sie zu allgemeiner Kommunikation befähigen“ (Kmk-Expertenkommission 1995, 72).
Für die im Folgenden zu bestimmende Definition der Studierfähigkeit bzw. deren Kriterien ist die allgemeine Bildung und in ihr die schulische Grundbildung somit die Voraussetzung, jedoch noch nicht die hinreichende Definition oder Vorgabe. So formuliert wiederum die Kmk-Expertenkommission: „Folgt man den geltenden Vereinbarungen, dann erweitern die Sekundarstufe II und die gymnasiale Oberstufe die Grundbildung zur Phase „Vertiefter Allgemeinbildung“. Jetzt wird verlangt, dass die Lernenden nicht nur in allgemeine Bedingungen der Kommunikation und die Voraussetzungen der Staatsbürgerrolle eingeführt werden, sondern zugleich in wissenschaftliche Verfahren und Erkenntnisweisen, und dass sie studierfähig werden, vor allem dadurch, dass die Lernenden solides Können und Wissen in bestimmten Fächern erwerben sowie Lern- und Studientechniken, Einstellungen und Verhaltensweisen beherrschen, die für intensives geistiges Arbeiten notwendig sind“ (Kmk- Expertenkommission 1995, 73).
Neben dem Terminus „Allgemeine Bildung“ mit all seinen dargelegten Facetten wird der Bereich der Bildung somit um den Begriff „Vertiefte Allgemeinbildung“ erweitert. Auch in diesem Fall ist und war die Versuchung groß, vertiefte Allgemeinbildung wieder eher als eine vertiefte schulische Grundbildung im Sinne einer nunmehr schwerpunktmäßigen Wissenschaftsorientierung zu sehen, obgleich das Adverb zugleich explizit den Gleichwertigkeitscharakter unterstreicht. Die klassische allgemeine Bildung kann somit als notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe gesehen werden, die auf die Studierfähigkeit vorbereitet, diese jedoch noch nicht sichert. Die allgemeine Bildung wird somit zweifach erweitert: Einerseits durch die Vertiefung des Allgemeinen, andererseits durch ihre wissenschaftspropädeutische Komponente (vgl. Kmk-Expertenkommission 1995, 73). Auch diese Formulierung zeigt, dass mit der Bezeichnung der Wissenschaftspropädeutik eine besondere Zielkomponente gemeint ist, die sich durch das Hervorgehen aus dem Begriff der allgemeinen Bildung und deren weit reichenden Charakteristika von einer reinen Wissenschaftsorientierung abhebt und im Folgenden definiert wird.
2.1.2 Wissenschaftspropädeutik
Formen und Forderungen nach einer Vorbereitung auf die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens sind zwar seit jeher in Verbindung mit den Zielen und Aufgaben der gymnasialen Oberstufe gebracht worden. Der Versuch einer ersten konkreten Begriffsbestimmung seitens der Kmk geht jedoch auf einen Beschluss des Jahres 1977 zurück, in dem es in den „Empfehlungen zur Arbeit in der gymnasialen Oberstufe“ vom 2. Dezember 1977 unter den Lernzielpunkten zum wissenschaftspropädeutischen Arbeiten heißt: „Auf der Grundlage selbständigen Lernens führt der Unterricht hin zur Kenntnis wesentlicher Strukturen und Methoden von Wissenschaften sowie zum Verständnis ihrer komplexen Denkformen; zum Erkennen von Grenzen wissenschaftlicher Aussagen und zur Einsicht in Zusammenhang und Zusammenwirken von Wissenschaften; zum Verstehen wissenschaftstheoretischer und philosophischer Fragestellungen, zur Fähigkeit, theoretische Erkenntnisse sprachlich zu verdeutlichen und anzuwenden“ (Kmk 1977, 4).
Schon in diesen Formulierungen wird deutlich, dass mit der Wissenschafts propädeutik eine besondere Zielkomponente gemeint ist, die in ihrer Besonderheit über das für alle Phasen des Lernens geltende Prinzip der Wissenschafts orientierung und der damit verbundenen Forderung an die Lehrpläne, dem Stand der wissenschaftlichen Forschung nicht zu widersprechen, hinausgeht.
Wie die Kmk-Expertenkommission achtzehn Jahre später weiter spezifiziert, werden im Ziel der Wissenschaftspropädeutik nicht mehr nur Strukturmerkmale der Schule und des Lehrplans oder Kompetenzen und Lehrweisen der Lehrenden thematisiert, sondern wohldefinierte Leistungsmerkmale des Lernenden selbst. Die wissenschaftspropädeutische Kompetenz, in der Wissen und Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen gebündelt sind, werden in der Oberstufe sowohl in den Leistungskursen als auch in den Grundkursen selbst zum Standard der Arbeit. Laut Kmk-Expertenkommission müsse es um Initiationen in die Denk- und Arbeitsweisen der Wissenschaften gehen, nicht um wissenschaftliche Arbeit selbst. Propädeutisch müsse die Arbeit insofern sein, als die Initiationen in die Wissenschaften von ihrer Reflexion und Kritik begleitet werden müssen (vgl. Kmk- Expertenkommission 1995, 73).
Diese Ausführungen, vor allem wiederum die explizite Forderung nach einer kritischen, reflexiven Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, konkretisieren die bereits 1977 formulierten Forderungen nach Vermittlung und Bewusstmachung der Grenzen von Wissenschaften. Deutlich wird vor allem eine subjektorientierte Schülerorientierung. Nicht allein Wissensvermittlung im Sinne eines wissenschaftsorientierten Lehrplanes, sondern zugleich kritische und reflexive Auseinandersetzung mit Denk- und Arbeitsweisen der Wissenschaft werden als Ziele formuliert. Ausgehend von dieser Forderung ist offensichtlich, inwieweit die Kmk-Expertenkommission die allgemeine Bildung einerseits durch die Wissenschaftspropädeutik und andererseits durch eine Vertiefung des Allgemeinen erweitert sieht.
Der Terminus der Wissenschaftspropädeutik umfasst die oben beschriebenen Merkmale des subjektorientierten formalen Bildungsanspruchs als auch des materialen Anspruchs der Sache. Wie bewusst und weit reichend dabei die Wortwahl „Propädeutik“ eingeschätzt werden darf, zeigt eine etymologische Beleuchtung des Begriffs.
Neben dem griechischen Präfix „pro“ leitet sich „pädeutik“ von dem griechischen Verb paideuein ab und wird im Deutschen entweder mit „unterrichten“ oder aber „erziehen“ übersetzt. Die Probleme einer semantischen Differenzierung[19] dieser Begriffe spiegelt die beschriebene bildungstheoretische Diskussion wieder. Sensibilisiert ob dieser Entwicklung könnte somit bereits in der terminologischen Wahl das Bestreben gesehen werden, sich über diese Differenzierung hinweg zu setzen und in einem Begriff den nun schon oft beschriebenen Qualifikations- und Erziehungsauftrag zu manifestieren. Somit dürften sich Ziele und Gegenstände der Wissenschaftspropädeutik auch keinesfalls allein durch einen rein ziel- oder produktorientierten Unterricht erreichen lassen, sondern bestenfalls durch einen Unterricht, der Qualifikations- und Erziehungsprozesse als Grundlage für einen kritischen und reflexiven Umgang mit Wissensinhalten initiiert.
Hinsichtlich der geforderten Hochschulreife kann jedoch auch eine gelungene wissenschaftspropädeutische Arbeit nicht allein als Indikator herangezogen werden. Wie schon für die allgemeine Bildung gilt auch in diesem Fall, dass sie in ihrer Bestimmung als notwendige, jedoch nicht als die hinreichende Bedingung der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe angesehen wird.
[...]
[1] So weist beispielsweise Gaschke auf den Irrglaube hin, „die deutschen Schulen hätten vor allem deshalb schlecht abgeschnitten, weil unsere Schulen in den vergangenen Jahren zu selten umgekrempelt worden seien. Richtig ist das Gegenteil: Im ganzen Bildungsbereich herrscht seit 30 Jahren Hyperaktivität. Seit ihrer Einführung in den siebziger Jahren ist zum Beispiel die gymnasiale Oberstufe in manchen Bundesländern sechs, sieben, acht Mal neu organisiert worden. Vielleicht sind Schüler und Lehrer gerade deshalb verwirrt, weil zu viel, zu oft, zu kurzatmig an den Schulen herumgedoktert wurde – ohne zu überprüfen, ob die Schüler beispielsweise in Teamarbeit, am Computer oder im Projektunterricht wirklich mehr lernen“ (In: Die Zeit vom 28.2.2002).
[2] „Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen vom 5.10.1998“, in: Amtsblatt NRW 1 (1998) 12, 223 – 242.
[3] Hier zu verstehen in Bezug auf den „Litauischen Schulplan“ von 1809, in dem es heißt: „Der allgemeine Schulunterricht geht auf den Menschen überhaupt ein, und zwar als gymnastischer ästhetischer didaktischer und in dieser letzteren Hinsicht wieder als mathematischer philosophischer, der in dem Schulunterricht nur durch die Form der Sprache rein, sonst immer historisch-philosophisch ist, und historischer auf die Hauptfunktion seines Wesens.“ (W. v. Humboldt, Litauischer Schulplan, IV 188f.) Aus dem Kontext, in dem die zitierte Stelle steht, wird deutlich, dass Humboldt unter „allgemeinem Schulunterricht“ den Unterricht versteht, den alle jungen Menschen erhalten sollen (Elementarschule und gelehrte Schule). Die Gegenstände des allgemeinen Schulunterrichts sind nicht auf spezifische berufliche Aufgaben bezogen und haben keine speziellen Ausbildungsinhalte zum Gegenstand. Vielmehr geht der Unterricht von Fragen, Inhalten und Anforderungen aus, die nach Humboldt für alle jungen Menschen von Bedeutung sind. Nach Humboldt reicht es nicht, den Menschen mit Wissen „vollzustopfen“, sondern er gibt mit der anthropologisch-bildungstheoretischen Strukturierung der inhaltlichen Ausrichtung des Unterrichts eine neue Struktur vor (Humboldt, ebd.).
[4] Es soll in diesem Zusammenhang nur kurz auf die Stellung der Universitäten sowie die gesellschaftlichen Möglichkeiten verwiesen werden, die eine Hochschulzugangsberechtigung mit sich brachte. Die Vorherrschaft deutscher Universitäten im 19. Jh. ist den Quellen zufolge unbestreitbar. Aus politisch/gesellschaftlicher Sicht wird als Ausgangspunkt für diese Entwicklung in der Literatur die Schlacht von Jena im Jahr 1806 angeführt, nach der Napoleon Berlin erreichte und die „starren Preußen“ zu wesentlich mehr Flexibilität gezwungen wurden (vgl. z.B. Watson 2001). Aus intellektueller Sicht ist es vor allem Johann G. Fichte, Christian Wolff und Immanuel Kant zu verdanken, dass die deutsche Forschung von ihrer lähmenden Bindung an die Theologie befreit wird und deutsche Gelehrte einen deutlichen Vorsprung vor ihren europäischen Gegenspielern auf den Gebieten der Philosophie und der Naturwissenschaften erreichen können. Deutsche Universitäten sind es auch, die erstmals Physik, Chemie und Geologie als den Geisteswissenschaften gleichwertige Fächer anerkennen. Dies führt dazu, dass unzählige Amerikaner und Briten wie z.B. Matthew Arnold und Thomas Huxley von dem geistigen Leben an den Universitäten in Deutschland schwärmen (vgl. Bradby 1939, 285 ff.); C. Eliot 1869 als Präsident der Havard University sogar als erster versucht, das deutsche System vor allem in Bereichen der Forschung an amerikanischen Universitäten nachzuahmen (vgl. Flexner 1930). Eine Zugangsberechtigung an deutsche Universitäten konnte somit tatsächlich schon als ein erster Schritt hin zu einem international anerkannten Abschluss und einer vielversprechenden Berufskarriere angesehen werden.
[5] Die Aktualität und Reichweite dieses somit seit 1947 andauernden Wunsches wird in der häufig zitierten Rede Roman Herzogs anlässlich des Berliner Bildungsforums deutlich, in der es heißt: „In einer Welt, die sich immer mehr in kleine Fachwelten aufsplittert, in denen Eingeweihte und Experten im jeweils eigenen Jargon kommunizieren, sollten wir nicht noch einer allzu frühen Spezialisierung Vorschub leisten. Die Palette unserer Pflichtschulfächer muß also breit bleiben oder besser: wieder breiter werden. Das heißt aber nicht, dass auf alle Schüler noch mehr stofflicher Inhalt zukommen wird. Im Gegenteil: Es geht darum, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und allen ein breites Grundwissen zu vermitteln, ob sie nun später Rechtsanwalt, Arzt, Techniker oder Polizeibeamter werden wollen.“ (Dokumentiert in: DIE ZEIT vom 07.11.1997, Nr.46.)
[6] Die von Flitner 1958 formulierten „Vier Initiationen“, die als Grundlage der Zielsetzungen des Tutzinger Maturitätskatalogs angesehenen werden, „um universitäre Studien beginnen zu können“ beinhalten:
Ein elementares Verstehen der christlichen Glaubenswelt und ihrer wesentlichen irdischen Schicksale
Ein philosophisch-wissenschaftlich-literarisches Problembewusstsein
Ein Verständnis für das Verfahren und die Grenzen der exakt-naturwissenschaftlichen Forschung und ihrer Bedeutung für die Technik
Ein Begreifen der Problemlage, die in der politischen Ordnung insbesondere durch die Französische Revolution, durch den Gedanken der Bürgermitverantwortung, der Rechtssicherheit und persönlichen Freiheit, der Völkerrechtsidee entstanden ist, und wie die politische Aufgabe und die gesellschaftliche Zuständigkeit einander beeinflussen (Flitner 1958, 46).
[7] „Kyklisch“, d.h. weder stofflich ausgeweitet und aufgehäuft, noch einseitig spezialisiert, sondern konzentriert auf einen Kernbestand geistiger Grunderfahrungen, in denen sich Ursprünge unserer geistigen, wissenschaftlich-technischen, sozialen, politischen und religiösen Situation fassen lassen, und von denen eigentlich niemand, der Wissenschaft studieren und verstehen und dann öffentliche Verantwortung tragen will, sich sollte dispensieren dürfen. (Vgl. Scheuerl 1969)
[8] Ziel ist es, „Ansprüche der Gesellschaft“ wie auch „individuelles Bedürfnis“ mit der Bemühung um eine ausgewogene Berücksichtigung beider Aspekte zu verwirklichen (Kmk 1972, 13). Die 1977 erschienenen „Empfehlungen zur Arbeit in der gymnasialen Oberstufe“ verweisen in diesem Zusammenhang auf die „Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung als wesentlichen Erziehungsziel“ und einer „wissenschaftspropädeutische(n) Grundbildung mit Vertiefung in Schwerpunktbereichen“ als besondere Ziele der gymnasialen Oberstufe (vgl. Kmk 1978, 3).
[9] Zur Notwendigkeit allgemeingültiger Vergleichskriterien wird an dieser Stelle auf die Diskussion vor dem Hintergrund des Numerus clausus verwiesen. Eine erste verfassungsgerichtliche Überprüfung dieses Verfahrens ergibt 1972, dass der Numerus clausus – die durch Engpässe der Studienplätze im Fachbereich Medizin einsetzende Praxis, Studenten nach dem Notendurchschnitt ihres Abiturzeugnisses auszuwählen – nur auf gesetzlicher Grundlage und nur unter strengen Voraussetzungen als verfassungsmäßig angesehen wird. Vor allem soll die „Auswahl und Verteilung nach sachgerechten Kriterien mit einer Chance für jeden an sich hochschulreifen Bewerber, möglichst unter Anwendung einheitlicher Kriterien“ sichergestellt sein, bevor dem Zulassungsverfahren nach Leistung (Abiturnote) und Wartezeit (zur Sicherung der Chancen auch der Bewerber mit schlechteren Noten) seitens des Bundesverfassungsgerichts „trotz einiger Bedenken“ zugestimmt wird (vgl. Zusf. zu BverfG – 8.2.77, 6 ff.). Verwiesen sei zudem auf die Einführung der Unterscheidung zwischen den Begriffen „Hochschulzugang“ und „Hochschulzulassung“. Die Bedenken des Verfassungsgerichts erweisen sich nur zu bald als begründet, da seitens der Schüler, aber auch Lehrer nunmehr zwei Prozesse große Bedeutung erfahren: die ganz gezielte Kalkulation und Manipulation der Durchschnittsnoten, die Aufwärtsverschiebungen der Notendurchschnitte, das Unterlaufen des Notengefüges durch Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges usf. – und andererseits eine immer größer werdende Aufmerksamkeit auf die enorme Verschiedenheit, die unüberschaubar gewordene Vielfalt der Hochschulreife (vgl. Flitner/Lenzen 1977, 10). Als Reaktion auf das Urteil wird in dem von den Ländern verabschiedeten Staatsvertrag formuliert und später im Hochschulrahmengesetz 1976 festgeschrieben, dass die Studienplätze „überwiegend nach dem Grad der gemäß § 27 (nämlich durch das Hochschulberechtigungszeugnis) nachgewiesenen Qualifikation für das gewählte Studium“ und „in den Nachweisen nach § 27 ausgewiesene Leistungen, die über die Eignung für den jeweiligen Studiengang besonderen Aufschluss geben können“, vergeben werden sollen (§ 32, Abs.3).
In Kenntnisnahme dieser Vereinbarung, insbesondere dem Ausdruck „Qualifikation für das gewählte Studium“ darf nun nicht mehr daran gezweifelt werden, dass bestimmte Noten des Abiturzeugnisses gemeint sind, obwohl immer wieder bestätigt wird, dass das Abitur seiner ganzen Anlage nach keine Spezialqualifikation für einen besonderen Studiengang, sondern eine allgemeine Hochschulreife enthalte.
[10] Zur Aktualität dieser Diskussion sei an dieser Stelle bereits vorab auf die vom BmBF am 18.2. 2003 in Berlin herausgegebene Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards verwiesen.
[11] Beschlüsse der Kmk vom 25.2.1994 und 2.12.1994
[12] Es sei darauf verwiesen, dass Inhalte und Zielsetzungen der durchgeführten Leistungsüberprüfungen sich allein auf die Sekundarstufe I bezogen haben. Aufgrund der Aktualität und der gesamtgesellschaftlichen Beachtung dieser Tests, vor allem der kürzlich veröffentlichten Pisa-Studie, erscheint eine Berücksichtigung jedoch unumgänglich.
[13] Pisa steht für „Programme for International Student Assessment“ – ein Programm zur zyklischen Erfassung basaler Kompetenzen, das von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt wird und dessen Ziel es ist, den OECD-Mitgliedsstaaten vergleichende Daten über die Ressourcenausstattung, individuelle Nutzung sowie Funktions- und Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen (vgl. OECD 1999). Die Indikatoren beziehen sich auf die Bereiche Lesekompetenz (Reading Literacy), mathematische Grundbildung (Scientific Literacy) und fächerübergreifende Kompetenzen (Cross-Curricular-Competencies).
[14] TIMSS steht für „Third International Mathematics and Science Study“ und ist ein mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundbildungstest. Im Rahmen von TIMSS wurde versucht, einen Kompromiss zwischen Anwendungsorientierung und curricularer Anbindung der Testaufgaben an Standardstoffe der Sekundarstufe I und II zu erreichen.
[15] Zur weiteren Differenzierung des Diskurses zur Bildungstheorie sei an dieser Stelle auf Hansmann/ Marotzki (1988) verwiesen.
[16] Beispielhaft für dieses Bildungsverständnis im Sinne von Bildungswissen könnte an dieser Stelle das von Schwanitz 1999 verfasste und seitdem auf den Bestsellerlisten zu findende Werk „Bildung, alles was man wissen muss“ angeführt werden, in dem bereits der Titel eine Gleichsetzung von Wissen und Bildung suggeriert. Andererseits zeigt der Erfolg aber auch, wie sehr nach einem Bildungskanon verlangt wird. Möglicherweise eine Folge der beschriebenen, uferlosen Bildungsdebatte oder gar die Angst und Einsicht, Bildungswissen in der Schule nicht vermittelt bekommen zu haben?
[17] „diesen Teil“ verstanden als schulische Grundbildung der allgemeinen Bildung (vgl. Kmk 1995, 72).
[18] Auf die Bedeutung der Vermittlung sozialer Kompetenzen und gesellschaftlicher Werte im Bildungssystem hat wiederum Roman Herzog in seiner bereits zitierten Ansprache anlässlich des Berliner Bildungsforums 1997 ausdrucksvoll hingewiesen: „Es ist ein Irrglaube anzunehmen, ein Bildungssystem komme ohne Vermittlung von Werten aus! Viele Lehrer leisten diese Wertevermittlung durch ihr Beispiel und durch Diskurse in ihren jeweiligen Fächern. Aber es ist auch auf wertevermittelnde Fächer zu achten. Ich wünsche mir ein Bildungssystem, das wertorientiert ist. Ich weiß sehr wohl, daß jede Art von Wertekatalog seit Jahren unter den Ideologieverdacht fällt, zumindest wenn er sich nicht auf Allgemeinplätze zurückzieht. Aber Bildung darf sich nicht auf die Vermittlung von Wissen und funktionalen Fähigkeiten beschränken! Zur Persönlichkeitsbildung gehört neben Kritikfähigkeit, Sensibilität und Kreativität eben auch das Vermitteln von Werten und sozialen Kompetenzen. Dabei denke ich durchaus auch an die Vermittlung von Tugenden, die gar nicht so altmodisch sind, wie sie vielleicht klingen: Verläßlichkeit, Pünktlichkeit und Disziplin, vor allem aber der Respekt vor dem Nächsten und die Fähigkeit zur menschlichen Zuwendung. Wir sollten uns auch die Zusammenhänge bestimmter Werte stärker bewußt machen: Toleranz kann es nur geben, wo es auch einen eigenen Standpunkt gibt. Eine Auseinandersetzung mit fremden Denk- und Wertesystemen setzt das Wissen über die eigene Herkunft und die eigenen prägenden Traditionen voraus.“ (Dokumentiert in: Die Zeit vom 7. November1997, Nr.46.)
[19] Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die deutsche Sprache in der semantischen Differenzierung dieser Termini eine Ausnahme darstellt (vgl. bspw. auch die Etymologie sowie deutsche Übersetzungsmöglichkeiten des anglo- amerikanischen Begriffs education).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832488949
- ISBN (Paperback)
- 9783838688947
- DOI
- 10.3239/9783832488949
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – Sportwissenschaften, Sportdidaktik I
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juli)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- sportdidaktik prüfungsfach abiturprüfung schulversuch systemtheoretische beobachtungsmehtodik gleichwertigkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de