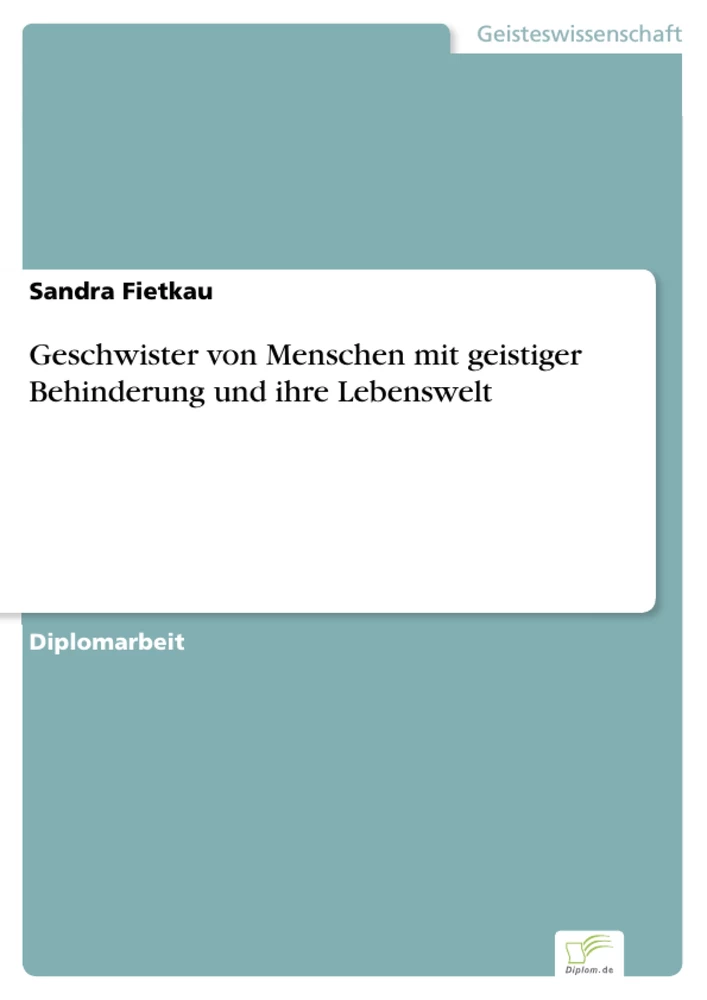Geschwister von Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Lebenswelt
Zusammenfassung
Zurzeit liegt die Lebenserwartung in Deutschland bei ungefähr 75 Jahren für Männer und bei 81 Jahren für Frauen. Die Zeit, die Geschwister zusammen verbringen, ist also relativ lang länger als die gemeinsame Zeit mit den Eltern oder mit Lebenspartnern. Deshalb ist es diese Beziehung wert, näher betrachtet zu werden. Wie groß sind die gegenseitigen Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der Geschwister? Wie verlaufen Geschwisterbeziehungen?
Es gibt allerdings auch Geschwisterbeziehungen, die unter anderen Voraussetzungen stehen und teilweise ganz anders verlaufen. Was passiert, wenn eine Person zusammen mit einer Schwester oder einem Bruder mit geistiger Behinderung aufwächst? Inwiefern verändert sich hier der Verlauf der Geschwisterbeziehung? Wie beeinflussen die besonderen Erlebnisse das Verhalten und die Einstellungen des nichtbehinderten Geschwisters?
Am Anfang der Beobachtungen über Familien mit einem Mitglied mit geistiger Behinderung wurde hauptsächlich untersucht, wie das Leben der Eltern sich durch die Geburt eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen verändert. Erst einige Zeit später wurde entdeckt, dass auch das Leben der nichtbehinderten Geschwister durch die Schwester oder den Bruder mit geistiger Behinderung beeinflusst wird.
So müssen sie zum Beispiel sehr früh lernen, Rücksicht zu nehmen und werden verstärkt für Aufgaben im Haushalt oder bei der Betreuung des Geschwisters herangezogen. Dies kann, abhängig von vielen verschiedenen Faktoren inner- und außerhalb der jeweiligen Familie, positive oder negative Auswirkungen auf das Leben dieser nichtbehinderten Geschwister haben.
Die besondere Form der Geschwisterbeziehung zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren nichtbehinderten Geschwistern wird im Rahmen dieser Diplomarbeit näher betrachtet. Angesichts der Fülle von Aspekten, die beim Zusammenleben mit einem Geschwister mit geistiger Behinderung von Bedeutung sind, konnten diese nicht alle umfassend behandelt werden. Deswegen wurde der Schwerpunkt direkt auf die Geschwisterbeziehung gelegt und diese auf ihre Entwicklung und Veränderung im Laufe des Lebens hin untersucht.
Im ersten Teil der vorliegenden Diplomarbeit werden, nach einer kurzen Betrachtung des Begriffs der geistigen Behinderung und einigen Definitionsversuchen, neue Blickwinkel der Forschung dargestellt. Danach wird die besondere Geschwisterbeziehung zwischen einem nichtbehinderten Kind, bzw. Jugendlichen, und seinem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Geschwisterbeziehung – die längste Beziehung des Lebens
2. Besonderheiten bei Geschwistern mit geistiger Behinderung
2.1 Geistige Behinderung
2.2 Veränderungen in der Forschung
2.2.1 Ein neuer Blickwinkel
2.2.2 Der Ökologische Ansatz nach Bronfenbrenner
2.2.3 Äußere Einflüsse auf die Geschwisterdyade
3. Die Geschwisterbeziehung in Kindheit und Jugend
3.1 Die Geburt eines Kindes mit geistiger Behinderung
3.2 Die Entwicklung der Geschwisterbeziehung
3.3 Die Rolle des nichtbehinderten Geschwisters in der Kindheit
3.4 Pubertät und Adoleszenz als Krise und Chance
4. Die Geschwister als Erwachsene
4.1 Die Befragung
4.1.1 Methodisches Vorgehen
4.1.2 Die Stichprobe
4.2. Ergebnisse der Befragung
4.2.1 Rückblickende Beurteilung des Aufwachsens in einer besonderen Geschwisterbeziehung
4.2.2 Verhältnis zwischen den Geschwistern im Erwachsenenleben
4.2.3 Pläne für das Älterwerden
4.3 Schlussfolgerungen
5. Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft
5.1 Berührungsängste und Verhaltensunsicherheiten
5.2 Sozialpolitische Aspekte
5.3 Akzeptanz und Integration
6. Hilfen für die nichtbehinderten Geschwister
6.1 Hilfreiche personale Faktoren
6.2 Hilfen durch das direkte Umfeld
6.3 Hilfen von außen
6.4 Indirekte Hilfen
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
8.1 Monographien und Zeitschriften
8.2 Graue Literatur
8.3 Internetquellen
9. Anlagen
Ein Tag ohne Daniel?
Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil Daniel immer schon da war. Daniel ist mein kleiner älterer Bruder. Eigentlich ist er ja schon öfter sogar für eine Woche weg gewesen, aber es wurde zumindest von ihm gesprochen. Und wenn man einen Tag so tun würde, als ob es Daniel nicht gäbe? Auch das ist nicht einfach. Ein Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr, vielleicht ein Leben ohne Daniel, ich glaube, so etwas gibt es für mich gar nicht.
Stefanie, 13 Jahre
(Knees & Winkelheide 1999, 24)
1. Geschwisterbeziehung – die längste Beziehung des Lebens
„Geschwisterbeziehungen reichen in die ersten vorsprachlichen Tage der Kindheit zurück. Sie sind die dauerhaftesten aller Bindungen. Eltern sterben, Freunde verschwinden, Ehen lösen sich auf, aber Geschwister können ihre Verbindung, genau genommen, nicht aus der Welt schaffen;…“ (Lüscher 1997, 20)
Derzeit wächst nur jedes vierte Kind in Deutschland als Einzelkind auf. Jedes zweite hat einen Bruder oder eine Schwester und jedes fünfte zwei Geschwister (Internet 1). Brüder und Schwestern begleiten sich meist das ganze Leben. Sie werden zusammen groß, haben dieselben Eltern, teilen wichtige Erlebnisse. Außerdem beeinflussen sie sich gegenseitig und wirken auf die Entwicklung der oder des Anderen ein.
Zurzeit liegt die Lebenserwartung in Deutschland im Schnitt bei ungefähr 75 Jahren für Männer und bei 81 Jahren für Frauen (Internet 2). Die Zeit, die Geschwister zusammen verbringen, ist also relativ lang – länger als die gemeinsame Zeit mit den Eltern oder mit Lebenspartnern. Deshalb ist es diese Beziehung wert, näher betrachtet zu werden. Wie groß sind die gegenseitigen Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der Geschwister? Wie verlaufen Geschwisterbeziehungen?
Es gibt allerdings auch Geschwisterbeziehungen, die unter anderen Voraussetzungen stehen und teilweise ganz anders verlaufen. Was passiert, wenn eine Person zusammen mit einer Schwester oder einem Bruder mit geistiger Behinderung aufwächst? Inwiefern verändert sich hier der Verlauf der Geschwisterbeziehung? Wie beeinflussen die besonderen Erlebnisse das Verhalten und die Einstellungen des nichtbehinderten Geschwisters?
Gemäß des Mikrozensus von 2003 leben in Deutschland rund 8,4 Millionen Menschen mit Behinderung, davon sind cirka 6,7 Millionen Menschen schwerbehindert (Pfaff & Mitarbeiterinnen 2004, 1184). Wie viele dieser Menschen eine geistige Behinderung haben, kann aufgrund der gemeinsamen Auflistung von geistiger Behinderung zusammen mit Lernstörungen, organisch bedingten Wesensänderungen und psychischen Erkrankungen nicht genau angegeben werden.
Wenn aber von der Gesamtzahl der in dieser Gruppe aufgelisteten Menschen (ungefähr 1.153.000 Personen), die eindeutig nicht zutreffenden Gruppen wie z.B. die Menschen mit Suchtkrankheiten herausgerechnet werden, kommt man auf eine ungefähre Zahl von 830.000 Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland (Stand 12/2003, Internet 3).
Durch den allgemeinen Geburtenrückgang und durch verbesserte medizinische Präventions- und Therapiemöglichkeiten im Besonderen erwarten Busch und Pfaff (1996), dass die Anzahl jüngerer Menschen mit Behinderung abnehmen wird. Dennoch ist eine Prognose der demographischen Entwicklung kaum möglich. Auf der anderen Seite ist nach Roberto (1993) durch die bessere medizinische Versorgung von einer Zunahme der Lebenserwartung für Menschen mit geistiger Behinderung auszugehen, weswegen sich auch die Dauer der Geschwisterbeziehungen verlängert.
Menschen mit geistiger Behinderung sind ganz speziell auf die Hilfe von Eltern und Geschwistern angewiesen. Wenn die Eltern noch leben, ist es meist selbstverständlich, dass diese die Betreuungsaufgaben übernehmen und alle wichtigen Dinge im Leben des Menschen mit Behinderung regeln.
Heutzutage ist jedoch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder mit Behinderung ihre Eltern überleben und die nichtbehinderten Geschwister nach dem Tod der Eltern für ihre Geschwister verantwortlich sind. Somit bleibt die Geschwisterbeziehung über eine längere Zeit gekennzeichnet durch den hohen Grad an emotionaler und instrumenteller Unterstützung (Seltzer & Kraus 1993).
Diese besondere Form der Geschwisterbeziehung zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren nichtbehinderten Geschwistern soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher betrachtet werden. Angesichts der Fülle von Aspekten, die beim Zusammenleben mit einem Geschwister mit geistiger Behinderung von Bedeutung sind, kann diese Arbeit nicht dem Anspruch gerecht werden, alle umfassend zu behandeln. Deswegen soll der Schwerpunkt direkt auf die Geschwisterbeziehung gelegt und diese auf ihre Entwicklung und Veränderung im Laufe des Lebens hin untersucht werden.
Um die Lebenswelt von Geschwistern erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung genauer betrachten zu können und um eine realistische Darstellung der Situation zu ermöglichen, wurde im Rahmen dieser Arbeit den betroffenen Geschwistern anhand eines Fragebogens direkt die Möglichkeit gegeben, sich zu ihrer Beziehung zur Schwester oder zum Bruder mit geistiger Behinderung zu äußern. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen zusammen mit den Ergebnissen anderer Studien im Verlauf dieser Arbeit wiedergegeben werden.
Nach einer kurzen Betrachtung des Begriffs der geistigen Behinderung und einigen Definitionsversuchen werden im zweiten Kapitel außerdem neue Blickwinkel der Forschung, speziell der ökologische Ansatz von Bronfenbrenner (1981), dargestellt. Im dritten Kapitel wird die Geschwisterbeziehung daraufhin untersucht, wie sich die Beziehung zwischen Kindern mit geistiger Behinderung und ihren nichtbehinderten Geschwistern im Verlauf der Kindheit und Jugend entwickelt und was für eine Rolle das nichtbehinderte Geschwister während des gemeinsamen Aufwachsens einnimmt.
Auch Menschen mit geistiger Behinderung werden heute älter als früher, sie erhalten viel Hilfe aus der Familie und bleiben oft ein Leben lang abhängig (Lüscher 1997). Deswegen wird versucht, die besondere Geschwisterbeziehung anschließend im Laufe des Erwachsenenlebens der Geschwister darzustellen und zu betrachten, was sich im Laufe des Älterwerdens verändert. Dies soll unter anderem anhand der Ergebnisse aus der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Befragung diskutiert werden.
Außer zu den Besonderheiten in der Beziehung zu ihrem Geschwister wurden die Teilnehmer der Befragung auch nach ihrer Meinung zum Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft befragt. In der Gesellschaft wurde dieser Punkt ebenso schon des Öfteren diskutiert und ist, gemeinsam mit den Aussagen der Geschwister, Inhalt des fünften Kapitels. Abschließend sollen in Kapitel sechs noch verschiedene Arten von Hilfsmöglichkeiten für die nichtbehinderten Geschwister dargestellt werden, wobei diese in Hilfen innerhalb der Familie, Hilfen von außen und indirekte Hilfen unterteilt werden.
Um kein Geschlecht zu benachteiligen wird während der Ausführungen in dieser Diplomarbeit zwischen der weiblichen und männlichen Sprachform abgewechselt. Sofern sich der jeweilige Kontext nicht direkt auf ein Geschlecht bezieht, sind damit selbstverständlich beide Geschlechter angesprochen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen zur sprachlichen Stigmatisierung durch die Bezeichnung „Behinderte“ wird außerdem, soweit passend und im Satzverlauf möglich, von „Menschen mit Behinderung“ gesprochen, um den Menschen selber und nicht seine Behinderung in den Vordergrund zu rücken.
2. Besonderheiten bei Geschwistern mit geistiger Behinderung
2.1 Geistige Behinderung
„Auf den geistig behinderten Menschen läßt sich lediglich hinweisen, er ist begrifflich nicht zu fassen. Die Definition ‚geistige Behinderung’ scheitert an der Ratlosigkeit desjenigen, der dieses Phänomen beschreiben und interpretieren will, da er die existentielle Wahrheit und Wirklichkeit mit seinen Kriterien und Argumenten nicht erreicht, in der sich der geistig behinderte Mensch vorfindet und definiert.“ (Thalhammer 1974, zit. n. Holtz 1994, 16)
Entsprechend dieser Aussage von Thalhammer ist keine umfassende Definition von geistiger Behinderung möglich. Da es aber nach Krebs (1996, 43) ein „ureigenstes menschliches Bedürfnis“ ist, alles benennen zu können, sollen im Folgenden einige Definitionsversuche dargestellt werden.
Geistige Behinderung genau von anderen Behinderungen abzugrenzen ist nicht möglich und eine Einteilung jeweils abhängig vom Standpunkt und den Wertvorstellungen des Einschätzenden. Meist werden bei solchen Einordnungen die betroffenen Menschen mit Behinderung nicht beteiligt, es werden Aussagen über die betroffenen Personen gemacht, sie werden zum Objekt von Erklärungen (Speck 1993).
Menschen mit geistiger Behinderung stellen einen sehr heterogenen Personenkreis dar. Somit wird die Einteilung in Definitionen zu einem komplexen Gegenstand, konzentriert sich meist auf Mängel oder Defizite und endet in Negativ-Zuschreibungen und diskriminierenden Bewertungen (Baur 2003, Jakobs 1998). Diese an den Defiziten orientierte Haltung wurde auch bei folgender Definition aus einem medizinischen Fachlexikon angewendet:
Behinderung, geistige: (engl.) mental handicap; Bezeichnung für angeborene oder frühzeitig erworbene Intelligenzminderung, die mit einer Beeinträchtigung des Anpassungsvermögens einhergeht; Einteilung nach dem Schweregrad der Intelligenzminderung in leichte bis schwerste geistige Behinderung; Prävalenz in der Gesamtbevölkerung: 0,5-0,7%, häufig in Zusammenhang mit anderen (psychischen oder körperlichen) Störungen; …“ (Pschyrembel 2004, 206)
Hier wird geistige Behinderung nach dem Grad der Intelligenzminderung eingeteilt. Es gibt aber noch weitere Kriterien, anhand der sich geistige Behinderung klassifizieren lässt, z.B. nach der sozialen Kompetenz, auf der Verhaltensebene, nach Entwicklungsaufgaben, aufgrund der Ätiologie (Herkunft bzw. Ursache, z.B. bei einer nachweisbaren organischen Bedingung der geistigen Behinderung) oder nach pädagogischen Aspekten (Holtz 1994). Die im Brockhaus-Lexikon aufgeführte Definition versucht, einige dieser Kriterien mit einzuschließen:
„geistige Behinderung, Intelligenzminderung, Minderbegabung, veraltete Bezeichnung Oligophrenie, Schwachsinn, Verminderung der intellektuellen Fähigkeiten, der sprachl. Entwicklung und der motor. Fertigkeiten unterschiedl. Grades mit der Einschränkung bzw. Unfähigkeit zur selbstständigen, zweckmäßigen Lebensführung. Damit verbunden sind die Begrenzung der Lebensbewältigungstechniken, der sozialen Fertigkeiten und die Beeinträchtigung des schul. Bildungsgangs.“ (Brockhaus 2004, 823)
Dennoch ist diese Definition immer noch stark geprägt durch eine „defektologische“ Sichtweise, die geistige Behinderung als Zustand oder Eigenschaft beschreibt und sich an Defiziten orientiert. Boban und Hinz (1993) beschreiben aber neben der „defektologischen“ noch eine zweite, die so genannte „dialogische“ Sichtweise. Diese sieht geistige Behinderung als dynamischen Prozess des Behindertwerdens, als Entwicklung und betrachtet die Kompetenzen, die trotz der geistigen Behinderung vorhanden sind (zur tabellarischen Gegenüberstellung der defektologischen und dialogischen Sichtweise siehe Anhang 1).
Diese Betrachtungsweise wird auch von anderen Autoren vertreten. Sie verstehen Behinderung als Prozess, der sich unter vielfältigem Einfluss sozialer Faktoren in der zwischenmenschlichen Beziehung ergibt. Menschen sind nicht von Grund auf behindert, ihre geistige Behinderung entwickelt sich demnach im Prozess des wechselseitigen Austauschs zwischen ihnen als Individuum und ihrer Umwelt (Lempp 1997, Thimm & Wieland 1987).
Auch die WHO leitet ihre Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit aus dieser Sichtweise ab (DIMDI 2004). Die Klassifikation ist in zwei Bereiche unterteilt (ebd., 9): Den ersten Bereich stellen die Körperfunktionen und –strukturen dar. Es wird untersucht, welche körperlichen oder organischen Einschränkungen vorhanden sind. Danach geht es um Aktivitäten und Partizipation, d.h. es wird betrachtet, inwieweit die jeweilige Person aktiv sein und am Leben der Gesellschaft teilnehmen (partizipieren) kann. Dabei wird Behinderung aber nicht als Bezeichnung einer Komponente, sondern nur als Oberbegriff verwendet, um Stigmatisierung zu vermeiden, und definiert sich als:
„…ein Oberbegriff, der alle Körperfunktionen und Aktivitäten sowie Partizipation (Teilhabe) umfasst; entsprechend dient Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe).“ (ebd., S. 9)
Im Gegensatz zur Betrachtung von Defiziten und Schwächen hat die dialogische Haltung, die das Entstehen von Behinderung im zwischenmenschlichen Prozess betont und die vorhandenen Kompetenzen einer Person betrachtet, eine deutlich positivere Sichtweise auf Menschen mit geistiger Behinderung. Deswegen soll sie den weiteren Ausführungen als Grundlage dienen.
2.2 Veränderungen in der Forschung
2.2.1 Ein neuer Blickwinkel
Geschwisterbeziehungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren nichtbehinderten Geschwistern sind ein relativ neues Thema in der Forschung. Während des Aufwachsens von Kindern mit geistiger Behinderung ist die Mutter meist als Hauptbezugsperson für das Kind verantwortlich und so besteht zwischen ihnen die augenscheinlich intensivste Beziehung.
Deshalb wurde diese Bindung auch am meisten untersucht und es wurde geprüft, inwiefern die Mutter das Kind beeinflusst und umgekehrt. Die Geschwister liefen lange Zeit „nebenher“ und es war in der Forschung offenbar nicht von Interesse, ob und wie sie durch ein Geschwister mit geistiger Behinderung beeinflusst werden.
Verhältnismäßig spät spricht Edmundson (1985) von einer „discovery of siblings“ (zit. n. Seifert 1989, 12) und meint damit die Entdeckung der Geschwister als wichtiges Forschungsthema. Die seit Mitte der 60er Jahre hauptsächlich im angloamerikanischen Sprachraum durchgeführten Untersuchungen hatten meist die weißen Kinder oder Jugendliche der Mittelschicht zur Zielgruppe und wollten herausfinden, welche negativen Auswirkungen das Aufwachsen mit einem Geschwister mit geistiger Behinderung auf das nichtbehinderte Geschwisterkind hat (Lüscher 1997, Gibbs 1993).
Als Untersuchungsmethode wurden oft Befragungen durchgeführt, wobei anstelle der Kinder auch deren Eltern oder Lehrer befragt wurden, wenn die Kinder aufgrund ihres Alters noch keine eigenen Angaben machen konnten. Außerdem wurden die Kinder bei gemeinsamen Aktivitäten mit den Geschwistern mit geistiger Behinderung beobachtet. Diese beiden Methoden sind wegen ihrer subjektiven Untersuchungsweise recht umstritten, deswegen fanden später psychologische Testverfahren und auch Verhaltensfragebögen Anwendung in der Untersuchung von Geschwisterbeziehungen (Seifert 1989).
Trotz der neuen Methoden waren die Studien immer noch geprägt von der Frage nach negativen Auswirkungen des Aufwachsens mit einem Kind mit geistiger Behinderung. Es wurde nur nach Entwicklungsgefährdungen und Problemen gesucht, bei einem Kind mit geistiger Behinderung wurden für die Geschwister automatisch defizitäre Entwicklungsbedingungen vorausgesetzt. Auf den Gedanken, auch nach positiven Auswirkungen zu suchen, kamen die Forscher erst später (Tröster 2001).
Inzwischen sind Studien nicht mehr auf negative Auswirkungen festgelegt und räumen ein, „…that growing up with ‚a difference in the family’ […] can offer the child a unique opportunity to confront society’s discriminations and gain perspective on the deeper meaning of life.“ (Gibbs 1993, 345).
Allerdings gibt es immer noch einige Kritikpunkte, die auch in heutigen Studien nicht ganz beseitigt wurden. Meist weisen die Untersuchungen eine recht große Altersbreite der untersuchten Geschwister auf, weswegen die Ergebnisse nie direkt auf eine Altersgruppe bezogen werden können. Der Kontakt zu den freiwilligen Teilnehmern der Studien wird oft im Rahmen einer schon angefangenen Therapie hergestellt, es nehmen also meist Geschwister teil, die bereits auf Grund von Problemen in Behandlung sind.
Des Weiteren wird keine Unterscheidung bezüglich der Behinderungsformen des Geschwisters durchgeführt. Es fehlen vielfach Angaben zur Art der Funktionsbeeinträchtigung oder zur Schwere der Behinderung, weswegen nicht klar aufgezeigt werden kann, welche Aspekte der Behinderung die Geschwisterbeziehung wie beeinflussen. Eine Kontrollgruppe wird meist ebenfalls nicht eingesetzt (Tröster 2001, Seifert 1989).
Obwohl die bisherigen Studien bezüglich der Durchführung und ihrer negativen Fragestellung kritisch betrachtet werden können, waren die Ergebnisse teilweise doch sehr relevant und sollen für die weitere Betrachtung der Geschwisterbeziehungen in den folgenden Kapiteln herangezogen werden.
2.2.2 Der Ökologische Ansatz nach Bronfenbrenner
Neu in der Forschung ist die Betrachtung des Umfelds der Geschwister im Rahmen von Studien über Geschwisterbeziehungen. Die Umwelt hat sowohl direkten, als auch indirekten Einfluss auf das Verhalten und Erleben der Geschwister und deshalb ist es nötig, diese in Untersuchungen mit einzuschließen. „Ökologie“ ist eigentlich ein biologischer Begriff und „...bezeichnet die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und Umwelt. Soziologen und später auch Psychologen haben den Begriff übernommen und auf die sozialen, institutionellen und kulturellen Beziehungen der Menschen bezogen.“ (Seifert 1989, 31).
Einer der ersten, der diese äußeren Einflüsse auf ein Individuum beschrieben und in Ebenen eingeteilt hat, ist der amerikanische Wissenschaftler Urie Bronfenbrenner. Sein zentrales Anliegen war die Untersuchung der äußeren Bedingungen, unter denen ein Kind aufwächst:
„Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befaßt sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozeß wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten beeinflußt, in die sie eingebettet sind.“ (Bronfenbrenner 1981, 37)
In seiner Definition der menschlichen Entwicklung bezeichnet Bronfenbrenner diese als Ergebnis der Wechselbeziehung zwischen dem menschlichen Organismus und seiner Umwelt. Der Mensch entwickelt sich also nicht allein aus sich selbst, sondern wird von der Umwelt maßgeblich beeinflusst, wirkt aber auch auf diese ein und es entsteht eine wechselseitige Beziehung. Somit kommt der Umwelt des Individuums und der subjektiven Wahrnehmung dieser Umwelt durch das Individuum eine große Bedeutung für die individuelle Entwicklung zu (Seifert 1989).
Um die Vielzahl der Einflüsse, die beim Aufwachsen auf ein Kind einwirken, zu ordnen, entwirft Bronfenbrenner ein Modell aus vier Systemen, wobei jedes System eine Ebene der Umwelt des Kindes darstellt. Er beginnt mit der direkten Umwelt, also der Familie und endet mit dem großen Rahmen des Staates:
- Mikrosystem
“Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt.“ (Bronfenbrenner 1981, 38)
(nach Seifert (1989, 32) für das Kind z.B. Familie, Schulklasse oder Freundeskreis)
- Mesosystem
“Ein Mesosystem umfaßt die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist…“ (ebd., 41)
(nach Seifert (1989, 32) für das Kind z.B. Beziehungen zwischen Elternhaus, Schule und Freunden)
- Exosystem
“Unter Exosystem verstehen wir einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflußt werden.“ (ebd., 42)
(nach Seifert (1989, 32) für das Kind z.B. Arbeitsplatz oder Bekanntenkreis der Eltern)
- Makrosystem
“Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzliche formale und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung […], die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen könnten, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Weltanschauungen und Ideologien.“ (ebd., 42)
(nach Seifert (1989, 32) sind dies „…die kulturellen, ökonomischen, sozialen, technologischen und politischen Bedingungen einer Gesellschaft.“)
Das Verhalten des Umfelds im Rahmen der verschiedenen Systeme wirkt sich auf das Individuum aus. Der Einfluss der Familie auf die Geschwisterbeziehung ist direkt sichtbar, allerdings können auch die höheren Systeme auf die Familie und damit auf die Geschwisterbeziehung einwirken und diese verändern.
So beeinflusst z.B. die Reaktion der Gesellschaft auf Menschen mit Behinderung indirekt die Einstellung der nichtbehinderten Geschwister. Die Systeme und die Position des Individuums in oder zu ihnen sind aber nicht festgelegt oder bleiben das ganze Leben gleich, sie sind auf Grund von individueller Entwicklung und äußeren Ereignissen im Lauf des Lebens einem dynamischen Wandel unterzogen. So wird sich z.B. das Mikrosystems eines Kindes durch die Geburt eines Geschwisters stark verändern (Seifert 1989).
2.2.3 Äußere Einflüsse auf die Geschwisterdyade
Bronfenbrenner (1981, 72) definiert eine so genannte „Primärdyade“ als eine Beziehung zwischen zwei Personen, die durch Gegenseitigkeit (Reziprozität) gekennzeichnet ist. Tätigkeiten, die das jeweilige Mitglied einer Dyade vornimmt, wirken direkt auf den Anderen ein und deswegen werden sie normalerweise untereinander abgestimmt. Es besteht eine affektive Beziehung zwischen den beiden an der Dyade beteiligten Personen, egal ob diese Beziehung durch positive, negative oder ambivalente Gefühle gekennzeichnet ist.
Die Primärdyade besteht auch dann, wenn die Beteiligten nicht zusammen sind, da sie trotzdem noch starke Gefühle füreinander haben und an den Anderen denken. Außerdem besteht in einer Dyade ein großer Einfluss auf die gegenseitige Entwicklung. Alle diese Eigenschaften einer Dyade treffen auf die Geschwisterbeziehung zu und somit kann sie auch als „Geschwisterdyade“ bezeichnet werden (ebd., 72f).
Das Modell der Ökologischen Umwelt wird von vielen Autoren benutzt, um die Auswirkungen der Umwelt auf die Geschwisterbeziehung zu erläutern:
„The place in which development occurs includes the ecology and the locally adapted environment in which the siblings and their family live. The culture includes the meanings, beliefs, values and conventional practices learned and shared by members of a community.” (Weisner 1993, 53)
Wenn Bronfenbrenners Ansatz nun konkret auf die Geschwisterbeziehung zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren nichtbehinderten Geschwistern übertragen wird, so bedeutet dies, dass man nicht allein die Beziehung betrachten kann, um gewisse Entwicklungen und Gegebenheiten zu erklären. Es müssen auch immer die individuellen Faktoren der Umwelt mit einbezogen werden, die einen entscheidenden Einfluss auf die Geschwisterbeziehung haben, so z.B.:
- Individuelle Bedingungen der Geschwister
- Geschlecht, Geburtsrangplatz, Familiengröße
- Art und Ausmaß der Behinderung
- Beziehungen innerhalb der Familie
- Einstellungen der Eltern, partnerschaftliche und eheliche Zufriedenheit
- Interaktionsqualität zwischen den Geschwistern
- Lebensbedingungen der Familie
- Sozioökonomischer Status, Schichtzugehörigkeit, Wohnsituation
- Soziales Netzwerk der Familie
- Verwandte, Freunde, Nachbarn
- Infrastruktur des Wohnorts
- Ambulante Dienste, Kurzzeiteinrichtungen, Freizeit, Bildungsangebote
- Akzeptanz von Behinderung innerhalb der Gesellschaft
- Sozialpolitik
(Seifert 1997, 245f; Simeonson & Mc Hale 1981, zit. n. Kasten 1993, 115)
Diese Aufzählung umfasst sowohl individuelle Faktoren der Geschwister als auch Einflüsse des Mikrosystems Familie auf die Geschwisterbeziehung, z.B. die Auswirkungen der elterlichen Partnerbeziehung auf ihre Kinder. Darüber hinaus werden auch Faktoren des Mesosystems, z.B. die Beachtung des sozialen Netzwerks, und Einwirkungen aus dem Makrosystem, z.B. sozialpolitische Maßnahmen, mit berücksichtigt.
Eine andere Darstellung wurde von Furman und Buhrmeister (1985; zit. n. Lüscher 1997) in einem Flussdiagramm vorgenommen. Ursprünglich beinhaltete diese Auflistung allerdings nur die Familie als Mikrosystem der Geschwisterbeziehung und betrachtete nur die Einflüsse, die innerhalb dieser direkten Umwelt auf die Beziehung einwirken können. Bei der Übernahme in ihre eigene Publikation hat Lüscher (ebd.) das Diagramm um den Faktor der Gleichaltrigengruppe erweitert, da ihrer Meinung nach der Einfluss dieser Gruppe auf die Geschwisterbeziehung so groß ist, dass er in dieser Aufzählung nicht fehlen darf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Variablen der Familienkonstellation sind neben der Familiengröße und der Geschwisteranzahl das relative Alter der Geschwister, deren Altersunterschied, die Geschlechterzusammensetzung sowie den Geburtsrangplatz. Die Eltern-Kind-Beziehungen werden dahingehend untersucht, wie Eltern und Kinder sich untereinander verhalten und inwiefern die Eltern auf die Geschwisterbeziehung Einfluss nehmen.
Bei der Geschwisterbeziehung selbst wird neben den einzelnen Machtpositionen und dem Status der Geschwister beobachtet, wie viel Nähe und Wärme zwischen ihnen herrscht und ob Rivalität oder Konflikte in der Beziehung vorkommen. Nach einer Betrachtung des Einflusses der Gleichaltrigengruppe oder Peergroup auf die Geschwisterbeziehung, die besonders im Jugendalter eine zunehmende Bedeutung hat, liegt ein weiterer wichtiger Punkt in den persönlichen Faktoren der Geschwister. Hierunter sind die kognitiven Fähigkeiten, das Sozialverhalten und weiteren Persönlichkeitseigenschaften der Kinder zu verstehen.
In den folgenden Kapiteln soll nun die Geschwisterbeziehung von Menschen mit geistiger Behinderung zu ihren nichtbehinderten Geschwistern unter Einbeziehung dieser Faktoren und des Ökologischen Ansatzes nach Bronfenbrenner (1981) untersucht werden.
3. Die Geschwisterbeziehung in Kindheit und Jugend
3.1 Die Geburt eines Kindes mit geistiger Behinderung
Für Eltern stellt die Geburt eines Kindes mit geistiger Behinderung eine Krisensituation dar. Obwohl im Zuge von Vorsorgeuntersuchungen und besseren Diagnosemöglichkeiten heute schon viele Eltern vorab über eine eventuelle Behinderung ihres Kindes informiert wurden, müssen sie sich nach dessen Geburt auf die neue Situation einstellen und sich mit der Behinderung ihres Kindes auseinandersetzen.
Dieser Bewältigungsprozess kann ganz grob in vier Phasen unterteilt werden, wobei Dauer und Intensität der Phasen von Person zu Person schwanken und auch nicht immer bei beiden Elternteilen synchron verlaufen.
Direkt nach der Geburt kommt die Phase des Schocks. Sie ist bestimmt durch große Verwirrung und Lähmung von Aktivität. Einige Zeit später tritt dann die Reaktionsphase ein. Die Eltern versuchen, sich mit ihren Ängsten, Enttäuschungen und Schuldgefühlen auseinanderzusetzen und so viel wie möglich über die Behinderung ihres Kindes zu erfahren. Danach kommt die Phase der Adaptation, der Anpassung. Sie wird auch Erholungsphase genannt, denn nun können die Eltern die Behinderung erstmals akzeptieren und unternehmen konkrete Schritte zur Betreuung und zur Förderung ihres Kindes. Abschließend kommt die so genannte Orientierungsphase, die durch zukunftsorientiertes Handeln geprägt ist und deren erfolgreiche Bewältigung das Ende der Krise darstellt (Tatzer et al. 1985, 193f).
Durch die Geburt eines Kindes mit geistiger Behinderung wird das Mikrosystem Familie massiv verändert; die Zukunftspläne, der Alltag, das Leben der Eltern, alles muss an das Kind angepasst werden. Wenn man sich dieses System mit seinen Mitgliedern als eine Art ‚Mobile’ vorstellt, so ist durch das Hinzukommen des neuen Teils das Gefüge sehr stark ins Wanken geraten und es muss erst ein neues Gleichgewicht geschaffen werden, bei dem jedes Familienmitglied seinen Platz findet (ebd.).
Sargent (1983, zit. n. Tatzer et al. 1985) beschreibt die Herausforderungen, die ein Kind mit geistiger Behinderung für die Familie darstellt, auf drei Ebenen: Auf der kognitiven Ebene müssen die anderen Familienmitglieder Verständnis für die Behinderung und ihre Konsequenzen aufbringen.
Daneben muss eine emotionale Annahme stattfinden und die Behinderung des Kindes gefühlsmäßig verarbeitet werden. Zusätzlich bringt dieses neue Familienmitglied einen enormen zeitlichen und körperlichen Aufwand mit sich, vor allem für die Eltern, da diese nun plötzlich eine Reihe von außerordentlichen Tätigkeiten zu erledigen haben.
Wenn das Kind mit geistiger Behinderung als erstes Kind in die Familie geboren wird, so haben die Eltern mehr Zeit und Raum, sich an die neue Situation anzupassen und die Behinderung ihres Kindes zu verarbeiten. Sie können sich auf dieses Kind konzentrieren und ihm viel Aufmerksamkeit schenken. Haben sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit Behinderung jedoch bereits ein weiteres Kind, ist die Situation eine ganz andere. Neben dem Säugling und der eigenen Krise aufgrund der Behinderung des Kindes kommt noch ein weiteres Kind hinzu, das Bedürfnisse hat und Zeit einfordert.
Für dieses erstgeborene Kind stellen die Geburt eines Geschwisters und die Veränderung des Systems Familie eine Krise dar, die der Psychologe Alfred Adler „Entthronungstrauma“ genannt hat (Kasten 2001, 47). Das Kind verliert seine Position als einziges Kind und muss nun lernen zu teilen. Am Anfang ist es die Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern, später dann z.B. Spielsachen oder Süßigkeiten. Außerdem ändern sich durch die neue Zahl der Familienmitglieder eventuell die finanzielle Situation oder auch die Erziehungsideale der Eltern (Achilles 2002).
„Wenn ein neues Baby geboren wird, müssen alle Kinder etwas von ihren Eltern ‚abtreten’. Die Kinder, die ‚zuerst da waren’, betrachten den Neuankömmling mit gemischten Gefühlen. Vielleicht freuen sie sich auf einen neuen Spielkameraden, genauso gut könnten sie aber auch schmollen, weil sie ‚entthront’ wurden. […] Das bislang jüngste (oder einzige) Kind verliert seine Rolle als Baby, es wird nun zum großen Bruder oder zur großen Schwester.“ (Miller 1997, 171)
Im Durchschnitt ist ein Kind bei der Geburt des Geschwisters zwei Jahre alt. Es befindet sich dann gerade in einer Übergangsphase, in der es beginnt, erste eigene Erfahrungen zu machen und sich aus der engen Beziehung zu den Eltern zu lösen. Nun kommt aber ein neues Kind in die Familie, das alles das machen darf, was dem ‚großen’ Kind mühevoll abgewöhnt wurde.
So darf es z.B. aus der Flasche trinken, trägt Windeln und wird lange Zeit auf dem Arm umher getragen. Somit entsteht eine Konfliktsituation, das Kind ist verwirrt und empfindet das Baby als Bedrohung, da es die eigene Position in der Familie in Frage stellt. Um dieser Unsicherheit zu entfliehen, kann es zu einem Rückfall in babyhaftes Verhalten kommen (Oriesek-Savioz 1988).
Zu diesem Zeitpunkt ist es für die weitere Entwicklung des nichtbehinderten Geschwisters und auch für die Anfänge der Geschwisterbeziehung sehr entscheidend, wie sich die Eltern verhalten. Trotz der Geburt des Kindes mit geistiger Behinderung und der eigenen psychischen Belastung müssen sie sich genügend Zeit nehmen, um auf das nichtbehinderte Kind einzugehen.
Sie müssen versuchen, die Bedürfnisse des ‚großen’ Kindes genauso zu beachten, wie sie sich auch um das Neugeborene kümmern. Indem sie ihrem älteren Kind die neue Situation erklären und ihm eine Möglichkeit zum Kontakt mit dem neuen Geschwister geben, helfen sie dabei, dass das Kind, gemäß dem Bild des Mobiles, seine neue Position im veränderten Familiengefüge finden kann und sich das gesamte System wieder zu einer Einheit zusammenfügt.
„Fühlt sich jedes einzelne [Kind, S.F.] in seiner individuellen Art von den Eltern geachtet und akzeptiert, wird es fähig werden, das andersartige Geschwister als solches zu tolerieren und zu achten.“ (Oriesek-Savioz 1988, 20f)
Findet diese Anpassung und Neuorientierung allerdings nicht statt, wird das Erlebnis der Geburt des Geschwisters zum Schock, dessen Bewältigungsprozess sich unter Umständen bis ins Erwachsenenalter hinziehen kann. Teilweise treten Anpassungsschwierigkeiten auf, die sich in Aggressivität, Rückzugstendenzen, Isolation und Ablehnung äußern und auch das Verhältnis zu den Eltern, besonders zur Mutter, stark beeinflussen. Diese traumatischen frühkindlichen Erfahrungen prägen das spätere Sozialverhalten und wirken sich negativ auf die Geschwisterbeziehung aus (Kasten 2001).
3.2 Die Entwicklung der Geschwisterbeziehung
Die Zeit der frühen Kindheit ist nach Petri (1994) eine Phase emotionaler und körperlicher Verbundenheit zwischen den Geschwistern, sie verbringen fast die gesamte Zeit zusammen und üben eine „lebendige, fröhliche, angstfreie“ Kommunikation (ebd., 29). Emotionen werden ausgetauscht, die Geschwister haben intensiven Körperkontakt und sind sehr stark wechselseitig aufeinander bezogen. Während dieser Phase wird das Fundament für die Geschwisterbeziehung gelegt und es entwickelt sich die Basis für ein gemeinsames Vertrauen.
Aufgabe der Eltern ist es, diese Kontakte zu ermöglichen und die Anfänge der Bindung zwischen den Geschwistern zu fördern. Die Geschwister sollten gerade in den ersten gemeinsamen Lebensmonaten sehr viel Zeit miteinander verbringen, da sich die entscheidenden Grundlagen der Geschwisterbeziehung bereits bis zum 24. Lebensmonat ausgebildet haben (Dunn & Kendrick 1982, zit. n. Lüscher 1997).
Bei einem Kind mit geistiger Behinderung liegt das Problem in den besonderen Bedürfnissen und der Notwendigkeit der Betreuung durch die Eltern. Das Kind steht in symbiotischer Verstrickung zu einem Elternteil, meist der Mutter, da diese für die Pflege und Betreuung der Kinder zuständig ist. Das Familiengeschehen und der gesamte Alltag werden durch das Kind mit Behinderung dominiert und es erhält sehr viel Aufmerksamkeit. Da das Geschwister mit geistiger Behinderung die oberste Position in der Familienhierarchie einnimmt, bleibt nicht immer genügend Zeit für das nichtbehinderte Kind übrig (Tröster 2001, Tatzer et al. 1985).
Neben dem hohen Bedarf an Pflege und Betreuung schildern Stoneman und Brody (1993) noch weitere individuelle Faktoren des Kindes mit geistiger Behinderung, die einen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung haben. So kommt es z.B. darauf an, wie groß die gesundheitlichen Belastungen des Kindes sind und ob die Geschwister ohne Einschränkungen miteinander spielen dürfen. Drohen ständig gesundheitliche Krisen, ist ein normaler Umgang und ungehemmtes Spielen wahrscheinlich nicht möglich.
Des Weiteren grenzt auch eine körperliche Behinderung, die eventuell zusätzlich zur geistigen Behinderung vorhanden ist, die Spielmöglichkeiten der Geschwister ein. Ist das Kind mit geistiger Behinderung aggressiv oder hört es nicht auf Anweisungen des nichtbehinderten Geschwisters, kann dies die Beziehung zusätzlich belasten und führt dazu, dass das nichtbehinderte Kind sich weniger mit seinem Geschwister beschäftigt. Somit ist eine altersgemäße, ungehemmte Kommunikation zwischen den Geschwistern nicht immer möglich.
Hat das Geschwister mit geistiger Behinderung starke Einschränkungen in seinen kognitiven, sprachlichen oder sozialen Fähigkeiten, wirkt sich dies negativ auf die Interaktion zwischen den Geschwistern aus. Trotzdem wurde aber durch mehrere Studien belegt, dass Geschwisterpaare, bei denen ein Kind eine geistige Behinderung hat, normalerweise genauso viel Kontakt haben wie andere Geschwister und dass sie viel Zeit zusammen verbringen (Tröster 2001, Stoneman & Brody 1993, Abramovitch et al. 1987 & 1982).
„The findings of these studies demonstrated that sibling pairs that include children with disabilities were similar to other sibling pairs in the amount of interaction and the affect demonstrated. However, the role relationships in sibling pairs with one sibling with a disability were more asymmetrical, with the non-disabled sibling demonstrating more helping, teaching, managing, and dominating behaviors.” (Boyce & Barnet 1993, 171)
Wie bei Boyce und Barnet deutlich wird, gibt es aber doch einen Unterschied in der Interaktion bezüglich der Symmetrie des Verhaltens. Ausgehend von der Theorie des sozialen Lernens nach Bandura „…wird angenommen, daß das behinderte Geschwister vom Vorbild des gesunden Geschwisters lernt.“ (1977, zit. n. Kasten 2001, 178).
Das nichtbehinderte Geschwister versucht, sich in die Lage des Geschwisters mit geistiger Behinderung zu versetzen, um sich besser auf dessen Bedürfnisse und Fähigkeiten einstellen zu können. Es kommt zu einer ungleichen Rollenverteilung, einer so genannten Rollenasymmetrie, die auch im Spielverhalten der Kinder sichtbar wird.
Die nichtbehinderten Kinder passen das Spiel und ihr Verhalten den Möglichkeiten des Geschwisters mit geistiger Behinderung an und wählen weniger wettbewerbs- oder leistungsorientierte Spiele (Tröster 2001). Sie nehmen durch diese Fördersituation also eine Art Vorbildfunktion für ihr Geschwister mit geistiger Behinderung ein. Allerdings müssen Spielsituationen bei diesen Geschwistern eher geplant und durch die Eltern initiiert werden als bei ‚normalen’ Geschwisterpaaren (Miller 1997).
Bei einem Kind mit geistiger Behinderung ist die Beziehung zwischen den Geschwistern meist nicht gleichwertig, sondern wird vom nichtbehinderten Geschwister dominiert (zur Rolle des nichtbehinderten Geschwisters siehe Kapitel 3.3):
„Wenn das dominante, direktive Verhalten des nichtbehinderten Geschwisterkindes als Ausdruck seines Bemühens zu werten ist, die Kompetenzunterschiede in den kognitiven Fertigkeiten zu kompensieren, wären die ausgeprägten asymmetrischen Geschwisterbeziehungen dann zu erwarten, wenn eines der Kinder aufgrund der Behinderung in seiner kognitiven Entwicklung beeinträchtigt ist.“ (Tröster 2001, 8)
Zwischen nichtbehinderten Geschwisterpaaren entwickelt sich aus der Liebe untereinander und durch eine diese positive Beziehung bestärkende Elternliebe ein soziales Verantwortungsgefühl, welches durch Rollenspiele und wechselseitige soziale Verantwortung geübt werden kann. Dieses Üben im geschützten Rahmen dient als Grunderfahrung für spätere soziale Beziehungen (Lüscher 1997, Petri 1994).
Aufgrund der Rollenasymmetrie und der teilweise eingeschränkten Interaktion ist dies bei Geschwistern mit einem Kind mit geistiger Behinderung nicht immer so möglich. Geschwister mit geistiger Behinderung reagieren auf Gefühle des nichtbehinderten Geschwisters unter Umständen unangemessen oder gar nicht. Eine Erwiderung ihrerseits können sie oft ebenfalls nicht ausdrücken (Gamble & Woulbroun 1993).
Neben Faktoren wie der Rollenasymmetrie und den Interaktionsfähigkeiten spielen bereits seit der frühen Kindheit die Variablen der Familienkonstellation eine große Rolle. So beeinflussen z.B. die Zufriedenheit der Mutter, das emotionale Klima in der Familie und deren finanzielle Lage die Geschwisterbeziehung.
Außerdem wirken die Art, wie Probleme innerhalb der Familie gelöst werden oder die ethnische Herkunft der Familie direkt oder indirekt auf die Geschwister ein. Auch sozial-psychologische Faktoren, d.h. der kulturelle und familiäre Umgang mit der Behinderung und deren Definition sind entscheidende Faktoren (Furman 1993, Stoneman & Brody 1993, Grossman 1972).
Je nachdem, in welcher Stadt, welchem Viertel und mit wie viel Geld die Familie lebt und wie sie mit der Behinderung umgeht, sind die Möglichkeiten für die Geschwister unterschiedlich. Hackenberg (1987) fand außerdem eine Verbindung zwischen der Zufriedenheit der Mutter und der Beziehung zwischen den Geschwistern. Ist die Mutter zufrieden mit ihrer Rolle, kann sie auf die einzelnen Bedürfnisse ihrer Kinder besser eingehen und die Erziehungssituation förderlicher gestalten (ebd., 207).
Außerdem haben Persönlichkeitsvariablen der Mutter, wie z.B. ihre Einstellungen zu den Kindern, eigene Perspektiven, Lebenstechniken oder Erziehungshaltungen einen Einfluss auf die Verarbeitungsformen der Geschwister. Es zeigt sich, dass eine positive Einstellung der Mutter dem nichtbehinderten Kind dabei hilft, seine eigene Rolle innerhalb der Familie besser wahrnehmen zu können (ebd.).
Während des gemeinsamen Aufwachsens von Geschwistern wird ihre Beziehung gefestigt und das ältere Geschwister dient als Modell und Vorbild für die Aktivitäten des Alltags. Geschwister können sich in ihrer Entwicklung fördern, aber auch gegenseitig herausfordern (Cicirelli 1982). Hierbei ist ein positives elterliches Vorbild sehr wichtig, denn am Anfang übernehmen Kinder die positive Einstellung, die die Eltern ihren Kindern gegenüber haben und imitieren deren Verhalten (Achilles 2002, Kasten 2001).
Das Verhalten unter den Geschwistern ist unter anderem auch noch abhängig vom Altersunterschied der Geschwister. So zeigt sich, dass bei größerem Altersabstand auch mehr soziales Verhalten beobachtet werden kann (Abramovitch et al., 1987 & 1982).
Im Laufe des Aufwachsens kommt es außerdem zu sozialer Konkurrenz, die Geschwister vergleichen sich untereinander und treten in eine Art Wettbewerb. Nachdem sich die einzelnen Kinder zunächst noch mit ihren Geschwistern identifizieren, kommt es im Laufe der Entwicklung zu einer Abgrenzung und De-Identifikation. Die eigene Person wird mit dem Geschwister auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin verglichen und die individuellen Persönlichkeitsmerkmale zeigen sich.
Langsam bauen die Geschwister ein eigenes Selbstbild auf und durch die Abgrenzung gegenüber dem Geschwister kann es zu heftigen Streitereien kommen (Lüscher 1997, Petri 1994). Allerdings wurde nachgewiesen, dass nichtbehinderte Kinder, trotz vieler Einschränkungen und Rücksichtnahme, ihre Beziehung zum Geschwister mit geistiger Behinderung als positiv beurteilen. Bemerkenswert ist, dass die Beziehung durch zuvorkommendes und hilfsbereites Verhalten gekennzeichnet ist, wohingegen konfliktreiche Auseinandersetzungen und heftige Streitereien fast nicht vorkommen (Tröster 2001, Bågenholm & Gillberg 1991).
Durch erste Trennungserfahrungen beim Eintritt in den Kindergarten oder später in die Schule lösen sich die Kinder von der Mutter und von ihren Geschwistern und beginnen, notwendige eigene Schritte in Richtung Individualisierung und Autonomie zu machen. Die persönliche Identität bildet sich und es kommt zu einer zunehmenden Differenziertheit im Erleben und Verhalten des Kindes (Lüscher 1997, Petri 1994).
3.3 Die Rolle des nichtbehinderten Geschwisters in der Kindheit
„The roles, responses, and feelings of the nonhandicapped sibling toward the handicapped child are not likely to be static, but rather change as the sibling adapts to the handicapped child, and copes with the day-to-day process of interacting with the handicapped sibling in the various ecological contexts of which they are part.“ (Crnic & Leconte 1986, 78)
Für die Geschwisterbeziehung und auch für das nichtbehinderte Geschwister selbst ist es sehr wichtig, dass die Eltern von Anfang an offen mit der Behinderung ihres Kindes umgehen und dass in der Familie darüber geredet wird. Für das nichtbehinderte Kind hat sich durch die Geburt des Kindes mit geistiger Behinderung die Familie völlig verändert. Plötzlich dreht sich alles um das neue Kind und am Verhalten der Eltern oder der Umgebung merkt das Geschwister, dass irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht hört es auch Gesprächsfetzen aus Unterhaltungen zwischen den Eltern und fängt an, sich Gedanken zu machen.
Das Denken eines Kindes ist am Anfang geprägt durch so genanntes magisches Denken und durch eine egozentrische Perspektive. Das Kind steht im Mittelpunkt seines Denkens, kann sich noch nicht in andere hinein versetzen und viele Vorgänge in der Umwelt noch nicht erklären. Somit findet es oft eine eigene Begründung für die Behinderung des Bruders oder der Schwester, wenn es von den Eltern keine andere Erklärung erhält.
Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung wird an direkt sichtbaren Dingen festgemacht und so kann es sein, dass sich das Kind die Behinderung z.B. durch äußerliche Merkmale des Geschwisters erklärt. Gleichzeitig werden diese Merkmale mit der eigenen Person verglichen. Oft denken die Kinder, dass sie mit Schuld haben an der Behinderung des Geschwisters oder befürchten, selbst behindert werden zu können (Lobato 1993).
Durch häufige Krankenhausaufenthalte des Geschwisters mit geistiger Behinderung hat das nichtbehinderte Kind weniger Kontakt zu seinen Eltern als vor der Geburt des Geschwisters. Dies kann unter Umständen als emotionale Ablehnung oder Zurückweisung durch die Eltern fehlgedeutet werden und zu Problemen im Verhalten des Kindes führen (Sourkes 1980, zit. n. Lobato 1993). Außerdem werden durch die räumliche Trennung der Geschwister oftmals ein normaler, ungehemmter Kontakt und die Ausbildung einer stabilen Geschwisterbeziehung verhindert.
Wenn Eltern ihrem nichtbehinderten Kind verständliche Informationen über Art, Ausmaß oder Ursache der Behinderung geben, helfen sie ihm, Zweifel und Ängste gegenüber dem Geschwister auszuräumen. Die Eltern sollten dem Kind genau erklären, was passiert und wieso sich in der Familie viel verändert. Gleichzeitig sollten die Kinder auch gesagt bekommen, was die Eltern von ihnen erwarten und wo sie mithelfen sollen, z.B. bei der Hausarbeit oder der Betreuung des Geschwisters. Dadurch können Probleme vermieden werden und das Kind kann seine Position in der Familie besser finden.
„When families understand and address these sibling concerns directly, there is less likely to be confusion and resentment about the sibling’s role and responsibilities.” (Crnic & Leconte 1986, 88).
Sowohl Kasten (2001), als auch Grossman (1972) schildern, dass es Kindern aus größeren Familien besser gelingt, sich an ein Geschwister mit geistiger Behinderung anzupassen. Sie haben während der schwierigen ersten Phase und auch später beim Aufwachsen immer noch andere nichtbehinderte Geschwister, mit denen sie eine ‚normale’ Geschwisterbeziehung ausleben können. Außerdem können sie sich die Verantwortung für das Geschwister mit geistiger Behinderung und die zusätzlichen Aufgaben teilen.
Erstgeborene Kinder haben es dabei einfacher, da sie die während der ersten Zeit ihres Lebens ohne große Belastung aufwachsen und erst nach einiger Zeit mit der Behinderung des neuen Geschwisters konfrontiert werden. Geschwister, die nach dem Kind mit geistiger Behinderung geboren werden, haben es nach Kasten (2001, 179) demnach schwerer, da sie oft eine verkürzte Kindheit haben und früh Verantwortung für das Geschwister übernehmen müssen.
Im Vergleich zu Geschwistern nichtbehinderter Kinder zeigt sich, dass die Gruppe der Geschwister von Kindern mit geistiger Behinderung im Bereich der Hausarbeit und für Betreuungsaufgaben deutlich stärker eingebunden wird (Tröster 2001). Allerdings ist es von der Geburtsposition und dem Geschlecht abhängig, wie viel Verantwortung die Geschwister für ihren Bruder oder ihre Schwester mit geistiger Behinderung übernehmen müssen und ob sie bei Aufgaben in Zusammenhang mit dem Kind mit geistiger Behinderung herangezogen werden oder nicht (Tröster 2000b).
Einige Studien stimmen darin überein, dass die ältere Schwester für ihr Geschwister mit Behinderung am meisten machen müsse und begründen dies unter anderem mit der traditionellen weiblichen Rollenerwartung. Schwestern hätten die größte Belastung durch Betreuungsaufgaben und Pflichten im Haushalt und seien speziell in Zwei-Kind-Familien besonderem Druck ausgesetzt (Cleveland & Miller 1977, Farber 1959, zit. n. Hackenberg 1987).
Grossman (1972) untersuchte die Belastung der Geschwister in den verschiedenen Bevölkerungsschichten der USA und kam zu dem Ergebnis, dass nur bei Schwestern der Oberschicht ein negativer Einfluss des Geschwisters mit Behinderung auf die Persönlichkeitsentwicklung zu beobachten sei. Dadurch, dass Kinder aus der Arbeiterklasse eher noch in traditionellen Rollenmustern leben, ist es für die Schwestern üblich, Verantwortung für die Geschwister zu übernehmen. Somit sehen sie sich in ihrer Persönlichkeit nicht übermäßig eingeschränkt.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832488727
- ISBN (Paperback)
- 9783838688725
- DOI
- 10.3239/9783832488727
- Dateigröße
- 11.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Lausitz in Cottbus – Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juli)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- bruder schwester behinderte geschwisterbeziehung familie
- Produktsicherheit
- Diplom.de