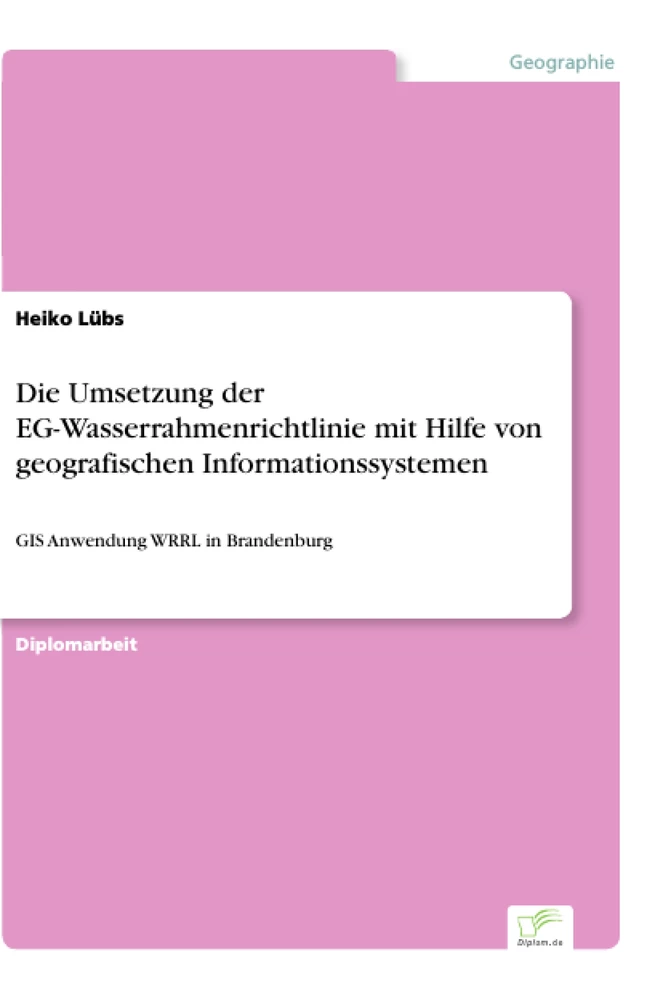Die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen
GIS Anwendung WRRL in Brandenburg
©2005
Diplomarbeit
134 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Diese Diplomarbeit setzt den Schwerpunkt auf die Vorstellung bzw. Beschreibung der Arbeiten zur Umsetzung der WRRL und dabei besonders auf die Arbeiten mit geografischen Informationssystemen. Allgemein werden diese beschrieben und am Beispiel des Landes Brandenburg veranschaulicht. Dabei wird ein aktuell auftretendes Problem untersucht und an einer Lösung dafür gearbeitet. Es handelt sich bei diesem Problem um die Genauigkeit der Lageinformationen der Einleiterstellen kommunaler Kläranlagen.
Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Bestandsaufnahme, mit deren Hilfe der aktuelle Zustand sowie die bestehenden Belastungen der Gewässer in Brandenburg zu analysieren und hinsichtlich der Auswirkungen zu beurteilen sind. Für die Kläranlagen muss ein verlässlicher Bezug zu den Wasserkörpern hergestellt werden. Ziel ist eine Verifizierung und Ergänzung der bisher vorliegenden Lageinformationen durch eine Abfrage bei den Betreibern der Anlagen. Dabei geht es um die Erzeugung von Umgebungskarten und deren Einbindung in die existierende Kläranlagen-Datenbank. Damit soll eine Ausgabe eines Serienbriefes erreicht werden, der neben Umgebungskarten weitere Angaben zu den
Anlagen enthält. Mit der erhaltenen Lösung ist ein wichtiger Schritt zur Bestandsaufnahme getan. Diese ist die Voraussetzung für den Bericht 2005 und die weiteren Schritte, insbesondere Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme, welche unerlässlich auf dem Weg zur Zielerreichung der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind.
In der vorliegenden Arbeit wird zu Beginn die EG-Wasserrahmenrichtlinie vorgestellt. Dabei wird die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beleuchtet und auf die Ziele eingegangen. Zu den Hauptzielen zählen die Schaffung eines Ordnungsrahmens für die europäische Wasserwirtschaft durch das Ablösen sektoraler Richtlinien in Maßnahmenprogramme bzw. Bewirtschaftungspläne sowie die Erreichung eines guten Gewässerzustandes in allen Gewässern der EU (Oberflächengewässer und Grundwasser) bis zum Jahr 2015. Die Wasserrahmenrichtlinie zeichnet sich durch viele Neuerungen aus, die nach der Vorstellung der Ziele beschrieben werden. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet ein ehrgeiziges Fristenkonzept, auf welches in Kapitel 3 eingegangen wird. Dieses betrifft sowohl die rechtliche, als auch die fachliche Umsetzung. Der Schwerpunkt wird auf die fachliche Umsetzung gelegt. Hier spielen die Begriffe Bestandsaufnahme, Monitoring sowie Bewirtschaftungspläne und […]
Diese Diplomarbeit setzt den Schwerpunkt auf die Vorstellung bzw. Beschreibung der Arbeiten zur Umsetzung der WRRL und dabei besonders auf die Arbeiten mit geografischen Informationssystemen. Allgemein werden diese beschrieben und am Beispiel des Landes Brandenburg veranschaulicht. Dabei wird ein aktuell auftretendes Problem untersucht und an einer Lösung dafür gearbeitet. Es handelt sich bei diesem Problem um die Genauigkeit der Lageinformationen der Einleiterstellen kommunaler Kläranlagen.
Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Bestandsaufnahme, mit deren Hilfe der aktuelle Zustand sowie die bestehenden Belastungen der Gewässer in Brandenburg zu analysieren und hinsichtlich der Auswirkungen zu beurteilen sind. Für die Kläranlagen muss ein verlässlicher Bezug zu den Wasserkörpern hergestellt werden. Ziel ist eine Verifizierung und Ergänzung der bisher vorliegenden Lageinformationen durch eine Abfrage bei den Betreibern der Anlagen. Dabei geht es um die Erzeugung von Umgebungskarten und deren Einbindung in die existierende Kläranlagen-Datenbank. Damit soll eine Ausgabe eines Serienbriefes erreicht werden, der neben Umgebungskarten weitere Angaben zu den
Anlagen enthält. Mit der erhaltenen Lösung ist ein wichtiger Schritt zur Bestandsaufnahme getan. Diese ist die Voraussetzung für den Bericht 2005 und die weiteren Schritte, insbesondere Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme, welche unerlässlich auf dem Weg zur Zielerreichung der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind.
In der vorliegenden Arbeit wird zu Beginn die EG-Wasserrahmenrichtlinie vorgestellt. Dabei wird die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beleuchtet und auf die Ziele eingegangen. Zu den Hauptzielen zählen die Schaffung eines Ordnungsrahmens für die europäische Wasserwirtschaft durch das Ablösen sektoraler Richtlinien in Maßnahmenprogramme bzw. Bewirtschaftungspläne sowie die Erreichung eines guten Gewässerzustandes in allen Gewässern der EU (Oberflächengewässer und Grundwasser) bis zum Jahr 2015. Die Wasserrahmenrichtlinie zeichnet sich durch viele Neuerungen aus, die nach der Vorstellung der Ziele beschrieben werden. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet ein ehrgeiziges Fristenkonzept, auf welches in Kapitel 3 eingegangen wird. Dieses betrifft sowohl die rechtliche, als auch die fachliche Umsetzung. Der Schwerpunkt wird auf die fachliche Umsetzung gelegt. Hier spielen die Begriffe Bestandsaufnahme, Monitoring sowie Bewirtschaftungspläne und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8855
Lübs, Heiko: Die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von Geografischen
Informationssystemen - GIS Anwendung WRRL in Brandenburg
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Danksagung
Ich möchte hiermit allen danken, die in irgend einer Form zum Gelingen dieser
Diplomarbeit beigetragen haben.
Dr. Harry Storch vom Lehrstuhl Umweltplanung danke ich, dass er mein Interesse an der
Arbeit mit Geographischen Informationssystemen geweckt hat und ich so eine interessante
Thematik für die Diplomarbeit gefunden habe. Weiterhin danke ich ihm für die Betreuung
und die wichtigen Hinweise zum Anfertigen der Diplomarbeit.
Prof. Dr. Brigitte Nixdorf und Dr. Michael Mutz vom Lehrstuhl Gewässerschutz danke ich
für die unkomplizierte Kommunikation und die Betreuung der Diplomarbeit.
Mike Hemm vom Lehrstuhl Gewässerschutz danke ich für die technische Unterstützung
vor allem beim Umgang mit Datenbanken und Kartenwerken.
Birgit Fiszkal vom Landesumweltamt Brandenburg danke ich für die gute Zusammenarbeit
und die Zeit, die sie sich für mich genommen hat, um mich in die Thematik ,,Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie in Brandenburg" einzuarbeiten. Auch danke ich Sylke
Wünsch vom Landesumweltamt Brandenburg für ihre Hilfe.
Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern Dietmar und Gudrun Lübs, die viel Geduld mit mir
aufgebracht haben und mich während des gesamten Studiums bedingungslos unterstützt
haben.
Ich danke meinen Freunden Heike Bartholomäus, Anett Haessner, Michael Hesse und
Matthias Kreusslein für Korrekturarbeiten und Hinweise zu formalen Sachen in dieser
Diplomarbeit.
Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden
Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde
vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Cottbus, 27.04.2005
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
5
Die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe
von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung
WRRL in Brandenburg
Heiko LÜBS
1 EINFÜHRUNG 8
1.1
Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
9
1.2
Methodische Vorgehensweise
9
2 DIE EG-WASSERRAHMENRICHTLINIE 11
2.1
Entstehung und Entwicklung
11
2.2
Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie
15
2.2.1
Allgemeine Ziele
15
2.2.2
Ziele für Oberflächengewässer
17
2.2.3
Ziele für Grundwasser
21
2.3
Wesentliche Neuerungen und Instrumente
22
3 DAS FRISTENKONZEPT UND DIE UMSETZUNG DER
WASSERRAHMENRICHTLINIE IN DEUTSCHLAND
27
3.1
Fristen und Schwerpunkte der rechtlichen Umsetzung
28
3.2
Fristen und Schwerpunkte der fachlichen Umsetzung
33
3.2.1
Bestandsaufnahme 34
3.2.1.1
Bestandsaufnahme Oberflächengewässer
35
3.2.1.2
Bestandsaufnahme Grundwasser
38
3.2.1.3
Abschließende Maßnahmen der Bestandsaufnahme
39
3.2.2
Monitoring 41
3.2.3
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme
46
3.2.3.1
Bewirtschaftungspläne 47
3.2.3.2
Maßnahmenprogramme 49
3.3
Interpretations- und Handlungsspielräume
51
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
6
3.4
Konsequenzen für die Wasserwirtschaft in Deutschland
53
4 WAS SIND GEOGRAFISCHE INFORMATIONSSYSTEME? 54
4.1
Definition GIS
54
4.2
Einsatzgebiete GIS
57
4.3
Anforderungen der EG-WRRL an GIS
58
5 DIE GEWÄSSERSITUATION UND DIE UMSETZUNG DER
EG-WASSERRAHMENRICHTLINIE IN BRANDENBURG
62
5.1
Zustand der Gewässer in Brandenburg
62
5.1.1
Güte der Standgewässer
62
5.1.2
Güte der Fließgewässer
64
5.2
Flussgebietseinheiten in Brandenburg
68
5.2.1
Die Flussgebietseinheit Oder
68
5.2.2
Die Flussgebietseinheit Elbe
71
5.2.2.1
Die Koordinierungsräume der Elbe
73
5.2.2.2
Der Koordinierungsraum Havel
74
5.3
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Brandenburg
76
5.3.1
Stand der Umsetzung in Brandenburg
76
5.3.2
WasserBLIcK-Schablonen 79
5.3.3
Umsetzung mit Hilfe von WasserBLIcK
84
6 PROBLEME BEI DER UMSETZUNG DER
WASSERRAHMENRICHTLINIE IN BRANDENBURG IM
BEREICH GIS UND DEREN LÖSUNG
92
6.1
Das Problem ,,Lageinformationen der Einleiterstellen kommunaler
Kläranlagen" 92
6.2
Allgemeines zu Kläranlagen
93
6.3
Praktische Lösung des Problems / Verifizierung der vorhandenen
Lageinformationen 95
6.4
Evaluierung der eingesetzten Lösung
102
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
7
6.5
Ausblick 102
7 SCHLUSSBETRACHTUNG 103
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 105
TABELLENVERZEICHNIS 107
QUELLENVERZEICHNIS 108
ANHANGVERZEICHNIS 119
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
8
1 Einführung
Mit Einführung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde der Gewässerschutz in
Europa in völlig neue Bahnen geleitet. Wurde bisher das wasserwirtschaftliche Handeln in
Deutschland bzw. in den anderen Mitgliedsstaaten durch einen punktuellen bzw. sektoralen
Ansatz geprägt, so verfolgt die WRRL einen ganzheitlichen Ansatz mit einer räumlichen
Betrachtung ganzer Flussgebietseinheiten über politische und administrative Grenzen
hinweg. Auch der integrierte Ansatz, der nicht nur traditionell technische und
naturwissenschaftliche Belange, sondern auch ökonomische, soziale und partizipative
Fragen berücksichtigt, ist eine Neuerung innerhalb der WRRL. Die WRRL, als das
bestehende deutsche Wasserrecht auf Bundes- und Länderebene, kann ein wichtiger
Meilenstein im Bemühen um eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen in Europa
sein, enthält sie doch klar formulierte Ziele für die Gewässergüte. Sie stellt die deutsche
Wasserwirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Die Richtlinie enthält innovative
Ansätze zum Umgang mit Gewässerressourcen, insbesondere anspruchsvolle Ziele für die
Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasser. So ist das vorrangige Ziel das
Erreichen des 'guten Zustandes' für alle Gewässer bis 2015. Die Umsetzung dieses Zieles
soll in zwei Schritten realisiert werden. Als erstes wird der Zustand der europäischen
Gewässer erfasst und über Ländergrenzen hinweg einheitlich dokumentiert. Im Anschluss
soll der Zustand der Gewässerbelastung schrittweise über Gewässerentwicklungs- und
Bewirtschaftungspläne verbessert und kontrolliert werden.
Die Umsetzung der WRRL ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Wasserwirtschaft in
Deutschland. Die Methodik bei der Umsetzung sollte v. a. die Informationen und Daten
nutzen, die bundesweit, möglichst in digitaler Form, verfügbar sind. Wegen der engen
Zeitvorgaben der WRRL müssen Verfahren schnell, d. h. ohne langwierige neue
Datenrecherchen, durchführbar sein. Die Anforderungen lassen sich nur mit Hilfe
hochleistungsfähiger Informations- und Kommunikationstechnologie in akzeptablen
Zeiträumen meistern. So sieht die WRRL zwingend vor, dass alle europäischen
Mitgliedsstaaten ihre Gewässer mit Hilfe von Geografischen Informationssystemen (GIS)
verwalten müssen. An mehreren Stellen fordert sie die Übermittlung von Daten in Form
von Karten bzw. explizit im GIS Format (Anhang I, ii: Geographische Ausdehnung der
Flussgebietseinheit, Anhang II, 1.1, vi: geographische Lage der Typen der
Oberflächenwasserkörper, Anhang V, 1.4.2: Darstellung der Überwachungsergebnisse und
Einstufung des ökologischen Zustands und des ökologischen Potenzials, Anhang V, 1.4.3:
Darstellung der Überwachungsergebnisse und Einstufung des chemischen Zustandes).
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
9
1.1 Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
Diese Diplomarbeit setzt den Schwerpunkt auf die Vorstellung bzw. Beschreibung der
Arbeiten zur Umsetzung der WRRL und dabei besonders auf die Arbeiten mit
geografischen Informationssystemen. Allgemein werden diese beschrieben und am Beispiel
des Landes Brandenburg veranschaulicht. Dabei wird ein aktuell auftretendes Problem
untersucht und an einer Lösung dafür gearbeitet. Es handelt sich bei diesem Problem um
die Genauigkeit der Lageinformationen der Einleiterstellen kommunaler Kläranlagen.
Diese spielen eine wichtige Rolle bei der Bestandsaufnahme, mit deren Hilfe der aktuelle
Zustand sowie die bestehenden Belastungen der Gewässer in Brandenburg zu analysieren
und hinsichtlich der Auswirkungen zu beurteilen sind. Für die Kläranlagen muss ein
verlässlicher Bezug zu den Wasserkörpern hergestellt werden. Ziel ist eine Verifizierung
und Ergänzung der bisher vorliegenden Lageinformationen durch eine Abfrage bei den
Betreibern der Anlagen. Dabei geht es um die Erzeugung von Umgebungskarten und deren
Einbindung in die existierende Kläranlagen-Datenbank. Damit soll eine Ausgabe eines
,,Serienbriefes" erreicht werden, der neben Umgebungskarten weitere Angaben zu den
Anlagen enthält. Mit der erhaltenen Lösung ist ein wichtiger Schritt zur Bestandsaufnahme
getan. Diese ist die Voraussetzung für den Bericht 2005 und die weiteren Schritte,
insbesondere Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme, welche unerlässlich auf
dem Weg zur Zielerreichung der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind.
1.2 Methodische Vorgehensweise
In der vorliegenden Arbeit wird zu Beginn die EG-Wasserrahmenrichtlinie vorgestellt.
Dabei wird die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beleuchtet und auf die Ziele
eingegangen. Zu den Hauptzielen zählen die Schaffung eines Ordnungsrahmens für die
europäische Wasserwirtschaft durch das Ablösen sektoraler Richtlinien in
Maßnahmenprogramme bzw. Bewirtschaftungspläne sowie die Erreichung eines guten
Gewässerzustandes in allen Gewässern der EU (Oberflächengewässer und Grundwasser)
bis zum Jahr 2015. Die Wasserrahmenrichtlinie zeichnet sich durch viele Neuerungen aus,
die nach der Vorstellung der Ziele beschrieben werden.
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet ein ehrgeiziges Fristenkonzept, auf welches in
Kapitel 3 eingegangen wird. Dieses betrifft sowohl die rechtliche, als auch die fachliche
Umsetzung. Der Schwerpunkt wird auf die fachliche Umsetzung gelegt. Hier spielen die
Begriffe Bestandsaufnahme, Monitoring sowie Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme eine wichtige Rolle. In Verbindung mit der
Wasserrahmenrichtlinie gibt es Interpretations- und Handlungsspielräume, welche in dieser
Arbeit ebenfalls angedeutet werden. Die Konsequenzen für die Wasserwirtschaft in
Deutschland bilden den Abschluss der Vorstellung der Wasserrahmenrichtlinie.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
10
Geografische Informationssysteme, die gemäß Gesetzestext der Wasserrahmenrichtlinie
zwingend notwendig zur Umsetzung der Ziele selbiger sind, werden in Kapitel 4
vorgestellt. Hier werden Einsatzgebiete von GIS erwähnt und spezielle Vorgaben der EG-
WRRL an GIS erwähnt.
Kapitel 5 konzentriert sich dann auf das Land Brandenburg. Es wird der aktuelle Zustand
der Gewässer im Land dargestellt. Danach erfolgt eine Beschreibung der Aufteilung der
Flussgebietseinheiten sowie Koordinierungsräume im Land Brandenburg. Wie jedes andere
Bundesland nutzt das Land Brandenburg das Internetportal WasserBLIcK bei der
Berichterstattung der Gewässersituation im Land. Dieses Portal wird vorgestellt und über
den Stand der Umsetzung im Land Brandenburg berichtet.
In Kapitel 6 wird das Problem, welches sich in Verbindung mit der Berichterstattung für
das Land Brandenburg ergibt, beschrieben. Das Problem ist die nicht eindeutige Zuordnung
der Einleitstellen kommunaler Kläranlagen zu wasserrahmenrichtlinienrelevanten
Gewässern bzw. die teilweise ungenaue Angabe von Lageinformationen der Einleitstellen.
Für die Kläranlagen muss jedoch ein verlässlicher Bezug zu den Wasserkörpern hergestellt
werden, da die Zuordnung der eingeleiteten Frachten zu den Wasserkörpern für
Bewirtschaftungsfragen erforderlich ist. Das Ziel ist die Erstellung eines Berichtes bzw.
Serienbriefes aus der Kläranlagendatenbank des Landes Brandenburg hinaus, welcher
neben Umgebungskarten, die generiert werden (und damit eine eindeutige Zuordnung zu
einem Wasserkörper erlauben), weitere Angaben zu den Anlagen enthält. Es ist zwingend
erforderlich, einen verlässlichen Bezug der Kläranlagen zu den Einleitstellen zu haben.
Alle zwei Jahre geht der Bericht an die Zweckverbände/Kommunen, welche diesen
innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten mit ihren Angaben auszufüllen haben.
Die Lösung, welche den neuen Bericht enthält, wird für das Landesumweltamt
Brandenburg entwickelt, das die Arbeiten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
koordiniert. Ob die eingesetzte Lösung ausgereift ist, oder ob in der Hinsicht noch
Verbesserungsbedarf besteht, darüber wird in den Teilkapiteln 6.4 und 6.5 diskutiert. Es
erfolgt eine Auswertung der angewandten Problemlösung sowie ein Ausblick auf folgende
Berichte und einer Vereinfachung der Erfassung der Informationen der Einleitstellen durch
eine eventuelle Automatisierung.
Eine Zusammenfassung, verbunden mit einer Schlussbetrachtung zu den Problemen, die in
der Diplomarbeit behandelt wurden, erfolgt in Kapitel 7.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
11
2 Die
EG-Wasserrahmenrichtlinie
2.1 Entstehung und Entwicklung
,,Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt
und entsprechend behandelt werden muss" lautet der erste Satz der EG-
Wasserrahmenrichtlinie, welche durch ihr In-Kraft-Treten am 22.12.2000 die europäische
Wasserpolitik revolutionierte. Die Notwendigkeit des Erlasses einer derartigen Richtlinie
ist historisch bedingt. Die Wasserpolitik der Europäischen Gemeinschaft hatte ihren
Ursprung in den 70er Jahren. ,,Die erste Gesetzgebungswelle fand zwischen 1975 und 1980
statt [...]" (Breyer, 2004, 5) Diese Wasserpolitik zeichnete sich vor allem durch einen
nutzungs- und sektororientierten Gewässerschutz aus, der in den vergangenen zwei
Jahrzehnten durch über 30 Richtlinien geprägt wurde. So gab es einerseits Richtlinien wie
z. B. die Trinkwasser-, die Badegewässer- oder die Fisch- und Muschelgewässerrichtlinie,
welche Umweltqualitätsnormen für spezifische Wasserkategorien festlegten, andererseits z.
B. die Grundwasser-Richtlinie, welche Emissionsgrenzwerte für spezifische
Wassernutzungen aufstellte. In diesen Richtlinien spielten biologische und ökologische
Funktionen der Gewässer - als Lebensräume für Pflanzen und Tiere - nur eine
untergeordnete Rolle. Auch waren die Richtlinien an einzelnen Nutzungen orientiert und
nicht aufeinander abgestimmt. Eine zweite Gesetzgebungswelle wurde Anfang der 90er
Jahre infolge des Frankfurter Ministerseminars zur europäischen Wasserpolitik im Jahre
1988 angestoßen. Daraus gingen verschiedene neue Richtlinien zum Gewässerschutz
hervor, wie z. B. die Nitratrichtlinie oder die Richtlinie über die Behandlung von
kommunalen Abwässern. Die Richtlinien der 90er Jahre beinhalteten moderne Vorgaben
auf Emissionsseite, d. h. dem Emissionsprinzip des Wasserrechtes wurde Rechnung
getragen (§ 7a WHG). Diese Richtlinien zeigten sich auch dahingehend verbessert, als dass
der Umweltschutz als Ziel in den EG-Vertrag aufgenommen wurde. In Tabelle 1 werden
die Richtlinien aufgeführt, die vor der Einführung der EG-WRRL maßgebend waren.
Tab. 1: Bestand an Gewässerrichtlinien vor Einführung der EG-WRRL (Quelle:
Jedlitschka, 2002, 1)
Jahr
Richtlinie
1975
1976
1976*
1977*
1978*
1979*
1980*
1980
1991
1991
Richtlinie Oberflächengewässer zur Trinkwasserentnahme und
Tochterrichtlinie über Probenahme und Analytik 1979
Richtlinie Badegewässer
Richtlinie Ableitung gefährlicher Stoffe und Tochterrichtlinien für insgesamt
17 ausgewählte gefährliche Stoffe 1982-1986*
Entscheidung Informationsaustausch über Qualität von Oberflächengewässern
Richtlinie Fischgewässer
Richtlinie Muschelgewässer
Richtlinie Grundwasser
Richtlinie Trinkwasserqualität (Neufassung 1998)
Richtlinie kommunale Abwasserbehandlung
Richtlinie Nitratbelastung aus der Landwirtschaft
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
12
1992
1996
Richtlinie Berichtspflichten und Tochterentscheidungen über
Wasserfragebögen
Richtlinie integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung
* diese Richtlinien sind gemäß WRRL aufgehoben
Jedoch kam es auch bei diesen Richtlinien zu Überschneidungen, weil diese nicht
aufeinander abgestimmt waren. So konnte kein schlüssiges Gesamtkonzept der
Gewässerschutzpolitik erkannt werden und aufgrund der Einbringung von verschiedenen
,,Tochterrichtlinien" und dem dadurch entstandenen ,,Flickenteppich von Gesetzen"
verlangten Europäisches Parlament und Rat seit langem eine neue und besser koordinierte
Wassergesetzgebung. (vgl. Breyer, 2004, 5) Auf dem Frankfurter Ministerseminar wurden
bereits erste Gedanken zu kohärenten Regelungen für eine nachhaltige
Gewässerbewirtschaftung diskutiert. Der erste Versuch der Europäischen Kommission
einer einheitlichen Richtlinie zur Gewässerökologie erwies sich im Jahr 1994 als nicht
konsensfähig. So forderten Rat, Europäisches Parlament und mehrere Mitgliedsstaaten in
der Folgezeit weiterhin eine umfassende Neugestaltung des europäischen Wasserrechtes
durch die Umsetzung einer Rahmenrichtlinie mit dem Ziel einer kohärenten
Gewässerbewirtschaftung. ,,Die Kommission hat am 26. Februar 1997 auf Grundlage der
vorausgegangenen Konsultation einen ersten Entwurf einer Richtlinie des Rates zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik, nachfolgend Wasserrahmenrichtlinie genannt, vorgelegt." (Jedlitschka,
2002, 2) Dieser Vorschlag zur Rahmenrichtlinie wurde daraufhin noch zweimal ergänzt.
Als erstes wurde das Emissionsprinzip stärker betont und damit der so genannte
kombinierte Ansatz stärker verfolgt (27.11.1997). Dieser kombinierte Ansatz (Artikel 10
WRRL) beachtet neben Emissionsgrenzwerten, und der sich daraus ergebenden Definition
des jeweiligen Standes der Technik, auch zusätzlich anzuwendende immissionsbezogene
Qualitätsziele für die Gewässer selbst. Bei einer Überschreitung der Qualitätsziele im
Gewässer, ist es erforderlich, strengere Emissionswerte festzulegen. Auf deutschen Druck
hin wurde der kombinierte Ansatz in die Richtlinie aufgenommen. Am 17.02.1998 kam es
zu einer Konkretisierung der Merkmale des ,,guten Gewässerzustandes" in Anhang V. Am
16.06.1998 konnte eine politische Einigung der EG-Umweltminister über die wesentlichen
Inhalte der Wasserrahmenrichtlinie erzielt werden. Der gemeinsame Standpunkt des Rates
wurde im März 1999 unter deutscher Präsidentschaft beschlossen. Nach zwei Lesungen im
Februar 1999 bzw. 2000 wurden zahlreiche Änderungsanträge des Europäischen
Parlaments vom Rat nicht übernommen, sodass sich im Frühjahr 2000 ein schwieriges
Vermittlungsverfahren anschloss, welches unter portugiesischer Präsidentschaft geführt
und Ende Juni 2000 abgeschlossen wurde.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
13
Konfliktpunkte, die das Vermittlungsverfahren erforderten, waren:
1
·
Verbindlichkeit der Umweltziele sowie Fristen für die Erreichung des guten
Zustandes
·
Ausnahmeregelungen
·
Grundwasserqualität
·
Preise/Gebühren für Wasser
·
Gefährliche Stoffe (insbesondere die Einstellung von Einleitungen innerhalb
von 20 Jahren)
Im September 2000 billigten Rat und Europäisches Parlament das Vermittlungsergebnis.
So trat die Richtlinie 2000/60 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. 10.
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich
der Wasserpolitik am 22.12.2000 in Kraft. Tabelle 2 verdeutlicht nochmals die
Chronologie der Entstehung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
Tab. 2:
Zeittafel der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Quelle: Boeck, 2003)
Datum
Vorgang
Inhalt
15.06.1994
Vorschlag der Kommission für
eine Richtlinie des Rates über
die ökologische Qualität von
Gewässern
·
Qualitätsziele für Gewässer
·
Ablösung der
qualitätsbezogenen geltenden
EG-Richtlinien
26.02.1997
Vorschlag der Kommission für
eine Richtlinie des Rates zur
Schaffung eines
Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik
·
Festlegung abstrakter
Gewässerschutzziele
·
Bewirtschaftung nach
Flusseinzugsgebieten
·
Maßnahmenprogramme
11.02.1999
1. Lesung im Europäischen
Parlament
Verschärfung der Richtlinie in den
Bereichen
·
gefährliche Stoffe
·
Grundwasser
·
Ausnahmen
·
Fristen
22.10.1999 Gemeinsamer Standpunkt des
Rates
Überarbeiteter Entwurf
16.02.2000
2. Lesung im Europäischen
Parlament
Verschärfungen der Richtlinie in den
Bereichen: Ausnahmen und Fristen.
1
Aufzählung nach Jedlitschka, 2002, 8
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
14
23.05.2000 29.06.2000 Vermittlungsverfahren
·
Aufnahme von besonders
gefährlichen Stoffen i.S.v.
OSPAR mit dem Ziel, Werte
nahe Null zu erreichen
·
Verbesserung der
Grundwasserregelungen
·
Konkretisierung der
Verpflichtung, kostendeckende
Wasserpreise einzuführen
·
Verkürzung der Fristen
22.12.2000 In-Kraft-Treten
der
Richtlinie
mit Veröffentlichung im
Amtsblatt
Identisch mit dem Ergebnis des
Vermittlungsverfahren
Trotz der Tatsache, dass die WRRL den deutlichen Charakter eines Kompromisses trägt,
entspricht sie in weiten Teilen den deutschen Vorstellungen. Bund und Länder können auf
eine gute Zusammenarbeit bei der Entstehung der WRRL zurückblicken; die beiden
Hauptziele wurden erreicht. Diese waren, einerseits EU-einheitliche Rahmenvorgaben für
eine integrierte Gewässerbewirtschaftung zu erhalten, andererseits dem im deutschen
Wasserrecht maßgebenden Emissionsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen. (vgl. LAWA,
2002, 3)
Mit der WRRL wurde eine Voraussetzung für eine einheitliche Gewässerschutzpolitik in
der Europäischen Union geschaffen. Einzelrichtlinien (s. o.), deren Inhalte in die WRRL
eingegangen sind, wurden aufgehoben. Für den Gewässerschutz gelten in Zukunft neben
der WRRL nur noch folgende Richtlinien:
Für das Grundwasser
·
91/676/EWG Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
·
91/414/EWG Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln mit Anhang VI
·
98/83/EG Trinkwasser
Für Oberflächengewässer
·
91/271/EWG Behandlung von kommunalem Abwasser
·
76/160/EWG Badegewässer
·
94/43/EG Integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
15
2.2 Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie
2.2.1 Allgemeine Ziele
Mit der Einführung der EG-WRRL soll ein einheitlicher Rahmen für einen gemeinsamen
Ansatz, gemeinsame Ziele, Prinzipien, Definitionen und grundlegende Maßnahmen für die
Wasserwirtschaft in Europa geschaffen werden. Die zwei Hauptziele sind die Schaffung
eines Ordnungsrahmens für die europäische Wasserwirtschaft, durch das Ablösen
sektoraler Richtlinien in Maßnahmenprogramme bzw. Bewirtschaftungspläne und die
Erreichung eines guten Gewässerzustandes in allen Gewässern der EU
(Oberflächengewässer und Grundwasser) bis zum Jahr 2015.
Für die konkreten Schritte zur Erreichung des ,,guten Zustandes" sind die zuständigen
Behörden in den Mitgliedsstaaten auf nationaler, regionaler, lokaler oder
Flusseinzugsgebietsebene
verantwortlich. ,,Der WRRL liegt ein ökologischer
Gewässerbegriff zu Grunde. Sie reduziert Gewässer nicht auf den Wasserkörper, sondern
bezieht auch die Wechselwirkungen zwischen den Gewässern und den von ihnen
beeinflussten oder abhängigen Lebensräumen in die Betrachtung ein." (NABU, 2002) Sie
verfolgt somit das Prinzip des integrierten Gewässerschutzes und zeichnet sich durch einen
qualitativen und quantitativen Gewässerschutz sowie einen ökologischen und
ökonomischen Ansatz aus.
Die Ziele sind in Artikel 1 festgelegt:
·
Schutz und Verbesserung des Zustandes aquatischer Ökosysteme und des
Grundwassers einschließlich von Landökosystemen, die direkt vom Wasser abhängen,
·
Förderung einer nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen,
·
Schrittweise Reduzierung prioritärer Stoffe und Beenden des Einleitens/Freisetzens
prioritär gefährlicher Stoffe,
·
Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers,
·
Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren.
Konkretisiert werden die Zielstellungen in Artikel 4 unter Bezug auf Anhang V. Demnach
ist das Umweltziel der ,,gute Zustand" aller Gewässer, der innerhalb von 15 Jahren nach In-
Kraft-Treten der Richtlinie, also Ende 2015, erreicht werden muss.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
16
Dieser gute Zustand beinhaltet nach Artikel 4 Anhang V:
·
den guten ökologischen Zustand für Oberflächengewässer,
·
den guten quantitativen Zustand für das Grundwasser,
·
den gute chemischen Zustand für Oberflächengewässer und Grundwasser und
·
das gute ökologische Potenzial für stark veränderte oder künstliche Gewässer
(Schifffahrtsstraßen, Stauhaltungen, Seitenkanäle, Staudurchgänge usw.).
Eine Übersicht über die wesentlichen Ziele der EG-WRRL gibt Abbildung 1.
Abb. 1: Ziele EG-Wasserrahmenrichtlinie (Quelle: eigene Erhebung)
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
17
2.2.2 Ziele für Oberflächengewässer
Bei den Oberflächengewässern werden die Kategorien Flüsse, Seen, Übergangs- und
Küstengewässer sowie künstliche und erheblich veränderte Gewässer unterschieden. Das
wichtigste Umweltziel, das Erreichen des ,,guten Zustandes", wird für die
Oberflächengewässer anhand ökologischer und chemischer Kriterien definiert. Es ist der
gute chemische und ökologische Zustand zu erreichen, soweit sie nicht als ,,künstlich" oder
,,erheblich verändert" eingestuft werden.
1
Zur Einordnung des ökologischen Zustandes
werden Qualitätskomponenten herangezogen. Vorrangig sind dies die biologischen
Komponenten; ergänzend bzw. unterstützend sollen die hydromorphologischen sowie die
chemischen Elemente dienen. Somit macht die EG-WRRL die biologische Artenvielfalt
zum Ziel des Handelns. Die biologischen Komponenten sind:
·
Zusammensetzung und Abundanz der Gewässerflora (Phytoplankton,
Makrophyten und Phytobenthos),
·
Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
(Makrozoobenthos),
·
Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fische.
Diese biologischen Komponenten sind entscheidend bei der Feststellung des ökologischen
Zustandes. Wenn sich hier Abweichungen vom guten Zustand feststellen lassen, sind die
hydromorphologischen Elemente:
·
Durchgängigkeit, Morphologie, Hydrologie (Abfluss, Dynamik, Verbindung
zum Grundwasser)
sowie die chemischen Komponenten:
·
allgemeine Parameter (Temperatur, pH, O
2
),
·
synthetische Schadstoffe und
·
nichtsynthetische Schadstoffe in signifikanten Mengen
zu untersuchen. Die Qualitätskomponenten werden in Tabelle 3 genauer aufgeschlüsselt.
1
Was laut EG-WRRL unter ,,künstlichen" und ,,erheblich veränderten" Gewässern fällt, dazu folgt in
diesem Kapitel eine Erklärung.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
18
Tab. 3:
Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustands von
Flüssen, Seen, Übergangs- und Küstengewässern nach Anhang V (WRRL)
(Quelle: GRÜNE LIGA, 2004a, 10)
Biologische Qualitätskomponenten
Flüsse und Seen
Übergangsgewässer
Küstengewässer
Phytoplankton,
Makrophyten und
Phytobenthos, Benthische
wirbellose Fauna,
Fischfauna
Phytoplankton, Großalgen,
Angiospermen, Benthische
wirbellose Fauna, Fischfauna
Phytoplankton, Großalgen,
Angiospermen, Benthische
wirbellose Fauna
Hydromorphologische Qualitätskomponenten
Flüsse und Seen
Übergangsgewässer
Küstengewässer
Wasserhaushalt,
Durchgängigkeit des
Flusses, Morphologie
Wasserhaushalt, Morphologie Tidenhub, Morphologie
Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten
Allgemeine Bedingungen
Flüsse und Seen
Übergangs- und
Küstengewässer
Nährstoffkonzentration,
Temperatur, Salzgehalt,
Sauerstoffgehalt,
Versauerungszustand,
Sichttiefe (Seen)
Nährstoffkonzentration,
Temperatur, Salzgehalt,
Sauerstoffgehalt, Sichttiefe
Spezifische synthetische
und nichtsynthetische
Schadstoffe
Stoffe gemäß Anhang X (prioritäre Stoffe) und Stoffe, die in
signifikanten Mengen eingeleitet werden
Bei der Bewertung des ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer wird ein
fünfstufiges Klassifizierungssystem herangezogen, welches die Stufen sehr gut, gut, mäßig,
unbefriedigend und schlecht beinhaltet. Diesen fünf Stufen werden die Farben blau, grün,
gelb, orange und rot bei der Darstellung zugeteilt. Mit ,,sehr gut" wird ein vom Menschen
nahezu unbeeinflusstes Gewässer eingestuft. Dieser als Referenz dienende ,,sehr gute
Zustand" ist zu ermitteln, er ist ökoregion- sowie gewässertypspezifisch. Deutschland wird
nach Anhang XI EG-WRRL in die fünf Ökoregionen zentrales Flachland, westliches
Flachland, zentrales Mittelgebirge, westliches Mittelgebirge und Alpen eingeteilt, die
Übergangs- und Küstengewässer in die Ökoregionen Nordsee und Ostsee. Bei der
Gewässertypbeschreibung kommen zwei unterschiedliche Systeme zur Anwendung. (vgl.
Regierung von Unterfranken, 2003, B. 2-2) System A berücksichtigt die Ökoregionen,
Höhenlage, Einzugsgebietsgröße und Geologie. System B berücksichtigt die Höhenlage,
geographische Lage, Einzugsgebietsgröße und Geologie sowie optional z. B. bei Flüssen
die Strömungsenergie und Gewässerbreite/-tiefe/-gefälle. Für die in Deutschland ca. 20
Fließgewässerarten, verschiedene Seentypen, Küsten- und Übergangsgewässer müssen
demnach Referenzgewässer gefunden werden, welche ein vom Menschen nahezu
unbeeinflusstes Ökosystem aufweisen. Von diesem sehr guten Zustand (=1) wird für jeden
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
19
Gewässertyp der gute Zustand abgeleitet. Für den guten ökologischen Zustand darf bei
keinem der Kriterien der Faktor 0,8 unterschritten werden, d.h. der Zustand muss zu
mindestens 80% dem des guten Zustandes entsprechen.
Zusätzlich zum ökologischen Zustand wird der chemische Zustand bestimmt. EU-
Parlament und Rat einigten sich am 20. November 2001 auf eine Liste von 33 prioritären
Stoffen bzw. Stoffgruppen. Diese werden zur Beurteilung des chemischen Zustandes
herangezogen und sind in Artikel 16 WRRL festgehalten. Tabelle 4 listet alle prioritären
Stoffe bzw. Stoffgruppen auf.
Tab. 4:
Übersicht prioritäre Stoffe nach Wasserrahmenrichtlinie (Quelle: GRÜNE
LIGA, 2004b, 17)
Prioritäre Gefährliche
Stoffe
Zu überprüfende
Prioritäre Stoffe
Prioritäre Stoffe, die nicht
als Prioritäre Gefährliche
Stoffe eingestuft werden
·
Cadmium
·
Quecksilber
·
Hexachlorcyclohexan
·
Nonylphenole
·
Tributylzinnverbindungen
·
Bromierte Diphenylether
(Pentabromdiphenylether)
·
Chloralkana C10-13
·
Hexachlorbenzol
·
Hexachlorbutadien
·
PAK
·
Pentachlorbenzol
·
Blei
·
Anthracen
·
Atrazin
·
Chlorpyrifos
·
Diuron
·
Endosulfan
·
Isoproturon
·
Naphthalin
·
Simazin
·
Trifluralin
·
DEHP
·
Octylphenole
·
Pentachlorphenol
·
Trichlorbenzole
·
Nickel u. Verbindungen
·
Alachlor
·
Chlorfenvinphos
·
Benzol
·
Dichlormethan
·
1,2 Dichlorethan
·
Fluoranthen
·
Trichlormethan
Die Richtlinie unterscheidet zwischen ,,prioritären Stoffen" und ,,prioritär gefährlichen
Stoffen". Damit ein Stoff als ,,prioritär gefährlich" eingestuft werden kann, muss er
folgende Voraussetzungen erfüllen: Die Substanz muss schlecht abbaubar (persistent) sein,
sie muss sich in Nahrungsketten anreichern können (bioakkumulativ) und sie muss toxisch
sein. Es werden ergänzend auch weitere Auswahlkriterien, welche besonders die
endokrinen und hormonähnlichen Eigenschaften betreffen, bei der Einstufung von
,,prioritär gefährlichen Stoffen" herangezogen.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
20
,,Aufgrund ihrer Schadwirkung und der Häufigkeit ihres Vorkommens sollen die
prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe durch einheitliche Emissions- und
Immissionswerte begrenzt oder sogar vollständig eliminiert bzw. bis auf die natürliche
Hintergrundkonzentration reduziert werden." (Grüne Liga, WRRL Info 3, 2002, 2). Für
,,prioritäre Stoffe" ist vorgesehen, dass deren Einleitung reduziert werden soll. Bei
,,prioritär gefährlichen Stoffen" soll innerhalb der nächsten 20 Jahre eine Nullemission
erreicht werden. Weitere Umweltqualitätsnormen, die auf dem Weg zum guten chemischen
Zustand eingehalten werden müssen, sind in Anhang IX WRRL (Emissionsgrenzwerte und
Qualitätsziele der Richtlinie 76/464/EWG Ableitung gefährlicher Stoffe mit
Tochterrichtlinien) bzw. in sonstigen Richtlinien der Gemeinschaft (z. B. Nitratrichtlinie
und Anhang VI der Pflanzenschutzmittelrichtlinie) festgehalten. Wenn alle chemischen
Umweltqualitätsnormen eingehalten sind, ist der gute chemische Zustand erreicht. Hier gibt
es nur die Klassifizierung zwischen Ja (Zustand erreicht, Farbe blau) und Nein (Zustand
nicht erreicht, Farbe rot).
Für künstliche oder erheblich veränderte Gewässer wird das ,,gute ökologische Potenzial"
als Ziel formuliert. Für Gewässer, bei denen der gute ökologische Zustand nicht bzw. nicht
mit verhältnismäßigen Mitteln erreicht werden kann - und wenn durch die
Wiederherstellung Nutzungen wie die Schifffahrt, Wasserkraft oder der Hochwasserschutz
gestört würden -, ist nicht der gute ökologische Zustand das Ziel, sondern es ist das gute
ökologische Potenzial zu erreichen.
Die EG-WRRL definiert künstliche Gewässer nach sehr strengen Kriterien. Sie dürfen nur
dort ausgewiesen werden, wo Gewässer erst durch menschliche Einwirkung entstanden
sind und vorher nicht vorhanden waren. Die EG-WRRL (Artikel 4, Absatz 3) gibt genaue
Vorgaben, wann Gewässer als ,,erheblich verändert" eingestuft werden können. ,,Die
Ausweisung von Gewässern als erheblich verändert muss in einem differenzierten
Verfahren erfolgen. Voraussetzung ist die erhebliche Veränderung des Gewässers in
seinem Wesen durch physikalische Veränderungen durch den Menschen." (HMULV,
2004) So kann z. B. die Verwandlung eines Flusses in einen Stausee in die Kategorie
,,erheblich verändert" fallen, jedoch nicht als künstliches Gewässer geführt werden.
Aus den Tabellen in Anhang V WRRL ergeben sich die Definitionen des guten
ökologischen Zustandes bzw. des guten ökologischen Potenzials. Das gute ökologische
Potenzial ist jedoch von schlechterer Qualität geprägt. Dementsprechend wird damit ein
geringeres Umweltziel definiert. Bei entsprechend starker Verbauung kann beispielsweise
ein ,,mäßiger Zustand" dem ,,guten Potenzial" entsprechen. Abbildung 2 zeigt einen
Zustandsvergleich zwischen naturnahen und erheblich veränderten Gewässern. Für
,,erheblich veränderte" Gewässer gelten niedrigere Qualitätsziele als für ,,naturnahe"
Gewässer (EQR: Ecological Quality Ratio).
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
21
Abb. 2: Ökologische Klassifikation erheblich veränderter Gewässer (Quelle: GRÜNE
LIGA, 2004a, 18)
Dass sich daraus Probleme ergeben, ist offensichtlich. So wurden z. B. in Holland 95% der
Gewässer als erheblich verändert eingestuft, damit lediglich das gute ökologische Potenzial
das Ziel der Gewässerbewirtschaftung ist. Somit erscheint es logisch, dass die europäischen
Umweltverbände strengere Maßnahmen für die Ausweisung dieser Gewässer fordern.
Andernfalls könnte man dem Beispiel Hollands folgen und ca. 90% der Gewässer als
erheblich verändert einstufen, was im Endeffekt sogar zu einer Verschlechterung der
Situation führen könnte. Hier ist u. a. die Wasserwirtschaft gefordert, darauf zu achten,
dass kein Missbrauch betrieben wird.
2.2.3 Ziele für Grundwasser
Der gute Zustand des Grundwassers charakterisiert sich durch den guten chemischen sowie
den guten mengenmäßigen Zustand. Diese beiden Qualitätsziele sind zu erreichen.
Detaillierte Werte, wie sie die WRRL für die Oberflächengewässer vorgibt, fehlten anfangs
noch komplett für das Grundwasser, gab es doch erhebliche Meinungsverschiedenheiten
zwischen dem europäischen Parlament und Rat während des legislativen Prozesses. So
konnten die EU-Mitgliedsstaaten bis zur Verabschiedung der WRRL keine Einigung zum
Grundwasserschutz erzielen. Mit neunmonatiger Verspätung jedoch hat die EU-
Kommission am 19. September 2003 einen Entwurf für eine Grundwasser-Tochterrichtlinie
zur WRRL vorgelegt.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
22
Dieser Entwurf kann nur eine Minimalvariante darstellen, bei deren Umsetzung es zu einer
Schwächung des Grundwasserschutzes in der EU kommen könnte. Es fehlen EU- weite
Grenzwerte für die meisten das Grundwasser gefährdenden Schadstoffe. Vielmehr werden
die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis Ende 2005 Grenzwerte für Stoffe festzulegen, welche
das Ziel des guten chemischen Zustandes der Grundwasserkörper gefährden könnten.
Werden also diese aufgestellten Grenzwerte eingehalten und gibt es des Weiteren keine
Anzeichen für einen anthropogen bedingten Zustrom von Salzwasser, kann der gute
chemische Zustand des Grundwassers als erreicht angesehen werden. Wie beim
Oberflächenwasser gilt auch beim Grundwasser ein Verschlechterungsverbot des
Zustandes. Es wird jedoch nur zwischen dem ,,guten" und dem ,,schlechten Zustand"
unterschieden, womit eine wesentlich undifferenziertere Regelung getroffen ist. Neben dem
,,guten chemischen Zustand" ist der ,,gute mengenmäßige Zustand" das erstrebenswerte
Ziel für das Grundwasser nach WRRL. Maßgeblicher Parameter für die Beurteilung des
mengenmäßigen Zustandes ist der Grundwasserspiegel. Für alle Grundwasserkörper soll
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und neubildung hergestellt werden.
2.3 Wesentliche Neuerungen und Instrumente
Bei der EG-WRRL ging die EU-Kommission völlig neue Wege. Sie ist die erste Richtlinie,
die nicht allein vom EU-Ministerrat beschlossen wurde, sondern im so genannten Co-
Decision-Verfahren erlassen wurde. Neben der beratenden und zur Kenntnis nehmenden
Funktion war das Europäische Parlament erstmals mitentscheidend, was allerdings auch zu
Inkonsistenzen innerhalb der Richtlinie führte. Ebenfalls neu ist, dass die Kommission sich
aktiv an der Umsetzung der Richtlinie beteiligt und eine Strategie zur Umsetzung fährt.
Daraus ergibt sich ein bisher unbekanntes Maß an Transparenz und
Beteiligungsmöglichkeiten. ,,Mit Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist eine
grundlegende Neuorientierung der Wasserwirtschaft und der europäischen Wasserpolitik
verbunden, die in der Einführung neuer Instrumente der Bewirtschaftung (z. B.
Maßnahmenprogramme, Bewirtschaftungsplan, ökonomische Anreizmechanismen für
einen sparsamen Umgang mit Wasserressourcen), der Stärkung ökonomischer
Bewertungsansätze bei der Entscheidungsfindung sowie dem naturräumlichen Bezug bei
der Bewirtschaftung von Flussgebieten ihren Ausdruck findet." (Dehnhardt, Nischwitz,
2003, 1) Für die Gewässerbewirtschaftung auch in Deutschland enthält die WRRL
wichtige neue Instrumente.
Ein Instrument, das Umweltziel ,,guter Zustand" für alle Gewässer, welches bis 2015
erreicht werden muss, wurde bereits im vorhergehenden Kapitel ausführlich beschrieben.
Auf dem Weg zur Erreichung dieses Zieles zeichnet sich die Wasserrahmenrichtlinie durch
ein gewässertypisches Vorgehen aus. Bisher war es so, dass bei der Bewertung keine
Unterschiede zwischen den Gewässertypen gemacht wurden, d. h. für alle Gewässer
wurden die selben Maßstäbe angesetzt. Nach der Wasserrahmenrichtlinie werden
Gewässerabschnitte u. a. nach ihrer Hydrogeologie und Hydromorphologie eingestuft.
Insgesamt werden ca. 20 Fließgewässer- und 10 Seentypen unterschieden. Für jeden Typ
wird ein Referenzgewässer ausgewiesen, welches dem natürlichen Zustand entspricht.
Somit unterscheiden sich die Referenzbedingungen für den ,,sehr guten Zustand" zwischen
den verschiedenen Gewässertypen.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
23
Die wichtigste Neuerung innerhalb der WRRL ist wohl der Ansatz der
Gewässerbewirtschaftung in Flussgebietseinheiten. Eine Flussgebietseinheit ist laut Artikel
2 Absatz 15 WRRL ein als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten
festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten
Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten Grundwässern und Küstengewässern besteht.
Ein Einzugsgebiet definiert Artikel 2 Absatz 13 WRRL als Gebiet, aus welchem über
Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen der gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen
Flussmündung, einem Ästuar oder Delta ins Meer gelangt. Die Gewässer sind in Zukunft
flussgebietsbezogen zu bewirtschaften. Ausschlaggebend sind nicht mehr die Staats- und
Ländergrenzen, sondern die Grenzen der hydrologischen Einzugsgebiete. In Deutschland
wurden die zehn Flusseinzugsgebiete Donau, Rhein, Maas, Ems, Weser, Elbe, Eider, Oder,
Schlei/Trave und Warnow/Peene ausgewiesen. Einen Überblick darüber gibt Abbildung 3.
Abb. 3: Flussgebietseinheiten in Deutschland nach der Wasserrahmenrichtlinie
(Umweltbundesamt, Februar 2000)
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
24
Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, für die Flusseinzugsgebiete Bewirtschaftungspläne
aufzustellen. Dabei kommt es auch auf die Zusammenarbeit der einzelnen Bundesländer
aufgrund der flussgebietsbezogenen Betrachtung an. Die Forderung nach der Bildung von
Flussgebietseinheiten ist nicht gänzlich neu. Bereits das WHG forderte die Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen für Flussgebiete. Dies war jedoch auf Länder-Niveau begrenzt.
Der Bewirtschaftungsplan stellt künftig das Hauptinstrument der WRRL dar. Ein wichtiger
Teil sind die Maßnahmenprogramme. In einem gesonderten Kapitel soll innerhalb dieser
Diplomarbeit dieses Thema noch genauer betrachtet werden.
Gegenüber der bisherigen Betrachtung überwiegend von Summenparametern sieht die
Wasserrahmenrichtlinie eine einzelstoffbezogene Betrachtungsweise vor. Ein neues
Instrument ist der bereits angeklungene kombinierte Ansatz. Dieser wird für Einleitungen
aus Punktquellen und diffusen Quellen in Gewässer vorgeschrieben. Er sieht einerseits die
Festlegung von Emissionswerten, und der damit verbundenen Definition des jeweiligen
Standes der Technik, und andererseits eine Definition von immissionsbezogenen
Qualitätszielen für die Gewässer selber vor. Werden die Qualitätsziele im Gewässer
überschritten, sind strengere Emissionswerte festzulegen.
Nach Artikel 9 WRRL ist das Prinzip kostendeckender Wasserpreise zu berücksichtigen.
So fordert die Wasserrahmenrichtlinie von den Mitgliedstaaten die Berücksichtigung des
Grundsatzes der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen. Die Wasserpreise sollen die
Kosten der Wasserversorgung einschließlich der Umwelt- und Ressourcenkosten
widerspiegeln und dem Verursacherprinzip genüge tun. ,,Das Verursacherprinzip besagt,
dass derjenige die Kosten der Vermeidung oder Beseitigung eines Umweltschadens zu
übernehmen hat, der für die Entstehung verantwortlich ist. Ferner ist der Verursacher von
Umweltschäden auch Adressat für Verbote, Gebote und Auflagen seitens des Gesetzgebers.
Die Anwendung des Verursacherprinzips führt zur Verteuerung umweltschädigender
Produktionsverfahren und der dabei erzeugten Güter." (Quality-Datenbank, 1998)
Hierdurch soll es gelingen, dass sich die Investitionen im Einzugsgebiet auf Dauer selbst
tragen und die Mittel dafür durch den Wasserpreis aufgebracht werden. Des Weiteren soll
Wasser nicht mehr allein als Lebensmittel angesehen werden, sondern auch als
Wirtschaftsgut, welches erschöpfbar ist. Die Wassergebührenpolitik soll Anreize zur
effizienten Nutzung der Wasserressourcen schaffen. Eine Möglichkeit diesem Ziel näher zu
kommen, wären beispielsweise ,,Wasserfonds" oder ,,Public-private-Partnerships".
Artikel 14 der WRRL sieht vor, dass alle Mitgliedsstaaten angehalten sind, eine aktive
Beteiligung aller interessierten Stellen an der Richtlinie, insbesondere an der Aufstellung,
Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, zu
fördern (Artikel 14, Absatz 1 WRRL).
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
25
,,Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten die Öffentlichkeit, einschließlich der Nutzer,
insbesondere im Hinblick auf folgende Punkte informieren und anhören:
·
Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung der Bewirtschaftungspläne für die
Flussgebiete und die Anhörungen bis spätestens 2006,
·
Überblick über die für das Einzugsgebiet festgestellten bedeutenden
Wasserbewirtschaftungsfragen bis spätestens 2007,
·
Entwurf des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet bis spätestens 2008."
(Europäische Gemeinschaften, 2002, 11)
Die aktive Beteiligung kann dabei bis zur Mitentscheidung reichen. Bei der Beratung ist
die schriftliche Äußerung die Minimalvorgabe.
Durch die Einbindung der Öffentlichkeit lassen sich wesentliche Vorteile erzielen:
·
Unterstützung durchgeführter Projekte durch die Bevölkerung,
·
Annäherung an die Ziele der Agenda 21,
·
Chance der Berücksichtigung kostengünstiger ,,nicht-wissenschaftlicher" Lösungen
und
·
Stärkung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung.
In den deutschen Bundesländern ist ein völlig unterschiedlicher Grad an
Öffentlichkeitsbeteiligung anzutreffen. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind
die einzigen Bundesländer, in denen die Umweltverbände an der Bestandsaufnahme
beteiligt sind, wobei Schleswig-Holstein eine Vorreiterrolle in der
Öffentlichkeitsbeteiligung einnimmt. Der Landesverband koordiniert hier die
Arbeitsgruppen, die sich aus Wasserverbänden, Wasserversorgungsunternehmen, Ämtern,
Städten, Kreisen, Landesnaturschutzverbänden, Bauernverbänden und
Fischereifachvertretern zusammensetzen. Des Weiteren gibt es für die
Flussgebietseinheiten Flussgebietsbeiräte, die ein überregionales Forum darstellen, welches
zur Transparenz in der Öffentlichkeit beiträgt. Der Beteiligungsumfang schwankt jedoch
von Bundesland zu Bundesland. In einigen Bundesländern besteht großer Nachholbedarf.
In Berlin und Brandenburg beispielsweise gab es bislang fast keine Beteiligung der
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
26
Öffentlichkeit. Hier konnten keine Absichten erkannt werden, über das unbedingt
notwendige Maß hinauszugehen.
,,Insgesamt stellt damit die WRRL die zuständigen Behörden vor komplexe
Anforderungen, die eine Neuorientierung einerseits im organisatorisch-administrativen
Bereich andererseits bezüglich der Erfüllung neuer fachlicher und methodischer Aufgaben
erfordern. Um dem integralen Ansatz insbesondere hinsichtlich der
Öffentlichkeitsbeteiligung und der flussgebietsbezogenen Koordinierungsaufgabe
Rechnung zu tragen, müssen mit der Umsetzung der WRRL geeignete Kooperations- und
Partizipationsstrukturen geschaffen werden, um Problemlösungsfähigkeiten nicht-
staatlicher Akteure überhaupt nutzen zu können." (Dehnhardt, Nischwitz, 2003, 1)
Ein weiteres wichtiges neues Instrument ist das ehrgeizige Fristenkonzept, was die
Wasserrahmenrichtlinie bei der rechtlichen Umsetzung vorgibt. Die Fristen sind
vorgegeben und werden im nächsten Kapitel genauer vorgestellt.
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
27
3
Das Fristenkonzept und die Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland
Die WRRL beinhaltet eine Reihe von Aufgaben, die jeweils innerhalb einer bestimmten
Frist zu erfüllen sind, um das Ziel des ,,guten Zustands" zu erreichen. Einen Überblick über
dieses ehrgeizige sowie verbindliche Fristenkonzept gibt Abbildung 4.
Abb. 4: Fristenkonzept der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Quelle: WWF-World Wide
Fund For Nature, 2001, 9)
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
28
Es handelt sich hierbei um rechtlich bindende Fristen, d. h. es stellt keine zeitliche Abfolge
dar, bei der eine Aktion abgeschlossen sein muss, bevor die nächste beginnt. Dieser
Zeitplan ist so eng gesetzt, dass mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt werden müssen.
,,Die WRRL verpflichtet die Mitgliedsstaaten, alle Gewässer mit Ausnahme der
künstlichen Gewässer innerhalb der angegebenen Fristen in einen guten Zustand zu
überführen. Ausnahmen sind nur entsprechend den engen Vorgaben der WRRL zulässig."
(LAWA, 2002, 5) ,,Die rechtlichen und fachlichen Vorgaben zur Umsetzung der Richtlinie
müssen zeitgerecht vorliegen, um die erforderlichen Arbeiten auf einer sicheren Grundlage
in Angriff nehmen zu können." (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, 2004a)
3.1 Fristen und Schwerpunkte der rechtlichen Umsetzung
Nach Artikel 24 muss die Richtlinie innerhalb von drei Jahren in nationales Recht
umgesetzt sein; der Stichtag hierfür war also der 22. Dezember 2003. Da der Bund in
Wasserfragen nur die Rahmengesetzgebung innehat, und die Gesetzgebungskompetenz bei
den Ländern liegt, erwies sich die konsistente rechtliche Umsetzung der WRRL in
Deutschland als kompliziert. In einem ersten Schritt erfolgte die Novellierung der
Wassergesetzgebung mit der Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) an die
WRRL. Eine umfassende Umsetzung der WRRL im Wasserhaushaltsgesetz war aufgrund
der erwähnten Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 75 GG) nicht
möglich. Es wurden somit nur die wesentlichen Grundsätze der Richtlinie übernommen
und Regelungsaufträge an die Länder erteilt. Folgende Aspekte der WRRL wurden ins
WHG aufgenommen:
1
·
Ergänzung des § 1a WHG (Grundsatz) im Hinblick auf eine nachhaltige
Gewässerbewirtschaftung und den Schutz direkt von Gewässern abhängender
Ökosysteme, Vorrang der ortsnahen Wasserversorgung,
·
Übernahme einiger Definitionen der WRRL (z. B. Flussgebietseinheit, Einzugsgebiet),
·
Grundsatz der Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten und Verpflichtung zur
nationalen und internationalen Koordination,
·
Aufnahme der Bewirtschaftungsziele für die Gewässer entsprechend der Struktur des
WHG: guter ökologischer und chemischer Zustand der oberirdischen Gewässer und
Küstengewässer, gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer Zustand für die
1
Aufzählung aus Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2004a
Die Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinie mit Hilfe von geografischen Informationssystemen - GIS-Anwendung WRRL in Brandenburg
29
künstlichen und erheblich veränderten Gewässer (ein Ausnahmetatbestand der
WRRL), guter mengenmäßiger und chemischer Zustand des Grundwassers,
·
Regelung der nach der WRRL zulässigen Ausnahme- und
Fristverlängerungsmöglichkeiten. Die Erreichung des Zieles eines guten
Gewässerzustandes kann um maximal 12 Jahre verlängert werden, unter bestimmten
Umständen (z. B. entgegenstehende überwiegende öffentliche Interessen,
Verhältnismäßigkeitserwägungen) können schwächere Ziele angestrebt werden und für
künstliche oder durch den Menschen erheblich veränderte Gewässer können geringere
Zielanforderungen festgelegt werden. Hier besteht aber ein hoher Begründungsbedarf
und die Ausnahmen und Verlängerungen sind regelmäßig zu überprüfen und ggf.
anzupassen.
Mit dieser 7. Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes, welche im Sommer 2002 rechtskräftig
wurde, war es jedoch nicht getan. Es mussten darüber hinaus die 16 Landeswassergesetze
entsprechend geändert werden, welche zunächst an die Neuregelungen im WHG angepasst
werden mussten. Zahlreiche Regelungen der WRRL können nicht bundeseinheitlich
vorgegeben werden und mussten bzw. müssen in Eigenverantwortung der 16 Bundesländer
umgesetzt werden.
,,Wesentliche Regelungen der Landeswassergesetze zur WRRL:
·
Zuordnung der Gewässer zu den Fluss-/Teileinzugsgebieten, Zuständigkeiten
·
Fristen
·
Koordinierung zwischen den Ländern
·
Behördenverbindlichkeit von Bewirtschaftungsplänen und
Maßnahmenprogrammen
·
Datenermittlung und -verarbeitung
·
Umfang der wirtschaftlichen Analyse
·
Regelmäßige Überprüfung der wasserwirtschaftlichen Zulassungen
·
Bestimmungen zu Gewässerrandstreifen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832488550
- ISBN (Paperback)
- 9783838688558
- Dateigröße
- 2.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- umgebungskarten maßnahmenprogramme oberflächengewässer grundwasser monitoring
- Produktsicherheit
- Diplom.de