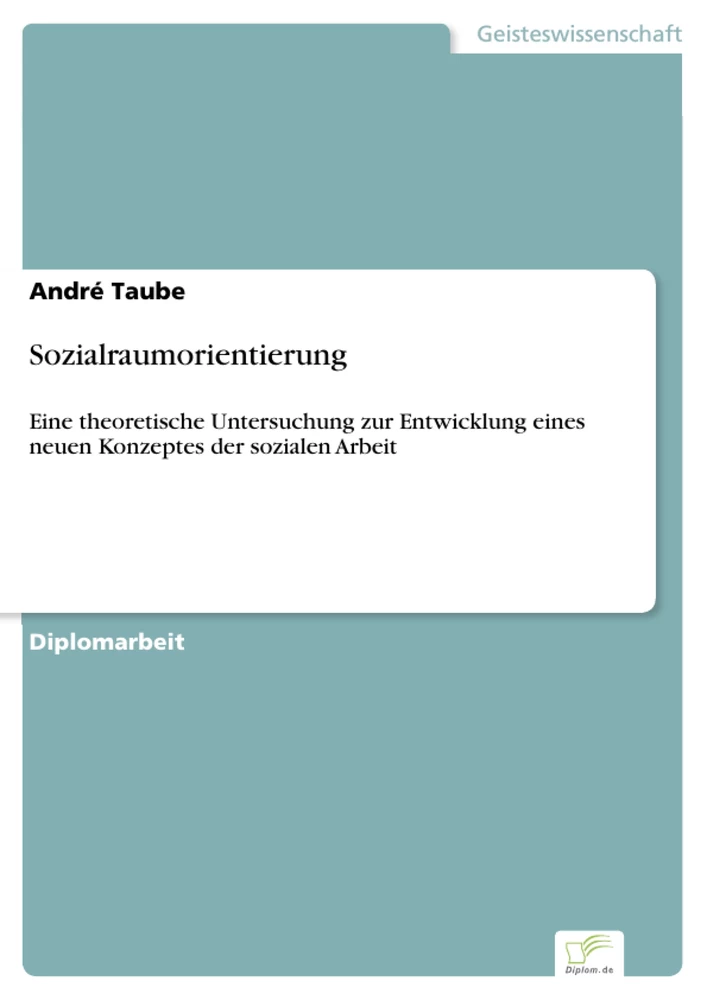Sozialraumorientierung
Eine theoretische Untersuchung zur Entwicklung eines neuen Konzeptes der sozialen Arbeit
Zusammenfassung
Meine Diplomarbeit ist inhaltlich durch mehrere Ansätze gekennzeichnet.
In den ersten beiden Kapiteln meiner Arbeit bearbeite ich die Thematik der Individualisierung und Pluralisierung, die im Wesentlichen die gesellschaftliche Entwicklung mit geprägt haben.
Die Soziale Arbeit hat sich mit den sozialen Risiken einer modernisierten Gesellschaft auseinandergesetzt und Konzepte erarbeitet, die dieser Entwicklung Rechnung tragen sollen.
In einem weiteren Schritt werde ich eine Notwendigkeit von Konzepten Sozialer Arbeit aufzeigen, im Kontext o.g. gesellschaftlicher Entwicklungen.
Die Konzepte, die ich in meinem Hauptteil meiner Arbeit bearbeiten werde, sind im Wesentlichen geprägt durch den Begriff der Lebenswelt. Das dritte Kapitel beschließt den allgemeineren Teil meiner Arbeit. In diesem Abschnitt ist es ein besonderes Anliegen von mir den Begriff der Lebenswelt in seiner philosophischen Dimension zu beschreiben, um ihn dann abzuleiten auf sozialpädagogische Konzepte. Ein historischer Rückbezug ist insofern bedeutsam, da das Konzept der Lebensweltorientierung (Thiersch) wesentliche Inhalte aufgreift, die in dem philosophischen Begriff der Lebenswelt angelegt sind. Dieses Konzept wird den Ausgangspunkt darstellen für meine weiteren theoretischen Überlegungen.
Praxisrelevant schien mir die Fragestellung, ob dieses Konzept in seiner Abstraktheit und Komplexität ableitbar ist auf die sozialpädagogische Praxis. In einem von mir selbst gewählten praktischen Beispiel eines Krisenwohnprojektes, in dem ich auch selbst tätig war, gelingt es mir, eine Antwort darauf zu finden.
Ein forschungsleitendes Interesse meiner Diplomarbeit ist die theoretische Untersuchung des Konzeptes der Sozialraumorientierung. Zum einen geht es mir darum, eine historische Entwicklung von Sozialraumorientierung aufzuzeigen. Lebensweltorientierung und Gemeinwesenarbeit stellen Konzepte Sozialer Arbeit dar, die im Wesentlichen das Konzept der Sozialraumorientierung mit geprägt haben.
Zum anderen gilt es in dieser Fragestellung meiner Arbeit herauszuarbeiten, stellt man die o.g. Konzepte gegenüber, ob es sich bei Sozialraumorientierung um ein neues, innovatives Konzept Sozialer Arbeit handelt.
In der ausführlichen Bearbeitung meiner Fragestellung habe ich die Erkenntnis gewonnen, daß Sozialraumorientierung im Wesentlichen den Inhalten entspricht, wie sie in den Konzepten der Lebensweltorientierung und der Gemeinwesenarbeit aufgezeigt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Modernisierung der Gesellschaft
2.1 Gesellschaftliche Entwicklungen
2.1.1 Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft
2.1.2 Individualisierung als Arbeitsprinzip der Sozialpädagogik/Sozialarbeit (SP/SA)
2.2 Fazit und Überleitung
3. Konzepte und Methoden
3.1 Notwendigkeit von Konzepten in der Sozialen Arbeit (SA)
3.2 Eine Differenzierung der Begrifflichkeiten
3.2.1 Konzepte der (SA)
3.2.2 Methoden der (SA)
3.3 Fazit und Überleitung
4. Die Philosophie der Lebenswelt
4.1 Der Begriff der Phänomenologie (Husserl, E.)
4.2 Strukturen der Lebenswelt von (Schütz, A.)
4.2.1 Zur Entstehung seiner Werke
4.2.2 Wirklichkeit und Alltag, Sozialwelt und Naturwelt
4.3 Kritische Betrachtung und Überleitung
5. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit (Thiersch, H.)
5.1 Zur Differenzierung der Begriffe Lebensweltorientierung und Alltagsorientierung
5.2 8. Jugendbericht (1990)
5.3 Das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe
5.3.1 Lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung (KJHG)
5.3.2 Entwicklungs- und Strukturmaximen
(Thiersch, H. und 8. Jugendbericht)
5.3.2.1 Arbeitsprofile lebensweltorientierter Sozialer Arbeit
5.3.2.2 Hilfe zur Selbsthilfe
5.4 Das Konzept der Alltagsorientierung (Thiersch, H.)
5.4.1 Alltag
5.4.2 Alltagsorientierung als Rahmenkonzept
5.5 Anmerkungen verschiedener Autoren zum Alltagsbegriff
5.6 Praxisbezug I
5.6.1 Das Konzept „StandBy-Projekt“
5.6.2 Grundlage des Angebotes
5.6.3 Problemstellung
5.6.4 Problemklärung
5.6.5 Arbeitsweisen
5.6.6 Resümee
5.7 Fazit und Überleitung
6. Gemeinwesenarbeit
6.1 Historische Entwicklung
6.2 Ansätze von Gemeinwesenarbeit in Deutschland
6.3 Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip Sozialer Arbeit
Exkurs: Empowerment
6.4 Strategien der Gemeinwesenarbeit (Hinte/Karas, Alinsky, Murray)
6.5 Kritische Stellungnahme und Überleitung
7. Das Konzept der Sozialraumorientierung
7.1 Entwicklungsstadien
7.2 Sozialraumorientierung in der fachlichen Diskussion
7.3 KGSt- Bericht 12/
7.3.1 Kontraktmanagement zwischen den öffentlichen und
freien Trägern in der Jugendhilfe
7.3.2 Erläuterungen zum Ansatz sozialraumorientierter Sozialer Arbeit
7.4 Qualitätskriterien in der Sozialraumorientierung
7.4.1 Fall spezifische Arbeit
7.4.2 Fall übergreifende Arbeit
7.4.3 Fall unabhängige Arbeit
7.5 Fazit und kritische Stellungnahme
7.6 Praxisbezug II
7.6.1 Zwischenbericht I des Modellprojektes: Hamburg, Dezember 2001„Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung (HzE) unter Einbeziehung der Implementierung eines Sozialraumbudgets“
7.6.2 Hintergrund der Projektentwicklung
7.6.3 Problemstellung bei den Hilfen zur Erziehung
7.6.4 Bildung eines Trägerverbundes
7.6.5 Konzeptentwicklung
7.6.6 Implementierungsphase
7.6.7 Zwischenbilanz und bisherige Erkenntnisse, Stand der Arbeit
8. Schlußbetrachtung
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Meine Diplomarbeit ist inhaltlich durch mehrere Ansätze gekennzeichnet.
In den ersten beiden Kapiteln meiner Arbeit bearbeite ich die Thematik der Individualisierung und Pluralisierung, die im Wesentlichen die gesellschaftliche Entwicklung mit geprägt haben.
Die Soziale Arbeit hat sich mit den sozialen Risiken einer modernisierten Gesellschaft auseinandergesetzt und Konzepte erarbeitet, die dieser Entwicklung Rechnung tragen sollen.
In einem weiteren Schritt werde ich eine Notwendigkeit von Konzepten Sozialer Arbeit aufzeigen, im Kontext o.g. gesellschaftlicher Entwicklungen.
Die Konzepte, die ich in meinem Hauptteil meiner Arbeit bearbeiten werde, sind im Wesentlichen geprägt durch den Begriff der „Lebenswelt“. Das dritte Kapitel beschließt den allgemeineren Teil meiner Arbeit. In diesem Abschnitt ist es ein besonderes Anliegen von mir den Begriff der „Lebenswelt“ in seiner philosophischen Dimension zu beschreiben, um ihn dann abzuleiten auf sozialpädagogische Konzepte. Ein historischer Rückbezug ist insofern bedeutsam, da das Konzept der Lebensweltorientierung (Thiersch) wesentliche Inhalte aufgreift, die in dem philosophischen Begriff der „Lebenswelt“ angelegt sind. Dieses Konzept wird den Ausgangspunkt darstellen für meine weiteren theoretischen Überlegungen.
Praxisrelevant schien mir die Fragestellung, ob dieses Konzept in seiner Abstraktheit und Komplexität ableitbar ist auf die sozialpädagogische Praxis. In einem von mir selbst gewählten praktischen Beispiel eines „Krisenwohnprojektes“, in dem ich auch selbst tätig war, gelingt es mir, eine Antwort darauf zu finden.
Ein forschungsleitendes Interesse meiner Diplomarbeit ist die theoretische Untersuchung des Konzeptes der Sozialraumorientierung. Zum einen geht es mir darum, eine historische Entwicklung von Sozialraumorientierung aufzuzeigen. Lebensweltorientierung und Gemeinwesenarbeit stellen Konzepte Sozialer Arbeit dar, die im Wesentlichen das Konzept der Sozialraumorientierung mit geprägt haben.
Zum anderen gilt es in dieser Fragestellung meiner Arbeit herauszuarbeiten, stellt man die o.g. Konzepte gegenüber, ob es sich bei Sozialraumorientierung um ein neues, innovatives Konzept Sozialer Arbeit handelt.
In der ausführlichen Bearbeitung meiner Fragestellung habe ich die Erkenntnis gewonnen, daß Sozialraumorientierung im Wesentlichen den Inhalten entspricht, wie sie in den Konzepten der Lebensweltorientierung und der Gemeinwesenarbeit aufgezeigt werden.
Doch was ist denn nun dran an dem Konzept der Sozialraumorientierung?
Das Konzept erhält seine Brisanz in der aktuellen fachpolitischen Diskussion der Jugendhilfe, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit.
In meinem letzten Kapitel geht es mir im Wesentlichen darum, dem Leser die eigentliche sozial (finanz) politische Relevanz in der Debatte um Sozialraumorientierung näher zu erläutern.
Diese Relevanz wird besonders deutlich, schaut man sich das Konzept genauer an, im Kontext einer Umstrukturierung der Jugendhilfe, insbesondere der Hilfen zur Erziehung (KJHG), wie sie im KGSt- Bericht gefordert wird. Sozialraumorientierung befindet sich noch in seiner Erprobungsphase, so daß noch keine endgültigen Ergebnisse aus der Praxis vorliegen.
In meinem forschungsleitendem Interesse dieses Kapitels geht es mir nicht nur hauptsächlich darum, zu einem Ergebnis zu kommen. Natürlich beziehe ich mich auf die pädagogischen Inhalte des Konzeptes und erkenne hier auch viel Positives. Trotzdem ist es ein wichtiges Anliegen von mir auf eventuelle Gefahren hinzuweisen, die ich in dem Konzept der Sozialraumorientierung erkenne.
Ich habe mich in der theoretischen Auseinandersetzung mit dieser Thematik kritisch zu Wort gemeldet. Meine Antworten auf die Fragestellung, ob und wie sich in Zukunft Sozialraumorientierung auswirken könnte, auf die Soziale Arbeit in der Jugendhilfe, sind rein hypothetischer Natur. Die Entwicklung wird zeigen wohin der Weg von Sozialraumorientierung führt.
Zum Schluß stelle ich in meinem zweiten Praxisbezug, das Hamburger Modellprojekt (Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung) der Jugendamtsregion III in Eidelstedt/Stellingen vor. Ich selbst habe an diesem Projekt in keiner Weise mitgearbeitet. Transparent dargestellt, zeigt es dem Leser welche notwendigen Schritte man einleiten muß, will man in Zukunft „Sozialraumorientiert“ arbeiten.
2. Modernisierung der Gesellschaft
2.1 Gesellschaftliche Entwicklungen
Ulrich Beck spricht von einer wohlfahrtstaatlichen Modernisierung, einem gesellschaftlichen Individualisierungsschub, der sich bislang in einer unerkannten Reichweite und Dynamik vollzogen hat.
Zusammengefaßt beschreibt die o.g. These einen historischen Kontinuitätsbruch, somit wird deutlich, daß auf dem Hintergrund eines vergleichsweisen hohen materiellen Lebensstandards und weit vorangetriebenen sozialen Sicherheiten, die Menschen aus ihren traditionellen Klassenbedingungen und Versorgungsbezügen herausgelöst wurden.
Im Zuge dessen waren die Menschen verstärkt auf sich selbst und ihr individuelles Arbeitsmarktschicksal mit allen Risiken, Chancen und Widersprüchen verwiesen.
(vgl. Beck 1986, S. 116)
So stellt sich für Beck die Frage nach den Klassenunterschieden, der sozialen Ungleichheit, mit Armut und Verelendung. Wie lassen sich die sozialen Risiken im Kontext wohlfahrtstaatlicher Modernisierung erklären?
Weg von dieser Argumentation der sozialen Frage, so hat sich die Bundesrepublik von einer Mangelgesellschaft zu einer Reichtumsgesellschaft entwickelt, die oben beschriebene Risiken systematisch mit produziert hat.
Diese Modernisierungsrisiken gewinnen insbesondere immer dann und dort an Bedeutung, und hier kommt der Autor wieder auf die soziale Frage zurück, wo echte materielle Not objektiv verringert oder erfolgreich ausgegrenzt worden ist (vgl. Rauschenbach 1993, S. 32ff).
Genauer werde ich die Frage nach den sozialen Risiken im Anschluß dieses Kapitels beantworten.
Es wird deutlich, daß die Relationen sozialer Ungleichheit zwar relativ konstant geblieben sind, insgesamt aber eine Niveauverschiebung nach oben erfolgt ist.
Beck spricht von einem sogenannten Fahrstuhleffekt, die Klassengesellschaft wird insgesamt eine Etage höher gefahren (vgl. Beck a.a.O., S. 122).
Thiersch unterstreicht diese Aussage und spricht im Zuge dieser Entwicklung von einer Zwei-Drittel/Ein-Drittel Gesellschaft, indem der größere Teil von Lebensmöglichkeiten und Ressourcen profitiert, der Kleinere aber an den Rand gerät (vgl. Thiersch 1992, S. 21).
Dieses hat in der Konsequenz zur Folge, daß sich traditionelle Milieus auflösen und die Menschen die Verbesserungen des eigenen Lebensstandards im Generationenvergleich als immer so nachhaltig erleben, daß sie sich stückweise aus den Zwängen der Herkunftsmilieus lösen (vgl. ebd.).
Unter den Bedingungen eines sozialen Wandels und einer Enttraditionalisierung der industriegesellschaftlichen Lebensformen (hierzu genauer, Beck a.a.O., S. 113) wird deutlich, daß alte und neue soziale Probleme und Benachteiligungen nebeneinander existieren, daß schicht-, geschlechts- und regionspezifische Benachteiligungen und Disparitäten weiter wirken.
Somit wird deutlich, daß Pluralisierung und Individualisierung heute die gesellschaftstheoretischen Bezugsgrößen sind, an denen in der sozialwissenschaftlichen Diskussion die Entwicklung unserer Gesellschaft thematisiert wird.
Gesellschaftliche und soziale Folge der Auflösung gewachsenen traditionellen Milieus, beinhalten Risiko und Chance zugleich (vgl. Böhnisch/Münchmeier 1990, S. 48ff).
2.1.1 Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft
Aus meiner Perspektive läßt sich der Prozeß der Individualisierung aus einer pluralistischen Gesellschaftsordnung heraus erklären.
So wird festgehalten, daß es keine einheitlich anerkannte Normen- und Wertestruktur in o.g. Gesellschaftsordnung gibt, sondern eine Vielzahl von Interessengruppen sozialer, religiöser, politischer und anderer Natur. Diese konkurrieren um gesellschaftlichen Einfluß, und damit um die Durchsetzung ihrer normativen Wertvorstellungen (vgl. Stimmer 1998, S. 370).
Auf zweifache Weise wird die Sozialpädagogik somit herausgefordert. Zum einem ist sie der Gefahr der Einflußnahme politischer und ideologischer Interessengruppen ausgesetzt, die ihre wissenschaftliche Betrachtungsweise ihres Gegenstandes verfälscht und überformt, zum anderen hat sie die schwierige Aufgabe ihre Klienten zu befähigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren eigenen Weg zu finden, ohne daß sie sich innerhalb dieser Strukturen von Interessengruppen vereinnahmen lassen (vgl. ebd. S. 371).
Pluralisierung und Individualisierung werden neben sozialer Dynamik, Technologisierung und Bürokratisierung, als ein wesentliches Merkmal moderner Gesellschaften westlicher Prägung beschrieben. Emanzipation, individuelle Autonomie und Selbstverwirklichung sind Begriffe, die diese Orientierung bestimmen (vgl. Stimmer a.a.O., S. 242).
An dieser Stelle verweise ich auf eine Zusammenfassung von (Krüger, H.-H.: Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft, Opladen 1997, S. 57ff), ebenfalls (Thiersch/Gieseckes 1970, offensiv-emanzipatorische Sozialpädagogik, S. 129ff).
Beide Thesenpapiere behandeln ausführlich die o.g. Begrifflichkeiten, basierend auf der theoretischen Grundlage der kritischen Theorie, Interaktionismus und Erziehungswissenschaft.
„Enttraditonalisierung der individuellen Lebensführung kann auf sozialer Ebene als ein Verlust an kollektiver Orientierung umschrieben werden, als Freisetzung aus den Abhängigkeiten ständischer Gesellschaften. Individualisierung markiert insofern einen Vorgang, in dem die Menschen aus dem Nest der sie leitenden und bindenden Traditionen, aus den Schranken und Sicherheiten der Klassenkulturen und Herkunftsmileus herausfallen- „freigesetzt“ werden, wie Marx dies nannte- und mit sich selbst als Dreh- und Angelpunkt der eigenen Lebensführung konfrontiert werden (Zit. nach Beck 1985, in: Rauschenbach a.a.O., S. 88).
Individualisierung wird hier dementsprechend als ein historisch widersprüchlicher Prozeß der Vergesellschaftung verstanden. Es entsteht ein neues, unmittelbares Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Demnach werden die einzelnen selbst als Konsumenten, Staatsbürger und Klienten, als Arbeitnehmer, wie als Entscheidungsinstanz über die Gestaltung ihrer Freizeit ungleich direkter und ungeschützter mit den Anforderungen, Mechanismen, Möglichkeiten und Zwängen der Gesellschaft konfrontiert (vgl. Rauschenbach a.a.O., S. 41).
Thiersch unterstützt diese These und weist darauf hin, daß Vergesellschaftung und Individualisierung zunehmen, als gleichsam gegenläufige Bewegungen. Diese unterstreichen die Ambivalenz der Individualisierung. Sich zu orientieren wird eine eigene, aufwendige und schwierige Aufgabe, sie bedeutet in der Zumutung der Selbstbehauptung zugleich Chance und Überforderung bzw. Lebensbewältigung als Vermittlung wird zunehmend kompliziert.
(vgl. Thiersch 1992, S. 21)
Anders formuliert bedeutet Individualisierung zugleich Freiheitsgewinn und Freiheitsverlust, wachsende Freiheit und wachsende Bindungslosigkeit. Neue Freiheiten werden mit neuen Zwängen erkauft. Individualisierung wird zu einem neuartigen Risikospiel mit Gewinn- und Verlustchancen (vgl. Rauschenbach a.a.O., S. 444).
2.1.2 Individualisierung als Arbeitsprinzip der Sozialpädagogik/Sozialarbeit (SP/SA)
Aus den Individualisierungs- und Pluralisierungsschüben einer postmodernen Gesellschaftsform heraus, entstehen soziale Risiken für die Menschen.
Diese Risiken entstehen aus der Vielfalt der Optionen der neu gewonnenen Freiheit, was zugleich auch ein Wagnis mit ungewissen Folgen darstellen kann.
Erklärbar werden diese Risiken unter dem Hintergrund der zwischenmenschlichen belastenden Verhältnisse in denen die Menschen leben, mit ihren riskanten Beziehungen, ihrem Erleben von Anonymität, Diskontinuität und Isolation.
Die Menschen experimentieren sozusagen mit sich selbst und riskieren dabei psycho-soziale Grenzerfahrungen, ohne zu wissen was daraus wird (vgl. Rauschenbach a.a.O., S. 38).
Aufgeführt werden u.a. Sinnkrisen, Orientierungsverlust, existenziell bedrohende Lebenskrisen, extensiver, Lebensressourcen zerstörender Rauschmittelgenuß, Depressionen, Trauer, Schmerz, quälende Ungewißheiten, u.v.a. (vgl. ebd.).
Die Lebensmöglichkeiten, das Leben jedes Einzelnen werden selbst zu einem Risiko, einem Projekt mit offenem Ausgang. In Anbetracht dieser Feststellung, erfordert diese neue Lage ein ungleich höheres Maß an (Möglichkeits-) Wissen über soziale Zusammenhänge, über mögliche Wirkungen und Folgen psycho-sozial belastender Lebenslagen.
Diese Belastungen der Lebenslagen, seine Wirkung und die Folgen für die Menschen, lassen sich aus der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die als Modernisierung bezeichnet wird, erklären, was auf einen Zusammenhang von Sozialer Arbeit, Erziehung und Risikogesellschaft hinweist (vgl. ebd. S. 39).
Dieser Zusammenhang wird von Hans Pfaffenberger in: (Kaller, P.: Lexikon Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialrecht, Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim 2001, S. 185) folgendermaßen verdeutlicht.
„Individualisierung meint einmal eine kulturelle Entwicklungstendenz oder ein Moment der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die auch als „Modernisierung“ bezeichnet wird.
Sie führt zur Erhöhung der Chancen und Optionen des Einzelnen aber zugleich zur Verschärfung von Entscheidungskonflikten und ähnlichen Belastungen und Überforderungen, die von manchen Autoren zur Hauptsache für den Bedarf an Sozialarbeit/Sozialpädagogik (SA/SP) erklärt wird.
Deshalb gehört sie auch in dieser Bedeutung schon zur Fachsprache der Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ (Zit. nach Kaller, P. a.a.O., S. 185).
Individualisierung als Arbeitsprinzip der SA/SP hat somit in der Fachterminologie einen zentralen Stellenwert eingenommen.
Dieses Prinzip geht in seiner praktischen Ausrichtung von der Besonderheit des Einzelfalles, einer Gruppe oder eines Gemeinwesens aus (hier wird schon auf die Entstehung der drei klassischen Methoden Sozialer Arbeit hingewiesen). Es soll nicht als individuelle Schuldzuweisung gesellschaftlicher Ursachen verstanden werden. Vielmehr steht die Hinwendung zu den Interessen, Fähigkeiten, den Lebenslagen und Lebensgeschichten der Individuen, mit ihrer Besonderheit und Einmaligkeit im Vordergrund (vgl. Stimmer a.a.O., S. 242).
Daraus läßt sich ein handlungsleitendes Interesse von SA/SP erkennen.
Zum einen fordert das Arbeitsprinzip die sorgfältige, („individualisierende“) Analyse von Ursachen und Auslösern von Notlagen usw. und deren Verknüpfung im Einzelfall (Fallstudien und Kasuistik), zum anderen soll es das Fallverstehen und die methodische Bearbeitung des Einzelfalls fordern und sichern.
Dieses Prinzip gilt aber für alle drei Arbeitsformen von SA/SP und nicht nur für die Einzelfallbearbeitung. So müssen auch die Familie, die Gruppe und das Gemeinwesen in ihrer sozusagen „individuellen“ Einmaligkeit und Einzigartigkeit wahrgenommen und verstanden werden, damit Sozialarbeit/Sozialpädagogik adäquate Hilfe anbieten und leisten kann (vgl. Pfaffenberger in Kaller, P. a.a.O., S. 185).
An dieser Stelle erhalten die Leser schon einen ersten Hinweis auf das Konzept der Sozialraumorientierung. Das handlungsleitende Interesse dieses Ansatzes basiert nämlich im Wesentlichen auf dem oben aufgeführtem Arbeitsprinzip Sozialer Arbeit. Besonders deutlich wird dieses Interesse, wenn ich mich später mit den Konzepten der Lebensweltorientierung, der Gemeinwesenarbeit und der Sozialraumorientierung detaillierter auseinandersetze.
2.2 Fazit und Überleitung
Zusammenfassend kann ich mir nun erklären warum eine Notwendigkeit bestand, Konzepte und Methoden Sozialer Arbeit zu entwickeln, die o.g. Modernisierungsrisiken Rechnung tragen sollen.
Individualisierung und Pluralisierung stellen meiner Meinung nach die Rahmenbedingungen sozialarbeiterischen Handelns dar und weisen auf komplexe, vielschichtige Problemlagen und Nöte der Menschen in einer modernen Gesellschaft hin.
Aus dieser Erkenntnis heraus erscheint es mir nur logisch und verstehbar, daß die Sozialarbeit/Sozialpädagogik die große Herausforderung angenommen hat, Konzepte und Methoden zu entwickeln, die eben o.g. Probleme und Notlagen auffangen sollen bzw. adäquate Hilfen so anzubieten, daß Hilfe zur Selbsthilfe für die Menschen möglich wird.
Bevor ich inhaltlich mit der theoretischen Untersuchung sozialpädagogischer Konzepte fortfahre, ist es mir ein Anliegen zu verdeutlichen, was Konzepte und/oder Methoden Sozialer Arbeit darstellen sollen, welchen Stellenwert sie in der Sozialarbeit einnehmen.
3. Konzepte und Methoden
3.1 Notwendigkeit von Konzepten in der Sozialen Arbeit (SA)
In einer kurzen Einführung, was mein Anliegen meiner Diplomarbeit unterstützt, wird verdeutlicht welchen Stellenwert Konzepte und Methoden Sozialer Arbeit haben.
So wird angemerkt, daß gerade auf der professionellen Seite, nämlich SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen, heute stärker als früher ihr Handeln gegenüber der Gesellschaft, den Klienten und nicht zuletzt auch gegenüber sich selbst begründen müssen (vgl. Jakob, Wensierski 1997, S. 7).
Es stellt sich somit die Frage, insbesondere nach geeigneten Methoden und Konzepten, die in der Lage sind, sozialpädagogisches Handeln als Prozeß zu verstehen, die der Komplexität des beruflichen Alltags der Sozialen Arbeit gerecht werden, und die vor allem die subjektive Perspektive und lebenspraktische Autonomie der Klienten, als notwendige Voraussetzung für jede sozialarbeiterische Intervention in Rechnung stellen.
Daran sind Anforderungen an die heutige Zeit gestellt, die eine planvolle Gestaltung und kritische Selbstreflexion der Sozialen Arbeit notwendig erscheinen lassen.
Begriffe wie Professionalisierung, Fachlichkeit, Sozialpädagogische Diagnosen, Hilfeplangestaltung, Supervision, Selbstevaluation und lebensweltorientierte Methoden sind nur einige Stichworte, die diese Modernisierung der Sozialarbeit und Sozialpädagogik begleiten (vgl. ebd.).
Ich verstehe, daß eine Modernisierung der Gesellschaft, sukzessive eine Modernisierung der Sozialen Arbeit nach sich gezogen hat. Das allein reicht aber nicht aus. So bin ich der Meinung, daß o.g. Begrifflichkeiten in eine konstruktive Planung und Gestaltung von sozialarbeiterischen Konzepten, mit seinen methodischen Settings, implementiert werden sollten. Diese sollen nach meinem Verständnis nachweislich Auskunft über Ziele und Inhalte pädagogischer Interventionen geben können. Diese sollten transparent dargestellt und in Hinblick ihrer Umsetzung überprüfbar bzw. nachvollziehbar sein.
Peter Flosdorf merkt hierzu an, daß eine pädagogische Konzeption insofern mehr leisten muß, als die plakative Darstellung eines Prospektes. Es reicht nicht aus einzelne pädagogische Szenen oder Räume auf buntem Glanzpapier, dekorativ darzustellen. Ein Konzept muß dem Fachmann und interessierten Leser einen Überblick über die Ziele, Inhalte und Methoden und deren organisatorische Verwirklichung, sprich praktische Umsetzung geben können (vgl. Flosdorf, P. 1988, S. 145).
Demnach fehlt es an klaren Zielformulierungen, oder wie Pedro Graf es ausdrückt, sind Konzeptionen Sozialer Arbeit oft eher Werbe- und Rechtfertigungsschriften, als daß sie handlungsleitende Programme darstellen, die auf einer präzisen Analyse der sozialen Lage ihrer Adressaten und deren Bedürfnisse und daraus abgeleiteten Handlungsstrategien beruhen würden (vgl. Graf, P. 1996 S. 14).
Ich greife die Anmerkungen der beiden Autoren auf und versuche in einem nächsten Schritt näher zu erklären, worum es sich überhaupt handelt, wenn man von Konzepten und/oder Methoden in der Sozialen Arbeit spricht.
3.2 Eine Differenzierung der Begrifflichkeiten
3.2.1 Konzepte der (SA)
Ein Konzept ist einfach gesagt nichts mehr als eine erste Niederschrift, eine erste Fassung, ein Plan oder Entwurf (lat. Conceptum „das (in Worten) Abgefaßte, Ausgedrückte“), eine Methode ist ein planmäßiges, folgerichtiges Verfahren, Vorgehen, Handeln, ein wissenschaftliches Anwenden, Einführen und Entwickeln (vgl. Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch 1985, S. 2207 u. S. 2526).
Konzepte der Sozialpädagogik/Sozialarbeit in ihrer historischen Entwicklung sind in der Rezeption amerikanischer Fachliteratur ein entlehnter Begriff nach dem 2. Weltkrieg, entnommen der englisch- amerikanischen Fachsprache (concept, vergl. etymologisch Konzeption, Konzeptualisierung usw .).
Es handelt sich demnach um strukturierende bzw. organisatorische Schlüsselbegriffe oder Grundbegriffe eines Fachgebietes oder wissenschaftlichen Disziplin.
Es wurden in den letzten Jahrzehnten nacheinander tiefenpsychologisch-psychoanalytische, soziologische und lerntheoretische, verhaltenstherapeutische Konzepte rezipiert (auf,- an,- übernommen) und in den wissenschaftlichen Bezugsrahmen übernommen (hierzu genauer Pfaffenberger in Kaller, P. a.a.O., S. 248).
Einfacher ausgedrückt ist ein Konzept ein Handlungsmodell des Pädagogen, in dem Ziele, Inhalte und Methoden in einen sinnhaften Zusammenhang stehen bzw. ist es die theoretisch begründete Anleitung zur sinnvollen Abfolge von Handlungen, deren Erläuterungen und Reflexion. Das Konzept stellt ein Entwurf dar, in dem das Ziel und die effektivste Methode zur Zielerreichung gedanklich vorweggenommen wurde (vgl. Schilling, J. 1993, S. 230).
Unter Konzept kann ebenfalls ein Handlungsmodell verstanden werden, in welchem die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die Verfahren sich sinnhaft im Ausweis der Begründung und Rechtfertigung darstellen (vgl. Geißler/Hege 1992, S. 23).
3.2.2 Methoden der (SA)
Der Begriff der Methode oder „methodos“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet in seinem Wortsinn „Weg zu etwas“. Es handelt sich um das planmäßige Verfahren zur Erreichung eines bestimmten Zieles. So wird angemerkt, daß jeder Wissenschaft und Erfahrungswissenschaft eine Methodenlehre vorausgeht, die den wichtigsten Teil der Wissenschaftstheorie bildet. In den empirischen Sozialwissenschaften, z.B. der Psychologie und Soziologie gelten Befragung, Beobachtung, Experiment u.a. als Grundmethoden.
So werden ihnen spezielle Einzelmethoden der Anwendung (Erkenntnismethoden) zugeordnet, wie Testverfahren, Explorationen, Anamnesen (vgl. Kaller, P. a.a.O., S. 271).
Paul Kaller bezieht sich in seinen Ausführungen auf (Lowy, L.: Sozialarbeit- Sozialpädagogik als Wissenschaft im amerikanischen und deutschsprachigen Raum, Freiburg/Br. 1983).
Insgesamt wird deutlich, daß Soziale Arbeit eine Arbeit mit methodischem Ansatz ist, die bestimmten Interventionstechniken folgt. Diese sind Mittel und Wege, um Soziale Arbeit sachgemäß zu praktizieren, und sie sind grundsätzlich Sinn relevant, und wie alle Herangehensweisen orientieren sich auch diese an der Effizienz, ausgewiesen durch das Experiment. Soziale Arbeit ist obschon dieser Überlegung mehr als die Summe ihrer Methoden und Techniken (vgl. Mangold, J. 1997, S. 33).
Die Begriffsvielfalt der Methode kann z.B. in acht verschiedenen Ansätzen definiert werden. So gibt es die Methode als Muster des Lehrverhaltens, als angewandte Lernprinzipien, als zielgerichtete Verfahrensweisen, als Strukturmoment und als Erfindung, als theoretische Konzeption des pädagogischen Handlungszusammenhangs, als Form der Unterrichtskommunikation und Methode als Erziehungsweg (vgl. Schulze, Th. in Schilling a.a.O., S. 64). Schilling kommt zum Ergebnis, daß aufgrund dieser Vielfalt von Erscheinungen sehr unterschiedlicher Art und Größenordnung, es nicht möglich ist in einer erziehungswissenschaftlichen Darstellung oder Untersuchung naiv von „Methode“ zu sprechen. „Es kann nicht sein, einfach eine bestimmte Gruppe von Erscheinungen herauszugreifen, ohne sich zu vergewissern, welchen Stellenwert sie im Gesamtfeld der Erscheinungen besitzen und in welchem Bezugsrahmen sie zu interpretieren sind“ (Zit. nach Schilling a.a.O., S. 65).
Ich erkenne eine versteckte Kritik von Schilling in seiner Ausführung, wenn es um den professionellen Umgang mit dem Begriff der Methode in der Sozialen Arbeit geht.
So komme ich zur Annahme, daß Methoden eben mehr sind als bloße sozialpädagogische Ansätze. Inhalte und Verfahrensweisen einer Methode sollten nach meinem Verständnis immer so angewendet werden, daß sie ein bestimmtes Ziel nicht nur anstreben, sondern als Mittel zur Zielerreichung dienen und immer dabei den Anspruch erheben sollten, Probleme wirklich zu lösen, oder wie Mangold sich treffend dazu äußert: „ Effizient ist eine Arbeit erst, wenn sie zu einer Lösung des Problems führt“ (Zit. nach Mangold, J. a.a.O., S. 33).
Ähnliche Problemsicht erkennen auch Geißler/Hege. Die Autoren merken an, daß die Frage nach den Mitteln, den Methoden sozialpädagogischen Handelns so übergewichtig und dominant wird, daß sie losgelöst von Ziel- und Inhaltsproblemen zum Selbstzweck wird bzw. bleiben der Begründungs- und Rechtfertigungszusammenhang der Ziele und Inhalte des beruflichen Handelns weitgehend undiskutiert (vgl. Geißler/Hege a.a.O., S. 19).
Ebenso wird kritisch angemerkt, daß eine berufliche Handlungskompetenz sich somit weitgehend in die Scheinfreiheit verlagern kann, wobei nicht mehr über den beruflichen Alltag selbst diskutiert und unterschieden werden kann, sondern nur noch über die Methode seiner Realisierung. In der Konsequenz könnte daraus ein Methodenpluralismus entstehen und sukzessive Inhalte und Ziele sozialpädagogischen Handelns in den Hintergrund treten (vgl. ebd.).
Die Autoren mahnen an, daß die komplexe, inhaltliche Fragestellung sozialpädagogischen Handelns auf die Formel reduziert werden könnte. „Welches Symptom verschwindet am schnellsten, mit welcher Methode“? (Zit. nach Geißler/Hege a.a.O., S 20)
Ein Rückbezug zu den Inhalten und Zielen einer Methode könnte ebenso ausbleiben, wie die Integration in ein umfassendes Konzept sozialpädagogischen Handelns (vgl. ebd. S. 20ff).
Hier wird noch einmal deutlich, wie wichtig die Evaluation und Dokumentation sozialpädagogischer Handlungsabläufe ist. Ich denke sie sollten in jeder Konzeption einen zentralen Stellenwert einnehmen.
Unterstützt wird diese o.g. Problemstellung durch die Aussage Erich Wenigers, der hinzufügt, daß erzieherische Methoden keine bloßen Techniken, keine bis ins einzelne festgelegten Verfahrensweisen sind. Sie sind Formen menschlicher Begegnung, variabel nach Zeit, Ort individueller Situation und Stimmung der Beteiligten. Das wiederum bedeutet, daß wir die Freiheit unseres methodischen Handelns nur gewinnen können, indem wir die Bedingungen für das jeweils methodische Handeln erkennen. So sollten die strukturellen Voraussetzungen für die Wahl einer Methode einerseits, ebenso wie die Möglichkeiten zur Zielerreichung mit dieser oder jener Methode andererseits, immer in Betracht genommen werden, um herauszufinden welche Grenzen und Schwächen oder auch welche Reichweite die zu wählende Methode hat (vgl. Weniger, E. in Geißler/Hege a.a.O., S. 32).
Grundsätzlich umfassen drei klassische Methoden der Sozialen Arbeit, die Arbeitsformen und Verfahrensweisen der sozialpädagogisch/sozialen Praxis, als Praxis der Interventionsmethoden. Entstanden sind diese Methoden aus den Entwicklungstendenzen einer modernisierten Gesellschaft, wie ich sie versucht habe darzustellen.
Unterschieden wird in primäre Methoden (soziale Einzelhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit) und sekundäre Methoden (Administration und Organisation, Forschung, Praxisberatung und Supervision).
(hierzu genauer, Kaller, P. a.a.O., S. 271ff)
Es soll hier jetzt nicht mein Anliegen sein, einen historischen Rückbezug zur Entstehung der drei klassischen Methoden Sozialer Arbeit vorzunehmen, das ist auch nicht mein Thema.
(hierzu genauer, Stimmer, F. Lexikon der Sozialpädagogik und Sozialarbeit 1998, S. 312)
Ich vernachlässige an dieser Stelle eine detaillierte, inhaltliche Wiedergabe der drei klassischen Methoden Sozialer Arbeit (soziale Einzelhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit) und komme später noch einmal auf die Methode der Gemeinwesenarbeit zurück, die ich dann detaillierter darstellen werde
3.3 Fazit und Überleitung
Ich denke, daß eine Notwendigkeit von Konzepten und Methoden Sozialer Arbeit, in ihrer Weiterentwicklung und Realisierung, mit ihren Zielen, Inhalten und pädagogischen Handlungsabläufen, aus einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet, immer gegeben ist.
Wie von mir aufgeführt, gibt es eine Fülle von unterschiedlichen Interpretationen, was ein Konzept und /oder eine Methode in der Sozialen Arbeit darstellen soll.
Aufgrund dieser Begriffsvielfalt stelle ich mir die Frage, wenn es um die Entwicklung eines Konzeptes der Sozialraumorientierung geht, woher diese Überlegungen stammen bzw. auf welchen Konzepten und Methoden beruhen die Inhalte eines sozialräumlichen Ansatzes der Sozialen Arbeit? Ist es nur eine weitere Methode oder ein Experiment, was subsumiert unter schon bestehenden Methoden, keine neuen Erkenntnisse bringt?, oder ist es etwa ein ganz neues, nie da gewesenes, innovatives Konzept Sozialer Arbeit?
Um meine Fragestellung zu beantworten, ist es hilfreich sich mit dem lebensweltorientierten Ansatz Sozialer Arbeit von Hans Thiersch zu beschäftigen. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für weitere theoretische Untersuchungen meiner Arbeit, ebenso gehe ich genauer auf die klassische Methode der Gemeinwesenarbeit ein, woraus sich eine Entwicklung einer Sozialraumorientierung ableiten läßt.
Bevor ich nun mit dem Vergleich o.g. Konzepte fortfahre, ist es ein Anliegen von mir den Begriff der "Lebenswelt" aus seiner philosophischen Dimension heraus näher zu erläutern, um ihn dann abzuleiten auf sozialpädagogische Konzepte.
Ich werde versuchen mich knapp zu halten, da dieses Experiment sonst wiederum die Dimensionen meiner Diplomarbeit sprengen würde.
4. Die Philosophie der Lebenswelt
4.1 Der Begriff der Phänomenologie von Husserl, E.
Mit der Thematik der Lebenswelt haben sich viele Autoren auseinandergesetzt, wie z.B. Habermas, Kant, Hegel u.v.a.
Ich beziehe mich bei meiner Darstellung auf die Gedanken von Husserl, E.
Der Begriff der Lebenswelt wurde von Husserl, E. (1859-1938) eingeführt und entstammt dem Sinn nach aus der phänomenologischen Soziologie, der „Phänomenologie“ (vgl. Stimmer a.a.O., S. 304).
Seinen Gedanken zu folgen war nicht leicht, und trotz seiner abstrakten und doch sehr differenzierten Auslegung des Lebensweltbegriffes, komme ich nicht umhin seine begründete Philosophie der Phänomenologie kurz darzustellen.
Ich werde mich beschränken, da das Thema dermaßen Komplex ist und ich nur den kleinen Teil beschreibe, von dem ich ausgehe ihn verstanden zu haben, und daß er mir in meinen weiteren Ausführungen hilfreich sein kann.
Allgemein kann unter Phänomenologie die Lehre von den Erscheinungen (Phänomenen) verstanden werden, die die Trennung der Wahrheit von Schein ermöglicht, und somit als Fundament für empirisches Wissen gilt (vgl. ebd. S. 369).
Gemeint sind Erscheinungen im Unterschied zum „Ding an sich“. Es beschreibt die Lehre von der Wesenheit, der Bedeutung, dem Sinn der Dinge unter Ausklammerung ihrer individuellen Realität, die nur Erscheinungsformen sind (vgl. Wahrig, G.: Deutsches Wörterbuch 1985, S. 2838).
So spricht Husserl gelegentlich auch vom „Natürlichen Leben“ oder auch einer Ontologie des „So seins“ der Dinge. Nach seinem Verständnis verbleibt die Welt/Lebenswelt noch innerhalb dieser natürlichen Einstellung. Anders ausgedrückt, befindet sich der Mensch der natürlichen Einstellung innerhalb dieser „vorgegebenen“, an sich seienden, „objektiven“ Welt, seiner Lebenswelt (vgl. ebd.).
„Das objektive Äußere wird zu einer objektiven Erkenntnis und erfordert Geltung für jedermann und wird intersubjektiv vermittelt“ (Zit. nach Ulfig, A.: Lebenswelt, Reflexion und Sprache 1997, S. 27). Es bedeutet erst einmal nichts anderes, daß wir Menschen die gleiche Sicht der Dinge haben, unser Bewußtsein verschiedener Personen gemeinsam ist (vgl. Wahrig a.a.O., S. 1962).
Ich verstehe, daß alle Menschen die Gegenstände oder Dinge ihrer Umgebung erst einmal nur als das wahrnehmen was sie sind, in ihrer äußeren Erscheinungsform, z.B. ein Haus ist ein Haus, ein Baum ein Baum usw. Unter intersubjektiv verstehe ich die philosophische Denkrichtung von Husserl, daß jeder Mensch davon ausgeht, daß seine Mitmenschen eine gleiche Vorstellung der äußeren Objekte haben, das Gleiche erkennen wie ich selber.
Ein Baum wird faktisch immer ein Baum, so wie er da steht bleiben, ohne Bedeutung und inhaltslos. Somit erkläre ich mir Husserls Theorie der Ontologie, die Theorie der natürlichen Einstellung der Lebenswelt.
Husserl geht in seiner begründeten philosophischen Denkrichtung davon aus, daß die Menschen ihre äußere Welt sich aneignen mit ihren natürlichen Dingen, wenn sie als sinnhaft erlebt werden.
Er meint, daß alles sinnhaft Erlebte vom Individuum durch intentionale (zielgerichtete) Bewußtseinsakte geschaffen wird. Diese phänomenologische Herangehensweise bildet die umfassende Grundlage, daß Strukturen und Prozesse in der Lebenswelt aufgedeckt werden können, die zur Bildung der „Erfahrungswelt“ bzw. „Wissenswelt“ führen (vgl. Stimmer a.a.O., S. 369).
Die Phänomenologie hatte als wissenschaftstheoretische Grundlage großen Einfluß auf die Geisteswissenschaften. Neben einer phänomenologischen Soziologie, Psychologie und Pädagogik, gibt es seit den frühen 80er Jahren auch eine phänomenologisch beeinflußte Sozialpädagogik (Alltagsansatz) (vgl. ebd. S. 370).
Wie verstehe ich Husserls Philosophie? Ich denke wir können uns die Welt nur zu Eigen machen, wenn wir den äußeren Dingen eine subjektive Bedeutung verleihen, ihnen einen Sinn verleihen. Hier fällt mir wieder das Beispiel mit dem Baum ein. So ist ein Baum erst einmal nichts anderes als ein Baum, so wie er da vor mir als Faktum gegenüber steht. So kann er für mich ein zu schützendes Gut sein, das erhalten werden soll, damit die Natur geschützt wird. Für jemand anderen bringt sein Holz Profit, dieser Mensch denkt eher über den wirtschaftlichen Nutzen nach, also wird er ihn wahrscheinlich abholzen. Je nachdem welche individuelle Bedeutung, welche Symbolik der Baum für mich hat, wird er für mich wirklich. Das bedeutet im Umkehrschluß, daß der Baum aus seiner natürlichen, starren Einstellung herausfällt und für mich erlebbar bzw. sinnlich wahrgenommen werden kann. Ich kann mich jetzt um die jeweilige Symbolik, die der Baum für mich und den anderen hat streiten. Überzeugt der andere Mensch mich mit seiner Vorstellung, daß man mit Bäumen viel Geld machen kann, wird sich gleichsam die Struktur meiner Lebenswelt verändern. Wo eben noch ein Baum war, ist nichts mehr. Die Lebenswelt wäre demnach für mich die erlebte Wirklichkeit im Alltag und nicht nur bloße Erscheinungsform. Ich erlange ein Wissen über meine Lebenswelt, ich beziehe mich auf ihre Strukturen, die für mich handlungsleitend sind.
„Unter Lebenswelt versteht man die vorwissenschaftliche, dem Menschen selbstverständliche Wirklichkeit, die ihn umgibt. Die Lebenswelt erhält ihr Gepräge durch das persönliche Erleben seines alltäglichen, direkten Umfeldes durch den Menschen, aus dem er seine Primärerfahrungen bezieht, die ihm Handlungssicherheit verleihen. Der Begriff der Lebenswelt gewinnt seit dem zunehmenden Interesse am „Alltag“ in der Sozialpädagogik an Bedeutung“ (Zit. nach Stimmer a.a.O., S. 304).
Um nun auf das Konzept der lebensweltorienterten Sozialen Arbeit von Thiersch hinzuführen, werde ich nun in einer Zusammenfassung auf die Strukturen der Lebenswelt von Alfred Schütz eingehen.
4.2 Strukturen der Lebenswelt von (Schütz, A./Luckmann, T.)
4.2.1 Zur Entstehung seiner Werke
Schütz hat sich mit den Strukturen der Lebenswelt auseinandergesetzt. Ein Jahr vor seinem Tod hat er sich intensiv mit seinen Vorbereitungen beschäftigt, für sein Buch, was lange geplant war.
Seine Gedanken und Entwürfe waren bereits so weit gereift, daß es dem Autor Thomas Luckmann nützlich erschien die Hauptlinie seiner Gedanken weiter zu verfolgen.
Durch einer exakten Rekonstruktion und einer angemessenen Interpretation des philosophischen und soziologischen Werks von Schütz, gelang es die Bücher „Strukturen der Lebenswelt“, Band 1+2 zu vollenden (vgl. Schütz/Luckmann 1979, Band 1, S. 20).
4.2.2 Wirklichkeit und Alltag, Sozialwelt und Naturwelt
Um den Begriff der Lebenswelt aus der Sichtweise von Schütz zu erläutern, wird der Autor mit einer Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den in der natürlichen Einstellung verharrenden Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit beginnen.
Schütz definiert diese Wirklichkeit als die alltägliche Lebenswelt. Diese Welt soll als ein Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache, normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes, als schlicht gegeben vorfindet (vgl. ebd.).
„Mit schlicht gegeben bezeichnen wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf weiteres unproblematisch ist“ (Zit. nach Schütz/Luckmann 1979, Band 1, S. 25).
In der Konsequenz kann man aus dieser These ableiten, daß die von außen natürlich gegebene determinierte Welt, den Wirklichkeitsbereich darstellt, in den wir Menschen uns bewegen, in den wir eingreifen, den wir verändern können. Gleichermaßen kann es aber auch bedeuten, daß wir in unseren freien Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
Schütz geht davon aus, daß in der alltäglichen Lebenswelt vorgefundene Gegenständlichkeiten und Ereignisse, sowie das Handeln und die Handlungsereignisse anderer Menschen, als zu überwindende Widerstände, aber auch als unüberwindliche Schranken gedeutet werden können. In Anlehnung an die Erkenntnistheorie der Phänomenologie Husserls, kann sich nur in der alltäglichen Lebenswelt eine gemeinsame kommunikative Welt konstituieren (vgl. Schütz/Luckmann 1979, Band 1, S. 25).
Schütz kommt somit zu der Erkenntnis, daß in dieser meiner gegebenen natürlichen Welt, die für mich fraglos und selbstverständlich „wirklich“ ist, auch andere Menschen existieren, mit ähnlichen Bewußtsein ausgestattet, das im Wesentlichen meinem gleich ist.
Daraus ergibt sich, daß meine Lebenswelt nicht meine Privatwelt ist, sondern die gegebene Grundstruktur ihrer Wirklichkeit ist den Menschen gemeinsam (intersubjektiv).
(vgl. ebd. S. 26)
Ich erkenne an dieser Stelle, wie sehr sich Schützes Interpretationen mit denen von Husserl gleichen, ebenso finde ich in diesen Ausführungen auch meine These zur Lebenswelt bzw. Phänomenologie bestätigt.
Schütz interpretiert die Lebenswelt auch als Naturwelt. Die natürlichen Gegenstände der äußeren Umwelt wären somit für alle Menschen gleich, da sie sich auf einen gemeinsamen Interpretationsrahmen beziehen (vgl. ebd.).
Ein wesentliches Merkmal kommt nun hinzu. Schütz meint, daß eine Erkenntnis, die wir erlangen, auch durch die Erlebnisse meiner Mitmenschen erlangt werden kann. Er geht in der Annahme davon aus, daß der Einzelne sich auch auf die Motive und Intentionen des Handelns anderer Menschen bezieht, dieses geschieht in einer wechselseitigen Wirkung (vgl. ebd.).
Die Lebenswelt wird somit auch zu einer Sozialwelt. Schütz gewann die Erkenntnis, daß die Menschen sich nicht nur auf die natürlichen, vorgegebenen Dinge ihrer Welt beziehen, sondern gleichzeitig auch auf die anderen Mitmenschen. Ich kann nach dieser Vorstellung mit anderen in mannigfache Sozialbeziehungen treten. Die Lebenswelt ist somit auch Sozial- bzw. Kulturwelt, in der ich mich befinde.
Schütz interpretiert die Lebenswelt auch als eine Welt mit sinnhaftem Aufbau für die Menschen (vgl. Schütz/Luckmann 1979, Band 1, S. 27).
Der Autor Luckmann interpretiert diesen sinnhaften Aufbau folgendermaßen.
Für ihn wird deutlich, daß die natürliche Einstellung, das Vorgegebene, die Außenweltdeutungen nicht mehr für alle Menschen eindeutig die Selbe ist.
Die eigene Lebenswelt wird individuell gedeutet und bekommt damit einen spezifischen Sinn für den Einzelnen. (ein Baum eben nicht nur ein und der Selbe bleibt)
Je nach symbolischer Bedeutung können die Naturdinge für den Einzelnen zu Kulturobjekten, menschliche Körper zu Mitmenschen und diese sich wiederum in Bewegungen, Handlungen, Gesten und Mitteilungen verwandeln (vgl. ebd.).
Zusammenfassend versteht Schütz die Lebenswelt in ihrer Totalität als Natur- und Sozialwelt.
Diese Welt stellt sowohl einen Schauplatz, als auch das Zielgebiet meines und unseres wechselseitigen Handelns dar (vgl. ebd.).
„Um unsere Ziele zu verwirklichen müssen wir ihre Gegebenheiten bewältigen und sie verändern“ (Zit nach Schütz 1979, Band 1, S. 28).
Schütz kommt zum Ergebnis, daß die Lebenswelt eine Wirklichkeit ist, die wir durch unsere Handlungen modifizieren und die andererseits unsere Handlungen modifiziert.
Die natürliche Einstellung der Welt des täglichen Lebens ist durchgehend vom pragmatischen Motiv bestimmt (vgl. ebd. S. 29).
Gleichzeitig wird der Begriff der Lebenswelt als der Inbegriff einer Wirklichkeit beschrieben, die erlebt, erfahren und erlitten wird. Unsere Wirklichkeit wird im Tun bewältigt, was aber auch die Gefahr des Scheiterns bedeuten kann. Ein pragmatisches Motiv bedeutet demnach, daß wir in die Lebenswelt des Alltags handelnd eingreifen und diese durch unser Tun verändern können (vgl. Schütz/Luckmann 1984, Band 2, S. 11).
„Der Alltag ist jener Bereich der Wirklichkeit, in dem uns natürliche und gesellschaftliche Gegebenheiten als die Bedingungen unseres Lebens unmittelbarer begegnen, als Vorgegebenheiten, mit denen wir fertig zu werden versuchen müssen.
Wir müssen in der Lebenswelt des Alltags handeln, wenn wir uns am Leben erhalten wollen. Wir erfahren den Alltag wesensmäßig als den Bereich menschlicher Praxis" (Zit. nach Schütz/Luckmann 1984, Band 2, S. 11).
4.3 Kritische Betrachtung und Überleitung
Ich habe mich eingehend mit der philosophischen Denkrichtung Husserls und Schütz/Luckmann auseinandergesetzt.
Ich habe nur einen Bruchteil dessen erfassen können, was das insgesamte Spektrum der Thematik „Lebenswelt“ angeht.
Mir liegt es fern, und das maße ich mir auch nicht an, die unterschiedlichen philosophischen Denkrichtungen von Husserl und Schütz auf ihren wahrheitsgemäßen Inhalt hin zu überprüfen.
Schütz hat den philosophischen Gedanken Husserls weiter verfolgt und den Begriff der Lebenswelt weiter unterteilt in eine natürliche und soziale Welt.
Beide Philosophen gehen im Prinzip davon aus, daß die natürliche Einstellung der Welt, also das, was uns an gesellschaftlicher Realität gegenübersteht, intersubjektiv wahr genommen wird. Ein gleiches Bewußtsein, z.B. von Armut, Isolation oder Ausgrenzung kann es meiner Meinung nach nicht geben. Daran schließt sich auch die Kritik von Luckmann, der sich fragt, ob die natürliche Einstellung der Welt intersubjektiv bleibt, wir das gleiche Bewußtsein der Welt haben.
Die Lebenswelt kann nur verstanden werden, wenn die natürlichen Dinge der Welt ausgelegt werden. Um die eigene Lebenswelt zu verstehen, je nachdem in welcher individuellen Situation ich mich befinde, um in ihr zu handeln und auf sie wirken zu können, ist auch das Denken in der lebensweltlichen Einstellung pragmatisch motiviert (vgl. Schütz/Luckmann 1984, Band 2, S. 28).
Ich deute daraus, daß jeder einzelne Mensch ein individuelles Bewußtsein über seine Probleme und Nöte entwickelt. Wenn Armut, Isolation und Ausgrenzung seine Situation begleiten, wird er sich seine eigenen Gedanken über die Problematik machen, die dann für den Menschen handlungsleitend sind. Er wird für sich einen sinnvollen, praktischen Weg herausfinden, wie er am besten mit der Situation umgehen kann. Entweder er findet die Möglichkeit die Probleme zu bewältigen, die natürlichen Widerstände zu durchbrechen oder er wird daran scheitern.
Ich denke, mit „Handeln in der Sozialen Arbeit“ kann es nicht darum gehen, daß die Professionellen den gegebenen Alltag für ihre Klienten so verändern und ihn passend für ihn machen, damit dann Lebensbewältigung stattfinden kann.
Nehme ich Gegebenheiten wahr, nehme ich in erster Linie die Menschen wahr, mit ihrer ganz eigenen, individuellen Sicht ihrer alltäglichen Probleme, in ihrer Lebenswelt, ihrer Familie ihrem Stadtteil, der für sie auch Lebensraum bedeuten kann.
Ich denke für die sozialpädagogische Praxis wäre es daher wichtig mit den Menschen so zu arbeiten, daß diese in eigener Auseinandersetzung mit dem Vorgefundenen, in ihrer Lebenswelt, zu eigenen Sichtweisen und handlungsleitenden Motiven gelangen. Damit sie die Probleme selbst erkennen und zu eigenen Lösungen kommen können.
Soziale Arbeit sollte fördern, unterstützen und mehrere Möglichkeiten der Wahl bereitstellen, entscheiden sollte der Klient selber.
In den nun folgenden Kapiteln ist es mir wichtig darzustellen, wie sich der Begriff der Lebenswelt weiterentwickelt hat, bezogen auf sozialpädagogische Konzepte, die die von mir aufgeführte Problematik zum Thema haben. Unter dem Schlagwort „Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung“ wird später deutlich oder ist es vielleicht ja jetzt schon, woher die o.g. Überlegungen kommen, auf welche Inhalte sie sich konzeptionell beziehen. Die Konzepte der Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung wurden meines Erachtens weitgehend in ihrer Entwicklung mit geprägt durch den Begriff der Lebenswelt, mit seinen zentralen Inhalten von „Wirklichkeits- und Alltagsnähe“. Später wird dieser Zusammenhang für die Leser deutlicher, wenn ich die Konzepte detaillierter vorstelle.
Thiersch greift die Gedanken von Husserl und Schütz auf. Er orientiert sich an der Erkenntnistheorie der Lebenswelt und hat ein Rahmenkonzept für Soziale Arbeit geschaffen. Dieses Rahmenkonzept wurde in pragmatische Arbeitsfelder der Sozialarbeit/Sozialpädagogik integriert und operationalisiert.
5. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit (Thiersch, H.)
5.1 Zur Differenzierung der Begrifflichkeiten Lebensweltorientierung und Alltagsorientierung
Zur Differenzierung der Begrifflichkeiten Lebensweltorientierung und Alltagsorientierung möchte ich folgendes anmerken.
Zum einem geht es um die Darstellung eines Rahmenkonzeptes lebensweltorientierter Jugendhilfe, wie es der 8. Jugendbericht von 1990 dargestellt hat, zum anderen handelt es sich um Alltagsorientierung, als spezifisches Verstehens- und Handlungskonzept. Alltagsorientierung wurde als eine der Strukturmaximen in dem 8. Jugendbericht aufgeführt.
Thiersch weist zwar auf einen synonymen Gebrauch beider Begriffe hin, aber den kritischen Impuls einer als alltagsorientiert verstandenen Sozialpädagogik sieht er in der Unterscheidung zwischen der Wirklichkeit des Adressaten und der professionellen, wissenschaftlich fundierten Sichtweise der Sozialpädagogik (vgl. Thiersch 1992, S. 46).
Eine Differenzierung versucht Theodor Schulze zu verdeutlichen. Es scheint möglich zwischen diesen beiden Bereichen zu differenzieren. So kann die Lebenswelt als der weitere Begriff, und der Alltag als der Engere gedeutet werden. Verstehbar, wenn man erkennen kann, daß das Alltagskonzept durch die sozialpädagogischen Interventionen markiert wird, und das Lebensweltkonzept den Horizont, den Raum akzentuiert, in den hinein die Intervention etwas zu bewegen, zu verändern und zu fördern versucht (vgl. Schulze in Grunwald, Ortmann, Rauschenbach, Treptow 1996, S. 78).
Ich gehe in der Annahme davon aus, daß wir Professionellen mit den Betroffenen in ihrem Alltag, mit ihren Nöten und Krisen konfrontiert werden. Alltägliche Soziale Arbeit, und hier wird immer wieder angesetzt, hat den zentralen Gegenstand der Subjektorientierung.
Die Autoren Gaby Flößer und Hans-Uwe Otto merken hierzu an, daß personenbezogene soziale Dienstleistungen verstanden werden als Unterstützungen der eigenen Bemühungen der Klientel, zur Wiedererlangung der Autonomie ihrer Lebenspraxis (Selbststeuerungsfähigkeit). Diese Leistungen haben daher die Anerkennung des Subjektstatusses unmittelbar zur Voraussetzung (vgl. Flößer/Otto, in Rauschenbach a.a.O., S. 184).
Probleme und Nöte der Menschen werden sichtbar, wenn man den hinter den Vorhang alltäglicher Beziehungen schaut. Hier im Alltag gilt es herauszuarbeiten, und an dieser Stelle trete ich in Interaktion mit den Betroffenen, was jeweils der Fall ist, wie stellt sich die Situation für mich dar, immer bezogen auf die individuelle Sichtweise der Person. Wo, wann und wie setze ich meine sozialpädagogische Intervention an. Die Lebenswelt wäre demnach für mich die Orientierung im Raum, im Feld, in der sich der Klient alltäglich bewegt. Die Lebenswelt ist für mich die Orientierung an der äußeren, gegebenen Struktur. Hier kann ich eine Antwort darauf finden und strukturelle Ursachen in Verbindung mit den alltäglichen Nöten und Problemen der Betroffenen bringen. Das wäre meine Definition einer ganzheitlichen, systemisch orientierten Sozialen Arbeit. Lebenswelt und Alltag bedingen sich einander. Eine eindeutige Trennung, wie Thiersch beschreibt, ist nur bedingt möglich, da der Alltag eben nur ein Teil der Lebenswelt ist (vgl. Thiersch 1992, S. 78).
Um den Faden meiner Argumentationslinie wieder aufzugreifen und auf das Konzept der Sozialraumorientierung in seiner Entwicklung hinzuweisen, ist es notwendig sich mit den zentralen Inhalten des Lebensweltkonzeptes auseinanderzusetzen, hier im Speziellen mit dem 8. Jugendbericht von 1990.
5.2 8. Jugendbericht (1990)
In der wissenschaftlichen Konzeptdiskussion einer lebensweltorientierten Jugendhilfe, beziehen sich die verschiedenen Autoren, die an der Berichtskommission zusammengearbeitet haben, unter anderem auch Hans Thiersch, auf die vielfältigen und differenzierten Entwicklungen im Laufe der letzten Jahre (vgl. Thiersch 1992, S. 17).
Thiersch konstatiert, daß die Darstellung der Lebensverhältnisse Jugendlicher und ihrer Familien im Jugendbericht bestimmt ist durch die Konzepte der Pluralisierung von Lebenslagen und der Individualisierung der Lebensverhältnisse (hierzu genauer Thiersch ebd. S. 20).
Auf diese Entwicklungen bin ich anfangs meiner Arbeit detailliert eingegangen. Zudem wird deutlich, daß es notwendig war auf die Modernisierung der Gesellschaft hinzuweisen, da das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nicht unwesentlich von dieser Entwicklung mit geprägt worden ist.
Aus diesen o.g. Entwicklungen haben sich unterschiedliche Problemsichten und Arbeitsentwicklungen herausgebildet, die sich in den unterschiedlichen Institutionen und Interventionsmustern ähnlich darstellen und verstanden werden können als parallele Trends. Diese können zu einer gemeinsamen Sichtweise von Problemen führen, woraus sich ein gemeinsames Verständnis der Jugendhilfe bilden kann (vgl. ebd.).
Im 8. Jugendbericht 1990 (S. 75, unter 2.1.1) finden sich die Strukturbestimmungen wieder, die den gesellschaftlichen Auftrag näher bestimmen.
Jugendhilfe ist in ihrem gesellschaftlichen Auftrag geprägt durch die widersprüchlichen Intentionen unserer Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe und die Notwendigkeit, den Anpassungs- und Orientierungsaufgaben im Modernisierungsprozeß gerecht zu werden.
Geprägt durch den Selbstanspruch unserer Gesellschaft auch Sozialstaat zu sein, ist die Jugendhilfe gleichermaßen konfrontiert mit den Zwängen der Macht-, Produktions und Marktgesetze. Unter diesem Hintergrund des Modernisierungsprozesses ergaben sich neue Aufgaben für die Jugendhilfe, die sich konkretisieren in ihrem spezifischen Arbeitsfeld der Erziehung, auch außerhalb von Schule und Familie (hierzu genauer, 8. Jugendbericht 1990, S. 75ff).
Eine Voraussetzung zur offensiven Politik und Öffentlichkeitsarbeit, ist die selbstkritische Darstellung der Jugendhilfe in ihren derzeitigen Leistungen und zukünftigen Aufgaben, wie sie der 8. Jugendbericht vorgestellt hat.
Im Jugendbericht und Jugendhilfebericht werden Probleme erkennbar. Die Lebensverhältnisse, Lebensschwierigkeiten und daraus resultierenden Aufgaben der Unterstützung und Hilfe für die Menschen, können nur im Kontext der institutionellen und professionellen Ordnung gesehen werden.
Durch den institutionsspezifischen Blick kann es aber zu einer problemspezifischen Verengung, z.B. in bezug auf Familienbild, Jugend als Problemgruppe oder Frauen in defizitären Situationen, kommen (vgl. Thiersch 1992, S. 25).
Ich denke Soziale Arbeit ist durch das doppelte Mandat von Kontrolle und Hilfe einer ständigen Gefahr von Zuschreibungs,- und Stigmatisierungsprozessen ausgesetzt, oder wie Thiersch es formuliert, agiert lebensweltorientierte Jugendhilfe in dem Wissen um die Notwendigkeit und Tragfähigkeit ihrer Arbeit, ebenso wie im Wissen, um die in ihr liegende Gefahr, die Eigensinnigkeiten und Ressourcen der Lebenswelt einzuengen, zu kolonalisieren. (vgl. ebd.)
Um etwas gegen die Gefahr der verengten Sichtweise zu tun, scheint es notwendig eine detaillierte Darstellung der Normalität von Lebensverhältnissen offen zu legen.
Lebensweltorientierung ist das Konzept einer professionalisierten Sozialen Arbeit, die darauf abzielt, Verengungen der institutionalisierten und spezialisierten Jugendhilfe zu überwinden. Die in diesem Konzept favorisierte Orientierung an der Normalität von Lebensverhältnissen, ist der Ausgangspunkt für neue Fixierung der Aufgabenbestimmung der Jugendhilfe. Probleme Schwierigkeiten und Defizite können immer nur von dieser Normalität aus, wie es Thiersch formuliert hat, verstanden werden, also als Besonderung, Verhärtung und Zuspitzung in den Problemen einer Lebensbewältigung (vgl. Thiersch 1992, S. 20).
So verstanden weist lebensweltorientierte Jugendhilfe auf die Tradition der Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit zurück (vgl. ebd.). Um mein Anliegen weiter zu verdeutlichen, denn es geht um die theoretische Untersuchung eines gemeinwesenorientierten bzw. sozialraumorientierten Konzepts der Sozialen Arbeit, sagt Thiersch, daß Konzepte wie (Anfangen wo der Klient steht, Situationsbezug der Arbeit und z.B. Gemeinwesenarbeit) Konzepte sind, die als Lebensweltorientierung im weitesten Sinne verstanden werden können. Er bezieht sich dabei auf die Arbeiten von (C.W. Müller 1982/1988) (vgl. ebd.).
Der 8. Jugendbericht weist ebenfalls auf eine Notwendigkeit präventiver und feldorientierter Jugendhilfe hin, die unumstritten und allseits gefordert wird (hierzu genauer, 8. Jugendbericht a.a.O., S. 170ff).
Gemeint sein könnte, daß die Jugendhilfe weg von einer passiven, abwartenden auf Defizite ausgerichteten Sozialen Arbeit, hin zu einer offensiv, präventiv ausgerichteten Sozialen Arbeit wechseln möchte.
Im 8. Jugendbericht spricht man von einem Paradigmenwechsel in der Jugendhilfe, der sich weg vom klinisch-kurativen (defizitären) Krankheitsmodell, hin bewegt zum lebensräumlich- präventiven Ressourcenmodell, in der Konjunktur ökologischer Konzepte. Diese bieten einen Rahmen, von dem aus sowohl Arbeitsprozesse mit Einzelnen, wie mit Familien und Gruppen, aber auch im Milieu eines Stadtteils strukturiert werden können. Angegeben wird hier (Hinte 1985), der sich schon damals mit ökologischen Ansätzen mittlerer Reichweite (Mesosysteme) in der Sozialarbeit auseinandergesetzt hat. Dabei wurde auf Konzepte aus der Tradition der Gemeinwesenarbeit zurückgegriffen (vgl. ebd. S. 171).
Aus dieser Konjunktur ökologischer Konzepte, hat sich auch die Idee eines sozialräumlichen Handlungsansatzes entwickelt (vgl. ebd.). Der 8. Jugendbericht weist mit dem Paradigmenwechsel auf eine Umstrukturierung der Jugendhilfe hin. Ich erkenne an dieser Stelle, daß die Idee eines geforderten, präventiven Ressourcenmodells Sozialer Arbeit heute, 10 Jahre später, mit dem Konzept der Sozialraumorientierung eingelöst werden soll.
Das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe greift die eben genannten Entwicklungen auf. In einer Zusammenfassung versuche ich zu verdeutlichen, worum es inhaltlich bei diesem Konzept geht. Das ist insofern von Bedeutung, da die Schwerpunkte von Sozialraumorientierung im Wesentlichen auf die Inhalte einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit zurückgreifen.
5.3 Das Konzept einer lebensweltorientierten Jugendhilfe
Die von der Jugendhilfe zu gewährenden Unterstützungen und Anregungen sollen so strukturiert sein, daß diese sich im Rahmen der gegebenen Struktur, Verständnis- und Handlungsmuster befinden.
Sie sollen die individuellen, sozialen und politischen Ressourcen so stabilisieren, stärken und wecken, daß Menschen sich in ihnen arrangieren, ja vielleicht Möglichkeiten finden, Geborgenheit, Kreativität, Sinn und Selbstbestimmung zu erfahren (vgl. Thiersch 1992, S. 23).
Lebensweltorientierte Jugendhilfe knüpft an die traditionelle Betroffenheitsperspektive der Klienten an und will Menschen zur Bewältigung der gegebenen Lebensverhältnisse helfen bzw. Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Sie spricht von einer ganzheitlichen Wahrnehmung der Lebensmöglichkeiten und Schwierigkeiten, wie sie im Alltag erfahren werden.
Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe ist nur ein Aspekt von Jugendhilfe. Sie kann nur eingebettet gesehen werden in Jugendhilfepolitik (Sozialpolitik, Stadt- und Wohnbaupolitik, Arbeitspolitik, Bildungs- und Schulpolitik).
Es handelt sich um ein kritisches Konzept, es bezieht sich eben nicht nur auf Bilder einer heilen Welt, sondern geht inhaltlich auf die Ungleichheiten der Pluralität der Lebenslagen und der Individualisierung der Lebensführung ein. Somit ist Lebensweltorientierung Indiz der Krise heutiger Lebenswelt und zugleich Ausdruck des Anspruchs, in dieser Krise angemessen agieren zu können (vgl. ebd., S. 25).
In der nun folgenden Darstellung beziehe ich meine Ausführungen sinngem. auf Thiersch 1993 und hierzu ein angefertigtes einseitiges Thesenpapier (Thiersch 1993, S. 11-28 a.a.O.: In Thesenpapier: Zellner, Schneider, Gleich, Otto) in welchem Lebensweltorientierung zusammengefaßt wurde.
1. Hierin wird darauf hingewiesen, daß lebensweltorientierte Soziale Arbeit ein sozialpolitisches verortetes Arbeitsprogramm ist. Konzeptbegriffe sind hierin: Ganzheitlichkeit, Offenheit, Allzuständigkeit, die nicht im Widerspruch zur Struktur, Differenzierung, Methode und definierten Arbeitsverständnis stehen.
2. Lebensweltorientierung wendet sich explizit gegen Normalisierung, Stigmatisierung und Disziplinierung.
3. Lebensweltorientierung agiert strukturiert, ganzheitlich und sucht individuelle, soziale, politische, regionale und lokale Ressourcen auszuschöpfen.
4. Sie zielt auf Hilfe zur Selbsthilfe, auf die Befähigung des Individuums, sein Leben bewältigen zu können, mit Respekt vor dem Eigensinn der Adressaten.
5. Kritisch wird bemerkt, ob sich dieses Arbeitsprogramm in Anbetracht der Pluralisierung der Lebenslagen („aufwendige Normalität“) durchsetzen läßt.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832488017
- ISBN (Paperback)
- 9783838688015
- DOI
- 10.3239/9783832488017
- Dateigröße
- 536 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juni)
- Note
- 2,8
- Schlagworte
- gemeinwesenarbeit lebensweltorientierung individualisierung pluralisierung konzepte methoden
- Produktsicherheit
- Diplom.de