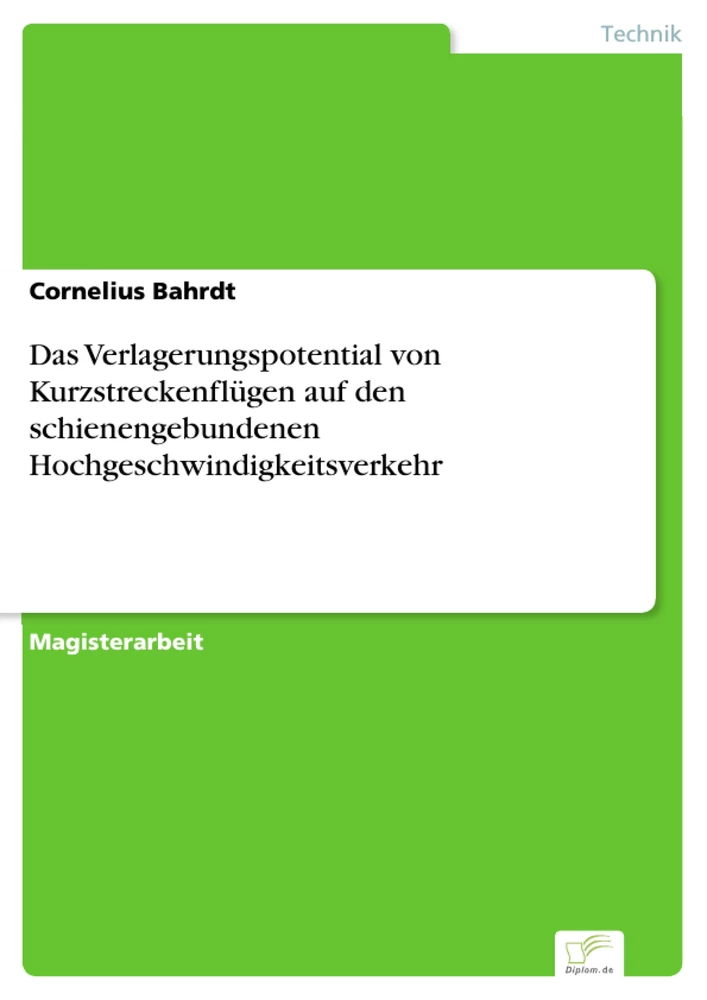Das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, die zur Realisierung einer intermodalen Verkehrsverlagerung der zu erwartenden Verkehrszuwächse in Europa und speziell in Deutschland beitragen können. Hierbei richtet sich der Fokus auf die Kooperation zwischen den Verkehrsträgern Luft und Schiene im Bereich des Personenverkehrssektors.
Einführend erfolgt in Kapitel 2 ein Überblick über die heutige Verkehrssituation in Europa und Deutschland sowie eine gesonderte Darstellung der Entwicklung im Schienen- und Luftverkehrssektor.
Nach Darlegung der Kerndefinitionen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) und für Kurzstreckenflüge wird in Kapitel 3 der Arbeit das europäische Flughafensystem und Schienen-Hochgeschwindigkeitsnetz analysiert um nachfolgend bestehende Verlagerungen von Kurzstreckenflügen zu Gunsten der Schiene zu erläutern. Als Grundlage dient hier ein Überblick über das europäische Flughafensystem, bei welchem auf die fünf größten europäischen Flughäfen (Hubs) London Heathrow, Frankfurt a. M., Paris Roissy-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol und Madrid Barajas eingegangen wird. Die Flughafenstandorte werden bezüglich ihres Verkehrsaufkommens und ihrer Intermodalität untersucht. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden ausgewählte HGV-Strecken nach ihrer Einbindung in das europäische Netz und ihrem Verkehrsaufkommen dargestellt.
Im Umfang dieser Arbeit wird ausschließlich auf den HGV mit Rad-Schienen-Technik eingegangen. Die Technologie der Magnetschwebebahnen geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, da sie einerseits in Europa noch keine Anwendung gefunden hat und andererseits in der heutigen Situation nur auf ausgewählten Strecken realisiert werden könnte, somit also kein ganzheitliches Netz erstellen könnte. Eine solche für den HGV innovative Technik würde in naher Zukunft nur zu Insellösungen führen.
Bezüglich der bestehenden HGV-Strecken auf Rad-Schiene-Basis und vorhandener Verlagerungen erfolgt eine Darstellung der PBKAL (Paris / Brüssel / Köln / Amsterdam / London) mit den Teilstrecken Paris London, Paris Brüssel Köln und Brüssel Amsterdam sowie der Strecken Paris Marseille des TGV Sud-Est / TGV Méditerranée (TGV = train à grand vitesse) und Madrid Sevilla (AVE = Alta Velocidad Española) mit deren Charakteristika, die eine Verlagerung ermöglicht haben.
Es folgt nach den europäischen Praxisbeispielen des dritten Kapitels der Übergang zur Situation in Deutschland. Im Zuge des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen: Verkehrsentwicklung
2.1 Definitionen
2.1.1 Definition: Kurzstreckenflüge
2.1.2 Definition: Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV)
2.2 Allgemeine Verkehrsentwicklung in Europa und Deutschland
2.3 Die Verkehrsentwicklung im Schienenverkehrssektor
2.4 Die Verkehrsentwicklung im Luftverkehrssektor
3 Das europäische Flughafensystem und HGV-Netz
3.1 Das europäische Flughafensystem
3.1.1 Grundlagen zum europäischen Flughafensystem
3.1.2 Die fünf größten europäischen Flughäfen
3.1.2.1 London Heathrow (LHR)
3.1.2.2 Frankfurt a. M. (FRA)
3.1.2.3 Paris Roissy-Charles de Gaulle (CDG)
3.1.2.4 Amsterdam Schiphol (AMS)
3.1.2.5 Madrid Barajas (MAD)
3.2 Das europäische HGV-Netz
3.2.1 Grundlagen zum europäischen HGV-Netz
3.2.2 Ausgewählte HGV-Strecken
3.2.2.1 PBKAL: Paris / Brüssel / Köln / Amsterdam / London
3.2.2.1.1 Segment Paris – London
3.2.2.1.2 Segment Paris – Brüssel – Köln
3.2.2.1.3 Segment Brüssel – Amsterdam / HSL-Zuid
3.2.2.2 TGV Sud-Est / TGV Méditerranée: Paris – Marseille
3.2.2.3 AVE: Madrid – Sevilla
4 Das deutsche Flughafensystem und HGV-Netz
4.1 Das deutsche Flughafensystem
4.1.1 Grundlagen zum deutschen Flughafensystem
4.1.2 Innerdeutsches Verkehrsaufkommen im Luftverkehr
4.1.3 Die fünf bedeutendsten deutschen Flughäfen neben Frankfurt
4.1.3.1 München (MUC)
4.1.3.2 Düsseldorf (DUS)
4.1.3.3 Berlin (THF, TXL, SXF, BBI)
4.1.3.4 Hamburg (HAM)
4.1.3.5 Köln / Bonn (CGN)
4.2 Das deutsche HGV-Netz
4.2.1 Grundlagen zum deutschen HGV-Netz
4.2.2 Ausgewählte (HGV-)Strecken
4.2.2.1 ICE: Hannover – Würzburg
4.2.2.2 ICE: Mannheim – Stuttgart
4.2.2.3 ICE: Hamburg – Berlin
4.2.2.4 ICE: Hannover – Berlin
4.2.2.5 ICE: Frankfurt – Köln
4.2.2.6 Metropolitan: Köln – Hamburg
4.2.3 Zukünftige HGV-Projekte in Deutschland
4.2.3.1 Stuttgart – Ulm
4.2.3.2 Berlin – Leipzig / Halle – Erfurt – Nürnberg
4.2.3.3 Nürnberg – Ingolstadt – München
5 Das Verlagerungspotential von Kurzstrecken- flügen auf den schienengebundenen HGV
5.1 Verlagerungsrelevante Faktoren Luft / Schiene
5.1.1 Faktor Zeit
5.1.2 Faktor Kosten
5.1.3 Faktor Qualität
5.1.4 Faktor Relationen
5.1.5 Faktor Kooperation und Konkurrenz
5.1.5.1 Konkurrenz durch Low-Cost-Carrier
5.1.6 Weitere Faktoren
5.2 Kooperation Luft / Schiene
5.2.1 Vorteile einer Kooperation
5.2.2 Nachteile einer Kooperation
5.2.3 Bestehende Kooperations- / Seamless-travel-Angebote
5.2.3.1 AIRail
5.2.3.2 RailFly
5.2.3.3 Codesharing
5.2.3.4 Kuriergepäck Flughafenservice
5.3 Thesen zum Verlagerungspotential in Deutschland
5.4 Verkehrsverlagerung im Rahmen der EU-Osterweiterung
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Experteninterviews
Experteninterviews – Leitfäden
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungen
Abbildung 1: Modal Split der Verkehrsleistung der EU-15
Abbildung 2: Modal Split der Verkehrsleistung in Deutschland
Abbildung 3: Stromsysteme des europäischen Eisenbahnnetzes
Abbildung 4: Langfristige Veränderungsrate des jährlichen Passagieraufkommens am FRA vs. BIP BRD
Abbildung 5: Punkt-zu-Punkt-Verkehr und Hub-and-spoke-System
Abbildung 6: Die 25 verkehrsstärksten Flughäfen Europas 2003
Abbildung 7: London Heathrow - LHR
Abbildung 8: Frankfurt a. M. - FRA
Abbildung 9: Paris Roissy-Charles de Gaulle - CDG
Abbildung 10: Amsterdam Schiphol - AMS
Abbildung 11: Madrid Barajas - MAD
Abbildung 12: Das japanische Shinkansen-Netz
Abbildung 13: Das französische TGV-Netz - Bestand und Planung
Abbildung 14: Europäisches HGV-Netz 2004
Abbildung 15: Entwicklung des HGV in Europa 1991-2001 (in Pkm)
Abbildung 16: Europäisches HGV-Netz 2020
Abbildung 17: Marktanteile Paris – Brüssel 1994 und 2000
Abbildung 18: Flughäfen und -plätze in Deutschland 2003
Abbildung 19: Passagieraufkommen der 20 verkehrsstärksten Strecken im innerdeutschen Luftverkehr sowie innerdeutsche Endzielaussteiger je Flughafen (ab 0,25 Mio. Passagiere) im Jahr 2004
Abbildung 20: Passagieraufkommen der 15 größten deutschen Flughafenstandorte im Jahr 2004
Abbildung 21: Direkte ICE-Verbindungen pro Tag auf den 20 verkehrsstärksten Relationen des innerdeutschen Luftverkehrs 2004
Abbildung 22: Das deutsche ICE-Netz 2005
Abbildung 23: Skizze der Verkehrsmittelbedeutung nach Entfernung und Reisezeit
Abbildung 24: Kostenstruktur Liniencarrier, Low-Cost-Carrier und ICE
Abbildung 25: Passagieraufkommen der 20 verkehrsstärksten Relationen im innerdeutschen Luftverkehr 2004
Tabellen
Tabelle 1: Grobeinschätzung der Verkehrsnachfrage für den BVWP 2003
Tabelle 2: Passagierzahlen der 25 verkehrsstärksten Flughäfen Europas 2003
Tabelle 3: Passagierzahlen im Jahr 2004 und Schienenanbindung der fünf größten europäischen Flughäfen im Vergleich
Tabelle 4: Endzielaussteiger im innerdeutschen Luftverkehr 2004
Tabelle 5: Passagieraufkommen der 20 verkehrsstärksten Strecken im innerdeutschen Luftverkehr im Jahr 2004
Tabelle 6: Passagierzahlen und Schienenanbindung der 15 größten deutschen Flughafenstandorte im Jahr 2004
Tabelle 7: Direkte ICE-Verbindungen pro Tag auf den 20 verkehrsstärkstenStrecken des innerdeutschen Luftverkehrs 2004
Tabelle 8: Das Verlagerungspotential der 50 verkehrsstärksten Relationen im innerdeutschen Luftverkehr 2004
1 Einleitung
In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, die zur Realisierung einer intermodalen Verkehrsverlagerung der zu erwartenden Verkehrszuwächse in Europa und speziell in Deutschland beitragen können. Hierbei richtet sich der Fokus auf die Kooperation zwischen den Verkehrsträgern Luft und Schiene im Bereich des Personenverkehrssektors.
Einführend erfolgt in Kapitel 2 ein Überblick über die heutige Verkehrssituation in Europa und Deutschland sowie eine gesonderte Darstellung der Entwicklung im Schienen- und Luftverkehrssektor.
Nach Darlegung der Kerndefinitionen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) und für Kurzstreckenflüge wird in Kapitel 3 der Arbeit das europäische Flughafensystem und Schienen-Hochgeschwindigkeitsnetz analysiert um nachfolgend bestehende Verlagerungen von Kurzstreckenflügen zu Gunsten der Schiene zu erläutern. Als Grundlage dient hier ein Überblick über das europäische Flughafensystem, bei welchem auf die fünf größten europäischen Flughäfen (Hubs) London Heathrow, Frankfurt a. M., Paris Roissy-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol und Madrid Barajas eingegangen wird. Die Flughafenstandorte werden bezüglich ihres Verkehrsaufkommens und ihrer Intermodalität untersucht. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden ausgewählte HGV-Strecken nach ihrer Einbindung in das europäische Netz und ihrem Verkehrsaufkommen dargestellt.
Im Umfang dieser Arbeit wird ausschließlich auf den HGV mit Rad-Schienen-Technik eingegangen. Die Technologie der Magnetschwebebahnen geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, da sie einerseits in Europa noch keine Anwendung gefunden hat und andererseits in der heutigen Situation nur auf ausgewählten Strecken realisiert werden könnte, somit also kein ganzheitliches Netz erstellen könnte. Eine solche für den HGV innovative Technik würde in naher Zukunft nur zu Insellösungen führen.
Bezüglich der bestehenden HGV-Strecken auf Rad-Schiene-Basis und vorhandener Verlagerungen erfolgt eine Darstellung der PBKAL (Paris / Brüssel / Köln / Amsterdam / London) mit den Teilstrecken Paris – London, Paris – Brüssel – Köln und Brüssel – Amsterdam sowie der Strecken Paris – Marseille des TGV Sud-Est / TGV Méditerranée (TGV = train à grand vitesse) und Madrid – Sevilla (AVE = Alta Velocidad Española) mit deren Charakteristika, die eine Verlagerung ermöglicht haben.
Es folgt nach den europäischen Praxisbeispielen des dritten Kapitels der Übergang zur Situation in Deutschland. Im Zuge des vierten Kapitels folgt zunächst wie beim europäischen Flughafennetz eine Situationsbeschreibung der deutschen Flughäfen mit den Standorten München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Köln / Bonn. Hierbei wird ihr Verkehrsaufkommen und der Grad ihrer Intermodalität untersucht. Anschließend erfolgt im Rahmen der Behandlung des deutschen HGV-Netzes eine nähere Analyse der Strecken Hannover – Würzburg, Mannheim – Stuttgart, Hamburg – Berlin, Hannover – Berlin und Frankfurt – Köln. Im weiteren Verlauf werden aktuelle Bau- und Planungsvorhaben im Bereich des HGV erläutert.
Das fünfte Kapitel und gleichzeitig Hauptteil der Arbeit untersucht das Verlagerungspotential von Kurzstreckenflügen auf den schienengebundenen Hochgeschwindigkeitsverkehr. Es werden eingangs verlagerungsrelevante Faktoren und ihre Bedeutung aufgezeigt. Im weiteren Verlauf wird auf bestehende Kooperationsangebote zwischen den Verkehrsträgern Luft und Schiene, sowohl mit ihren Vor- als auch Nachteilen sowie die Konkurrenz durch Low-Cost-Carrier analysiert. Für ausgewählte deutsche Strecken wird auf Basis der relevanten Faktoren eine Einschätzung zu weiteren Verlagerungspotentialen geliefert. Abschließend werden Potentiale, welche sich durch die EU-Osterweiterung ergeben könnten, untersucht.
Im zusammenfassenden sechsten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit herausgestellt und eine eigene Empfehlung bezüglich notwendiger Voraussetzungen für zukünftig funktionierende Verlagerungen getätigt.
2 Grundlagen: Verkehrsentwicklung
Zunächst soll ein Überblick über die derzeitige Situation der Verkehrsnachfrage in Europa, mit Fokus auf Deutschland, gegeben werden. Nach der Darstellung verschiedener Modal Splits (Anteile der verschiedenen Verkehrsträger an der gesamten Verkehrsleistung) folgt die Darstellung der Entwicklungen im Schienenverkehrs- sowie Luftverkehrssektor. Neben einer Beschreibung der bisherigen Entwicklung werden auch Entwicklungsprognosen aufgezeigt.
2.1 Definitionen
Um eine Definitionsbasis für die nachfolgenden Analysen zu erlangen werden im Folgenden die wichtigsten Komponenten der Themenstellung, Hochgeschwindigkeitsverkehr und Kurzstreckenflüge, definiert. Ergänzende Be-griffe, die einer Definition bedürfen, werden im Laufe der Arbeit an jeweiliger Position erläutert.
2.1.1 Definition: Kurzstreckenflüge
Flugstrecken können im Allgemeinen in Kurz-, Mittel- und Langstrecken unterschieden werden. Eine einheitliche Definitionsbasis existiert hierbei für den Begriff Kurzstreckenflug nicht. Bei Maurer (Maurer, 2003) werden allgemein innerdeutsche Flüge und Flüge ins benachbarte Ausland unter 1.000 km als Kurzstreckenflüge bezeichnet. Merkmale sind hierbei:
- Fluggeräte mit zwei Triebwerken,
- typische Reisezeiten bis 90 min,
- häufige Starts und Landungen, so genannte Cycles (Vorgang von Start bis Landung als zusammengefasstes Ereignis),
- durchschnittlich acht Flugstunden pro Tag,
- gute Start- und Landeleistungen, günstiger Treibstoffverbrauch im Steigflug, kurze Turnarounds (Bodenzeiten),
- Einsatz von Flugzeugen mit Propellerturbinen und kleinen Jets auf Strecken mit geringem Passagieraufkommen und Jets bei höheren Passagierzahlen.
Quelle: Maurer, 2003, S. 151
Die Deutsche Lufthansa AG unterteilt Kurzstreckenflüge ihrerseits in zwei Kategorien. Zum einen Ultrakurzstreckenflüge, die weniger als 250 km lang sind, bzw. deren Blockzeit (Zeit vom Verlassen der Gateposition oder auch Off-blocks bis zur Parkposition am Zielflughafen bzw. On-blocks ) (Maurer, 2003) unter anderthalb Stunden betragen. Beispiele sind hierfür die deutschen Verbindungen von Frankfurt nach Köln, Düsseldorf, Stuttgart oder Nürnberg. Diese stellen meistens Zubringerflüge zu interkontinentalen Flügen dar. Zum anderen sind Kurzstreckenflüge diejenigen Verbindungen, die Distanzen unter 800 km zurücklegen. Beispiele sind hierfür die Strecken Hamburg – München oder Köln – Berlin. Kurzstreckenflüge weisen im Vergleich zu Mittel- und Langstreckenflügen zwar einen geringen Anteil an geflogenen Kilometern auf (rund 7 %), besitzen jedoch einen relativ hohen Anteil an Passagieren (Deutsche Lufthansa AG, 2005).
Ergänzt werden kann die Definition durch Angaben der DB Personenverkehr GmbH , welche eine Dreiteilung nach den Marktanteilen vornimmt. So nimmt die Schiene bis 300 km einen nahezu konkurrenzlosen Anteil ein. Zwischen 300 und 500 km herrscht der größte Wettbewerb mit Anteilen der Bahn bis 60 %. Ab 500 km sinken die Bahnanteile auf 30 bis 40 %, was jedoch stark von einzelnen Angeboten und Strecken abhängig ist (Born, 2005).
2.1.2 Definition: Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV)
Erst seit dem Zweiten Weltkrieg wird verstärkt Gebrauch vom Begriff des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (HGV) gemacht. Die traditionellen Streckendeterminanten (u.a. Steigungen im Längs- und Querprofil, Kurvenradien und auch Sicherheitseinrichtungen) ermöglichen heute in der Regel je nach Triebfahrzeug Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Für Geschwindigkeiten, die über diese Grenze hinausgehen, sind technische Neuerungen der Trasse als auch der Fahrzeuge von Nöten. In der vorliegenden Arbeit wird der Schwellenwert von V = 200 km/h genutzt, um den Hochgeschwindigkeitsverkehr von dem übrigen Schienenverkehr abzugrenzen. Seitens der Union Internationale des Chemins de fer (UIC) und der Generaldirektion Verkehr der Europäischen Kommission wird dieser Schwellenwert ebenfalls als Definitionsgrenze für den HGV genutzt. Beide Institutionen merken jedoch an: „There is no single standard definition of high speed rail.“ (UIC, 2004). Demnach wird der HGV zusätzlich nach den Bereichen Infrastruktur, Fahrzeuge, und Kohärenz der Infrastruktur- und Fahrzeugkennwerte definiert.
European Union definition of Highspeed: DIRECTIVE 96/48/EC APPENDIX 1:
“The trans-European High Speed rail System
1) Infrastructure
a) The infrastructure of trans-European High Speed system shall be that on the trans-European transport network identified in Article 129C of the Treaty:
- those built specially for High Speed travel
- those specially upgraded for High Speed travel.
They may include connecting lines, in particular junctions of new lines upgraded for High Speed with town centre stations located on them, on which speeds must take account of local conditions.
b) High Speed lines shall comprise:
- Specially built High Speed lines equipped for speeds generally equal to or greater than 250 km/h,
- Specially upgraded High Speed lines equipped for speeds of the order of 200 km/h
- Specially upgraded High Speed lines which have special features as a result of topographical, relief or town-planning constraints, on which the speed must be adapted to each case.
2) Rolling stock
The High Speed advanced-technology trains shall be designed in such a way as to guarantee safe, uninterrupted travel:
- at a speed of at least 250 km/h on lines specially built for High Speed, while enabling speeds of over 300 km/h to be reached in appropriate circumstances,
- at a speed of the order of 200 km/h on existing lines which have been or are specially upgraded,
- at the highest possible speed on other lines.
3) Compatibility of infrastructure and rolling stock
High Speed train services presuppose excellent compatibility between the characteristics of the infrastructure and those of the rolling stock. Performance levels, safety, quality of service and cost depend upon that compatibility.”
Quelle: UIC, Definitions of High Speed, 2004
2.2 Allgemeine Verkehrsentwicklung in Europa und Deutschland
Der ständig wachsende technische Fortschritt ermöglicht heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten des internationalen Güteraustausches und der Personenbeförderung mit immer kürzeren Transportzeiten. Die steigenden Verkehrszahlen im Bereich des Frachtverkehrs sind weitestgehend auf neue Trends im Transportwesen wie Liberalisierung des Welthandels, Just-in-time Produktionen und die damit induzierten Lagerhaltungen auf der Straße und auf E-Commerce zurückzuführen. Weiterhin führen Outsourcing-Prozesse und Lohngefälle innerhalb der EU zu internationalen Unternehmensverflechtungen und Arbeitsteilungen mit einer Ausweitung der Zulieferradien und Absatzmärkte, die auch grenzüberschreitend zu einem verstärkten Verkehrswachstum führen. „Die internationale wirtschaftliche Verflechtung [hat] zur Folge, dass ein größerer Koordinations- und Kooperationsbedarf entsteht.“ (BMVBW, 2003, S. 7). Dies bewirkt sowohl im Güter- aber vor allem auch im Geschäftsreiseverkehr eine Zunahme der Wegedistanzen und -häufigkeiten, die im Geschäftsreiseverkehr meistens mit dem Flugzeug getätigt werden.
Aber auch außerhalb des Geschäftsreiseverkehrs gibt es im Personenverkehr deutliche Trends, die für ein weiteres Wachstum des Verkehrssektors sprechen. Die Handlungsräume der Menschen weiten sich durch verbesserte Infrastrukturangebote und schnellere Verkehrsmittel, aber auch durch Faktoren wie der räumlichen Trennung der drei Grunddaseinsfunktionen Arbeiten , Wohnen , Versorgen stetig aus. Hinzu kommt, dass die Zahl der Haushalte insgesamt in Deutschland durch ein leichtes Bevölkerungswachstum von 2,74 % zwischen 1991 (80,3 Mio. Menschen) und Ende 2003 (82,5 Mio. Menschen) (BMVBW, 2000 / Destatis, 2003) als auch durch eine gesteigerte Anzahl von Singlehaushalten angewachsen ist. So war zwischen 1991 und 1998 eine Zunahme der privaten Haushalte von 35,3 Mio. auf 37,9 Mio. zu verzeichnen (BMVBW, 2000). Auch in Europa (EU-15) ist die Gesamtbevölkerung um ca. 24 %, von 366,2 Mio. im Jahr 1991 auf 454,6 Mio. im Jahr 2003 angewachsen (Eurostat, 2003 2004 a). Aus diesem Bevölkerungszuwachs entsteht eine weitere Steigerung des Verkehrsaufkommens durch Fahrten zur Arbeitsstelle, zu Versorgungseinrichtungen und für Freizeitaktivitäten.
Insgesamt zeigen sich die Verkehrszuwächse und die gesteigerte Mobilität der Bevölkerung beispielsweise an den in Deutschland pro Tag und pro Person zurückgelegten Wegstrecken. Diese lagen im Jahr 1958 noch bei fünf Kilometern und erreichten im Jahr 1998 bereits 25 Kilometer (Kulke, E., 1998). Im Vergleich zu 1998 ist die Wegstrecke pro Person pro Tag in nur sechs Jahren um ca. 55 % gestiegen und lag im Jahr 2002 bei 39 Kilometern pro Person (BMVBW, 2002). Dabei liegt die Reisedauer pro Tag pro Person mittlerweile bei 82,5 min (BMVBW, 2002). Nahezu 1 h 30 min leistet also jeder Bundesbürger pro Tag für die Teilnahme am Verkehr. Die gestiegene Mobilität der Bevölkerung wird auch deutlich, wenn man die Anzahl der Pkw pro 1.000 Einwohner betrachtet. Diese hat sich in den letzten 30 Jahren von rund 217 im Jahr 1973 (EU-15) auf 500 im Jahr 2001 (EU-15) mehr als verdoppelt (Eurostat, 2003).
Laut dem Bundesverkehrswegeplan 2003 lag im Jahr 1997 die Gesamtleistung des Personenverkehrs bei rund 943 Mrd. Pkm (Personenkilometer), die Verkehrsleistung des Güterverkehrs insgesamt bei 371 Mrd. tkm (Tonnenkilometer). Auf Basis des Integrationsszenarios des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) ab 1997, welches die „[...] nicht immer widerspruchsfreien ökonomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen an die Verkehrspolitik soweit wie möglich in Übereinstimmung bringt [...]“ (BMVBW, 2003), werden für das Jahr 2015 folgende Prognosen erstellt: Die Verkehrsleistung des Personenverkehrs wird voraussichtlich auf 1.130 Mrd. Pkm (+ 20 %) und die des Güterverkehrs auf 608 Mrd. tkm (+ 64 %) steigen. Ziel müsse es hierbei sein, den dominierenden Gebrauch des Verkehrsträgers Straße verstärkt auf alternative Möglichkeiten wie Binnenwasserstraßen für den Güterverkehr und Schienenstrecken in der Nutzung sowohl durch Güter- als auch Personenverkehre zu verlagern. „Die Mobilität der Zukunft wird nur durch das intelligente Zusammenspiel von Straße, Schiene, Wasserstraße und Luftraum in einem vernetzten Verkehrssystem ermöglicht.“ (BMVBW, 2003 a, S. 27).
Tabelle 1: Grobeinschätzung der Verkehrsnachfrage für den BVWP 2003
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BMVBW, 2003, S. 11 / Eigene Zusammenstellung
Bei der Aufschlüsselung der Verkehrsleistung nach einzelnen Verkehrsträgern wird deutlich, dass die Straße eine dominierende Rolle einnimmt. Sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr hat dieser Verkehrsträger seit Jahren eine scheinbar unaufholbare Position eingenommen. Auch die prognostizierten Verkehrszuwächse werden in erster Linie von der Straße aufgenommen werden.
Abbildung 1: Modal Split der Verkehrsleistung der EU-15
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: IHK Aachen, 2005, S. 2
Abbildung 2: Modal Split der Verkehrsleistung in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: IHK Aachen, 2005, S. 2
Das angestrebte wirtschaftliche Wachstum wird auch in Zukunft zu weiter steigenden Verkehrszahlen führen. Um diesem Wachstum nicht im Weg zu stehen und dennoch das Verkehrswachstum ökonomisch und nachhaltig sinnvoll zu gestalten und zu steuern ist eine intermodale Verkehrsplanung nötig. Eine abgestimmte Verkehrspolitik muss das Netz der Verkehrsträger leistungsfähiger ausbauen, welches jedoch auch wiederum weiteren Verkehr induziert. Wichtiger hingegen ist es, Bereiche zu fördern in denen eine Verlagerung und Vernetzung der Verkehrsmittel angestrebt wird. Der Verkehrsträger Schiene muss bei einer angestrebten Verlagerung die nötigen Voraussetzungen schaffen, konkurrenzfähig gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr agieren zu können. Um die derzeitige Situation des Schienenverkehrssektors deutlicher herauszustellen wird im Folgenden auf die Entwicklung des Schienenverkehrssektors eingegangen.
2.3 Die Verkehrsentwicklung im Schienenverkehrssektor
Das Zeitalter des Schienenverkehrs begann in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in England. Bereits 1813 wurde die erste funktionsfähige Dampflokomotive Puffing Billy hergestellt. Im Jahr 1825 wurde dann die erste Dampf-Eisenbahn ausschließlich für den Güterverkehr auf der Strecke Stockton – Darlington eingesetzt, bevor 1830 die ersten Personentransporte zwischen Liverpool und Manchester stattfanden. Als Grundmodell diente die von Georg Stephenson entwickelte Lokomotive Rocket , welche damals die langsamen Pferdebahnen durch Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h rasch ablöste (Martinsen, 1997).
Erst gut zehn Jahre nach den ersten in England praktizierten Eisenbahnfahrten wurden auch auf dem europäischen Festland die ersten Eisenbahnen betrieben. In Belgien wurde Anfang Mai 1835 die Strecke Mecheln – Brüssel in Betrieb genommen ehe Ende des gleichen Jahres in Deutschland die Strecke Nürnberg – Fürth eröffnet wurde. In den folgenden Jahren erhielten auch Frankreich (Paris – St. Germain, August 1837), Österreich (Floridsdorf – Deutsch-Wagram, November 1837), die Niederlande (Amsterdam – Haarlem, September 1839), Italien (Neapel – Portici, September 1839) sowie Dänemark (Altona – Kiel (bis 1849 dänisch), September 1844) und die Schweiz (Zürich – Baden, August 1847) ihre ersten Eisenbahnstrecken (Dünbier, 1984).
Die Situation in Deutschland, damals in mehrere Teilstaaten gegliedert und daher meist national ausgerichteten Interessen innerhalb der Teilstaaten, führte zunächst zu einem Eisenbahnbau, der sich keineswegs mit den Vorschlägen von Friedrich List deckte. List trat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderst für ein einheitliches Zollgebiet und den Eisenbahnbau ein. Er forderte bereits im Jahre 1833 ein zusammenhängendes Eisenbahnnetz, da dieses die ökonomische Situation Deutschlands positiv beeinflussen würde. Oft wurden jedoch die Strecken „[...] nicht rein nach technisch-ökonomischen Gesichtspunkten gebaut [...], sondern mussten zur Vermeidung von Konflikten mit Nachbarstaaten unter ungünstiger Streckenführung innerhalb der Landesgrenzen verlaufen.“ (Dünbier, 1984, S. 12). Durch den Zusammenschluss der deutschen Teilstaaten im Jahr 1871 wurde auch ein einheitliches Eisenbahnnetz notwendig, was 1920 zur Gründung der Deutschen Reichsbahn führte. Die Entwicklung in Deutschland verdeutlicht so die Bedeutung des Schienennetzes und seiner positiven Wirkung auf ein Zusammenwachsen mehrerer Teilstaaten.
„High-speed railways might help increase cohesion in today`s Europe, just as conventional railways had done on a national level.“ (Roll, 1996, S. 2).
Die Länge der europäischen Schienenstrecken wuchs durch starke Bautätigkeiten von 3.000 km im Jahr 1840 auf 224.000 km im Jahr 1890 bei einer durchschnittlichen jährlichen Baurate von ca. 4.400 km (Dünbier, 1984). Die Bautätigkeiten der meisten europäischen Bahnen verliefen ähnlich wie in Deutschland in drei Bauphasen. Bis ungefähr 1880 wurden die meisten Hauptstrecken fertiggestellt (1. Phase) und bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges waren weitere Nebenstrecken in Betrieb gegangen (2. Phase). Als dritte Phase lässt sich der Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg herausstellen, in der die mittlerweile 100 Jahre alten Strecken nicht mehr den technischen Neuerungen der Triebfahrzeuge entsprachen. Die entstehenden Kapazitätsengpässe der Strecken wurden seitdem durch Aus- und Neubauten der Strecken kompensiert, vorrangig mit dem Ziel einer Geschwindigkeitserhöhung.
Durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919 standen die deutschen Einzelstaaten vor der Auflage, „[...] die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen bis zum 1. April 1921 in sein Eigentum (Anm.: Eigentum des deutschen Reiches) zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.“ (Rossberg, 1977, S. 45). Aus diesem Grund kam es, wie schon erwähnt, 1920 zur Gründung der Deutschen Reichsbahn, welche 1922 eine Netzgröße von ca. 53.600 km aufwies. (Rossberg, 1977). Kriegsverluste des Ersten und Zweiten Weltkrieges und damit verbundene Zerstörungen und Abtretungen durch Reparationszahlungen setzten dem deutschen Eisenbahnwesen stark zu. Dennoch wuchs insgesamt das Streckennetz und wies 1945 eine Länge von 45.000 km Normalspurbahnen auf (Rossberg, 1977).
Die politische Situation Deutschlands bedingte eine Aufteilung des Streckennetzes auf die verschiedenen Besatzungszonen. Auf der Seite der ehemaligen DDR bestand weiterhin die Deutsche Reichsbahn mit einer Netzgröße von ca. 18.000 km Normal- und Schmalspurbahnen im Jahre 1938, während auf der Seite der BRD die Strecken der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone mit Wirkung des 7. Septembers 1949 in die Deutsche Bundesbahn (DB) übergingen. Eine einheitliche Betriebsstruktur der DB trat jedoch erst 1952 mit einer Vielzahl von Bahndirektionen im gesamten Bundesgebiet in Kraft. Anfang der neunziger Jahre entschied sich die Bundesregierung nach der Wiedervereinigung zu einer umfassenden Bahnreform.
Die Bahnreformgesetze wurden notwendig, da die Bahn wirtschaftlich ungünstige und untragbare Voraussetzungen aufwies. Zum einen sanken die Anteile des Bahnverkehrs trotz eines allgemeinen Verkehrswachstums und zum anderen stellten zunehmende finanzielle Defizite mit beispielsweise vier Milliarden DM Fehlbetrag am Ende des Jahres 1989 und zugleich einem Schuldenstand von 44 Mrd. DM ein nicht länger tolerierbares Haushaltsrisiko des Bundes dar (DB AG, 2003). Die Bahnreform war in zwei Stufen angelegt und bewirkte zum 1. Januar 1994 den Übergang der bis dahin staatlich geführten Deutschen Bundesbahn und Deutschen Reichsbahn in ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Somit entstand vor nun rund zehn Jahren die Deutsche Bahn AG (DB AG). Hauptrangige Ziele dieser Reform waren es, die Produktivität der Bahn zu steigern und einen Wettbewerb zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen auf dem betriebenen Netz zu erwirken. Der Übergang von staatlichen in unternehmerische Aufgaben beinhaltete auch die Garantie seitens der Regierung, bezüglich Aus- und Neubauten der Schieneninfrastruktur unterstützend tätig zu sein. Im Schienenpersonennahverkehr wurde im Rahmen der ersten Stufe zum 1. Januar 1996 eine Regionalisierung eingeleitet, welche eine Übertragung der Verantwortung auf Länderebene bewirkte. In der zweiten Stufe der Bahnreform wurden aus dem Gesamtkonzern DB AG mehrere Geschäftsbereiche ausgegliedert. Seit dem 1. Januar 1999 bestehen als Teilbereiche die von der Holding DB AG gesteuerten, koordinierten und kontrollierten Bereiche der DB Fernverkehr AG , DB Netz AG (Fahrweg), DB Regio AG (Nahverkehr), DB StationService AG (Personenbahnhöfe) und Railion Deutschland (Güterverkehr) mit eigener Entscheidungsbefugnis und Ergebnisverantwortung für ihre Unternehmensbereiche.
Die angesprochene Bahnreform wuchs aus der erkannten Notwendigkeit heraus, einer jahrzehntelangen Vernachlässigung von Investitionen in die Infrastruktur der Eisenbahnen und konstantem Rückgang des Schienennetzes entgegenzuwirken. Zwischen 1950 und 1976 nahm die Länge der Schienen der Bundesbahn von 30.500 km auf 28.800 km ab (Rossberg, 1977). Bis 1990, dem Jahr der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, waren auf Bundesseite rund 45 % der Strecken (11.700 km) elektrifiziert und ca. 46 % (12.300 km) mehrgleisig ausgebaut. Auf Seiten der Deutschen Reichsbahn bot sich eine unzureichend in Stand gehaltene Infrastruktur. So waren 1990 hier nicht einmal 30 % der Strecken (3.800 km) elektrifiziert und gerade einmal ein Drittel mehrgleisig ausgebaut (DB AG, 2003). Mit der Bahnreform mussten zahlreiche Investitionen getätigt werden, so dass alle Ausgaben im Modernisierungsprogramm bis 2003 ein Volumen von rund 70 Mrd. Euro erreichten.
Heute beträgt die Länge der in Deutschland betriebenen Strecken rund 35.600 km, wovon ca. 19.400 km (54,5 %) elektrifiziert sind (DB AG, 2003). Noch Anfang 2003 betrug die Betriebslänge der DB AG jedoch noch ungefähr 41.000 km. Auf europäischer Ebene (EU-15) ist das Schienennetz in den letzten 30 Jahren von 153.300 km auf 148.600 km gesunken (Eurostat, 2003), wobei in Deutschland vor allem zwischen 1995 und 2001 die stärkste Reduzierung (- 13,7 %) stattfand (Eurostat, 2003), welches die Auswirkungen der Programme Mora-C (Marktorientiertes Angebot - Cargo) und Mora-P (Marktorientiertes Angebot - Personenverkehr) der DB AG zeigt. Die Aufgabe unrentabler Strecken im Zuge dieser Pogramme bewirkte einen Rückzug der Bahn aus der Fläche, so dass die Bahn vor allem im Nahbereich kaum Konkurrenz zum Verkehrsträger Straße bietet. Eine Verkehrsverlagerung ist hier daher derzeit weiter eingeschränkt.
Grenzüberschreitend ergeben sich weitere Probleme, die vor allem technisch bedingt sind und zu erheblichen Zeitverlusten führen. Es existieren auf europäischer Ebene drei unterschiedliche Spurweiten, fünf verschiedene Stromsysteme, sieben divergierende Signaltechniken sowie mindestens zwölf unterschiedliche nationale Zugsteuerungs- und Sicherungssysteme.
Abbildung 3: Stromsysteme des europäischen Eisenbahnnetzes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Messerschmidt, 1997, S. 63
Technische Neuerungen erlauben zwar geringere Zeitverluste durch den Einsatz von Mehrsystemtriebfahrzeugen, zu beachten ist hierbei jedoch, dass solche Mehrsystemtriebfahrzeuge sowohl „[...] in der Beschaffung, im Unterhalt als auch im Energieverbrauch aufwendiger als vergleichbare Einsystemfahrzeuge gleicher Leistung [sind] [...]“ (Dünbier, 1984). Beim Grenzübertritt sinkt die Durchschnittsgeschwindigkeit des Schienengüterverkehrs beispielsweise auf gerade einmal 18 km/h (Europäische Kommission, 2001). Weiterhin muss in vielen Fällen neben einem Lok-Tausch auch ein Wechsel des Personals erfolgen. Ab 2006 soll ausländischen Eisenbahnen der Zutritt zu den jeweiligen Märkten in ganz Europa geöffnet und ab 2007 sollen sogar Kabotagetransporte (rein nationale Beförderungsleistungen durch ausländische Eisenbahnunternehmen) auf den derzeit insgesamt 150.000 km Bahnstrecken ermöglicht werden. Deutschland nimmt beim Öffnungsprozess für einen freien Wettbewerb eine Vorreiterrolle ein. Bereits heute nutzen ca. 280 Unternehmen, davon 260 der DB AG konzernfremde Eisenbahnen, das deutsche Schienennetz (DB AG, 2003)
Die Entwicklung des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes soll in Kapitel 3.2 näher betrachtet werden. Zunächst folgt ein Überblick über die Entwicklung des Luftverkehrssektors als Ausblick für das in Kapitel 3.1 behandelte europäische Flughafensystem.
2.4 Die Verkehrsentwicklung im Luftverkehrssektor
Der Bereich des Luftverkehrs ist im Vergleich zum Straßenverkehr, dem Verkehr auf dem Wasserweg und der Schiene der jüngste Verkehrssektor. Es gab bereits Ende des 18. Jahrhunderts erste vereinzelte Luftfahrten, als beispielsweise am 03. Oktober 1785, „[...] der Franzose Jean Pierre Blanchard [...] von Frankfurt a. M. [...] aus in einer etwa halbstündigen [Ballon-] Fahrt nach Weilburg an der Lahn [...]“ flog (Flughafen Frankfurt Main AG, 1986) und Frankfurt somit zum ersten deutschen Startplatz im Luftverkehrswesen wurde. Mit der Stationierung des Luftschiffes Viktoria Luise ab dem 14. Februar 1814 wurde in Frankfurt die Passagier-Luftfahrt eingeläutet. Die erste Flugmaschine, der Flyer No.1 von den Gebrüdern Wright konstruiert, erhob sich erst rund neunzig Jahre später in den USA. In einem zwölf Sekunden dauernden Flug flog zum ersten Mal aus eigener Kraft eine Flugmaschine am 17. Dezember 1903 über die Dünen von Kitty Hawk, North Carolina (DLR, 2003). Mit dem Ersten Weltkrieg kam es zu einem vorläufigen Einbruch der sich entwickelnden zivilen Luftfahrt in Europa. Ebenso führte in Deutschland der Vertrag von Versailles zu Flugverboten und Zerstörung von Fluggeräten. So erklärt sich auch, dass der zivilen Luftfahrt an den meisten Flugplätzen eine militärische Nutzung vorausging, von der man sich aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entfernte und eine Entmischung der Nutzungsinteressen vornahm. Es entstanden schwerpunktmäßig zivil oder militärisch genutzte Flugplätze. Der Flughafen Amsterdam Schiphol wurde beispielsweise ab 1945, London Heathrow ab 1946 und Frankfurt a. M. ab 1950 zivil genutzt.
In Deutschland besteht eine statistische Erhebung über die Entwicklung des deutschen Fluglinienverkehrs bereits seit Ende des Ersten Weltkrieges. Im Jahr 1919 wurden so 2.000 Passagiere und 10 t Fracht befördert. Der planmäßige deutsche Luftverkehr setzte erst ab 1925 ein, als 55.000 Passagiere und 520 t Fracht sowie 290 t Post transportiert wurden. Seit diesem Zeitpunkt begann ein stetiges Wachstum, welches jedoch durch wirtschaftliche und politische Faktoren zum Teil erheblich gebremst wurde. Nach einem Einbruch während der Weltwirtschaftskrise bis 1933 stiegen die Passagierzahlen bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges wieder stärker an und überschritten 1938 die Grenze von 300.000 Passagieren pro Jahr. Der Zweite Weltkrieg wiederum bewirkte einen Rückgang der Passagierbeförderungen im Luftverkehr, mit dessen Ende und der Besatzung durch die Alliierten Truppen die deutsche Luftfahrt vor dem Aus stand (Seifert, 1999).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832487867
- ISBN (Paperback)
- 9783838687865
- DOI
- 10.3239/9783832487867
- Dateigröße
- 6.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen – unbekannt, Geographie
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- flughafen eisenbahn verkehr verkehrsverlagerung luftverkehr
- Produktsicherheit
- Diplom.de