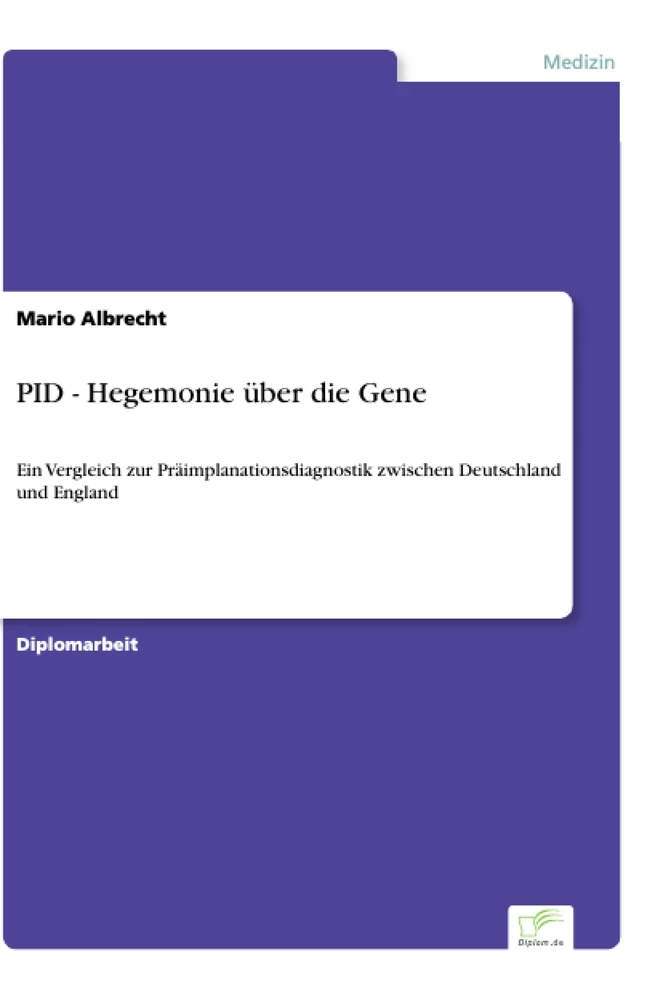PID - Hegemonie über die Gene
Ein Vergleich zur Präimplanationsdiagnostik zwischen Deutschland und England
Zusammenfassung
Die Gentechnik ist eine Querschnittstechnologie, die in unterschiedlichsten Bereichen wie der Biologie, der Medizin, der Biotechnologie sowie der Agrar- und Lebensmittelindustrie vertreten ist und zudem auch in das Bewusstsein vieler Menschen, der sogenannten breiten Öffentlichkeit, eingedrungen ist. Die Debatten über die Gentechnik lösen unterschiedlichste Reaktionen aus. Einerseits werden Hoffnungen geweckt - wie z.B. dass heutzutage unheilbare Krankheiten dank therapeutischen Klonens bezwungen werden können - andererseits die Angst hervorgerufen, dass die Anwendung der Gentechnik unabsehbare Folgen ökologischer und sozialer Natur nach sich ziehen könnte. Die Fortschritte in der Biotechnologie werfen somit ständig neue praktische und politische Fragestellungen auf. Die Fragen bzw. Antworten, welche die Diskurse über die Gentechnik beherrschen, werden auf das Leben der heutigen und zukünftigen Generationen mit Sicherheit beträchtliche Auswirkungen haben.
Francis Fukuyama appelliert daran, die Entwicklung der Bio- und Gentechnologie nicht allein als eine ethische, sondern auch als politische Herausforderung zu erkennen. Tatsächlich ist die Gentechnik ein Bereich des demokratischen Kampfes, denn in vielen Gebieten dieser Querschnittstechnologie liegt ein enormes Potential an neuen Herrschaftsverhältnissen. Somit wird auch der Bereich der genetischen Information, mit welchem sich meine Arbeit beschäftigt, von einer Vielzahl von Akteuren und Determinanten beeinflusst und gesteuert. Der zukünftige Umgang mit genetischen Informationen ist eine jener Entscheidungen, die über das kollektive Leben der Gemeinschaft getroffen werden. Wie Ernesto Laclau zu bedenken gibt, sind solche Entscheidungen niemals vollkommen rational, denn wären sie das, würden sie völlig offensichtlich sein und würde eine Entscheidung nicht mehr benötigt werden.
Einer der vielen demokratischen Konflikte betreffend die Gentechnik gilt dem Umgang mit genetischen Information, deren Zugang durch die genetische Diagnostik ermöglicht wird. Als Teil dieses Komplexes rund um genetische Diagnostik beschäftige ich mich mit der Präimplantationsdiagnostik (PID) dem Gentest am künstlich gezeugten Embryo und der Frage nach den demokratie-politischen Konflikten um die heutigen und mögliche zukünftige Nutzen bzw. Nachteile dieser Technik, die als Teil einer zunehmenden Technologisierung der menschlichen Reproduktion fungiert.
Die Möglichkeit der Diagnose genetisch […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Grundbegriffe der Hegemonietheorie von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau
1.1 Einführung in die Thematik 10-14
1.2 Diskurs
1.3 Antagonismus
1.4 Hegemonie
2 Die Einführung neuer Technologien
2.1 Technik
2.2 Technology Policy
2.2.1 Leitbilder
2.2.2 Experten als Policy-Akteure
2.2.3 Der Staat
2.3 Technikfolgen-Abschätzung
3 Die Präimplantationsdiagnostik
3.1 Problemdefinition
3.2 Beschreibung der Technologie
3.3 Voraussage der zukünftigen Technologieentwicklung
3.3.1 Diskursverschränkung
3.3.2 Die PID auf dem freien Markt
3.3.3 Voraussagen zur PID von Forschung abhängig
3.4 Beschreibung der Gesellschaft, der Betroffenen; Voraussage sozialer Entwicklungen
3.4.1 PID-Debatten in unterschiedlichen nationalen und kulturellen Kontexten
3.4.2 Eugenik
3.4.3 Reproduktionstechnologie
3.5 Analyse politischer Handlungsoptionen
3.5.1 Gemeinschaftliche und völkerrechtliche Aspekte
4 Die PID in Deutschland und England
4.1 Die politische Theorie
4.1.1 Unterschiede durch Politik, Recht, Philosophie und Religion
4.1.2 Die emotionale Verfasstheit eines Landes Deutschland
4.2 Deutschland von 1985 bis 1990
4.2.1 Das Embryonenschutzgesetz
4.2.2 Bundestagsdebatte zum Embryonenschutzgesetz
4.2.3 Überblick 1985-1990
4.3 Deutschland von 1990 bis 2000
4.3.1 Medien, Akteure
4.3.2 Das Jahr 2000 als Höhe- und Wendepunkt
4.3.3 Überblick 1990 – 2000
4.4 Deutschland von 2000 bis 2004
4.4.1 Überblick 2000 bis 2004 England
4.3 England von 1982 bis 1990
4.3.1 Der Warnock-Report
4.3.2 Prä-Embryo -
4.3.2 Parlamentsdebatte zum Human Fertilisation and Embryology Act
4.3.3 Überblick 1982-1990
4.3.5 Die Human Fertilisation and Embryology Authority
4.4 Die PID in England und Deutschland im Vergleich Zusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
Bibliographie
Einleitung
Die Gentechnik ist eine Querschnittstechnologie, die in unterschiedlichsten Bereichen wie der Biologie, der Medizin, der Biotechnologie sowie der Agrar- und Lebensmittelindustrie vertreten ist und zudem auch in das Bewusstsein vieler Menschen, der sogenannten breiten Öffentlichkeit, eingedrungen ist. Die Debatten über die Gentechnik lösen unterschiedlichste Reaktionen aus. Einerseits werden Hoffnungen geweckt - wie z.B. dass heutzutage unheilbare Krankheiten dank therapeutischen Klonens bezwungen werden können - andererseits die Angst hervorgerufen, dass die Anwendung der Gentechnik unabsehbare Folgen ökologischer und sozialer Natur nach sich ziehen könnte. Die Fortschritte in der Biotechnologie1 werfen somit ständig neue praktische und politische Fragestellungen auf. Die Fragen bzw. Antworten, welche die Diskurse über die Gentechnik beherrschen, werden auf das Leben der heutigen und zukünftigen Generationen mit Sicherheit beträchtliche Auswirkungen haben.
Francis Fukuyama appelliert daran, die Entwicklung der Bio- und Gentechnologie nicht allein als eine ethische, sondern auch als politische Herausforderung zu erkennen.2 Tatsächlich ist die Gentechnik ein Bereich des demokratischen Kampfes, denn in vielen Gebieten dieser Querschnittstechnologie liegt ein enormes Potential an neuen Herrschaftsverhältnissen. Somit wird auch der Bereich der genetischen Information, mit welchem sich meine Arbeit beschäftigt, von einer Vielzahl von Akteuren und Determinanten beeinflusst und gesteuert. Der zukünftige Umgang mit genetischen Informationen ist eine jener Entscheidungen, die über das kollektive Leben der Gemeinschaft getroffen werden. Wie Ernesto Laclau zu bedenken gibt, sind solche Entscheidungen niemals vollkommen rational, denn wären sie das, würden sie völlig offensichtlich sein und würde eine Entscheidung nicht mehr benötigt werden.
Einer der vielen demokratischen Konflikte betreffend die Gentechnik gilt dem Umgang mit genetischen Information, deren Zugang durch die genetische Diagnostik ermöglicht wird. Als Teil dieses Komplexes rund um genetische Diagnostik beschäftige ich mich mit der Präimplantationsdiagnostik (PID) - dem Gentest am künstlich gezeugten Embryo - und der Frage nach den demokratie-politischen Konflikten um die heutigen und mögliche zukünftige Nutzen bzw. Nachteile dieser Technik, die als Teil einer zunehmenden Technologisierung der menschlichen Reproduktion fungiert.
Die Möglichkeit der Diagnose genetisch bedingter Krankheiten durch die PID wirft erhebliche Probleme auf und stellt die Frage nach einem gesellschaftlich vertretbaren Umgang mit diesem Wissen, vor allem wenn es keine Therapiemöglichkeiten gibt. Die PID zwingt zu einer Selektion, und diese Selektion des menschlichen Erbgutes erlaubt es möglicherweise, eine zusätzliche konstruierte Herrschaft bzw. Unterdrückung - wie dies beispielsweise durch Klasse, Rasse, Religion, Nationalismus der Fall ist - entstehen zu lassen. Jeder sozial handelnde Mensch ist durch ein Ensemble von Subjektpositionen konstituiert. Eine Subjektposition könnte sich zukünftig aus der Diagnostik der jeweiligen Erbanlage ergeben. Der zukünftige Umgang mit der PID wird durch demokratie-politische Kämpfe entschieden und erfordert deswegen eine Vorstellung, wie solche Konflikte geführt werden.
Eine Vorstellung, wie demokratie-politische Konflikte nachvollzogen werden können, entwickelten der Argentinier Ernesto Laclau und die Französin Chantal Mouffe mittels dekonstruktiver Strategien und diskursanalytischer Theorie. Sie erarbeiteten eine Gesellschaftstheorie, die Gesellschaft nicht als eine Totalität mit einer universellen Konstitutionslogik erfasst, sondern als ein heterogenes und diskontinuierliches Feld von Antagonismen. Diese Diskurstheorie bietet die Möglichkeit, Konflikte - die antagonistische Konfrontation - nicht als einen Zustand des Mangels zu verstehen, sondern als fundamental. Das Eintreten für die Unumgänglichkeit von Konflikten unterscheidet die Theorie von Laclau/Mouffe von den gängigen philosophischen Politikkonzeptionen.
Durch ihre Vorstellung von Hegemonie wird der politische Raum als Bereich des Antagonismus - einen Bereich einer Vielzahl von Kämpfen - neu gedacht, innerhalb dessen es viele Formen von Herrschaft oder Formen von Unterdrückung gibt. Der antagonistische Moment, der soziale Konflikt, ist ein ursächlicher Moment, er stellt nicht das Ergebnis von etwas anderem dar. Das bedeutet, dass sich die Orte der Antagonismen zwar stets verschieben werden, es aber immer Antagonismen geben wird. Die Gendiagnostik im allgemeinen und die PID im speziellen enthalten ein enormes Potential an neuen Herrschaftsverhältnissen, denn der Diskurs darüber, welches Leben als wertvoll erachtet wird und welches nicht, enthält, da er die Identität eines jeden Menschen betrifft, einen grundlegenden Machtanspruch. Die Diskurse um die PID besitzen deshalb ein großes Potential, als Ort vieler Antagonismen zu fungieren, weil die ständige hegemoniale Verschiebung in der „Wertigkeit des Lebens“ durch Veränderung der „genetische Selektionsstandards“ jeden Menschen der Gefahr aussetzt, „unerwünschte“ Erbanlagen zu besitzen, und sich somit die jeweilige Identität des Menschen innerhalb der Gesellschaft verändert.
Wie sind der heutige und der mögliche zukünftige Nutzen bzw. die Nachteile der PID für die Gesellschaft zu bewerten?
Wie kann der politisch-demokratische Kampf bei der Einführung neuer Techniken im allgemeinen und bei der PID im speziellen gedacht werden?
Wie sind die unterschiedlichen Diskurse betreffend der PID in England und in Deutschland zu erklären?
Mit der vorliegenden Arbeit diskutiere und behandle ich diese Fragen unter Bezugnahme und Annahme der Gesellschaftstheorie von Laclau/Mouffe.
Im ersten Kapitel werde ich jene Grundbegriffe des Werkes Hegemony and Socialist Strategy – Towards a radical democratic politics von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau und die dazugehörenden Überlegungen, die als Grundlage der theoretische Betrachtung meiner Arbeit dienen, darstellen. Da eine vollständige Darstellung der Gesellschaftstheorie Laclau/Mouffes den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, zeichne ich ihre Vorstellungen nur soweit nach, als diese mir erstens verständlich und sie zweitens für die vorliegende Arbeit dienlich sind.
Im zweiten Kapitel werde ich allgemein die Problematiken bei der Einführung neuer Techniken erörtern. Die Gestaltungsanstrengungen in diesem Bereich sind deshalb so schwierig, weil kein Steuerungszentrum existiert und es auch keine klaren Steuerungsziele gibt. Die technische Entwicklung wird neben dem Staat von vielen weiteren Akteuren und deren Interessenvertretungen getragen. Ein Konsens über Ziele der Technisierung ist nicht vorhanden, und auch hinter scheinbar gemeinsamen Zielen können sich eine Vielzahl individueller Einzelinteressen verbergen. In dem Abschnitt „Technikfolgenabschätzung“ (TA) - einem wichtigen Instrument der Politikberatung - werden allgemein ihre Methoden, Ansatzpunkte, Institutionalisierung dargestellt, um im dritten Kapitel die TA als Schema zu nutzen die PID als Technologie darlegen zu können.
Im dritten Kapitel wird die besondere Problemstellung der PID aufgezeigt. Die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes und die daraufhin erfolgten Versprechungen, dass die Gentherapie Behandlungserfolge für nahezu alle Krankheiten bringen würde, erwies sich als sehr verfrüht, denn die „Abschrift“ des dekodierten Lebens kann nach wie vor niemand lesen.3 Daraus resultiert ein Grundproblem, das auch auf die PID zutrifft, nämlich, dass die Gendiagnoseverfahren weit fortgeschritten sind, die Möglichkeiten der Gentherapie aber weit hinterher hinken. Die moralischen Dilemmata, wie sie durch die PID aufgeworfen werden, und ihre Lösungen sind an institutionelle, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kontexte gebunden. Nach dem Schema einer technologieinduzierten TA-Studie werde ich die PID in diesem Kapitel behandeln. Dies impliziert eine Problemdefinition; Beschreibung der Technologie; Voraussage der zukünftigen Technologieentwicklung; Beschreibung der Gesellschaft, der Betroffenen und Voraussage sozialer Entwicklungen; sowie Analyse politischer Handlungsoptionen.
Im vierten Kapitel beleuchte ich anhand eines zeitgeschichtlichen Vergleichs zwischen Deutschland und England die jeweiligen Entwicklungen in den die PID betreffenden Diskursen. „Laclau/Mouffe lösen das Politische von seiner zeitlichen und räumlichen Verbindung mit partikularen hegemonialen Verhältnissen und Regierungsformen, um eine reine Theorie des Politischen voranzutreiben. Das heißt, eine Theorie, die nicht die Funktion des Politischen mit seiner historisch kontingenten Strukturierung verwechselt.“4 Laclau/Mouffe bieten die Möglichkeit, politisches Handeln zu verstehen; das Aufzeigen der unterschiedlichen Diskursentwicklungen zur PID in England und Deutschland kann jedoch nur in seiner historisch und kulturellen Dimension nachvollzogen werden und ist deshalb so interessant, weil die PID in England im Gegensatz zu Deutschland5 rechtlich zulässig ist und bereits seit zur Anwendung kommt.
Auch aus österreichischer Sicht ist dieser Vergleich von großem Interesse, da sich die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt im Juli dafür ausgesprochen hat, das herrschende Verbot im Reagenzglas erzeugte Embryonen per Gentest zu untersuchen unter bestimmten Voraussetzungen aufzuheben.6 Die österreichische Bioethikkommission orientiert sich in dieser Frage stark an den Erfahrungen und dem Regulierungsmodell Großbritanniens.7
Grundbegriffe der Hegemonietheorie von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau
Zunächst soll der Teil „Einführung in die Thematik“ einen ersten Einblick in das teils sehr abstrakte Theoriewerk Laclau/Mouffes verschaffen. In den weiteren Abschnitten werden die Begriffe Diskurs, Antagonismus und Hegemonie näher erläutert, auf welche die Arbeit von Laclau/Mouffe aufbaut. Durch die Aufarbeitung dieses Theoriewerks kann und soll weder eine vollständige Wiedergabe erfolgen, noch kann auf Kritiken, wie sie beispielsweise von Anna Maria Smith oder Judith Butler formuliert wurden, eingegangen werden.
Das Politikverständnis Laclau/Mouffes ist gekennzeichnet von der Vorstellung des „ewigen“ Vorhandenseins und Austragens von gesellschaftlichen Konflikten. Politisches Handeln wird als Konflikthandeln begriffen, womit eine Vorstellung, wie Demokratie abseits der klassischen politischen Ideologien verstanden werden kann, vermittelt wird. Somit können politische Konflikte in einer Demokratie allgemein - und im besonderen die Kontroversen um die PID - aus einer anderen Perspektive betrachtet werden, als dies mit den Vorstellungen der klassischen politischen Ideologien möglich ist.
Offen bleibt allerdings die Frage der Grenzziehung, d.h. welche sozialen Konflikte und welche sozialen Gegensätze eigentlich politische Gegensätze sind, wenn man einmal unterstellt, dass nicht jeder Konflikt und jeder Gegensatz ohne weiteres auch ein politischer Konflikt und ein politischer Gegensatz ist. Es ist zudem sehr schwer zu klären, auf Grund welcher Gegebenheiten gesellschaftliche Konflikte zu politischen werden.8 Die Gentechnik hat sich jedoch gewiss zu einem politischen Konfliktfeld entwickelt.
„Der Konflikt um die Gentechnik ist eine ausgezeichnete Illustration dieses demokratischen Konfliktes. Kontroversen gentechnische Verfahren betreffend werden immer massiver und insbesondere in Europa gilt es heute als unbestritten, dass die Zukunft der Gentechnik untrennbar mit ihrer demokratischen Aushandlung und noch zu erzeugenden gesellschaftlichen Akzeptanz verbunden ist. Bei allen revolutionären Charakter der Gentechnik werden die bereits beobachtbaren oder in Zukunft noch zu erwartenden Revolutionen der Biotechnologie trotz allem nur dann stattfinden, wenn die Gesellschaft sie auch wirklich will.“9
Einführung in die Thematik
Als Laclau/Mouffe in den frühen er Jahren Hegemony and Socialist Strategy zu schreiben begannen, war der Marxismus in eine Krise geraten. Es gab ein Gefühl „auf der Linken“, dass es ein Problem mit der marxistischen Theorie gab, nämlich dass diese in erster Linie eine ökonomistische Sicht darstellte. Mit Hilfe der Arbeiten Gramscis konnte ein nicht-ökonomistischer Marxismus erarbeitet werden.10
In ihrem Buch Hegemony and Socialist Strategy setzen sich Chantal Mouffe und Ernesto Laclau mittels dekonstruktiver Strategien und diskursanalytischer Theorie kritisch mit marxistischen Gesellschaftstheorien auseinander. Gesellschaft wird nicht als eine Totalität mit einer universellen Konstitutionslogik erfasst, sondern als ein heterogenes und diskontinuierliches Feld von Antagonismen. Laclau/Mouffe dekonstruieren das Klassen-zentrische Denken marxistischer Positionen. Es geht nicht um den Kampf11 zwischen verschiedenen Klassen, sondern vielmehr um die Produktion von Identitäten, wobei es nicht eine einfache Identität gibt, viel mehr existieren immer Knotenpunkte aus verschiedensten Identifikationsformen.12
Die von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau erkannte Notwendigkeit, den politischen Raum zu vervielfachen, führte zum zentralen Ansatz in ihrer Gesellschaftstheorie, nämlich der Notwendigkeit zu verstehen, dass es verschiedene Formen von Antagonismen gibt. Sie zeigen auf, dass der Klassenantagonismus einer unter vielen ist, es aber tatsächlich eine Vielzahl von Orten der Macht in der Gesellschaft gibt. Der antagonistische Moment, der soziale Konflikt, ist ein ursächlicher Moment, er stellt nicht das Ergebnis von etwas anderem dar.
Für Laclau und Mouffe ist alles Diskurs. Das bedeutet nicht, dass es außerhalb eines Diskurses nichts geben würde, sondern nur, dass wir dieses „Außen“ nicht artikulieren können. Deshalb sind nicht nur alle unsere Äußerungen diskursiv, sondern auch alle unsere Handlungen. In Anlehnung an Wittgensteins Sprachspiel13 lehnen Laclau/Mouffe eine Eingrenzung des Diskurses auf das Sprachliche ab. Ein Diskurs ist laut Laclau/Mouffe auch kein gedankliches Konstrukt, sondern ist immer materiell. Ein einzelnes Subjekt kann sich also einen Diskurs nicht gedanklich aufbauen, sondern beruht er auf unterschiedlichen materiellen Elementen.14
Die Erkenntnis, dass das Subjekt durch die Vielfalt der Subjektpositionen und politischen Identitäten immer auf der Grundlage von komplexen diskursiven Praktiken konstruiert wird, erklärt, dass Gesellschaft in einem homogenen Block für Laclau/Mouffe nicht existiert.15
Es besteht bei Laclau/Mouffe das Bekenntnis zur Differenz und das Bekenntnis, dass es niemals ein Feld totaler Übereinstimmung geben wird, sondern sich die diversen antagonistischen Positionen immer „zusammenraufen“. Der Term Demokratie bleibt deshalb immer ein unerfüllter.16
„Mit ihrer Analyse verweigern sie jeder Theorie endgültiger Bedeutungsfixierung die Gefolgschaft, was nicht heißt sich in einem Relativismus zu verlieren: Um überhaupt von einem Fließen von Differenzen reden zu können, muss es partielle Fixierungen von Bedeutungen geben, hier wird der Einfluß Lacans17 sichtbar, diese nennen Laclau/Mouffe Knotenpunkte .“ Knotenpunkte bezeichnen jene privilegierten Signifikanten, die die Bedeutung einer Signifikantenkette fixieren, ohne die Aussagen nicht möglich wären. Jeder Diskurs konstituiert sich als Versuch, das Feld der Diskursivität zu beherrschen.18
Die endgültige Unmöglichkeit einer stabilen Differenz sowie die Nichtigkeit jedes Aufschubes einer endgültigen Schließung jeglicher Identität wird in dem Begriff Antagonismus zusammengefasst.19
Durch die Vorstellung von Hegemonie versuchen Laclau/Mouffe, den politischen Raum als einen Bereich des Antagonismus, einen Bereich einer Vielzahl von Kämpfen, neu zu denken. Hegemonie taucht in einem von Antagonismen durchzogenen Feld auf, auf dem durch Äquivalenzphänomene getrennte Räume existieren, deren Grenzen jedoch so instabil sind, dass die Artikulation der Elemente auch zu den entgegengesetzten Lagern möglich ist.
Hegemoniale Formationen sind nicht auf die Logik einer einzigen sozialen Kraft zurückzuführen, weshalb man sich Hegemonie nicht als die Vorherrschaft - z.B. einer herrschenden Klasse - vorstellen darf. Ihre Vorrangstellung erhalten die hegemonialen Formationen - obwohl nicht lokalisierbar - durch Ausschlussmechanismen. In jedem gesellschaftlichen Feld werden Intelligibilitäten geschaffen, die gleichzeitig Ausschlüsse tätigen. Alles, was den intelligiblen Rahmen als Bedeutungsüberschuss bedroht, wird ausgeschlossen. Die Naturalisierung mit dem Anschein des Substanzhaften ist ein Hegemonieeffekt.20
Der Dekonstruktivismus zeigt diesen Ausschluss, also die Entscheidung durch Hegemonie in einem nicht entscheidbaren Terrain, auf. Hegemonie und Dekonstruktion sind also untrennbar miteinander verbunden. „Der Dekonstruktivismus ist eine Demokratietheorie mit einem radikalen und ethischen Begriff des Demokratischen: Demokratie ist ein unabschließbares Projekt ohne definitive Form, aber mit dem Vermögen, sich beständig selbst in Frage zu stellen.“21
Die Spezifität der liberalen Demokratie sieht Mouffe in der Legitimierung des Konfliktes und der Weigerung, ihn durch die Auferlegung einer autoritären Ordnung zu unterbinden. Eine liberale Politik ist vor allem eine pluralistische Demokratie, welche die Diversitäten der Konzepte als wertvoll erachtet und nicht als Mißstand ansieht. Dies verlangt nach Institutionen, die eine besondere Dynamik zwischen Konsens und Zwist zu etablieren vermögen. Natürlich ist Konsens notwendig, er sollte jedoch auf die Institutionen beschränkt bleiben, die für die demokratische Ordnung konstitutiv sind.22
„Man kann kein Bestehen einer Pluralität von legitimen Werten ernsthaft ins Auge fassen, ohne annehmen zu müssen, dass diese irgendwann miteinander in Konflikt geraten. Und dieser Konflikt kann nicht einfach bloß mit Begriffen von widerstreitenden Interessen dargestellt werden. Viele Konflikte sind deshalb antagonistisch, weil sie unter den widerstreitenden Interpretationen der ethisch-politischen Werte stattfinden, die durch die liberal-demokratischen Institutionen verkörpert werden.“ Der Fortschritt der Demokratie wird niemals in Form einer sanften, fortschreitenden Evolution stattfinden.23
„Rechtsauffassungen werden immer untereinander in Konflikt geraten, und ohne eine echte demokratische Konfrontation zwischen widerstreitenden Rechten und ohne einen Wandel der existierenden Machtbeziehungen kann es kein dynamisches demokratisches Leben geben. Die Politik vor allem die demokratische, kann niemals Konflikt und Uneinigkeit überwinden. Ihr Ziel ist es, die Einheit eines Kontextes des Konfliktes und der Meinungsvielfalt zu gewährleisten; sie ist mit der Formation eines „Ihnen“ gegenübergestellten „Wir“ beschäftigt. Was für die demokratische Politik von Bedeutung ist, ist nicht die Überwindung der Opposition von „Wir“ und „Sie“, sondern die spezielle Weise, durch den diese Opposition hergestellt wird. Deshalb verlangt eine Erfassung des Wesens der Politik einen Umgang mit dem Bereich des Antagonismus, der sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen zeigt.“ Mouffe sieht in jedem demokratiepolitischen Konsens ein zeitweiliges Resultat einer provisorischen Hegemonie. Hegemonie stellt eine Stabilisierung von Macht dar und beinhaltet auch immer eine Art von Ausschluss. Sie kommt zu dem Schluss;24
„Es kann keine demokratische Politik ohne philosophische Reflexion geben, denn um ihre eigenen Dynamiken zu begreifen, muß sie alle Konsequenzen aus der Tatsache ziehen, dass sich Macht und Antagonismus nicht auslöschen lassen. Genau das wird aber unmöglich gemacht, wenn irgendwelche Ausschlüsse als der Ausdruck „freier Ausübung demokratischer Vernunft präsentiert werden.“25
Diskurs
„According to Laclau, the concept of discourse has distant roots in the transcendental turn in western philosophy. Classical transcendentalism urged us to focus not on the concrete facts, but rather on their conditions of possibility. ... In other words, our cognitions and speech-acts only become meaningfull within a certain pre-established discourse. However, there are two important differences between classical transcendentalism and contemporary theories of discourse.
First, while classical transcendentalism conceive the conditions of possibility as ahistorical and invariable, the theories of discourse insist on the historicity and variability of discourse. That is, the transcendental conditions are not purely transcendental, but continuously changed by empirical events.
Second, while classical transcendentalism is still in some sense anchored in an idealist conception of the subject as the creator of the world, the theories of discourse rely on a notion of structure which has played a key role within Saussurean and post Saussurean linguistic.“26
Für ein besseres Verständnis der Diskurstheorie Laclau/Mouffes ist es nützlich, die Entwicklungen der dekonstruktiven Mittel, die Jacques Derrida, der als Hauptvertreter der Dekonstruktivismus gilt, zur Verfügung stellte, aufzuzeigen. Jacques Derrida führte den Terminus der Dekonstruktion ein, um im Gegensatz zu einer negativen Zerschlagung bzw. Ablehnung der Tradition eine intensive Beschäftigung mit überlieferten Denkschemata in deren Abarbeitung zu betonen. Derrida überprüfte die philosophisch-politische Annahme eines regulierenden Zentrums und die Geschlossenheit der jeweiligen Systeme und brachte die scheinbar sicheren Fundamente der traditionellen Konzepte von totalizing structures durch das Aufzeigen von zwei Widersprüche ins Wanken.
„The first is that, due to its closure, the passage from one structure to another can only be thought of in terms of chance, hazard, or catastrophe. The second is that, due to its centredness, morpholigical changes will be a result of the unfolding of its internal logics. Together these problems clearly demonstrate the need for a deconstruction of the concept of structure.“
Das Verwerfen der Vorstellung eines ultimativen Zentrums, welches die Struktur strukturiert, sich aber gleichzeitig diesem Prozess der Strukturierung entziehen kann, ist die logische Schlussfolgerung.27
„Deconstruction of the notion of closed and centred structures brings us directly to the concept of discourse, which can be defined as a differential ensemble of signifying sequences that, in the absence of a fixed centre, fails to invoke a complete closure.“28
Diskurse bezeichnen die aus artikulatorischen Praxen entstandenen „strukturierten Totalitäten“. Die differenziellen Positionen, die innerhalb eines Diskurses durch Artikulation erscheinen, werden von Laclau/Mouffe als „Momente“ bezeichnet. Sie dürfen aber nicht als Entitäten verstanden werden, sondern haben ausschließlich relationalen Charakter, welcher erst Identität und Kohärenz zeitigt, weshalb der theoretische Ansatz auch als „radikaler Relationismus“ bezeichnet wird. „Elemente“ hingegen bezeichnen die nicht diskursiv artikulierten Differenzen: „Die sprachlichen und nichtsprachlichen Elemente werden nicht bloß nebeneinander gestellt, sondern konstituieren ein differenzielles und strukturiertes System von Positionen, das heißt, einen Diskurs.“29
Laclau und Mouffe ziehen daraus zwei wesentliche Schlussfolgerungen: Sie sprechen zunächst nicht mehr von dem Subjekt sondern von „Subjektpositionen“, die sich innerhalb diskursiver Formationen verstreut vorfinden. Zweitens stellen sie fest „...die Praxis der Artikulationen als Fixierung/Verlagerung eines Systems von Differenzen kann nicht bloß aus rein sprachlichen Phänomenen bestehen; sie muss vielmehr die gesamte materielle Dichte der mannigfaltigen Institutionen, Rituale und Praxen durchdringen, durch die eine Diskursformation strukturiert wird.“30
Mit ihrer Argumentation richten Laclau/Mouffe sich gegen den klassischen Begriff des Subjekts als einer substanziellen, essentiellen Entität, die im vorhinein gegeben ist und den sozialen Prozess dominiert. Wir haben es mit einer Serie partikularer Subjektpositionen zu tun, die durch die Kontingenz des diskursiven Prozess selbst produziert werden und deren Signifikation nicht im vorhinein fixiert ist: „sie wechselt entsprechend der Weise, auf die sie in einer Äquivalenzreihe durch den metaphorischen Überschuss artikuliert werden, der die Identität jeder einzelnen von ihnen definiert.“ Was nicht vergessen werden darf, ist, dass solche Einheit immer radikal kontingent ist, also keinen Ausdruck irgendeiner inneren Notwendigkeit darstellt, „so könnte man sich z.B. eine ökologische Position vorstellen, die die einzige Lösung in einem starken, anti-demokratischen, autoritären Staat sieht, der wieder die Kontrolle über die Ausbeutung natürlicher Ressourcen übernimmt.“31
Jede diskursive Formation wird von einem Äußeren beeinflusst, bedroht und umgeformt, jedoch durch dieses Äußere auch erst ermöglicht. „Das Äußere wird durch andere Diskurse konstituiert. Gerade die diskursive Natur dieses Äußeren ermöglicht die Anfechtbarkeit jeden Diskurses, da ihn nichts endgültig vor Deformation und Destabilisierung seines Systems von Differenzen durch andere diskursive Artikulationen, die außerhalb von ihm agieren, schützt.“32
Alles, was artikuliert werden kann, liegt innerhalb des Diskurses; was nicht artikuliert wird, befindet sich außerhalb des Diskurses im diskursiven Feld. Artikulation ist somit für Laclau/Mouffe nicht nur jeder sprachliche oder nicht-sprachliche Vorgang, der eine Beziehung zwischen verschiedenen Elementen herstellt und somit deren Identität verändert, sondern das sine qua non des Diskurses. Elemente definieren Differenzen, die nicht diskursiv artikuliert werden. Durch die Artikulation werden die Elemente zu Momenten, deren Bedeutung (Identität) zu einem nicht fixierten Punkt innerhalb des Diskurses wird.33
Als Beispiel zur Unterscheidung von Diskurs und dem diskursiven Feld nennt Torfing den Wohlfahrtsstaat. Die Idee des Wohlfahrtsstaates war in der Theorie des Merkantilismus untrennbar mit der Frage verbunden, wie das Vermögen der Nation stetig gesteigert werden kann, sowie mit der Vorstellung, dies durch eine ständig wachsende Bevölkerung zu gewährleisten. Für liberale Theorien stand später die Maximierung des privaten Nutzens innerhalb der Ökonomie im Vordergrund. Keine dieser ökonomischen Definitionen beherrschte den Diskurs des modernen Wohlfahrtsstaates der Nachkriegszeit. Die Idee des universalen Rechts, das soziale Rechte einschloss und den Staat die Aufgabe als Bereitsteller von Mitteln für die ärmeren Schichten zusprach, dominierte. Die ökonomische Krise der letzten Jahrzehnte brachte die Theorieansätze des Merkantilismus und liberal-ökonomische Vorstellungen erneut und erstarkt hervor, sodass von einem Übergang vom „Keynesian Welfare State“ zu einem „Schumpeterian Workfare Regime“ gesprochen werden kann.34
„The lesson of this illustrative example is that the distinction between discourse and the discursive should be made in terms of differing degrees of fixity/unfixity. That is, while the unfixed elements of a disintegrated discourse clearly belong to the field of discursivity, the partially fixed moment within concrete discourse do not.“35
Das Beispiel des Wohlfahrtsstaatsdiskurses soll zur Illustration dienen, dass sich die Momente innerhalb eines Diskurses durch das diskursive Feld ständig verändern. Um einen Bezug zur PID herzustellen sei an dieser Stelle ein anderer Diskurs erwähnt, der das diskursive Feld der PID mitbestimmt, nämlich die Frage wodurch das Verhalten des Menschen bestimmt ist. Peter Huemer hat dies bei einer Podiumsdiskussion mit Christiane Nüsslein-Volhard in folgender bündigen Weise getan:
„Seit meiner Jugend gibt es einen sich immer hin- und herbewegenden Streit, den ich ganz knapp in die zwei Chiffren zusammenfassen möchte: Milieu oder Gene. Heute ist eindeutig die Biologie für Fragen der Sexualität, Beziehung, Erziehung, Kinder, bis hin zur Kriminalität zuständig. Auch am Buchmarkt sind praktisch nur Bücher von Biologen zu finden, während vor Jahren das absolute Gegenteil der Fall war. Damals waren es die Psychologen, die Soziologen, die Analytiker. Es ist also eine Pendelbewegung festzustellen.“36
Jeder Diskurs versucht das Feld der Diskursivität zu beherrschen, mit dem Versuch, ein Zentrum zu konstruieren und das Fließen der Differenzen aufzuhalten. Jeder Diskurs unterliegt aber Veränderungen. Seine Grenzen sind nur temporär festgelegt, und es findet eine ständige Umwandlung von Elementen zu Momenten statt. Für Laclau/Mouffe sind diese Umwandlungen kontingent; jede Umwandlung hätte auch anders verlaufen können als sie tatsächlich verlief. Wie konstituieren sich jedoch die Grenzen zwischen Diskurs und diskursivem Feld?
„Die Grenze ist für Laclau/Mouffe der Antagonismus, der den Diskurs ständig unterwandert und damit verhindert, dass sich dieser als abgeschlossene und positive Realität konstituiert. Dabei ist der Antagonismus nichts, was ein Außen von einem Innen abgrenzt, sondern er verläuft auch Innerhalb des Diskurses.“37
. Antagonismus
Das antagonistische Verhältnis ist weder ein logischer Widerspruch, noch eine Realopposition, denn bei beiden Typen handelt es sich um Verhältnisse, deren Gegenstände volle Identität besitzen. „Beim Antagonismus handelt es sich gerade nicht um das Verhältnis voller Identität, sondern dieses Verhältnis entsteht gerade wegen der Unmöglichkeit ihrer vollen Konstitution. Das antagonistische Verhältnis ist die Erfahrung der Grenzen der Unmöglichkeit sich vollständig zu konstituieren. Dies betrifft jede Subjektposition, als auch jede soziale Formation, z.B. Gesellschaft. Das Problem der Beschreibung von Antagonismen ist nicht zufällig, denn wenn Sprache ein System von Differenzen ist, so ist der Antagonismus das Scheitern der Differenz.“38
Um die Dimension des sozialen Antagonismus39 zu verstehen, muss die Subjektposition näher erläutert werden: „Die Subjektposition ist eine Weise, auf die wir unsere Position eines (interessierten) Agenten des sozialen Prozesses anerkennen, auf die wir unsere Verpflichtung gegenüber einer bestimmten ideologischen Sache erfahren. Aber sobald wir uns als ideologische Subjekte konstituieren, sobald wir Anrufung antworten und eine bestimmte Subjektposition einnehmen, sind wir a priori, per definitionem, getäuscht, übersehen wir die radikale Dimension des sozialen Antagonismus, ... es ist nicht der externe Feind, der mich daran hindert, meine Selbstidentität zu erreichen, sondern jene Identität ist bereits in sich selbst blockiert, von einer Unmöglichkeit markiert, und der externe Feind ist einfach das kleine Stück, der Rest an Realität, auf den wir diese intrinsische, immanente Unmöglichkeit projizieren oder externalisieren.“40
In dem Moment, wo in der sozialen Realität ein Sieg über den Feind im antagonistischen Kampf errungen wird, erfährt der Antagonismus seine radikalste Dimension. Der Augenblick des Sieges führt nicht zu der vollen Selbstidentität, sondern zu einem Verlust und der Erfahrung, dass wir niemals hatten, was wir verloren haben sollen.41
„Der Antagonismus entzieht sich der Möglichkeit, durch Sprache erfasst zu werden, da ja die Sprache nur als Versuch einer Fixierung dessen existiert, was der Antagonismus untergräbt.“42 Antagonismus stellt die Grenze der sozialen Objektivität dar. Bei einem Antagonismus zwischen zwei Kräften führen beide einen Diskurs, der mit dem jeweilis anderen nicht vereinbar ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Antagonismus zu erklären. Man kann behaupten, dass der Antagonismus eine bloße Erscheinung irgendeines objektiv zugrundeliegenden Prozesses sei, oder dass der Antagonismus die Grundlage bildet. Laclau/Mouffe sprechen dem Antagonismus diese grundlegende konstitutive Rolle bei der Errichtung der Grenzen des Sozialen zu.43
Die Grenze des Sozialen ist innerhalb des Sozialen gegeben und trennt nicht zwei Räume, dies wäre nur eine neue Differenz. „Damit ein sozialer Raum sich als objektiver geschlossener konstituieren könnte, müssten alle differenziellen Positionen als spezifische und unersetzliche Momente fixiert sein, und genau dies ist nicht möglich; Laclau/Mouffe geben ein Beispiel: Die herrschende Macht in einem Kolonialland definiert sich gegenüber dem kolonisierten Volk durch Sprache, Kleidung, Hautfarbe, eigenen Gebräuchen. Diese Differenzen sind durch die Unterscheidung Kolonisator/kolonisiertes Volk äquivalent, sie bilden eine Äquivalenzkette, und die Differenzen heben sich durch diesen gemeinsamen Bezugspunkt auf.“44
Während es für den Liberalismus keinen Antagonismus in der Gesellschaft gibt, schränkt ihn der Marxismus auf die Klassenfrage ein. Laclau/Mouffe orten den Antagonismus nicht bloß auf der Klassenebene, für sie gibt es eine Vielzahl von Antagonismen. Zudem behaupten sie, dass zwar bestimmte Antagonismen abgeschafft werden können, dass der Antagonismus aber niemals aus der Gesellschaft entfernt werden kann. Daher gibt es auch keine Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Antagonismen.45
Der Antagonismus wird in zwei Haupttypen unterteilt, den popularen und den demokratischen. Die Logik des popularen Antagonismus beruht auf einer Vereinfachung des politischen Raumes, während der demokratische Antagonismus den politischen Raum zunehmend komplexer gestaltet. Der populare Antagonismus teilt den sozialen Raum in zwei entgegengesetzte Lager. Die Entwicklung der demokratischen Positionen seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in den Ländern des entwickelten Kapitalismus haben jedoch die zunehmende automatische Einheit um einen popularen Pol zunehmend abgeschwächt. Die Bedingungen des politischen Kampfes in modernen Demokratien trennen die Gesellschaft nicht mehr in zwei antagonistische Lager, sondern an vielen verschiedenen Knotenpunkten, die miteinander in Beziehung stehen und eine strikte Einteilung in Freund/Feind unmöglich machen. „Dies erweitert das Feld der artikulatorischen Praxen enorm und transformiert jede Grenz-Front in etwas wesentlich Vieldeutiges und Instabiles, das beständig Verschiebungen unterworfen ist.“46 Das Auftreten antagonistischer Verhältnisse und die Instabilität dieser Grenzen sind Voraussetzungen für hegemoniale Formationen.
Eine Erklärung dafür, dass der Antagonismus niemals aus der Gesellschaft entfernt werden kann und es daher auch keine Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Antagonismen gibt, liefert Kant, dessen . Todesjahr sich heuer jährt.
„Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Kant versteht unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen; d.i. den Hang derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hiezu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften; weil er in einem solchen Zustand sich mehr als Mensch, d.i. die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzeln (isolieren); weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seiner seits zum Widerstand gegen andere geneigt ist. Dieser Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden, und, getrieben durch Ehrsucht, Herrschaft oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, ...“47
„Ohne jene, an sich zwar eben nicht sehr liebenswürdige Eigenschaft der Ungeselligkeit ... , würden in einem arkadischen Schäferleben, bei vollkommener Eintracht, Genügsamkeit und Wechselliebe, alle Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben:“48
. Hegemonie
Die Bedingungen für antagonistische Verhältnisse sind die Offenheit des Sozialen und die Existenz von artikulatorischen Praxen im Sozialen. Sind dann auch noch die Grenzen der antagonistischen Verhältnisse instabil und entwickeln sich bestimmte Momente innerhalb des Diskurs zu Knotenpunkten, kann von hegemonialen Effekten gesprochen werden. „Die Vorrangstellung erhalten hegemoniale Formationen, obwohl nicht lokalisierbar, durch Ausschlussmechanismen. In jedem gesellschaftlichen Feld werden Intelligibilitäten geschaffen, die gleichzeitig Ausschlüsse tätigen, alles, was den Bedeutungsüberschuss bedroht, wird ausgeschlossen. Die Naturalisierung mit dem Anschein des Substanzhaften ist ein Hegemonieeffekt.“49
Der Dekonstruktivismus zeigt auf, dass viele Strukturen, viele Kategorien, die sich selbst als geschlossen darstellen, in Wirklichkeit viele verschiedene Alternativen verbergen und diese unterdrücken. Sobald diese Kontingenz aufgezeigt wird, kann man sagen, „dass die Dekonstruktion den Bereich der Unentscheidbarkeit innerhalb der sozialen Verhältnisse vergrößert, die einer politischen Intervention bedürfen, aber gleichzeitig bedarf dies einer Theorie der Entscheidung: wie eine Entscheidung innerhalb eines unentscheidbaren Terrains zu treffen ist. Und das ist, was die Theorie der Hegemonie zu tun versucht.“50
„Now, if deconstruction discovers the role of the decision out of the undecidability of the structure, hegemony, as a theory of the decision taken in an undecidable terrain, requires that the contingent connections existing in that terrain are fully shown by deconstruction. ... Whereas hegemony brings us from undecidability to decidability, deconstruction shows the contingent and constitutive character of decidable hegemonic articulations by revealing the undecidability of the decision.“51
Eine hegemoniale Formation bildet sich, indem eine moralische, intellektuelle und politische Führerschaft sowie Autorität durch die Ausweitung eines Diskurses, der eine Zeit lang Elemente zu Momenten fixiert, erlangt wird. Die Autorität erlangt ihren Höhepunkt und wird zu einem hegemonialen Diskurs, wenn sich dieser zu einer sozialen Vorstellung wandelt und sich nicht nur als eine Ansammlung von politischen Positionen oder als Block konkreter sozialer Agenten präsentiert, der eine von vielen Alternativen ist, sondern sich als einzige Alternative zu totalem Chaos darstellen kann.52
Stewart Halls Analyse des Thatcherismus bietet hierfür ein gutes Beispiel. Der Thatcherismus beruhte weitgehend auf der Fähigkeit, mit sozialen Vorstellungen zu operieren. Viele politische Forderungen waren so konstruiert, dass sie mit mehr verbunden waren als ihrem vordergründigen Inhalt. Die Reformvorhaben zur Reduzierung der Autonomien der local governments wurden beispielsweise mit dem Vorwurf verbunden, dass diese Gelder für Programme verschwendeten, die nur Schwarzen, Asiaten, Gewerkschaften und Homosexuellen zugute kämen. Die „Gleichsetzung der local goverments mit homosexuellen Elementen“ muss - um Bedeutung zu erlangen - plausibel gemacht werden, und dies kann durch das Nachahmen bereits vorhandener Traditionen geschehen. In diesem Fall gelang dies vor allem durch die Anlehnung an die rassistische Tradition. „In this and many other cases, the Thatcherites demands signified an authoritarian populist common sense that responded effectively to everyday concerns about the economy, the family, race, gender and sexuality.“53
Anne Maria Smith sieht in der Dämonisierung der Homosexualität in Großbritannien von bis eine zentrale Legitimation des Thatcherismus und bezieht sich auf die neu-rechte Tradition des Dämonisierens der „inneren Feinde“ im allgemeinen und auf die Tradition des Neuen Rassismus im besonderen. Die Attacke auf die Homosexualität kann in seiner Spezifität nur im Kontext mit der partikularen britischen Politik in den ern und ern verstanden werden und glich nicht exakt jenen früherer Attacken. Wie Laclau, Mouffe und Hall denkt Smith, dass der Thatcherismus nur in Begriffen einer Hegemonietheorie verstanden werden kann.54
Je mehr sich ein hegemonialer Diskurs durch Artikulation institutionalisiert, desto mehr versuchen die politischen Agenten eines hegemonialen Diskurses, alternative Rahmenbedingungen mittels hegemonialer Praxis als illegitim, unmoralisch, irrational und zusammenhangslos darzustellen. Die Institutionalisierung einer bestimmten Artikulation kann, da sie gänzlich kontingent ist, nur durch die gewaltsame Unterdrückung von Alternativen erreicht werden. Die habituelle Wiederholung der hegemonialen Artikulation beginnt als die Regel zu operieren, die eine ahistorische und apolitische Unterscheidung zwischen dem Intelligiblen und dem Nicht-Intelligiblen installiert. Die Hegemonie hängt nicht von Popularität ab, sondern von der Normalisierung der Vorstellung, dass es keine Alternative gäbe. In Großbritannien der er war es fast unmöglich außerhalb des thatcheristischen Rahmens von Politik zu sprechen.55
Die Anstrengungen eines hegemonialen Diskurses enden aber niemals; „it remains endlessley troubled by alienation – a condition that can become acute even among its fervent supporters – disfunctional incitements, and resistances inspired by „outsiders“ discourse.“ Der Versuch, Hegemonie zu erreichen, erfordert es, viele Forderungen und Symbole zu artikulieren, auch wenn diese untereinander in antagonistischen Verhältnis stehen. Diese Antagonismen müssen neutralisiert werden, indem durch das Vorhandensein eines imaginären Feindes ein Mehr an Äquivalenz denn an Differenz erzeugt wird. Eine Kette äquivalenter Bedeutungen steht als Block anderen Äquivalenzketten gegenüber. Die beiden Logiken der Äquivalenz und Differenz begrenzen sich gegenseitig.56
Ein sehr anschauliches Beispiel, wie die Logiken Äquivalenz und Differenz angewendet werden, bieten US-amerikanische Wahlkämpfe. „Right-wing hegemonic forces in the United States, for example, are constantly faced with the challenge of redefining neo-conservatism and religious fundamentalism such that they can be integrated into a common worldview.“ Der Republikanische Präsidentschaftskandidat Bob Dole scheiterte an dem Versuch, eine mehrheitsfähige Äquivalenzkette zu erreichen, und unterlag Bill Clinton . Der Versuch der Differenz zu seinem Parteikollegen, dem Erzkonservativen Newt Gingrich, und dessen neoliberalen und rechtsextrem-populistischen Programms „Contract with America“ mit symbolischen Effekten, wie der häufigeren Besetzung von Ämtern mit ethnischen Minderheiten, die die Republikaner als Koalition auf breiter Basis zu positionieren sollte, misslang Dole.57
Ein hegemoniales Modell von Politik besteht aus einem Prozess, der auf pragmatische Weise eine Anzahl von unterschiedlichen politischen Elementen, verbunden durch Artikulation, zusammensetzt, die in dieser Weise nicht zusammenfallen müssen. Laclau nennt als Beispiel für so eine kontingente Intervention die Diskussion innerhalb der Kommunistischen Partei Italiens am Ende des Zweiten Weltkrieges. Die eine Position war, dass die Partei die Partei der Arbeiter sei und deswegen den Norden repräsentiere. „Die andere Position, die mehr Gramscianisch war ... verneinte dies und sagte; dass man die Partei im Süden aufbauen sollte, wie schwach die Arbeiterklasse dort auch immer sei. Sie behaupteten, dass es die Voraussetzung der Partei und der Gewerkschaft sein werde, das Zentrum einer Vielfalt von sozialen Initiativen darzustellen: der Kampf gegen die Mafia, der Kampf für schulische Einrichtungen usw. Der Kommunismus wurde so am Ende das vereinigende Symbol einer Vielfalt von Kämpfen, die in sich selbst keine Notwendigkeit aufweisen, auf diese Weise zusammenzufallen – es gab kein strukturelles Gesetz, das sie in diese Richtung drängte.“58
Laclau/Mouffe nehmen eine radikale anti-essentialistische Position ein. Sie leugnen nicht, dass es feste, die Gesellschaft bestimmende Strukturen gibt, sondern dass diese notwendig und unabänderlich sind. Dies trifft insbesondere auf die Wissenschaft und Technik zu, die Mittel zur Verwirklichung bestimmter Ziele zur Verfügung stellt.
„Neben den Zielen sind auch diese Mittel bezüglich ihrer Angemessenheit zu prüfen. Welche Techniken die Gesellschaft nutzen will, welche Risiken für einen bestimmten Nutzen in Kauf genommen werden sollten. Welche Techniken zur Linderung von Leid eingesetzt werden sollten und wie mit den Ambivalenzen umzugehen ist, ist in demokratischen Gesellschaften nur in einem breiten öffentlichen Diskurs zu beantworten.“59
Die Einführung neuer Technologien
Wird eine Technologie zur Schlüsseltechnologie erkoren, ranken sich mannigfaltige Hoffnungen aber auch Befürchtungen um ihre aufstrebenden Zweige. Die PID ist ein solcher Zweig in der Reproduktions-, Bio- und Gentechnologie.
In diesem Kapitel werde ich allgemein die Problematiken bei der Einführung neuer Techniken erörtern. Die Gestaltungsanstrengungen in diesem Bereich sind deshalb so schwierig, weil kein Steuerungszentrum existiert und es auch keine klaren Steuerungsziele gibt. Die technische Entwicklung wird neben dem Staat von vielen weiteren Akteuren und deren Interessenvertretungen getragen. Ein Konsens über Ziele der Technisierung ist nicht vorhanden, und auch hinter scheinbar gemeinsamen Zielen können sich eine Vielzahl individueller Einzelinteressen verbergen. Meine Bemühungen gehen nicht dahin, durch eine Art Systemanalyse ein umfassendes Erklärungsmodell für die Einführung neuer Technologien zu bieten. Es soll vielmehr gezeigt werden, dass Politik weiter aufgefasst werden muss, auch oder gerade in technischen Bereichen, die eng mit der Wissenschaft verbunden sind, welche vielerorts noch immer den Nimbus „der reinen Lehre im Dienste der Menschheit“ trägt.
Zunächst werde ich mich durch einen zeitgeschichtlichen Abriss mit dem Begriff Technik auseinandersetzen. In dem Abschnitt „Technoloy policy“ thematisiere ich die Bedeutung von Wissenschaft und Technologie als Themen der Politik. Im darauffolgenden Abschnitt werde ich die „Technikfolgenabschätzung“ (TA) im allgemeinen sowie ihre Methoden, Ansatzpunkte, Institutionalisierung darstellen. Dieser Abschnitt dient zudem als Vorlage, die PID als Technik - im Sinne der TA - im vierten Kapitel darlegen zu können.
Die Entstehung, Durchsetzung und Gestaltung neuer Technologien ist ein komplizierter Prozess - ganz besonders in Bezug auf Querschnittstechnologien - an denen eine Vielzahl von Akteuren und Determinanten beteiligt sind. Weder kann einigen Akteuren - wie beispielsweise dem Staat, der Industrie oder der Wissenschaft - ein kausales Steuerungspotential zugeschrieben werden, noch kann eine völlige Unsteuerbarkeit der Technik behauptet werden. Die Macht der verschiedenen Gruppen zur Durchsetzung der eigenen Interessen muss als etwas analysiert werden, das zirkuliert und in einer Art von Kette funktioniert, und über eine netzförmige Organisation ausgeübt wird.
In diesem Prozess wird sogenannten Leitbildern eine bedeutende Rolle für die Technikentwicklung zugesprochen. Diese Leitbilder stecken das Handlungsfeld ab, auf dem sich die Akteure bewegen sollen, und geben das Ziel, die grundlegende Handlungsrichtung, an. Wie bei jeder neuen Technologie können neben den gewünschten positiven Effekten auch unerwünschte Folgen eintreten.
Die Dynamik bei der Einführung neuer Technologien wird einerseits durch die vielen Akteure, sowie andererseits durch Rahmenbedingungen wie etwa Markt, Kultur, Recht, Medien und Gesellschaft beeinflusst. Der politische Raum bei der Einführung neuer Technologien ist zunächst leer und wird erst durch Geschichten, Diskurse und Grenzziehungen begehbar gemacht. Diskurse sind Effekte von Macht, wobei Macht nicht zentralistisch ausgehend von der jeweiligen exekutiven Herrschaftsinstanz gedacht wird, sondern als eine Formation oder Vernetzung von dezentralen und diskontinuierlichen Kräfteverhältnissen.
Wissenschaft und Technologie60 zählen zu den zentralen Institutionen moderner Gesellschaften und nehmen massiven Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das Verhältnis von Wissenschaft und Technologie ist gegenwärtig durch eine Entdifferenzierung und den Interaktionscharakter von beiden geprägt.61 Unter den Etiketten der „Wissens- oder Risikogesellschaft“ erhalten Expertise und Wissen eine neue, zentrale Wertigkeit für ökonomische und politische Steuerungsprozesse.
. Technik
„Die Technik ist nicht das gleiche wie das Wesen der Technik. Das Wesen der Technik ist auch nichts Technisches. Solange wir die Technik als etwas Neutrales begreifen, sind wir ihr am ärgsten ausgeliefert.“62
„Allgemein wird der Begriff der Technik im Zusammenhang mit künstlichen Geräten, Maschinen, Herstellungsprozessen, der Nutzung natürlicher Kräfte für menschliche Zwecke verwendet. In diesem Sinne gibt es Technik, solange Kulturen existieren.“63
Der Begriff Technik stammt aus dem Griechischen und bedeutet Handwerk oder Kunstfertigkeit, und es war der griechische Philosoph Sokrates, der sich mit dem Begriff der Technik als Erster beschäftigt und ständig mit Beispielen aus dem Bereich der techne - von den Schustern bis zu den Ärzten - gearbeitet hat. In der techne ist das Wissen alles, und das Verstehen ist auch schon das Können und das Werk.64
„Wissen und Wert fallen in seiner Technikphilosophie zusammen. Wenn in der techne etwas falsch gemacht wird, gemäß der Sokratischen Technikphilosophie, dann immer deswegen, weil man nicht das nötige Wissen und Können hat.“65
Die Beziehung und zugleich Interpretation zur Technik änderte sich in der Renaissance drastisch, als die exakten Naturwissenschaften aufkamen und mit der Technik eine Einheit zu bilden begannen. Die Technik des Handwerkers früherer Zeiten, in welcher der Brauch vorherrschte, wurde zunehmend durch den Drang nach Neuem beherrscht. Die Verschmelzung von Naturwissenschaften und Technik in der Renaissance führte dazu, dass die praktische Naturbewältigung erstmals theoretisch durchdrungen wurde. Der Forscher, der Entwürfe in die Praxis umsetzt, entspringt dieser Vorstellung.
Die moderne Technik stellt sich immer neue Aufgaben, und durch das systematische Forschen wird immer Neues erprobt. Der technische Fortschritt, der zwangsläufig das Ausmaß einer permanenten technischen Revolution angenommen hat, fördert eine allgemeine Zuwendung zur Neuheit und Zukunft überhaupt, während die technische Exaktheit die Massenproduktion und den Massenkonsum herbeiführte.66
Ab dem . Jahrhundert wurde technischer mit gesellschaftlichem Fortschritt gleichgesetzt, es erfolgte eine zunehmende systemhafte gesellschaftliche Verflechtung, und so kann heute die Technik nicht mehr von der Philosophie, Soziologie, Psychologie, Umwelt und Gesellschaft getrennt betrachtet werden. Die Technikeuphorie des . Jahrhunderts ebbte jedoch in den frühen er Jahren ab.
„Im Verlauf der siebziger Jahre trat die Frage auf, ob die Menschheit alles, was ihr technisch möglich ist, auch tun soll. erschien der aufsehenserregende Bericht des „Club of Rome“ mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“, der die Begrenztheit natürlicher Rohstoffvorkommen und die Belastbarkeit der Umwelt drastisch beschreibt.“67
[...]
1 Die Biotechnologie hat eine lange Tradition, die weit über diejenige der Gentechnologie hinausreicht. Mit Biotechnologie wird in dieser Arbeit der mit der Gentechnik überlappende Teil gemeint: Für biotechnologische Prozesse werden häufig gentechnisch veränderte Organismen eingesetzt. Biotechnologie und Gentechnologie werden daher oft als synonyme Begriffe bzw. als Begriffspaar benutzt.
2 Fukuyama, Francis: S.34
3 Der Standard, 5.6.2004
4 Bech, Dyrberg in Marchart Oliver(Hg.): S.25
5 Das deutsche Embryonenschutzgesetz von 1990 verbietet die Durchführung einer PID zwar nicht explizit (u.a. weil die Technik zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr weit entwickelt war), die Mehrheit der Experten geht jedoch von einem ableitbaren Verbot aus. TAB Arbeitsbericht Nr.94, (Hg.) Hennen, Sauter, 2004, S. 10
6 Der Standard, 26.7.2004,
7 Die Presse, 15.01.2004
8 Rohe, Karl: S. 13
9 Gottweis, Herbert in Klom, Katja: S.5
10 Mouffe-Laclau-Interview: S.6
11 Kampf soll eine soziale Beziehung insoweit heißen, als das Handeln an der Absicht der Durchsetzung des eigenen Willens gegen Widerstand des oder der Partner orientiert ist. Beziehungen existieren nur als menschliches Handeln bestimmten Sinngehalts, und ein Kampf zwischen ihnen bedeutet, dass eine bestimmte Art des Handeln durch eine andere, sei es gleicher oder anderer Menschen, im Laufe der Zeit verdrängt wird. Weber, Max: S. 65
12 Meschnigg, Gerhard: S.4ff
13 ..., dessen Beispiel mit dem Mauerbau zeigen soll, dass jede soziale Handlung in einc Bedeutungsfeld eingebettet ist. Es besteht kein Unterschied ob ein Stein im Gegenzug zu einer Bitte gereicht und dann der Mauer hinzugefügt wird. Der Mauerbau ist das Entscheidende. Marchart, Oliver in Marchart (Hg.): S.18
14 Hamann, Julia: S.2
15 Es ist kein Zufall, dass die grundlegende Behauptung von Hegemonie – Gesellschaft existiert nicht – den Lacanschen Satz – Die Frau existiert nicht – evoziert. Die wahre Errungenschaft von Hegemonie ist im Konzept „sozialer Antagonismen“ kristallisiert: weit davon entfernt, alle Realität auf eine Art Sprachspiel zu reduzieren, verstehen sie das sozio-symbolische Feld so, dass es um eine bestimmte traumatische Unmöglichkeit herum strukturiert ist, um einen bestimmten Riß, der nicht symbolisiert werden kann. Zizek Slavoj in Marchart (Hg.): S.123
16 Meschnigg, Gerhard: S.6ff
17 Für Laclau stellt die Psychoanalyse eine Art Erweiterung des ontologischen Horizontes des abendländischen Denkens dar, wie etwa die platonische Philosophie die griechische Mathematik oder hinter dem Kantianismus die newtonsche Physik den ontoligischen Horizont bildet, lässt sie sich nicht auf das Feld ihrer ursprünglichen Formulierung reduzieren. Was Lacan für Laclau so interessant macht, ist die Einführung der modernen Linguistik in die Theorie des Unbewussten, namentlich das Konzept des Unbewussten als Signifikantenkette. Lacan als Exeget Freuds lässt keinen Zweifel daran, dass die Mechanismen, die das Unbewusste gewissermaßen regieren sprachliche Funktionen sind, wie sie von der Linguistik aufgezeigt werden. Meschnigg, Gerhard: S.40,41
18 Meschnigg, Gerhard: S.10ff
19 Ebd.: S.12
20 Ebd.: S.18
21 Knoche, Stefan: S.17
22 Mouffe, Chantal: S.26ff
23 Ebd.: S.27ff
24 Ebd.: S.28
25 Ebd.: S.33ff
26 Torfing, Jacob: S. 84
27 Ebd.: S. 85
28 Ebd.: S.86
29 Laclau/Mouffe: S.159
30 Meschnigg, Gerhard: S.9
31 vgl. Zizek Slavoj in Marchart (Hg.): S.12-25
32 Laclau /Mouffe: S. 277
33 Hamann, Julia: S.2
34 Torfing, Jacob: S.92,93
35 Ebd.: S.92
36 Huemer, Peter: S.10
37 Hamann, Julia: S.3
38 Meschnigg, Gerhard: S.12
39 Als Beispiel greift Zizek den Klassenantagonismus auf. „Sobald ich mich selbst - in einer ideologischen Anrufung - als „Proletarier“ anerkenne, bin ich an der sozialen Realität beteiligt, kämpfe gegen den „Kapitalisten“, der mich daran hindert, mein menschliches Potential voll zu realisieren, der meine Entwicklung blockiert. Wo liegt hier die der Subjektposition eigene ideologische Illusion? Sie liegt genau in der Tatsache, dass es der „Kapitalist“ ist, dieser externe Feind, der mich daran hindert, meine Selbstidentität zu erreichen: die Illusion ist, dass ich nach der eventuellen Vernichtung des antagonistischen Feindes endlich den Antagonismus loswerden und eine Identität mit mir selbst erreiche.“ Zizek, Slavoj in Marchart (Hg.): S.126
40 Zizek, Slavoj in Marchart (Hg.): S.123
41 Ebd.: S.127
42 Laclau/Mouffe: S. 181
43 Mouffe-Laclau-Interview: S.20
44 Meschnigg, Gerhard: S.14
45 Mouffe-Laclau-Interview: S.20
46 Laclau/Mouffe: S.175
47 Kant, Immanuel: S.143
48 Ebd.: S.144
49 Meschnigg, Gerhard: S.18
50 Mouffe-Laclau-Interview: S.32
51 Torfing, Jacob: S.103
52 Smith, Anna Maria: S.171
53 Ebd.: S.171
54 Smith, Anna Maria in Marchart (Hg.): S.227
55 Ebd.:c S. 232
56 Smith, Anna Maria: S.173
57 Ebd.: S. 176
58 Mouffe-Laclau-Interview: S.32
59 Elstner, Marcus: in Elstner Marcus (Hg.): S.1
60 Aus sprachlogischen und fachgeschichtlichen Gründen sollte der Begriff Technologie als Betriebswissenschaft von der Technik verstanden werden.
61 Gottweis, Herbert in Dachs, Herbert (Hg.): S. 652, 653
62 Heidegger, Martin: Die Frage nach der Technik, 1954. in Bechara, John, S. 24
63 Bechara, John: S. 26
64 Ebd.: S. 20
65 Ebd.: S. 20
66 Ebd.: S. 28
67 Klom, Katja: S.48
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832487584
- ISBN (Paperback)
- 9783838687582
- Dateigröße
- 744 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Human- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- präimplantationsdiagnostik in-vitro-fertilissation technikfolgenabschätzung eugenik hfeact eschg
- Produktsicherheit
- Diplom.de