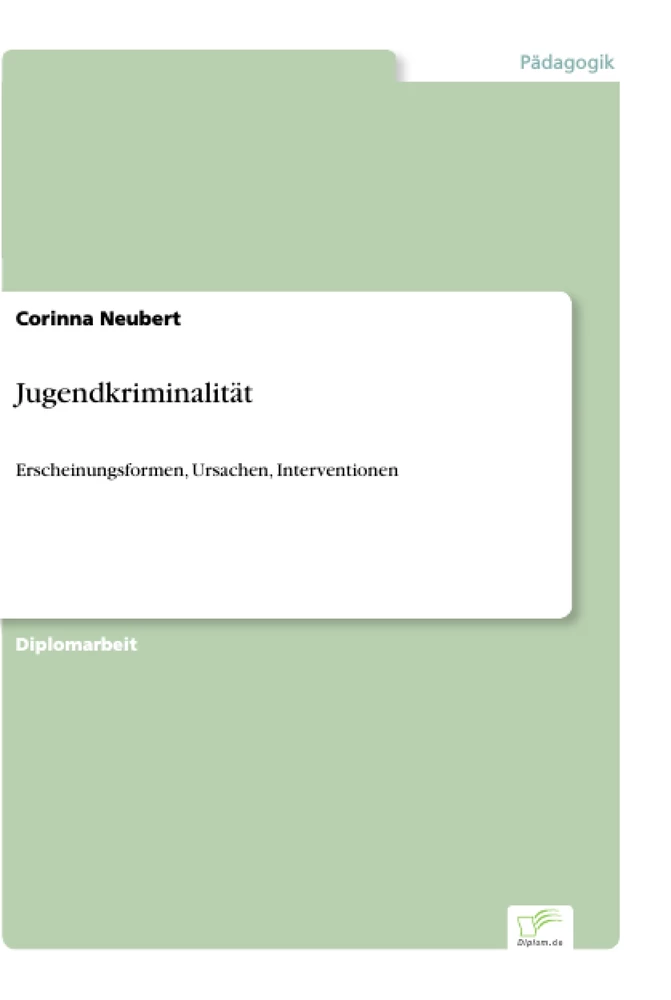Jugendkriminalität
Erscheinungsformen, Ursachen, Interventionen
©2004
Diplomarbeit
73 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Mit der Titelwahl dieser Arbeit soll auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass im Bereich der Jugendkriminalität effektivere Lösungswege anzustreben wären. Dieses Thema ist mit Sensibilität und Feingefühl zu bearbeiten, weil es sich um eine Klientel handelt, bei welcher die Persönlichkeit noch nicht völlig ausgereift ist. In den letzten Jahren hat die Beschäftigung und Behandlung mit dem Bereich der Jugendkriminalität an Aktualität gewonnen. Es gibt einige wichtige Studien, die sich mit dem Problem der zunehmenden und teilweise immer gewalttätigeren Jugenddelinquenz beschäftigen. Diese zieht die Autorin heran, um die Hintergründe und die Beschaffenheit der Jugendkriminalität zu beleuchten. Sie ist differenziert zur Erwachsenenkriminalität zu betrachten.
Um so mehr erfordert dieser Bereich, wenn es um eine Strafzumessung geht, eine reflektierende Herangehensweise, was bedeutet, dass urteilende Institutionen zweimal nachdenken und sich selbst reflektieren müssten, bevor Urteile gesprochen werden. Denn ...nur wer mindestens zweimal denkt (= versteht), dürfte urteilen dürfen... (Horst Schüler-Springorum, 1991). In dieser Arbeit geht es nicht um die Suche nach einem Patentrezept. Selbst wenn der Wunsch nach einem Konzept zur Verbrechensbekämpfung vorhanden ist, wird die Leistung der folgenden Arbeit darin liegen, die Vor- und Nachteile bzw. die Wirksamkeit bestehender Reaktionen auf Kriminalität zu skizzieren sowie Vorschläge für die zukünftige Vorgehensweise in der Bekämpfung von Jugendkriminalität zu unterbreiten.
Die folgende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil beschreibt den Unterschied zwischen der Jugend- und Erwachsenenkriminalität. Die Beschäftigung mit der Jugendphase führt zu einem näheren Verständnis dieser Klientel. Die Autorin weist auf die innere Motivation Jugendlicher zu kriminellen Handlungen hin, durch welche Jugendkriminalität in einem anderen Licht dargestellt wird. Es werden typische Eigenschaften, die für die Jugendphase ausschlaggebend sind, beschrieben. Mit dieser Darstellung versucht die Autorin die klare Abgrenzung zur Erwachsenenkriminalität vorzunehmen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Ursachen, die zu kriminellen Handlungen Jugendlicher führen können, beschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren und Bedingungen, die zusammen wirken und nicht isoliert betrachtet werden können. Die Ursachenforschung dieser Arbeit geht auf einige Wichtige ein und beginnt mit der Suche […]
Mit der Titelwahl dieser Arbeit soll auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass im Bereich der Jugendkriminalität effektivere Lösungswege anzustreben wären. Dieses Thema ist mit Sensibilität und Feingefühl zu bearbeiten, weil es sich um eine Klientel handelt, bei welcher die Persönlichkeit noch nicht völlig ausgereift ist. In den letzten Jahren hat die Beschäftigung und Behandlung mit dem Bereich der Jugendkriminalität an Aktualität gewonnen. Es gibt einige wichtige Studien, die sich mit dem Problem der zunehmenden und teilweise immer gewalttätigeren Jugenddelinquenz beschäftigen. Diese zieht die Autorin heran, um die Hintergründe und die Beschaffenheit der Jugendkriminalität zu beleuchten. Sie ist differenziert zur Erwachsenenkriminalität zu betrachten.
Um so mehr erfordert dieser Bereich, wenn es um eine Strafzumessung geht, eine reflektierende Herangehensweise, was bedeutet, dass urteilende Institutionen zweimal nachdenken und sich selbst reflektieren müssten, bevor Urteile gesprochen werden. Denn ...nur wer mindestens zweimal denkt (= versteht), dürfte urteilen dürfen... (Horst Schüler-Springorum, 1991). In dieser Arbeit geht es nicht um die Suche nach einem Patentrezept. Selbst wenn der Wunsch nach einem Konzept zur Verbrechensbekämpfung vorhanden ist, wird die Leistung der folgenden Arbeit darin liegen, die Vor- und Nachteile bzw. die Wirksamkeit bestehender Reaktionen auf Kriminalität zu skizzieren sowie Vorschläge für die zukünftige Vorgehensweise in der Bekämpfung von Jugendkriminalität zu unterbreiten.
Die folgende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil beschreibt den Unterschied zwischen der Jugend- und Erwachsenenkriminalität. Die Beschäftigung mit der Jugendphase führt zu einem näheren Verständnis dieser Klientel. Die Autorin weist auf die innere Motivation Jugendlicher zu kriminellen Handlungen hin, durch welche Jugendkriminalität in einem anderen Licht dargestellt wird. Es werden typische Eigenschaften, die für die Jugendphase ausschlaggebend sind, beschrieben. Mit dieser Darstellung versucht die Autorin die klare Abgrenzung zur Erwachsenenkriminalität vorzunehmen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Ursachen, die zu kriminellen Handlungen Jugendlicher führen können, beschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren und Bedingungen, die zusammen wirken und nicht isoliert betrachtet werden können. Die Ursachenforschung dieser Arbeit geht auf einige Wichtige ein und beginnt mit der Suche […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8731
Neubert, Corinna: Jugendkriminalität - Erscheinungsformen, Ursachen, Interventionen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Freie Universität Berlin, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
2
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGEN ... 3
EINLEITUNG... 4
1
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN JUGEND- UND ERWACHSENENKRIMINALITÄT ... 8
2
URSACHEN DER JUGENDKRIMINALITÄT ... 12
2.1
Soziale Ursachen ... 13
2.2
Jugendliche als Opfer familiärer Gewalt... 19
2.3
Jugendliche in unserer heutigen Gesellschaft... 24
3
BESCHAFFENHEIT DER JUGENDKRIMINALITÄT... 26
3.1
Untersuchungen zur Jugenddelinquenz... 26
3.2
Zur polizeilichen Kriminalstatistik ... 32
4
AMBULANTE MAßNAHMEN IM JUGENDSTRAFRECHT... 34
4.1
Der Täter- Opfer- Ausgleich ... 35
4.2
Der Soziale Trainingskurs... 42
4.3
Ambulante Maßnahmen vs. Strafrechtliche Maßnahmen ... 47
5
WIE IST ZUKÜNFTIG MIT STRAFFÄLLIGEN JUGENDLICHEN UMZUGEHEN? ... 52
5.1
Kriminalprävention im Vordergrund... 53
5.1.1
Schulschwänzerprogramm ... 56
5.1.2
Jugendrechtshäuser ... 59
6
ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION ... 62
LITERATURVERZEICHNIS... 65
ANHANG... 69
3
Abkürzungen
BKA
Bundeskriminalamt
bzw.
beziehungsweise
d.h.
das
heißt
DVJJ
Deutsche
Vereinigung
für
Jugendgerichte
und
Jugendgerichtshilfen
e.V.
Hrsg.
Herausgeber
KFN
Kriminologisches
Forschungsinstitut Niedersachsen
KJHG
Kinder-
und
Jugendhilfegesetz
PKS
Polizeiliche
Kriminalstatistik
PSB
Periodischer
Sicherheitsbericht
sog.
sogenannte
TOA
Täter-
Opfer-
Ausgleich
u.a.
und
andere
usw.
und
so
weiter
u.v.m.
und
vieles
mehr
vgl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
4
Einleitung
Mit der Titelwahl dieser Arbeit soll auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass im
Bereich der Jugendkriminalität effektivere Lösungswege anzustreben wären. Dieses The-
ma ist mit Sensibilität und Feingefühl zu bearbeiten, weil es sich um eine Klientel handelt,
bei welcher die Persönlichkeit noch nicht völlig ausgereift ist. In den letzten Jahren hat die
Beschäftigung und Behandlung mit dem Bereich der Jugendkriminalität an Aktualität ge-
wonnen. Es gibt einige wichtige Studien, die sich mit dem Problem der zunehmenden und
teilweise immer gewalttätigeren Jugenddelinquenz beschäftigen. Diese zieht die Autorin
heran, um die Hintergründe und die Beschaffenheit der Jugendkriminalität zu beleuchten.
Sie ist differenziert zur Erwachsenenkriminalität zu betrachten. Um so mehr erfordert die-
ser Bereich, wenn es um eine Strafzumessung geht, eine reflektierende Herangehensweise,
was bedeutet, dass urteilende Institutionen zweimal nachdenken und sich selbst reflektie-
ren müssten, bevor Urteile gesprochen werden. Denn "...nur wer mindestens zweimal
denkt (= versteht), dürfte urteilen dürfen..." (Horst Schüler- Springorum, 1991, S.280). In
dieser Arbeit geht es nicht um die Suche nach einem Patentrezept. Selbst wenn der
Wunsch nach einem Konzept zur Verbrechensbekämpfung vorhanden ist, wird die Leis-
tung der folgenden Arbeit darin liegen, die Vor- und Nachteile bzw. die Wirksamkeit be-
stehender Reaktionen auf Kriminalität zu skizzieren sowie Vorschläge für die zukünftige
Vorgehensweise in der Bekämpfung von Jugendkriminalität zu unterbreiten.
Die folgende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil beschreibt den Unterschied
zwischen der Jugend- und Erwachsenenkriminalität. Die Beschäftigung mit der Jugend-
phase führt zu einem näheren Verständnis dieser Klientel. Die Autorin weist auf die innere
Motivation Jugendlicher zu kriminellen Handlungen hin, durch welche Jugendkriminalität
in einem anderen Licht dargestellt wird. Es werden typische Eigenschaften, die für die Ju-
gendphase ausschlaggebend sind, beschrieben. Mit dieser Darstellung versucht die Autorin
die klare Abgrenzung zur Erwachsenenkriminalität vorzunehmen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Ursachen, die zu kriminellen Handlungen Jugendli-
cher führen können, beschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren und Bedingungen, die
zusammen wirken und nicht isoliert betrachtet werden können. Die Ursachenforschung
dieser Arbeit geht auf einige Wichtige ein und beginnt mit der Suche nach den sozialen
Ursachen, die hinter einer vermehrten Kriminalitätsbereitschaft stehen können. Es folgt die
Beleuchtung der familiären Situation, denn die Erfahrung von innerfamiliärer Gewalt kann
als weitere Ursache der Kriminalität aufgeführt werden.
5
Dabei geht es nicht nur um die selbst erlebte Gewalt, sondern auch um die beobachtete
Gewalt zwischen den Eltern. Die These, dass die jugendlichen Täter oft erst Opfer von
erwachsener Gewalt sind, wird überprüft. Die Gewalterfahrungen müssen in Verbindung
mit elterlicher emotionaler Vernachlässigung gesehen werden. Die Bedeutung der Eltern-
Kind- Beziehung wird aus bindungstheoretischer Sicht erklärt. In einem letzten Schritt
betrachtet die Autorin die Jugendlichen in der heutigen Gesellschaft. Die Veränderung der
wirtschaftlichen Lage führt zu Anpassungsproblemen. Die finanziellen Möglichkeiten und
die Arbeitsmarktlage entsprechen nur noch selten den Ansprüchen und Bedürfnissen unse-
rer Gesellschaft. Für den Menschen stellt sich dieser Wandel als Herausforderung dar. Die-
se schwierige Situation muß überwunden werden. Jugendliche besitzen noch nicht die in-
nere Festigkeit und das Selbstwertgefühl, sich dem Lebensstil, der auf Statuskriterien auf-
gebaut ist, zu entziehen. Sie benötigen zur besseren Vorbereitung auf die schwierige Ar-
beitsmarktlage ebenso Hilfe bei der Orientierung und der Suche nach Perspektiven. Die
Vermutung, dass die genannten Faktoren Veränderungen im Bereich der Jugendgewalt
erklären können, wird von empirischen Untersuchungen, die vom Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen (KFN) 1998 durchgeführt wurden, überprüft.
Die Beschaffenheit der Jugendkriminalität, die im dritten Teil der Arbeit beschrieben wird,
weist auf die Form bzw. Qualität jugendlicher Kriminalität hin, die anhand der Polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS) aufgeführt wird. Die PKS ist die häufigst verwendete Krimi-
nalstatistik. Kriminalstatistiken sind amtliche Statistiken und geben im weitesten Sinne
Aufschluss über Täter, Opfer , Fälle, Verfahren, Schäden und Rechtsfolgen. Die PKS im
engeren Sinne umfasst alle der Polizei bekanntgewordenen Vorgänge und enthält Informa-
tionen zu Fällen, Tatverdächtigen und Opfer. Die Aussagekraft der PKS wird durch die
Dunkelfeldproblematik deutlich eingeschränkt, denn es handelt sich nur um die polizeilich
registrierte Kriminalität (sog. "Hellfeld"- Kriminalität), die in der PKS aufgenommen wird.
Straftaten, die der Polizei verborgen bleiben, bewegen sich im Dunkelfeld. Das Dunkelfeld
kann sich durch die Änderung des Anzeigeverhaltens in der Bevölkerung und der Intensität
der Verbrechensbekämpfung (polizeiliche Kontrolle) verschieben bzw. "aufhellen". Eine
exakte Darstellung der Verbrechenswirklichkeit ist nicht gegeben, jedoch wird der Versuch
unternommen, so nah wie möglich an der Realität heran zu kommen. Mit sog. Dunkelfeld-
studien kann die Hellfeldkriminalität in der PKS überprüft werden.
Hierzu zieht die Autorin Analysen, die vom Kriminologischen Forschungsinstitut Nieder-
sachsen zur Polizeilichen Kriminalstatistik mit den Schwerpunkten Jugendkriminalität
6
durchgeführt wurden, heran. Alltägliche Aussagen, wie die Jugendkriminalität sei gewalt-
tätiger geworden, werden überprüft.
Im vierten Teil werden Reaktionsweisen auf jugendliche Kriminalität beschrieben, wobei
strafende und ambulante Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Zuvor
folgt eine Darstellung ambulanter Maßnahmen im Jugendstrafrecht. Die Autorin befasst
sich mit dem Täter- Opfer- Ausgleich und dem Sozialen Trainingskurs. Während der Tä-
ter- Opfer- Ausgleich auf die Aufarbeitung der in der Vergangenheit liegenden Tat abzielt,
richtet sich der Soziale Trainingskurs auf die Zukunft. Der Täter soll zu einer Verhaltens-
änderung bewegt werden. Der Erfolg dieser Maßnahmen wird mit dem Erfolg strafender
repressiver Reaktionen (Jugendarrest und Jugendgefängnis) verglichen.
Die Frage, wie in Zukunft der Umgang mit straffälligen Jugendlichen geregelt werden
müsste, führt im fünften Teil nicht unbedingt zu einer klaren Antwort. Es werden Wege
skizziert, die sich vordergründig auf die Kriminalprävention beziehen. Es geht um ein A-
gieren im Vorfeld, d.h. um ein Abfangen Jugendlicher, bevor sie die Flucht in eine krimi-
nelle Karriere suchen. Soziale Institutionen werden eingebunden und gleichsam zur Ver-
antwortung gezogen. Gerade weil die Kriminalität junger Menschen meist von Faktoren
abhängt, die von gesellschaftlichen Entwicklungen im weitesten Sinne bestimmt werden,
besteht die präventive Bedeutung in einem Zusammenwirken aller an Erziehung, Sozialisa-
tion und Bildung Beteiligter. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und ein Mehr an Reaktio-
nen und Kontrolle werden diskutiert.
Zur Eingrenzung des Themas ist zu sagen, dass sich die Autorin auf die Kriminalität be-
zieht, welche sich im leichten bis mittlerem Deliktbereich bewegt. Schwere Delikte, wie
Mord, Totschlag und Triebtaten werden ausgeschlossen. Es handelt sich bei der Jugend-
kriminalität, wie auch in der PKS dargestellt, quantitativ vor allem um Diebstahlskrimina-
lität. Eine beängstigende Entwicklung ist bei der Körperverletzung zu verzeichnen, was die
Autorin dazu veranlasst, auch auf diesen Deliktbereich einzugehen. Des Weiteren wird die
Kriminalität Jugendlicher allein in Deutschland dargestellt. Obgleich es sehr interessant
wäre, Vergleiche anderer Nationen heranzuziehen, wird die Autorin gezwungen, ihre Ar-
beit aufgrund des Umfangs einzugrenzen. Bevor sich der Leser auf die folgende Arbeit
einlässt, sind noch einige Definitionen und Abgrenzungen zu folgenden Begriffen anzufüh-
ren. Begriffe, wie Delikt, Delinquenz oder Devianz werden teilweise synonym gebraucht,
tatsächlich sind sie jedoch nicht kongruent. Ein Delikt bezeichnet eine Straftat, d.h. ein
rechtwidriges schuldhaftes Verhalten. Die Delinquenz (straffälliges Verhalten) wird als
Gegenstück zum Delikt bei Jugendlichen gebraucht.
7
Die Devianz schließlich umfasst jegliches abweichende Verhalten. Dieses ist nicht nur im
Bereich der Kriminalität anzusiedeln, sondern bezieht sich ebenso auf Regelverstöße im
zwischenmenschlichen Bereich, die nicht formell sanktioniert werden, d.h. keine Straftat
darstellen. Kriminalität orientiert sich im wesentlichen an der Definition der Straftat. Mit
Kriminalität sind sämtliche Rechtsverletzungen gemeint.
8
1 Der Unterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenkriminalität
Die Jugendkriminalität umfasst das strafbare Verhalten junger Menschen. Dazu zählen
Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) und Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre), wobei
das Altersspektrum auch Kinder (unter 14 Jahre) einschließt. Bei der Jugendkriminalität
handelt es sich zumeist um ein vorübergehendes Phänomen. Sie ist ubiquitär und episo-
denhaft, so Nickolai. Ubiquitär bedeutet, es ist normal, dass Jugendliche im Laufe ihrer
Entwicklung einige Straftaten begehen und episodenhaft meint, dass es zur Jugendphase
gehört, mit Grenzen zu experimentieren und auch straffällig zu werden, bis zur Überwin-
dung des schwierigen Prozesses des Hineinwachsens in das Erwachsenenalter, an dessen
Ende eine Abnahme jugendlicher Straftaten zu verzeichnen ist (vgl. Nickolai in Nickolai
und Reindl 1999). Die Jugenddelinquenz setzt sich meist nicht in Erwachsenenkriminalität
fort. Die Autorin zieht zur Erklärung dieser speziellen Jugendphase jugendpsychologische
Erkenntnisse heran und stellt mit Hilfe der Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
die Kriminalität Jugendlicher dar.
Das Jugendalter grenzt sich von anderen Altersgruppen ab. Es wird aus entwicklungspsy-
chologischer Sicht als Übergangsphase zwischen der Kindheit und der Erwachsenenwelt
gesehen. Mit dem Jugendalter verbindet sich der Wunsch, von Erwachsenen ernst genom-
men zu werden. Es gehört zur Jugendphase Grenzsituationen erleben zu wollen, was auch
zur besseren Orientierung dient. Ein erhöhtes Risikoverhalten führt zum Experimentieren
mit Grenzen. Nach Heckner sind der Umgang mit Drogen oder ein delinquentes Verhalten
typische Merkmale dieser Experimentierfreudigkeit (vgl. Heckner in DVJJ- Baden- Würt-
temberg 1999, S.16). Jugendliche benötigen Räume, in denen man Abenteuer und Risiko
ausreizen kann. Unsere Gesellschaft kennzeichnet sich durch eine Erlebnis- und Erfah-
rungsarmut. Heckner hält beispielsweise abenteuerliche Ausflüge in der Natur für eine
wichtige Erfahrung. Hier können Jugendliche bei Bergbesteigungen oder Wildwasserfahr-
ten Gefahren erleben und meistern. Aber auch das Aufgehen in einer bestimmten Tätigkeit
ist hier einzuordnen. Sie erleben durch das Bewältigen herausfordernder Aufgaben eine
Selbstbestätigung. Diese erlebnispädagogischen Wege, die Heckner beschreibt, stellen
alternative Grenzsituationen dar, die ein Umlenken von delinquenten Verhaltensweisen
bewirken können. Jugendliche zeichnen sich aber nicht nur durch ein experimentierfreudi-
ges Verhalten aus. Die Beziehung zu den Erwachsenen wird, so Heckner, gleichsam auf
die Probe gestellt. Jugendliche erwarten von Erwachsenen ein konsequentes Verhalten,
welches eine klare Grenzweisung beinhaltet. Sie möchten als autonome Wesen anerkannt
9
werden, an Prozesse, die sie betreffen, beteiligt werden und gleichsam Selbständigkeit er-
fahren, so Heckner.
Jugendliche erwarten von den Erwachsenen, dass diese sich mit ihnen auseinander setzen.
Dabei möchten sie nicht belehrt werden, sondern überzeugende Argumente hören. Jugend-
liche legen besonderen Wert auf Ehrlichkeit und Interesse seitens der Erwachsenen. Dazu
gehört die Anerkennung ihrer Andersartigkeit. Es geht in erster Linie um eine ,,Beziehung
statt Erziehung" (Heckner in DVJJ- Baden- Württemberg 1999, S. 23).
Die Jugendphase ist nicht nur als Experimentierphase, in der Grenzen getestet und erlebt
werden, zu bezeichnen. Sie geht nach Conrads auch mit einer erhöhten Verunsicherung
einher. Es sind schwierige Entwicklungsaufgaben zu lösen, wie die Ablösung vom Eltern-
haus, der Aufbau neuer zwischenmenschlicher Beziehungen, die Eingliederung in die Ar-
beitswelt, das Finden eigener Wert- und Normorientierungen sowie die Übernahme der
Verantwortung für die eigene Existenz (vgl. Conrads in Heitmeyer u.a. 1995, S.143). Die
kindliche Abhängigkeit von den Eltern und damit die Sicherheiten gehen verloren. Diese
Krise muss überwunden werden.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht kann der Jugendliche diesen Wandel, der mit einer
Verunsicherung und Verängstigung einhergeht, überwinden, ohne dass sich eine Krise an-
bahnt, wenn genügend Sicherheiten vorhanden sind. Neuenschwander meint, dass Sicher-
heiten wie beispielsweise Werte, soziale Unterstützung oder materielle Möglichkeiten
durch vertraute Bezugspersonen, Gleichaltrige oder andere Ressourcen geboten werden
können (vgl. Neuenschwander 1996, S.13). Die Entwicklungspsychologie sieht das Ju-
gendalter als Übergang, mit dem die Kindheit abgeschlossen und das Erwachsenenleben
eingeleitet wird. Es ist eine Zeit der Veränderungen, Veränderungen im körperlichen, kog-
nitiven und sozialen Bereich (Veränderung der Qualität zwischenmenschlicher Beziehun-
gen, z.B. zu Eltern, Gleichaltrigen, Geschwistern usw.). Jugendliche neigen zu devianten
Verhalten. Das Experimentieren (von Grenzen, politischen Orientierungen, Lebensstilen
usw.) ist als wichtiger Schritt in der Suche nach einer eigenen Identität zu verstehen. Die
Beziehung zu den Eltern ist für die Identitätsentwicklung sehr wichtig. Denn Jugendliche
orientieren sich an der Lebensführung der Eltern und viel wichtiger, sie identifizieren sich
mit ihren Eltern, auch wenn mehr Zeit mit Gleichaltrigengruppen verbracht wird. Nach
Neuenschwander ist der Einfluss der Eltern auf die Einstellungen und Werte des Jugendli-
chen nicht zu unterschätzen. Ebenso wird aus bindungstheoretischer Sicht von Bowlby die
wichtige Bedeutung der Eltern für die Identitätsentwicklung postuliert. In lebenswichtigen
Entscheidungen, wie zum Beispiel Berufswahl, benötigen sie die Hilfe und den Rat der
10
Eltern (vgl. Neuenschwander 1996, S.103-104). Jugendliche brauchen Autoritätspersonen.
Eine stabile sichere Beziehung zu den Eltern kann für die Identitätsentwicklung eine zuver-
lässige Ressource darstellen. Dann findet auch eine erfolgreiche Elternablösung statt, die
als eine Entwicklungsaufgabe des Jugendalters angesehen wird. Während der Elternablö-
sung werden die Werte und Normen der Eltern hinterfragt und kritisiert. Jugendliche er-
warten von den Eltern einerseits weiterhin Unterstützung in ihrer Suche nach einer eigenen
Identität und andererseits eine stabile Wertvertretung der Eltern. ,,So müssen sie damit
klarkommen, daß sie ihre Eltern kritisieren, aber dennoch lieb haben, oder daß sie heute
Wertvorstellungen vertreten, die ihnen morgen falsch erscheinen" (Conrads in Heitmeyer
u.a. 1995, S.143). Gerade in dieser Übergangsphase ist die Anerkennung und Unterstüt-
zung ihres Umfeldes von Bedeutung. Stabile und zuverlässige Beziehungsstrukturen kön-
nen positiv wirken und dem Jugendlichen ein Gefühl von Sicherheit bieten. ,,Aus ungelös-
ten Elternablösungskonflikten können soziale Verwahrlosung, Konsum harter Drogen,
Delinquenz usw. resultieren" (Neuenschwander 1996, S.187).
Das Vorliegen einer Identitätskrise wurde u.a. von Erikson (1966) postuliert, welche auf
die pluralistische Gesellschaft mit ihrer Rollenvielfalt und Freiheit zurückzuführen ist.
Möglicherweise kann der Schwierigkeitsgrad der anstehenden Entwicklungsaufgaben in
unserer Gesellschaft, die pluralistischer und komplexer geworden ist, gewachsen sein. Dies
könnte zu einer echten Herausforderung für viele Jugendliche werden. Das Vorhandensein
einer Jugendkrise ist nicht für alle Jugendliche generalisierbar, so Neuenschwander. Sie
muss eher im individuellen Lebenslauf gesucht werden (vgl. Neuenschwander 1996, S.92-
94). Auf der Suche nach einer Identität kann eine Reaktion auf die Identitätskrise nach
Erikson die Bildung einer negativen Identität sein. Dem Jugendlichen ist es nicht so sehr
wichtig, ob er eine positive oder eine negative Identität innehat. Denn der junge Mensch
scheint es lieber vorzuziehen, eine negative Identität zu haben, anstatt keinerlei Identität
aufzuweisen (vgl. Kohlberg 2000, S.120).
,,Denn wenn man die scheinbar psychotischen oder kriminellen Vorfälle in der Adoleszenz richtig
diagnostiziert und behandelt, weisen sie nicht die gleiche fatale Bedeutung auf wie in anderen Al-
tersabschnitten. So mancher Jugendliche, der herausfindet, daß die Behörden von ihm erwarten, daß
er >ein Stromer<, >ein komischer Vogel< oder >nicht auf Draht ist<, gehorcht auf perverse Weise
und wird erst aus Trotz dazu" (Erikson 1966 in Kohlberg 2000, S.119).
Das Dilemma der Identitätskrise, das Erikson beschreibt, liegt einerseits in dem Wunsch
des Jugendlichen, seinem Leben einen Sinn zu verleihen und anderseits in der unbedingten
Suche nach einen Platz in der Gesellschaft begründet, mit der Konsequenz, dass, wenn eine
positive Identität nicht erreichbar erscheint, auch eine negative Identität angestrebt wird.
11
Der Jugendliche befindet sich in der Phase, ein Selbst zu entwickeln. In dieser Entwick-
lung sind Werte und Normen bzw. Einstellungen noch nicht verfestigt. Sie können auch
wieder verworfen werden. Diese Tatsache spricht für den Unterschied zwischen der Ju-
gend- und Erwachsenenkriminalität. Delinquentes Verhalten von Jugendlichen ist nicht als
Vorläufer von Erwachsenenkriminalität zu sehen.
Die Jugendkriminalität unterscheidet sich von der Erwachsenenkriminalität in der Qualität
und Quantität. Es handelt sich laut PKS 2002 immer noch bei der Jugendkriminalität vor
allem um Diebstahlskriminalität, obgleich die Gewaltkriminalität nicht unterschätzt wer-
den kann. Während sich nach der PKS 2002 die Erwachsenenkriminalität überwiegend im
Bereich der schweren Delikte bewegt, wie beispielsweise Mord (81,3%), Totschlag
(83,0%), Vergewaltigung (78,6%), erpresserischer Menschenraub (81,0%), Geiselnahme
(82,2%) und Körperverletzung mit Todesfolge (72,5%), ist die Jugendkriminalität lediglich
bei den Raubdelikten (minderjährige Tatverdächtige=37,4% und Heranwachsende=
19,1%) überrepräsentiert (vgl. PKS 2002, 3.18 Gewaltkriminalität, Tabelle 20 im Anhang).
Jedoch sind bei ihnen auch andere Bereiche wie Sachbeschädigung (minderjährige Tatver-
dächtige= 40% und Heranwachsende= 14,2%), ,,schwerer" Diebstahl (minderjährige Tat-
verdächtige= 33,4% und Heranwachsende= 17,7%) und gefährliche und schwere Körper-
verletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen (minderjährige Tatverdächtige= 34% und He-
ranwachsende= 19,3%) in beachtlicher Größenordnung vertreten (vgl. PKS 2002, 3.15
Sachbeschädigung, Tabelle 20; 3.7 Diebstahl unter erschwerenden Umständen, Tabelle 20;
3.4 Körperverletzung, Tabelle 20). Gewaltdelikte von Minderjährigen richten sich laut der
PKS 2002 meist gegen die eigenen Altersgenossen. Die Kriminalität Erwachsener ist ein-
deutig gewalttätiger.
Es ist ein Geflecht von Ursachen verantwortlich dafür, wenn es um Gewalt gegen bzw.
zwischen Kindern geht. Diese Bedingungsfaktoren sind in zunehmenden wirtschaftlichen
und sozialen Ungleichheiten und Benachteiligungen zu finden (vgl. nächstes Kapitel). Ei-
gene Gewalterfahrungen und soziale Benachteiligungen können sich auf die Gewaltbereit-
schaft auswirken. Man spricht oft davon, dass jugendliche Gewalttäter erst Opfer waren.
Diese Behauptung wird von der Autorin im nächsten Kapitel (2.2) überprüft. Die Erfah-
rung innerfamiliärer Gewalt führt zum Erlernen einer gezielten Konfliktlösungsstrategie.
12
2 Ursachen
der
Jugendkriminalität
Ursachenanalysen können leicht zur Verharmlosung führen, insbesondere wenn sie sich
einseitig bewegen. Es geht weder darum, jugendliche Gewalttäter einseitig als ,,Opfer"
darzustellen, noch sie als Täter zu etikettieren. Es geht auch nicht darum, die Jugendkrimi-
nalität nur als Jugendphase zu betrachten und damit das Problem lediglich als Übergangs-
phänomen zu benennen. Ein anderes Problem stellt sich jedoch dar, wenn auf komplexe
Ursachenanalysen verzichtet wird. Denn dann gewinnen Erklärungsansätze an Bedeutung,
die Gewalttätigkeit rein als Eigenschaft der Person begreifen. Die Ursachenforschung ist
ein wichtiges Hilfsmittel, auf das nicht verzichtet werden kann, gerade wenn es um die
Suche nach Lösungswegen für den Umgang mit Jugendkriminalität geht. Ihr Nutzen liegt
in der frühzeitigen Erkennung von Verhaltensauffälligkeiten Jugendlicher, was ein schnel-
les Reagieren nach sich ziehen sollte. Gerade in erzieherischer Hinsicht ist eine rasche und
konsequente Reaktion schon bei den ersten Deliktsauffälligkeiten notwendig. Es gibt eine
Vielzahl von Ursachen, die mit der Jugendkriminalität zusammen hängen und die oft zu-
sammen wirken. Ursachen können in ungünstigen Sozialisationsbedingungen, wie bei-
spielsweise Arbeitslosigkeit der Eltern oder Wohnsituation sowie in eigenen ungünstigen
Zukunftsperspektiven gründen, oder aber in der Persönlichkeit des Jugendlichen liegen,
was bedeuten kann, dass der Jugendliche eine geringe Selbstachtung und eine unzurei-
chende soziale Kompetenz aufweist. Die familiäre Gewalt, von welche insbesondere Fami-
lien in sozial prekären Lagen betroffen sind, kann als weitere Ursache im Zusammenhang
mit der Jugendkriminalität aufgeführt werden. Auch den Medien kann eine gewisse Ein-
flussmacht zugeschrieben werden, wenn nämlich Jugendliche aufgrund der in der Werbung
angepriesenen Bedürfnisorientierung einen die finanziellen Möglichkeiten übersteigenden
Lebensstil an den Tag legen, oder wenn Medien Gewalt als normale Verhaltensweise zur
Bewältigung von Problemen anpreisen und dadurch einen negativen Einfluss auf die Ju-
gendlichen ausüben. Die Autorin wird bei ihrer Ursachenforschung auf die ungünstigen
Sozialisationsbedingungen und auf die Erfahrungen der Jugendlichen mit innerfamiliärer
Gewalt und die daraus resultierenden Folgen eingehen.
13
2.1 Soziale
Ursachen
Im folgenden soll den sozialen Ursachen nachgegangen werden, die mit Jugendkriminalität
zusammenhängen. Dabei stellt sich heraus, dass es sich bei den meisten jugendlichen Tä-
tern bzw. Tatverdächtigen um solche Jugendliche handelt, die ein niedriges Bildungsni-
veau aufweisen und deren gesellschaftliche Position von relativer Armut, sozialer Aus-
grenzung und schlechten Integrationsperspektiven gekennzeichnet ist. Die soziale Integra-
tion stellt sich insbesondere bei den jungen Ausländern als Problem dar. Anhand der KFN-
Schülerbefragung von 1998 in vier Städten (Leipzig, Hamburg, Hannover und Stuttgart)
stellten Pfeiffer u.a. fest, dass es einen Zusammenhang von Gewaltbereitschaft und schwie-
riger sozialer Lage verbunden mit ungünstigen Zukunftsperspektiven gibt.
Die Jugendlichen, deren Eltern von Arbeitslosigkeit bzw. Sozialhilfe betroffen sind, sind
seltener eingebunden in Freundeskreise, weisen eine geringere Teilhabe an gesellschaftli-
chen Aktivitäten auf. Sie sind weniger in Sportverbänden integriert, was mit einer Kosten-
frage zusammenhängt (vgl. Pfeiffer u.a. 1998, S.57, Abbildung 24). Dafür besuchen diese
Jugendlichen eher Jugendzentren, die nicht verbindlich sind (vgl. Abbildung 24).
Quelle: Abbildung 24 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S.57
Die befragten Schüler äußerten selbst Sorge über ihre Zukunftsaussichten. Angesichts der
sozioökonomischen Belastungen der Familie und des niedrigen Bildungsniveaus der Ju-
gendlichen sind vermehrt Zukunftsängste bei den Jugendlichen aus Familien in sozial pre-
kären Lagen vorzufinden. Die Gewaltbereitschaft korreliert mit der schwierigen sozialen
Lage und dem niedrigen Bildungsniveau, wobei vorwiegend Ausländer betroffen sind.
14
Quelle: Tabelle 18 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S.86
Die Schülerbefragung hat bestätigt, dass jugendliche Täter meist ein niedriges Bildungsni-
veau aufweisen und dass es sich zumeist um Ausländer handelt, die als Täter von Gewalt-
delikten in Erscheinung treten. Hinzu kommt die Deliktshäufigkeit. Ausländische Jugend-
liche begehen häufiger Mehrfachtaten. Die folgende Abbildung zeigt nach einer selbstbe-
richteten Delinquenz der Schüler eine deutliche Überrepräsentation von türkischen Jugend-
lichen.
Quelle: Abbildung 49 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S.81
Wenn man sich nun den Status der Jugendlichen anschaut, fällt auf, dass wiederum die
ausländischen Jugendlichen eher von Benachteiligungen betroffen sind, wenn es um die
soziale Lage der Familien und die besuchte Schulform geht. Sie leben häufiger in Famili-
en, die von Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe betroffen sind und besuchen eher eine Schul-
form mit ungünstigen Zukunftsaussichten. Im Hinblick auf die Schülerbefragung stellte
sich heraus, dass es wiederum türkische Jugendliche sind, die häufiger mit einem unterpri-
vilegierten Status zu kämpfen haben (vgl. Abbildung 69).
15
Quelle: Abbildung 69 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S. 102
Unterprivilegierte Jugendliche weisen deutlich höhere Raten aktiver Gewalttäter auf. Diese
extreme Ungleichheit macht sich demzufolge im Gewalthandeln der Jugendlichen bemerk-
bar. Besonders deutlich tritt dies bei einzelnen Delikten in Erscheinung. Die Körperverlet-
zung nimmt im Gewaltgeschehen den Platz Nummer eins ein. Die Rate der Gewalttäter mit
unterprivilegierten Status übersteigt die Rate der Gewalttäter mit privilegierten Status um
das Dreifache (vgl. Abbildung 70).
Quelle: Abbildung 70 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S. 103
16
Begriffe wie soziale Ausgrenzung, Armut und schlechte soziale Perspektiven können kurz
mit sozialen Integrationsproblemen umschrieben werden, die, wie gezeigt, zu einem An-
wachsen der Jugendkriminalität führen können. Von dieser ungünstigen Lebenssituation
waren Anfang der 90er Jahre besonders Ausländer betroffen. Die starke Zuwanderung von
Ausländern in den 80er Jahren hat insbesondere in den 90er Jahren eine im sozialen Be-
reich belastende Situation ausgelöst, mit der überwiegend die ausländische Bevölkerung,
nachdem die soziale Integration mehr oder weniger mißlungen war, konfrontiert wurde.
Die Kriminalität ( besonders Diebstahlsdelikte) stieg an. Erst nach Änderung des Asylge-
setzes 1993 ging die Kriminalität, insbesondere die Diebstahlskriminalität, zurück. Das
starke Anwachsen der Diebstahlsdelikte ist primär auf die Zuwanderung der Asylbewerber
zurückzuführen. Die folgenden Abbildungen zeigen die polizeilich registrierten Tatver-
dächtigenzahlen einmal von 1984 bis 1993 und einmal von 1993 bis 1997.
Quelle: Abbildung 13 aus Pfeiffer, C. u.a. (1998): Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger Menschen. Kinder und
Jugendliche als Täter und Opfer 1998, S. 22
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832487317
- ISBN (Paperback)
- 9783838687315
- DOI
- 10.3239/9783832487317
- Dateigröße
- 3.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Erziehungswissenschaft und Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Mai)
- Note
- 2,7
- Schlagworte
- jugend eingreifen kontrolle überwachung
- Produktsicherheit
- Diplom.de