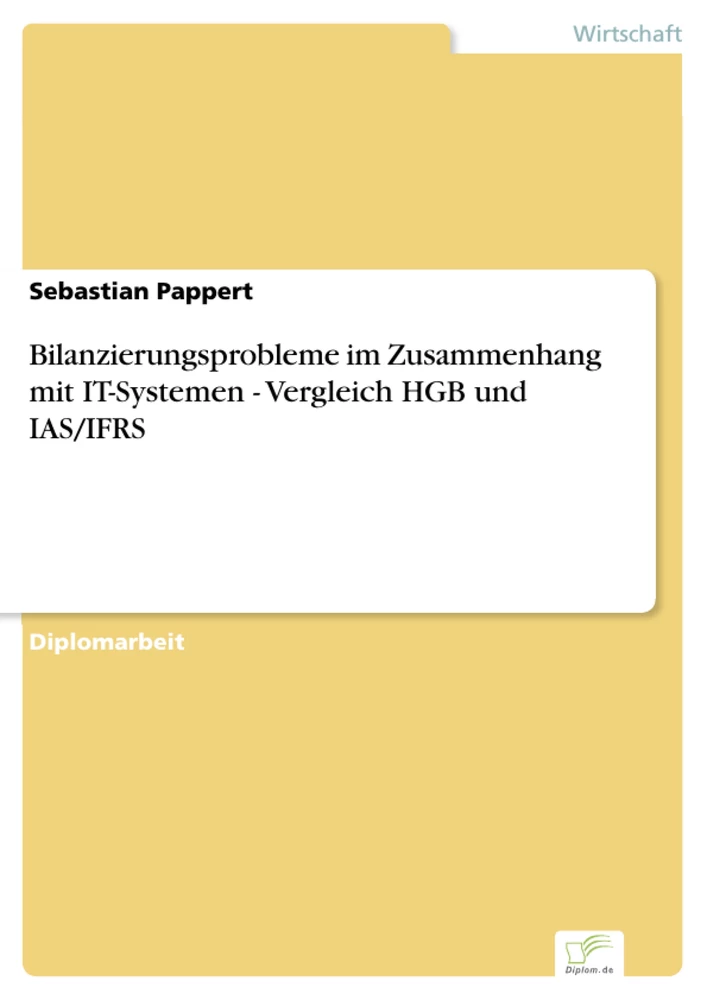Bilanzierungsprobleme im Zusammenhang mit IT-Systemen - Vergleich HGB und IAS/IFRS
©2005
Diplomarbeit
130 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die rechnergestützte Informationsverarbeitung ist aus der betrieblichen Praxis mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Jedes Unternehmen benutzt in irgendeiner Form Systeme der Informationsverarbeitung, angefangen vom einzelnen PC mit einigen Anwendungsprogrammen bis hin zu komplexen Rechnernetzen mit kostspieligen ERP-Software-Systemen zur Optimierung der Geschäftsprozesse.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausführlich mit den Problemen, die sich dem Informationstechnik anwendenden Unternehmen bezüglich des Ansatzes und der Bewertung von IT stellen. Die Betrachtung erfolgt getrennt nach den beiden Komponenten einer EDV-Anlage, der Software und der Hardware.
Hierbei werden zunächst die Begriffe Hardware und Software kurz veranschaulicht und ein grundlegender Überblick über die Rechnungslegungskonzeptionen des HGB, der IAS/IFRS und auch der US-GAAP gegeben (letztere sind jedoch nicht Bestandteil der Arbeit).
Im Bereich der Software liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit selbst erstellter Individual- bzw. umfangreich modifizierter Standardsoftware vor dem Hintergrund des Aktivierungsverbotes für unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände gem. §§ 248 Abs.2 HGB und 5 Abs.2 EStG. Es wird aufgezeigt, dass gerade im Bereich der ERP-Software die Konzeption des HGB hier oft zu Fehlinformationen im Abschluss führt. Die Alternativen, die der DRS 12 Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens sowie IAS 38 hier vorsehen, werden ausführlich dargelegt. Die Aktualität der Problematik im Hinblick auf die Software-Bilanzierung wird durch die 2004 vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichte Stellungnahme zur Bilanzierung von Software beim Anwender (IDW RS HFA 11) verdeutlicht.
Im Bereich der Hardware liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit nachträglicher Aufwendungen im Zusammenhang mit Aufrüstungen von EDV-Anlagen. Die Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand in diesem Zusammenhang wird unter anderem anhand eines vom Verfasser erstellten Beispiels anschaulich gemacht. In diesem Rahmen wird auch der Komponentenansatz des IAS 16, verbindlich anzuwenden seit dem 01.01.2005 im Rahmen der Bilanzierung von Sachanlagen, in seinen Grundzügen erklärt und kritisch beleuchtet. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die künftige Relevanz beider Systeme (HGB und IAS/IFRS) in der deutschen Rechnungslegung […]
Die rechnergestützte Informationsverarbeitung ist aus der betrieblichen Praxis mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Jedes Unternehmen benutzt in irgendeiner Form Systeme der Informationsverarbeitung, angefangen vom einzelnen PC mit einigen Anwendungsprogrammen bis hin zu komplexen Rechnernetzen mit kostspieligen ERP-Software-Systemen zur Optimierung der Geschäftsprozesse.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausführlich mit den Problemen, die sich dem Informationstechnik anwendenden Unternehmen bezüglich des Ansatzes und der Bewertung von IT stellen. Die Betrachtung erfolgt getrennt nach den beiden Komponenten einer EDV-Anlage, der Software und der Hardware.
Hierbei werden zunächst die Begriffe Hardware und Software kurz veranschaulicht und ein grundlegender Überblick über die Rechnungslegungskonzeptionen des HGB, der IAS/IFRS und auch der US-GAAP gegeben (letztere sind jedoch nicht Bestandteil der Arbeit).
Im Bereich der Software liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit selbst erstellter Individual- bzw. umfangreich modifizierter Standardsoftware vor dem Hintergrund des Aktivierungsverbotes für unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände gem. §§ 248 Abs.2 HGB und 5 Abs.2 EStG. Es wird aufgezeigt, dass gerade im Bereich der ERP-Software die Konzeption des HGB hier oft zu Fehlinformationen im Abschluss führt. Die Alternativen, die der DRS 12 Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens sowie IAS 38 hier vorsehen, werden ausführlich dargelegt. Die Aktualität der Problematik im Hinblick auf die Software-Bilanzierung wird durch die 2004 vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichte Stellungnahme zur Bilanzierung von Software beim Anwender (IDW RS HFA 11) verdeutlicht.
Im Bereich der Hardware liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Aktivierungsfähigkeit nachträglicher Aufwendungen im Zusammenhang mit Aufrüstungen von EDV-Anlagen. Die Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand in diesem Zusammenhang wird unter anderem anhand eines vom Verfasser erstellten Beispiels anschaulich gemacht. In diesem Rahmen wird auch der Komponentenansatz des IAS 16, verbindlich anzuwenden seit dem 01.01.2005 im Rahmen der Bilanzierung von Sachanlagen, in seinen Grundzügen erklärt und kritisch beleuchtet. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die künftige Relevanz beider Systeme (HGB und IAS/IFRS) in der deutschen Rechnungslegung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8665
Pappert, Sebastian: Bilanzierungsprobleme im Zusammenhang mit IT-Systemen -
Vergleich HGB und IAS/IFRS
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Fachhochschule Düsseldorf, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
LEBENSLAUF
Name: Sebastian
Pappert
Anschrift: Lindemannstraße
77
40237 Düsseldorf
Tel: 0211 158 12 12
Mobil: 0177 626 60 23
E-Mail: sebastian-p1@gmx.de
Geburtsdatum:
01. September 1975
Nationalität: deutsch
Familienstand: ledig
Sprachen:
Deutsch, Englisch, Latein
Schulischer Werdegang:
08/82 06/86
Katholische Grundschule in Rietberg
08/86 07/97
Privatgymnasium Marienschule in Lippstadt
Abschluss:
Abitur
10/98 02/02
Freie Universität Berlin
Studium
der
Volkswirtschaftslehre
03/02 03/05
Fachhochschule Düsseldorf
Studium
der
Betriebswirtschaftslehre
Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH)
Zivildienst:
07/97 08/98
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Bereich:
Schwerstbehindertenbetreuung
Nebenberufliche Tätigkeiten
während des Studiums:
07/00 10/00
Schokoblau Veranstaltungsservice GbR, Berlin
(kfm.
Praktikum)
07/01 10/01
DC Computersteuerungen AG, Salzkotten
(kfm.
Praktikum)
07/04 12/04 Studentische Aushilfe bei der Rechtsanwaltssozietät Hengeler Mueller /
Düsseldorf
Besondere Kenntnisse:
Englisch (zweimonatiger Aufenthalt in den USA) in Wort und
Schrift
Microsoft Office-Paket (Word, Excel, Outlook, Access, Powerpoint)
Berufliche Tätikgeiten:
ab 04/05
Tätigkeit als Wirtschaftsprüferassistent bei der Bavaria
Revisions- und Treuhand AG / München
Sebastian Pappert
I
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung ...1
II. Grundlagen ...3
1. Begriff der Software ... 3
1.1 Firmware ... 3
1.2 Systemsoftware... 4
1.3 Anwendungssoftware ... 4
1.3.1 Individualsoftware ... 4
1.3.2 Standardsoftware... 5
1.3.2.1 fixe Standardsoftware ... 5
1.3.2.2 variable Standardsoftware... 5
1.4 Rechtsnatur der Software... 6
2. Begriff der Hardware... 7
2.1 Die Zentraleinheit ... 8
2.2 Die Peripheriegeräte ... 9
2.3 Die externen Speicher... 9
2.4 Rechnerkategorien ... 9
2.5 Computer im Netzverbund ... 11
3. Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme HGB, US-
GAAP und IAS/IFRS... 12
3.1 Handelsgesetzbuch... 12
3.1.1 Geschichte... 12
3.1.2 Primäre Ziele und oberste Bewertungsprinzipien ... 13
3.1.3 Reformen jüngerer Zeit in Richtung internationaler Rechnungslegung
... 15
3.2 US-GAAP ... 16
3.2.1 Geschichte... 16
3.2.2 Primäre Ziele und oberste Bewertungsprinzipien ... 18
3.3 IFRS ... 19
3.3.1 Geschichte... 19
3.3.2 Primäre Ziele und oberste Bewertungsprinzipien ... 20
3.3.3 Relevanz der IFRS als länderübergreifende
Rechnungslegungskonzeption... 20
III. Bilanzierung der Software ...23
1. gemäß dem HGB... 23
1.1 Bilanzierung dem Grunde nach... 23
1.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit... 23
1.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit... 25
1.1.2.1 Abgrenzung von Anlage- und Umlaufvermögen... 25
1.1.2.2 Abgrenzung materieller und immaterieller
Vermögensgegenstände ... 27
1.1.2.3 Entgeltlicher Erwerb ... 29
1.1.2.3.1 Bedeutung des Umfangs der Verfügungsmacht über die
Software ... 29
1.1.2.3.2 Abgrenzung von Anschaffungs- und Herstellungsvorgängen
... 30
1.1.2.3.2.1 bei Individualsoftware... 30
1.1.2.3.2.2 bei fixer Standardsoftware ... 31
II
1.1.2.3.2.3 bei variabler Standardsoftware ... 31
1.1.2.3.2.3.1 Customizing - Versetzung der Standardsoftware in
den Zustand der Betriebsbereitschaft oder Herstellung einer
Individualsoftware?... 32
1.1.2.3.2.3.2 Kriterien für die Umschaffung ... 33
1.1.3 Umfang der Anschaffungskosten entgeltlich erworbener Software... 35
1.1.3.1 Anbahnung der Anschaffung... 35
1.1.3.2 Herstellung der Betriebsbereitschaft ... 36
1.1.3.2.1 Schulung des Personals software- oder
organisationsbezogener Aufwand? ... 37
1.1.3.2.2 Reorganisation des Unternehmens software- oder
organisationsbezogener Aufwand? ... 38
1.1.4 Nachträgliche Aufwendungen... 39
1.1.5 Updates und Release-Wechsel ... 39
1.2 Bilanzierung der Höhe nach ... 40
1.2.1 Erstbewertung... 40
1.2.2 Folgebewertung ... 41
1.2.2.1 planmäßige Abschreibungen... 41
1.2.2.2 außerplanmäßige Abschreibungen ... 42
1.3 Ausweis der Software... 43
1.3.1 Bilanz... 43
1.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung ... 43
1.3.3 Zusätzliche Angaben (Anhang) ... 43
1.4 Die Unterschiede der Software-Bilanzierung gemäß DRS 12 zum HGB. 44
1.4.1 Ansatz... 45
1.4.2 Bewertung ... 45
1.4.3 Ausweis ... 46
1.4.4 Empfehlungen de lege ferenda... 47
2. Bilanzierung gemäß den IFRS... 48
2.1 Bilanzierung dem Grunde nach... 48
2.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit... 48
2.1.1.1 Identifizierbarkeit: ... 49
2.1.1.2 Verfügungsmacht ... 49
2.1.1.3 künftiger wirtschaftlicher Nutzen ... 50
2.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit... 50
2.1.2.1 bei entgeltlich erworbener Software ... 50
2.1.2.1.1 Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Nutzenzuflusses ... 51
2.1.2.1.2 zuverlässige Bewertungsfähigkeit ... 51
2.1.2.1.2.1 Umfang der Anschaffungskosten ... 52
2.1.2.1.2.2 Ermittlung des fair value... 52
2.1.2.2 bei selbst erstellter Software ... 53
2.1.2.2.1 Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase ... 53
2.1.2.2.2 Kriterien für den Ansatz der Entwicklungsaufwendungen... 54
2.1.2.2.3 Abgrenzung von Forschung und Entwicklung bei Individual-
und Standardsoftware ... 55
2.1.2.2.4 Umfang der Herstellungskosten ... 58
2.1.3 nachträgliche Aufwendungen ... 58
2.2 Bilanzierung der Höhe nach ... 59
2.2.1 Erstbewertung... 59
2.2.2 Folgebewertung ... 59
2.2.2.1 Benchmark-Methode... 59
2.2.2.2 Neubewertungsmethode ... 60
III
2.2.2.3 Abschreibungen ... 61
2.2.2.3.1 planmäßig... 61
2.2.2.3.2 außerplanmäßig ... 62
2.2.2.3.2.1 Nettoveräußerungswert... 62
2.2.2.3.2.2 Nutzenwert... 63
2.2.2.3.2.3 Wertminderung einer Zahlungsmittel generierenden
Einheit... 64
2.3 Ausweis der Software... 66
2.3.1 Bilanz... 66
2.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung ... 67
2.3.3 Zusätzliche Angaben (Anhang) ... 67
IV. Bilanzierung der Hardware...70
1. gemäß dem HGB... 70
1.1 Bilanzierung dem Grunde nach... 70
1.1.1 Abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit ... 70
1.1.2 Hardware als geringwertiges Wirtschaftsgut... 71
1.1.3 Hardware als Einzelwirtschaftsgut oder als einheitliches
Wirtschaftsgut... 71
1.1.3.1 Bewertungseinheit auf der Ebene eines PCs ... 72
1.1.3.2 Bewertungseinheit auf der Ebene eines Computer-Netzwerkes 73
1.1.3.3 Verkabelung als eigenständiges Wirtschaftsgut, als Teil des
Gebäudes oder als Teil der Anlage?... 74
1.1.4 Beispiel XY-Pictures GmbH... 75
1.1.5 nachträgliche Aufrüstung der Hardware ... 76
1.1.5.1 Herstellung ... 77
1.1.5.1.1 Zweitherstellung nach technischem Vollverschleiß ... 77
1.1.5.1.2 Herstellung durch Wesensänderung ... 78
1.1.5.2 Erweiterung ... 78
1.1.5.3 Wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand
hinaus ... 79
1.1.6 Verlängerung der Nutzungsdauer infolge einer Aufrüstung ... 81
1.1.7 Nebeneinander von Herstellungs- und Erhaltungsaufwendungen... 82
1.1.8 Lösung des Beispiels... 83
1.2 Bilanzierung der Höhe nach ... 83
1.2.1 Erstbewertung... 83
1.2.2 Folgebewertung ... 84
1.2.2.1 planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen... 84
1.2.2.2 Festwertansatz... 84
1.3 Ausweis der Hardware ... 85
1.3.1 Bilanz... 85
1.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung ... 85
1.3.3 Zusätzliche Angaben (Anhang) ... 85
2. gemäß den IFRS ... 86
2.1 Bilanzierung dem Grunde nach... 86
2.1.1 Abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit ... 86
2.1.2 Nachträgliche Aufrüstung der Hardware... 86
2.1.3 Der Komponentenansatz des IAS 16... 87
2.1.3.1 Aufteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten... 88
2.1.3.2 Ermittlung der Nutzungsdauer der einzelnen Komponenten... 89
2.1.3.3 Ausnahmen vom Komponentenansatz gemäß IAS 16.45... 89
2.1.3.4 Aktivierung der Aufwendungen für Großinspektionen ... 91
IV
2.2 Bilanzierung der Höhe nach ... 93
2.2.1 Erstbewertung... 93
2.2.2 Folgebewertung ... 93
2.2.3 Abschreibungen... 93
2.2.3.1 planmäßig ... 93
2.2.3.2 außerplanmäßig ... 94
2.3 Ausweis der Hardware ... 94
2.3.1 Bilanz... 94
2.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung:... 94
2.3.3 Zusätzliche Angaben (Anhang) ... 94
V. Zusammenfassung und kritischer Vergleich...97
Anhang ...101
Quellenverzeichnis...106
A. Selbständige Bücher und Schriften ... 106
B. Beiträge in Sammelwerken... 107
C. Aufsätze in Zeitschriften, Zeitungen und Loseblattwerken ... 107
D. Dissertationen ... 112
E. Internetquellen... 113
F. Sonstiges Schrifttum (Gesetzestexte, Bilanzkommentare etc.) ... 113
V
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.
am
angegebenen
Ort
Abs.
Absatz
Abschn.
Abschnitt
abzgl.
abzüglich
ADS
Adler/Düring/Schmaltz
AfA
Absetzung
für
Abnutzung
AICPA American
Institute
of Certified Public
Accountants
AktG
Aktiengesetz
APB
Accounting
Principles
Board
Aufl.
Auflage
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches
Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BIOS
Basic
Input
Output
System
BiRiLiG Bilanzrichtlinien-Gesetz
BMF
Bundesministerium
der
Finanzen
BMJ
Bundesministerium
der
Justiz
bspw.
beispielsweise
BStBl.
Bundessteuerblatt
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CAP
Committee
on
Accounting
Procedure
CD
Compact
Disc
CGU
Cash
Generating
Unit
CPU
Central
Processing
Unit
DAX
Deutscher
Aktienindex
d.
h.
das
heißt
DRS
Deutsche
Rechnungslegungs
Standards
DRSC
Deutsches Rechnungslegungs Standards
Committee
VI
DSR Deutscher
Standardisierungsrat
DVD
Digital Versatile Disc
d.
Verf. des
Verfassers
ED
Exposure
Draft
EDV
Elektronische
Datenverarbeitung
EG
Europäische
Gemeinschaft
EITO
European
Information
Technology
Observatory
ERP-Software Enterprise
Ressource
Planning-Software
EStG
Einkommensteuer-Gesetz
EStR
Einkommensteuer-Richtlinien
etc.
et
cetera
EU
Europäische
Union
EuGH
Europäischer
Gerichtshof
evtl.
eventuell
f.
folgende
ff.
fortfolgende
FAF
Financial
Accounting
Foundation
FASB
Financial
Accounting
Standards
Board
FG
Finanzgericht
Fn.
Fußnote
GAAP
Generally
Accepted Accounting Principles
GB
Gigabyte
gem.
gemäß
ggf.
gegebenenfalls
ggü.
gegenüber
GHz
Gigahertz
GmbH
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
GmbHG
GmbH-Gesetz
GoB
Grundsätze
ordnungsgemäßer
Buchführung
GoF
Geschäfts-
oder
Firmenwert
GrS
Großer
Senat
GuV
Gewinn-
und
Verlustrechnung
GWG
geringwertiges
Wirtschaftsgut
HFA
Hauptfachausschuss
HGB
Handelsgesetzbuch
VII
Hrsg.
Herausgeber
hrsg.
von
herausgegeben
von
HS
Halbsatz
IAS
International
Accounting
Standards
IASB
International
Accounting
Standards
Board
IASC
International
Accounting
Standards
Committee
i.
d.
R.
in
der
Regel
IDW
Institut
der
Wirtschaftsprüfer
IFAC
Council of International Federation of
Accountants
IFRS
International
Financial
Reporting
Standards
IOSCO
International Organization of Securities
Comissions
i.
S.
d.
im
Sinne
des
i.
S.
v.
im
Sinne
von
IT
Informationstechnik
i. V. m.
in Verbindung mit
Jg.
Jahrgang
Kap. Kapitel
KapAEG
Gesetz zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Konzerne an
Kapitalmärkten und zur Erleichterung der
Aufnahme von Gesellschafterdarlehen
(Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz)
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich
KoR Kapitalmarktorientierte
Rechnungslegung
LAN
Local Area Network
Losebl. Loseblatt-Sammlung
MB
Megabyte
MBit
Megabit
Mio.
Millionen
nach h. M.
nach herrschender Meinung
NEMAX
Aktienindex
des
Neuen
Marktes
No.
Number
VIII
Nr.
Nummer
NWB
Neue
Wirtschafts-Briefe
NYSE
New
York
Stock
Exchange
o.
ä.
oder
ähnliches
PC
Personalcomputer
PDA
Personal
Digital
Assistant
PublG
Gesetz über die Rechnungslegung von
bestimmten Unternehmen und Konzernen
(Publizitäts-Gesetz)
RAM
Random
Access
Memory
RFH
Reichsfinanzhof
ROM
Read
Only
Memory
RS
Stellungnahme
zur
Rechnungslegung
S.
Seite
bzw.
Seiten
SEC
U. S. Securities and Exchange Comission
SFAC
Statements
of
Financial Accounting Concepts
SFAS
Statement
of
Financial Accounting Standards
SIC
Standing
Committee
on
Interpretations
SMAX
Aktienindex
der
Nebenwerte
(small
caps)
sog.
sogenannte
SPA
Software
Publisher
Association
StB
Steuerberater
Std.
Stunden
Tz.
Teilziffer
bzw.
Randziffer
u.
a.
und
andere
u.
a.
unter
anderem
US-GAAP United
States-Generally Accepted Accounting
Principles
u. U.
unter Umständen
v. vom
v. a.
vor allem
VFE-Lage
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
vgl. vergleiche
WG Wirtschaftsgut
WP Wirtschaftsprüfer
IX
WPK Wirtschaftsprüfer-Kammer
z. B.
zum Beispiel
zzgl. zuzüglich
Kapitel I Einleitung
1
I. Einleitung
Die rechnergestützte Informationsverarbeitung ist aus der betrieblichen Praxis
mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Vom kleinsten
Einzelunternehmen bis hin zu international tätigen Großkonzernen werden in
jedem Unternehmen elektronische Informationssysteme zur Datenverarbeitung
eingesetzt. Angefangen vom einzelnen Personalcomputer (PC) bis hin zu
komplexen Netzwerken mit hunderten oder tausenden einzelner Rechner. Die
Gründe für die Automatisierung von Daten- oder
Informationsverarbeitungsaufgaben
1
liegen im Rationalisierungsstreben der
Unternehmen. Gegenüber der konventionellen Form der Datenverarbeitung
entstehen einerseits Kostenvorteile durch Personaleinsparungen, andererseits
wird hierdurch die Bearbeitung großer Datenmengen überhaupt erst zeitgerecht
ermöglicht. Weitere Vorteile des IT-Einsatzes ergeben sich durch die Möglichkeit
zur Aufbewahrung und zeitnahen Analyse großer Datenmengen.
2
Die große und immer noch wachsende Bedeutung der Informationstechnik wird
auch durch die Umsatzzahlen der IT-Branche verdeutlicht, die mit 1,7 Billionen
Euro weltweitem Gesamtumsatz im Jahr 2000 einer der größten
Wirtschaftszweige der Welt ist.
3
Nach rückläufigen Umsatzraten in den Jahren
2002 und 2003 wird der Branche von der EITO
4
für 2005 weltweit wieder eine
Wachstumsrate von knapp sechs Prozent prognostiziert.
Die vorliegende Arbeit erörtert die speziellen Bilanzierungsprobleme, die sich dem
Informationstechnik anwendenden Unternehmen bezüglich des Ansatzes und der
Bewertung von EDV-Anlagen stellen. Getrennt nach den beiden
Hauptkomponenten eines IT-Systems, der Hardware und der Software, erfolgt die
Betrachtung jeweils nach der Rechnungslegungskonzeption des
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach der Konzeption der IAS/IFRS
5
. Der
1
Die Begriffe Daten- bzw. Informationsverarbeitung werden im Folgenden synonym verwendet,
ebenso die Begriffe IT-System bzw. EDV-Anlage.
2
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I. 8. Auflage, Stuttgart 2001, S. 19
(Fn. bezieht sich auf die vorangegangenen zwei Sätze)
3
Vgl. ebenda, S. 85
4
EITO (Abkürzung von: European IT Observatory), eine europäische IT-
Marktforschungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt/M.
5
Sofern im Folgenden vom gesamten Rechnungslegungssystem der IAS/IFRS die Rede ist, wird
die Bezeichnung IFRS verwendet.
Kapitel I Einleitung
2
Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei im Bereich der Software v. a. auf der
Aktivierungsfähigkeit selbst erstellter Individual- bzw. umfangreich modifizierter
Standardsoftware. im Bereich der Hardware wird v. a. die Aktivierungsfähigkeit
nachträglicher Aufwendungen untersucht. Es wird jeweils davon ausgegangen,
dass das bilanzierende Unternehmen Eigentümer der Informationstechnik ist oder
zumindest über ein unbefristetes Nutzungsrecht über Selbige verfügt. Die
Sonderformen des Soft- oder Hardwareleasings bzw. der Miete werden in der
Arbeit nicht behandelt. Die speziellen Bilanzierungsprobleme der Soft- und
Hardwarehersteller sind ebenfalls nicht Teil dieser Arbeit.
Im folgenden zweiten Kapitel werden zunächst die Begriffe Software und
Hardware veranschaulicht. Des Weiteren wird ein grundlegender Überblick über
die Rechnungslegungssysteme des HGB, der IFRS und der US-GAAP gegeben.
Dies schließt eine Erläuterung des Verfassers mit ein, aus welchen Gründen die
Bilanzierung der Soft- und Hardware nach US-GAAP von der vorliegenden Arbeit
ausgenommen wurde.
Im dritten Kapitel folgt die Bilanzierung der Software, zunächst nach HGB unter
Einbeziehung des DRS-12, anschließend nach IFRS.
Ähnlich wird im vierten Kapitel zur Bilanzierung der Hardware verfahren, mit
Ausnahme einer DRS-Erläuterung, da hier kein relevanter Standard vorliegt.
Im fünften Kapitel werden die im Verlauf der Arbeit festgestellten wesentlichen
Unterschiede zwischen HGB und IFRS bei der Hard- und Softwarebilanzierung
nochmals kurz zusammengefasst und kritisch beleuchtet. Abschließend wird ein
Ausblick auf die zukünftige Relevanz beider Systeme in der deutschen
Rechnungslegung gegeben.
Kapitel II.1 Grundlagen Begriff der Software
3
II. Grundlagen
1. Begriff der Software
Software ist der allgemeine Sammelbegriff für alle Programme, mit denen eine
EDV-Anlage betrieben werden kann oder die der Lösung einer bestimmten
Problemstellung dienen. Programme sind in einer Programmiersprache, einer
formalen, dem Computer verständlichen, Sprache geschriebene Folge von
Anweisungen an den Computer. Anders ausgedrückt sind Programme dem
Rechner verständliche Codes. Neben den Programmen werden auch
Datenbankinhalte und Handbücher der Software zugerechnet.
6
Es existiert eine
Vielzahl unterschiedlicher Softwaretypen und eine noch größere Anzahl einzelner
Programme. Hinsichtlich der bilanziellen Behandlung ist jedoch, unabhängig
davon, ob es sich um die Softwarelösung eines Warenwirtschaftssystems, einer
Telekommunikationsplattform oder eines Materialwirtschaftssystems handelt,
lediglich folgende Unterscheidung relevant:
1.1 Firmware
Steuerangaben zur Ausführung von Elementarfunktionen der Prozessorhardware
werden Mikrobefehle genannt. Die Gesamtheit dieser Mikrobefehle bildet die
Firmware.
7
Ein Beispiel für ein solches Mikroprogramm ist das BIOS (Basic Input
Output System), welches im Zentralspeicher des Rechners abgelegt ist. Bei
dessen Einschalten lädt es das Betriebssystem von der Festplatte in den
Arbeitsspeicher.
8
6
Rautenstrauch, Claus; Schulze, Thomas: Informatik für Wirtschaftswissenschaftler und
Wirtschaftsinformatiker. Berlin/Heidelberg 2003, S. 54 (Fn. bezieht sich auf die vorangegangenen
drei Sätze)
7
Hansen, Hans Robert/Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 941 (Fn. bezieht sich
auf die vorangegangenen zwei Sätze)
8
ebenda, S. 46
Kapitel II.1 Grundlagen Begriff der Software
4
1.2 Systemsoftware
Systemsoftware, v. a. das Betriebssystem, bildet die Schnittstelle zwischen der
Hardware und den Anwendungsprogrammen. Das Betriebssystem dient selbst
keiner konkreten Anwendung durch den Benutzer, sondern hat die Aufgabe, die
Ausführung der Anwendungssoftware auf der jeweiligen Hardwarekonfiguration zu
koordinieren und die Benutzeraufträge zu organisieren. Darüber hinaus bildet es
die grafische Schnittstelle zwischen System und Benutzer. Es ist somit zum
Betrieb eines Rechners zwingend notwendig.
9
Die gängigsten Betriebssysteme im
PC-Bereich sind die der Firma Microsoft, aktuell die Versionen Windows 2000 und
XP. Ebenfalls sehr verbreitet sind die Unix-Systeme wie bspw. Solaris von Sun
Microsoft, AIX von IBM, HP-UX von Hewlett-Packard, Mac OS von Apple oder die
sog. Open-Source Variante Linux.
10
Beim Kauf eines handelsüblichen PCs ist
häufig ein Betriebssystem bereits installiert und im Kaufpreis enthalten.
11
1.3 Anwendungssoftware
Anwendungsprogramme bieten Lösungen für spezifische Problemstellungen des
EDV-Nutzers.
12
Die Anwendungssoftware lässt sich wie folgt weiter unterteilen.
1.3.1 Individualsoftware
Individualsoftware ist der Begriff für Programme, die speziell für die Bedürfnisse
eines Unternehmens oder einer Abteilung entwickelt werden. Diese kommen
überall dort zum Einsatz, wo die gängige ,,Software von der Stange" in ihren
Funktionen die betrieblichen Anforderungen nicht mehr erfüllen kann. Der Vorteil
der Individualsoftware besteht somit in der expliziten Ausrichtung auf die
spezifischen Bedürfnisse des Benutzers.
13
Nachteilig ist dagegen der
vergleichsweise hohe Anschaffungspreis, da stets nur ein einzelner Anwender
sämtliche Entwicklungskosten zu tragen hat.
9
ebenda, S. 150
10
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge der Wirtschaftsinformatik. 8. Auflage,
Berlin/Heidelberg u. a. 2004, S. 24 f.
11
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 150 f.
12
vgl. Freese, Peter: Informationsverarbeitung für Wirtschaftswissenschaftler und Kaufleute.
Paderborn 2003, S. 35
13
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 152
Kapitel II.1 Grundlagen Begriff der Software
5
1.3.2 Standardsoftware
Als Standardsoftware werden Programme bezeichnet, die vom Hersteller fertig
angeboten werden und auf mehrfache, oft massenhafte, Nutzung ausgelegt sind.
Sie bieten daher allgemeingültige Lösungen für eindeutig definierte
Anwendungsbereiche, sind meist branchenübergreifend und auf unterschiedlichen
Betriebssystemen einsetzbar und können i. d. R. zu einem Festpreis gekauft
werden.
14
1.3.2.1 fixe Standardsoftware
Eine fixe Standardsoftware ist ein fertiges Programm, das beim Kauf ohne
Modifikationen direkt einsatzfähig ist und nur noch auf dem Rechner installiert
werden muss. Hierunter fällt die weitestgehend standardisierte Bürosoftware, da
an diese unabhängig von der Branche und weltweit ähnliche Anforderungen
gestellt wird. Beispiele sind die Bürosoftwarepakete MS Office, Lotus Smart Suite
oder Open Office mit Textverarbeitungsprogrammen wie MS Word oder
AdobePageMaker, Tabellenkalkulationsprogrammen wie MS Excel oder Lotus 1-
2-3 und Website-Editoren wie MS Frontpage oder Macromedia Dreamweaver.
15
Diese Standardprogramme haben den Vorteil, dass sie gegenüber individueller
Programmierung erheblich kostengünstiger sind, da sich die Entwicklungskosten
auf viele, häufig Millionen, Nutzer verteilen.
1.3.2.2 variable Standardsoftware
Sämtliche Typen der fixen Standardsoftware unterstützen jeweils einzelne
Funktionen eines Unternehmens. Darüber hinaus gibt es jedoch auch variable
Standardsoftware, die als System funktionsübergreifend ganze
Geschäftsprozesse abbildet und optimiert. Grundlage solcher Softwaresysteme
sind zunächst auch wieder fixe Standardprogramme, sog. Module, welche
Gemeinsamkeiten zwischen den Prozessabläufen verschiedener Unternehmen in
ihren Programmen und Datenbanken vereinen. Diese standardisierten Module
decken jeweils einen Funktionsbereich eines Unternehmens ab, wie bspw. die
14
vgl. Biethahn, Jörg: Einführung in die EDV für Wirtschaftswissenschaftler. 10.Auflage,
München/Wien u. a. 2002, S. 310
15
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 30 f.
Kapitel II.1 Grundlagen Begriff der Software
6
Produktion, den Vertrieb, die Finanzbuchhaltung oder die Personalwirtschaft.
16
Die
einzelnen Funktionsmodule werden nach dem Kauf, i. d. R. unter Einbeziehung
eines IT-Beratungsunternehmens, aufwendig im Rahmen des sog. Customizing an
die unternehmensindividuellen Bedürfnisse angepasst. Dabei werden die
Komponenten dergestalt miteinander verbunden, dass sämtliche
Funktionsbereiche permanent in einen Bearbeitungsfluss von Geschäftsvorfällen
eingebunden sind und somit zu deren Auswertung und Optimierung beitragen
können.
17
Ein solches unternehmensweites System wird ERP (Enterprise
Ressource Planning)-Programm genannt.
Bei der Implementierung einer ERP-Software müssen häufig neben
länderspezifischen Anpassungen an unterschiedliche Sprachen, Datumsformate,
Kontenpläne oder Währungen auch umfangreiche Modifikationen am Quellcode
der Software vorgenommen werden, so dass häufig aus der einstmaligen
Standard- eine Individualsoftware entsteht.
18
Weltweiter Marktführer solcher Softwareprodukte ist der deutsche Hersteller SAP
mit seiner E-Business-Plattform mySAP.com und dessen zentraler Komponente
SAP R/3 Enterprise. Weitere gängige ERP-Programme werden von den Firmen
Oracle, Peoplesoft oder i2 hergestellt. PC&C bietet mit Navision ein speziell für
den Mittelstand entwickeltes Produkt an.
19
Die Mehrzahl der angebotenen
Standardmodule stellen dabei branchenneutrale Lösungen (cross industry
solutions) dar. Daneben sind auch branchenspezifische Produkte (industry
solutions) bspw. für den Bankensektor oder die Automobilindustrie erhältlich.
20
1.4 Rechtsnatur der Software
,,Software wird in der ganzen Welt als eine schöpferische Leistung angesehen, die
in Analogie zu einem Roman, einem Bild oder einer Komposition gesetzlich
geschützt ist. In Deutschland gilt für derartige Werke der Schutz des
16
vgl. Staud, Josef: Geschäftsprozessanalyse mit ereignisgesteuerten Prozessketten. Berlin/New
York u. a. 1999, S. 21 ff. (Fn. bezieht sich auf die vorangegangenen zwei Sätze)
17
Möhrlen, Regine; Kokot, Friedrich: SAP R/3-Kompendium. 2. Aufl., Haar bei München 1998,
S. 57
18
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 527
19
Staud, Josef: Geschäftsprozessanalyse...,a.a.O., S. 237
20
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 525 ff. (Fn. bezieht
sich auf die vorangegangenen zwei Sätze)
Kapitel II.1 Grundlagen Begriff der Software
7
Urheberrechts. Das Copyright ist das entsprechende Gegenstück der USA."
21
Das
Urheberrecht verleiht seinem Eigentümer das exklusive Recht, die Software zu
kopieren, zu verkaufen oder zu modifizieren. Der Käufer von Copyright-Software
erwirbt lediglich das Recht zur Nutzung Selbiger, darf jedoch keine weiteren
Kopien der Software anfertigen und verkaufen. Darüber hinaus wird Software
häufig auch durch Softwarelizenzen geschützt, welche die Art und Weise der
Nutzung der Software regeln. Diese Lizenzverträge erweitern häufig die Rechte
des Copyrights für den Nutzer, indem sie ihm z. B. gestatten, die Software auf
mehreren Rechnern zu installieren. Die Softwarelizenz ist ein zweiseitiger Vertrag
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, der klassisch durch Unterschreiben des
Käufers und Rücksendung desselben an den Verkäufer erfolgt. Aus
Vereinfachungsgründen wird bei Software, die in Massen über Geschäfte
vertrieben wird, der Lizenzvertrag auf die Verpackung gedruckt, in der sich die mit
der Software bespielte CD befindet. Der Käufer akzeptiert den Vertrag durch
Öffnen der Verpackung. Diese Art des Vertriebs wird auch als ,,take or leave"-
Ansatz bezeichnet. Die Palette der Lizenzoptionen ist breit gefächert. Es gibt
sowohl Verträge, die nur die Nutzung einer einzelnen Person vorsehen (single-
user license) als auch solche, die Mehrfachnutzungen erlauben (multi-user
license), wobei dann nicht selten die konkrete Anzahl der zur Nutzung
berechtigten Personen vertraglich festgehalten wird.
22
2. Begriff der Hardware
Hardware ist der Sammelbegriff aller materiellen Bestandteile einer EDV-Anlage.
Um den Prozess der Datenverarbeitung, bestehend aus den Teilaufgaben
Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Daten, gewährleisten zu können,
müssen folgende Hardwarekomponenten vorhanden sein: Die Peripherie- oder
Ein- und Ausgabegeräte, die Zentraleinheit sowie externe Speichermedien.
23
21
Rautenstrauch, Claus; Schulze, Thomas: Informatik...,a.a.O., S. 91
22
ebenda, S. 91 f. (Fn. bezieht sich auf den gesamten Absatz)
23
ebenda, S. 20 f.
Kapitel II.2 Grundlagen Begriff der Hardware
8
2.1 Die Zentraleinheit
Die Zentraleinheit (central processing unit, CPU) ist das ,,Herz" des Computers,
der Rechner an sich. Diese Funktionseinheit übernimmt die Aufgabe der
Datenverarbeitung wie das Durchführen von Berechnungen oder die Modifikation
von Texten oder Grafiken.
24
Die CPU besteht aus einem Hauptspeicher und einem
oder mehreren Prozessoren, welche sich wiederum aus jeweils einem Rechen-
und einem Steuerwerk zusammensetzen.
25
Der Hauptspeicher besteht aus einem RAM (random access memory) und einem
ROM (read only memory). In das RAM, den Arbeitsspeicher, werden die
auszuführenden Programme und die damit zu verarbeitenden Daten geladen.
26
Im
Gegensatz zu externen Speichermedien wie Magnetplatten oder CDs ist dieser
Speicher elektronisch. Dies ermöglicht einerseits extrem kurze Zugriffszeiten im
Nanosekundenbereich auf die enthaltenen Daten, bedeutet aber andererseits,
dass diese nur flüchtig während des Betriebs der Anlage gespeichert sind.
27
Das
ROM ist schreibgeschützt und enthält das BIOS.
28
Der Arbeitsspeicher steht in direktem Dialog mit dem Prozessor.
29
Der Prozessor
holt sich die Befehle sowie die notwendigen Daten aus dem im Arbeitsspeicher
geladenen Programm. Im Rechenwerk werden dann die eigentlichen Operationen
ausgeführt. Aufgabe des Steuerwerks ist, abhängig von den auszuführenden
Befehlen, die Koordination der Arbeit des Rechenwerks. Nachdem eine Operation
vom Prozessor abgearbeitet ist, wird das Ergebnis in den Hauptspeicher
zurückkopiert.
30
Des Weiteren sind in der CPU Pufferspeicher, sog. Caches,
enthalten, die einen Ausgleich zwischen langsamer und schneller arbeitenden
Einheiten bewirken.
31
Die Leistungsfähigkeit von Prozessoren wird v. a. durch
deren Taktfrequenz bestimmt, welche durch die Maßzahl Mega- bzw. Gigahertz
ausgedrückt wird.
24
ebenda, S. 18
25
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 14
26
Freese, Peter: Informationsverarbeitung...,a.a.O., S. 19
27
Biethahn, Jörg: Einführung...,a.a.O., S. 28
28
Rautenstrauch, Claus; Schulze, Thomas: Informatik...,a.a.O., S. 25
29
Biethahn, Jörg: Einführung...,a.a.O., S. 28
30
Rautenstrauch, Claus; Schulze, Thomas: Informatik...,a.a.O., S. 26 f. (Fn. bezieht sich auf den
gesamten Absatz)
31
ebenda, S. 31
Kapitel II.2 Grundlagen Begriff der Hardware
9
2.2 Die Peripheriegeräte
Bevor die Daten von der CPU verarbeitet werden können, müssen sie zunächst
mittels Eingabegeräten in den Computer eingebracht werden. Zu den
Eingabegeräten zählen u. a. die Tastatur, die Maus oder der Trackball, Scanner,
Mikrofone, digitale Kameras oder externe Speicher. Liegen die Daten nicht in
binärer Form vor, so müssen die Eingabegeräte diese zunächst in Binärcodes
überführen. So wird bspw. von der Tastatur nach jedem Tastendruck das jeweilige
Zeichen in eine Bitfolge verwandelt.
Nach Eingabe und Verarbeitung der Daten werden diese dann schließlich wieder
ausgegeben. Sie werden entweder zu anderen Rechnern übertragen, auf externen
Medien gespeichert oder mittels Ausgabegeräten wie Bildschirmen, Druckern oder
Lautsprechern in einer dem Menschen verständlichen Form angezeigt.
32
2.3 Die externen Speicher
Da der Arbeitsspeicher flüchtig und pro Einheit Speicherkapazität vergleichsweise
sehr teuer ist, werden externe Speichermedien benötigt, um größere
Datenmengen langfristig aufbewahren zu können. Hierzu gehören Magnetplatten,
Disketten, Magnetbänder, Smartcards und optische Speichermedien wie CDs oder
DVDs.
33
Da in einem handelsüblichen PC eine Magnetplatte stets fest mit
eingebaut ist, wird diese auch als Festplatte bezeichnet.
2.4 Rechnerkategorien
Rechnerkategorien werden i. d. R. nach Preisspannen oder technischen
Kenndaten abgegrenzt. Diese Größen unterliegen im Zeitablauf aufgrund der
technischen Entwicklung großen Veränderungen, so dass die Grenzen zwischen
den einzelnen Kategorien teils fließend sind. Generell werden unterschieden:
·
Embedded Systems (Einbaucomputer, z. B. Steuerungseinheiten an
Fließbandanlagen)
·
Mobile Clients (Notebooks, PDAs und Smartphones)
·
Netzwerkcomputer und Thin Clients
32
ebenda, S. 19 (Fn. bezieht sich auf die vorangegangenen vier Sätze)
33
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 17 ff.
Kapitel II.2 Grundlagen Begriff der Hardware
10
·
Personalcomputer
·
Workstation
·
Großrechner (mainframe computer)
·
Superrechner (high performance computing server)
34
Personal Digital Assistants (PDAs) sind etwa handflächengroße Geräte, auf denen
mit Hilfe spezieller Betriebssysteme (z. B. Windows CE) Standardprogramme wie
Word, Excel oder PowerPoint genutzt werden können. Mobiltelefone, die PDA-
Funktionalitäten integrieren, werden Smartphones genannt. Thin Clients sind
preisgünstige Rechner mit vergleichsweise geringer Leistungsfähigkeit, die rein für
den Terminalbetrieb im Netzwerk vorgesehen sind. Diese Geräte kommen daher
ohne eigene Festplatte aus.
35
Unter einer Workstation verstand man ursprünglich
einen Hochleistungsrechner mit großem, hochauflösendem Monitor, der für
technisch-wissenschaftliche oder sonstige rechenintensive Arbeiten vorgesehen
war. Aufgrund der enormen Leistungsentwicklung der PCs sind diese beiden
Kategorien jedoch kaum noch zu unterscheiden. Die beiden Begriffe werden daher
im Folgenden synonym verwendet. Großrechner bieten einerseits hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeiten durch Mehrprozessorsysteme und zeichnen sich
andererseits durch große Speicherkapazitäten aus. Sie werden v. a. in größeren
Netzwerken als Abteilungs- oder Unternehmensserver eingesetzt. Im Gegensatz
zu PCs benötigen diese Rechner aufwendige Kühlungssysteme und geschultes
IT-Personal zum Betrieb.
36
Aufgrund der größeren Benutzerfreundlichkeit wird
daher heute, wenn möglich, anstatt eines Großrechners alternativ ein Verbund von
PCs im Unternehmen eingesetzt. Diese Variante ist i. d. R. auch erheblich
kostengünstiger.
37
Superrechner mit hunderten oder tausenden von Prozessoren
nehmen eine Sonderstellung ein, da es weltweit nur einige hundert Installationen
gibt. Sie werden bspw. für die Wetterprognose oder militärische Zwecke wie der
Simulation einer Nuklearexplosion verwandt.
38
34
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 57; sowie Mertens,
Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 35
35
ebenda, S. 37
36
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 61 (Fn. bezieht sich
auf die vorangegangenen drei Sätze)
37
vgl. Buck-Emden, Rüdiger; Galimow, Jürgen: Die Client/Server-Technologie des SAP-Systems
R/3. 2. Auflage, Paris/Reading u. a. 1995, S. 28
38
vgl. Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 81 ff.
Kapitel II.2 Grundlagen Begriff der Hardware
11
2.5 Computer im Netzverbund
Rechner werden im Unternehmen nicht nur einzeln eingesetzt, sondern auch zu
Netzwerken miteinander verbunden. Dies führt zu einer besseren
Kapazitätsauslastung, da der jeweils am wenigsten beanspruchte Rechner neue
Aufgaben zugewiesen bekommt. Des Weiteren können umfangreiche
Rechenaufgaben, die ein PC alleine nicht mehr effizient bearbeiten kann, parallel
von mehreren Geräten gleichzeitig gelöst werden. Darüber hinaus können die
Anwender gleichzeitig auf gleiche Datenbestände oder kostspielige Software
zugreifen, die auf diese Weise nicht mehr für jeden Arbeitsplatz angeschafft
werden muss. Gleiches gilt für Hardware-Ressourcen wie bspw. teure
Laserdrucker. Zusätzlich ermöglicht das Netzwerk den Anwendern, miteinander
per E-Mail zu kommunizieren.
39
Im Netzverbund werden ein oder mehrere Rechner als Server eingesetzt, auf
denen Programme oder Daten gespeichert sind. Auf diese können die
Arbeitsplatzrechner (Clients) dann zugreifen. In kleinen Netzwerken reichen oft
leistungsfähige PCs für den Serverbetrieb aus. Für größere sind jedoch meist
Mehrprozessorsysteme erforderlich.
40
Verbunden werden die Rechner über ein
Kommunikationsnetz, welches sich aus den Leitungen (Kupfer-, Koaxial- und
Glasfaserkabel oder Mobilfunk) und Verbindungsrechnern wie Routern, Bridges
oder Switches zusammensetzt.
41
Als Schnittstelle zwischen Rechnern und
Kommunikationsnetz dienen Modems oder Netzwerkkarten.
Die auf ein Gebäude, eine Abteilung oder das Betriebsgelände räumlich
begrenzten Netzwerke eines Unternehmens werden als Local Area Network (LAN)
bezeichnet. Die Datenübertragung in diesen Netzwerken verläuft erheblich
schneller als die im Internet. Neben LANs nutzen Unternehmen auch sog.
Intranets, geschlossene Netzwerke auf Basis der Internet-Technologie. Auf diese
Art kann ein Unternehmen mit weltweit verstreuten Filialen ein geschlossenes
Netzwerk mit entsprechenden Zugriffsrechten nutzen. Hierbei werden die
Verbindungen und Leitungen des Internets benutzt und mittels
39
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 38 f. (Fn. bezieht sich auf den
gesamten Absatz)
40
Hansen, Hans Robert; Neumann, Gustaf: Wirtschaftsinformatik I...,a.a.O., S. 60
41
Buck-Emden, Rüdiger: Die Technologie des SAP R/3-Systems. 4. Auflage, Bonn/Reading u. a.
1998, S. 51
Kapitel II.3 Grundlagen Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme
HGB, US-GAAP und IAS/IFRS
12
Verschlüsselungstechniken wie dem sog. Virtual Private Network Daten vor dem
Zugriff Dritter geschützt.
42
3. Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme
HGB, US-GAAP und IAS/IFRS
3.1 Handelsgesetzbuch
3.1.1 Geschichte
Im Einklang mit der kontinentaleuropäischen Tradition wird die
Rechnungslegungskonzeption in Deutschland in ihren maßgeblichen Grundsätzen
vom Gesetzgeber geregelt.
43
Beim HGB handelt es sich um ein sog. code law.
44
Das HGB trat am 01. Januar 1900 in Kraft. Dessen Drittes Buch Handelsbücher
war damals stark auf einer Aktiennovelle von 1884 aufgebaut, auf welche die
Grundsätze des Gläubigerschutzes, des Vorsichtsprinzips und der
Ausschüttungsbemessungsfunktion zurückzuführen sind. Diese prägen bis heute
die deutsche Rechnungslegung.
45
Im Verlauf der Zeit unterlag das HGB großen
Veränderungen. Vor allem die angestrebte Harmonisierung der Rechnungslegung
durch die Europäische Union brachte tief greifende Neuerungen mit sich.
Die 1978 verabschiedete 4. EG-Richtlinie (Vorschriften über den Einzelabschluss)
und die 1984 verabschiedete 7. EG-Richtlinie (Vorschriften über den
Konzernabschluss) wurden im Rahmen des Bilanzrichtlinien-Gesetzes (BiRiLiG)
vom 19.12.1985 in deutsches Recht umgesetzt. Der deutsche Gesetzgeber
beschränkte sich hierbei jedoch nicht auf eine reine Transformation der EG-
Richtlinien, sondern nahm eine umfassende Neugestaltung des Bilanzrechts vor.
So erstreckten sich die Neuregelungen nicht nur auf Kapitalgesellschaften und
Konzerne, sondern auf alle Rechtsformen. In diesem Rahmen wurden allgemeine
42
Mertens, Peter; Bodendorf, Freimut u. a.: Grundzüge...,a.a.O., S. 50 (Fn. bezieht sich auf die
vorangegangenen drei Sätze)
43
Vigelius, Christoph: HGB, US-GAAP, IAS. 2.Aufl., Frankfurt/M. 1998, S. 11
44
Krawitz, Norbert: Die Rechnungslegungsvorschriften nach HGB, IAS und US-GAAP im kritischen
Vergleich in: Steuern und Bilanzen, 3. Jg. 2001, S. 630
45
Born, Karl: Rechnungslegung nach IAS, US-GAAP und HGB im Vergleich. 2.Aufl., Stuttgart
2001, S. 20
Kapitel II.3 Grundlagen Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme
HGB, US-GAAP und IAS/IFRS
13
Regeln in den §§ 238-263 HGB kodifiziert. Diese wurden um spezielle Ansatz-,
Bewertungs- und Ausweisvorschriften sowie umfassende Angabe- und
Erläuterungspflichten für Kapitalgesellschaften in den §§ 264-289 HGB ergänzt.
46
Das Dritte Buch des HGB, welches den Jahresabschluss regelt, umfasst
insgesamt die §§ 238-342a HGB. Neben diesem sind das GmbH-Gesetz, das
Aktiengesetz, das Publizitätsgesetz und die Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung (GoB) für die Rechnungslegung von Bedeutung. So ist der
Jahresabschluss gem. § 243 Abs.1 HGB nach den GoB aufzustellen.
47
Diese
stellen einen unbestimmten Rechtsbegriff dar. Sie sind als zentrale Prinzipien der
Rechnungslegung zu verstehen und ergänzen verpflichtend die schriftlich fixierten
Gesetze. Diese Konstellation gewährleistet die Praktikabilität des gesetzlichen
Normengerüsts.
48
Die GoB werden definiert durch das Gesetz und die zugrunde
liegenden EG-Richtlinien, die Rechtsprechung des BGH, des EuGH und des BFH,
die Stellungnahmen des IDW, die gesicherten Erkenntnisse der
Betriebswirtschaftslehre, die Bilanzierungspraxis ordentlicher Kaufleute
49
sowie
die Kommentierungen zu den Gesetzen
50
.
3.1.2 Primäre Ziele und oberste Bewertungsprinzipien
Obwohl im HGB im Gegensatz zu den IFRS oder US-GAAP an keiner Stelle
explizite Ziele der dort geregelten Rechnungslegung konkretisiert werden, lassen
sich als primäre Ziele dennoch der Gläubigerschutz, die Kapitalerhaltung
51
und
gem. den §§ 264 und 297 HGB die zutreffende Darstellung der Vermögens-,
Finanz-, und Ertragslage des Unternehmens im Jahresabschluss ausmachen. Im
Unterschied zu dem in den IFRS oder US-GAAP postulierten, äquivalenten, Ziel
des ,,true and fair view"
52
stellt die Forderung nach der zutreffenden Darstellung
der Lage des Unternehmen kein overriding principle dar. Die Einhaltung der
bestehenden Einzelvorschriften ist somit im HGB eine dem ,,true and fair view"
46
Kirsch, Hans-Jürgen: Vom Bilanzrichtlinien-Gesetz zum Transparenz- und Publizitätsgesetz in:
Die Wirtschaftsprüfung 55. Jg. 2002, S. 744 (Fn. bezieht sich auf den ganzen Absatz)
47
Hladjk, Ingo: Internationale Rechnungslegung nach HGB, US-GAAP und IAS, in: Steuer &
Studium 7/2000, S. 319
48
Vigelius, Christoph: HGB...,a.a.O., S. 14 (Fn. bezieht sich auf die vorangegangenen zwei Sätze)
49
Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2000, 12. Aufl., Düsseldorf 2000, S. 189 (Fn. bezieht sich auf den
gesamten Satz bis zur Fn.)
50
Hladjk, Ingo: Internationale...,a.a.O., S. 319
51
ebenda, S. 319 (Fn. bezieht sich auf den gesamten Satz bis zur Fn.)
52
siehe unten
Kapitel II.3 Grundlagen Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme
HGB, US-GAAP und IAS/IFRS
14
ggü. höher gestellte Norm.
53
Führt jedoch die Einhaltung einer Einzelvorschrift
dazu, dass im Jahresabschluss eine verzerrte Darstellung der VFE-Lage gegeben
ist, muss dies im Anhang deutlich gemacht werden.
Der Gläubigerschutz lässt sich historisch mit der in Deutschland vorherrschenden
Kreditfinanzierung seitens der Unternehmen erklären. Aus dem Gläubigerschutz
ergibt sich das oberste Prinzip der deutschen Rechungslegung, das
Vorsichtsprinzip, welches im Rahmen des BiRiLiG im § 252 Abs.1 Nr.4 HGB
kodifiziert wurde.
54
Dem Vorsichtsprinzip entspringen zwei zentrale
Unterprinzipien: Einerseits das Realisationsprinzip, welches einen Gewinnausweis
erst dann zulässt, wenn ein Vermögensgegenstand an den Käufer übergegangen
ist bzw. von diesem abgenommen wurde.
55
Andererseits das Imparitätsprinzip,
welches eine Ungleichbehandlung von Aktiva und Passiva vorsieht, d. h. im
Gegensatz zu den Gewinnen müssen Verluste bereits dann erfolgswirksam
erfasst werden, wenn sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ersichtlich sind.
56
Vorsichtige Bewertung ist generell ,,...als eine Bewertungsregel aufzufassen, die
überall dort zum Zuge kommt, wo auf Grund unvollständiger Informationen oder
der Ungewissheit künftiger Ereignisse zwangsläufig Ermessensspielräume
bestehen."
57
Im Zweifelsfall soll das Unternehmen also seinen
Vermögensgegenständen einen geringeren, den Schulden dagegen einen
höheren Wert beimessen. Auf diese Weise soll dem Gläubiger (bzw. Anleger im
Fall von Kreditinstituten/Versicherungsunternehmen) ein hohes Maß an Sicherheit
gegeben werden, dass die im Jahresabschluss dokumentierte Haftungsbasis des
Unternehmens im Bedarfsfall tatsächlich zur Befriedigung seiner Ansprüche zur
Verfügung steht.
58
Der Gläubiger ist folglich unschwer als wichtigster Adressat
eines HGB-Abschlusses auszumachen.
Im Gegensatz zu einem IFRS/US-GAAP-Abschluss kommt dem
handelsrechtlichen Abschluss neben der Dokumentations- und
53
Krawitz, Norbert: Die Rechnungslegungsvorschriften...,a.a.O., S. 632 und Vigelius, Christoph:
HGB...,a.a.O., S. 15
54
Kirsch, Hans-Jürgen: Vom Bilanzrichtlinien-Gesetz...,a.a.O., S. 744
55
Adler/Düring/Schmaltz (ADS): Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6.Aufl.,
Stuttgart 1995, SS. 55-56, Tz. 82
56
ADS: Rechungslegung...,a.a.O., S. 60, Tz. 92
57
ADS: Rechnungslegung: ,a.a.O., S. 48, Tz. 61
58
Leonardi, Hildegard: HGB oder IAS/US-GAAP? in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
51. Jg. 1998, S. 168
Kapitel II.3 Grundlagen Grundsätzlicher Überblick über die Rechnungslegungssysteme
HGB, US-GAAP und IAS/IFRS
15
Informationsfunktion eine Zahlungsbemessungsfunktion zu.
59
Die
Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter/Anteilseigner orientieren sich am
Bilanzgewinn. Die Handelsbilanz ist ferner über das Prinzip der Maßgeblichkeit
gem. § 5 Abs.1 S.1 EStG und der umgekehrten Maßgeblichkeit gem. § 5 Abs.1
S.2 EStG eng an die Steuerbilanz gekoppelt, so dass auch eine
Zahlungsbemessungsfunktion hinsichtlich der Ertragsteuern besteht.
Im internationalen Vergleich gewährt das HGB eine Vielzahl expliziter Ansatz- und
Bewertungswahlrechte und verlangt vergleichsweise wenige Erläuterungen im
Anhang.
60
Beispielhaft genannt sei der Ansatz von Herstellungskosten gem. § 255
Abs.2 HGB, der dem Bilanzierenden einen erheblichen Spielraum in der
Erstbewertung selbst erstellter Vermögensgegenstände lässt.
3.1.3 Reformen jüngerer Zeit in Richtung internationaler Rechnungslegung
Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Geschäftsbeziehungen
zwischen den Unternehmen, der zunehmenden Öffnung der Kapitalmärkte und
dem wachsenden Kapitalbedarf deutscher Unternehmen erließ der Gesetzgeber
im Frühjahr 1998 das Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz (KapAEG). Dies
erlaubte kapitalmarktorientierten Unternehmen befristet bis 2004 einen
befreienden Konzernabschluss nach internationalen Normen aufzustellen. Obwohl
nicht explizit benannt, kommen hierfür nur die IFRS und US-GAAP in Betracht. Bis
dahin mussten deutsche Unternehmen, wollten sie internationale Kapitalmärkte in
Anspruch nehmen, entweder einen dualen HGB/IFRS- oder HGB/US-GAAP-
Abschluss erstellen oder zumindest eine Überleitungsrechung auf die
internationalen Normen vornehmen. Der Vorreiter, die damalige DaimlerBenz AG,
tat dies bspw. bei ihrem Gang an die New Yorker Börse (NYSE) 1993. Für die
betroffenen Unternehmen bedeutete dies einen erheblichen Mehraufwand.
61
Eine weitere deutliche Veränderung der Rechnungslegungsregeln in Deutschland
bedeutete das ebenfalls 1998 verabschiedete Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmen (KonTraG), mit dem der Gesetzgeber Inhalt und
59
Krawitz, Norbert: Die Rechnungslegungsvorschriften...,a.a.O., S. 631
60
Ballwieser, Wolfgang: Zum Nutzen handelsrechtlicher Rechnungslegung in: Rechnungslegung
warum und wie, hrsg. von Wolfgang Ballwieser, München 1996, S. 20
61
Kirsch, Hans-Jürgen: Vom Bilanzrichtlinien-Gesetz...,a.a.O., S. 746 (Fn. bezieht sich auf den
gesamten Absatz)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832486655
- ISBN (Paperback)
- 9783838686653
- DOI
- 10.3239/9783832486655
- Dateigröße
- 674 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Düsseldorf – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2005 (März)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- erp-software hardware rechnungslegung vermögensgegenstände us-gaap
- Produktsicherheit
- Diplom.de