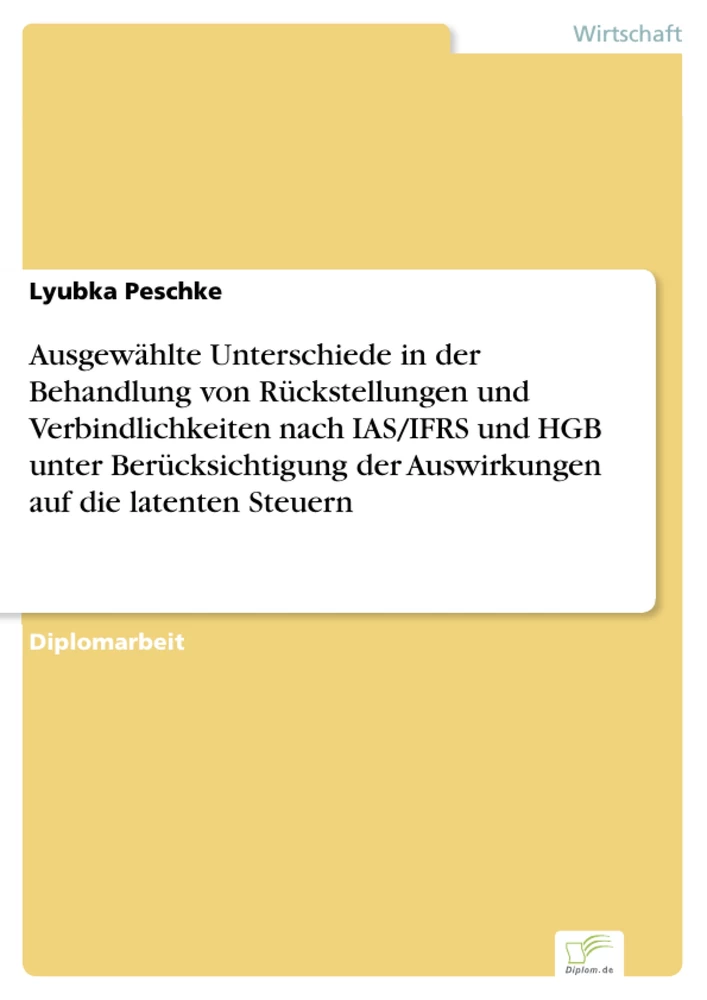Ausgewählte Unterschiede in der Behandlung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten nach IAS/IFRS und HGB unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die latenten Steuern
Zusammenfassung
Accounting is often referred to as the language of business.
Mit dieser Aussage weisen Mueller/Gernon/Meek der Rechnungslegung eine entscheidende Funktion im Wirtschaftsleben zu: sie dient als Kommunikationsmittel. Damit die Wirtschaftssubjekte und Teilnehmer am Wirtschaftsverkehr untereinander Informationen austauschen können, müssen sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Dieses Erfordernis hatte man in der Europäischen Gemeinschaft (EG) erkannt, und im Rahmen der Harmonisierung des Gesellschaftsrechts die 4., 7. und 8. EG-Richtlinie verabschiedet. Die Richtlinien wurden in Deutschland durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz vom 19.12.1985 in nationales Recht umgesetzt. Mit ihrer Hilfe konnte eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der externen Rechnungslegung in den EU-Staaten erreicht werden. Dadurch gewinnt die internationale Rechnungslegung immer stärker an Bedeutung. Die Gründe für diese Entwicklung sind zahlreich. Als erstes Unternehmen wurde 1993 die damalige Daimler Benz AG an der New Yorker Börse notiert. Da der handelsrechtliche Konzernabschluss von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde nicht anerkannt wurde, musste ein Konzernabschluss nach den amerikanischen Vorschriften US-GAAP aufgestellt werden.
Mit der stark zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft werden immer mehr globalisierte und einheitliche Rechnungslegungsstandards erforderlich. Die Nachfrage nach transparenten und vergleichbaren Jahresabschlüssen ist stark gewachsen. Je nach Land und Behörde werden hierfür entweder die International Accounting Standards (IAS) und/oder die United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) akzeptiert.
Auf diese Entwicklungen hat der deutsche Gesetzgeber reagiert, indem mit dem KapAEG ein neuer § 292a in das HGB eingefügt wurde. Danach dürfen börsennotierte Mutterunternehmen Konzernabschlüsse nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS, US-GAAP) erstellen bei Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines HGB-Konzernabschlusses (befristet bis 31.12.2004). Allerdings führt die Bilanzierung nach internationalen Regeln zu dem ständigen Erfordernis, die einzelnen neu veröffentlichten Vorschriften auf Abweichungen zu den EU-Richtlinien und zum HGB zu untersuchen. Im Rahmen des sog. Core Set of Standards sind viele IAS geändert oder neu geschaffen worden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Rückstellungsbilanzierung grundlegend überarbeitet: Ergebnis ist der im Juli 1998 vom IASC […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
1.1. Problemstellung
1.2. Verlauf der Arbeit
2. Die Bilanzierung der Rückstellungen im Vergleich nach HGB und IAS
2.1. HGB
2.1.1. Definition der Rückstellungen
2.1.2. Rückstellungsbildung aus statischer und dynamischer Sicht
2.2. IAS - der Begriff der Rückstellungen (provisions)
2.3. Ansatz von Rückstellungen
2.3.1. Passivierungsvoraussetzungen nach HGB
2.3.1.1. Der Ansatz von Verbindlichkeitsrückstellungen
2.3.1.2. Der Ansatz von Aufwandsrückstellungen
2.3.1.3. Der Ansatz von Drohverlustrückstellungen
2.3.2. Passivierungsvoraussetzungen nach IAS
2.3.2.1. Gegenwärtige Verpflichtung
2.3.2.2. Resultat aus vergangenen Ereignissen
2.3.2.3. Außenverpflichtung
2.3.2.4. Wahrscheinlicher Nutzenabfluss
2.3.2.5. Schätzung des Verpflichtungsbetrags
2.4. Abgrenzung der Rückstellungen von den Verbindlichkeiten
2.5. Abgrenzung von den Eventualschulden (contingent liabilities)
2.6. Die Bewertung von Rückstellungen im Vergleich
2.6.1. HGB – vernünftige kaufmännische Beurteilung
2.6.2. Die in die Bewertung von Rückstellungen einzubeziehenden Aufwendungen und Erträge
2.6.3. IAS – Best Estimate
2.6.3.1. Zugangsbewertung
2.6.3.2. Folgebewertung
2.7. Die Bildung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
2.7.1. HGB
2.7.2. IAS
2.8. Ausweis und Erläuterung von Rückstellungen
3. Grundlagen der Bilanzierung von Verbindlichkeiten nach HGB und IAS/IFRS
3.1. Begriff und Arten von Verbindlichkeiten
3.1.1. Definition nach HGB
3.1.2. Definition nach IAS 37 (liability)
3.2. Der Ansatz von Verbindlichkeiten
3.2.1. Grundsätze für den Ansatz von Verbindlichkeiten nach HGB
3.2.1.1. Gegenwärtige Verpflichtung
3.2.1.2. Wirtschaftliche Belastung
3.2.1.3. Quantifizierbarkeit
3.2.2. Der Ansatz antizipativer passivischer Rechnungsabgrenzungsposten
3.2.3. Ansatzkriterien für Verbindlichkeiten nach IAS/IFRS
3.3. Allgemeine Bewertungsregeln für Verbindlichkeiten nach HGB
3.3.1. Erstbewertung
3.3.2. Folgebewertung
3.3.3. Die Bewertung von Sachleistungsverpflichtungen
3.3.4. Bilanzierungsweise bei geringerem Auszahlungsbetrag
3.3.5. Bilanzierungsweise bei höherem Auszahlungsbetrag
3.3.6. Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten
3.4. Bewertungsvorschriften für Verbindlichkeiten nach IAS
3.4.1. Zugangsbewertung
3.4.2. Folgebewertung
3.5. Der Ausweis und die Erläuterung von Verbindlichkeiten
3.5.1. Größenspezifische Gliederung nach HGB
3.5.2. Die Angabe der Restlaufzeiten und der Sicherheiten von Verbindlichkeiten
3.6. Der Ausweis von Liabilities nach IAS 37
3.7. Abgrenzung von den Eventualschulden nach HGB
4. Die Auswirkungen auf die latenten Steuern
4.1. Latente Steuern nach HGB - das Timing-Konzept
4.2. Latente Steuern nach IAS - das Temporary- Konzept
4.2.1. Aktivische latente Steuern
4.2.2. Passivische latente Steuern
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung:
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
1.1. Problemstellung
„Accounting is often referred to as the language of business.“[1]
Mit dieser Aussage weisen Mueller/Gernon/Meek der Rechnungslegung eine entscheidende Funktion im Wirtschaftsleben zu: sie dient als Kommunikationsmittel. Damit die Wirtschaftssubjekte und Teilnehmer am Wirtschaftsverkehr untereinander Informationen austauschen können, müssen sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Dieses Erfordernis hatte man in der Europäischen Gemeinschaft (EG) erkannt, und im Rahmen der Harmonisierung des Gesellschaftsrechts die 4., 7. und 8. EG-Richtlinie verabschiedet.[2] Die Richtlinien wurden in Deutschland durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz vom 19.12.1985 in nationales Recht umgesetzt.[3] Mit ihrer Hilfe konnte eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der externen Rechnungslegung in den EU-Staaten erreicht werden. Dadurch gewinnt die internationale Rechnungslegung immer stärker an Bedeutung. Die Gründe für diese Entwicklung sind zahlreich. Als erstes Unternehmen wurde 1993 die damalige Daimler Benz AG an der New Yorker Börse notiert. Da der handelsrechtliche Konzernabschluss von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde nicht anerkannt wurde, musste ein Konzernabschluss nach den amerikanischen Vorschriften – US-GAAP – aufgestellt werden.[4]
Mit der stark zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft werden immer mehr globalisierte und einheitliche Rechnungslegungsstandards erforderlich. Die Nachfrage nach transparenten und vergleichbaren Jahresabschlüssen ist stark gewachsen. Je nach Land und Behörde werden hierfür entweder die International Accounting Standards (IAS) und/oder die United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) akzeptiert.
Auf diese Entwicklungen hat der deutsche Gesetzgeber reagiert, indem mit dem KapAEG ein neuer § 292a in das HGB eingefügt wurde. Danach dürfen börsennotierte Mutterunternehmen Konzernabschlüsse nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS, US-GAAP) erstellen bei Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines HGB-Konzernabschlusses (befristet bis 31.12.2004).[5] Allerdings führt die Bilanzierung nach internationalen Regeln zu dem ständigen Erfordernis, die einzelnen neu veröffentlichten Vorschriften auf Abweichungen zu den EU-Richtlinien und zum HGB zu untersuchen. Im Rahmen des sog. Core Set of Standards sind viele IAS geändert oder neu geschaffen worden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Rückstellungsbilanzierung grundlegend überarbeitet: Ergebnis ist der im Juli 1998 vom IASC verabschiedete und im September 1998 veröffentlichte IAS 37 „Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets“, der seit dem 1. Juli 1999 in Kraft ist.[6] IAS 37 hat eine besondere Relevanz, da die Rückstellungen aufgrund ihrer Eigenschaften und Bedeutung zu den meistdiskutierten Bilanzpositionen gehören. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, die Unterschiede in der Bilanzierung von Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten nach HGB und IAS herauszuarbeiten.
1.2. Verlauf der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Zu Beginn ist dem Leser die Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung näher zu bringen. Im zweiten Kapitel wird eine Analyse der Bilanzierung von Rückstellungen im Vergleich nach HGB und IAS/IFRS durchgeführt. Danach wird speziell auf den Ansatz der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Aufwandsrückstellungen hingewiesen. Anschließend wird eine Abgrenzung der Rückstellungen von anderen Bilanzposten vorgenommen. Das dritte Kapitel zeigt auf, welche Unterschiede bei der Bilanzierung der Verbindlichkeiten nach HGB und IAS/IFRS bestehen. Gegenstand des vierten Kapitels ist eine kurze Untersuchung, welche Auswirkungen sich auf die latenten Steuern aufgrund zahlreiche Ansatzunterschiede ergeben. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung über den Themenkomplex.
2. Die Bilanzierung der Rückstellungen im Vergleich nach HGB und IAS
2.1. HGB
2.1.1. Definition der Rückstellungen
„ Bei den Rückstellungen handelt es sich um eine bezüglich ihres Inhalts umstrittene und deshalb in der Literatur intensiv diskutierte Bilanzposition.“[7] Ihre Passivierung dient dem Zweck, künftige Ausgaben oder Verluste dem Wirtschaftsjahr der Verursachung zuzuordnen.[8]
Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verpflichtungen eines Unternehmens, die zu künftigen Ausgaben führen und deren zugehöriger Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Durch Rückstellungen können ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder bestimmte Aufwendungen bilanziell erfasst werden.
Im Gliederungsschema des § 266 Abs. 3 HGB stehen die Rückstellungen als eigene Kategorie zwischen dem Eigenkapital und den Verbindlichkeiten.
Begriffliche Verwechslungen können sich mit den Rücklagen als Bestandteil des Eigenkapitals ergeben. Die Kapitalrücklagen werden durch Außenfinanzierung gebildet und die Gewinnrücklagen durch Innenfinanzierung aus Gewinnen des Unternehmens. Rückstellungen stellen auch ein Mittel der Innenfinanzierung dar, allerdings unterscheiden sich von den Gewinnrücklage dadurch, dass die Bildung von Rückstellungen aufwandswirksam in der GuV erfolgt, also sie mindern den Erfolg des Unternehmens in einer bestimmten Periode und stellen Fremdkapital dar. Gewinnrücklagen dagegen stellen Eigenkapital dar.[9]
Von den Verbindlichkeiten unterscheiden sich Rückstellungen dadurch, dass die Verpflichtung zu künftigen Ausgaben dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss ist.
Sowohl bei Rückstellungen als auch bei Verbindlichkeiten sind die Kriterien des Passivierungsgrundsatzes erfüllt.[10]
Verbindlichkeiten und einem Teil der Rückstellungen (nämlich Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen) ist gemeinsam, dass sie für künftige Ausgaben gebildet werden, die bereits realisierten Erträgen (Pensionsrückstellungen) oder keinen Erträgen (Rückstellungen für Schadenersatz) zuzurechnen sind.
Im Unterschied zu Verbindlichkeiten sowie zu Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen werden Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften für Ausgaben gebildet, die künftigen Erträgen zuzurechnen sind. Ein schwebender Vertrag führt nur dann zum Ansatz einer Schuld, wenn die aus ihm resultierenden Verpflichtungen die Ansprüche übersteigen. Anderenfalls liegt zwar eine wirtschaftliche Verpflichtung des Unternehmens vor, mangels wirtschaftlicher Belastung aber keine Schuld. Die wirtschaftliche Verpflichtung ist im Jahresabschluss gegebenenfalls unter den Haftungsverhältnissen oder im Anhang gemäß § 285 Abs. 3 anzugeben.[11]
Die folgende Übersicht stellt die Abgrenzung der Rückstellungen von den Verbindlichkeiten und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen graphisch dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Baetge, Bilanzen, S. 356.
Grundsätzlich können Rückstellungen aufgrund von Außenverpflichtungen und aufgrund von Innenverpflichtungen gebildet werden.
Bei den Außenverpflichtungen besteht immer eine Verpflichtung gegenüber Dritten. Es handelt sich um Verbindlichkeitsrückstellungen, wenn die Verpflichtungen mit vergangenen Erträgen zusammenhängen. Stehen künftige Ausgaben im Zusammenhang mit künftigen Erträgen, so fordern die Abgrenzungsgrundsätze keine bilanzielle Erfassung der Verpflichtung. Übersteigen aber die künftigen Ausgaben für ein eingeleitetes (schwebendes) Geschäft die erwarteten Erträge von diesem Geschäft, so verlangt das Imparitätsprinzip der Bildung einer Drohverlustrückstellung.
Verbindlichkeitsrückstellungen aufgrund von Außenverpflichtungen werden aufgrund von rechtlichen und aufgrund von faktischen Außenverpflichtungen (z.B. Kulanzrückstellungen) gebildet. Faktische Außenverpflichtungen sind durch sittliche, soziale oder betriebswirtschaftliche Handlungszwänge begründet.
Bei den Rückstellungen für rechtliche Verpflichtungen wird unterschieden zwischen Rückstellungen für bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen (z. B Pensionsrückstellungen) und solche für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen (z.B. Rückstellungen für die Entsorgung von Altlasten).
Bei den Innenverpflichtungen handelt es sich um Verpflichtungen des Bilanzierenden gegenüber sich selbst (Aufwandsrückstellungen).[12]
2.1.2. Rückstellungsbildung aus statischer und dynamischer Sicht
Bei keinem anderen Bilanzposten kommen die Unterschiede zwischen der statischen und der dynamischen Bilanztheorie so deutlich zum Ausdruck wie bei den Rückstellungen.
Aus statischer Sicht dürfen Rückstellungen nur dann gebildet werden, wenn es sich bei den Verpflichtungen um Rechtsverbindlichkeiten gegenüber Ditten handelt (z.B. nur Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften). Ziel ist es, die Schuldendeckungsfähigkeit des Unternehmens durch eine Gegenüberstellung der Schulden und des Vermögens darzustellen.[13]
Aus dynamischer Sicht steht die periodengerechte Erfolgsermittlung im Vordergrund. Rückstellungen sind nicht nur für Verpflichtungen gegenüber Ditten oder drohende Verluste zu bilden, sondern auch für jegliche eigentlich notwendige, aber unterlassene betriebliche Ausgaben, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zur Erzielung von Erträgen erforderlich waren. Typisches Beispiel sind die künftigen Ausgaben für unterlassene Instandhaltung.
Der in § 249 HGB aufgestellte Rückstellungskatalog weist darauf hin, dass der Gesetzgeber des HGB 1985 einen Kompromiss zwischen einer statischen und einer dynamischen Bilanzauffassung gesucht und wahrscheinlich gefunden hat.[14]
2.2. IAS - der Begriff der Rückstellungen (provisions)
Entgegen geäußerten Vermutungen, dass die angelsächsisch-orientierte Rechnungslegung keine oder kaum Rückstellungen kenne, werden in diesem Standard ungewisse Verbindlichkeiten als in der Bilanz auszuweisende Rückstellungen definiert.[15]
Rückstellungen sind in IAS 37.10 definiert als Schulden, die bezüglich des Fälligkeitszeitpunktes oder bezüglich ihrer Höhe ungewiss sind. Damit stellen sie eine Untergruppe der Schulden dar[16] und unterscheiden sich von den sonstigen Schulden allein hinsichtlich des Unsicherheitsgrades des zeitlichen Anfalls und der Höhe der Verpflichtung sowie in einigen Fällen hinsichtlich der Unsicherheit, ob überhaupt eine Verpflichtung vorliegt.[17] Die Abgrenzung zwischen sonstigen Schulden und Rückstellungen ist allerdings schwierig und nicht ganz eindeutig.[18] Die Unsicherheit dem Grunde nach wird in dieser Definition zwar nicht erwähnt, sie ist aber in dem Begriff der Schuld mit enthalten, für den es ausreicht, dass ein Ressourcenabfluss wahrscheinlich ist. Da die Rückstellungen ein Unterfall der Schulden sind, werden deshalb auch Unsicherheiten dem Grunde nach unter den Rückstellungen erfasst.[19]
Die grundsätzlichen Definitionen der Rückstellungen nach HGB bzw. der provisions nach IAS stimmen fast überein; das sind Verpflichtungen, die sich durch Ungewissheit bezüglich ihrer Höhe oder ihres Eintrittes auszeichnen. Sie müssen auch die gleichen Kriterien erfüllen (gegenwärtige Verpflichtung, die aus der Vergangenheit resultiert, dessen Begleichung zu wirtschaftlichem Ressourcenabfluss führen wird sowie Quantifizierbarkeit der Verpflichtung). Die accruals stellen eine weitere Untergruppe der Schulden nach IAS dar. Von den Rückstellungen unterscheiden sie sich durch einen wesentlich höheren Grad der Sicherheit hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt der Erfüllung. Es handelt sich um Schulden, die sich aus der Lieferung von Gütern oder Dienstleistungen ergeben. Ein Leistungstausch hat bereits stattgefunden, wurde aber noch nicht in Rechnung gestellt oder über dessen Entgelt konnte noch nicht geeinigt werden.[20] Hierzu gehören auch an Mitarbeiter geschuldete Beträge. Abgegrenzte Schulden werden häufig als Teil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.[21]
2.3. Ansatz von Rückstellungen
2.3.1. Passivierungsvoraussetzungen nach HGB
Der Passivierungsgrundsatz schreibt vor, welche Sachverhalte als Schulden zu definieren sind und somit auch passivierungsfähig (abstrakte Passivierungsfähigkeit), und welche, deren Sachverhalten keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen (konkrete Passivierungsfähigkeit mit Passivierungspflichten, Passivierungswahlrechten bzw. Passivierungsverboten). Des Weiteren kann eine Schuld angesetzt werden, wenn ein konkretes Passivierungsgebot oder solches Wahlrecht besteht, ohne dass die Voraussetzungen der abstrakten Passivierungsfähigkeit erfüllt sind.[22]
Die Vorschriften für die Passivierung von Schulden werden später in Kap. 3.2.1. beschrieben und sie gelten auch für Rückstellungen.
Diese allgemeine abgeleitete Beschreibung der Schuld, für die eine Rückstellung zu bilden ist, wird durch die Vorschrift des § 249 HGB ergänzt. Demnach besteht Passivierungspflicht für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, für die Nachholung bestimmter Instandhaltungsaufwendungen sowie für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung. Passivierungswahlrechte sind für Rückstellungen für bestimmte, dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnende, innerbetrieblich anfallende Aufwendungen vorgesehen. Dieser Paragraph enthält somit eine Aufzählung verschiedener Tatbestände, die eine Pflicht oder ein Wahlrecht zur Bildung von Rückstellungen vorsehen.[23]
Im Einzelnen lassen sich die in § 249 genannten Rückstellungen in vier Rückstellungsarten gliedern:[24]
1) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten,
2) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
3) Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung (Kulanzrückstellungen) und
4) Aufwandsrückstellungen.[25]
2.3.1.1. Der Ansatz von Verbindlichkeitsrückstellungen
Tatbestandsmerkmale der wichtigsten Fallgruppe, der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, sind Verpflichtungscharakter und Ungewissheit über Bestehen, Entstehen und/oder Höhe der Verbindlichkeit.[26]
Eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist zu bilden, wenn eine wirtschaftlich belastende und in der Höhe quantifizierbare Verpflichtung gegenüber Dritten wahrscheinlich, aber noch nicht sicher ist. Die Außenverpflichtungen lassen sich in faktische und rechtliche Verpflichtungen unterscheiden. Die letzteren wiederum beruhen auf öffentlich-rechtlichen oder bürgerlich-rechtlichen Schuldverhältnissen. Beiden ist gemeinsam, dass diese erst dann zu bilanzieren sind, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind:
1) Die Verpflichtung gegenüber Dritten muss konkretisiert sein. Sie liegt vor, wenn ein Dritte von dem Unternehmen eine bestimmte Leistung rechtlich erzwingen kann, z.B. aufgrund eines Vertrages oder eines gesetzlichen Schuldverhältnisses.
2) Die Verpflichtung muss wirtschaftlich belastend sein. Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn sich bei ihrer Einlösung in der Zukunft eine Bruttovermögensminderung durch den Abgang von Aktiva ergibt, d.h. die durch Rückstellungsbildung entstandenen Ausgaben hängen mit künftigen Erträgen zusammen. In diesem Fall würde das gegen die Abgrenzungsgrundsätze verstoßen, da die Aufwendungen nicht den zugehörigen Erträgen zugerechnet wären. Eine wirtschaftliche Belastung liegt demnach nur dann vor, wenn die Aufwendungen vergangenen Erträgen oder keinen Erträgen zurechenbar sind.[27]
3) Die Verpflichtung muss ihrer Höhe nach quantifizierbar sein. Die Höhe des Betrags muss zumindest im Rahmen einer Bandbreite angegeben werden können. Bei der Bildung einiger Rückstellungen kann man sich an Erfahrungswerten der Vergangenheit orientieren (z.B. Gewährleistungsrückstellungen).
Auch die passivischen latenten Steuern gemäß § 274 Abs.1 Satz 1 HGB erfüllen die Kriterien des Passivierungsgrundsatzes und werden als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten passiviert.[28]
Vergleicht man das handelsrechtliche mit dem steuerrechtlichen Ergebnis und ist das erste aufgrund zeitlicher Ansatz- und Bewertungsunterschiede größer als das steuerrechtliche Ergebnis, so liegt eine öffentlich- rechtliche Verpflichtung zur künftigen Steuermehrzahlung. Die Inanspruchnahme durch den Fiskus ist sicher, nur der Zeitpunkt der Steuernachzahlung ist ungewiss.
Eine wirtschaftliche Belastung liegt vor, da sich das künftige Bruttovermögen durch die Steuermehrzahlung mindert.
Die latente Steuer ist quantifizierbar, da man ungefähr weiß, wann sich die zeitliche Ergebnisunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz umkehren und den Steuersatz geschätzt werden kann.[29]
Beispiele für Rückstellungen aufgrund von bürgerlich-rechtlichen Außenverpflichtungen sind:
- Verpflichtungen aufgrund von Gewährleistungsverträgen,
- Verpflichtungen zur Produkthaftung,
- Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,
- Abrechnungsaufwendungen von Bauaufträgen nach § 14 VOB/B,
- Drohende Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Wechselobligo,
- Haftpflichtansprüche Dritter,
- Prozessaufwendungen,
- Ausstehende Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern
- Jubiläumsrückstellungen.[30]
Zu den Rückstellungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Außenverpflichtungen gehören:
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind,
- Aufwendungen der Betriebsprüfung,
- Latente Steuern,
- Gewerbe-, Körperschaft- und sonstige Steuerzahlungen,
- Aufwendungen der handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung,
- Aufwendungen vorgeschriebener Sicherheitsinspektionen,
- Aufwendungen für Umweltschutz, z.B. für Altlastensanierung[31]
Außer rechtlichen Außenverpflichtungen, können auch faktische Außenverpflichtungen bestehen. Dies ist der Fall, wenn ein Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen ist, Gewährleistungen gegenüber Dritten ohne rechtliche Verpflichtungen zu übernehmen. Wenn solche Verpflichtungen die drei Kriterien des Passivierungsgrundsatzes, nämlich - gegenwärtige Verpflichtung gegenüber Dritten, wirtschaftliche Belastung und Quantifizierbarkeit - erfüllen, sind nach § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 als Kulanzrückstellungen zu passivieren.[32]
2.3.1.2. Der Ansatz von Aufwandsrückstellungen
Bei den Aufwandsrückstellungen herrscht die periodengerechte Erfolgsermittlung als Bilanzierungszweck vor. Die dynamische Bilanztheorie steht im Vordergrund. Sowohl der RFH als der BFH ließen in ihrer Rechtsprechung bestimmte Aufwandsrückstellungen zu.[33]
Nach der BFH-Entscheidung GrS 2/68[34], der das Maßgeblichkeitsprinzip konkretisiert, führen Passivierungspflichten in der Handelsbilanz zu Passivierungspflichten in der Steuerbilanz und Passivierungswahlrechte in der Handelsbilanz zu Passivierungsverboten in der Steuerbilanz.
Da im AktG a. F. über Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung oder Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden, ein Passivierungswahlrecht existierte, folgte somit zwingend, dass man keine Aufwandsrückstellungen in der Steuerbilanz bilden durfte. Als Reaktion darauf wurde in § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB ein Passivierungsgebot eingefügt. Auf diese Weise ist eine steuerliche Anerkennung dieser handelsrechtlichen Rückstellungen gewährleistet.[35]
Außerdem dürfen Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung nach § 249 Abs. 1 Satz 3 gebildet werden, wenn die Instandhaltung nach Ablauf der Frist nach Satz 2 Nr. 1 abgelaufen ist.[36]
Darüber hinaus besteht ein Passivierungswahlrecht für Aufwendungen, die ihrer Eigenart nach genau umschrieben, dem Geschäftsjahr oder früheren Geschäftsjahren zuzuordnen sind, am Abschlusstag wahrscheinlich oder sicher sind, ihrer Höhe und Zeitpunkt des Eintritts aber unbestimmt sind. Der oben genannte BFH-Grundsatz führt somit zu einem Passivierungsverbot in der Steuerbilanz.
Die durch Aufwandsrückstellungen zu berücksichtigenden Verpflichtungen unterscheiden sich von den nach § 249 Abs. 1 Satz 1 zu antizipierenden ungewissen Verbindlichkeiten dadurch, dass ihnen keine rechtliche oder wirtschaftliche Verpflichtung gegenüber einem Dritten zugrunde liegt.[37]
Die Definitionsgrundsätze für den Jahreserfolg erfordern unter Umständen die aufwandswirksame Bilanzierung einer (Innen-)Verpflichtung. Die Passivierungspflicht von Innenverpflichtungen lässt sich mit dem Realisationsprinzip und dem Grundsatz der Abgrenzung der Sache nach (matching principle) begründen.[38]
Auch bei den Aufwandrückstellungen müssen die drei Kriterien des Passivierungsgrundsatzes erfüllt sein . Das Kriterium der Verpflichtung wird bei den Aufwandsrückstellungen durch den Grundsatz der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach konkretisiert. Die durch eine Aufwandsrückstellung zu berücksichtigende Innenverpflichtung ist durch bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr entstandene Erträge begründet.
Der Grundsatz der Sache nach verlangt, den realisierten Erträgen des abzuschließenden Geschäftsjahres die ihnen zuzurechnenden Aufwendungen sachlich zuzuordnen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Instandhaltung aus betriebstechnischen Gründen schon vor dem Abschlussstichtag erforderlich war. Also handelt es sich bei der Innenverpflichtung um eine betriebswirtschaftlich erforderliche Nachholung vorher unterlassener Ausgaben.
Von besonderer Bedeutung für die Aufwandsrückstellungen ist die ausreichende Konkretisierung der Verpflichtung. Anderenfalls könnten Aufwandsrückstellungen vom Bilanzierenden willkürlich gebildet werden.[39] Folglich ist eine Objektivierungsregel notwendig, damit der Bilanzierende solche Rückstellungen möglichst willkürfrei bildet.
Das Kriterium der wirtschaftlichen Belastung ist zum Bilanzstichtag dann erfüllt, wenn die zugrunde liegenden künftigen Ausgaben dem abzuschließenden oder einem früheren Geschäftsjahr zuzurechnen sind.
Als letztes muss die Verpflichtung quantifizierbar sein. Der Rückstellungsbetrag muss zumindest im Rahmen einer Bandbreite angegeben werden.
Typische Beispiele für Aufwandsrückstellungen sind:
- Rückstellungen für unterlassene Großreparaturen,
- Rückstellungen für freiwillige Prüfungen des Jahresabschlusses,
- Rückstellungen für (unterlassene) freiwillige Sozialleistungen,
- Rückstellungen für unterlassene Entsorgungsmaßnahmen,
- Rückstellungen für unterlassene Abbruchvorhaben.[40]
Gemäß IAS 37 stellen diese sog. handelsrechtlichen Aufwandsrückstellungen grundsätzlich keine Rückstellungen dar und sind somit nicht passivierungsfähig. Im Unterschied zu den Verbindlichkeitsrückstellungen und den Drohverlustrückstellungen ist hier entweder das Kriterium der Unentziehbarkeit oder das Kriterium der Verpflichtung gegenüber Dritten nicht erfüllt; d.h. sie sind reine Innenverpflichtungen.[41]
2.3.1.3. Der Ansatz von Drohverlustrückstellungen
Verbindlichkeitsrückstellungen und Aufwandsrückstellungen haben etwas Gemeinsames: der zu ihrer Bildung erfasste Aufwand ist gemäß den Abgrenzungsgrundsätzen der Sache und der Zeit nach Erträgen aus der Vergangenheit zuzurechnen. Drohverlustrückstellungen werden demgegenüber gebildet, obwohl der zugehörige Ertrag erst in der Zukunft anfällt. Ihre Bildung gemäß HGB erfolgt nicht aufgrund der Abgrenzungsgrundsätze, sondern auf Basis des Imparitätsprinzips, nach dem noch nicht realisierte künftige negative Erfolgsbeiträge in das abzuschließende Geschäftsjahr zu antizipieren sind.[42]
Sowohl nach § 249 Abs.1 Satz 1 HGB als auch nach IAS 37. 66 besteht eine Passivierungspflicht für Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.
Ein schwebendes Geschäft im handelsbilanziellen Sinne liegt dann vor, wenn bei einem zweiseitigen verpflichtenden Vertrag noch keiner der Vertragspartner die vereinbarte Lieferung oder Leistung erbracht hat. Der Schwebezustand kann mit dem Abschluss eines Vertrages oder aber schon mit der Abgabe eines bindenden Vertragsangebotes beginnen und endet mit dem Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung durch einen der Vertragspartner.[43]
Diese werden nach der Art des Vertragsgegenstandes in Beschaffungs- und Absatzgeschäfte (auf eine einmalige Leistung gerichtet) sowie in Dauerschuldverhältnisse unterschieden.
Die aus schwebenden Geschäften resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen werden grundsätzlich im Jahresabschluss nicht bilanziert, da eine Aktivierung gegen das Realisationsprinzip verstoßen würde und außerdem würde das keine wirtschaftliche Belastung für den Bilanzierenden darstellen. Übersteigt der Wert der eigenen Leistungen den Wert der zu erwartenden Gegenleistungen, so droht ein schwebendes Geschäft mit einem Verlust in Höhe des Differenzbetrags. Den drohenden Verlust muss das Unternehmen ausweisen und dementsprechend nach § 249 Abs. 1 Satz 1 eine Rückstellung bilden.[44]
Die Möglichkeit eines Verlusteintrittes reicht nicht aus für die Bildung einer Drohverlustrückstellung. Voraussetzung für die Verlustantizipation ist, dass der „Verlust“ für das Unternehmen aufgrund konkreter Tatsachen vorhersehbar ist.[45]
Die Rückstellungspflicht ergibt sich zum einen aus dem in § 252 Abs. 1 Nr. 4 niedergelegten Imparitätsprinzip und zum anderen aus dem Passivierungsgrundsatzes (eine rechtliche Verpflichtung gegenüber Dritten aufgrund eines abgeschlossenen Vertrags, wirtschaftliche Belastung und Quantifizierbarkeit).[46]
Auch nach IAS 37 stellen solche drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Rückstellungen dar. Das ergibt sich zum einen aus den Definitionskriterien, zum anderen aus den Ansatzkriterien. Das verpflichtende Ereignis ist in diesem Fall der Abschluss des Geschäftes, der aufgrund des Verlustes zu einer Verpflichtung führt.[47] Damit eine Bilanzierung in Frage kommt, muss der Vertrag als nachteilig einzustufen sein. Ein Vertrag ist nachteilig, wenn die zur Erfüllung der Verpflichtung unvermeidbaren Kosten höher sind als die zu erwartenden ökonomischen Vorteile.[48]
Die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften unterscheiden sich von den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten dadurch, dass nur der drohende Verpflichtungsüberschuss aus dem schwebenden Geschäft und nicht die Gesamtverpflichtung zurückgestellt wird. Außerdem beruht die Rückstellungsbildung nicht auf dem Grundsatz der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach, sondern auf dem Imparitätsprinzip.[49]
Durch die Rückstellung für drohende Geschäfte werden also nicht künftige, den Erträgen des Geschäftsjahres oder abgelaufenen Geschäftsjahren zuzuordnende Ausgaben, sondern drohende künftige negative Erfolgsbeiträge antizipiert. Nicht die periodengerechte Erfolgsermittlung liegt hier als Bilanzierungszweck zugrunde, sondern die Kapitalerhaltung.[50]
2.3.2. Passivierungsvoraussetzungen nach IAS
Die Bilanzierung und Angabe von Rückstellungen (Provisions), Eventualschulden (Contingent Liabilities) und Eventualforderungen (Contingent Assets) ist in IAS 37 geregelt. Ausgenommen von der Regelung sind gemäß IAS 37.1 solche Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen,
a) die aus zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten resultieren,
b) die aus noch zu erfüllenden Verträgen resultieren; auf belastende Verträge ist der Standard allerdings anwendbar,
c) die Lebensversicherungsunternehmen aus ausgegebenen Policen entstehen oder
d) die durch einen anderen International Accounting Standard abgedeckt werden.
e) Passivische latente Steuern (IAS 12), Pensionsrückstellungen (IAS 12) sowie Verpflichtungen aus Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (IAS 39), sind in einem anderen IAS geregelt.[51]
Gemäß IAS 37.14 sind Rückstellungen zu passivieren, wenn die folgenden drei Ansatzkriterien kumulativ erfüllt sind:
1) ein Unternehmen hat aus einem Ereignis der Vergangenheit eine gegenwärtige Verpflichtung;
2) der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser Verpflichtung ist wahrscheinlich, und
3) die zuverlässige Schätzung der Höhe der Verpflichtung ist möglich.[52]
Wird eines der Ansatzkriterien nicht erfüllt, ist eine Passivierung von Rückstellungen unzulässig. Vielmehr werden solche nicht passivierungsfähigen Tatbestände als Eventualschulden definiert.[53] Daher ist in der Praxis insoweit der Umfang der rückstellungspflichtigen Tatbestände geringer als nach dem deutschen HGB.[54] Diese Ansatzkriterien stimmen weitgehend mit den allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen für die Schulden im framework überein.
2.3.2.1. Gegenwärtige Verpflichtung
Das erste Ansatzkriterium von IAS 37 ist das Bestehen einer Verpflichtung. Dabei wird –analog zum framework - zwischen rechtlichen und faktischen Verpflichtungen unterschieden. Rechtliche Verpflichtungen (legal obligation) entstehen infolge eines privatrechtlichen Vertrags, gesetzlicher Vorschriften oder sonstiger rechtswirksamer Erlasse, so dass sich das Unternehmen der Verpflichtung grundsätzlich nicht entziehen kann.[55]
Für eine faktische Verpflichtung (constructive obligation) formuliert IAS 37 weitere Konkretisierungserfordernisse, die auf eine Unabwendbarkeit der Verpflichtung durch das Unternehmen abstellen. Eine constructive obligation entsteht, wenn
- das Unternehmen durch seine betriebliche Praxis, öffentlich angekündigte Maßnahmen oder eine aktuelle Aussage anderen Parteien gegenüber seine Bereitschaft zur Übernahme bestimmter Verpflichtungen signalisiert hat und
- das Unternehmen dadurch bei den anderen Parteien die berechtigte Erwartung geweckt hat, dass es dieser Verantwortung nachkommt.
Die Betonung der anderen Parteien in beiden Unterkriterien verdeutlicht die Einschränkung faktischer Verpflichtungen auf Außenverpflichtungen.[56] Faktische Verpflichtungen sind erst dann anzusetzen, wenn diese den betroffenen Parteien vor dem Bilanzstichtag detailliert mitgeteilt worden sind.
Die Nichterfüllung der Verpflichtung würde dann möglicherweise zu einem wirtschaftlichen Nachteil (z.B. Reputationsverlust) des Unternehmens führen.[57] Diese Umschreibung entspricht der Unterscheidung zwischen privat- und öffentlich-rechtlichen Ursachen im HGB.
Da das Vorliegen einer faktischen Verpflichtung nicht immer eindeutig ist und sich somit ohne weitere Konkretisierung ein großer Ermessensspielraum bei der Rückstellungsbildung ergeben würde, hat das IASB an die Passivierungsfähigkeit von nicht rechtlich durchsetzbaren Verpflichtungen konkrete, objektivierbare Anforderungen gestellt.[58] Die Zulässigkeit faktischer Verpflichtungen wurde insbesondere vom FASB wegen der damit verbundenen Interpretationsspielräume kritisiert.[59]
[...]
[1] Vgl. Mueller/Gernon/Meek (1987), Accounting: An International Perspective, S. 1.
[2] Vgl. Coenenberg (1997), S. 16.
[3] Vgl. Förschle/Reimer/Scheffels (1997), S. 1.
[4] Vgl. Buchholz, R., Grundzüge des Jahresabschlusses nach HGB und IAS, (2002 ), S. 10.
[5] Vgl. http:// www.rwp.bwl.uni-muenchen.de
[6] Vgl. Ernsting/von Keitz (1998), S. 2477.
[7] Vgl. Coenenberg, A., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 19. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag,
2003, S. 347.
[8] Vgl. Falterbaum, H./Bolk, W./ Reiß, W./ Eberhart, R., Buchführung und Bilanz, in: Grüne Reihe, Bd. 10,
19. Aufl., Erich Fleischer Verlag, Achim 2003.
[9] Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.J./Thiele, S., Bilanzen, 6. aktual. Aufl., IDW –Verlag, Düsseldorf, 2002, S. 355.
[10] Vgl. zum Thema Passivierungsvoraussetzungen für Schulden nach HGB Kap. 2.3.1. und Kap. 3.2.1.
[11] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 355-356.
[12] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 357; s. später zum Thema Kap. 4.
[13] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 358-361.
[14] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 359-361.
[15] Vgl. Tanski, J., Internationale Rechnungslegungsstandards, Beck-Wirtschaftsberater, München, 2002, S. 304.
[16] Vgl. Förschle/Kroner/Heddäus, WPg (1999), S. 42.
[17] Vgl. PricewaterhouseCoopers (Hrsg.), 3rd Edition, 2002, Tz. 37-11.
[18] Vgl. Baetge, IAS-Komm., Teil B, IAS 37, S. 7.
[19] Vgl. Ernsting/von Keitz (1998), S. 2477.
[20] Vgl. Coenenberg, A., (2003) S. 354.
[21] Vgl. Federmann, R./ International Accouting Standards Committee Foundation, IAS/IFRS – stud. 2., ak- tualisierte und erweiterte Auflage, Berlin 2004, S. 344.
[22] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 361.
[23] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 361.
[24] Die nach § 266 Abs. 3 B. in der Bilanz einer großen Kapitalgesellschaft oder einer großen haftungsbe- schränkten Personenhandelsgesellschaft auszuweisenden Rückstellungen sind dagegen wie folgt zu glie- dern: Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen.
[25] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 361.
[26] Vgl. Falterbaum/Bolk/Reiß, Buchführung und Bilanz, S. 872.
[27] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 362-364.
[28] Vgl. später zum Thema latente Steuern Kap. 4.
[29] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 364.
[30] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 365.
[31] Vgl. Baetge, J./ Philipps, H., Rückstellungen für Altlastensanierung, S. 57-66.
[32] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 366.
[33] Vgl. Moxter, A., Bilanzrechtsprechung, 5. Auflage, S. 90-94.
[34] Vgl. BFH, Beschluss vom 03.02.1969-GrS 2/68, S. 291-294.
[35] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 367.
[36] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 367.
[37] Vgl. Moxter, A., Bilanzrechtsprechung, 5. Aufl., S. 90-94.
[38] Vgl. Moxter, A., Bilanzrechtsprechung, 2. Aufl., S. 83 und S. 89.
[39] Vgl. Ballwieser, W., Allgemeine Grundsätze, S. 15.
[40] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 369-372.
[41] Vgl. Baetge, IAS-Komm., Teil B, IAS 37, Rn. 182.
[42] Vgl. Moxter, A., Zur Abgrenzung von Verbindlichkeitsrückstellungen und Verlustrückstellungen, S. 1477-1480.
[43] Vgl. BFH, Urteil vom 16.11.1982 – VIII R 95/81, S. 361-364.
[44] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 373.
[45] Vgl. Baetge/Knüppe, Vorhersehbare Risiken und Verluste, S. 395-397.
[46] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 373-374.
[47] Vgl. Baetge, IAS-Komm., Teil B, IAS 37, Rn. 180.
[48] Vgl. IAS 37. 10.
[49] Vgl. Groh, M., Verbindlichkeitsrückstellung und Verlustrückstellung , S. 27.
[50] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 374.
[51] Vgl. Baetge, J., Bilanzen, (2002), S. 403.
[52] Vgl. Baetge, IAS-Komm., Teil B, IAS 37, Rn. 25.
[53] Vgl. später zum Thema Kap. 2.5.
[54] Vgl. Tanski, J., Internationale Rechnungslegungsstandards, 2002, S. 306.
[55] Vgl. Baetge, IAS-Komm., Teil B, IAS 37, Rn. 16.
[56] Vgl. Pellens, B., Internationale Rechnungslegung, S. 443; Ernsting, I./Keitz, I. v., Bilanzierung von Rück- stellungen nach IAS 37, S. 2478.
[57] Vgl. Förschle/Holland/Kroner, 5. Auflage, 2001, S. 216.
[58] Vgl. Förschle/Kroner/Heddäus, WPg 1999, S. 45.
[59] Vgl. Herzig/Köster (1999), Rn. 63.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832486563
- ISBN (Paperback)
- 9783838686561
- DOI
- 10.3239/9783832486563
- Dateigröße
- 636 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Fachhochschule Norddeutschland Osnabrück – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (März)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- bilanzierung bilanzen passivposten rechnungslegungsstandards
- Produktsicherheit
- Diplom.de