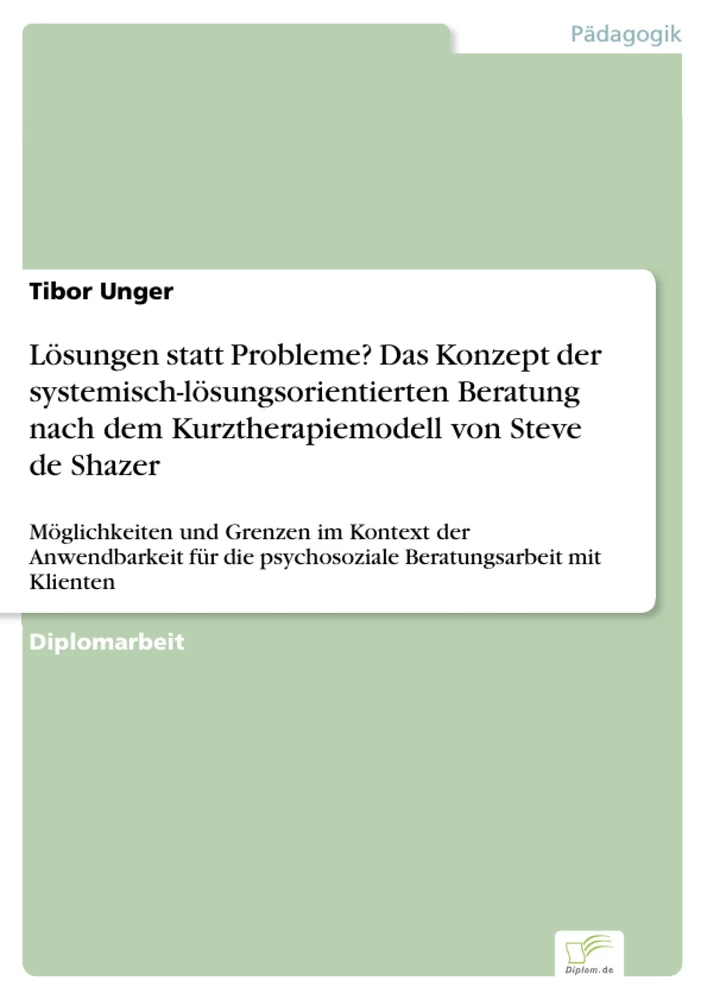Lösungen statt Probleme? Das Konzept der systemisch-lösungsorientierten Beratung nach dem Kurztherapiemodell von Steve de Shazer
Möglichkeiten und Grenzen im Kontext der Anwendbarkeit für die psychosoziale Beratungsarbeit mit Klienten
Zusammenfassung
Die Anregung zur Beschäftigung mit dem Thema entstand durch ein Praktikum in der sozialpädagogischen Familienberatungsstelle, einem Projekt der Freien Universität Berlin. Diese Einrichtung orientiert ihre sozialpädagogische Arbeit an Erkenntnissen, Modellen und Methoden der systemischen Familientherapie, um sie in der psychosozialen Beratung mit Einzelpersonen, Paaren und Familien umzusetzen.
Psychosoziale Beratung erfordert individuumübergreifende (system-)theoretische Konzepte. Selbst wenn nur ein einzelner Klient in die Beratung kommt, kann man ihn in seinem sozialen Kontext betrachten und gedanklich die für den Klienten wichtigen Systeme mit in die Beratung einbeziehen. Die systemische Familienberatung ist nicht pathologieorientiert, sondern ressourcenorientiert, setzt also bei den in der Familie vorhandenen Ressourcen an, die gemeinsam mit ihr aktiviert werden. Die Klienten bestimmen dabei ihre Ziele selbst und versuchen gemeinsam mit dem Berater , neue Lösungswege zu finden und zu erproben. In diesem Sinne kann Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden, in dem sie die Selbstheilungskräfte der Klienten, die in einer akuten Lebenskrise verloren gingen, reaktiviert.
Bei der Auseinandersetzung mit den theoretischen und praktischen Erkenntnissen der systemischen Familientherapie und Beratung wurde ich auf das Konzept der lösungsorientierten Beratung aufmerksam, das auf dem Kurztherapiemodell Steve DE SHAZERs und seinem Team vom Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee (USA) basiert. Einer der wichtigsten Grundsätze besteht hier in der Annahme, dass entgegen traditioneller Vorstellungen Ursache, Genese und Art der Aufrechterhaltung von Problemen nicht bekannt sein müssen, um eine Lösung erreichen zu können.
Der Ansatz beinhaltet Vorschläge zur Einteilung des Beratungsprozesses in Phasen sowie zur Gestaltung der Kommunikation mit Klienten. Der Fokus in der lösungsorientierten Beratung richtet sich konsequent auf Informationen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Lösungen und auf das Entdecken zieldienlicher Ressourcen. WALTER/PELLER (1999) beschreiben eine mit diesem Grundsatz korrespondierende Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und auf die Zukunft. Deshalb soll man sich auf lösungs-orientiertes Sprechen konzentrieren und nicht auf problem-orientiertes (ebd. S. 53).
Ausgehend von dem Zitat DE SHAZERs Problem talk creates problems, solution talk creates solutions! (vgl. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hintergrund der Themenwahl
1.2 Aufgabenstellung, Ziel und Gliederung der Arbeit
2 Beratung und Therapie
2.1 Unterscheidung und Abgrenzung
2.2 Fazit
3 Systemtheoretische Grundlagen
3.1 Historischer Kontext
3.2 Merkmale und Regeln von Systemen
3.3 Kybernetik
3.4 Homöostase
3.5 Autopoiese
3.6 Konstruktivismus
4 Systemische Sichtweisen in der Familientherapie
4.1 Das strategische Modell der Palo-Alto-Gruppe
4.1.1 Interventionstechnik Reframing
4.1.2 Vorgehensweise
4.2 Das Mailänder Modell
4.2.1 Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität
4.2.2 Vorgehensweise
4.3 Auf dem Weg zur Lösung
5 Modell der lösungsorientierten Kurztherapie und Beratung
5.1 Steve de Shazer und das BFTC
5.1.1 Therapie als Konversation
5.1.2 Der Einfluss Milton Ericksons
5.2 Die Leitlinien und Grundprinzipien
5.2.1 Lösungen statt Probleme
5.2.2 Der humanistische Hintergrund
5.3 Methodik des BFTC – der lösungsorientierte Beratungsprozess
5.3.1 Teil 1 – Sequenz 1: Feststellen des Anliegens
5.3.2 Teil 1 - Sequenz 2: Exploration der Ausnahmen
5.3.3 Teil 1 – Sequenz 3: Die Wunderfrage
5.3.4 Teil 1 – Sequenz 4: Die Skalierungsfrage
5.3.5 Teil 2: Die Konsultationspause
5.3.6 Teil 3: Mitteilen der Botschaft
5.3.7 Zweite und folgende Sitzungen
5.3.8 Abschluss der Beratung
6 Möglichkeiten und Grenzen des lösungsorientierten Konzepts
6.1 Möglichkeiten
6.2 Grenzen
7 Schlussbetrachtung
8 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hintergrund der Themenwahl
Die Anregung zur Beschäftigung mit dem Thema entstand durch ein Praktikum in der sozialpädagogischen Familienberatungsstelle, einem Projekt der Freien Universität Berlin. Diese Einrichtung orientiert ihre sozialpädagogische Arbeit an Erkenntnissen, Modellen und Methoden der systemischen Familientherapie, um sie in der psychosozialen Beratung mit Einzelpersonen, Paaren und Familien umzusetzen.
Psychosoziale Beratung erfordert individuumübergreifende (system-)theoretische Konzepte. Selbst wenn ’nur’ ein einzelner Klient[1] in die Beratung kommt, kann man ihn in seinem sozialen Kontext betrachten und gedanklich die für den Klienten wichtigen Systeme[2] mit in die Beratung einbeziehen. Die systemische Familienberatung ist nicht pathologieorientiert, sondern ressourcenorientiert, setzt also bei den in der Familie vorhandenen Ressourcen an, die gemeinsam mit ihr aktiviert werden. Die Klienten bestimmen dabei ihre Ziele selbst und versuchen gemeinsam mit dem Berater[3], neue Lösungswege zu finden und zu erproben. In diesem Sinne kann Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden, in dem sie die Selbstheilungskräfte der Klienten, die in einer akuten Lebenskrise verloren gingen, reaktiviert.
Bei der Auseinandersetzung mit den theoretischen und praktischen Erkenntnissen der systemischen Familientherapie und Beratung wurde ich auf das Konzept der lösungsorientierten Beratung aufmerksam, das auf dem Kurztherapiemodell Steve DE SHAZERs und seinem Team vom Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee (USA) basiert. Einer der wichtigsten Grundsätze besteht hier in der Annahme, dass – entgegen traditioneller Vorstellungen – Ursache, Genese und Art der Aufrechterhaltung von Problemen nicht bekannt sein müssen, um eine Lösung erreichen zu können.
Der Ansatz beinhaltet Vorschläge zur Einteilung des Beratungsprozesses in Phasen sowie zur Gestaltung der Kommunikation mit Klienten. Der Fokus in der lösungsorientierten Beratung richtet sich konsequent auf Informationen über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Lösungen und auf das Entdecken zieldienlicher Ressourcen. Walter/Peller (1999) beschreiben eine mit diesem Grundsatz korrespondierende Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und auf die Zukunft. Deshalb soll man sich auf lösungs-orientiertes Sprechen konzentrieren und nicht auf problem-orientiertes (ebd. S. 53).
1.2 Aufgabenstellung, Ziel und Gliederung der Arbeit
Ausgehend von dem Zitat de Shazers „Problem talk creates problems, solution talk creates solutions!“ (vgl. Schlippe/Schweitzer 2000, S. 35) entstand der Titel der vorliegenden Arbeit Lösungen statt Probleme? Das Konzept der systemisch - lösungsorientierten Beratung nach dem Kurztherapiemodell von Steve de Shazer. Der Untertitel Möglichkeiten und Grenzen im Kontext der Anwendbarkeit für die psychosoziale Beratungsarbeit mit Klienten wurde hinzugefügt, um der Darstellung und Betrachtung eine kritische Auseinandersetzung innerhalb der vorhandenen Literaturquellen bezüglich dieses lösungsorientierten Modells hinzuzufügen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die systemtheoretischen Gedanken darzustellen und die Implementierung der vorhandenen Theorien im psychosozialen-beraterischen Kontext mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten darzustellen. Im Anschluss daran soll das lösungsorientierte Modell de Shazers eingehend betrachtet und auf Möglichkeiten und Grenzen hin untersucht werden. Im Detail folgt diesem Ziel folgende Logik des Aufbaus:
Nach einer kurzen Einleitung beschäftigt sich zunächst das zweite Kapitel mit den in der Literatur immer wieder synonym verwendeten Begriffe Beratung und Therapie. Diese Unterscheidung erscheint am Anfang dieser Arbeit sinnvoll, da im Folgenden die Begriffe konsequent angewendet werden können und somit Missverständnisse von vornherein verhindert werden.
Das dritte Kapitel widmet sich ausschließlich den systemtheoretischen Grundlagen. Deren Implikationen für die Entwicklung einer systemischen Sichtweise in der Familientherapie und Beratung, sowie weitere ausgewählte Modelle der systemischen Praxis, die für die Darstellung des lösungsorientierten Konzeptes bedeutsam sind, werden im vierten Kapitel vorgestellt. In diesem Kontext werden vor allem das strategische Modell der Palo-Alto-Gruppe um WATZLAWICK und WEAKLAND, sowie das Mailänder Modell von Selvini Palazzoli u.a. vorgestellt.
Im fünften Kapitel wird dann das Konzept der lösungsorientierten Beratung, das auf dem Kurztherapiemodell Steve DE SHAZERs basiert, dargestellt. Hierbei werden folgende Fragen berücksichtigt:
- Weshalb scheint es sinnvoll, sich diesem Beratungskonzept zufolge, allein auf Lösungen und Ressourcen zu konzentrieren?
- Welche Grundprinzipien und Leitlinien sind – hinsichtlich der Abwendung von der Problemanalyse - mit diesem Konzept verbunden?
- Welche methodischen Elemente stellt das lösungsorientierte Modell bereit, um auch lösungs- und ressourcenorientiert vorgehen zu können?
- Wie gestaltet sich der lösungsorientierte Beratungsprozess?
Möglichkeiten und Grenzen des lösungsorientierten Konzeptes im Hinblick auf psychosoziale Beratung werden abschließend im Hinblick auf die Fachliteratur im sechsten Kapitel reflektiert.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Schlussbemerkung im siebten Kapitel, in der eine persönliche Bilanz, die die theoretischen Erkenntnisse mit den Erfahrungen in der praktischen Anwendung verbindet.
2 Beratung und Therapie
Bei der Auswertung der Quellen wurde zunächst die Feststellung gemacht, dass die Autoren – im Kontext systemischer Literatur - generell zur synonymen Verwendung der Begriffe Beratung und Therapie neigen. Dieses mag aus der Tatsache resultieren, dass Konzeptionen von psychosozialer Beratung untrennbar verknüpft sind mit Entwicklungen, Modellen und Methoden aus der klinischen, psychotherapeutischen Forschung.
Gerade weil sich viele der Autoren zwar der Bedeutung dieser beiden Hilfe-Formen bewusst sind, dennoch aber in ihren Ausführungen die Begriffe Beratung und Therapie scheinbar willkürlich synonym verwenden, scheint es umso wichtiger, zunächst den Versuch einer Klärung und begrifflichen Einordnung vorzunehmen.
Ein kurzer Exkurs: Seit den siebziger Jahren kam es in Deutschland zu einer gewaltigen Verbreitung psychologischen Wissens (vgl. Belardi et al. 1996, S. 40). Psychotherapeutische Begriffe werden zunehmend in den Medien, im Alltag und auch in der zwischenmenschlichen Interaktion oder Diskussion benutzt. Die Suche der Menschen nach Sinn und neueren, individualisierteren Lebensentwürfen begünstigte diesen regelrechten “Psychoboom“. Die sozialpädagogische Beratung ist hiervon nicht unbeeinflusst geblieben. Einerseits müssen hier neue Erkenntnisse benachbarter Felder berücksichtigt werden, andererseits dürfen die breiter angelegten Beratungsaufgaben der Sozialpädagogik nicht mit der eher in die Tiefe der Persönlichkeit und Lebensgeschichte gehenden Psychotherapie verwechselt werden.
Dennoch können sich aus einem psychosozialen (sozialpädagogischen) Beratungsprozess heraus fließende Grenzen zu einer therapeutischen Situation entwickeln. Wenn die Übergänge zwischen Beratung und Therapie fließend sein können, wie lassen sich dann die Grenzen näher bestimmen?
2.1 Unterscheidung und Abgrenzung
Beratung und Therapie lassen sich anhand von zentralen Strukturmerkmalen, wie z. B. dem institutionellen Rahmen, dem Anlass, der Dauer, der Mittel bzw. Methodik, dem Schwerpunkt und der Zielsetzung unterscheiden oder abgrenzen.
Psychosoziale Beratung findet in sozialpädagogischen Einrichtungen statt und weniger in der psychotherapeutischen Praxis. Als funktionale Beratung (z. B. im Jugendamt) oder als institutionale Beratungsmöglichkeit (z. B. Familienberatung, Eheberatung u. a.). Freiwilligkeit stellt hierbei ein Wesensmerkmal sozialpädagogischer Beratungsarbeit dar (vgl. Belardi et al. 1996, S. 41). Während Beratung fast ausschließlich ambulant durchgeführt wird, kann die intensive Arbeit mit psychisch schwer beeinträchtigten Menschen im Rahmen einer Therapie auch teilweise stationär erfolgen (vgl. Brem-Gräser 1996, S. 13). Institutionell ist Therapie eher formell, das heißt an Ort, Zeit, Struktur gebunden und wird vorwiegend von professionellen Therapeuten ausgeübt, welche durch ihre spezifische Ausbildung einer bestimmten Therapierichtung angehören (ebd. 1996, S. 15).
Der Anlass bzw. die Gründe für eine Beratung können vielfältig sein. So sind es meist konkrete und häufig akute Schwierigkeiten und Alltagsprobleme, die subjektiv als belastend und schwer lösbar erlebt werden und daher als beratungsrelevant erscheinen, z. B. Partnerschaftsprobleme, Familienprobleme, Erziehungs- und Berufsschwierigkeiten. Anlass für eine Therapie besteht hingegen u.a. bei chronisch gewordenen innerpsychischen Konflikten und Problemen. Diese können in Fehl- und Ersatzlösungen verarbeitet werden , welches zu einem starken, unlösbaren Leidensdruck führen könnte. Diese Belastungen sind in der Regel therapiebedürftig (vgl. Brem-Gräser 1996, S. 8).
Bezüglich der Dauer verlaufen Beratungsprozesse eher diskontinuierlich, zeitlich überwiegend kürzer und seltener ab als Therapien, die unter Umständen mehrere Jahre dauern können (vgl. Belardi et al. 1996, S. 41).
Bezüglich der Wahl der Mittel ist die Beratung in der Sozialpädagogik nicht an einer psychotherapeutischen Richtung orientiert. Sie nutzt vielmehr alle Möglichkeiten vorhandener Ansätze (z. B. systemischer Familientherapie, verhaltensorientierter oder tiefenpsychologischer Konzepte), die miteinander vereinbar und Erfolg versprechend sind (vgl. Belardi et al. 1996, S. 41).
Den Schwerpunkt in der Beratung bildet überwiegend der Blick auf die Gegenwart und Zukunft des Klienten und weniger auf die Vergangenheit. Im Gegensatz zur Therapie stehen die inneren, seelischen Prozesse der Ratsuchenden nicht so sehr im Mittelpunkt. Den Schwerpunkt der Therapie bildet meist die intensivere Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit und den zumeist in der Vergangenheit liegenden Ursachen für psychische Probleme.
SCHAUB/ZENKE (1997, S. 56) definieren als Zielsetzung von Beratung, „durch Informationen, klärende Gespräche, Ermutigung und die gemeinsame Erarbeitung von Entscheidungshilfen den Ratsuchenden zur Selbsthilfe zu befähigen.“ Des Weiteren skizzieren die Autoren in ihrer Definition von Beratung einen Prozess, der sich in der Regel durch folgende Arbeitsschritte kennzeichnet (ebd. S. 56):
1. Klärung des Beratungsanliegens,
2. Entwicklung von verschiedenen Lösungsansätzen,
3. Sammlung entscheidungsrelevanter Informationen,
4. Auswertung der Informationen,
5. Erarbeitung von Entscheidungskriterien,
6. Hilfen beim Entscheidungsprozess und
7. Angebote an Realisierungshilfen.
Als Zielsetzung von Beratung schlussfolgert sich hieraus die Wiederherstellung eines begrenzten Bereichs personaler Kompetenz und Bereitschaft, sowie die Förderung der Selbsthilfeintention, der Selbststeuerungsfähigkeit und der Handlungskompetenz des Klienten (vgl. Brem-Gräser 1996, S. 8). Die stützende Verfahrensweise der Beratung bedient sich nach Brem-Gräser (1996, S. 16) stabilisierender, aufbauender, motivierender oder anleitender Methoden. Dabei greift sie in der Regel nicht auf analytisches Vorgehen zurück. Ihr Ziel ist es, im Vergleich zur Therapie, weniger die heilende Erforschung der seelischen Tiefen und damit verbunden, grundlegende Persönlichkeitsveränderungen zu erreichen, sondern vielmehr dem Klienten Hilfestellung beim Gewinnen von Perspektive und Kraft zu geben: „[...] um seine (wenn auch noch so begrenzten) Kräfte zur Bewältigung seiner Situation wirksamer einsetzen zu können.“ (Brem-Gräser 1996, S. 16).
Abschließend kann man bei der Gegenüberstellung von Beratung und Therapie auf die drei von Alterhoff (1983) formulierte Punkte verweisen, die folgende Ergebnisse zeigen:
1. Zwischen Therapie und Beratung ist kein grundsätzlicher Unterschied zu erkennen.
2. Beratung und Psychotherapie lassen sich an Hand einer Reihe von Kriterien als je eigenständige Maßnahmen beschreiben.
3. Beratung ist der umfassendere Begriff, Psychotherapie eher ein Spezialfall von Beratung ( vgl. Alterhoff 1983, In: Brem-Gräser 1996, S. 9).
2.2 Fazit
Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass trotz der geschilderten Unterschiede bezüglich der Strukturmerkmale zwischen Beratung und Therapie es einen Bereich gibt, in dem diese Grenzen nicht immer klar sein können und deswegen im Beratungsprozess möglicherweise fließend ineinander übergehen. Falls man in der sozialpädagogischen Beratung immer wieder an denselben Punkt einer verfestigten Lebensproblematik mit tieferen Ursachen kommt, so handelt es sich hierbei um den Bereich , den Psychotherapeuten als seelische Beeinträchtigung oder psychische Erkrankung bezeichnen. An dieser Stelle intensiv fortzufahren würde bedeuten, die Grenze zur Psychotherapie zu überschreiten (vgl. Belardi 1996, S. 43). Daraus wird deutlich, dass es keine ideale Grenzziehung zwischen Beratung und Therapie geben kann. Sozialpädagogische Berater müssen sich daher besonders ihrer Grenzen bewusst werden und ggf. rechtzeitig auf andere Institutionen verweisen können.
3 Systemtheoretische Grundlagen
Systemisches Denken hat in den unterschiedlichsten Disziplinen und Bereichen Einzug gehalten. In der Psychotherapie, der Organisationsberatung aber auch in Managementseminaren ist von systemischem Denken als einer Basiskompetenz die Rede. Die Systemtheorie bildet dabei den theoretischen Hintergrund, der sich aus verschiedenen Theorien der Biologie, Mathematik, Psychologie, Soziologie und anderen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt hat.
„Die Allgemeine Systemtheorie kann als Meta- bzw. Rahmentheorie verstanden werden, deren Ziel in der Integration und interdisziplinären Anwendung der verschiedenen Wissenschaften Ausdruck findet.“ (Böse/Schiepek 1989, S. 218).
Im Folgenden wird der historische Kontext, die Merkmale von Systemen sowie grundlegende systemtheoretische Erkenntnisse, die für die Entstehung einer systemischen Sichtweise bedeutsam sind und mit den Begriffen Kybernetik, Homöostase und Autopoiese verbunden werden, genauer erläutert.
3.1 Historischer Kontext
Bereits Ende der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden erste Ansätze zum systemischen Denken von dem Biologen Ludwig VON BERTALANFFY formuliert und bis zum Ende der vierziger Jahre zur sogenannten Allgemeinen Systemtheorie weiterentwickelt. VON BERTALANFFY gilt als einer der wichtigsten Gründungsväter neuerer systemtheoretischer Entwicklungen. Seine Grundidee bestand in der Annahme, dass sich in Systemen von belebter und unbelebter Natur ähnliche Strukturen und Prozessmerkmale feststellen lassen (vgl. Miller 1999, S. 26f.). Im Rahmen seiner Systemtheorie war VON BERTALANFFY der Ansicht, dass es Prinzipien und Gesetze geben müsse, die für alle Systeme im allgemeinen gelten, unabhängig, ob es sich um Systeme von biologischer, physikalischer oder sozialer Natur handelt.
3.2 Merkmale und Regeln von Systemen
Ein System wird als eine aus Elementen geordnete, zusammengesetzte Ganzheit definiert. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass diese Ganzheit sich qualitativ neu und anders verhält als die Summe ihrer isoliert betrachteten Einzelteile (vgl. Simon/Stierlin 1984, S. 355). Übertragen auf das System Familie bedeutet dies, dass jeder einzelne mit dem anderen so verbunden ist, dass eine Änderung des einen automatisch eine Veränderung des gesamten (Familien-) Systems nach sich zieht (vgl. Watzlawick et. al. 1990, S. 119).
Der Begriff Regel im systemischen Kontext bezeichnet die Gesetzmäßigkeit im Verhalten eines Systems. Sie beschreibt die Wiederkehr von Ereignissen und Verhaltensweisen (Redundanz), die die Interaktion eines Systems bestimmt. Die Wiederholung der Interaktion erweist sich als die dem System eigenen Strukturen und Muster, die bestimmen, welche Verhaltensformen zulässig sind und welche nicht (vgl. Simon/Stierlin 1984, S. 291). Im allgemeinen beziehen sich Regeln auf die Definition der Beziehung und die jeweilige Identitätsfindung der einzelnen Systemmitglieder. Sie umfassen alle Aspekte einer Beziehung, mit denen sich ein System in der Balance hält und gleichzeitig Stabilität und Entwicklung gesteuert werden können. Regeln können offen oder verdeckt, funktional oder düsfunktional sein (vgl. Schlippe 1991, S. 27).
3.3 Kybernetik
Kybernetik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Lehre von den sich selbst steuernden und regulierenden Systemen und ist daher mit der Systemtheorie eng verbunden. Ein zentrales Merkmal von Systemen liegt in ihrer Zirkularität, nach deren Grundsatz sich alle Prozesse innerhalb eines Systems einander wechselseitig bedingen. Kybernetik geht davon aus, dass Funktionen wie Steuerung, Regelung, Informationsaustausch und -verarbeitung bei Maschinen, Organismen und sozialen Gebilden den gleichen Prinzipien folgen. Ein wesentlicher Bestandteil eines kybernetischen Systems ist der Regelkreis. Seine stabilisierende Dynamik schafft die Grundlage für das selbstorganisierende, autonome Verhalten von Systemen. Im engeren Sinn besteht der Regelkreis aus zwei Elementen, zum einen aus der zu regelnden Größe, zum anderen aus dem Regler, der diese verändern kann. Durch den Kreislauf ist das System mit sich selbst rückgekoppelt (vgl. Böse/ Schiepek 1989, S. 99).
Systeme, die sich durch auf sich selbst zurückwirkende (rekursive) Kreisläufe organisieren, stabilisieren und aufrechterhalten werden als zirkulär beschrieben. Was in einem kybernetischen Regelungskreislauf als Output erscheint, wirkt gleichsam auch als neuer Input, also ein endloser Kreis (vgl. Watzlawick et. al. 1990, S. 121). Dieser Denkansatz ist zwar geeignet, auch auf menschliche Regelsysteme bezogen zu werden, allerdings ist menschliches, regelgeleitetes Handeln nicht vollständig auf diese Theorie reduzierbar – Kybernetik kann nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit verdeutlichen. Die kybernetische Analysemethode ist allerdings der komplexen Wirklichkeit wesentlich angemessener als die vorherrschende Ursache-Wirkungs-Erklärung. Bezogen auf den therapeutischen Kontext ist der Grundgedanke bei der Kybernetik der, dass ein außenstehender Beobachter (Berater/Therapeut) ein (Familien-)System beobachtet, analysiert und auf dieser Grundlage mit einer zielgerichteten Intervention beeinflussen kann.
Dieses Konzept der sogenannten Kybernetik 1. Ordnung unterlag jedoch sehr schnell dem Verdacht, Aussagen darüber treffen zu können, wie ein System wirklich funktioniert. Diese Theorie über beobachtete Systeme wurde kritisch betrachtet, da sie nichts über den Beobachter aussagt und damit Begriffe wie Kontrolle, Regelung und Steuerung impliziert (vgl. Schlippe/Schweizer 2000, S. 53).
Daher kam es zur Entwicklung der Theorie über den Beobachter, der ein System beobachtet, der sog. Kybernetik 2. Ordnung:
„ Bei der Kybernetik 2. Ordnung werden die kybernetischen Prinzipien auf die Kybernetik selbst bezogen (daher zweite Ordnung), es geht um die ’Landkarten’, um die Fragen, wie menschliche Erkenntnis kybernetisch organisiert ist. Es wird bezweifelt, dass es ’da draußen’ objektiv vom Therapeuten erkennbare Systeme gibt. Vielmehr müssen der Beobachter und seine Erkenntnismöglichkeiten als Teil des Kontextes, den er beobachtet, mitkonzeptualisiert werden. Zwangsläufig ergibt sich daraus eine Abgrenzung zu Modellen, die Hierarchie und Kontrolle implizieren.“ (Schlippe/Schweitzer 2000, S. 53)
Der Beobachter (Therapeut/Berater) ist aus dieser Sicht nun ein Teil des (Familien-) Systems. Er befindet sich nicht mehr außerhalb und losgelöst vom System. Im Sinne der Kybernetik 2. Ordnung werden nicht die Eigenschaften der Systemteile, sondern ihre Beziehungen untereinander beobachtet und beschrieben.
3.4 Homöostase
Der Begriff der Homöostase beschreibt einen Gleichgewichtszustand innerhalb eines Systems. Dieser darf jedoch nicht statisch betrachtet werden, da lebende Systeme sich permanent in Bewegung befinden. Jedes lebende System muss Einflüsse jeder Art, ob von innen oder außen, auffangen und verarbeiten. Ihnen stellt sich einerseits das Problem, ihre Stabilität zu erhalten und andererseits die Bedingung, sich verändern zu müssen. Dieser Prozess wird in Analogie zum Regelkreis aus der Kybernetik durch zwei Mechanismen bedingt:
1. Die Fähigkeit zur Stabilität erfolgt durch negative Rückkoppelungspro-zesse.
2. Die Fähigkeit zur Veränderung entsteht durch positive Rückkoppelungs-prozesse.
Homöostase ist erkennbar, wenn die Rückkopplung zwischen System und Umwelt einen stabilen Wert ergibt und das System in Bezug auf Verhalten, Zustand und Struktur gleich erscheint (vgl. Simon 1988, S. 55). Die Mechanismen der Rückkopplung, auch Feedback genannt (vgl. Hoffman 1984), werden nach zwei möglichen Erscheinungsformen differenziert:
1. Die negative, kompensierende Form des Feedbacks begünstigt die Stabilisierung eines Systems, in dem es Abweichungen ausgleicht.
2. Das positive Feedback dagegen wirkt verstärkend auf Abweichungen und führt zu einem neuen homöostatischen Niveau.
Dabei sind morphostatische (Status Quo erhaltende) und morphogenetische (Entwicklungsfördernde) Systemkräfte wirksam (vgl. Hoffman 1984, S. 51f.).
Aus Sicht der systemischen Beratung führt die Homöostase laut SCHLIPPE/SCHWEITZER (2000, S. 62) zu zwei Problemen. Zum einen verleitet es den Therapeuten dazu, von außen den Sollzustand zu definieren, zum anderen fehlt die Möglichkeit, dass sich das System von selbst in neue, unvorhergesehene, kreative Zustände versetzen kann.
Das Konzept der Homöostase stellt die Mechanismen der Strukturerhaltung in den Mittelpunkt, nicht aber die des Strukturwandels. Letzteres soll nun anhand des Konzeptes der Autopoesie erläutert werden.
3.5 Autopoiese
Die Fähigkeit eines (biologischen) Systems, seine Strukturen an die Umwelt anzupassen und ggf. zu verändern, wird Selbstorganisation genannt. Die Biologen MATURANA und VARELA (1987) prägten hier den Begriff der Autopoiese (aus dem Griechischen wörtlich ‘Selbsterzeugung’) und schlugen ursprünglich vor, den Begriff der Autopoiese auf die Beschreibung von Zellnetzwerken zu beschränken und den allgemeineren Begriff der organisatorischen Geschlossenheit, der keine Produktionsprozesse spezifiziert, auf alle anderen lebenden Systeme anzuwenden.
Der Soziologe Niklas LUHMANN hingegen hat eine Theorie der sozialen Autopoiese entwickelt, mit der er die These vertritt, dass soziale Systeme zwar autopoietisch, aber keine lebenden Systeme seien. Ein für ihn zentrales Element sozialer Netzwerke ist die Kommunikation:
„Soziale Systeme bedienen sich der Kommunikation als ihres besonderen Modus der autopoietischen Reproduktion. Ihre Elemente sind Kommunikationen, die von einem Netzwerk von Kommunikationen rekursiv produziert und reproduziert werden und außerhalb eines solchen Netzwerks nicht existieren können.“ (Luhmann In: Capra 2002, S. 115)
Lebende, offene Systeme sind ständig sich verändernden Umweltbedingungen ausgesetzt. Um dem Streben nach Homöostase entgegen zu kommen, ist es für ein System erforderlich, sich an seine Umwelt anzupassen. Der Prozess der Selbst-Aufrechterhaltung ist die spezifische Organisationsform lebender Systeme, die mit dem Konzept der Autopoiese beschrieben wird. Der Fortbestand eines Systems hängt von dessen Wandlungsfähigkeit ab. Ein System, das sein Gleichgewicht verloren hat und es versucht, wiederherzustellen, verändert sich und damit auch die Bedingungen seiner Umwelt. Dies wiederum verändert seine Strukturen.
Autopoietische Systeme produzieren und reproduzieren ständig sowohl ihre einzelnen Elemente als auch die Organisation der Beziehungen zwischen diesen
Elementen in einem rekursiven Prozess. Ein sehr häufig verwendetes Beispiel hierfür ist die Körperzelle, die fortwährend ihre Bestandteile (Moleküle) und zugleich jene Elemente, die die Zelle nach außen abgrenzen (Membran), erzeugt, um damit die Weiterproduktion von Molekülen (und somit das Überleben der Zelle) zu ermöglichen (vgl. Schlippe/Schweitzer 2000, S. 68). Dazu Mikrobiologin Lynn MARGULIS:
„Stoffwechsel, der unaufhörliche chemische Vorgang der Selbsterhaltung, ist eine unverzichtbare Eigenschaft des Lebendigen... Nur durch diesen ständigen Fluss von chemischen Verbindungen und Energie kann sich das Leben ununterbrochen selbst hervorbringen, reparieren und fortpflanzen. Nur in Zellen und in Organismen, die aus Zellen bestehen, läuft Sauerstoffwechsel ab.“ (Margulis In: Capra 2002, S. 26).
Übertragen auf psychische und soziale Systeme kann das Konzept der Autopoiese in der Beratersituation dazu anregen, Eigenheiten im Verhalten von Klienten, auch wenn sie dem Berater nicht gefallen, zunächst einmal als für deren Struktur und Überleben nützlich und sinnvoll anzusehen. Dies verlangt vom Berater, eben jene Struktur kennen zu lernen, wertzuschätzen und Veränderungsanregungen auf diese hin abzustimmen (vgl. Schlippe/Schweitzer 2000, S. 68).
3.6 Konstruktivismus
Der philosophische Ansatz des Konstruktivismus bildet die erkenntnistheoretische Grundlage systemischen Denkens. Kernfrage des Konstruktivismus ist:
Auf welche Art und Weise nehmen wir aktiv an der Konstruktion unserer
eigenen Erfahrungswelt teil ?
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die Wirklichkeit, bzw. die Welt, die wir wahrnehmen, ein individuelles Konstrukt ist. WATZLAWICK betont die Unterscheidung zwischen zwei Ebenen der Wirklichkeitswahrnehmung:
„Wir müssen unterscheiden zwischen dem Bild der Wirklichkeit, das wir durch unsere Sinne empfangen, und der Bedeutung, die wir diesen Wahrnehmungen zuschreiben.“ (Watzlawick 2003, S. 38)
[...]
[1] Zugunsten einer flüssigen Schreibweise benutze ich im Folgenden die Bezeichnung Klient/Klienten und fasse hierbei die männliche- und weibliche Form zusammen.
[2] z. B. Familienangehörige, Ehepartner etc.
[3] Auch hier verwende ich im Folgenden die neutrale Bezeichnung, die sowohl den Berater als auch die Beraterin mit einschließt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832486426
- ISBN (Paperback)
- 9783838686424
- DOI
- 10.3239/9783832486426
- Dateigröße
- 511 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Erziehungswissenschaft und Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2005 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- familientherapie systemtheorie kybernetik lösungsorientiert beratung
- Produktsicherheit
- Diplom.de