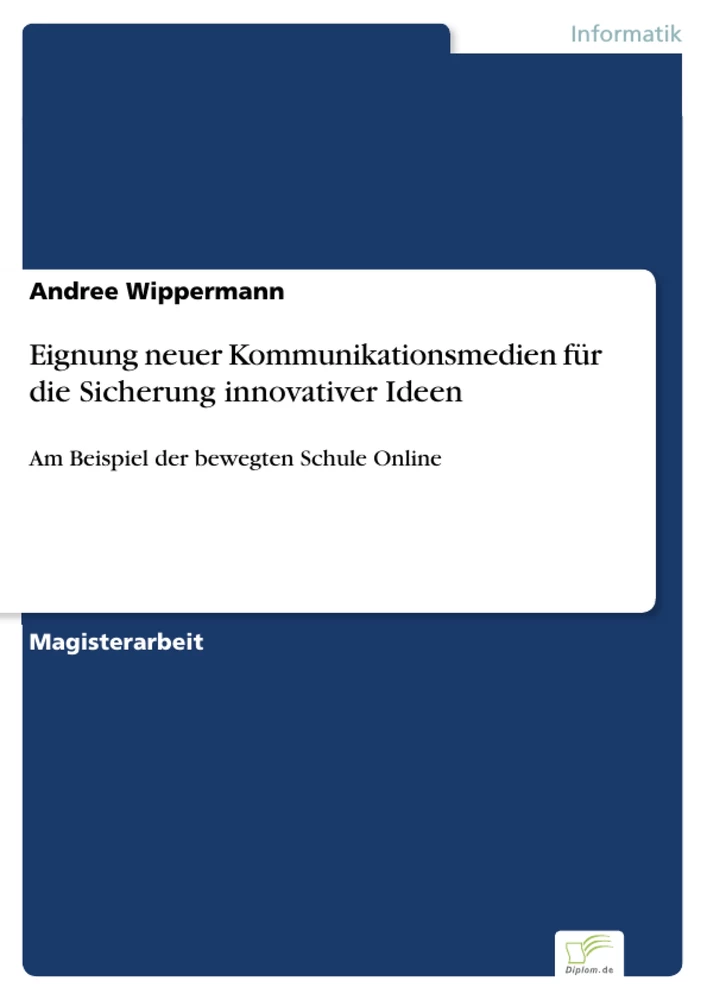Eignung neuer Kommunikationsmedien für die Sicherung innovativer Ideen
Am Beispiel der bewegten Schule Online
Zusammenfassung
Nach Ansicht von Soziologen leben wir heute in einer ausdifferenzierten Gesellschaft mit hoch spezialisierten Subsystemen, die jeweils einen spezifischen Beitrag zum Gelingen von Gesellschaft beisteuern. Das Hauptproblem ist dabei die Reduktion von Komplexität und das Gelingen von relativ unwahrscheinlicher Kommunikation. Wenn wir morgens aufstehen und die Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten betrachten (liegen bleiben, aufstehen, Kaffee kochen, beten, duschen, lesen ...), bekommen wir einen ersten Eindruck dieser These.
Sind die Dienste des Internet eine Antwort auf die alten Fragen nach einer besseren und effizienteren Kommunikation? Im Cartoon trägt der eigenwillige Lösungsvorschlag des Schülers nicht gerade zur Reduktion von Komplexität bei. Es zeigt sich, dass auch beim Einsatz von neuer Technologie (z.B. Internet, CD-ROM) neben Problemlösungsstrategien auch Fragen entstehen, die sich aus der Qualität des Mediums ergeben. Man fühlt sich an die Heisenbergsche Unschärferelation erinnert: Beim Aufbau einer Internetseite werden einerseits Hoffnungen auf einen effizienten Umgang mit einer Projektidee verbunden, gleichzeitig erhöht sich durch den Einsatz der neuen Technik die Binnenkomplexität des neu etablierten Kommunikationssystems.
In der gegenwärtigen Diskussion um die sogenannten Neuen Medien (neu waren auch schon der Videorekorder oder das Kabelfernsehen) fällt auf, dass Veröffentlichungen, die den Novitätscharakter des Mediums Internet herausstellen, zunehmend durch Beschreibungen konkreter Anwendungsfälle ersetzt werden. Die Zeiten des Staunens ob der neuen Möglichkeiten (E-Mail, Internet, Multimedia) scheinen durch einen veralltaglichten Einsatz abgelöst worden zu sein. Die Magie des Internet ist der Entzauberung durch elegante Benutzeroberflächen, kommerzialisierte Dienste und Zweckmäßigkeit gewichen die Faszination bleibt. Durch die Leistungsversprechungen des Internet werden zunehmend mehr Anwendungskontexte erschlossen und gesellschaftliche Funktionsbereiche in das digitale Format übertragen. Der kommerzielle Sektor bleibt der entscheidende Innovationsmotor, dessen Entwicklungen auch auf andere Bereiche ausstrahlen. Die alten Fragen nach einer besseren Organisation des Wissens werden durch die neuen Medien zugleich neu und anders beantwortet.
Neue Formen der Kommunikation und Rezeptionsmöglichkeiten von Informationen werden in dieser Arbeit am Beispiel der Internetseite wwwbewegteschulede […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Fragestellung und Forschungsdesign
3. Das Projekt Bewegte Schule Niedersachsen
3.1 Begründung der Projektidee
3.2 Ebenen des Projektes
3.3 Ziele des Projektes
3.4 Nachhaltigkeit eines Projektgedankens
3.5 Das Projekt "Bewegte Schule Online"
3.6 Projektseminar "N21: Bewegte Schule ans Netz"
4. Gesellschaft und medienvermittelte Information
4.1 Die Idee der Wissensgesellschaft
4.1.1 Information
4.1.2 Wissen
4.1.3 Innovation
4.1.4 Innovationen in der Wissensgesellschaft
4.1.5 Innovationen in Deutschland
4.1.6 Das Versprechen der Neuen Medien
4.2 Entwicklung und Bedeutung des Internet
4.2.1 Definition – Was ist das Internet?
4.2.2 Technik und Entwicklung des Internet
4.2.3 Institutionalisierung
4.2.4 World Wide Web: Das Internet ist in der Normalität angekommen
4.2.5 Hypertext als Aufbruch in nicht-lineare Informationsverknüpfung
5. Systemtheoretische Perspektive
5.1 Begründungszusammenhang
5.2 Zur Funktion sozialwissenschaftlicher Theorie
5.3 Die Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann
5.3.1 Was ist ein System?
5.3.2 Struktur und Komplexität
5.3.3 Das Verhältnis von Handlung und Kommunikation
5.3.4 Funktionale Analyse der Bewegten Schule Online
5.3.5 Kommunikation und Medien
6. Evaluation der Bewegten Schule im Internet
6.1 Nutzung von bewegteschule.de
6.1.1 Entwicklung der Zugriffszahlen seit dem Online-Start
6.1.2 Ergebnisse der Log-File-Analyse: Besucher
6.1.3 Ergebnisse der Log-File-Analyse: Download-Volumen
6.1.4 Bewertung und Einordnung der Zugriffszahlen
6.2 Inhaltsanalyse der Multimedia CD-ROM
6.2.1 Definitionen: CD-ROM, Multimedia und Digitalisierung
6.2.2 Methodik der Inhaltsanalyse
6.2.3 Aufbau und Struktur der CD-ROM
6.2.4 Zur Funktion der CD-ROM
6.2.5 Ausblick
6.3 Inhaltsanalyse der Newsletter
6.3.1 Newsletter und Mailinglisten
6.3.2 Der Newsletter von Bewegte Schule Online
6.3.3 Funktion der Newsletter
6.4 Klassifikation der E-Mail-Kontaktanfragen
6.5 Befragung der Newsletter-Abonnenten
6.5.1 Allgemeine Kennzeichen der Befragung
6.5.2 Technischer Hintergrund des Fragebogens
6.5.3 Einsatz des elektronischen Befragungsverfahrens
6.5.4 Konsequenzen für die Befragung der Newsletter-Abonnenten
6.5.5 Auswahlverfahren
6.5.6 Durchführung der empirischen Untersuchung
6.6 Ergebnisse der Befragung
6.6.1 Soziodemografische Merkmale der Nutzer von BSO
6.6.2 Medienausstattung
6.6.3 Einstellungen zu den Neuen Medien
6.6.4 Internetnutzung
6.6.5 Nutzung der Plattform Bewegte Schule Online
6.6.6 Bewertung der Nützlichkeit von bewegteschule.de
6.6.7 Potentiale neuer Medien zur nachhaltigen Projektsicherung
7. Strategien für eine nachhaltige Projektentwicklung
8. Literaturverzeichnis
9. Anhang
Anhang a: Anschreiben der Newsletterabonnenten per E-Mail vom 16.7.2004
Anhang b: Anschreiben der CD-Besteller per E-Mail vom 8.8.2004
Anhang c: Nachfassschreiben an die Newsletterabonnenten per E-Mail vom 7.9.2004
Anhang d: Nachfassschreiben an die CD-Besteller per E-Mail vom 8.9.2004
Anhang e: Der Newsletter von Bewegte Schule Online
Anhang f: Fragebogen
Anhang g: Randauszählung (Diagramme)
Anhang h: "Bewegte Schule Archiv-CD-ROM 2003/2004"
Anhang i: Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Informations- und Wissensgesellschaft im Google-Vergleich
Abb. 2: Wachstum der Internetrechner (hosts). (Slater 2002, Folie 42)
Abb. 3: Startseite von bewegteschule.de vom 15.2.2004
Abb. 4: Informationsbörse von bewegteschule.de (Ausschnitt)
Abb. 5: Linksammlung von bewegteschule.de (Kategorienübersicht)
Abb. 6: Kontaktformular von bewegteschule.de
Abb. 7: Formular zum Erfassen der E-Mail-Adresse für den Newsletter
Abb. 8: Bestellseite für die „Archiv-CD-ROM 2003/2004“
Abb. 9: Webserver-Statistik für bewegteschule.de in der Monatsübersicht
Abb. 10: Besucher: Juli 2003 bis Juli 2004 (für April 2003 liegen keine Daten vor)
Abb. 11: Durchschnittliche Anzahl Besucher/Tag
Abb. 12: Korrelation von Besuchern und Download-Volumen im März 2004
Abb. 13: Anzahl Links (Treffer) im Internet, die auf die Internetseite verweisen
Abb. 14: Das Hauptmenü der CD-ROM von Bewegte Schule Online
Abb. 15: Anzahl monatlich verkaufter Archiv-CD-ROMs (nur Internetbestellungen)
Abb. 16: Entwicklung der Newsletterabonnentenzahlen
Abb. 17: Inhaltsanalyse der Newsletterbeiträge nach Kategorien
Abb. 18: Klassifikation der eingegangen E-Mails an www.bewegteschule.de
Abb. 19: Art der Kontaktaufnahme mit bewegteschule.de
Abb. 20: Bewertung der Nützlichkeit von bewegteschule.de
Abb. 21: Bewertung der Nützlichkeit von BSO: Bewegtes Lernen im Unterricht
Abb. 22: Bewertung der Nützlichkeit von BSO: Pressemitteilungen
Abb. 23: Internetplattform und Newsletter im Vergleich
1. Einleitung
Nach Ansicht von Soziologen leben wir heute in einer ausdifferenzierten Gesellschaft mit hoch spezialisierten Subsystemen, die jeweils einen spezifischen Beitrag zum Gelingen von Gesellschaft beisteuern. Das Hauptproblem ist dabei die Reduktion von Komplexität und das Gelingen von relativ unwahrscheinlicher Kommunikation. Wenn wir morgens aufstehen und die Vielfalt an Handlungs-möglichkeiten betrachten (liegen bleiben, aufstehen, Kaffee kochen, beten, duschen, lesen ...), bekommen wir einen ersten Eindruck dieser These.
Sind die Dienste des Internet eine Antwort auf die „alten Fragen“ nach einer besseren und effizienteren Kommunikation? Im Cartoon trägt der eigenwillige Lösungsvorschlag des Schülers nicht gerade zur Reduktion von Komplexität bei. Es zeigt sich, dass auch beim Einsatz von neuer Technologie (z.B. Internet, CD-ROM) neben Problemlösungsstrategien auch Fragen entstehen, die sich aus der Qualität des Mediums ergeben. Man fühlt sich an die Heisenberg’sche Unschärferelation erinnert: Beim Aufbau einer Internetseite werden einerseits Hoffnungen auf einen effizienten Umgang mit einer Projektidee verbunden, gleichzeitig erhöht sich durch den Einsatz der neuen Technik die Binnenkomplexität des neu etablierten Kommunikationssystems.
In der gegenwärtigen Diskussion um die sogenannten Neuen Medien (neu waren auch schon der Videorekorder oder das Kabelfernsehen) fällt auf, dass Veröffentlichungen, die den Novitätscharakter des Mediums „Internet“ herausstellen, zunehmend durch Beschreibungen konkreter Anwendungsfälle ersetzt werden. Die Zeiten des Staunens ob der neuen Möglichkeiten (E-Mail, Internet, Multimedia) scheinen durch einen veralltaglichten Einsatz abgelöst worden zu sein. Die Magie des Internet ist der Entzauberung durch elegante Benutzeroberflächen, kommerzialisierte Dienste und Zweckmäßigkeit gewichen – die Faszination bleibt. Durch die Leistungsversprechungen des Internet werden zunehmend mehr Anwendungskontexte erschlossen und gesellschaftliche Funktionsbereiche in das digitale Format übertragen. Der kommerzielle Sektor bleibt der entscheidende Innovationsmotor, dessen Entwicklungen auch auf andere Bereiche ausstrahlen. Die „alten Fragen“ nach einer besseren Organisation des Wissens werden durch die „neuen“ Medien zugleich neu und anders beantwortet.
Neue Formen der Kommunikation und Rezeptionsmöglichkeiten von Informationen werden in dieser Arbeit am Beispiel der Internetseite www.bewegteschule.de herausgearbeitet.
Dabei begegnen uns die „alten Medien“ in Form von digitalisierten PDF-Dokumenten und Literaturhinweisen, die über das Internet vorgestellt werden. Anstatt einer separaten Betrachtung des Internet fordert Nicola Döring (2003) das Einnehmen eine medienökologischen Perspektive, um Aneignung und Gebrauch des neuen Mediums in Handlungskontexten zu beschreiben. Der Handlungskontext, der dieser Arbeit zu Grunde liegt, ist ein pädagogischer, da die Nutzerinnen und Nutzer der Internetplattform vornehmlich an Schulen tätig sind. Die konkrete Bezugnahme auf den Anwendungskontext der Bewegten Schule im Internet soll es ermöglichen, Strukturen des Online-Projekts herauszuarbeiten, die in Form von Handlungsempfehlungen auch für ähnliche Projektvorhaben nutzbar gemacht werden können.
2. Fragestellung und Forschungsdesign
In dieser Arbeit möchte ich untersuchen, inwieweit sich die neuen Kommunikationsmedien – repräsentiert durch Internet und Multimedia-CD-ROM – für die Sicherung eines innovativen Projektgedankens eignen. Dazu sollen theoretische Überlegungen zur medienvermittelten Information (Kapitel 4) und die empirischen Ergebnisse aus der Evaluation der Internetplattform bewegteschule.de (Kapitel 6) zu einer hinreichenden Klärung der Fragestellung führen.
Die Idee für dieses Forschungsthema entwickelte sich im Laufe meiner redaktionellen Arbeit an der Internetplattform Bewegte Schule Niedersachsen. Diese Tätigkeit wird ständig von der Frage begleitet, wie ein nachhaltiger Aufbau einer Internetplattform gelingen kann und welche Bausteine (z.B. Newsletter oder CD-ROM) sich als nützlich erweisen.
Die Evaluation der Internetplattform ist als eine Wirkungskontrolle zu verstehen. Die bisher ergriffenen Maßnahmen zum Aufbau der Internetplattform Bewegte Schule Online (bewegteschule.de) sollen auf Wirkung und Nachhaltigkeit überprüft werden. Aus den erhaltenen Daten werden Empfehlungen entwickelt, die im Kontext der Internetplattform Bewegte Schule Online handlungsleitend relevant sind. Gleichzeitig sollen auf allgemeiner Ebene Perspektiven für eine effizientere Nutzung der neuen Kommunikationsmedien aufgezeigt werden. Zielgruppe für diese Empfehlungen sind Planungsgruppen für Online-Projekte, Webmaster und Redakteure, die sich mit der Übertragung einer Projektidee auseinandersetzen.
Vorteil dieser Untersuchung ist der direkte Praxisbezug. Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen stammen aus der konkreten Arbeit mit der Internetplattform bewegteschule.de und wirken wiederum auf diese zurück. Gleichzeitig liegen hier auch die Grenzen der Untersuchung. Die Fragestellung dieser Arbeit ist nach dem Kenntnisstand des Verfassers in der Literatur bisher nicht behandelt worden.
3. Das Projekt Bewegte Schule Niedersachsen
Vorausgeschickt werden soll an dieser Stelle eine einführende Projekt-beschreibung zum Zweck der Einordnung des Untersuchungsgegenstandes (der Internetplattform „Bewegte Schule Online“) in den Kontext des Projektes "Niedersachsen macht Schule durch Bewegte Schule".
Das Projekt "Niedersachsen macht Schule durch Bewegte Schule" wurde 1998 durch das Niedersächsische Kultusministerium für drei Schuljahre (1998-2001) ins Leben gerufen und durch verschiedene Kooperationspartner[1] und Förderer unterstützt.[2] Das Sportdezernat der Bezirksregierung Braunschweig hat für das Land Niedersachsen die Leitung und Koordinierung übernommen. Zur Umsetzung des Projektvorhabens wurden zwei Lehrkräfte an das Sportdezernat delegiert, die als mobiles Team [3] die Aufgabe übernommen haben, das Projekt zu koordinieren. Im Verbund mit Unterstützern sollten bei den Kooperationspartnern und im Schulsystem Strukturen gestaltet werden, um die Ziele des Projektes (Kapitel 3.2) zu erreichen.[4] In der Praxis bedeutet dies aber nicht, dass mit Hilfe des mobilen Teams die Leitideen unreflektiert und in allen Punkten auf die Bildungseinrichtungen übertragen werden sollten, sondern das Lehrkräfte oder Schulen „diejenige Leitidee als Einstieg auswählen, durch die sie sich am meisten angezogen fühlen“[5].
3.1 Begründung der Projektidee
In dem Beitrag „Veränderte Kindheit – veränderte Schule“ aus der ersten Handreichung zur Bewegten Schule in Niedersachsen gibt Zimmer (1999) begründete Argumente für bewegten Unterricht und ein neues didaktisches Konzept: „Leben und Lernen mit allen Sinnen“. Insbesondere werden die Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern – unter anderem der stark zunehmende Medieneinsatz (Kapitel 3.1.1) – für verschiedene Auffälligkeiten und Krankheitsbilder bei Kindern verantwortlich gemacht.[6] Daraus ergibt sich nach Zimmer notwendigerweise die Forderung nach einem neuen pädagogischen Leitbild:
„Lernen mit allen Sinnen muß zur didaktischen Forderung für alle Institutionen werden, die sich die Bildung und Erziehung von Kindern zur Aufgabe machen.“[7]
Die zunehmende Mediennutzung als freizeitgestaltendes Element bei Kindern und Jugendlichen führt nach Zimmer zu einer zunehmenden Verarmung an Erfahrungen:
„Eine besondere Rolle spielen in dieser sinnenarmen Welt die Medien. Sie drohen zu Ersatzdrogen für vorenthaltene Primärerfahrungen zu werden, Drogen, die dazu verführen, gelebt zu werden, anstatt selber zu leben.“[8]
Medien sind nach der KIM-Studie (2002) wichtiger Bestandteil in der Freizeitgestaltung von Kindern.[9] Neben den klassischen Massenmedien wie Fernsehen, Radio, Tageszeitung, Fachzeitschriften haben besonders das Internet und das Handy an Bedeutung gewonnen. Während im Jahr 2000 nur sechs Prozent der 6 bis 13-Jährigen ein eigenes Handy besaßen, waren es 2002 schon 16% (KIM-Studie 2002, 18). Einen eigenen Internetanschluss hatten 2002 nur 5% der Kinder, wobei berücksichtigt werden muss, dass in 47% der Haushalte ein Internetanschluss zur Verfügung stand und der Zuwachs gegenüber 2000 (27% der Haushalte mit Internetanschluss) bemerkenswert ist. Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt die persönliche Medienausstattung stark zu.[10] Im Jahr 2002 verfügten 82% der 12- bis 19Jährigen über ein eigenes Handy. Die enorme Dynamik, mit der das Handy als neues Kommunikationsmedium Einzug in die Jugendzimmer gehalten hat wird deutlich, wenn man bedenkt, dass 1998 nur 8% der Jugendlichen ein eigenes Handy besaßen.[11]
Laut einer repräsentativen Studie (n=1.718) des Instituts für Jugendforschung (IFS[12] ) nimmt nicht nur die Zahl der Handynutzer zu, sie werden gleichzeitig auch immer jünger: 2004 telefoniert bereits jedes zweite Kind zwischen 11 und 12 Jahren mit dem eigenen Handy.[13] Die häufigsten Aktivitäten sind neben dem Telefonieren das Verschicken von SMS-Nachrichten und Handy-Spiele. Da sich das Verhältnis von Minuten, die über das Festnetz telefoniert werden, immer weiter zu Gunsten des Handys verschiebt, muss der Handynutzung unter dem Gesichtspunkt der Mobilität in den nächsten Jahren große Bedeutung zugestanden werden. Durch den Einsatz dieser portablen Endgeräte kann auch die Internet-Nutzung in anderen Kontexten (unterwegs im Zug, in der Schule etc.) erfolgen.[14] Angesichts dieser rasanten Entwicklung ist es nicht verwunderlich, dass aussagekräftige Studien zur Nutzung von Handys bislang nicht vorliegen. Dagegen ist die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen besser erforscht. Hier ist eine Veränderung der Nutzungsmuster bei den Kindern zu beobachten. Das Internet hat in den Jahren 2000-2003 an Bedeutung gewonnen: 52% der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren nutzten 2002 das Internet. Die am häufigsten genutzten Dienste waren dabei E-Mail (39%) und die themenspezifische Informationsbeschaffung (74%)[15]. Von den 14- bis 19Jährigen nutzten 2003 schon 81% das Internet.[16] Auch hier lässt sich ein deutlicher Anstieg der Nutzerzahlen in den letzten Jahren feststellen.
Diese Entwicklungen können als Indiz für eine Prioritätenverschiebung in der Mediennutzung und der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen gedeutet werden. Wenn davon ausgegangen wird, dass jedem Kind ein individuelles Zeitbudget zur Verfügung steht, so wird sich die vermehrte Nutzung des Internet oder des Handys zu Lasten der Nutzungsdauer der traditionellen Medien (TV, Radio, Buch, Zeitung etc.) verschieben. Dieser Effekt verstärkt sich, da das Internet sämtliche Dienste der alten Medien in Verbindung mit seinen spezifischen Vorteilen zur Verfügung stellt:
„In den nächsten Jahren wird das besondere Augenmerk auf der Frage liegen (müssen), wie sich „alte“ und „neue“ Medien längerfristig zueinander positionieren – insbesondere auch, inwieweit aus den neuen Konstellationen strategische Allianzen entstehen werden.“[17]
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Erfahrungen in zunehmendem Maße über das Medien „Bildschirm“ gemacht werden. Wie aber kann nun ein Medium, das für eine Verarmung an Wahrnehmung und Bewegung mitverantwortlich gemacht wird, durch einen Projektgedanken für mehr Bewegung in den Schulen sorgen? Diese Einsicht können wir nur erhalten, wenn wir uns von den kausalen Ursache-Wirkungsschemata (nach dem Muster: „Kinder, die vermehrt die Neuen Medien nutzen, bewegen sich weniger.“) verabschieden und scheinbar paradoxe Eigenheiten von Gesellschaft akzeptieren. Die Neuen Medien können, je nach Kontext, positiv wie negativ auf die Entwicklung von Kindern wirken.
3.2 Ebenen des Projektes
Kleine-Huster und Pilz-Aden (2000) unterscheiden zu Beginn der Planungsphase (Oktober 1998) verschiedenen Projektebenen:[18]
1. Ebene: Die konkrete Aufgabe [ Handlungsebene ]
2. Ebene: Operationaler Ablauf des Projektes [ Operation ]
3. Ebene: Vermittlung zwischen Projekt und Gesamtbetrieb
[ Kommunikation ]
4. Ebene: Rückkopplungsfolgen im Gesamtbetrieb [ Rückkopplung ]
5. Ebene: Psychosoziales und emotionales Geschehen [ Personen
(Psychische Systeme) ]
Diese in der zweiten Handreichung zur Bewegten Schule Niedersachsen veröffentlichten Planungsschritte sollen nach Angaben der Autoren dazu dienen, den Prozess für den externen Beobachter nachvollziehbar zu machen. Zu beobachten ist dabei ein systemisch angelegtes Projektmanagement, das zwischen Handlungsebene, Operation, Kommunikation, Rückkopplung und den Personen unterscheidet. Ich habe diese Begrifflichkeiten den Planungsebenen zugeordnet, da es sich dabei um zentrale Kategorien der Theorie sozialer Systeme handelt, die im Zuge dieser Arbeit sowohl theoretisch (Kapitel 5) als auch hinsichtlich ihres Stellenwertes für das Projekt Bewegte Schule untersucht werden.
Die Handlungsebene beschreibt die praktische Projektebene, wie sie sich beispielsweise für die zwei Lehrkräfte des mobilen Teams mit Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Kooperationspartnern an den Schulen in Niedersachsen darstellt.
Unter Operation kann man die inneren Prozesse (z.B. Arbeitsabläufe) des Projektes verstehen. Die Identität des Projektes rückt in das Zentrum der Betrachtung, wenn von den Autoren nach den Systemgrenzen und den Strukturen des Projektes gefragt wird, also in welchen Rahmen und nach welchem Selbstverständnis „operiert“ wird. Ebene 3 fasse ich unter dem Aspekt der Kommunikation zusammen, da eine Vermittlung eng mit dem Begriff des Mediums verknüpft ist, über das die Vermittlung abläuft.
Rückkoppellungen oder Rückmeldungen entstehen wiederum als kommunikative Akte, die auf das Projekt zurückwirken und dort möglicherweise Anpassungen der Struktur hervorrufen. Mit der psychosozialen bzw. emotionalen Ebene sollen ganzheitliche Perspektive des Projektgedankens vervollständigt werden. Wichtig ist hier die Frage, inwieweit die durch das Projekt angestrebten Veränderungen auf Widerstände stoßen.
Dieser Prozess der Selbstreflexion ist sehr nützlich, da es dem Beobachter ermöglicht, die Entwicklungsschritte des Projekts zu verfolgen und dadurch frühzeitig auf konzeptionelle Probleme aufmerksam zu werden.
3.3 Ziele des Projektes
In der Veröffentlichung zur Bewegten Schule Niedersachsen fasst Kleine-Huster (2000) die Ziele des Projektvorhabens zusammen:
„Zentrale Leitidee des Projektes ist es, dass die Bewegung und die Wahrnehmung der Kinder für eine gesundheitsfördernde Persönlichkeits-entwicklung wertzuschätzen ist. Lehrkräfte können die Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung als integralen Bestandteil des Lernens und zur Gestaltung des Schullebens in allen Bereichen erkennen und umsetzen.“[19]
Aus dieser Leitidee lassen sich Aufgaben ableiten, die durch das mobile Team gefördert werden sollen:[20]
- Lernen und Lehren mit allen Sinnen fördern.
- Innen- und Außenräume gestalten – vom Leerraum zum Lernraum.
- vielfältiges Schulleben gestalten.
- Schulprogramme entwickeln, die der Ausprägung der Schule entsprechen.
- Alltagstaugliche Konzepte für ganzheitliches Lernen und Lehren erarbeiten, zusammentragen und veröffentlichen.
- Interaktive Arbeits- und Kommunikationsstrukturen entwickeln und ausbauen, die über das Projektende hinauswirken.
Zur Zeit der Projektdurchführung gab es in Niedersachsen 2.400 Grundschulen und Orientierungsstufen, die als Kernzielgruppe ausgemacht wurden:
„Zielgruppe in dem Projekt Bewegte Schule sind die Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern. Mit diesem Projekt werden besonders Schulen der ersten sechs Jahrgänge angesprochen (Grundschulen, Orientierungsstufen, Sonderschulen, Integrierte Gesamtschulen), die die oben genannten Leitideen für wichtig erachten und auch entsprechende Handlungsziele erreichen wollen. [...] In Niedersachsen sind demnach ca. 2400 Schulen angesprochen.“[21]
Eine vollständiger Erschließung sämtlicher Schulen war nicht möglich, jedoch ist die „Einbeziehung möglichst vieler Schulen in das Projekt und die Verwirklichung einer Bewegten Schule in möglichst vielen Fällen“ ein wichtiges Planungsziel.[22] Es sollten durch die Vor-Ort-Arbeiten des mobilen Beratungsteams Anregungen zu einem nachhaltigen Kommunikations- und Handlungsprozess übermittelt werden:
„[...] d.h. jetzt sind Weichen zu stellen, damit der handlungsleitende Grundgedanke des Projektes auch über diese Dauer hinaus wirkt und in den bestehenden Organisationen der Schule weiter getragen wird.“[23]
Die Beteiligung der Schulen war nach einjähriger Projektlaufzeit nach Angaben der Handreichung 1999 erfreulich. So haben sich nach Kück (1999) 1.000 niedersächsische Schulen zu dem Projekt informiert, wobei aus den Materialien nicht genau hervorgeht, inwieweit die Absicht der Schulen, sich zu einer Bewegten Schule zu entwickeln, auch umgesetzt wurde.
Nach dem Abschluss der Arbeit des mobilen Beratungsteams wurden Ziele formuliert, die sich insbesondere mit der Nachhaltigkeit des Projektgedankens der Bewegten Schule befassten. Da ein Projekt per Definition schon zeitlich begrenzt angelegt ist, mussten Strategien entwickelt werden, die den Projektgedanken über das Projektende hinaus wirksam werden lassen konnten. Nachhaltigkeit wurde als Planungsziel relevant:
„Dabei wird es auch darauf ankommen, dass ein Arbeits- und Kommunikationsnetz auf- und ausgebaut wird, das die im Zusammenhang mit dem Projekt gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse nach dessen Beendigung wirksam bleiben und werden lässt.“[24]
Im November 2001 wurde mit Beendigung der eigentlichen Projektphase diese Idee in Form der Internetplattform bewegteschule.de umgesetzt. Eine ausführliche Beschreibung der Website wird unter Kapitel 6. vorgenommen.
3.4 Nachhaltigkeit eines Projektgedankens
Seit der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (1992) wird nachhaltige Entwicklung vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten diskutiert.[25] Dabei soll das Wirtschaftswachstum mit einer ökologischen Tragfähigkeit und Verteilungsfairness für die nachfolgenden Generationen in Einklang gebracht werden:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“[26]
Diese allgemeine Definition wurde in Rio de Janeiro um die soziale und ökonomische Dimension erweitert. Leben wir heute in einer Kultur der Nachhaltigkeit? In der wissenschaftlichen, politischen und öffentlichen Diskussion wird der Begriff in fast allen gesellschaftlichen Kontexten als handlungsleitendes Prinzip gebraucht. So wird in Szenarien zur Zukunft der Menschheit davon ausgegangen, dass „die Weltbevölkerung wahrscheinlich bereits um das Jahr 1978 die Kapazitätsgrenze der Erde für ein nachhaltiges Wachstum erreicht hatte“.[27] In der Forschung werden Preise für nachhaltige Konzepte vergeben (z.B. Braunschweig-Preis der Physiker 2001), Politiker aus allen Lagern sprechen sich für nachhaltige Konzepte aus, und Ökonomen versuchen, globalen Wohlstand durch nachhaltiges Wirtschaften zu erreichen.[28] Angesichts der Komplexität dieser globalen Debatte sieht Radermacher (1999) Problemlösungspotentiale bei den Neuen Medien:
„Das Potential des technischen Fortschritts ist enorm, und keine Technologie hat je so große Chancen eröffnet, wie die Informations- und Kommunikations-technik.“[29]
Radermacher bleibt mit seinen Aussagen allerdings vage. Potentiale sind selbst noch keine Lösungen und Chancen müssen erst ergriffen und umgesetzt werden. Er setzt seine Hoffnung auf die Dematerialisierung von Ressourcen, dass heißt, aus den vorhandenen Ressourcen bei geringerer Umweltbelastung mehr zu machen. Nach dem Prinzip „Bits statt Atome“ sollen unsere Bedürfnisse durch Telearbeitssysteme, Tele-Medizin und weltweite Ausbildungssysteme (digitale Bibliotheken) befriedigt werden. Wachstum soll dadurch bei schonendem Umgang mit den natürlichen Ressourcen gesichert werden.
Die Nachhaltigkeitsdiskussion hat sich heute stark ausdifferenziert und bezieht nahezu alle gesellschaftlichen Handlungsfelder mit ein. Während auf der Makroebene Probleme einer nachhaltigen Umwelt- und Bevölkerungs-entwicklung diskutiert werden, stehen auf der Mikroebene Fragen zur Sicherung von Nachhaltigkeit in Projekten im Vordergrund. Der Bereich der Bildungspolitik ist in Deutschland ein wichtiges Betätigungsfeld für innovative Projektarbeit. Nur wenig bleibt aber nach Projektende auch erhalten, so dass der Gedanke einer nachhaltigen Projektkonzeption und –praxis umgesetzt werden muss: Woran liegt es, dass viele Ideen zwar erfolgreich erprobt, aber dann keine Nachahmung finden?
In Bezug auf die Bewegte Schule im Internet soll Nachhaltigkeit zunächst als Kommunikationsproblem aufgefasst werden, um danach zu fragen, inwieweit es mit Hilfe neuer Medien möglich ist, diese Kommunikationsprozesse aufrechtzuerhalten, damit Erfahrungen und Erkenntnisse des Projektes nach dessen Beendigung wirksam bleiben.
Nachhaltigkeit kann erst durch Fortführung von Kommunikation erreicht werden. Kommunikation geht wiederum der Handlung voraus. Die Systemtheorie wird für diese Zusammenhänge einige interessante Perspektiven an die Hand geben (Kapitel 5). In welchem Maße das Internet (Kapitel 4.2) als Träger von Informationen und Kommunikationen für eine zukunftsfähige Sicherung eines Projektgedankens dienen kann, gilt es im Zuge dieser Arbeit anhand der Erfahrungen mit der Internetplattform bewegteschule.de zu untersuchen.
3.5 Das Projekt "Bewegte Schule Online"
Die „Bewegte Schule im Internet“, im folgenden auch Bewegte Schule Online oder bewegteschule.de, ist hervorgegangen aus dem Projekt „Niedersachsen macht Schule durch Bewegte Schule“ (Kapitel 3).
Der Antrag der Fridtjof-Nansen-Schule (Hannover), die virtuelle Plattform bewegteschule.de zu entwickeln, wurde beim Niedersächsischen Kultus-ministerium 2001 genehmigt. Die Ziele des Aktionsprogramms n-21 (www.n-21.de) und des Projektes „Niedersachsen macht Schule durch Bewegte Schule“ sollten miteinander verbunden und die praktische Nutzung von Multimedia und Internet erprobt werden.
In einem Anschreiben an die Schulen Niedersachsens stellt Hermann Städtler (Fridtjof-Nansen-Schule) in Abstimmung mit Insa Abeling (Gemeinde Unfallversicherungs-verband Hannover) Ziele des Online-Projekts vor:
„Motiviert hat uns bei unserer Arbeit die Vorstellung, dass Bewegte Schulen durch eine virtuelle Plattform zum Austausch von Informationen über Möglichkeiten und Grenzen ihrer oft sehr unterschiedlichen Arbeit gestärkt werden können. [...] Es eröffnet die Möglichkeit, dass mehrere Redakteure in ganz Niedersachsen über bewegteschule.de schnell und einfach Informationen bereitstellen können.“[30]
Mit dem Ausbau der Internetplattform soll einerseits die Nachhaltigkeit des Projektgedankens gesichert und zugleich die Eignung der neuen Kommunikationsmedien überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei der an den Bedürfnissen der Lehrer/Innen orientierte Aufbau der Internetseite:
„Durch den bedarfsgerechten Auf- und Ausbau der multimedialen Arbeitsumgebung sollen das Lernen voneinander und das Lernen miteinander gefördert und vertieft, sowie die zukunftsweisenden Möglichkeiten der praktischen Nutzung von Multimedia und Internet erprobt werden.“[31]
Die technische Realisierung des Basisinternetauftritts wurde von einer Hannoveraner Medienagentur (SL-Media GmbH) übernommen, die den weiteren Ausbau der Plattform begleitend betreut.
3.6 Projektseminar "N21: Bewegte Schule ans Netz"
Zur Unterstützung konnte im Frühjahr 2002 Prof. Dr. Christian Wopp als Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften an der Universität Osnabrück für die Projektbegleitung gewonnen werden. Im Rahmen der zweisemestrig angelegten projektorientierten Lehrveranstaltung "N21: Bewegte Schule ans Netz", an der sich 28 Sportstudierende beteiligten, wurde die Internetplattform beginnend mit dem Wintersemester 2002/2003 betreut, ausgestaltet und evaluiert. Die Projektgruppe der Universität Osnabrück verstand sich dabei als Serviceeinrichtung. Eingehende Anfragen (per E-Mail) sollten von den Studierenden durch eine Informationsmanagement-Gruppe aufgenommen und an die zuständigen Redaktionsgruppen weitergeleitet und bearbeitet werden. Die Redaktionsgruppen wurden zusätzlich mit der Erstellung von Beiträgen für den Newsletter und der Erarbeitung innovativer Ideen zur Weiterentwicklung von bewegteschule.de beauftragt.
Aus dieser Projektarbeit ist der „Evaluationsbericht www.bewegteschule.de“ hervorgegangen. Inhalt der Ausarbeitung ist eine qualitative Evaluation über den Zeitraum Juli 2002 bis Juni 2003 und eine quantitative Evaluation auf der Basis der eingegangenen E-Mails. Daraus wurden Strategien für die Fortsetzung des Internetauftritts abgeleitet. Der Bericht zeigt, dass durch die universitäre Projektbearbeitung ein Erfolg in Bezug auf eine positive Entwicklung der Besucherzahlen erreicht werden konnte: Von Juli 2002 bis März 2003 wurde jeden Monat ein Besucherzahlenzuwachs von durchschnittlich 13,5% registriert.
„Werden die Daten über die Gesamtzahl der Besucher sowie jene über die durchschnittliche Besucherzahl pro Tag betrachtet, kann der Arbeit des Seminars ein Erfolg zugeschrieben werden.“[32]
Als problematisch erwiesen sich im Zuge der Seminararbeit neben technischen Schwierigkeiten bei der Einrichtung der notwendigen Kommunikationsstrukturen (E-Mail-Konten, Internetzugang etc.) in erster Linie die Bearbeitung der eingehenden E-Mails von den Besuchern der Internetplattform Bewegte Schule Online. Die Beantwortung der eingegangen Anfragen musste zum Großteil an die Steuerungsgruppe in Hannover übergeben werden, da es sich häufig um allgemeine Material- oder unterrichtsspezifische Anfragen handelte. Insgesamt wurde die Zahl der eintreffenden E-Mails im Vorfeld überschätzt. Im Verlauf der gesamten Seminarzeit (bis Juni 2003) sind rund 30 themenrelevante Mails eingegangen.[33] Dies ist meiner Auffassung nach allerdings nicht als Indikator für ein mangelndes Interesse der Lehrerinnen und Lehrer am Projekt der Bewegten Schule zu werten, sondern eher als ein normales Phänomen angesichts der Besucherzahlen der Internetplattform und des relativ geringen Aufforderungscharakters der Kontaktaufnahme mittels eines Kontaktformulars anzusehen. Die These, dass die Besucher der Plattform tendenziell eine Konsumentenhaltung einnehmen, wird auch durch eine Klassifikation der eingegangen E-Mails bestätigt (Kapitel 6.4).
Das Projekt der Bewegten Schule Online gilt es im nächsten Kapitel in Bezug auf den gesellschaftlichen Diskurs um die Neuen Medien zu besprechen. Im Zuge dieser Analyse werde ich Begriffe erläutern, die im Zuge der Diskussion um die Wissensgesellschaft von hoher Relevanz sind (Kapitel 4.1) sowie den besonderen Charakter des Internet analysieren (Kapitel 4.2). Durch die systemtheoretische Perspektive (Kapitel 5) werde ich versuchen, die Strukturen des Kommunikationssystems Bewege Schule Online herauszuarbeiten.
4. Gesellschaft und medienvermittelte Information
Während Internet-Analysen – bedingt durch die Geschwindigkeit und Dynamik dieses Mediums – eine sehr geringe Haltbarkeitsdauer aufweisen,[34] bestehen einige sozialwissenschaftliche Zeitdiagnosen – wie zum Beispiel die der Wissensgesellschaft (Kapitel 4.1) – seit vielen Jahrzehnten.
Ich möchte an dieser Stelle wichtige Begriffe nicht einfach übernehmen, sondern diese auf Gehalt und Aussagekraft hin überprüfen und zur Aufklärung in der Informationsgesellschaft beitragen.
Die Bewertung der sozialwissenschaftlichen Diagnose soll unter Rückgriff auf die Systemtheorie erfolgen. Es kann geprüft werden, ob sich die Lebensbedingungen von Individuen und gesellschaftliche Wirklichkeit besser erfassen lassen, wenn wir von der Wissensgesellschaft sprechen.[35] Inzwischen konkurriert das Konzept der Wissensgesellschaft neben anderen: zum Beispiel Kommunikationsgesellschaft (z.B. Münch, 2001), Informationsgesellschaft (z.B. Gates, 1995) oder digitale Gesellschaft (z.B. Glotz, 2000).[36] Ob angesichts der neuen Handlungs- und Kommunikationsformen, die sich aus den Strukturen des Internet ergeben, bestehende Theorieentwürfe modifiziert werden müssen, ist dabei eine interessante Forschungsperspektive.
4.1 Die Idee der Wissensgesellschaft
Der Begriff der Wissensgesellschaft wurde erstmals 1966 von dem amerikanischen Soziologen Robert E. Lane in Zusammenhang mit seinen Überlegungen zu Politik und Ideologie eingeführt. Danach war es vor allem Daniel Bell (1973), der den Ausdruck in seinem Werk über die postindustrielle Gesellschaft popularisierte.[37] Darin kommt bereits zum Ausdruck, dass das Wissen als gesellschaftlich relevantes Gut den Materialismus der Industriegesellschaft abgelöst oder ihn zumindest an Bedeutsamkeit überboten haben musste (vgl. Kapitel 3.2.1).
Worin liegt aber die besondere Bedeutsamkeit von Wissen? Leidhold (2001) bemerkt, dass das Wissen „immer schon ein wesentliches Merkmal menschlicher Lebensformen“ gewesen ist.[38] Seine tragende Rolle für die Gesellschaft ergibt sich heute aus der ökonomischen Verwertung des Wissens, seiner Abgrenzung vom Informationsbegriff und seiner Einbettung in völlig neue Kommunikationsverhältnisse durch den Einsatz der Neuen Medien, die in diesem Zusammenhang neue Problemlösungskonzepte versprechen. In diesem komplexen Kontext gilt es den Fokus der Betrachtung auf die Vermittlung von Wissen (als operationalisierte Information) mittels des Internet zu legen.
4.1.1 Information
Der Informationsbegriff wird bei Fleischer u.a. (2001) in Bezug auf einen zu lösenden Problemzusammenhang definiert:
„Danach ist Information – ganz im Sinne der allgemeinen Pragmatik als Handlungslehre – die Teilmenge von Wissen, die von einer bestimmten Person oder einer Gruppe in einer konkreten Situation zur Lösung von Problemen benötigt wird.“[39]
Es zeigt sich, dass Information in Differenz zu Wissen definiert wird. Im Alltagsgebrauch findet häufig keine klare Trennung der Begriffe statt; es wird oft von Informationen gesprochen, was sich in der häufigen Verwendung des Informationsbegriffs ausdrückt. Der Stellenwert der beiden Begriffe soll durch die Anzahl der Treffer der Suchmaschine Google veranschaulicht werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Informations- und Wissensgesellschaft im Google-Vergleich
Ich gehe davon aus, dass die Suchergebnisse von der weltweit größten Internet-Suchmaschine[41] google.de als Indikator für die Relevanz von bestimmten Begriffen gelten können und einen systematischen Vergleich erlauben. Dabei ist zu beachten, dass die absoluten Ergebnisse der Suchmaschine sehr dynamisch sind und von Tag zu Tag variieren können. Die Relationen der untersuchten Begriffe bleiben dabei aber immer annähernd erhalten, so dass die vorgestellte Rangfolge ihre Aussagekraft behält. So ist in Abbildung 1 zu erkennen, dass der Begriff Informationsgesellschaft wesentlich häufiger in den Websites und Dokumenten des Internet auftaucht als der Begriff Wissensgesellschaft.
Ist dies allerdings eine treffendes Bild über die Gesellschaftsform, in der wir zu Zeit leben? Die Ergebnisse geben meiner Auffassung nach eher einen Diskussionsstand wieder und zeigen, mit welchen Begriffen – auch im Wissenschaftsbetrieb – vornehmlich operiert wird. Das Begriffspaar sollte nicht gegeneinander ausgespielt, sondern die Unterschiede von Information und Wissen herausgearbeitet werden. Ich möchte dabei deutlich machen, dass das Internet zwar Informationen bereitstellt, diese aber erst durch kognitive Prozesse zu Wissen verarbeitet werden können.
Folglich kann im Internet nur nach Informationen und nicht nach Wissen gesucht werden. Diese Informationen werden erst durch kognitive Filter- und Verarbeitungsprozesse des Menschen zu Wissensbeständen. Dies entspricht dem Verständnis, das die moderne Systemtheorie vom Informationsbegriff hat. Für sie ist Information ein Ereignis, das zwar von der Umwelt ausgelöst wird, dann aber vom System autonom verarbeitet wird:
„Als Information soll hier ein Ereignis bezeichnet werden, das Systemzustände auswählt. Das ist nur an Hand von Strukturen möglich, die die Möglichkeiten begrenzen und vorsortieren. [...] Ereignisse sind [...] zeitpunktfixierte Elemente. Sie kommen nur einmal und nur in einem für ihr Erscheinen nötigen Kleinstzeitraum (specious present) vor. [...] Eine Information, die sinngemäß wiederholt wird, ist keine Information mehr. Sie behält in der Wiederholung ihren Sinn, verliert aber ihren Informationswert.“[42]
Am Beispiel des Kommunikationssystems bewegteschule.de soll dieser systemische Informationsbegriff konkretisiert werden. Die Information, dass in Hannover eine Grundschule nach dem Konzept einer Bewegten Schule gestaltet wurde, ist nach dem Verständnis der Systemtheorie ein Ereignis, das den Systemzustand von bewegteschule.de anregt. Es kann auf dieses Ereignis beispielsweise in der Form reagiert werden, als die Information in die Website integriert und anderen Nutzer zur Verfügung gestellt wird. Die Information wirkt somit auf die Struktur des Systems; sie ist selbst keine Struktur, sondern hat einen Struktureffekt hinterlassen.
Leidhold (2001) spricht in diesem Zusammenhang von der „formgebenden Übertragung“, die eine Information kennzeichnet. Liest nun ein Besucher von bewegteschule.de diese Information, hat sie für diese Person einen Informationswert. Nach dem Verständnis der Systemtheorie passt der Besucher seinen eigenen Systemzustand (seine Erfahrungen und Erwartungen) auf diese Information an. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass der Leser bzw. die Leserin nun sensibler auf zukünftige Berichte zur bewegten Schule reagiert oder in anderer Form den Beitrag reflektiert. Liest dieser Besucher die gleiche Meldung am nächsten Tag in der Zeitung, so hat diese Aktivität keinen Informationswert mehr, da sie den eigenen Systemzustand nicht mehr ändert, denn es wurde bereits reagiert.
Information ist immer selektiv an den Sinnhorizont des Systems gekoppelt. Die Redaktion von bewegteschule.de würde keine Beiträge zur Aufzucht von Puten veröffentlichen, weil es nicht zum Möglichkeitsbereich (oder: Sinnhorizont) von bewegteschule.de gehört. Dem Sinnhorizont unserer Internetplattform entspricht es, nur die Informationen aus der Umwelt herauszufiltern und systemintern zu verarbeiten, die sich dem Themenbereich der Bewegten Schule zuordnen lassen.
Interessant ist bei der systemtheoretischen Auffassung die Idee, dass Informationen sowohl Orientierungsfunktion besitzen als auch Unsicherheiten auslösen können.[43] So sind Informationen von bewegteschule.de zum einen handlungsleitend, wenn Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise Elemente zur Gestaltung einer bewegten Pause in die Praxis übernehmen. Es wird eine Selektion (Pausengestaltung) vorgenommen, die andere Möglichkeiten ausschließt und somit Komplexität reduziert (vgl. Kapitel 5.3.2). So ist es denkbar, dass durch die Bekanntgabe der Möglichkeit einer alternativen Gestaltung von Unterricht (nach dem Prinzip der Bewegten Schule) ein Orientierungsverlust entsteht, der unter Umständen auf den Rückzug bekannter Konzepte zurückführt. Dieser potentielle Doppelcharakter von Information sollte bei der weiteren Besprechung bedacht werden.
Aus dem Problem der Steigerung von Komplexität durch Informationen ergibt sich eine interessante Perspektive, die sich auf die Möglichkeit zur Evolution von informations-verarbeitenden Systemen bezieht:
„Wenn Sinn und Information als evolutionäre Errungenschaft zur Verfügung stehen, kann mithin eine eigene Sinnevolution in Gang kommen, die ausprobiert, welche Schemata der Informationsgewinnung und –verarbeitung sich in ihren Anschlußqualitäten (vor allem: prognostisch und handlungsmäßig) bewähren.“[44]
Luhmann verweist hier auf einen evolutionären Charakter von Sinnbeständen und deutet zugleich Möglichkeiten an, die durch Ausprobieren entstehen. Über die Plattform bewegteschule.de werden gesellschaftlich relevante Themen (zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Sport etc.) durch Kommunikationsprozesse reproduziert. Diese Themen entstehen nach Luhmann nicht zufällig, sondern orientieren sich an gesellschaftlichen Sinnbeständen („eine Art Vorrat möglicher Themen“).[45] Der Themenvorrat ist kulturell geprägt und wird – sofern er für Kommunikationszwecke aufbewahrt wird – Semantik genannt.[46]
4.1.2 Wissen
„Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet nicht in einem Schlußpunkt, sondern mit einem Fragezeichen. Ein Plus an Wissen bedeutet ein Plus an Fragestellungen, und jede von ihnen wird wieder von neuen Fragestellungen abgelöst.“[47] (Hermann Hesse)
Wissen tritt neben der Information als zentrale Kategorie im Kontext der Bewegten Schule Online auf. Neben einer Begriffsannäherung, die sich auf den sinnverarbeitenden Menschen bezieht, soll vor allem der Stellenwert des Wissens innerhalb der neuen Kommunikationsmedien besprochen werden. Mit der Entwicklung des Internet (Kapitel 4.2) sind völlig neue Formen der Kommunikation entstanden. Kann durch diese technische Innovation (Kapitel 4.1.3) eine bessere Organisation von Wissen gelingen? Erfüllen die Neuen Medien die Erwartungen an eine effiziente Kommunikation, zu jeder Zeit und an jedem Ort? Diese Fragen möchte ich, unter Rückgriff auf die Systemtheorie und unter Einbeziehung der Erfahrungen und empirischen Ergebnisse von Bewegte Schule Online, versuchen zu klären. Von zentraler Bedeutung ist die Frage, wie sich eine nachhaltige Vermittlung von Wissen, das im Laufe des Projekts der Bewegten Schule gesichert wurde, über die neuen Kommunikationsmedien darstellt und unter welchen Bedingungen sie gelingen kann.
Die Diskussion um den Wissensbegriff zielt vor allem auf die qualitative Komponente der kommunizierten Information ab.[48] Es müssen zu einer Information bestimmte Merkmale hinzukommen, um sie als Wissen einzustufen. Im Gegensatz zum Begriff der Informationsgesellschaft, der sehr technizistisch geprägt ist, bezieht Wissensgesellschaft die menschliche Handlung mit ein und macht den Begriff anwendbar.[49]
Leidhold (2001) fragt nach dem Ziel und der Richtung des Begriffs der Wissensgesellschaft und sieht darin vor allem ein Trendwort, „eine Entwicklung, die ihre volle Realität noch nicht gefunden hat.“[50] Er versteht Wissensgesellschaft als eine Entwicklung, die ihren Abschluss praktisch nicht erreichen kann, weil ständig neues Wissen produziert und reproduziert werden muss. Alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche (zum Beispiel Wissenschaft, Erziehung, Wirtschaft, Politik etc.) sind auf die ständige Produktion von neuem Wissen angewiesen.[51] Für die Erhaltung und Weiterentwicklung eines Systems ist es also notwendig, dass Information ständig zirkuliert, verarbeitet und nutzbar gemacht wird. Dieses Prozessieren von Informationen wird vom Menschen geleistet:
„Im Unterschied zur Information ist Wissen die Verbindung von nackten Daten mit Erfahrungen und der Fähigkeit, diese zu nutzen und in Handlungen einzubetten.“[52]
Thomaß (2001) koppelt den Wissensbegriff eng mit der Handlung. Dieser Aspekt sollte besonders betont werden, denn Informationen sind auf allgemeiner Ebene unabhängig vom menschlichen Verstehen.[53] Informationsverarbeitung findet sowohl bei der Übertragung des genetischen Codes als auch in elektronischen Rechnern statt und ist somit lösgelöst von menschlichen Erfahrungen und Handlungen. Wissen erhält seine besondere Bedeutung im Kontext menschlicher Erfahrungs- und Handlungsfelder.
Die Internetplattform bewegteschule.de stellt für das Handlungsfeld „Bildung“ Informationen bereit, die im Zuge der Befragung der Nutzer von bewegteschule.de hinsichtlich ihrer Nützlichkeit bewertet werden (vgl. Kapitel 6). Die Ergebnisse sollen zeigen, ob und inwieweit die Informationen die Leser angeregt haben. Der Gebrauchswert einer Information rückt damit in den Vordergrund. Erst wenn Informationen als relevant und somit nützlich eingestuft werden, können sie auch reflektiert in Handlungskontexte eingebracht werden. Information ist dabei nur die technische Botschaft; es bedarf aber des Wissens um die korrekte Anwendung. Die Komplexität eines individuellen Lernvorgangs lässt sich durch die systemtheoretische Perspektive zeigen. Dazu rückt der Mensch mit seinem operativ geschlossenen, kognitiven System in den Mittelpunkt. Wissen wird nach Luhmann individuell erzeugt und kann deshalb auch nicht von außen aufgenötigt werden:
„Weder die äußere Realität, noch relevante andere sind in der Lage, das selbstkonstituierte Wissen eines Bewußtseins oder einer Kommunikation zu instruieren; es gibt lediglich die Möglichkeit der Irritation.“[54]
Besonders anschaulich wird diese Aussage, wenn man sich die Situation eines klassischen Frontalunterrichts vor Augen führt. Diese Unterrichtsform bedient sich der Vermutung, dass Wissen vom Sender (Lehrer/In) zum Empfänger (Schüler/In) übergeben werden kann und unterliegt damit einem fundamentalen Irrtum. Der kognitive Apparat des Menschen ist operativ geschlossen. Niemand kann mit dem Bewusstsein eines anderen Menschen denken. Es können nur Umwelt irritationen, die sich als Reizungen, Überraschungen oder enttäuschte Erwartungen äußern, eine Systemänderung (Lernerfolg) auslösen. Die Irritation ist in der oben angesprochen Unterrichtsform oft sehr gering, da der kognitive Apparat von dieser Lehrer-Schüler Gegenüberstellung vermutlich wenig fasziniert wird.[55] Das psychische System bestimmt selbst, was als Irritation aufgefasst wird und ändert seinen Zustand (es lernt) durch Aneignung von Wissen nur dann, wenn es die Umweltreize als Irritation auffasst. Die Qualität der Irritation und die ausgelöste Reaktionsintensität ist wiederum prinzipiell nicht vorhersehbar, da jede Person (bzw. jedes kognitive System) unterschiedlich sensibilisiert ist. Für die Lernbereitschaft bedeutet dies, dass deutlich werden muss, in welcher Sinnrichtung eine Erwartungsänderung durch die Aufnahmen neuen Wissens erfolgen soll. Sollte bewegteschule.de einen neuen Schwerpunkt auf die Vermittlung von Informationen zum Thema Gesundheit legen, so muss der Sinnbezug dieser Aktion vermittelt werden, um Unsicherheiten zu vermeiden. Begründungen, wie etwa eine gesteigerte gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheit, könnten beispielsweise dazu dienlich sein.
Das systemtheoretische Konzept betont bei hoher Abstraktionslage die Individualität des Menschen. Wenn wir von Wissensgesellschaft sprechen, müssen wir akzeptieren, dass Wissen immer nur individuell erzeugtes Wissen sein kann und daraus die notwendigen Konsequenzen für unserer Fragestellung ziehen. Im Zuge dieser Arbeit gilt es somit zu klären, welche Rolle die neuen Kommunikationsmedien bei diesem Aneignungsprozess spielen. Dazu werde ich nach der Bestimmung der Rolle des Begriffs der Wissensgesellschaft die besondere Bedeutung des Internet (Kapitel 4.2) herausstellen. Die Plausibilität erhält diese Gesellschaftskonzeption nicht zuletzt deshalb, weil Sie Wandlungsprozesse auch empirisch belegen kann.[56] Mit einem dynamischen Wissensbegriff kommen wir meines Erachtens der gesellschaftlichen Realität am nächsten. Die Dynamik entsteht durch die angesprochene Notwendigkeit der ständigen Wissensproduktion, die sich als Innovationsdruck beschreiben lässt.
4.1.3 Innovation
Der Kommunikationswissenschaftler Everett M. Rogers (1997) hat sich mit der Frage beschäftigt, unter welchen Bedingungen und wie schnell sich eine Innovation verbreitet.
Er definiert Innovation als eine Idee, ein Objekt oder eine Anwendung, die von einer Gruppe von Personen („an individual or other unit of adoption“)[57] als neu wahrgenommen wird und sich innerhalb eines sozialen Systems aufgrund bestimmter Merkmale mit einer bestimmten Adoptionsrate verbreitet.[58] |[59]
Das Innovations-Entscheidungs-Modell[60] nennt fünf Schritte zur Beschreibung dieses Diffusionsprozesses:
1. Kenntnis der Innovation (knowledge)
2. Überzeugung (persuasion)
3. Entscheidung für die Aneignung (decision)
4. Übernahme der Innovation (implementation)
5. Bestätigung der Innovation aufgrund positiver Erfahrungen (reinforcement)
Die Diffusion kann als ein Prozess der Kommunikation mittels bestimmter Medien über einen gewissen Zeitraum und dem Bezug auf die Mitglieder eines sozialen Systems beschrieben werden. Die Entscheidung für die Anneignung (Stufe 3) einer Innovation hängt maßgeblich davon ab, welche Versprechen von der Innovation ausgehen (s. Kapitel 4.1.6) und wird nach der Diffusionstheorie dann begünstig, wenn wiederum fünf Eigens haften erfüllt werden:[61]
1. Relativer Vorteil relative (advantage)
2. Kompatibilität (compatibility)
3. Komplexität (complexity)
4. Möglichkeit des Ausprobierens (trialability)
5. Möglichkeit der Wahrnehmung (observability)
Entscheidend ist der individuelle Vorteil, der aus der Innovation gewonnen wird. Die theoretischen bzw. objektiven Möglichkeiten spielen dabei eine untergeordnete Rolle, weil sie eben nur theoretisch und nicht konkret wirksam werden können.
Am Beispiel der Bewegten Schule lassen sich die oben genannten Eigenschaften erklären. Das Konzept hat sich für viele Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis bewährt (advantage), es lässt sich in vorhandene Schulstrukturen integrieren (compatibility), verlangt neue Sichtweisen und Fähigkeiten der Lehrkräfte (complexity), ermöglicht das Ausprobieren bestimmter Bausteine einer Bewegten Schule (trialability) und wird über die Medien (zum Beispiel bewegteschule.de) für andere öffentlich gemacht (observability).
Mit diesem Modell lässt sich erklären, warum sich einige Innovationen schneller als andere durchsetzen. Sofern die Nutzer von bewegteschule.de keinen persönlichen Vorteil vom Prinzip der Bewegten Schule erfahren, wird es kaum möglich sein, sie über theoretische Möglichkeiten zu bewegen, das Konzept anzunehmen. Gleiches gilt für die Plattform der Bewegten Schule im Internet. Erst wenn die Nützlichkeit des Internetauftritts ausreichend akzeptiert ist, kann der Projektgedanke auch nachhaltig gesichert werden.
Wichtig für die Vermittlung der Innovationen innerhalb des sozialen Systems sind die Trendsetter (innovators).[62] Ihnen kommt die Aufgabe zu, eine sogenannte kritische Masse zu mobilisieren, durch die eine Innovation getragen wird:
„A final crucial concept in understanding the nature of the diffusion process is the critical mass, which occurs at the point at which enough individuals have adopted an innovation that the innovation's further rate of adoption becomes self-sustaining (…).”[63]
Eng damit verbunden ist die systemische Vorstellung von der Selbstreproduktion eines Systems mittels seiner eigenen Elemente. Das Internet kann demnach als autopoietisches (sich selbst reproduzierendes) System betrachtet werden: es hat seine kritische Masse erreicht[64] und trägt sich durch die ständige Zirkulation von Kommunikationen, die sich wiederum auf gesellschaftlich relevante Themen beziehen. Für die Plattform bewegteschule.de stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen dieses Projekt „self-sustaining“ und damit nachhaltig gesichert werden kann.[65]
Die Erwartungen ruhen dabei auf den Innovationspotentialen des Internet und seinen Diensten: Ist es gelungen, über den Newsletterversand, der CD-ROM zur Bewegten Schule und der Informationsbörse von bewegteschule.de ein sich selbst erhaltendes System zu etablieren?
4.1.4 Innovationen in der Wissensgesellschaft
Hinsichtlich der Bedeutung von Innovationen in der Wissensgesellschaft sollte herausgearbeitet werden, welche Funktionen sie erfüllen und welche Erwartungen sich aus zukünftigen Entwicklungen ergeben. Er kann zwischen technischen (Medium: Internet) und inhaltlichen (Inhalt/content) Innovationen unterschieden werden. Aus der Co-Evolution beider Formen ergibt sich eine spannende Dynamik. Im Internet sind zum einen Inhalte zu finden, die beispielsweise aus gedruckten Werken übernommen wurden und zum anderen – und weitaus größeren Teil – werden neue Inhalte im Netz veröffentlicht. Hier lässt sich eine Parallele zur Epoche des Buchdrucks ziehen, die zunächst ebenfalls durch die Übernahme vorhandener Inhalte gekennzeichnet war, danach aber eine Reihe von Innovationen entfesselte.[66]
4.1.5 Innovationen in Deutschland
Der Begriff der Innovation wird in Deutschland insbesondere durch die Bezugnahme auf technische Entwicklungsfelder diskutiert. Ein hohen Innovationsfähigkeit der Wirtschaft wird dabei als Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen gewertet.[67] Die Bundesregierung leistet sich gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft zahlreiche internetbezogene Projekte, die neue Entwicklungen herausarbeiten und in die Praxis überführen sollen. So hat der Deutsche Bundestag am 11. Mai 2000 die Entwicklung einer „Strategie für eine nachhaltige Informationstechnik“ beschlossen.
In der Wirtschaft wird in westlichen Gesellschaften durch eine aggressive Innovationsstrategie versucht, Marktvorteile zu erarbeiten. Verkürzte Innovationszyklen sind Folgen der Globalisierung und der zunehmenden Arbeitsteilung.[68] Besonders auffällig ist dies in der Softwarebranche, die nach dem Motto „obsolete your own products“[69] verfährt: das neuentwickelte Produkt ist bereits durch einen Nachfolger überholt, wenn es auf den Markt gekommen ist. Behrendt u. Erdmann (2003) sehen in den veränderten Markt- und Umweltbedingungen den Grund für diese Unternehmensstrategie. Leidhold (2001) sieht in den kommerziellen Entwicklungen die treibende Kraft für Innovationen:
„Typisch sind hierfür die Produktzyklen in der Computertechnologie und in der Welt des Internet. Hier gilt die Faustregel: Ein Internetjahr entspricht drei Jahren in der herkömmlichen industriellen Ökonomie.“[70]
Innovationen stehen nicht losgelöst in der Gesellschaft, sondern müssen immer in einem Problemzusammenhang gesehen werden. So hat im Kontext der Wissensgesellschaft die Technik des Internet Hoffnungen auf ein Mehr an Informationen und Wissen geweckt.
4.1.6 Das Versprechen der Neuen Medien
Medieninnovationen scheinen seit Erfindung des Buchdrucks nach einem stetig wiederkehrenden Muster zu verlaufen. Nachfolgendes Zitat aus einer Literaturstudie zur Struktur und Nutzungsmöglichkeiten neuartiger Tele-kommunikationssysteme aus den frühen 80er Jahren spiegelt die gegenwärtige Diskussion über das Internet getreulich wieder:
„All diese Gesichtspunkte lassen erkennen, daß uns die neuen Medien weniger vor Probleme stellen, die sich aus technischen Umwälzungen zu ergeben pflegen (z.B. ‚Erfindung der Elektrizität’), als vor Entscheidungen, wie sie uns bei der Bewältigung des Alltags- und Berufslebens helfen oder schaden, welche Bedeutung sie für unser kulturelles Verhalten gewinnen können.“[71]
Auch in den 80er Jahren wurden mit den technischen Innovationen Erwartungen auf eine aktive Einbindung des Bürgers in gesellschaftliche Funktionsbereiche verbunden.[72] Mit der Vermehrung der Hör- und Fernsehfunkkanäle, des Videotextes und dem Einsatz von Videorekordern entstanden Leistungsversprechen hinsichtlich einer allgemeinen Zunahme an Informationen und der selbstbestimmten Selektion von Angeboten. Aus den Funktionsmöglichkeiten des Internet sind ähnliche Erwartungen und Leistungsversprechen erwachsen, die ich für die Wissensgesellschaft im allgemeinen und für die Plattform bewegteschule.de genauer untersuchen möchte.
Die Vor- und Nachteile der Zunahme an Information und die Rolle des Menschen in dem Kommunikationsgeflecht werden im Zuge der Etablierung des Internet gegenwärtig heftig diskutiert. Während die theoretische Diskussion zwischen Kulturpessimisten und Technologieenthusiasten anhält, können wir im weltweiten Netz rund um die Uhr die Normalität im Umgang mit den Online-Diensten beobachten. Viele gesellschaftliche Funktionsbereiche sind in das Internet verlagert worden und ergänzen oder ersetzen die herkömmlichen Dienste. Das Versprechen einer effizienten Nutzung des Internet scheint insbesondere im kommerziellen Bereich eingelöst worden zu sein. Auch wenn zu Beginn der 21. Jahrhunderts verstanden werden musste, dass in der New Economy Gewinne nicht so leicht zu erwirtschaften sind wie erwartet, strahlt der Innovationsdruck des Online-Business auf Projekte zur Förderung der Wissensgesellschaft aus.[73] Lässt sich der zentrale Stellenwert, den man den Neuen Medien innerhalb der Diskussion um die Wissensgesellschaft beimisst, rechtfertigen? In Anlehnung an Leidhold (2001) lassen sich folgende Funktionserwartungen an die Neuen Medien nennen:
1. Ordnungsfunktion
2. Orientierungsfunktion
3. Organisation des Wissens
4. Universalität der Kommunikation
Mit der Digitalisierung ist es möglich geworden, Informationen schnell, kostengünstig und unabhängig von Ort und Zeit zu verbreiten und zu archivieren. Es ist ein genuines Medienmerkmal des Internet und ermöglicht in allen datenintensiven Bereichen (Arbeit, Bildung, Politik etc.) neue Konzepte und Problemlösungen.[74] Daten können durch Digitalisierung platzsparend und kostengünstig archiviert (CD-ROM / DVD) sowie durch Automatisierung effizient nach Informationen durchsucht werden. Damit verbinden sich Hoffnungen, die exponentiell ansteigenden Wissens- und Informationsmengen zu beherrschen und zu ordnen.[75] Zugleich wird von den Neuen Medien eine verbesserte Organisation des Wissens erwartet, die sich aus der Vereinigung aller Kommunikationsmittel in einem Medium ergibt.
4.2 Entwicklung und Bedeutung des Internet
Die Informationsbörse von bewegteschule.de basiert auf der Idee des Schenkens und Tauschens; einem Prinzip aus der Pionierzeit des Internet, das mit fortschreitender Kommerzialisierung zu marginalisieren droht. Mit folgender Analyse der Entwicklung und Bedeutung des Internet soll auch gezeigt werden, wie dieses Prinzip der Internet-Kultur entstanden ist. Um die Eignung des Internet für spezifische Kommunikationsaufgaben zu beurteilen, bedarf es einer genauen Kenntnis der Entwicklung und der Struktur des Mediums. Aus der Ideengeschichte computervermittelter Kommunikation durch das Internet lässt sich eine fundierte Einschätzung der Chancen und Risiken vornehmen.
4.2.1 Definition – Was ist das Internet?
Einleiten möchte ich mit einer Definition des Internet von William F. Slater (2002), Präsident des Chicago Chapter of the Internet Society:
Das Internet ist nach Slater
„A network of networks, joining many government, university and private computers together and providing an infrastructure for the use of E-mail, bulletin boards, file archives, hypertext documents, databases and other computational resources.”[76]
Es gibt verschiedene Herangehensweisen zur Beschreibung der Entwicklung des Internet. Eine technikzentrierte Sichtweise erscheint mir für unsere Zwecke nicht ausreichend, da die Funktionen und Entwicklungsschritte immer auch in Verbindung mit den Ideen von Personen standen und stehen. Döring (2003) betont in ihrem Werk zur Sozialpsychologie des Internet, dass die Netznutzer nicht einer vermeintlich eigendynamischen Vernetzung der Gesellschaft gegenüberstehen, sondern dass das die Technikgenese als Folge der Ideen von Menschen betrachtet werden muss:
„Tatsächlich sind Nutzergruppen und Nutzungsweisen der Technikentwicklung nicht nachgeordnet (so genannte Technik folgen), sondern mehr oder minder direkt in Prozesse der Technikentwicklung einbezogen (Technik genese).“[77]
Interessant wird es also, wenn wir fragen, wie sich die Kommunikation mit und durch das weltweite Rechnernetzwerk darstellt. Parallel zur technischen Entwicklung evoluieren auch die Ideen, die Entwicklung des Internet voranzutreiben. Diese Ideen, die zur Entwicklung des World Wide Web (WWW) führten, verliefen problemorientiert. In der Frühphase des Internet beschäftigten sich die Internet-Pioniere mit grundsätzlichen Funktionsweisen von Rechnern und dem Zugang zu Informationen, um darauf aufbauend immer effizientere Wege zu finden, Daten in einem Netzwerk von Rechnern auszutauschen.
4.2.2 Technik und Entwicklung des Internet
Als früher Vorläufer des modernen Internet gilt das ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), das am 1. September 1969 als Verbund von vier Rechnern an der University of California Los Angeles in Betrieb genommen wurde. Mit der Inbetriebnahme des ARPANET wurde der Paradigmenwechsel in der Definition vom Computer als Rechenmaschine zum Computer als Kommunikationsgerät vollzogen.[78] Eine Forschungsgruppe des US-Rüstungslieferanten Bolt, Beranek und Newman (BBN) entwickelte unter der Leitung von J.C.R. Licklider zunächst sogenannte Time-Sharing -Computersysteme, die eine Kommunikation zwischen Mensch und Rechner erlauben sollten. Aus der Weiterentwicklung dieses Modells entstand Lickliders ARPANET, dessen Leitmotiv die interaktive Verknüpfung von interaktiven Online-Gemeinschaften wurde.[79]
Betonen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass das ARPANET – obgleich vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium finanziert – nicht zu militär-strategischen Zwecken entworfen wurde. Der Zweck war vielmehr die „gemeinsame Nutzung der damals recht knappen Computer-Ressourcen an verschiedenen Universitäten.“[80] Dies spricht gegen die weit verbreitete These, das Internet solle im Falle eines nuklearen Angriffs durch seine dezentrale Struktur die militärische Kommunikation sicherstellen.[81]
Mit dem Einsatz des ARPANET vollzog sich auch ein Wandel des Datenübertragungsprinzips. Um die Bandbreite der Telefonleitungen wirtschaftlicher zu nutzen, wurden Daten als Pakete auf den Weg geschickt. Dieser telekommunikationstechnische Sprung von leitungsorientierter zu paketvermittelter Übermittlung von Kommunikationen war Voraussetzung für die verteilte, dezentrale Architektur des Internet.[82] Wenn jemand heute eine E-Mail mit einem Dateianhang – beispielweise einem Word-Dokument – versendet, so wird dieses Dokument in vielen Datenpäckchen auf die Reise geschickt. Jedes Datenpaket ist mit Informationen über den Absender und den Empfänger ausgestattet und findet autonom seinen Weg durch das Netzwerk. Am Zielrechner angekommen, fügen sich die zerteilten Kommunikate wieder zu einer Einheit zusammen.
Die ersten veröffentlichten Dokumente im ARPANET waren die Request for Comments (RFCs).[83] Ihnen fällt in der Entwicklung des Internet eine besondere Rolle zu. Diese elektronischen Diskussionspapiere, die in ihrer Frühform Angaben über die technischen Standard des Internet enthielten, wurden in ihrer Form ganz bewusst nicht als verbindliche Aussagen für die Netznutzer erlassen, sondern als „freundliche Bitte um Kommentierung“.[84] Steven D. Crocker, Autor des ersten RFC[85], verfolgte damit die Absicht, die Autorität des Geschriebenen zu brechen:
„First, there is a tendency to view a written statement as ipso facto authoritative, and we hope to promote the exchange and discussion of considerably less than authoritative ideas. Second, there is a natural hesitancy to publish something unpolished, and we hope to ease this inhibition.”[86]
Beim Durchsehen der heutigen RFC-Archive fiel mir auf, dass viele dieser Dokumente alles andere als unausgefeilt sind und sich vielfach als seitenlange Abhandlungen mit sauberem Inhaltsverzeichnis und Literaturangaben darstellen. Somit scheint die von Crocker geäußerte Hoffnung von einer Senkung der Hemmschwelle, etwas Unausgefeiltes zu veröffentlichen, nur bedingt zuzutreffen.
[...]
[1] Insbesondere die Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Niedersachsen.
[2] Vgl. Kück u.a. (1999), 2
[3] Im Niedersächsischen Kultusministerium ist ab dem 1. September 2003 ein "Mobiles Beratungsteam Neue Schulstruktur" (MBNS) eingerichtet worden, welches die Aufgaben hat, den Aufbau und die Umsetzung der Schulstrukturreform in Niedersachsen zu unterstützen: http://www.mk.niedersachsen.de/master/C2129532_N2129464_L20_D0_I579.html
[4] Vgl. Kleine-Huster (1999), 10
[5] Vgl. Kück u.a. (2000), 48
[6] Vgl. Zimmer (1999), 8
[7] Zimmer (1999), 8
[8] Zimmer (1999), 4
[9] vgl. Feierabend u.a. (2002), 60
[10] Ein eigenes Handy haben nach der JIM-Studie im Jahr 2002 schon 69% der 12- bis 13-Jährigen.
[11] Feierabend u.a. (2003), 17
[12] http://www.institut-fuer-jugendforschung.de/
[13] Diese Ergebnisse ermittelte das IJF Institut für Jugendforschung in einer repräsentativen Umfrage bei 6- bis 22-Jährigen (Basis: n = 1.718 Kinder und Jugendliche).
[14] Vgl. Döring (2003), 557
[15] Hier entfallen 37% auf das Item "Informationen für Schule suchen"
[16] Fluck u.a. (2003), 10
[17] Feierabend u.a. (2003), 72
[18] Vgl. Kleine-Huster u.a. (2000), 13
[19] Kleine-Huster (1999), 8
[20] Vgl. Kleine-Huster (1999), 8
[21] Kleine-Huster (1999), 13
[22] Vgl. Kleine-Huster (1999), 5
[23] Kleine-Huster u.a. (2000), 25
[24] Jürgens-Pieper (2000), 5
[25] Vgl. Huber (2001), 375
[26] Arbeitsgruppe „Informationsgesellschaft und nachhaltige Entwicklung“ (2002), 7
[27] Spektrum der Wissenschaft, März 2002, 73
[28] Zum Beispiel in: Becker-Boost, E. &Fiala, E. (2001). Wachstum ohne Grenzen. Globaler Wohlstand durch nachhaltiges Wirtschaften. Wien: Springer.
[29] Radermacher (1999)
[30] Hermann Städtler (Fridtjof-Nansen-Schule Hannover) in einem Anschreiben an die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung des Projekts Bewegte Schule Niedersachsen. Veröffentlichungsdatum unbekannt.
[31] Infobroschüre „Bewegte Schule auf neuen Wegen - ein Qualitätsnetzwerk“.
[32] Vgl. Walle u.a. (2003), 5
[33] Vgl. Walle u.a. (2003), 10
[34] Vgl. Döring (2003), 1
[35] Vgl. Döring (2003), 35
[36] Autoren für Zeitdiagnosen nach nach Döring, 35
[37] Vgl. Leidhold (2001), 429
[38] Leidhold (2001), 429
[39] Fleischer / Hartmann (2001), 10 nach Kuhlen (1990), 13
[40] Gemessen am 15. September 2004
[41] Vgl. Döring (2003), 75
[42] Luhmann (1985), 102
[43] Vgl. Luhmann (1985), 103 f. / Merten (1999), 472
[44] Luhmann (1985), 104
[45] Luhmann (1985), 224
[46] Vgl. Luhmann (1985), 224
[47] Quelle: http://www.daszitat.de/autoren/503204938c0cfee21/h/503204939913ac620.html
[48] Vgl. Leidhold (2001), 434
[49] Vgl.Ertner, S. (2004)., Zugriff am 6. September unter www.wissensgesellschaft.org
[50] Leidhold (2001), 429
[51] Vgl. Thomaß u.a. (2001), 182
[52] Thomaß u.a. (2001), 182
[53] Vgl. Leidhold (2001), 433
[54] Bardmann u.a. (1999), unter: Definitionen von I-J: Irritation
[55] Selbstverständlich gibt es Lehrkräfte, die durchaus die Fähigkeit besitzen, diese Faszination selbst im Frontalunterricht auszuüben.
[56] Vgl. De Haan u.a. (2002), 3
[57] Rogers (1997), Abschnitt „Innovation“
[58] Vgl. Rogers (1997), Abschnitt „Innovation“
[59] Zur Adoptionsrate des Internet vgl. Kapitel 4.2.4, Abbildung 2
[60] Vgl. dazu auch Döring (2003), 8 ff.
[61] Vgl. Rogers (1997), unter „Innovation“
[62] Vgl. Döring (2003), 10
[63] Rogers (1997)
[64] Vgl. Döring (2003), 11
[65] Ich möchte betonen, dass der Projektgedanke der Bewegten Schule auf der einen und dessen Umsetzung mittels der Internetplattform auf der anderen Seite an dieser Stelle analytisch getrennt behandelt werden. Der Projektgedanke der Bewegten Schule kann im Verständnis des Diffusionsmodells als relativ etabliert gesehen werden, wohingegen die Projektumsetzung mittels der Online-Plattform bewegteschule.de in dieser Arbeit analysiert wird.
[66] vgl. Merten (1999), 202
[67] Dudenhausen, Wolf-Dieter (2004). Pressemitteilung 200/2004 vom 14.9.2004: BMBF-Zukunftsforum "Mobiles Internet 2010" auf dem Petersberg eröffnet. http://www.bmbf.de
[68] vgl. Behrendt & Erdmann (2003), 4
[69] Ausspruch von Steve Ballmer, Chef von Microsoft. Quelle unbekannt.
[70] Leidhold (2001), 438
[71] Ronneberger (1982), 17
[72] Vgl. Ronneberger (1982), 25
[73] Vgl. Döring (2003), 32
[74] Vgl. Turek (2001), 220
[75] Vgl. Leidhold (2001), 435
[76] Slater (2002), Folie 6 von 50
[77] Döring (2003), 7
[78] Siehe Grassmuck (2002), 181
[79] Siehe Grassmuck (2002), 181
[80] Döring (2003), 3
[81] Döring (2002) stützt sich dabei auf Aussagen über die Internetgeschichte von Kathie Haffner und Matthew Lyon (1996)
[82] Siehe Grassmuck (2002), 181
[83] Zum derzeitigen Stand sind rund 3500 RFCs der Network-Working-Group erschienen und abrufbar unter http://www.faqs.org/rfcs/
[84] Vgl. Grassmuck (2002), 183 / vgl. Döring (2003), 3
[85] Zu lesen unter ftp://ftp.denic.de/pub/rfc/rfc1.txt behandelt dieses Diskussionspapier die Kommunikation zwischen dem IMP (Interface Message Processor, Paketvermittlungs-technologie) und dem bereits vorhandenen Host -Rechner (Host bezeichnet einen Rechner im Netzwerk bzw. im Internet)
[86] Steve Crocker, RFC-3, 1969
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832486181
- ISBN (Paperback)
- 9783838686189
- Dateigröße
- 3.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Osnabrück – Sportwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- unterricht internet systemtheorie informatik schüler
- Produktsicherheit
- Diplom.de