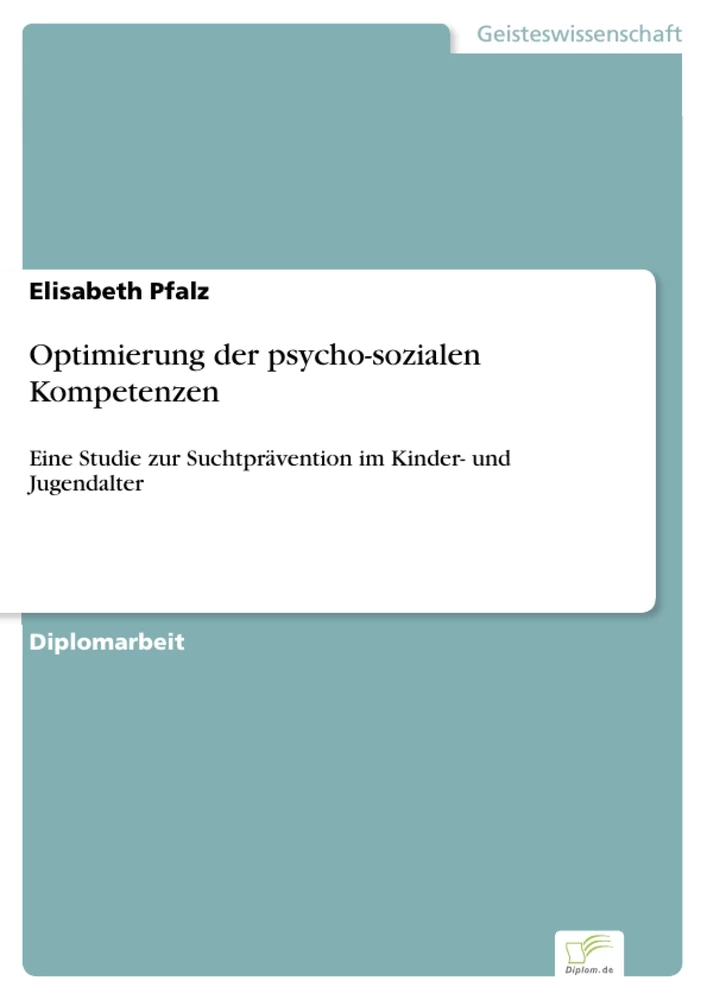Optimierung der psycho-sozialen Kompetenzen
Eine Studie zur Suchtprävention im Kinder- und Jugendalter
Zusammenfassung
Die augenfällig immer stärker werdende Problematik des Suchtgiftmissbrauchs durch Kinder und Jugendliche hat mich veranlasst, diese Arbeit zu verfassen. Nur wenn sich neben den Pädagog/innen auch die vorgesetzten Behörden des dringenden Handlungsbedarfs bewusst werden, kann sinnvolle Präventionsarbeit geleistet werden.
Moderne Suchtprävention hat noch keinen Platz im österreichischen Erziehungswesen gefunden.
Die Förderung psycho-sozialer Kompetenzen ist Teil der Gesundheitsförderung. Gesundheit selbst hat körperliche, psychische und soziale Anteile. Psychische Gesundheit bedeutet zum Beispiel, sich gut mit sich selbst zurechtzukommen/ sich mit sich selbst wohlfühlen, Selbstvertrauen zu haben, äußere Ereignisse sinnvoll interpretieren und bewältigen zu können, Stress bewältigen zu können und psychisch in normalem Ausmaß belastbar zu sein.
Soziale Gesundheit bedeutet zum Beispiel, über soziales Kapital zu verfügen (Wissen, Einfluss, Ressourcen), gut mit anderen zurechtzukommen, befriedende soziale Beziehungen aufbauen und leben zu können, adäquates soziales Verhalten an den Tag legen zu können und eigene Ziele und Ideen sozial verträglich verwirklichen zu können. Psycho-soziale Kompetenzen sind demzufolge Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang sowohl mit den Mitmenschen als auch mit Problemen und Stresssituationen im täglichen Leben ermöglichen.
Interessant ist in diesem Kontext die Stellungnahme der WHO zum Thema Gesundheitsförderung, welche in der Ottawa-Charta im Jahr 1986 wie folgt definiert wurde:
Gesundheitsförderung zielt auf den Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. ... Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur beim Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden.
Gang der Untersuchung:
Um moderne Suchtprävention betreiben zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0 Vorwort
1 Einleitung
1.1 Hypothese
1.2 Begriffsdefinitionen
1.2.1 Psycho-soziale Kompetenzen
1.2.2 Suchtprävention
1.3 Warum ist eine Optimierung der psycho-sozialen Fähigkeiten überhaupt notwendig? Erhebung des „Ist-Zustandes “ der sozialen Situation der Kinder und Jugendlichen in Österreich
1.4 Kinder heute
2 Zur vorliegenden Studie
2.1 Methode
2.2 Ergebnisse
3 Hypothesenprüfung
4 Ursachenforschung
4.1 Ausbildung zu Kindergartenpädagog/innen
4.2 Pädagogische Akademie des Bundes in Baden
4.3 Weiterbildungsangebote für Pflichtschullehrer/innen
5 Praktische Modelle für die Umsetzung suchtpräventiver Maßnahmen
5.1 Im Kindergarten
5.2 In den Schulen
5.2.1 Suchtpräventiver Unterricht an den Volksschulen
5.2.2 Praktische suchtpräventive Unterrichtsmodelle an Schulen für 10- bis 14-Jährige
6 Evaluierung durchgeführter Projekte
6.1 Im Kindergarten
6.2 In derVolksschule
6.3 In der Hauptschule
6.4 Die Kampagne „Kinder stark machen“
7 Voraussetzung für die effektive Durchführung suchtpräventiven Unterrichts
7.1 Maßnahmen im strukturellen Bereich
7.2 Notwendige Maßnahmen zur Förderung
der erforderlichen Rahmenbedingungen
8 Zusammenfassung und Ausblick
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang
0 Vorwort
Der Mensch ist ein „soziales Tier“: vom Augenblick seiner Geburt an – und sogar schon vorher – steht er in Interaktion mit der Umgebung und mit seinen Mitmenschen (vgl. Kivits 1994, S. 314).
Auf diese Interaktionen sind wir Zeit unseres Lebens angewiesen. Immer mehr Jugendliche erleben jedoch soziale Situationen als problematisch. Unzureichend entwickeltes sozial kompetentes Verhalten spielt in der aktuellen Diskussion um die Ursachen einer Vielzahl von psychischen Problemen, wie z.B. Depressionen, Selbstwertproblemen, Isolation, Kontaktschwierigkeiten und Drogenkonsum eine große Rolle.
Die Angst vor sozialen Situationen kann ein ständiger Stressor und damit ein Anlass zu Drogenmissbrauch sein (vgl. Pfingsten 1991, S. 76).
Der Anteil verhaltensauffälliger Schüler/innen hat stark zugenommen. Jeder verantwortungsvolle Pädagoge/jede verantwortungsvolle Pädagogin beschäftigt sich zwangsläufig mit der Frage nach den Ursachen und stößt auf die Faktoren: Elternhaus, Erziehung , gesellschaftspolitische Bedingungen u.Ä..
Das Verhalten der „heutigen“ Schülerinnen und Schüler wird oft an den Pranger gestellt.
Konstruktiver wäre es, nach den Ursachen zu fragen und erziehliche Mittel einzusetzen, die letztendlich Schüler/innen und Lehrer/innen zugute kommen würden: z.B. gesundheitsfördernde Maßnahmen mit dem Ziel der Optimierung der psycho-sozialen Kompetenzen.
Ich bin der Meinung, dass sich die Institutionen Kindergarten und Schule, vor allem aber auch die Politik, den Erfordernissen unserer Zeit stellen muss.
Die Thematik der Suchtprävention darf in diesem Zusammenhang nicht länger vernachlässigt werden. Sie ist zu einer wichtigen Erziehungsaufgabe unserer Zeit geworden.
Mit dieser Arbeit habe ich versucht, eine Bestandsaufnahme der suchtpräventiven Maßnahmen an Kindergärten und Schulen zu machen. Mein Ziel war es, herauszufinden, ob Suchtprävention den ihr zustehenden Platz im Erziehungswesen gefunden hat.
Da in unserer Gesellschaft und Zeit jede Veränderung zum Positiven vor allen Dingen finanzieller Mittel bedarf, bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse meiner Studie bei den verantwortlichen Stellen Gehör finden.
The human being is a "social animal": from the very moment of birth – and even before – he/she interacts with his/her surroundings and with his/her fellow human beings (Cf. Kivits, 1994, p. 314).
Throughout our lives we are dependent on this interaction. However, more and more young people today find social situations problematic.
Insufficiently developed social competence plays an important part in the discussion on the causes of a myriad of psychological problems, such as depression, lack of self-esteem, isolation, contact difficulties and drug consumption.
Fear of social situations can be a constant stress factor and even lead to substance abuse (Cf. Pfingsten, 1991, p. 76).
There has been a sharp increase in the numbers of socially disturbed pupils. Responsible pedagogues are inevitably occupied with rooting out the underlying causes and are confronted with the following factors: parental home, education and socio-political conditions, to name a few.
The behaviour of "present day" schoolchildren is often harshly criticised. It would, however, be more constructive to identify the underlying causes and take appropriate rectifying measures, which would in the long run benefit both schoolchildren and teachers: health-promoting measures for improving psycho-social competence.
In my opinion, those responsible in school and politics will have to face up to the requirements of our time.
Prevention of substance abuse must no longer be neglected. It has become an important educational task of our time.
With this thesis I have tried to make an inventory of measures for the prevention of substance abuse in kindergartens and schools. It was my ambition to find out whether prevention of substance abuse has been granted its legitimate place in education.
As – in our society and time – every improvement requires financial means above all, it remains to be hoped that the results of my thesis may be heard by those responsible.
Die Erstellung dieser Studie war nur möglich, weil sich viele Personen zur Mitarbeit bereit erklärt haben.
Mein Dank richtet sich an alle Menschen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben:
An die Lehrer/innen und Kindergartenpädagog/innen, die mir die Fragebögen ausgefüllt und zurückgeschickt haben;
An Dr. Reinhold Hohengartner und Dr. Klaus-Peter Diemert im Zukunftsministerium, die auf meine Anfragen sofort reagierten;
An Dr. Reiner Hanewinkel, der mir die Unterlagen zu seinen evaluierten Volksschulprojekten zukommen ließ;
An DSA Silvia Franke, die mich bezüglich der aktuellen Kindergartenprojekte beriet;
An den Leiter der Fachstelle für Suchtprävention in Niederösterreich, Dr. Kurt Fellöcker, der mich fachlich ausgezeichnet beraten hat;
An meine Freundin und Kollegin Silvia Münz, die mir mit ihren Ratschlägen bzgl. des SPSS-Programms oft eine große Hilfe war;
An meine Freundin und Kollegin Mag. Sheena Machotka, die den englischen Teil der Arbeit übernommen hat;
An meinen Bruder Andreas Kurz, der mir in altbewährter Manier diese Arbeit professionell lektoriert und formatiert hat;
An meinen Sohn Michael, den technische Probleme mit meinem Computer – im Gegensatz zu mir – niemals aus der Ruhe brachten;
An meine betreuende Professorin, Frau Dr. Marianne Wilhelm, die mir einen Teil ihrer Ferienzeit zur Verfügung stellte.
1 Einleitung
Die augenfällig immer stärker werdende Problematik des Suchtgiftmissbrauchs durch Kinder und Jugendliche hat mich veranlasst, diese Arbeit zu verfassen. Nur wenn sich neben den Pädagog/innen auch die vorgesetzten Behörden des dringenden Handlungsbedarfs bewusst werden, kann sinnvolle Präventionsarbeit geleistet werden.
1.1 Hypothese
Moderne Suchtprävention hat noch keinen „Platz“ im österreichischen Erziehungswesen gefunden.
1.2 Begriffsdefinitionen
1.2.1 Psycho-soziale Kompetenzen
Die Förderung psycho-sozialer Kompetenzen ist Teil der Gesundheitsförderung.
Gesundheit selbst hat körperliche, psychische und soziale Anteile.
Psychische Gesundheit bedeutet zum Beispiel:
- gut mit sich selbst zurechtzukommen/ sich mit sich selbst wohlfühlen,
- Selbstvertrauen haben,
- äußere Ereignisse sinnvoll interpretieren und bewältigen zu können,
- Stress bewältigen zu können,
- psychisch in „normalem“ Ausmaß belastbar zu sein.
Soziale Gesundheit bedeutet zum Beispiel:
- über „soziales“ Kapital zu verfügen (Wissen, Einfluss, Ressourcen),
- gut mit anderen zurechtzukommen,
- befriedende soziale Beziehungen aufbauen und leben zu können,
- adäquates soziales Verhalten an den Tag legen zu können,
- eigene Ziele und Ideen sozial verträglich verwirklichen zu können.
Psycho-soziale Kompetenzen sind demzufolge Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang sowohl mit den Mitmenschen als auch mit Problemen und Stresssituationen im täglichen Leben ermöglichen (vgl. http://www.give.or.at) (2003/07/05).
Interessant ist in diesem Kontext die Stellungnahme der WHO zum Thema Gesundheitsförderung, welche in der Ottawa-Charta im Jahr 1986 wie folgt definiert wurde:
„Gesundheitsförderung zielt auf den Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. ... Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur beim Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden“ (http://www.give.or.at) (2003/07/05).
(Den fett hervorgehobenen Passagen kommt im Verlauf der Arbeit besondere Bedeutung zu! – Anm. d. Verf.).
1.2.2 Suchtprävention
Abgrenzung des Themas
Um moderne Suchtprävention betreiben zu können, ist es notwendig, die Entstehung und Wirkungsweise von Sucht zu begreifen.
Da die suchtpräventiven Maßnahmen einen langen Entwicklungsprozess hinter sich haben, ist auch ein geschichtlicher Rückblick notwendig.
Die Charakteristik moderner Suchtprävention wird anschließend kurz angerissen.
Schließlich wird erläutert, welche allgemeinen Maßstäbe für Suchtprävention im Kindesalter und in der Schule gelten.
Zum Begriff „SUCHT“
Geht man von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes aus, so bedeutet Sucht so viel wie Siechtum, also Krankheit. Allen neueren Definitionen ist gemeinsam, dass sie Sucht
1. als unstillbares Verlangen nach einem Suchtmittel (substanzgebundene Sucht) oder nach einem Vorgang, einer Handlung (prozessgebundene Sucht) und
2. als progressive, also fortschreitende psycho-soziale Dynamik begreifen (vgl. Koller 1999, S. 12).
Sucht inkludiert sowohl physische, psychische als auch soziale Abhängigkeit (vgl. Uhl 2001, S.11).
Nach Ehmke ist „Sucht vor allem die Störung der Gefühlsfähigkeit, der Kommunikations- und damit auch der Beziehungsfähigkeit“.
Festzuhalten ist, dass Sucht in alltäglichen Bezügen entsteht und etwas mit den Bedingungen zu tun hat, unter welchen Menschen, gleich welchen Alters, ihren Alltag bewältigen. Eine Suchtpersönlichkeit als solche gibt es nicht, wohl aber zur Sucht disponierende Lebens- und Sozialisationserfahrungen (vgl. Fellöcker 2000, S. 102).
Seit den 70-er Jahren, nach der so genannten „Drogenwelle“, fand die Ursachenforschung ein weites Betätigungsfeld im Suchtbereich: Die Ansätze liegen sowohl in den psychologischen, physiologischen und soziologischen Bereichen als auch im Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren in der Person, der Umwelt und der jeweiligen Substanz.
Drogenkonsum wird auch in funktionellem Zusammenhang mit den Anforderungen und Belastungen jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben gesehen (vgl. Fellöcker 2000, S.1 ff).
Zum Begriff „PRÄVENTION“
Umgangssprachlich wird der Begriff Prävention meist als Summe von Maßnahmen verstanden, die gesetzt werden, um ein Problem zu verhindern, so lange das Problem noch nicht aufgetaucht ist.
Im wissenschaftlichen Kontext versteht man darunter hingegen jede denkbare Intervention, von Vorbeugung und früher Intervention bis zu therapeutischen Interventionen, nachdem das Problem bereits eingetreten ist. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich die Gliederung in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention (vgl. Uhl 2001, S. 5f).
In dieser Arbeit werde ich mich auf primärpräventive Maßnahmen beschränken. Diese beziehen sich ausschließlich auf Personen, die keine besonderen Risikogruppen bilden und bei denen das Problem noch nicht aufgetreten ist.
Geschichte der Suchtprävention
Suchtprävention gibt es schon seit einigen 100 Jahren:
Bereits im 16. und 17. Jahrhundert sprach man von einer „Drogenkrise“, als durch die koloniale Expansion Europas der unkontrollierte Genuss von Kaffee, Tee, Tabak und Kakao die „gottgewollte Ordnung“ zu bedrohen schien (vgl. Weninger 1998, S. 42).
Im 19. Jahrhundert, nach der industriellen Revolution, verschlechterte sich der Ernährungszustand breiter Bevölkerungsschichten: eine Untersuchung aus dem Jahre 1882 spricht von einer „erstaunlichen Fülle von Surrogaten“, die sich im Verlaufe des Industrialisierungsprozesses Eingang in die Küchen der Armen verschafft hatte: Kaffee, Kakao, Haschisch, Opium, Tabak und Branntwein - letzterer diente als Durstlöscher, Sorgenbrecher und Hungerstiller in einem. Schnaps wurde zu einem ebenso wichtigen wie miserablen Nahrungsmittel der Unterschichten und war ein „Fluchtvehikel“, das die harten Realitäten des Fabrikdaseins milderte (vgl. Weninger 1998, S. 55 f).
Die Frustverdrängung durch Alkohol begann sich gleichsam epidemisch auszubreiten.
Alkohol wurde in der Folge als „immense Gefahr für die moderne Gesellschaft“ wahrgenommen und Branntwein wurde steuerlich belastet; im Jahre 1880 folgte gar ein striktes Alkoholverbot.
Die US-amerikanische Prohibitionspolitik der 20-er und beginnenden 30-er Jahre zeigte deutlich, dass ein Alkoholverbot den Gesamtkonsum zwar senken kann, die sozialen und medizinischen Probleme jedoch multipliziert.
Interessanterweise galten die sogenannten „Betäubungsmittel“ und „Rauschgifte“ lange Zeit nicht als gesellschaftliches Problem. Erst 1912 fand auf Initiative der USA die erste internationale Opiumkonferenz statt, in welcher der Grundstein für die Drogenprohibition des 20. Jahrhunderts gelegt wurde (vgl. Weninger 1998, S. 60).
So wurde einerseits versucht, durch strikte Verbote den Drogenkonsum einzudämmen, andererseits wurde der Rausch als wirtschaftlicher und politischer Marktwert entdeckt und ausgebaut: neue Drogen wurden erfunden ( Heroin durch ein deutsches Pharmaunternehmen für die Helden an der Front), Kriege mit ihnen geführt und Waffen gegen Drogen getauscht
(vgl. Koller 1999, S.29).
In der Öffentlichkeit herrschte die Meinung vor, dass Drogen von „verweichlichten Individuen“ in der weitgehend automatisierten und motorisierten Industriegesellschaft konsumiert wurden.
Erst Ende der 80-er Jahre belegte eine Studie der UNESCO erstmals, dass Aufklärung und Verbote allein nicht genügten. Der Missbrauch von legalen und illegalen Drogen wurde immer weniger getrennt und die Unterscheidung zwischen ursachen- und symptomorientierter Prävention begann sich langsam durchzusetzen (vgl. Weninger 1998, S. 61).
Die – erwiesenermaßen – kontraproduktive Prohibition von illegalen Drogen wurde und wird jedoch von starken Interessensgruppen forciert: die illegale Drogenindustrie nimmt immerhin den dritten Platz in der Weltwirtschaftsstatistik ein...(vgl. Koller 1999, S. 29).
Moderne Suchtprävention
Das Verständnis von Suchtvorbeugung hat sich in den letzten 20 Jahren tiefgreifend verändert. Abschreckung erwies sich in vielen Studien als wirkungslos oder sogar kontraproduktiv (vgl. Fellöcker 2000, S. 5 ff).
Auch die Vermittlung sachlicher Informationen, die „Drogenaufklärung“, erwies sich „im besten Falle als wirkungslos“ (Künzel-Böhmer u.a. 1993, S. 18).
Die Verengung des Blickwinkels auf illegale Drogen hat sich ebenfalls als falsch herausgestellt.
Als für eine ganzheitliche Suchtvorbeugung eher effektiv haben sich ursachenorientierte Verhaltensweisen erwiesen, wobei man die Ursachen nicht in einer einzigen vermuten darf.
Man spricht hier besser von einem „Ursachengeflecht“.
Modellhaft lassen sich diese auf vier Pole oder Hauptstränge reduzieren:
Die Persönlichkeit mit ihrer gegenwärtigen Ausstattung an seelischen, körperlichen und geistigen Potentialen und ihrer Geschichte;
Den sozialen Nahraum, in dem diese Person sich bewegt und reift (z. B. Elternhaus, Schule, Freundeskreis etc.).
Das zur Verfügung stehende Angebot an Suchtmitteln bzw. süchtigen Verhaltensweisen, also das Suchtpotential bestimmter Mittel, die Griffnähe, die Verfügbarkeit etc. (oder kurz die
drei M: Mensch, Milieu und Mittel oder Markt).
Diese drei werden ergänzt durch einen vierten Einflussfaktor:
Den gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. Konsum- und Leistungsbezogenheit einer Gesellschaft, Arbeitslosigkeit, soziales Klima usw.
Suchtvorbeugung muss an allen vier Wurzeln ansetzen, wenn sie effektiv sein will!
(vgl. Robra 2001, S. 9).
Dem zufolge ergibt sich, dass Suchtprävention nicht mehr als Betätigungsfeld für Mediziner/innen und Exekutivbeamt/innen gesehen werden kann: sie muss in die Hände von Präventionsfachkräften mit einer Grundausbildung in Pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie, Soziologie oder Psychotherapie gelegt werden.
Suchtprävention ist, wenn sie dauerhaft wirksam sein will, unmittelbar mit der Stärkung der Selbstorganisation und der Beziehungen sowie der Verbesserung der Kommunikation innerhalb eines Systems (z.B. Schule) verbunden. Sie trägt zur Unterstützung der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen bei (vgl. Fellöcker 2000, S. 4).
Allgemeine Maßstäbe
Suchtvorbeugung im Kindesalter erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beachtung. Da die pädagogische Arbeit mit Kindern in Kindergärten und Volksschulen meist weniger von Leistungsansprüchen, sondern von pädagogischen Zielen wie sozialem Lernen oder der Förderung der Kreativität geprägt ist, bieten sich hier besonders gute Möglichkeiten zur Integration präventiver Ansätze ins Erziehungsgeschehen.
Ansatzpunkte für Suchtprävention im Kindesalter
Als persönlichkeitsstärkende Maßnahmen nennt Eva Waibel in ihrem Buch „Erziehung zum Selbstwert“ folgende Punkte:
Akzeptanz der eigenen und der Persönlichkeit anderer,
Anerkennung und Wertschätzung der Kolleg/innen und Schüler/innen ,
Auseinandersetzung mit Wert- und Sinnfragen,
Förderung von Kritik- und Konfliktfähigkeit,
Förderung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühles,
Abbau von Misserfolgsängsten bei Schüler/innen,
Förderung von Offenheit und Vertrauen,
Reflexion des eigenen Konsumverhaltens,
Übungen zur Erhöhung der Genuss- und Erlebnisfähigkeit
(vgl. Waibel 1994, S. 32).
Die zentrale Aussage ist, dass moderne suchtpräventive Maßnahmen bei der Stärkung der psycho-sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ansetzen müssen!
Suchtprävention in der Schule
Schule spielt eine besonders wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie ist neben der Familie der wichtigste Ort der Sozialisation. Sie sollte sich daher als Bindeglied zwischen Familie und Gesellschaft verstehen und entsprechend agieren.
Im § 2 (I) de Schulorganisationsgesetzes und im § 17 des Schulunterrichtsgesetzes ist dies klar formuliert:
Es ist die Aufgabe der Schule, die Schüler/innen in der Entwicklung ihrer Anlagen im Allgemeinen und in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu fördern. Ein Teil des pädagogischen Auftrags an die Schule ist daher allgemeine Gesundheitsförderung sowie Prävention in verschiedenen Bereichen, also auch Suchtprävention. Schule will und muss mithelfen, die ihr anvertrauten Kinder zu selbständigen, toleranten und eigenverantwortlichen Menschen zu erziehen, besser formuliert: zu bilden (vgl. Fellöcker 2000, S. 125).
Als beispielhafte Angebote möchte ich an dieser Stelle Gerald Kollers „Strategienbündel“ auflisten:
Suchtprävention ist in ihrer Zielsetzung in verschiedene Ansätze zu untergliedern, welche individual- wie auch strukturorientiert eingesetzt werden können.
Möglichkeiten dazu bieten sich auf gesellschaftlicher Ebene, auf der Beziehungsebene und auf der persönlichen Ebene z.B. durch:
Zukunftswerkstätten
Jugendpolitik
Medienpädagogik
Familienförderung
Kommunikationstraining
Abenteuerspielplätze
Sozialpädagogische Reisen
Erlebnispädagogik
Anbieten von Krisenhelfern
Kultur des Festes
Die meisten dieser Maßnahmen können im System Schule umgesetzt werden. Eine gewisse Verantwortung obliegt natürlich auch der Politik – vor allem auf kommunalpolitischer Ebene. Über die Probleme bei der Umsetzung wird noch an anderer Stelle reflektiert.
Besonders wichtig ist, dass Prävention in jedem Fall ein kontinuierlicher Prozess sein soll, der nicht nur in Form von Projekten, sondern als pädagogisches Prinzip im Schulalltag von möglichst vielen Lehrkräften mitgetragen wird (vgl. Koller 1999, S. 67).
1.3 Warum ist eine Optimierung der psycho-sozialen Fähigkeiten überhaupt notwendig? Erhebung des „Ist-Zustandes “ der sozialen Situation der Kinder und Jugendlichen in Österreich
Mitte der 80er Jahre mehrten sich bei Lehrerinnen und Lehrern die Feststellungen, dass es jene „pflegeleichten“ Schülerinnen und Schüler, die so brav und lernbereit an ihren Schultischen gesessen waren, nicht mehr gab. Vom Einzelphänomen dauerte es nicht lange bis zur breiten Diagnose: Die Schülerinnen und Schüler waren „anders“ geworden, nämlich „schwieriger“, fast zu einer Behinderung für die gewohnte Art zu unterrichten.
„Die Leistungsbereitschaft ist gesunken, die Aggressivität ist in ihren unterschiedlichen Ausprägungsformen erheblich gestiegen. Bereits Schulanfänger zeigen wenig Lernfreude und Arbeitslust, sind zunehmend unkonzentriert und passiv, was sich an einer Art ‚Konsumhaltung’ im Unterricht erkennen lässt. Neben kognitiven Lernproblemen fallen vor allem Sozialisationsdefizite auf, die in einem Verlust von Werthaltungen und Umgangsformen explizit werden.“ (Bericht der Grundschule an der Bergmannstraße in München, Brockmeyer, 1995 zit. n. Altrichter u.a. 1998, S. 357).
Mit diesen Ausführungen beginnt Ferdinand Eder seinen Artikel „Kindheit – Jugend – Schule: Veränderte soziale Bezüge, neue Aufgaben der Schule?“ (vgl. Altrichter u.a. 1998, S.357).
1.4 Kinder heute
„17 % der Schüler werden gemobbt“ betitelte die Wiener Zeitung vom 4. 4. 2002 einen ihrer Leitartikel, in welchem sie Bezug auf eine Studie der Psychologin Barbara Gasteiger Klicpera nahm (http://www.soziales.lernen.at (2003-04-24)).
Die Studienautorin erwartet eine Zunahme von Verhaltensstörungen an allen österreichischen Schultypen. Die oben erwähnten gemobbten Kinder neigen dazu, depressiv zu werden.
Der Kinderpsychiater und Psychotherapeut Max Friedrich bestätigte diese Entwicklung und ging noch weiter: Eine vor einem Jahrzehnt durchgeführte Studie, die demnächst wiederholt werden soll, habe ergeben, dass in Österreich pro Monat durchschnittlich ein Schüler bzw. eine Schülerin Selbstmord begehe (http://www.sozialeslernen.at (2003-04-24)).
Die konkreten Anforderungen an die Schule bezüglich der Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz der Schüler/innen haben sich im Laufe der Zeit beträchtlich geändert – nicht zuletzt dadurch, dass sich die sozialen Lebensfelder für die heranwachsenden Jugendlichen zusehends verengt haben.
Die folgende Aufzählung gesamtgesellschaftlicher Problemfelder skizziert die aktuelle Situation:
Familie: Im Verlauf des 20. Jahrhunderts verfiel die einstige Großfamilie in ein soziales System, das die einzelnen Generationen in Wohn- und Sozialform deutlich voneinander trennt.
Zerfall der Kernfamilie: Die hohe Scheidungsrate – speziell im städtischen Raum mitunter über 50 % – führt zu Rumpffamilien mit alleinerziehenden Müttern, zu mehr oder weniger stabil in sie einziehenden Lebensgefährten, die fallweise noch Kinder aus Vorbeziehungen in diese Rumpffamilie einbringen, und zu einer sehr großen Zahl von singulär lebenden Männern, die ihre Vaterrolle in stark reduzierter Form wahrnehmen.
Wohn- und Arbeitsverhältnisse: Die Wohn- und Arbeitssituation hat sich in den letzten 30 Jahren massiv verändert, hin zu einer erhöhten Flexibilität und Mobilität in Zeit und Raum.
Veränderungen auf allen Ebenen sind alltäglich und finden damit auch im direkten Lebensraum der Kinder statt.
Freiräume: Mit den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen und den speziellen Wohnbedürfnissen im städtischen Raum kam es zu einer dramatischen Abnahme von freien Bewegungs- und Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. An Stelle dieser „wilden“ Freiräume wird eine gestaltete und vorgefertigte Umgebung als Erlebnisraum angeboten (vgl. Windl/Germany 1999/2000, S. 3ff).
Mediale Konfrontation: Zusätzlich zu den reduzierten Handlungsräumen für Kinder steigt das Angebot an fertigen virtuellen Erlebnisflächen im Zusammenhang mit neuen Medien wie TV und Film. Die Medialisierung der Kinder korreliert mit der Abnahme aktiver Tätigkeit und Aneignung von Umwelt und der Verdrängung unmittelbarer Erfahrungen – zumal wenn bereits 35 % der 6- bis 8-Jährigen pro Woche 30 Stunden und mehr fernsehen und 20 % dieser Altersgruppe Exzessivseher sind, d.h. mehr Zeit vor dem Fernseher als in der Schule verbringen (vgl. Wöll 1998, S. 6). Dabei spielt die intensive visuelle Komponente eine tragende Rolle, während die auditive Anregung als Wahrnehmungskanal immer mehr an Bedeutung verliert. Dies erscheint insofern von Bedeutung, als der Mensch in seiner sinnlichen Wahrnehmung auf vielfältige Sinnesanregung angewiesen ist und nicht vorrangig visueller Information bedarf.
Betrachtet man nun die dargestellten Punkte, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die emotionale und soziale Kompetenz von Kindern in sehr vielen Fällen reduziert ist und dass sich vielfältige Konflikte ergeben, die alle Bereiche des Lebens der Kinder erfassen können (vgl. Windl /Germany 1999/2000, S.6ff).
Es mehren sich die Stimmen, die darauf hinweisen, dass die sozialen Probleme nicht nur auf „viele Fälle“ zurückgehen, sondern dass die Sozialisation unserer Gesellschaft im Großen und Ganzen nicht glücklich verlaufe:
Lehrer/innen haben und bekommen es immer mehr mit Kindern zu tun, deren Ausmaß und Erscheinungsform an Störungen über die Tatsache nicht mehr hinwegtäuschen, dass die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft nicht nur auf dem Papier neurotisierende, d.h. krank machende Auswirkungen auf unsere Kinder haben. Damit gewinnt die Rolle des Lehrers/der Lehrerin eine Facette dazu: Er/Sie hat es nicht mehr nur mit gut kontrollierten, auf den kleinsten pädagogischen Hinweis reagierenden Kindern zu tun, sondern muss sich zunehmend mit neurotisierten, d.h. aggressiv oder apathisch-gleichgültigen Kindern konfrontiert sehen, bei denen sein/ihr Repertoire an pädagogischen Möglichkeiten meist sehr schnell versagt.
Im Artikel „Die Erziehungskatastrophe“ äußert sich Heinz Zangerle, Kinderpsychologe und Psychotherapeut in Innsbruck, in ähnlicher Weise: „Erschwerend für die Erziehungsarbeit sowohl der Eltern als auch der Lehrer/innen – wirkt sich wohl auch die Auflösung von überlieferten Rollen von Kind und Erwachsenen aus.( Lehrer/innen müssten hier auf Professionalität zurückgreifen können und dazu entsprechende Aus- und Weiterbildung erhalten!) Auf Kontinuität und Regelhaftigkeit wird weitgehend verzichtet, ganz real vorhandene Machtdimension wird geleugnet, und dabei werden die Grundmuster der sozialen Beziehung zwischen Erwachsenen symmetrisch auf Kinder übertragen. Erziehungsverhalten orientiert sich dann – unabhängig von Alter und Entwicklungsstand – allein am kindlichen Willen/Unwillen – aussparend, dass das Kind erst Welt erfahren kann und darin geltende, gebräuchliche Regeln, Werte, Sinn, Normen etc. kennen lernen, wissen und einüben muss, um dann daran auch seinen Willen/ Unwillen erproben zu können. Dabei wird die wichtigste Erfahrung des Erwartungsaufschubs, der Frustrationstoleranz, des Verzichtens, Aushalten und Durchhaltens unlustiger, wenig lustvoller und unangenehmer gemacht“ (Zangerle: „Die Erziehungskatastrophe“. In: aps-2/2003. S. 9-13).
Zangerle bemängelt im Verlauf dieses Artikels weiterhin, dass 65 % aller Kinder, die ihm wegen Lern- und Verhaltensstörungen vorgestellt wurden, esoterisch vorbehandelt worden waren. Er weist auf die Gefahren durch Behandlungsmethoden durch im Schnellverfahren ausgebildete „Therapeuten“ hin: was Kinder dabei lernen, ist der rasche Griff nach Tropfen und Kügelchen, um Schwierigkeiten zu beseitigen. Das ist die Vorstufe zur (Psychopharmaka-) Abhängigkeit.
Die Mehrzahl der Eltern ist also offensichtlich durch die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen heillos überfordert, ihre Kinder zu erziehen: Laut einer Fragebogenerhebung, die im Jahr 1998 in den Kindergärten Deutschlands durchgeführt wurde, zeigt bereits ein Viertel aller Kindergartenkinder Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität, Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Schwierigkeiten, ängstliches oder depressives Verhalten (Zangerle: „Die Erziehungskatastrophe“. In: aps-2/2003. S. 9-13).
Selbstdisziplin ist ein Wort, dass man sich schon nicht mehr in den Mund zu nehmen getraut .
Lernen ich, wir, Kinder, Jugendliche die Selbstbeschränkung und Selbstdisziplin nicht, die anfangs „von außen“ kommen muss, weil das Kind das lernende Wesen ist, dann gibt es keine Grenzen, kein Herausbilden von Schuldbewusstsein, kein Ertragen von Frustration und Bedürfnisaufschub, kein Entwickeln von Kräften, Schwierigkeiten und Versagungen auszuhalten. Die Folgen: Unverständnis, Ungehaltenheit, geringer Selbstwert, Machtbedürfnis, Wut, Zorn Aggression, Demolieren, Demonstrieren, sexuelle Übergriffe, Sucht, Depression, Totschlag, Freitod! (Zangerle: „Die Erziehungskatastrophe“. In: aps-2/2003. S. 9-13).
2 Zur vorliegenden Studie
2.1 Methode
Erhebung der Daten:
Die Grundlage für die Untersuchung ist ein Fragebogen mit sechs Fragen und Raum für eigene Bemerkungen (siehe Anhang). Die gestellten Fragen sollten nach folgendem Muster beantwortet werden:
1...trifft völlig zu
2...trifft eher zu
3...trifft eher nicht zu
4...trifft nicht zu
Diese Bögen wurden im Frühjahr 2003 an fünf Kindergärten, fünf Volksschulen und fünf Hauptschulen im Bezirk Baden im südlichen Niederösterreich versandt.
Daraus ergab sich folgendes Sample:
An den Kindergärten betrug die Rücklaufquote 60%, an den Volksschulen 42% und an den Hauptschulen 74%. Insgesamt wurden 104 Personen befragt.
Für die Auswertung der Daten verwendete ich das SPSS II - Statistikprogramm, wobei ich mich auf Mittelwertvergleiche und T-Tests bei unabhängigen Stichproben beschränkte.
2.2 Ergebnisse
Frage 1: „Ich halte es für notwendig, an Kindergärten und Schulen suchtpräventive Maßnahmen zu setzen.“
Der Vergleich der Mittelwerte zeigt folgendes Ergebnis.
Kindergärten: 1,33
Volksschulen: 1,57
Hauptschulen: 1,39
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832485863
- ISBN (Paperback)
- 9783838685861
- DOI
- 10.3239/9783832485863
- Dateigröße
- 752 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- University of Derby – Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- suchtprävention platz schulwesen lehrpläne praktische modelle
- Produktsicherheit
- Diplom.de