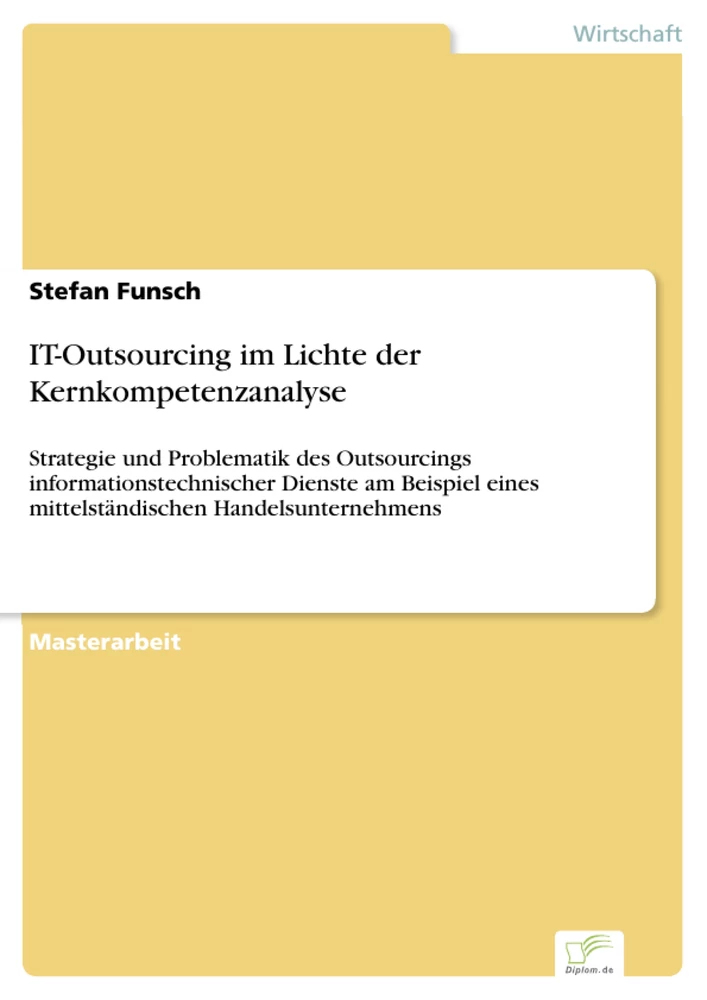IT-Outsourcing im Lichte der Kernkompetenzanalyse
Strategie und Problematik des Outsourcings informationstechnischer Dienste am Beispiel eines mittelständischen Handelsunternehmens
©2004
Masterarbeit
111 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Während die 90er Jahre geprägt waren durch grenzenlos erscheinende IT-Budgets vieler Unternehmen, mit denen teilweise mächtige IT-Abteilungen und eigene Rechenzentren errichtet wurden, ist dieser Trend seit einigen Jahren rückläufig. Auf Grund der rasanten Entwicklung der Technologie muss in immer kürzeren Abständen neues Know-how aufgebaut werden so dass eine effiziente Bereitstellung der IT vielfach an finanzielle Grenzen stößt.
Viele Unternehmen überlegen nunmehr sehr genau ob und wofür sie neue Investitionen innerhalb der IT tätigen wollen und mit welchem Return on Invest sie dabei rechnen können. Der Trend in die eigene IT zu investieren ist nicht nur rückläufig sondern seit einigen Jahren überlegen viele Firmen, wie wichtig und strategisch sinnvoll eine IT im eigenen Hause eigentlich ist und ob eine Auslagerung dieses Unternehmensbereiches, ein so genanntes Outsourcing, nicht ökonomischer ist.
IT-Outsourcing ist derzeit in aller Munde und erfreut sich in dem seit dem Zusammenbruch der New Economy arg gebeutelten IT-Markt, vor allem bei den Anbietern einer wachsenden Beliebtheit. Immer mehr IT-Häuser, wie IBM, EDS, HP oder Accenture bieten IT-Outsourcing als Service an und versprechen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen.
Das Outsourcing von IT-Dienstleistungen in Form von Beratung oder Durchführung von Implementierungsprojekten, was letztendlich nichts anderes als eine klassische Arbeitsteilung zwischen hausinternen und externen Dienstleistern darstellt, ist dagegen im Prinzip nichts Neues. Bereits bevor der IT-Boom zum Hype wurde, zogen Unternehmen externe Ressourcen zu Rate, um ihre IT zu optimieren.
Zu dieser, wahrscheinlich einfachsten Form des Outsourcing haben sich im Laufe der Jahre jedoch immer neue Ausprägungen hinzugesellt. Eine dieser, eher jüngeren und auch umstrittenen Ausprägungen betrifft das Auslagern des kompletten IT-Bereiches samt Mitarbeitern. Obwohl umstritten, werden bereits weltweit milliardenschwere Geschäfte mit diesem Outsourcing-Trend zwischen Unternehmen und den so genannten IT-Service-Providern geschlossen.
Alleine die IBM, als einer der weltweit größten Outsoucing-Anbieter, hat im Jahr 2003 ca. 15 Mrd. US-Dollar Umsatz mit Outsourcing-Aufträgen erwirtschaftet. Trotz dieses nach wie vor anhaltenden Trends zeigen Untersuchungen, dass mindestens die Hälfte aller Outsourcing-Verträge nicht den gewünschten Erfolg bringt und einige Unternehmen bereits wieder auf ein Insourcing […]
Während die 90er Jahre geprägt waren durch grenzenlos erscheinende IT-Budgets vieler Unternehmen, mit denen teilweise mächtige IT-Abteilungen und eigene Rechenzentren errichtet wurden, ist dieser Trend seit einigen Jahren rückläufig. Auf Grund der rasanten Entwicklung der Technologie muss in immer kürzeren Abständen neues Know-how aufgebaut werden so dass eine effiziente Bereitstellung der IT vielfach an finanzielle Grenzen stößt.
Viele Unternehmen überlegen nunmehr sehr genau ob und wofür sie neue Investitionen innerhalb der IT tätigen wollen und mit welchem Return on Invest sie dabei rechnen können. Der Trend in die eigene IT zu investieren ist nicht nur rückläufig sondern seit einigen Jahren überlegen viele Firmen, wie wichtig und strategisch sinnvoll eine IT im eigenen Hause eigentlich ist und ob eine Auslagerung dieses Unternehmensbereiches, ein so genanntes Outsourcing, nicht ökonomischer ist.
IT-Outsourcing ist derzeit in aller Munde und erfreut sich in dem seit dem Zusammenbruch der New Economy arg gebeutelten IT-Markt, vor allem bei den Anbietern einer wachsenden Beliebtheit. Immer mehr IT-Häuser, wie IBM, EDS, HP oder Accenture bieten IT-Outsourcing als Service an und versprechen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen.
Das Outsourcing von IT-Dienstleistungen in Form von Beratung oder Durchführung von Implementierungsprojekten, was letztendlich nichts anderes als eine klassische Arbeitsteilung zwischen hausinternen und externen Dienstleistern darstellt, ist dagegen im Prinzip nichts Neues. Bereits bevor der IT-Boom zum Hype wurde, zogen Unternehmen externe Ressourcen zu Rate, um ihre IT zu optimieren.
Zu dieser, wahrscheinlich einfachsten Form des Outsourcing haben sich im Laufe der Jahre jedoch immer neue Ausprägungen hinzugesellt. Eine dieser, eher jüngeren und auch umstrittenen Ausprägungen betrifft das Auslagern des kompletten IT-Bereiches samt Mitarbeitern. Obwohl umstritten, werden bereits weltweit milliardenschwere Geschäfte mit diesem Outsourcing-Trend zwischen Unternehmen und den so genannten IT-Service-Providern geschlossen.
Alleine die IBM, als einer der weltweit größten Outsoucing-Anbieter, hat im Jahr 2003 ca. 15 Mrd. US-Dollar Umsatz mit Outsourcing-Aufträgen erwirtschaftet. Trotz dieses nach wie vor anhaltenden Trends zeigen Untersuchungen, dass mindestens die Hälfte aller Outsourcing-Verträge nicht den gewünschten Erfolg bringt und einige Unternehmen bereits wieder auf ein Insourcing […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8575
Funsch, Stefan: IT-Outsourcing im Lichte der Kernkompetenzanalyse -
Strategie und Problematik des Outsourcings informationstechnischer Dienste
am Beispiel eines mittelständischen Handelsunternehmens
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Fachhochschule Bochum, MA-Thesis / Master, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Stefan Funsch - D
IPL
. B
ETRIEBSWIRT
/ M
ASTER OF
S
CIENCE
Am Homberg 9, 45529 Hattingen
Tel.: 02324/ 501575
E-Mail: stfunsch@web.de
Angaben zur Person
Geburt:
24. Juni 1972 in Essen
Familienstand: verheiratet
Konfession:
römisch-katholisch
Studium
2002 - 2004
Berufsbegleitendes Masterstudium zum Master of Science in Interna-
tional Management in Bochum (Gesamtnote: 1,3)
Masterarbeit: IT-Outsourcing im Lichte der Kernkompetenzanalyse -
Strategie und Problematik des Outsourcing informationstechnischer
Dienste am Beispiel eines mittelständischen Handelsunternehmens (No-
te: sehr gut)
1997 - 2000
Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bochum (Gesamtnote: 1,1)
Diplomarbeit: Das SAP Knowledge Warehouse als Lösung für SAP Re-
tail Solutions im Kontext Wissensmanagement (Note: sehr gut), ausge-
zeichnet mit dem Transferpreis Wirtschaft.
Beruflicher Werdegang
2000 - heute
IT Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen - Business Consul-
tant
Hauptaufgabenbereiche:
Organisations- und Veränderungsmanagement; Projektmanagement, -
koordination und -organisation; Inhouse Consulting; Business Develop-
ment; Handel
1996 - 1997
TOYS `R´ US - Store Manager in den Filialen Hagen, Wuppertal und
Krefeld
Hauptaufgabenbereiche:
Abteilungsleitung Operations und Kundenservice; Führung und Training
von ca. 15 Mitarbeitern; Einkauf Direktanlieferungen
1992 - 1996
C & A MODE & CO Nachwuchs-Führungskraft in den Filialen Bremen,
München, Berlin und Idar-Oberstein
Hauptaufgabenbereiche:
Koordination des Warenflusses und der Warenpräsentation; Qualitäts-
und Sortimentsmanagement; Kundenservice und Beschwerdemanage-
ment; fachliche Führungsverantwortung für ca. 15-20 Mitarbeiter; stell-
vertretende Filialleitung
Sonstige Kenntnisse
Sprachen
Englisch, fließend in Wort und Schrift
Spanisch, Grundkenntnisse
EDV
sehr gutes IT-Allgemeinwissen; sehr gute Anwenderkenntnisse in MS
Office-, Bildbearbeitungs- und Webdesign-Programmen; Grundkenntnis-
se in HTML-, JavaScript- und SQL-Programmierung sowie in den SAP-
Modulen Mobile Engine und Knowledge Warehouse.
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung ... 1
2
Theoretische Grundlagen des Outsourcing ... 4
2.1
Entwicklung und Ursachen des Outsourcing... 4
2.1.1
Bedeutung und Entstehung des Outsourcing ... 4
2.1.2
Wirtschaftstheoretische Sichtweise des Outsourcing ... 8
2.1.2.1
Die Bedeutung der Transaktionskostentheorie für das Outsourcing... 9
2.1.2.2
Die Bedeutung des Principle-Agent-Ansatz für das Outsourcing... 13
2.2
Der Einfluss des Outsourcing-Ansatzes auf Unternehmen ... 16
2.2.1
Die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch Outsourcing ... 17
2.2.2
Der Einfluss des Outsourcing auf die Unterteilung von Unternehmens-
aktivitäten in Kern- und Nichtkernaktivitäten... 19
2.2.3
Der Einfluss des Outsourcing auf nicht-monetäre Aspekte ... 23
2.2.4
Zusammenfassung der Benefits eines Outsourcing für ein Unter-
nehmen ... 25
2.2.5
Barrieren und Risiken eines Outsourcing ... 26
2.3
Empfehlungen und Instrumente zur strategischen Vorqualifizierung eines
Outsourcing... 28
3
Die Anwendung des Outsourcing auf den IT-Bereich ... 33
3.1
Entwicklung und Prognose des Marktes für IT-Outsourcing ... 33
3.2
Kategorisierung des IT-Outsourcing ... 35
3.2.1
Organisatorische Segmentierung... 36
3.2.2
Fachliche/ Inhaltliche Segmentierung ... 41
3.3
IT-Outsourcing und der Einsatz von Offshore-Ressourcen... 47
3.4
Beweggründe und mögliche Benefits eines IT-Outsourcing ... 48
3.5
Risiken und Erfolgsfaktoren eines IT-Outsourcing ... 51
3.6
Erarbeitung einer möglichen Vorgehensweise zur Abwägung eines IT-
Outsourcing... 53
3.6.1
Strukturierung der Outsourcing-Evaluierung als Projekt ... 55
3.6.2
Die Analysephase Die Due-Diligence ... 56
3.6.3
Erarbeitung eines Governance-Modells... 60
4
Evaluierung des IT-Outsourcing bei einem mittelständischen Handels-
unternehmen ... 62
Inhaltsverzeichnis
II
4.1
Die Situation im Handel ... 64
4.2
Kernkompetenzen des Handels... 67
4.3
Vorstellung und Zweck des Beispiel-Projektes ... 70
4.4
Die Outsourcing-Evaluierung ... 72
4.4.1
Die Erarbeitung eines Business-Konzeptes Die Due-Diligence ... 72
4.4.1.1
Liefermodell... 73
4.4.1.2
Kalkulation und Preismatrix ... 77
4.4.1.2.1
Kalkulation der Mindestabnahmemenge ... 77
4.4.1.2.2
Kalkulation und Erstellung der Preismatrix... 80
4.4.1.2.3
Die Gesamt-Vergleichskalkulation ... 84
4.4.2
Ausarbeitung eines Governance Modells ... 86
4.5
Bewertung und Ergebnis des Projektes ... 88
4.5.1
Diskussion der Outsourcing-Evaluierung ... 88
4.5.2
Empfehlungen an das Handelshaus ... 92
5
Fazit
... 94
Anhang
... 96
Literaturverzeichnis ... 97
Abbildungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Abhängigkeit der Transaktionskosten von der Eigenschaft
Spezifität der Leistung und der gewählten Koordinationsform... 12
Abbildung 2: Principal-Agent-Theorie im Überblick ... 15
Abbildung 3: Wertkette nach Porter... 17
Abbildung 4: Eskalationstreppe zur Prüfung von Fähigkeiten/Aktivitäten... 21
Abbildung 5: Zuordnung von Transaktionen zu Koordinationsformen ... 28
Abbildung 6: Koordinationsformen in Abhängigkeit von Spezifität und
strategischer Relevanz der Aufgabe ... 29
Abbildung 7: Empfehlungen durch Gegenüberstellung von strategischer
Relevanz und Häufigkeit einer Aktivität... 29
Abbildung 8: Ressourcenallokation ... 31
Abbildung 9: Koordinationsform in Abhängigkeit vom Einfluss der Qualität der
Aktivität auf den Wettbewerbsvorteil und der möglichen Qualitäts-
verbesserung durch Outsourcing ... 32
Abbildung 10: Komplexitätsgrad der Anforderungen an beteiligte Personen und
Unternehmen bei unterschiedlichen Outsourcing-Segmenten und
mögliche Koordinationsformen... 36
Abbildung 11: Beispiel für Multi-Vendor-Sourcing, eine Zwitterform des
partiellen und totalen Outsourcing... 38
Abbildung 12: Entwicklungsprognose der für ein Outsourcing in Frage
kommenden Geschäftsprozesse ... 40
Abbildung 13: Entstehung von Unternehmensnetzwerken durch BPO... 41
Abbildung 14: Weltweite Größe und Wachstum der IT-Outsourcing-Segmente . 47
Abbildung 15: Beweggründe eines IT-Outsourcing... 49
Abbildung 16: Bewertung der Entscheidungsfaktoren für ein IT-Outsourcing... 49
Abbildung 17: Phasenmodell einer Outsourcing-Evaluierung ... 62
Abbildung 18: Phasenmodell eines IT-Outsourcing-Projektes... 62
Abbildung 19: Entwicklung der Einzelhandelsumsätze... 65
Abbildung 20: Herausforderungen für Handelsunternehmen im Überblick... 65
Abbildung 21: Anteil abgeschlossener IT-Outsourcing-Verträge im Branchen-
vergleich ... 66
Abbildung 22: Beispiel einer Handelswertkette... 68
Abbildung 23: Modellskizze der Preismatrix... 75
Abbildungsverzeichnis
IV
Abbildung 24: Entwicklung der Projekt-Lieferorganisation... 76
Abbildung 25: Preismatrix aus dem Beispielprojekt mit fiktiven Zahlen aber realer
Relation. Abnahmevolumen pro Jahr in Personentagen und Preis
pro Stunde... 84
Abbildung 26: Kosteneinsparungen des Kunden bei einem Outsourcing in der
Jahresbetrachtung... 86
Abbildung 27: Governance-Modell aus dem Beispielprojekt... 87
Abbildung 28: Standardisierter Prozess aus dem Beispielprojekt bei neuen
Anforderungen der Fachabteilungen... 87
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Kalkulationsparameter... 78
Tabelle 2: zusätzliche Kalkulationsparameter für die Gesamtkalkulation ... 82
Abkürzungsverzeichnis
V
Abkürzungsverzeichnis
BPO
Business Process Outsourcing
E
Effizienzsteigerung in Prozent
eOV
Für den Outsourcer mögliches Gesamtabnahmevolumen mit Effizienz-
steigerung in Personentagen
ERP
Enterprise Ressource Planning
GKKm Gesamtkosten für den Kunden mit Outsourcing
GKKo
Gesamtkosten für den Kunden ohne Outsourcing
OGK
Outsourcer-Gesamtkosten für das mögliche Gesamtabnahmevolumen
OGP
Outsourcer-Gesamtpreis für das mögliche Gesamtabnahmevolumen
OOP
Outsourcer-Operations-Gesamtpreis
OOK
Outsourcer-Operations-Gesamtkosten
OV
Für den Outsourcer mögliches Gesamtabnahmevolumen in Personen-
tagen
Ox
Abdeckung des Gesamtprojektvolumens durch den Outsourcer -
Dienstleistungs-Katalog in Prozent
IT
Informationstechnologie
iV
Interner Verrechnungssatz des Kunden (Tagessatz)
M
Outsourcer-Marge in Prozent
MA
Mindestabnahmemenge in Euro
MApt
Mindestabnahmemenge in Personentagen
oAK
Auf die Laufzeit gleichmäßig verteilte Offshore-Ausbildungskosten
oK
Kostensatz der Offshore-Ressourcen
OKK
Operations-Kosten des Kunden ohne Outsourcing
OM
Operations-Marge (Outsourcer) in Prozent
oPT
Anteil Offshore-Ressourcen in Personentagen
pmPT
Anteil Projektmanagement in Personentagen
PN
Publication Number (Kennzeichnung von Gartner-Dokumenten)
pV
Prognostiziertes Gesamtprojektvolumen in Personentagen
SLA
Service Level Agreement
SP
Stundenpreis bei Abnahme des für den Outsourcer möglichen Gesamt-
abnahmevolumens
Abkürzungsverzeichnis
VI
TK
Auf die Laufzeit gleichmäßig verteilte Transformations- und Integrati-
onskosten (s.u.)
TP
Tagespreis bei Abnahme des für den Outsourcer möglichen Gesamtab-
nahmevolumens
Einleitung
1
1
Einleitung
Während die 90er Jahre geprägt waren durch grenzenlos erscheinende IT-Budgets
vieler Unternehmen, mit denen teilweise mächtige IT-Abteilungen und eigene
Rechenzentren errichtet wurden, ist dieser Trend seit einigen Jahren rückläufig.
Auf Grund der rasanten Entwicklung der Technologie muss in immer kürzeren
Abständen neues Know-how aufgebaut werden so dass eine effiziente Bereitstel-
lung der IT vielfach an finanzielle Grenzen stößt.
Viele Unternehmen überlegen nunmehr sehr genau ob und wofür sie neue Investi-
tionen innerhalb der IT tätigen wollen und mit welchem Return on Invest sie da-
bei rechnen können. Der Trend in die eigene IT zu investieren ist nicht nur rück-
läufig sondern seit einigen Jahren überlegen viele Firmen, wie wichtig und strate-
gisch sinnvoll eine IT im eigenen Hause eigentlich ist und ob eine Auslagerung
dieses Unternehmensbereiches, ein so genanntes Outsourcing, nicht ökonomischer
ist.
1
IT-Outsourcing ist derzeit in aller Munde und erfreut sich in dem seit dem Zu-
sammenbruch der New Economy arg gebeutelten IT-Markt, vor allem bei den
Anbietern einer wachsenden Beliebtheit. Immer mehr IT-Häuser, wie IBM, EDS,
HP oder Accenture bieten IT-Outsourcing als Service an und versprechen Kosten-
einsparungen und Effizienzsteigerungen.
2
Das Outsourcing von IT-Dienstleistungen in Form von Beratung oder Durchfüh-
rung von Implementierungsprojekten, was letztendlich nichts anderes als eine
klassische Arbeitsteilung zwischen hausinternen und externen Dienstleistern dar-
stellt, ist dagegen im Prinzip nichts Neues. Bereits bevor der IT-Boom zum ,,Hy-
pe" wurde, zogen Unternehmen externe Ressourcen zu Rate, um ihre IT zu opti-
mieren.
3
Zu dieser, wahrscheinlich einfachsten Form des Outsourcing haben sich im Laufe
der Jahre jedoch immer neue Ausprägungen hinzugesellt. Eine dieser, eher jünge-
ren und auch umstrittenen Ausprägungen betrifft das Auslagern des kompletten
IT-Bereiches samt Mitarbeitern. Obwohl umstritten, werden bereits weltweit mil-
liardenschwere Geschäfte mit diesem Outsourcing-Trend zwischen Unternehmen
und den so genannten IT-Service-Providern geschlossen.
1
Vgl. Ruoff, M.J.; Strategic Outsourcing, Steigerung der Unternehmenseffizienz durch Outsour-
cing, Zürich 2001, S. 9.
2
Vgl. Müller, E./ Preissner, A.; Outsourcing: Weg damit!, in: Manager-Magazin online,
http://manager-magazin.de/artikel/0,2828,278755,00.html
, 16.02.2004.
Einleitung
2
Alleine die IBM, als einer der weltweit größten Outsoucing-Anbieter, hat im Jahr
2003 ca. 15 Mrd. US-Dollar Umsatz mit Outsourcing-Aufträgen erwirtschaftet.
4
Trotz dieses nach wie vor anhaltenden Trends zeigen Untersuchungen, dass min-
destens die Hälfte aller Outsourcing-Verträge nicht den gewünschten Erfolg
bringt und einige Unternehmen bereits wieder auf ein Insourcing der IT drängen.
5
Woran liegt es, dass so viele Outsourcing-Bestrebungen scheitern? Wie sinnvoll
ist das Outsourcing des kompletten IT-Bereiches und welche Rolle spielt dabei
die Betrachtung von Kernkompetenzen?
Viele Unternehmen stellen sich derzeit derartige Fragen und sind skeptischer ge-
genüber dem Outsourcing-Trend geworden. Trotzdem, so sagen Experten, könnte
Outsourcing und somit die Reduktion der unternehmerischen Leistungstiefe
6
die
Unternehmenslandschaft in ähnlichem Ausmaß revolutionieren, wie einst das
Fließband und Lean Production.
7
Die vorliegende Masterarbeit widmet sich intensiver der Auslagerung kompletter
IT-Abteilungen. Das Ziel der Ausarbeitung ist es, zu analysieren, ob das Ausla-
gern des kompletten IT-Bereichs für ein Unternehmen ökonomisch (d.h. monetär
wie strategisch) sinnvoll ist und was dabei ggf. zu berücksichtigen ist. An Hand
eines Projektes aus der Praxis bei einem mittelständischen Handelsunternehmens,
das seine gesamte IT auslagern möchte, wird eine mögliche Vorgehensweise zur
Outsourcing-Evaluierung erarbeitet und das Komplett-Outsourcing der IT disku-
tiert.
Da bislang in Literatur und Praxis eine allgemein anerkannte Definition für die
Begrifflichkeit des Outsourcing fehlt,
8
ist es notwendig, eine gemeinsame Diskus-
sionsbasis für die Analyse und insbesondere für den praktischen Teil der Arbeit zu
schaffen.
3
Vgl. Streicher, H.; Outsourcing - Arbeitsteilung in der Datenverarbeitung, München 1993, S. 13.
4
Vgl. Computerwoche-Online; Die Kehrseite des Outsourcing Booms,
http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=58739
; 08.03.2004.
5
Vgl. Gartner Inc. (Hrsg.); Strategic Sourcing ,,The Book", White Paper, Juli 2002, S. 3.
6
Das Ausmaß der Leistungstiefe wird nach Picot durch das Ausmaß bestimmt, in dem benachbarte
Leistungsstufen jeweils innerhalb eines Unternehmens erstellt werden. (Vgl. Picot, A., Ein neuer
Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, in: Zeitung für Betriebswirtschaft (ZfB), 43 (1991),
Nr. 4, , S. 337).
7
Vgl. Fink, D./ Köhler, T./ Scholtisseck, S.; Die dritte Revolution der Wertschöpfung, Mit Co-
Kompetenzen zum Unternehmenserfolg, München 2004, S. 12 f.
8
Vgl. Ruoff, M.J.; a.a.O., S. 7.
Einleitung
3
Kapitel 2 widmet sich daher zunächst der Theorie des klassischen Outsourcing
und geht auf die Entstehung sowie dafür ausschlaggebende Beweggründe ein. Das
Kapitel stellt dabei zunächst die Bedeutung und Entstehung des Outsourcing dar,
bevor es sich den wirtschaftstheoretischen Hintergründen widmet. Das Thema
Outsourcing wird dort aus der Sichtweise der mikroökonomischen Theorie, insbe-
sondere an Hand der Transaktionskosten- sowie Principal-Agent-Theorie erläu-
tert. Mit diesen bedeutenden organisationstheoretischen Ansätzen der Mikroöko-
nomie lassen sich die Entstehung von Unternehmen und Zusammenarbeitsformen,
wie das Outsourcing, bereits begründen.
9
An die wirtschaftstheoretische und eher abstraktere Betrachtung anschließend,
werden im zweiten Teil dieses Kapitels Bedeutung und Einflussnahme des Out-
sourcing-Ansatzes auf Unternehmen und in Bezug auf unternehmerische Ent-
scheidungen untersucht.
Im dritten Kapitel wird dann das spezielle Gebiet des Outsourcing, das IT-
Outsourcing, vorgestellt und eine mögliche Vorgehensweise zur Evaluierung und
Analyse eines derartigen Outsourcing-Projektes erarbeitet.
Auf dieser Grundlage findet in Kapitel 4 die Theorie in der Praxis Anwendung.
Am Beispiel eines mittelständischen Handelsunternehmens (dessen Namen und
weitere Informationen, die auf den Namen schließen lassen, in dieser Arbeit aus
Geheimhaltungsvereinbarungen nicht genannt werden dürfen) wird die zuvor er-
arbeitete Vorgehensweise sowie die Aspekte der Theorie angewandt, um ein mög-
liches IT-Outsourcing des Unternehmens zu beurteilen. Das Ergebnis soll schließ-
lich Aufschluss über die Ausgangsfragestellung geben, ob ein Outsourcing der IT
sinnvoll ist. Zudem soll es einen Ansatz für eine verallgemeinernde Aussage be-
züglich des Komplett-Outsourcing der IT sowie der Rolle von Kernkompetenzen
in diesem Zusammenhang liefern. Ebenso wie das Handelsunternehmen so wird
auch der Name des Outsourcing-Anbieters in dieser Ausarbeitung nicht genannt.
Der Anbieter dieser Dienstleistung wird stattdessen im folgenden als ,,Outsour-
cer" bezeichnet.
9
Vgl. Ruoff, M.J.; a.a.O., S. 7 ff.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
4
2
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
Der Begriff des Outsourcing und auch viele der Strategien und Managementansät-
ze, die sich dahinter verbergen sind mittlerweile nicht mehr neu. Dennoch exis-
tiert erstaunlicherweise noch immer keine eindeutige und allgemein anerkannte
Definition des Outsourcing.
10
Das mag einerseits daran liegen, dass die Anwen-
dung der Begrifflichkeit in den letzten Dekaden einem stetigen Wandel unterlegen
war. Andererseits könnte auch die ständige Weiterentwicklung und die verschie-
denartigen neuen Trends der Outsourcing-Strategie der Unternehmen ein Grund
für die unscharfe Begriffsabgrenzung sein.
Aus diesem Grund ist es erforderlich, eine theoretische Grundlage für ein gemein-
sames Verständnis der Thematik zu schaffen, bevor man sich einer Outsourcing-
Diskussion zuwendet. In diesem Kapitel wird zunächst die historische Entwick-
lung des Outsourcing dargestellt, um die Ursprünge sowie die unterschiedlichen
Phasen der Anwendung der Begrifflichkeit zu erörtern und so zu einer für diese
Ausarbeitung grundlegende Definition zu gelangen.
Um schließlich ein tieferes Verständnis für die Beweggründe des Outsourcing zu
schaffen und gleichzeitig zu den Kriterien bei einer Outsourcing-Entscheidung
hinzuführen, werden Erklärungsansätze aus wirtschaftstheoretischer Sicht sowie
die Bedeutung für unternehmerische Entscheidungen dargestellt.
Gemeinsam mit dem an einer späteren Stelle der Ausarbeitung erläuterten IT-
Outsourcing werden somit die theoretischen Grundlagen für die Analyse eines
Praxisbeispiels geschaffen, ob und unter welchen Umständen ein Outsourcing der
IT als ratsam angesehen werden kann.
2.1
Entwicklung und Ursachen des Outsourcing
2.1.1 Bedeutung und Entstehung des Outsourcing
Der eigentliche Begriff des Outsourcing stammt aus dem amerikanischen Wirt-
schaftsleben (Outside Resource Using) und besagt, dass ein Unternehmen defi-
nierte Ressourcen bzw. Aufgaben in die Verantwortung Dritter übergibt.
10
Vgl. Ruoff, M.J.; a.a.O., S. 7.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
5
Obwohl man die Idee, bestimmte Funktionen an Fremdfirmen zu vergeben, zu-
mindest in Westdeutschland, bereits vereinzelt in den ausgehenden 50er Jahren
findet,
11
tauchte der Begriff des Outsourcing erstmals in den frühen 80er Jahren
auf.
Während die Unternehmen in den 60er und 70er Jahren versuchten, das Risiko
nachlassender Geschäfte innerhalb ihrer Kernaktivitäten durch Diversifikations-
strategien zu verringern, schlug der Trend in den Jahren darauf in die genau ent-
gegengesetzte Richtung um. Man gelangte zu der Ansicht, dass durch eine Diver-
sifikationsstrategie die Ressourcen zu verstreut, mit teilweise zu großem Kosten-
aufwand in neuen Bereichen eingesetzt werden, anstatt sie gebündelt auf die Be-
reiche zu konzentrieren, in denen man bereits etablierte Erfahrung und entspre-
chende Expertise aufgebaut hatte. Zu große und kostenträchtige Administrations-
bereiche waren nicht nur bei den Kernaktivitäten, sondern auch in den Nicht-
Kernbereichen entstanden. Der Verkauf oder die Auslagerung dieser Nicht-
Kernbereiche und -Aktivitäten bot daher eine gute Alternative, um die frei wer-
denden Ressourcen anderweitig effizienter zu nutzen.
12
In der betriebswirtschaftlichen Literatur wurde die Fremdvergabe in größerem Stil
an Zulieferfirmen jedoch zunächst nicht als Outsourcing, sondern als `make-or-
buy´ oder Lean Production erfasst, womit Entscheidungen über die Fertigungs-
bzw. Leistungstiefe, d.h. über Eigen- oder Fremdherstellung, eines Industrieunter-
nehmens beschrieben wurden. In der Literatur zum strategischen Management
und insbesondere für die Auslagerung von Dienstleistungen wird dies heutzutage
tendenziell häufiger unter dem Begriff Outsourcing diskutiert.
13
Die Beweggründe für ein Outsourcing können sehr verschieden sein (s. dazu
Kapitel 2.2.4.
) und auch bzgl. der organisatorischen Ausprägung existieren diffe-
renzierte Outsourcing-Ansätze. So kann die mögliche Drittfirma eine Tochterge-
sellschaft, eine Beteiligungsgesellschaft oder aber ein völlig fremdes Unterneh-
men sein. In den beiden ersten Fällen spricht man auch vom internen, in letzterem
Fall vom externen Outsourcing.
11
Vgl. Köhler-Frost, W.; Outsourcing sich besinnen auf das Kerngeschäft, in: Köhler-Frost, W.
(Hrsg.); Outsourcing, Eine strategische Allianz besonderen Typs, Berlin 1993, S. 13.
12
Vgl. Oates, D.; Outsourcing and the virtual organization, The incredible shrinking company,
London 1998, S. 1f.
13
Vgl. Picot, A.; Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, a.a.O., S. 338.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
6
Sehr häufig, wurde und wird der hohe Kosten-Druck, insbesondere durch die be-
reits an früherer Stelle erwähnten gewachsenen, überdimensionierten Administra-
tionsbereiche der Unternehmen als ein Grund für das Outsourcing bestimmter
Bereiche angeführt. So waren zunächst einerseits die ,,Hilfs-Aktivitäten" eines
Unternehmens, die in zu vernachlässigendem Ausmaß mit dem Geschäftsgegens-
tand in Zusammenhang standen, wie Gebäudereinigung, Werkschutz oder Mitar-
beiterrestaurant Mittelpunkt von Auslagerungsbestrebungen.
Andererseits wurden viele Unternehmen, besonders in der Fertigung, zu einer
Auslagerung auch von wertschöpfenden Aktivitäten motiviert, da man z.B. be-
stimmte Bauteile, mitunter auf Grund von hohen Administrationskosten nur we-
sentlich teurer produzieren konnte als andere Anbieter. Diese Überlegungen wur-
den, wie erwähnt, zunächst durch den Begriff ,,make-or-buy" geprägt.
14
Das Er-
gebnis war eine stetig abnehmende Fertigungs- bzw. Leistungstiefe, die zu Effi-
zienzgewinnen, Qualitätsverbesserungen und gesteigerter Innovationsfähigkeit
durch Fokussieren auf die Kernkompetenzen führen konnte, obwohl sich die
Wertschöpfung der Unternehmen reduzierte.
15
Als eine der Ursachen für dieses Phänomen gilt, dass mit steigender Komplexität
der Komponenten das Management eines Unternehmens nicht jeder einzelnen
Komponente die gleiche erforderliche Aufmerksamkeit zukommen lassen kann.
Ob es nun das Design oder die technische und strategische Weiterentwicklung der
Komponenten anbelangt, das Gesamtprodukt leidet bei komplexen Produkten
unter der fehlenden Detailbetrachtung der Einzelbauteile.
Durch die Spezialisierung eines Herstellers auf eine Komponente kann dieses
Problem jedoch entflochten werden und zudem, vornehmlich bei Standardbautei-
len, durch Größenvorteile (economies of scale) Kostenvorteile erzielt werden.
Als Beispiel denke man an die während der letzten Jahrzehnte gestiegene Kom-
plexität eines Autositzes, der heute mit Sitzheizung, elektronischer Sitzverstellung,
mit Memoryfunktion usw. ausgestattet sein kann.
14
Vgl. Köhler-Frost, W.; a.a.O., S. 13f.
15
Vgl. Fink, D./ Köhler, T./ Scholtisseck, S.; a.a.O., S. 20 f.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
7
Ein spezialisierter Hersteller wird dem Design und der Weiterentwicklung eines
solchen Produktes viel eher gerecht als ein Automobilhersteller dessen Fokus auf
die Motorenentwicklung, das Karosseriedesign und die Vermarktung gerichtet
ist.
16
Die Erkenntnis, dass eine zu große Leistungstiefe Managementkapazitäten,
Know-how und Kapital bindet, so dass diese Ressourcen für die strategisch wich-
tigen Aufgaben des Unternehmens nicht mehr zur Verfügung stehen, war ein
Ausgangspunkt für eine Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen und somit für
Outsourcing-Überlegungen.
17
Neben den bisher genannten Begründungen für entsprechende Auslagerungsüber-
legungen bestimmter Aktivitäten können auch bestimmte, gegebene Rahmenbe-
dingungen innerhalb eines Unternehmens grundsätzlich gegen eine Eigenerstel-
lung bzw. Eigenleistung sprechen. So können sich beispielsweise die zur Durch-
führung einer Aktivität fehlenden Ressourcen in Form mangelnder Fachkräfte,
nicht vorhandener Infrastruktur und unzureichendem Know-how als Barriere für
eine Inhouse-Lösung erweisen. Eine solche Fehlallokation an Ressourcen kann
durch eine Fremdvergabe ausgeglichen und zudem in einigen Fällen zu einem
Aufbau des im Unternehmen vorhandenen Know-hows führen.
18
Gegen Ende der 80er Jahre drang der Begriff des Outsourcing dann in den Infor-
matik-Bereich. Zu dieser Zeit gewann die IT (Informations-Technologie) inner-
halb der Unternehmen zunehmend an Bedeutung und verzeichnete ein massives
Wachstum. Gleichzeitig wurde dieser Bereich aber auch immer komplexer und
aufwendiger. Es musste zunehmend neues Know-how aufgenommen und entwi-
ckelt werden, um IT effizient zur Verfügung stellen zu können. Für diese Zwecke
musste zusätzlich und abseits vom Kerngeschäft Kapital investiert werden, so
dass man nach und nach bestimmte IT-Aufgaben nach ,,außen" vergab.
16
Vgl. Fink, D./ Köhler, T./ Scholtisseck, S.; a.a.O., S. 34 f.
17
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; Die grenzenlose Unternehmung, 4. Auflage,
Wiesbaden 2001, S. 291.
18
Vgl. Picot, A.; Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, a.a.O., S. 347 f.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
8
Durch den steigenden Stellenwert der IT in den letzten beiden Jahrzehnten war
der Begriff des Outsourcing dann zeitweise für die Auslagerung eben derartiger
IT-Aufgaben belegt
19
, wie auch ein Lexikoneintrag aus einer Gablerauflage von
1993 zeigt: ,,...Outsourcing bezeichnet grundsätzlich die wirtschaftlich begründete
Auslagerung der computergestützten Informationsverarbeitung auf Fremdfir-
men..."
20
In den letzten Jahren ist der Begriff dann jedoch wieder allgemeiner gefasst wor-
den und so lautet die Definition in der aktuellen Auflage des Gabler Wirtschafts-
lexikons: ,,...Outsourcing stellt eine Verkürzung der Wertschöpfungskette bzw.
der Leistungstiefe des Unternehmens dar..."
21
Vielfach wird mit Outsourcing lediglich das Auslagern von Nicht-Kern-
Aktivitäten beschrieben. In neueren Untersuchungen beschäftigt man sich aller-
dings überdies mit der Fragestellung, ob nicht auch die Auslagerung von be-
stimmten zuvor als Kernaktivitäten bezeichneten Bereichen sinnvoll sein kann.
22
Auf Grund der unterschiedlichen Definitionsansätze, soll der Begriff des Outsour-
cing in der vorliegenden Arbeit vereinfacht in seiner ursprünglichen Zusammen-
setzung als ,,Outside Resource Using", also allgemein als das Nutzen unterneh-
mensfremder Ressourcen verstanden werden.
2.1.2 Wirtschaftstheoretische Sichtweise des Outsourcing
Betrachtet man das Outsourcing und somit die Entscheidung näher, ob eine Funk-
tion, Tätigkeit oder ein ganzer Unternehmensbereich an eine Fremdfirma überge-
ben werden soll, so beschäftigt man sich mit einer grundlegenden Fragestellung
der Institutionenökonomie, die weit älter ist als der Begriff des Outsourcing. Da-
bei geht es um die Analyse von Institutionen, wie Märkten, Unternehmen oder
Rechtssystemen, in deren Rahmen ökonomischer Austausch stattfindet. Es wird
versucht, Abhängigkeiten zwischen den Institutionen und menschlichem Verhal-
ten zu beschreiben und so die Existenz und den Wandel von Institutionen be-
schreiben, vergleichen und bewerten zu können.
19
Vgl. Ruoff, M.J.; a.a.O., S. 9 f.
20
Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 13. Auflage, Wiesbaden 1993.
21
Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Wiesbaden 2001.
22
Vgl. The Corporate Executive Board (Hrsg.); Decision drivers for Business Process Outsourcing,
White Paper, Oktober 2002, S. 1.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
9
Die Institutionenökonomie betrachtet Markt und Hierarchie (in der Theorie dem
Unternehmen entsprechend) als konkurrierende Koordinationsinstrumente.
Zwei der Theorien, die im Kern der Institutionenökonomie stehen, sind die Prin-
cipal-Agent-Theorie und die Transaktionskostentherie, welche insbesondere auf
die Arbeiten von Ronald H. Coase (1937) sowie Oliver Williamson (1975 und
1985) zurückgeht.
23
Dieser wirtschaftstheoretische Blickwinkel soll zur genaueren Erörterung der ur-
sprünglichen Beweggründe des Outsourcing beitragen.
2.1.2.1 Die Bedeutung der Transaktionskostentheorie für das Outsourcing
Zentraler Ausgangspunkt der Transaktionskostentheorie ist die Frage nach der
Ursache für die Existenz von Unternehmen.
In den 30er Jahren versuchte R.H. Coase zu begründen, warum in einer Markt-
wirtschaft nicht alle Transaktionen über Märkte zwischen Einzelakteuren abgewi-
ckelt werden, sondern stattdessen teilweise über die unternehmensinterne Koordi-
nationsform der Hierarchie.
Vereinfacht zusammengefasst, kam Coase zu der Ansicht, dass die Existenz von
Unternehmen im wesentlichen durch Transaktionskosten begründet werden kann,
da diese in festen Organisationsformen durch administrative Entscheidungen bei
bestimmten Transaktionen geringer sind als bei Vertragsabschlüssen über den
Markt.
24
Unter Transaktionskosten versteht man sämtliche Kosten der Information und
Kommunikation bei einer arbeitsteiligen Leistungserstellung.
Dazu gehören:
Anbahnungskosten (z.B. Recherche, Reisen, Beratung)
Vereinbarungskosten (z.B. Verhandlungskosten, Rechtsabteilung)
Abwicklungskosten (z.B. Prozesssteuerung, Managementkosten)
Kontrollkosten (z.B. Qualitäts- und Terminüberwachung) und
Anpassungskosten (z.B. Zusatzkosten für evtl. notwendige Nachbearbei-
tungen).
23
Vgl. Müller-Stewens, G./ Lechner, C.; Strategisches Management, Wie strategische Initiativen
zum Wandel führen, Stuttgart 2001, S. 106 f.
24
Vgl. Coase, R.H.; The nature of the firm, in: Economica, 17. Aufl., 1937, S. 388.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
10
Derartige, auch zusammengefasst als Koordinationskosten bezeichnete Kosten
entstehen sowohl bei unternehmensinternen Transaktionen, als auch bei Marktbe-
ziehungen.
25
Die Höhe der Transaktionskosten hängt im Wesentlichen von den Eigenschaften
der zu erbringenden Leistung sowie von der gewählten organisatorischen Abwick-
lungsform ab. Eine Transaktionskostenanalyse zielt demnach auf die Minimierung
der Transaktionskosten für eine vorgegebene Leistung mit gegebenen Eigenschaf-
ten durch die Wahl der richtigen Organisations- bzw. Abwicklungsform.
Transaktionskosten können somit als Effizienzmaßstab zur Beurteilung und Aus-
wahl unterschiedlicher institutioneller Koordinationsformen betrachtet werden.
Dies bedeutet nach Coase, dass Unternehmen nur dann eine Existenzberechtigung
haben, wenn sie in ihrem ,,Binnenbereich" die Mehrzahl der mit Leistungserbrin-
gung verknüpften Koordinations- und Motivationsprobleme (also Transaktions-
kosten) besser und günstiger lösen können, als bei einer Abwicklung mit externen
Partnern über den Markt.
26
Eine Unternehmung stellt somit eine Alternative zur Organisation bestimmter
Transaktionen über den Markt dar. Innerhalb eines Unternehmens sind einzelne
Geschäfte bzw. Vertragsabschlüsse zwischen den Vertragsparteien ausgeschaltet
und werden durch administrative, hierarchische Entscheidungen ersetzt. So stellt
beispielsweise ein Mitarbeiter seine Arbeitskraft, durch einen einmalig vereinbar-
ten Arbeitsvertrag, dem Unternehmen zur Verfügung anstatt für jede noch so ge-
ringe Leistungserbringung einen neuen Vertrag abschließen zu müssen. Der Mit-
arbeiter überträgt entsprechende Verfügungsrechte auf den Arbeitgeber und ist
somit in einem definierten Rahmen administrativen bzw. hierarchischen Entschei-
dungen untergeordnet.
27
Wie bereits erwähnt, spielen neben der Art der Abwicklung die Eigenschaften der
Leistungserbringung eine nicht unerhebliche Rolle. Je spezifischer und strategisch
bedeutungsvoller eine Leistung ist, umso höher sind in der Regel auch die damit
verbundenen Transaktionskosten.
25
Vgl. Picot, A.; Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, a.a.O., S. 344.
26
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 50 ff.
27
Vgl. Coase, R.H.; Das Problem der sozialen Kosten, in Assmann, H.D./ Kirchner, C./ Schanze,
E. (Hrsg.): Ökonomische Analyse des Rechts, Tübingen 1993, S. 148 ff.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
11
So besteht beispielsweise mit zunehmender Spezifität einer Leistung bei einer
Fremdvergabe die Gefahr, dass der Partner auf Grund von entstehenden Abhän-
gigkeiten strategisch handelt und nachträglich zukünftige, erforderliche Leistun-
gen verteuert oder die Kontrolle der Vertragsdurchführung sehr kostenaufwendig
ist (s. dazu auch den Principal-Agent-Ansatz in Kapitel
2.1.2.2
). Bei Leistungen
mit einem weniger ausgeprägten Spezifitätsgrad ist diese Gefahr geringer, da es
an alternativen Anbietern auf dem Markt nicht mangelt und das Risiko des oppor-
tunistischen Verhaltens eines Vertragspartners sowie die Kontrollkosten kleiner
sind.
28
Die durch ein opportunistisches Handeln des Vertragspartners entstehenden Kos-
ten werden als ,,ex-post"-Kosten bezeichnet. Sämtliche Kosten, die im Vorfeld
einer Vertragsschließung anfallen, um u.a. die verschiedenen späteren Eventuali-
täten im Rahmen der Vertragsdurchführung abzuwägen, werden als ,,ex-ante"-
Kosten tituliert. Es kann also passieren, dass Verträge, insbesondere wenn spezifi-
sche Transaktionen betroffen sind, auf Grund der hohen ,,ex-ante"-Kosten für das
Schätzen und vertraglich zu regelnde Eingrenzen der ,,ex-post"-Kosten gar nicht
erst zustande kommen.
29
Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Eigen-
schaften einer Leistung, am Beispiel der Spezifität und der voraussichtlichen Hö-
he der Transaktionskosten bei entsprechender Abwicklungsform. Dabei wird the-
oretisch angenommen, dass ab einem bestimmten Spezifitätsgrad eine Koordina-
tion über den Markt so gut wie ausgeschlossen wird.
28
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 50 ff.
29
Vgl. Williamson, O.E.; A Comparison of alternative approaches to economic organization, in:
Journal of institutional and theoretical economics (JITE), Vol. 146, 1990, S. 110f.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
12
Abbildung 1: Abhängigkeit der Transaktionskosten von der Eigenschaft Spezifität der
Leistung und der gewählten Koordinationsform (Quelle: Picot, A./ Reichenwald, R./ Wi-
gand, R.-T.; a.a.O., S. 55)
Die Grafik veranschaulicht auch, dass es nicht unbedingt immer nur die extremen,
bereist skizzierten Koordinationsformen Markt und Hierarchie geben muss, son-
dern, dass sich auch Zwischenlösungen, hier hybride Form genannt, in diese Ko-
ordinationsdarstellung integrieren lassen. Solche Hybride sind z.B. Unterneh-
menskooperationen, Joint Ventures oder Lizenzvergaben an Dritte.
30
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Unternehmen theoretisch für jede
zu erbringende Leistung evaluieren muss, ob die Durchführung intern günstiger
ist, als wenn man diese über den Markt bezieht. Jede Transaktion kann somit auf
zwei Arten institutionalisiert werden. Sie kann:
· intern produziert, bzw. geleistet (Hierarchielösung) oder
· extern gekauft werden (Marktlösung).
Outsourcing entspricht in diesem Fall dem wirtschaftstheoretischen Äquivalent
der Marktlösung.
31
Dieser Theorie zu Folge, ist das ausschlaggebende Argument
bei der Entscheidung zugunsten einer Marktlösung (Outsourcing) oder einer Hie-
rarchielösung (Leistung mit internen Ressourcen) die Höhe der gesamtheitlichen
Transaktionskosten.
32
30
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 53.
31
Vgl. Ruoff, M.J.; a.a.O., S. 94 f.
32
Vgl. Picot, A.; Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der Leistungstiefe, a.a.O., S. 344.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
13
Durch die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie hat
nun die Markttransparenz und auch der Automatisierungsgrad mancher Transakti-
onen zugenommen. Transaktionskosten können durch den Einsatz solcher Tech-
nologien erheblich beeinflusst werden, so dass marktliche Koordinationen anstelle
von hierarchischen Lösungen ökonomisch sinnvoll werden können.
Insbesondere durch Automatisierung und Standardisierung sorgt die IT dafür, dass
viele Aktivitäten und Prozesse unspezifischer werden. Die Informations- und
Kommunikationstechnologie hat somit zur Entwicklung und zum derzeitigen Stel-
lenwert des Outsourcing entscheidend beigetragen und öffnet den Weg zu flie-
ßenden Unternehmensgrenzen, virtuellen Organisationen und Unternehmensnetz-
werken.
33
2.1.2.2 Die Bedeutung des Principle-Agent-Ansatz für das Outsourcing
Im Rahmen der Institutionenökonomie versucht neben der Transaktionskosten-
theorie die Principle-Agent-Theorie die Entscheidungen in arbeitsteiligen Organi-
sationen und somit auch die Outsourcing-Entscheidung zu beschreiben. Sie geht
dabei nicht von der Fragestellung nach den Ursachen für das Entstehen einer Un-
ternehmung aus, sondern setzt bei der Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung
an. Diese Art von Beziehung besteht in der wirtschaftlichen Praxis zwischen den
unterschiedlichsten Interessengruppen, wie z.B. Kunde und Lieferant, Eigentümer
und Manager oder Unternehmen und Dienstleister. Die Principal-Agent-Theorie
dient einerseits zur Erklärung und andererseits auch zur Gestaltung von Auftrag-
geber-Auftragnehmer-Beziehungen.
In einer Principle-Agent-Beziehung beeinflussen zahlreiche Entscheidungen
nicht nur einen sondern beide Vertragspartner (oder mehrere bei n:1:n-
Beziehungen). Die Entscheidung des Auftragnehmers nimmt also mitunter Ein-
fluss auf das Nutzenniveau des Auftraggebers, welcher allerdings häufig nur un-
vollkommen über das Verhalten des Agenten informiert ist. Äquivalent zur Trans-
aktionskostentheorie beinhaltet also auch die Principal-Agent-Theorie den Aspekt
der asymmetrisch verteilten Informationen und somit die potentielle Gefahr des
opportunistischen Verhaltens eines Vertragspartners.
33
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 71 f . sowie S. 296.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
14
Da in der Regel der Agent einen Informationsvorteil gegenüber dem Principal
besitzt, beziehen sich die im Rahmen dieser Theorie anfallenden Kosten der Ar-
beitsteilung auf die Handlungen und Kontrolle des Agenten. Diese Kosten sind
das ausschlaggebende Kriterium für die Effizienz von Principal-Agent-
Beziehungen und so auch ein wesentliches Entscheidungs-Kriterium bei der Out-
sourcing-Fragestellung. Sie ähneln somit den zuvor behandelten Transaktionskos-
ten und lassen sich ebenfalls in verschiedene Komponenten unterscheiden:
Überwachungs- und Kontrollkosten durch den Principal;
Signalisierungs- und Garantiekosten durch den Agenten;
Kosten durch einen verbleibenden Wohlfahrtsverlust (Residualverlust).
Die ersten beiden Kostenarten entstehen durch Maßnahmen des Principals bzw.
Agenten, um die durch Informationsasymmetrie hervorgerufene Unsicherheit zu
reduzieren. Die Garantieleistung, welche ein Agent in der Rolle eines externen
Anbieters übernimmt, ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Outsourcing für den
Kunden stets auch eine gewisse Risikoabsicherung bedeutet. Im Falle einer
schlechten Leistungserbringung kann er im Garantiefall entsprechende Rechte
geltend machen, während er bei Eigenerbringung diese Kosten selber tragen muss.
Ein Residualverlust existiert immer dann, wenn eine Transaktion wegen der Un-
vollkommenheit des Informationsstandes gar nicht oder in einem weniger wohl-
fahrtssteigerndem Umfang als möglich zustande kommt.
Alle genannten Kostenarten stehen in einer engen Beziehung zueinander. So lässt
sich beispielsweise ein in Kauf zu nehmender Residualverlust durch verstärkte
Kontrollaufwendungen einschränken, während diese durch entsprechend abgesi-
cherte Garantieleistungen des Agenten reduziert werden können. Wie schon in der
Transaktionskostentheorie ist letztendlich für die Abwicklung von Leistungsbe-
ziehungen das institutionelle Arrangement zu wählen, das die gesamtheitlichen
Principal-Agent-Kosten minimiert. Bei einer Outsourcing-Entscheidung stehen
immer die Principal-Agent-Kosten zwischen Unternehmen und Dienstleister den
innerhalb des Unternehmens existenten Principal-Agent-Kosten gegenüber.
Die genannten Kosten derartiger Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen hän-
gen im Wesentlichen von dem Ausmaß der Informationsasymmetrie zwischen den
Vertragspartnern ab.
Theoretische Grundlagen des Outsourcing
15
Hinsichtlich dieser Ursachen können drei Informationsproblemtypen klassifiziert
werden:
Hidden characteristics,
Hidden action,
Hidden intention.
Die Hidden characteristics beziehen sich auf Informationskosten vor einem
Vertragsabschluß, die dadurch entstehen können, dass der Principal die Eigen-
schaften und angebotenen Leistungen des Agenten nicht kennt. Sie können so-
wohl bei interner Leistungerstellung, z.B. durch eine erforderliche Einstellung
eines neuen Mitarbeiters, entstehen, als auch bei externer Leistungserstellung
durch Unwissenheit über die Fähigkeiten des externen Leistungsanbieters.
Das Problem der Hidden action tritt dagegen erst nach Vertragsabschluß, d.h.
nach erfolgter Agentenauswahl auf und beschreibt die Kosten, die durch Unwis-
senheit des Principal über die Handlungsausführung des Agenten entstehen.
Die dritte Klassifikation der Informationsasymmetrie, das Problem der Hidden
intention, bezieht sich auf die Kosten durch eine mögliche Ausnutzung des Prin-
cipals durch den Agenten bei spezifischer Leistungserbringung, welche zu Ab-
hängigkeiten führen kann.
34
Die genannte Problematik der Principal-Agent-Theorie wird in der folgenden Gra-
fik noch einmal im Überblick dargestellt.
Abbildung 2: Principal-Agent-Theorie im Überblick (Quelle: Eigene Darstellung in An-
lehnung an: Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 60)
34
Vgl. Picot, A./ Reichenwald, R./ Wigand, R.-T.; a.a.O., S. 56 ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832485757
- ISBN (Paperback)
- 9783838685755
- DOI
- 10.3239/9783832485757
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Bochum – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- handel transaktionskosten it-bereich
- Produktsicherheit
- Diplom.de