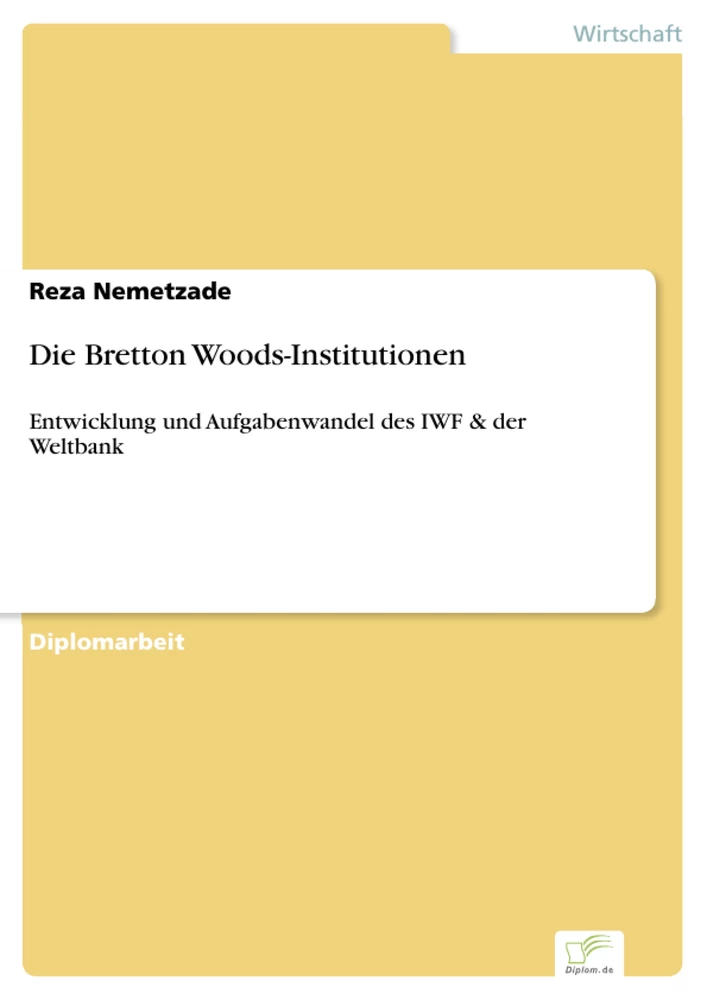Die Bretton Woods-Institutionen
Entwicklung und Aufgabenwandel des IWF & der Weltbank
Zusammenfassung
Das Thema dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung und der Aufgabenwandel der Bretton-Woods-Institutionen. Untersucht wird im Rahmen dieses Titels der Anpassungsprozess des Internationalen Währungsfonds und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vor dem Hintergrund einer dynamischen, sich global orientierenden Wirtschaft.
Die Gründung sah IWF und Weltbank als Instrumente zur Lösung von akuten Währungs- und Wirtschaftsproblemen der Nachkriegszeit. Dementsprechend beeinflussten sie die weltwirtschaftliche Entwicklung ab 1945 durch die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Nutzung und Entwicklung von Ressourcen der Mitgliedsländer und die Bewältigung von Zahlungsbilanzproblemen.
Außerdem rückten mit Etablierung der beiden Organisationen beratende Tätigkeiten neben finanziellen Aktivitäten in den Mittelpunkt der Aktivitäten, wobei sich Regierungen zunehmend auf obligatorische Beratungshilfe angewiesen sahen, um an finanziellen Programmen teilnehmen zu können. Der IWF als eine primär monetäre Institution hat die währungspolitische Zusammenarbeit und die Zahlungsbilanzproblematik zur Aufgabe, während die Weltbank von jeher entwicklungspolitisch ausgerichtet ist.
Das heißt, dass sie im Gegensatz zum Internationalen Währungsfonds langfristige Strategien für strukturell schwache Staaten entwickelt und konkret ausgedrückt Investitionen für produktive Zwecke finanziert. Wechselnden Bedingungen und Erfordernissen sind die beiden multilateralen Organisationen mit flexibler Politik und entsprechenden Mitteln begegnet. Mit dieser Abfassung ist die Fragestellung zu erörtern, inwiefern die Bretton-Woods-Institutionen seit ihrem Entstehen auf eine sich beschleunigt ändernde Wirtschaft und ihre Krisen, insbesondere in der Dritten Welt, einwirken konnten.
Bezüglich der Literaturlage ist anzumerken, dass eine Fülle von Publikationen über die Thematik der Bretton-Woods-Institutionen existiert, nicht zuletzt wegen der Bedeutung von IWF und Weltbank für die globale Wirtschaft, wie die folgenden Kapitel zeigen werden. Sehr positiv aufzunehmen ist die Tatsache, dass beide Organisationen einerseits neben den jährlichen Berichten weitere Dokumente regelmäßig publizieren, darunter das World Economic Outlook des IWF und die Global Economic Prospects and the Developing Countries der Weltbank, die als seriöse Quellen einzustufen sind.
Andererseits veröffentlichen hohe Angestellte der Institutionen des öfteren Aufsätze oder […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Verzeichnis der Tabellen
Verzeichnis der Abbildungen
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Konferenz von Bretton Woods
3. Die Grundsätze und Aufgaben der Organisationen
3.1. Der IWF
3.2. Die Weltbank
4. Anfängliche Entwicklung der Organisationen – Wachsende Bedeutung und Ausweitung
4.1. Der IWF bis zum Niedergang von Bretton Woods
4.1.1. Die Gründerjahre
4.1.2. Der IWF in den sechziger Jahren
4.1.3. Die siebziger Jahre bis zur Konferenz von Jamaika
4.2. Die ersten Dekaden der Weltbank
4.2.1. Die Aufnahme der Weltbankaktivitäten
4.2.2. Die IFC-Gründung
4.2.3. Die IDA-Gründung
4.2.4. Technische Probleme der Weltbank
4.2.5. Weltbankexpansion und Eindämmungspolitik
4.3. IWF und Weltbank als Richtungsweiser
5. Der Paradigmenwechsel der Weltbank
5.1. Theoretischer Hintergrund
5.2. Die Präsidentschaft McNamaras
5.2.1. Die Kapitalmärkte als Finanzierungsquelle
5.2.2. Beschaffungswirtschaftliche Aspekte
5.2.3. Entwicklungsruinen, Machtabfluss und die Lokomotiventheorie
6. Die Schuldenkrise der achtziger Jahre
Exkurs: IWF-Aufgaben im historischen Kontext
6.1. Die Rolle des IWF in der Schuldenkrise
6.1.1. Der Wandel der Fazilitäten
6.1.2. Der IWF als Katalysator
6.1.3. Konditionalität der Kreditvergabe
6.1.4. Kritik an der Konditionalität
6.2. Kooperation des IWF mit der Weltbank
6.2.1. Sektor- und Strukturanpassungsprogramme
6.2.2. Die Pläne von Baker und Brady
6.3. Kritik an der Bewältigung der Schuldenkrise
7. Die Entwicklungssituation zu Beginn der neunziger Jahre
7.1. Eine Bestandsaufnahme der Dritten Welt
7.2. Neue Aufgaben für den IWF
7.3. Die Neuorientierung der Weltbank
8. Der IWF vor der Schwelle zum neuen Jahrtausend
8.1. Die Asienkrise
8.1.1. Probleme der IWF-Stabilisierungsprogramme
8.1.2. Weltwirtschaftliche Folgen der Asienkrise
8.1.3. Kritik am IWF
8.2. Bail-Out, Frühwarnsysteme, Bankenaufsicht und Prävention
8.3. Interessenkonflikte der Nationen
9. Der Jahrtausendwechsel und ein Ausblick
9.1. Grundsatzdiskussionen
9.1.1. Weltbank ohne Existenzberechtigung?
9.1.2. Der IWF im Wandel?
9.2. Aussichten und wichtige Aufgabenbereiche
9.2.1. Reformen im öffentlichen Sektor
9.2.2. Technische Unterstützung und Training des IWF
9.2.3. Globalisierung und Umwelt
10. Schlussbemerkungen
Anhang
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1: Anteile ausgewählter Länder und Ländergruppen an Weltexporten und internationalen Reserven
Tabelle 2: Gesamte IBRD-Kredite bis zum 31.12.1961 - nach Regionen und Sektoren gegliedert
Tabelle 3: Die Größe der Weltbank/ IDA anhand Angestelltenzahl, Verwaltungsausgaben, Quantität und Summen der Kredite, von 1951-1971
Tabelle 4: Weltbankkreditvergabe von 1969-1980 - nach Armutsorientierung gegliedert
Tabelle 5: Schuldenkrise: Auslandsschulden der Entwicklungsländer 1982-1990
Tabelle 6: Inanspruchnahme der IWF-Kredite in den Jahren 1947-1985 in Mio. Sonderziehungsrechten (SZR)
Tabelle 7: Anteile der einzelnen Kreditkategorien an der gesamten Weltbankkreditvergabe von 1981-1986
Tabelle 8: Die finanziellen Engagements der internationalen Staatengemeinschaft und IWF-Kredite als Reaktion auf die Asienkrise
Tabelle 9: Wachstumsprognosen für Südostasien 1997-1998
Tabelle 10: Armutsindikatoren und Wirtschaftswachstum
Tabelle 11: Die Wirtschaftslage der 17 hochverschuldeten Entwicklungsländer 1985
Tabelle 12: Schuldenkrise: Kennziffern zur Schuldenbelastung einzelner Länder, Ländergruppen und Regionen
Tabelle 13: Die bisher größten Kredite des IWF
Tabelle 14: Quoten und Stimmrechtsanteile im IWF 2002
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Einordnung umfassender Reformvorschläge in das Konzept der „Impossible Trinity“
Abbildung 2: Technische Unterstützung des IWF im Jahr 2001 nach Regionen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Das Thema dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung und der Aufgabenwandel der Bretton-Woods-Institutionen. Untersucht wird im Rahmen dieses Titels der Anpassungsprozess des Internationalen Währungsfonds und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vor dem Hintergrund einer dynamischen, sich global orientierenden Wirtschaft.
Die Gründung sah IWF und Weltbank als Instrumente zur Lösung von akuten Währungs- und Wirtschaftsproblemen der Nachkriegszeit. Dementsprechend beeinflussten sie die weltwirtschaftliche Entwicklung ab 1945 durch die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Nutzung und Entwicklung von Ressourcen der Mitgliedsländer und die Bewältigung von Zahlungsbilanzproblemen. Außerdem rückten mit Etablierung der beiden Organisationen beratende Tätigkeiten neben finanziellen Aktivitäten in den Mittelpunkt der Aktivitäten, wobei sich Regierungen zunehmend auf obligatorische Beratungshilfe angewiesen sahen, um an finanziellen Programmen teilnehmen zu können. Der IWF als eine primär monetäre Institution hat die währungspolitische Zusammenarbeit und die Zahlungsbilanzproblematik zur Aufgabe, während die Weltbank von jeher entwicklungspolitisch ausgerichtet ist. Das heißt, dass sie im Gegensatz zum Internationalen Währungsfonds langfristige Strategien für strukturell schwache Staaten entwickelt und konkret ausgedrückt Investitionen für produktive Zwecke finanziert. Wechselnden Bedingungen und Erfordernissen sind die beiden multilateralen Organisationen[1] mit flexibler Politik und entsprechenden Mitteln begegnet. Mit dieser Abfassung ist die Fragestellung zu erörtern, inwiefern die Bretton-Woods-Institutionen seit ihrem Entstehen auf eine sich beschleunigt ändernde Wirtschaft und ihre Krisen, insbesondere in der Dritten Welt, einwirken konnten.[2]
Bezüglich der Literaturlage ist anzumerken, dass eine Fülle von Publikationen über die Thematik der Bretton-Woods-Institutionen existiert, nicht zuletzt wegen der Bedeutung von IWF und Weltbank für die globale Wirtschaft, wie die folgenden Kapitel zeigen werden. Sehr positiv aufzunehmen ist die Tatsache, dass beide Organisationen einerseits neben den jährlichen Berichten weitere Dokumente regelmäßig publizieren, darunter das „World Economic Outlook“ des IWF und die „Global Economic Prospects and the Developing Countries“ der Weltbank, die als seriöse Quellen einzustufen sind. Andererseits veröffentlichen hohe Angestellte der Institutionen des öfteren Aufsätze oder gar Monographien bezüglich der Multilateralen, was durch seinen Insider-Charakter einen bedeutenden Stellenwert hat. Beispiele dafür sind Dokumente von Jacques Polak, Fred Bergsten, Robert McNamara oder Joseph Stiglitz, auf die im Rahmen dieser Diplomarbeit unter anderem Bezug genommen wird.
Ferner ist es interessant, dass von allen Autoren, die sich mit der Thematik der Bretton-Woods-Institutionen beschäftigen, zwar oft Kritik geübt wird, jedoch selten ihre Existenz völlig in Frage gestellt wird. Das zeigt, dass trotz der gemachten und weiterhin bestehenden Fehler ein stiller Konsens über die Notwendigkeit des IWF und der Weltbank besteht, möge es auch nur für ein Minimum an Nord-Süd-Beziehungen[3] sein.
Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Entwicklung des IWF und der Weltbank seit ihrem Bestehen vor dem Hintergrund einer dynamischen Weltwirtschaft. Es stellen sich vor allem die Fragen, wie die Bretton-Woods-Institutionen mit sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umgegangen sind und inwiefern sie Lösungskonzepte für neue Probleme fanden. Kann man von einem Aufgabenwandel des IWF und der Weltbank sprechen?
Der folgende Abschnitt zeigt einen Überblick über die weiteren Kapitel der Abfassung.
Kapitel 2 schildert die Begebenheiten, die zur Gründung von IWF und Weltbank geführt haben. Insbesondere wird dabei auf die Notwendigkeit eines institutionellen Rahmens für einen expandierenden Welthandel hingewiesen.
Kapitel 3 erläutert die Aufgaben und Ziele der Institutionen, wobei der Schwerpunkt auf die konstitutionellen Voraussetzungen gesetzt wird. Der entsprechende Abschnitt geht also auf die Articles of Agreement, die Gründungsstatute der Organisationen, ein.
Das vierte Kapitel handelt von der anfänglichen Entwicklung, die zur Etablierung der Organisationen führte. Dabei sind die wirtschaftsgeschichtlichen Geschehnisse vom Kriegsende bis in die siebziger Jahre von Relevanz. Ferner sind die Verschiebungen der wirtschaftlichen Machtverhältnisse zwischen den Industrieländern, aber auch zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ein Thema.
Kapitel 5 konzentriert sich auf die Aktivitäten der Weltbank in den siebziger Jahren, in denen unter Weltbankpräsident McNamara ein bedeutender Richtungswechsel von der Infrastrukturorientierung hin zur Armutsorientierung vollzogen wurde. Kritisch betrachtet werden dabei das Ausmaß dieser Veränderung, jedoch auch die generelle Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten, die Beschaffungswirtschaft und das politische Durchsetzungsvermögen.
Die Schuldenkrise der achtziger Jahre ist das Thema des sechsten Kapitels, wobei der IWF mit seinen Aktivitäten im Vordergrund steht. Problematisch war die Entwicklung durch einen dramatischen Schuldenanstieg der Dritten Welt, was letztlich auch zu verstärkter Kritik an den Bretton-Woods-Institutionen führte.
Kapitel 7 erörtert die Probleme und sich wandelnden Aufgabenbereiche der Multilateralen in den neunziger Jahren, vor allem als Folge der entwicklungspolitischen Rückschritte der vorherigen Dekade.
Im achten Kapitel geht es um die zweite Hälfte der neunziger Jahre, wobei der Schwerpunkt auf die Krise in den Schwellenländern Südostasiens ab 1997 und den damit zusammenhängenden IWF-Strategien gesetzt wird.
Kapitel 9 behandelt die Lage der Bretton-Woods-Institutionen zu Beginn des neuen Jahrtausends. Von Relevanz sind in diesem Zusammenhang Diskussionen um die Aufgabenverteilung von IWF und Weltbank in der zukünftigen Weltwirtschaft.
Das Ende der Abfassung bildet Kapitel 10 mit einer kritischen Schlussbetrachtung, die in Ansätzen auch über das Thema hinausgeht. Die Glaubwürdigkeit der Bretton-Woods-Institutionen, die Integration der armen Länder in den Welthandel, die Gerechtigkeit innerhalb der Institutionen und die Beiträge reicher Volkswirtschaften zur offiziellen Entwicklungshilfe spielen dabei eine Rolle.
2. Die Konferenz von Bretton Woods
Gegen Ende des zweiten Weltkriegs plante die internationale Staatengemeinschaft unter Leitung der alliierten Westmächte bereits Nachkriegsszenarien. Besonders wirtschaftliche Fragestellungen bezüglich des zukünftigen Welthandels standen bei jenen Überlegungen im Vordergrund. Die Planungen gipfelten in einer Konferenz in Bretton Woods im amerikanischen New Hampshire, an der 45 Nationen teilnahmen, um den institutionellen Rahmen für das wirtschaftliche Geschehen ab 1944 festzulegen.
Es kristallisierte sich weit vor Kriegsende heraus, dass Europa als Hauptkriegsschauplatz besonderer Wiederaufbauanstrengungen bedurfte. Allein um die Versorgung der Volkswirtschaften mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen zu gewährleisten, war Hilfe von außen nötig. Gerade dazu musste die Staatengemeinschaft Regeln für den Außenhandel und internationale Kapitalbewegungen konstituieren. Insbesondere den USA als prädestiniertem Nachkriegsinvestor lag immenses Interesse an einem geregelten Wirtschaftssystem, in dem sie die einflussreichste, dominierende Rolle einnehmen würden. Im Gegensatz zur Situation der großen europäischen Volkswirtschaften stärkte der Krieg die heimischen Wirtschaftskapazitäten und verschonte das Territorium der Vereinigten Staaten fast ausnahmslos von Militärschlägen. So würden die USA in geplanten multilateralen Wirtschaftsorganisationen aufgrund ihrer Wirtschaftskraft eine dementsprechend entscheidende Rolle einnehmen.[4]
Ferner lag die Einflussnahme beim Wiederaufbau im strategischen Interesse der amerikanischen Regierung. Mit Wirtschaftshilfe und Verflechtung der europäischen Volkswirtschaften mit der eigenen würden sie den alten Kontinent auf lange Zeit an sich binden. Es handelte sich neben wirtschaftlicher Integration also auch um den Einfluss der Ideologie im Wettstreit mit der Sowjetunion.
Mit der UN-Konferenz von Bretton Woods 1944 unterzeichneten 44 Länder ein Abkommen zur Regelung von Währungs- und Kapitalfragen und insbesondere zur Gründung des Internationalen Währungsfonds, IWF, und der Internationalen Bank für Rekonstruktion und Entwicklung, kurz Weltbank. Die Sowjetunion nahm an den Verhandlungen ebenfalls teil, unterzeichnete das Abkommen jedoch nicht. Auf die Verhandlungen folgen sollten die Gründung der Welthandelsorganisation als auch die Aufnahme der General Agreements on Trades and Tarifs, GATT. Die Notwendigkeit des IWF sah man zur Zeit der Bretton Woods Konferenz darin, durch einen Stabilisierungsfonds etwaige Währungskrisen einzelner Mitgliedsstaaten kurzfristig auszugleichen, sofern sie nicht durch übermäßige Kapitalabflüsse oder mangelnde Kapitalverkehrskontrollen herbeigeführt würden. Die Weltbank würde mit der Aufgabe der Absicherung internationaler Kapitalbewegungen komplementär fungieren. Dabei setzte die Mitgliedschaft in der Weltbank eine Mitgliedschaft im IWF voraus.[5]
3. Die Grundsätze und Aufgaben der Organisationen
Die Entstehung der neuen Organisationen IWF und Weltbank bot der Mitgliedsgemeinschaft ein Szenario, das sich folgendermaßen darstellen lässt. Würde die Kooperation nur schleppend vorankommen und sich die Erfolge nur marginal einstellen, könnte man vom erreichten Minimalziel[6] sprechen. Dadurch könnten zumindest nationale Aktionen vermieden werden, die der Gemeinschaft schaden. Bei erfolgreicher Zusammenarbeit könnten die Mitgliedsstaaten das Maximalziel erreichen, das sich durch aktive Förderung des Allgemeinwohls durch alle Nationen auszeichnet. Praktisch würde diese beispielsweise den Abbau von Handelsschranken bedeuten. In diesem Zusammenhang ist die gemeinsame Förderung des Allgemeinwohls ein Idealfall, der utopisch erscheint. Denn dies setzt immer währende pareto-effiziente Situationen oder den steten Verzicht auf eigene Besserstellung zum Nachteil anderer voraus.[7]
3.1. Der IWF
In den 1945 festgelegten Articles of Agreement erklärt Artikel 1 die Grundsätze der Institution, die der Währungsfonds im Gegensatz zu anderen Artikeln bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht antasten sollte. Es ist in diesem Artikel beschrieben, dass der Internationale Währungsfonds zuständig ist für die Erweiterung internationaler Währungskooperation, Welthandelserweiterung, Währungsstabilität, Beseitigung von Handelshemmnissen, Bereitstellung von kurzfristigem Kapital als auch der Reduzierung von Ungleichgewichten bezüglich Zahlungsbilanzen der Mitglieder.[8]
Eine umfassende Unterscheidung der IWF-Funktion lässt sich anhand dreier Kriterien festsetzen. Die regulierende Funktion, die finanzielle Funktion und zuletzt die Funktion des technischen Unterstützers kennzeichnen IWF-Aktivitäten. Die regulierenden Aufgaben erfüllt der Internationale Währungsfonds, indem er die nationale Wirtschaftspolitik der Mitglieder direkt beeinflusst und kontrolliert. Explizit bewirkt der IWF Währungsstabilität und die Verhinderung einer Unterbewertung aus Exportgründen. Daneben regelte der Währungsfonds gerade zu Beginn der Bretton Woods Ära die Bedingungen der Konvertibilität bei fixen Wechselkursen.[9] Die finanzielle Funktion beruht auf der Annahme, dass ein gesundes Welthandelswachstum am besten zu realisieren ist, wenn die Zahlungsbilanzen der Länder untereinander möglichst ausgeglichen sind. Folglich soll ein vom IWF verwalteter Fonds den Mitgliedsländern kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten über Ziehungen aus dem Fonds bieten, um dem übergeordneten Ziel beizuwirken. Mit der technischen Funktion lassen sich Training und technische Unterstützung der Mitgliedsländer beschreiben.[10] Der IWF schult Angestellte der jeweiligen Regierungen auf verbesserte makroökonomische Fähigkeiten, speziell in Bezug auf die internationale Wirtschaft und Zahlungsbilanzprobleme.[11]
3.2. Die Weltbank
Die Gründungsstatute der Weltbank beinhalten ebenfalls grundlegende Funktionen, die die Institution mit Amtsaufnahme zu erfüllen hat. Artikel 1 der Articles of Agreement definiert, dass die Internationale Bank für Rekonstruktion und Entwicklung folgenden Grundsätzen Folge zu leisten hat. Sie soll Mitgliedsstaaten beim Aufbau kriegsgeschädigter Volkswirtschaften durch Bereitstellung von Investitionskapital assistieren, ausländisches Privatkapital mittels Investitionsgarantien fördern, den langfristigen Welthandelsausgleich unterstützen, Kredite für Projekte mit hoher Dringlichkeit an Mitgliedsstaaten gewähren und zuletzt alle Aktivitäten unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die nationalen Wirtschaften durchführen.[12]
Die Tatsache, dass der erste Aspekt der Articles of Agreement die Kriegswirtschaften betrifft und die erste Dekade der Weltbankarbeit hauptsächlich Europa galt, zeigt den historischen Grund zur Schaffung einer derartigen Institution bei der Konferenz von Bretton Woods. Das spätere Abwenden von den Industrienationen und der Wandel zur Entwicklungsorganisation für strukturell schwache Länder planten die Gründungsväter in den 1940er Jahren nicht.
Zu den Erschaffensgründen der Weltbank äußert sich Rainer Tetzlaff relativ kritisch, besonders die Rolle der USA betreffend. Er sieht die Motivation der wirtschaftlich dominierenden Nation darin, dass die US-Regierung die erhebliche, zukünftige Quantität des internationalen Leihkapitals bereits vor Kriegsende prognostiziert hat und sich dies zunutze machen wollte. Es ging hauptsächlich darum, wie auch in den Articles of Agreement bei Gründung verankert, Sicherheiten für die Kapitalinvestitionen in Form von Staatsgarantien zu schaffen. Gerade ausländische Regierungen eigneten sich dafür am besten, da sie im Vergleich zu Privaten die höchste Sicherheit repräsentierten.[13]
4. Anfängliche Entwicklung der Organisationen – Wachsende Bedeutung und Ausweitung
Sowohl der IWF als auch die Weltbank sind als multilaterale Organisationen einzuordnen. Eine genauere Betrachtung lässt den Schluss zu, dass beide seit Bestehen durch unterschiedlich starke nationale Einflüsse geprägt sind. Das bedeutet, dass Mitgliedschaften zwar durch alle Nationen möglich sind, die Entscheidungsmacht jedoch bei großen Volkswirtschaften liegt. Internationale Organisationen können dabei oft nicht am Herrschaftsgefälle vorbei operieren. Dementsprechend handelt es sich bei den Bretton Woods Institutionen um Organisationen asymmetrischen Typs. Im Gegensatz zur United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, oder der Food and Agricultural Organisation, FAO, die nach dem Mehrheitsprinzip agieren, tragen wirtschaftlich starke Nationen bei asymmetrischen Organisationen eine höhere Stimmgewichtung bei Organisationsentscheidungen.[14]
4.1. Der IWF bis zum Niedergang von Bretton Woods
4.1.1. Die Gründerjahre
Mit Errichtung der Bretton-Woods-Institutionen konzentrierte sich der IWF im System fixer Wechselkurse, das sich nach dem US-$ richtete, auf wirtschaftspolitische Instrumente, die Handels- und Devisenrestriktionen betreffend. Hauptsächlich wollte der IWF konkurrierende Währungsabwertungen verhindern, von denen er glaubte, dass sie ein Kernthema internationaler Wirtschaft seien. Den größten stimmrechtlichen Einfluss verzeichneten die USA von Beginn an mit über 30% und konnten bei wichtigen Entscheidungen dementsprechend einlenken. Die Vereinigten Staaten selbst vertraten eine harte Linie, die sie innerhalb des IWF durchsetzten. Charakteristisch dafür war ein zögerliches Einsetzen der Fondsmittel mit der Begründung, dass Reserven für Notfälle zu bilden seien. Folglich warf man dem Währungsfonds eine geringe Wirksamkeit vor, so dass seine Existenz letztendlich in Frage gestellt wurde. Margaret de Vries und Robert Triffin äußerten sogar unabhängig voneinander Erwägungen über die Übernahme der IWF-Funktionen durch die Weltbank. Für die genannten Autoren hatte der IWF seine Daseinsberechtigung verloren.[15]
In den Gründerjahren erfuhr der IWF eine wachsende Spezialisierung, so dass eine regionale Verteilung der Aufgabenbereiche unablässig erschien. 1953 beschloss das Management entsprechende Maßnahmen, um den veränderten Begebenheiten gerecht zu werden. Vier Regionalabteilungen befassten sich von dem Zeitpunkt an mit den Belangen der Mitglieder. Der Internationale Währungsfonds gründete eine asiatische Abteilung für Fernost und Südostasien, eine europäische Abteilung, eine Nahostabteilung und eine Abteilung für den amerikanischen Kontinent. Afrika spielte zu der Zeit keine bedeutende Rolle im IWF. Bezüglich der Liaison zu seiner institutionellen Schwester, der Weltbank, lässt sich festhalten, dass Anfang der 1950er Jahre ein zunehmendes Interesse an dem Ausbau wirtschaftlich effizienter Strukturen beiderseits zu beobachten war. Man erhoffte sich durch bessere Kooperation der beiden Organisationen vor allem Kosteneinsparungen in den Bereichen Statistik, Personal und allgemeiner Verwaltung. Unter Statistik versteht man in diesem Zusammenhang das Sammeln und Auswerten von allgemeinen Wirtschaftsdaten, unter Personal die Nutzung überschüssiger Kapazitäten.[16]
4.1.2. Der IWF in den sechziger Jahren
Die Entwicklung in den sechziger Jahren ist durch veränderte globale Rahmenbedingungen gekennzeichnet. Es herrschten fortan neue weltwirtschaftliche Machtverhältnisse, die durch das wieder erstarkte Europa einerseits und die Entkolonialisierung andererseits gekennzeichnet waren. Der Marshall-Plan[17] hatte zur Folge, dass die europäischen Nationen an Einfluss gewannen und die historischen Stimmrechtsverhältnisse den neuen Begebenheiten nicht mehr gerecht wurden. Bezüglich der Entwicklungsländer und speziell der Nord-Süd-Beziehungen bildete sich eine verstärkte politische Unabhängigkeit. Die neu gebildeten Institutionen UNCTAD und G-77 stellten den Ausdruck dieser Tendenz dar. Die Entwicklungsländer ersuchten ihre Interessen gegenüber den Industrieländern durch ihre eigene Organisation, G-77, aber auch durch die UNCTAD, die innerhalb der Vereinten Nationen fungiert, durchzusetzen. Die UNCTAD machte dabei den fairen Welthandel zu ihrer Hauptaufgabe.[18]
Tabelle 1: Anteile ausgewählter Länder und Ländergruppen an Weltexporten und internationalen Reserven
(Prozentuale Angaben)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Ferguson, Tyrone, [World, 1988], The Third World and decision making in the International Monetary Fund, Genf 1988, S. 31.
Die Statistik aus Tab. 1 zeigt, dass die Länder der europäischen Wirtschaftsunion zwischen 1953 und 1960 ihren Anteil am Welthandelsvolumen, gemessen an den Exporten, von 14% auf 25% steigerten. Dies ist insofern von Bedeutung, als diese Tatsache nicht nur den Aufbau Europas widerspiegelt, sondern auch die neue Stimmgewichtung im IWF. Denn diese basiert für jedes Land auf seinem Anteil am Welthandelsvolumen.
Die zweite Hälfte der sechziger Jahre kennzeichneten folgende Entwicklungen des Währungsfonds. Die Bretton-Woods-Institutionen einigten sich auf eine klarere Aufgabenteilung und Kooperation. Außerdem deuteten sich zum ersten Mal Reformen unter Einbezug der Sonderziehungsrechte an und der IWF macht Rohstoffmärkte zu einem neuen Aufgabenfeld.
Eine Vereinbarung zwischen IWF und Weltbank 1966 klärte die primären Verantwortlichkeitsbereiche der jeweiligen Institutionen. Verstärkt verdeutlichte sie, dass der IWF für Wechselkurse, währungspolitische Fragen, Zahlungsbilanzfragen und Stabilisierungsprogramme für Mitgliedsstaaten zuständig sei. Im Gegenzug sei die Weltbank im Metier der langfristigen Entwicklungsplanung und im Projektmanagement verantwortlich. Der Kernaspekt des Abkommens war jedoch die Rolle des gegenseitigen Kompetenzrespekts. Es sollte sichergestellt werden, dass die Organisationen sich bei ihren Aktivitäten auf die Expertisen der Schwesterorganisation stützen können, falls Expertisen erforderlich seien. Insofern war von Rationalisierungspotential auszugehen, da die gemeinsame Nutzung von Länderstudien und Wirtschaftsberichten unnötige Arbeit vermeiden hilf.[19]
1969 erwog der IWF die Einführung einer Fazilität, die auf Sonderziehungsrechten basiert. Jede Nation darf demnach entsprechend seiner eingezahlten IWF-Quote Ziehungen tätigen, wobei die Zahlungen jährlich erfolgen und die Quotenfestlegungen im Fünfjahresintervall. Weiterhin soll die Fazilität den Mitgliedsländern bedingungslos gewährt werden. Es gehen damit keine wirtschaftspolitischen Auflagen einher, da es sich um die grundlegende Fazilität handelt.[20]
Die Dollarschwemme[21] an den Finanzmärkten Ende der 1960er und die zunehmenden Währungskrisen zeigten die Reformbedürftigkeit des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse und der Gold-Dollar-Parität. Denn reale Wechselkursänderungen ignorierte der Währungsfonds zu lange. Erst spät nahm er Anpassungen vor. Es sollten ab diesem Zeitpunkt auch noch einige Jahre vergehen, bis der IWF sich vom Leitwährungssystem offiziell trennte. Bezüglich der Rohstoffmärkte deutete sich an, dass der IWF eine Möglichkeit suchte, stabilisierend auf diese einzuwirken. 1966 beschloss der Währungsfonds die Möglichkeit der kompensierenden Finanzierung von Exporterlösschwankungen. Inhaltlich handelte es sich bei dem neuen Instrument um ein neues Aufgabengebiet des IWF, da er von da an zusätzlich die Folgen von Preisschwankungen auf Rohstoffmärkten auszugleichen hatte. Von makroökonomischer Bedeutung ist dies für Länder, deren Wirtschaft und insbesondere ihre Deviseneinnahmen stark auf dem Export von Rohstoffen beruhen.[22]
Als Initiator der zweiten Rohstoffregelung trat Frankreich gemeinsam mit einer Reihe damalig französischer Kolonien in Afrika auf. Es ist ersichtlich, dass diese Länder in den 1960er Jahre eine hohe Importabhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen aufwiesen. Insbesondere wären die finanziellen Folgelasten bei Preissteigerungen von sensiblen Einfuhrgütern wie fossiler Brennstoffe für wirtschaftlich schwache afrikanische Länder verheerend. Dies sollte sich im Verlauf der Geschichte zeigen, unter anderem ausgelöst durch die Ölkrisen der 1970er Jahre. Die Entscheidung zur Errichtung einer speziellen Fazilität für Rohstoffausgleichslager, die Buffer Stock Facility, war 1969 demnach durchaus wegweisend.[23]
4.1.3. Die siebziger Jahre bis zur Konferenz von Jamaika
Im Folgenden sind die Zusammenhänge, die das System fester Wechselkurse zum Scheitern brachten und die Machtverteilung innerhalb des IWF während der 1970er von bedeutender Relevanz.
Als die USA 1971 nach einer Verkündung Präsident Nixons einen wirtschaftspolitischen Richtungswechsel durch das Aufheben der Gold-Dollar-Parität einleiteten, gerieten die übrigen IWF-Mitglieder, deren Quantität nach zahlreichen Beitritten beträchtlich war, unter Druck. Die Lex Americana[24] bedeutete inhaltlich, dass IWF-Mitglieder ihre Dollarreserven nicht mehr gegen das allzeit preisstabile Gold eintauschen konnten, sondern auf das Halten dieser gedrängt wurden. Dadurch gerieten die Akteure in die Lage, von der amerikanischen Zentralbank und ihrer Wirtschaftspolitik stärker als bisher abhängig zu sein, inflationäre Gefahren eingeschlossen. Der Dollarstandard löste den Gold-Dollarstandard ab.[25]
Die Machtverhältnisse im IWF waren durch folgende Charakteristika gekennzeichnet. Während es nach dem Marshall-Plan die wirtschaftlich aufstrebenden Europäer waren, die ihr Comeback durch die starken Positionen während der Reformverhandlungen konstatierten, folgten die Entwicklungsländer unter Führung der OPEC-Mitglieder. Zwar ist ihr Erfolg aufgrund der mangelnden Wirtschaftskraft der meisten Entwicklungsländer nur als mäßig zu beurteilen, sie erzielten jedoch in den siebziger Jahren einige Fortschritte zu ihren Gunsten. Obwohl die G-10 versuchten jegliche Kompromisse in Bezug auf die Beteiligung an IWF-Entscheidungen abzulehnen, gelang es dem formierten Länderblock sich zumindest teilweise am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Sie erlangten stärkere Repräsentanz, allein durch die quantitative Mehrheit und das dadurch implizierte Vetorecht. Bei der Wirtschaftskraft behielten die Industrieländer jedoch ihr Monopol und verteidigten die Übermacht der Stimmrechte.[26]
In diesem Zusammenhang sei auf die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 1970er Jahre verwiesen. Tabelle 1 macht die Grundlagen der Verhandlungsbemühungen von Seiten des OPEC-Konsortiums deutlich. So waren es die erdölexportierenden Länder, die zwischen 1970 und 1975 ihren Welthandelsanteil um 6% auf 26% steigern konnten. Einhergehend damit erhöhten sich die Devisenreserven der Ölexporteure drastischerweise von 5% auf 25%. Die übrigen Entwicklungsländer konnten keine signifikant positiven Veränderungen aufweisen.
Für den IWF entwickelte sich das auf den wichtigen Ölexporten beruhende Phänomen zu einer neuen Aufgabe. Gerade im Kontext der ersten Ölkrise Anfang der 1970er entstand enormer Regelungsbedarf. Die ölexportierenden Länder verfügten über unerwartete Deviseneinnahmen, während rohstoffarme Länder Finanzdefizite verbuchten. Dabei standen Entwicklungsländer ohne natürliche Erdölreserven vor dem größten Problem. Es galt für den IWF, eine Lösung für die Situation zu finden. Er fungierte deshalb als Mittler zwischen Rohstoffexporteuren und Rohstoffimporteuren. Die arabischen Länder finanzierten also die IWF-Kredite an die Importabhängigen, wobei im historischen Kontext von der Erdölfazilität gesprochen wird. 8,3 Milliarden Dollar stellten Ölexporteure von 1974 bis 1976 zur Verfügung, damit entsprechende IWF-Mittel vergeben werden konnten. Allein Italien und Großbritannien nahmen davon insgesamt 3 Milliarden Dollar in Anspruch. Bezüglich der IWF-Quoten bedeutete dies, dass mit Quotenänderung der Anteil der Ölländer von 5% auf 10% anstieg, was diesen eine erhöhte Einflussnahme im IWF ermöglichte. Die USA und Großbritannien gaben im Gegenzug 3,5% ab, was für diese Länder einen enormen Einflussverlust darstellte.[27]
Zwischen 1972 und 1976 waren die Entwicklungsländer durch die Führung der OPEC in der Lage, ihren monetären Einflussbereich im IWF teilweise auszuweiten. Dabei profitierten die angepriesene NIEO, New International Economic Order, nicht nur von der Ölkrise, sondern auch vom Niedergang des klassischen Bretton-Woods-System und den Machtkämpfen innerhalb der G-10. Denn die europäische Wirtschaftsgemeinschaft unter der Führung Frankreichs setzte alles daran, die amerikanische Währungsübermacht zu brechen. Resümierend lässt sich festhalten, dass dieser Zeitraum jedoch als ein Hochpunkt für die Dritte Welt zu betrachten ist, da die industrielle Währungselite in den folgenden Jahren ein höheres Maß an Einigkeit über ihre Wirtschaftspolitik finden sollte.[28]
Gerade das Verhältnis der Entwicklungsländer zum IWF war stets von vergebenen Mühen bestimmt, aufgrund struktureller Schwächen einen Sonderstatus innerhalb des Währungsfonds eingeräumt zu bekommen. Die Entwicklungsländer propagierten eine Relation zwischen Armut und Sonderziehungsrechten. Selbstverständlich kollidierte diese Vorstellung mit dem IWF-Gerüst und den Interessen der Industrieländer. Ein Höhepunkt dieser Bemühungen war die IWF-Konferenz 1976 in Jamaika, bei der der IWF schließlich die bisher höchste Quotenaufstockung von 29,2 auf 39,0 Milliarden kumulierte Sonderziehungsrechte beschloss, wobei die Devisenkredite gegen Einzahlung eigener Währung erhältlich waren. Fraglich sind dementsprechend die Inflationsgefahren, die von dieser Maßnahme ausgingen, jedoch schien der IWF den Interessen der Entwicklungsländer entgegengekommen zu sein.[29]
Ferner sind die Geschehnisse relevant im Kontext der Fragestellung dieser Arbeit, die letztendlich die Ablösung des Bretton-Woods-System bewirkten. Nach Nixons währungspolitischem Ausschweifen im Jahre 1971 und der auf europäischen Druck unmittelbaren Dollarabwertung erhoffte sich und erreichte der US-Finanzminister Connally nach der unliebsamen Abwertung zumindest einen volkswirtschaftlichen Swing.[30] Dieser kam durch die verbesserten Exportbedingungen zustande. Es war absehbar, dass freie Konvertibilität bei einem Dollar-Standard nur vorübergehend praktizierbar war. Die darauf folgenden Jahre des internationalen Währungssystems kennzeichneten zuerst weitere Dollarabwertungen bei gleichzeitigen Aufwertungen anderer wichtiger Währungen wie dem Yen und der D-Mark, die Bestrebungen Europas, freie Wechselkurse durchzusetzen und zuletzt die Etablierung der bereits vorhandenen Sonderziehungsrechte.
Die Anpassung der Dissonanzen durch Auf- und Abwertungen repräsentierte für Europa Entwicklungen von nationalem Interesse, wobei gerade Direktinvestitionen eine Schlüsselrolle spielten. Denn mittels des überteuerten US-$ beteiligten sich Amerikaner vermehrt an europäischen Unternehmen, wobei Übernahmen oft die Folge darstellten. Vor allem in Frankreich kauften sich amerikanische Investoren oft zum Unmute der französischen Regierung ein. Aus amerikanischer Sicht hatte das Opfern ganzer Exportsektoren zugunsten von Auslandsinvestitionen seit der Präsidentschaft Kennedys Tradition. Der US-$ hatte außerhalb des eigenen Landes seit Jahren eine überhöhte Kaufkraft, die es aus europäischer und japanischer Sichtweise zu brechen galt.[31]
Die Internationale Wechselkurspolitik wies ab 1973 einen fließenden Übergang zu freien Wechselkursen auf. Zuerst lösten sich einige europäische Regierungen vom festen Wechselkurs im Devisenverkehr, um dann später die gemeinsame Euroschlange[32] zu bilden. Schließlich lösten freie Wechselkurse die floatende Euroschlange ab.
4.2. Die ersten Dekaden der Weltbank
4.2.1. Die Aufnahme der Weltbankaktivitäten
Die ersten Rekonstruktionskredite leistete die IBRD im Jahre 1947 an die Niederlande, Frankreich, Dänemark und Luxemburg. Erst später sollten die Aggressoren des Zweiten Weltkriegs bedient werden. Diese Maßnahmen in Bezug auf Europa sollten gemeinsam mit weiteren Hilfen und Investitionen als Marshall-Plan in die Geschichte eingehen. Bereits ein Jahr später wandte sich die Weltbank ihrem namentlich zweiten Aufgabenbereich, der Entwicklung, zu. Die global diversifizierten Kredite gewährte die Institution an Äthiopien, Australien, Chile, Indien und Irak. Dabei ist augenfällig, dass die Summe der Wiederaufbaukredite im ersten Jahr etwa doppelt so hoch war wie der jährliche Durchschnitt der Entwicklungskredite für die fünf folgenden Jahre. Allein an diesem Faktum sind die Prioritäten auszumachen.[33]
Bezüglich der Wiederaufbaudarlehen ist von Relevanz, dass die Kreditnehmer sie fast ausschließlich für amerikanische Produkte verwendeten. Die Europäer importierten unter anderem Fertigwaren, Fabrikations- und Landmaschinen, Lokomotiven, Schiffe und Baustahl aus den USA. Für die Entwicklungsdarlehen sei eine Differenzierung nach Sektoren vorzunehmen. Bis 1961 konzentrierten sich Entwicklungsprojekte im Verkehrswesen auf Eisenbahn, Straßenverkehr, Schifffahrt, Häfen und Wasserstrassen, Flughäfen und Ölleitungen. Für den Schienenverkehr beispielsweise importierten die Kreditnehmer Lokomotiven, Rollmaterial und Schienen. Es ist daraus jedoch nicht zu schlussfolgern, dass die in Weltbankprojekte eingehenden Rohstoffe oder Produkte stets importiert wurden, wobei auf Abschnitt 5.2.2. zu verweisen ist.[34]
Der Energiesektor erfüllte aufgrund der stark steigenden Nachfrage in Entwicklungsländern eine wichtige Rolle und setzte sein Hauptaugenmerk auf die Errichtung von Kraftwerken. Die Projekte schlossen dabei die Leitungs- und Verteileranlagen mit ein. Hauptsächlich unterstützte die Weltbank Wasser- und Wärmekraftwerke, zog gleichzeitig aber auch Kernkraftwerke in Betracht, sofern der wissenschaftliche Stand des Landes und die Grundauslastung der Werke gegeben waren. Industrievorhaben der Weltbank bezogen sich auf Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Produktionsanlagen, außerdem auf die Unterstützung bei der Ausbeutung von Bodenschätzen. Im Sektor Landwirtschaft handelte es sich zu Beginn der Weltbankaktivitäten um Investitionen für die grundlegende landwirtschaftliche Entwicklung, das heißt Bewässerung, Flutkontrolle sowie Verbesserung des Bodens. Außerdem unterstützte die Bank den Import von landwirtschaftlichen Maschinen, Anlagen zur Verarbeitung und Vorratshaltung der Erzeugnisse, und unterstützte Zuchtviehhaltung und den Waldbau.[35]
Tabelle 2: Gesamte IBRD-Kredite bis zum 31.12.1961 - nach Regionen und Sektoren gegliedert
(Angaben in Millionen US-Dollar)1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1In Klammern: Angaben in Prozent, gerundet.
Quelle: Twele, Cord, [Entwicklungspolitik, 1995], Die Entwicklungspolitik der Weltbank-Gruppe vor dem Hintergrund der Schuldenkrise der „Dritten Welt“ seit Beginn der achtziger Jahre, Frankfurt am Main 1995, S. 77.
[...]
[1] Anm. Multilaterale Organisationen führen die Interessen mehrerer Staaten zusammen und verfolgen dabei eine bestimmte Zielsetzung. Kapitel 4 gibt Aufschluss über die verschiedenen Typen multilateraler Organisationen.
[2] Vgl. Gleske, Leonhard, [IWF, 1988], IWF und Weltbank. Aufgaben und Perspektiven, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jg. 41, H. 18, 1988, S. 832.
[3] Anm. Es handelt sich bei dem Begriff um die Beziehungen zwischen den entwickelten, reichen Volkswirtschaften des Nordens und den weniger entwickelten, tendenziell ärmeren Volkswirtschaften der südlichen Hemisphäre.
[4] Vgl. Van der Wee, Hermann, [Wohlstand, 1984], Der gebremste Wohlstand. Wiederaufbau, Wachstum und Strukturwandel der Weltwirtschaft seit 1945, München 1984, zitiert bei: Dickhaus, Monika, [DM, 1997], DM, Dollar, Rechnungseinheiten. Die Bundesbank und die Anfänge der Globalisierung in den 50er Jahren, in: Arbeitskreis für Bankgeschichte, H. 7, Frankfurt am Main 1997, S. 5.
[5] Vgl. Kapur, Davesh / Lewis, John P. / Webb, Richard C., [World, 1997], The World Bank. Its First Half Century, Washington D.C. 1997; Eichengreen, Barry / Odell, John, [States, 1996], The United States, the ITO and the WTO. Exit options, agent slack and presidential leadership, Berkeley 1996, zitiert bei: Dickhaus, Monika, [DM, 1997], DM, Dollar, Rechnungseinheiten. Die Bundesbank und die Anfänge der Globalisierung in den 50er Jahren, in: Arbeitskreis für Bankgeschichte, H. 7, Frankfurt am Main 1997, S. 6f.
[6] Anm. Bergsten stellt ein Szenario dar, das zwischen Misserfolg und Erfolg der Organisationen, Minimal- und Maximalziel variiert.
[7] Vgl. Bergsten, Fred C., [Reform, 1977], The Reform of International Institutions, in: Managing International Economic Interdependence. Selected Papers of Fred C. Bergsten 1975-1976, hrsg. von Fred C. Bergsten, Toronto 1977, S. 269, zitiert bei: Tetzlaff, Rainer, [Weltbank, 1980], Die Weltbank, Machtinstrument der USA oder Hilfe für die Entwicklungsländer. Zur Geschichte und Struktur der modernen Weltgeschichte, München 1980, S. 147f.
[8] Vgl. Johnson, Mary E., [Fund, 1993], The International Monetary Fund 1944-1992. A Research Guide, New York 1993, S. 3f.
[9] Anm. Die IWF-Mitglieder nahmen die Gold-Dollar-Parität 1944 bereits auf. Die Vereinbarung sah vor, dass der US-$ als Leitwährung fungierte und jede Mitgliedswährung in ein System fixer Wechselkurse in einer festen Parität zum US-$ gesetzt wurde. Die US-Regierung verpflichtete sich gleichzeitig Dollarbestände gegen Gold zu kaufen.
[10] Anm. 1947 nahm der Fonds seine finanzielle Funktion das erste Mal war und gewährte 11 Mitgliedsländern entsprechende Kreditziehungen. Trainingskurse und technische Unterstützung gewährte der Fonds seinen Mitgliedern ab 1950.
[11] Vgl. Johnson, Mary E., [Fund, 1993], The International Monetary Fund 1944-1992. A Research Guide, New York 1993, S. 12ff.
[12] Vgl. Salda, Anne C. M., [World, 1995], World Bank, New Jersey 1995, S. XII.
[13] Vgl. Tetzlaff, Rainer, [Weltbank, 1980], Die Weltbank, Machtinstrument der USA oder Hilfe für die Entwicklungsländer. Zur Geschichte und Struktur der modernen Weltgeschichte, München 1980, S. 154f.
[14] Vgl. ebd., S. 148f.
[15] Vgl. Andersen, Uwe, [Währungssystem, 1977], Das internationale Währungssystem zwischen nationaler Souveränität und supranationaler Integration. Entwicklungstendenzen seit Bretton Woods im Spannungsfeld der Interessen, Berlin 1977, S. 164ff.
[16] Vgl. Horsefield, Keith J., [Fund, 1969], The International Monetary Fund 1945-1965. Twenty Years of International Monetary Cooperation, Bd. 1: Chronicle, Washington D.C. 1969, S. 340f.
[17] Anm. Der Marshall-Plan war das amerikanische Wirtschaftsaufbauprogamm für Westeuropa in Folge des Zweiten Weltkriegs.
[18] Vgl. Ferguson, Tyrone, [World, 1988], The Third World and decision making in the International Monetary Fund, Genf 1988, S. 45.
[19] Vgl. Horsefield, Keith J., [Fund, 1969], The International Monetary Fund 1945-1965. Twenty Years of International Monetary Cooperation, Bd. 1: Chronicle, Washington D.C. 1969, S. 603f.
[20] Anm. Das Thema Wirtschaftspolitische Auflagen wird in Kapitel 6 besonders im Zusammenhang mit Erweiterten Fazilitäten genauer untersucht.
[21] Anm. Wenn ein regelrechter Marktmechanismus bestanden hätte, wäre der Dollarkurs stark gefallen. Es bestand jedoch das System fester Wechselkurse, das dies verhinderte.
[22] Vgl. Ferber, Manfred / Winkelmann, Günter, [Währungsfonds, 1972], Internationaler Währungsfonds, Weltbank, IDA, Frankfurt 1972, S. 32ff.
[23] Vgl. Horsefield, Keith J., [Fund, 1969], The International Monetary Fund 1945-1965. Twenty Years of International Monetary Cooperation, Bd. 1: Chronicle, Washington D.C. 1969, S. 605ff.
[24] Anm. In diesem Zusammenhang handelte es sich um die Durchsetzung amerikanischer Interessen zugunsten seiner eigenen Wirtschaft.
[25] Vgl. Andersen, Uwe, [Währungssystem, 1977], Das internationale Währungssystem zwischen nationaler Souveränität und supranationaler Integration. Entwicklungstendenzen seit Bretton Woods im Spannungsfeld der Interessen, Berlin 1977, S. 374f.
[26] Vgl. Ferguson, Tyrone, [World, 1988], The Third World and decision making in the International Monetary Fund, Genf 1988, S. 107f.
[27] Vgl. Hellmann, Rainer, [Dollar, 1976], Dollar, Gold und Schlange. Die letzten Jahre von Bretton Woods, Baden-Baden 1976, S. 161ff.
[28] Vgl. Ferguson, Tyrone, [World, 1988], The Third World and decision making in the International Monetary Fund, Genf 1988, S. 162f.
[29] Vgl. Hellmann, Rainer, [Dollar, 1976], Dollar, Gold und Schlange. Die letzten Jahre von Bretton Woods, Baden-Baden 1976, S. 166f.
[30] Anm. Der Begriff Swing entstammt der Keynesschen Volkswirtschaftstheorie und bezieht sich hier auf die makroökonomisch positiven Effekte einer Währungsabwertung bei Außenhandel.
[31] Vgl. Hellmann, Rainer, [Dollar, 1976], Dollar, Gold und Schlange. Die letzten Jahre von Bretton Woods, Baden-Baden 1976, S. 21f.
[32] Anm. Das gemeinsame Floaten europäischer Währungen, untereinander innerhalb fester Bandbreiten, jedoch gegenüber dem US-$ völlig flexibel, bezeichnet die Euroschlange.
[33] Vgl. Twele, Cord, [Entwicklungspolitik, 1995], Die Entwicklungspolitik der Weltbank-Gruppe vor dem Hintergrund der Schuldenkrise der „Dritten Welt“ seit Beginn der achtziger Jahre, Frankfurt am Main 1995, S. 75f.
[34] Vgl. World Bank, [World, 1963], World Bank, IFC and IDA, Washington D.C. 1963, S. 59ff.
[35] Vgl. ebd., S. 63f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832485634
- ISBN (Paperback)
- 9783838685632
- DOI
- 10.3239/9783832485634
- Dateigröße
- 532 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- internationale finanzsituation schuldenkrise asienkrise welthandel verhältnis industrie- entwicklungsländer
- Produktsicherheit
- Diplom.de