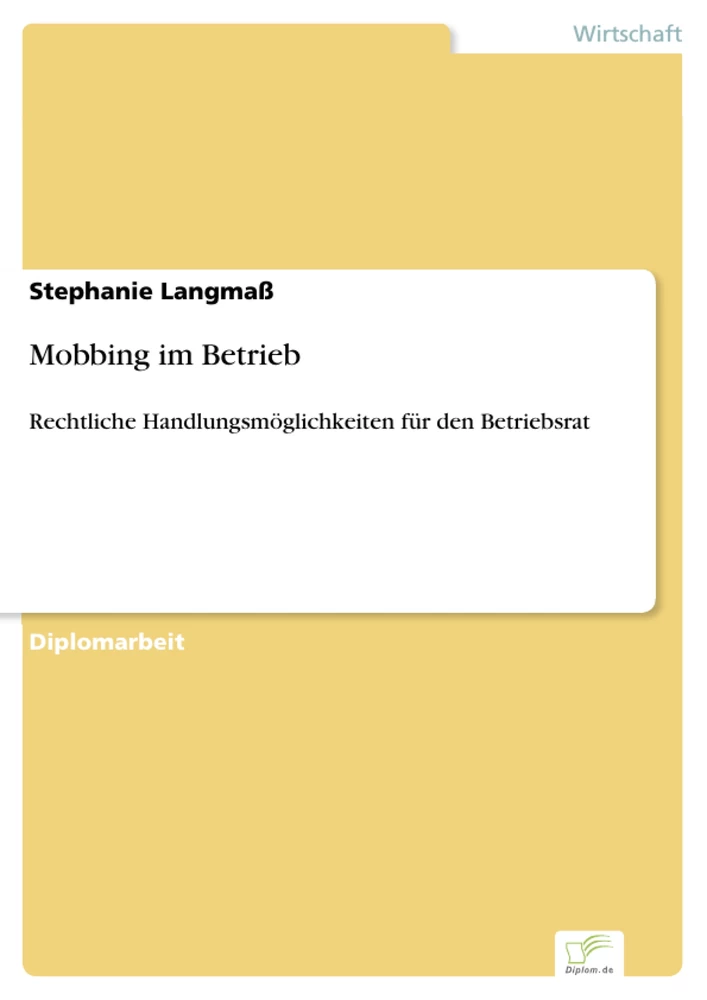Mobbing im Betrieb
Rechtliche Handlungsmöglichkeiten für den Betriebsrat
©2004
Diplomarbeit
125 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Mobbing ist ein Phänomen, das heute in den Medien sehr intensiv und umfassenddiskutiert wird. So wurde etwa von einer Sekretärin berichtet, die wochenlang von ihren Kollegen schikaniert wurde, bis sie schließlich einen Selbstmordversuch unternahm. Zurück im Büro begrüßten sie die Kollegen mit den Worten: Ach, nicht mal das haben Sie geschafft? Versuchen Sie´s doch noch einmal.
Bekannt wurde auch der Fall einer 22-jährigen Polizistin, die sich in Folge von Mobbinghandlungen und sexueller Belästigung mit ihrer Dienstwaffe erschossen hatte.
Wenn Menschen im Berufsleben in einer Art Zwangsgemeinschaft zum Zweck der Arbeitsverrichtung zusammenkommen, sind einzelne Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten nie gänzlich zu vermeiden. Was unterscheidet jedoch Mobbing - den Psychoterror am Arbeitsplatz - von alltäglichen, normalen Reibereien und Konflikten unter Kollegen?
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen definiert Mobbing in einem Grundsatzurteil vom 10.04.2001 als fortgesetzte, aufeinander aufbauende [ ]der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen [ ]die in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen. Aktuell leiden 2,5 % bis 3 % aller deutschen Beschäftigen unter Mobbing, so der Mobbing-Report 2002 von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Diese Tendenzen sind vor allem auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zurückzuführen. Durch die zunehmende Globalisierung der Märkte verstärkt sich der Druck auf die einzelnen Unternehmen. Die Folge sind Umstrukturierungen ganzer Betriebe und ein permanenter Stellenabbau. Die verbleibenden Arbeitsabläufe werden immer komplexer und verantwortungsvoller. Durch den ständig steigenden Leistungsdruck und die Angst um die berufliche Existenz entwickelt sich der Arbeitsplatz mehr und mehr zum allgemeinen Spannungsfeld. Die Folge ist ein schlechtes Betriebsklima, indem Konflikte mittels Schikane und Ausgrenzung anderer kompensiert werden.
Mobbing hat sowohl für die Betroffenen als auch für die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft weitreichende Konsequenzen: Die Mehrzahl der Mobbing betroffenen klagt über ein negatives Wohlbefinden sowie über psychische und physische Beschwerden. Etwas 20 % der Selbstmorde in Deutschland können zudem auf Mobbingaktivitäten zurückgeführt werden. Neben diesen dramatischen Folgen […]
Mobbing ist ein Phänomen, das heute in den Medien sehr intensiv und umfassenddiskutiert wird. So wurde etwa von einer Sekretärin berichtet, die wochenlang von ihren Kollegen schikaniert wurde, bis sie schließlich einen Selbstmordversuch unternahm. Zurück im Büro begrüßten sie die Kollegen mit den Worten: Ach, nicht mal das haben Sie geschafft? Versuchen Sie´s doch noch einmal.
Bekannt wurde auch der Fall einer 22-jährigen Polizistin, die sich in Folge von Mobbinghandlungen und sexueller Belästigung mit ihrer Dienstwaffe erschossen hatte.
Wenn Menschen im Berufsleben in einer Art Zwangsgemeinschaft zum Zweck der Arbeitsverrichtung zusammenkommen, sind einzelne Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten nie gänzlich zu vermeiden. Was unterscheidet jedoch Mobbing - den Psychoterror am Arbeitsplatz - von alltäglichen, normalen Reibereien und Konflikten unter Kollegen?
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen definiert Mobbing in einem Grundsatzurteil vom 10.04.2001 als fortgesetzte, aufeinander aufbauende [ ]der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen [ ]die in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen. Aktuell leiden 2,5 % bis 3 % aller deutschen Beschäftigen unter Mobbing, so der Mobbing-Report 2002 von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Diese Tendenzen sind vor allem auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zurückzuführen. Durch die zunehmende Globalisierung der Märkte verstärkt sich der Druck auf die einzelnen Unternehmen. Die Folge sind Umstrukturierungen ganzer Betriebe und ein permanenter Stellenabbau. Die verbleibenden Arbeitsabläufe werden immer komplexer und verantwortungsvoller. Durch den ständig steigenden Leistungsdruck und die Angst um die berufliche Existenz entwickelt sich der Arbeitsplatz mehr und mehr zum allgemeinen Spannungsfeld. Die Folge ist ein schlechtes Betriebsklima, indem Konflikte mittels Schikane und Ausgrenzung anderer kompensiert werden.
Mobbing hat sowohl für die Betroffenen als auch für die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft weitreichende Konsequenzen: Die Mehrzahl der Mobbing betroffenen klagt über ein negatives Wohlbefinden sowie über psychische und physische Beschwerden. Etwas 20 % der Selbstmorde in Deutschland können zudem auf Mobbingaktivitäten zurückgeführt werden. Neben diesen dramatischen Folgen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8545
Langmaß, Stephanie: Mobbing im Betrieb -
Rechtliche Handlungsmöglichkeiten für den Betriebsrat
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
II
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis... IV
Abkürzungsverzeichnis ...V
1
Einleitung ... 1
1.1 Problemstellung ... 1
1.2 Gang der Arbeit... 3
2
Mobbing verstehen... 5
2.1 Der Mobbingbegriff ... 5
2.1.1 Allgemeine Definition... 5
2.1.2 Rechtsprechungs-Definition... 6
2.2 Abgrenzung des Mobbing von anderen Konflikten ... 8
2.3 Mögliche Mobbinghandlungen ... 10
2.3.1 Die 45 Handlungen was Mobber tun ... 11
2.3.2 Katalog der 100+... Mobbinghandlungen ... 11
2.4 Der Verlauf von Mobbing... 13
2.5 Wer sind die Beteiligten? ... 15
2.6 Ursachen und Folgen... 16
2.6.1 Ursachen... 16
2.6.2 Folgen... 18
3
Mobbing aus rechtlicher Sicht ... 23
3.1 Arbeitsrechtliche Dimension des Mobbing... 24
3.2 Aktuelle arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zu Mobbing ... 27
3.3 Kollektivrechtliche Handlungsmöglichkeiten gegen Mobbing ... 33
4
Rechtliche Handlungsmöglichkeiten für den Betriebsrat ... 34
4.1 Die Stellung des Betriebsrats ... 34
4.2 Präventive Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats ... 36
4.2.1 Die Überwachungsaufgabe des Betriebsrats (§§ 80, 75 BetrVG)... 36
4.2.2 Unterrichtungs- und Beratungsrechte des Betriebsrats bezüglich der
Gestaltung von Arbeitsbedingungen (§ 90 BetrVG)... 40
Inhaltsverzeichnis
III
4.2.3 Mitbestimmungsrechte des Betriebrats (§ 87 BetrVG)... 44
4.2.4 Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Mobbingproblematik... 46
4.2.4.1
Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung zur
Mobbingproblematik... 48
4.2.4.2
Betriebsvereinbarung ,,Partnerschaftliches Verhalten am
Arbeitsplatz" der Volkswagen AG ... 50
4.2.5 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 BetrVG). 61
4.3 Reagierende Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats ... 64
4.3.1 Beschwerderecht der Arbeitnehmer (§§ 84, 85 BetrVG)... 64
4.3.1.1
Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat
(§ 85 BetrVG) ... 65
4.3.2 Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer (§ 104 BetrVG)... 67
4.4 Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen ... 68
5
Zusammenfassung und Ausblick ... 73
Anhang ...VIII
Literaturverzeichnis... XXI
Erklärung... XXI
Abbildungsverzeichnis
IV
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Hierarchische Position der Mobber... 15
Abbildung 2:
Mögliche Ursachen für Mobbing ... 17
Abbildung 3:
Betriebswirtschaftlicher Schaden durch Mobbing ... 20
Abbildung 4:
Volkswirtschaftlicher Schaden durch Mobbing... 21
Abbildung
5:
Eckpunkte für eine Betriebs- und Dienstvereinbarung zur
Mobbingproblematik... 50
Abkürzungsverzeichnis
V
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
AG
Arbeitgeber / Aktiengesellschaft
AiB
Arbeitsrecht im Betrieb (Zeitschrift)
AN
Arbeitnehmer
ArbG
Arbeitsgericht
AR-Blattei
Arbeitsrecht-Blattei (Loseblattsammlung)
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
Art.
Artikel
ArbuR, AuR
Arbeit und Recht (Zeitschrift)
Az.
Aktenzeichen
BAG
Bundesarbeitsgericht
BAUA
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin
BAT
Bundesangestelltentarif
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
BR
Betriebsrat
BRD
Bundesrepublik Deutschland
BV
Betriebsvereinbarung
bzw.
beziehungsweise
ca. circa
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
d.h.
das heißt
DKK
Däubler/Kittner/Klebe
Abkürzungsverzeichnis
VI
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
e.V.
eingetragener Verein
f., ff.
folgende, fortfolgende
FKHES
Fitting/Kaiser/Heither/Engels/Schmidt
GG
Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hako
Handkommentar
h.M.
herrschende Meinung
Hrsg.
Herausgeber
i.S.d.
im Sinne des
i.V.m.
in Verbindung mit
LAG
Landesarbeitsgericht
Mio.
Millionen
Mrd.
.
Milliarden
MRK
Menschenrechtskonvention
Nr.
Nummer
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift)
NZA-RR
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht-
Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift)
o.g.
oben genannte
PC
Personal Computer
Rn.
Randnummer
Abkürzungsverzeichnis
VII
S.
Seite/Satz
s., s.a.
siehe, siehe auch
u.a.
unter anderem / und anderen
usw.
und so weiter
u.U.
unter Umständen
vgl.
vergleiche
VW
Volkswagen
www
world wide web
z.B.
zum Beispiel
zit.
zitiert
ZPO
Zivilprozessordnung
z.T.
zum Teil
Einleitung
1
1
Einleitung
1.1
Problemstellung
Mobbing ist ein Phänomen, das heute in den Medien sehr intensiv und umfassend
diskutiert wird.
So wurde etwa von einer Sekretärin berichtet, die wochenlang von ihren Kollegen
schikaniert wurde, bis sie schließlich einen Selbstmordversuch unternahm.
Zurück im Büro begrüßten sie die Kollegen mit den Worten: ,,Ach, nicht mal das
haben Sie geschafft? Versuchen Sie´s doch noch einmal".
1
Bekannt wurde auch der Fall einer 22-jährigen Polizistin, die sich in Folge von
Mobbinghandlungen und sexueller Belästigung mit ihrer Dienstwaffe erschossen
hatte.
2
Wenn Menschen im Berufsleben in einer Art ,,Zwangsgemeinschaft" zum Zweck
der Arbeitsverrichtung zusammenkommen, sind einzelne Meinungsverschieden-
heiten und Streitigkeiten nie gänzlich zu vermeiden.
Was unterscheidet jedoch Mobbing - den Psychoterror am Arbeitsplatz - von all-
täglichen, normalen Reibereien und Konflikten unter Kollegen?
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen definiert Mobbing in einem
Grundsatzurteil vom 10.04.2001 als ,,fortgesetzte, aufeinander aufbauende [...]
der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen [...]
die in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso
geschützte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen"
3
.
1
Aus Diergarten 1994, S. 13.
2
Vgl. Müncher Merkur vom 17.02.1999.
3
Leitsatz 5 des LAG Thüringen im Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S.
274.
Einleitung
2
Aktuell leiden 2,5 % bis 3 % aller deutschen Beschäftigen unter Mobbing, so der
,,Mobbing-Report 2002" von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.
4
Diese Tendenzen sind vor allem auf gesellschaftliche und wirtschaftliche
Veränderungen zurückzuführen. Durch die zunehmende Globalisierung der
Märkte verstärkt sich der Druck auf die einzelnen Unternehmen. Die Folge sind
Umstrukturierungen ganzer Betriebe und ein permanenter Stellenabbau. Die
verbleibenden Arbeitsabläufe werden immer komplexer und
verantwortungsvoller. Durch den ständig steigenden Leistungsdruck und die
Angst um die berufliche Existenz entwickelt sich der Arbeitsplatz mehr und mehr
zum allgemeinen Spannungsfeld.
5
Die Folge ist ein schlechtes Betriebsklima, in
dem Konflikte mittels Schikane und Ausgrenzung anderer, kompensiert werden.
Mobbing hat sowohl für die Betroffenen als auch für die gesamte Gesellschaft und
Wirtschaft weitreichende Konsequenzen:
6
Die Mehrzahl der Mobbingbetroffenen
klagt über ein negatives Wohlbefinden sowie über psychische und physische
Beschwerden. Etwas 20 % der Selbstmorde in Deutschland können zudem auf
Mobbingaktivitäten zurückgeführt werden. Neben diesen dramatischen Folgen für
den einzelnen verursacht Mobbing in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)
zum anderen einen gesamtwirtschaftlichen Schaden in Höhe von ca. 25 Mrd.
Euro.
Mobbing kann und darf aufgrund der oben dargestellten gravierenden Folgen in
einer demokratischen Gesellschaft nicht geduldet werden und verstößt eindeutig
gegen die im Grundgesetz geschützten Persönlichkeitsrechte.
Das deutsche Arbeitsrecht bietet zum heutigen Zeitpunkt bereits vielfältige
juristische Möglichkeiten um gegen Mobbing vorzugehen, so dass Mobbing - der
Kampf am Arbeitsplatz - keinesfalls hingenommen werden muss.
4
Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002.
5
Vgl. Wolmerath 2000, S. 33 f.; Esser/Wolmerath, AiB 1996, S. 540.
6
Vgl. hierzu Kapitel 2.6.2.
Einleitung
3
Insbesondere der Arbeitgeber und die betriebliche Interessenvertretung sind
gefordert, alles zu unternehmen, um Mobbing möglichst präventiv zu verhindern
bzw. im konkreten Fall zu bekämpfen.
Speziell dem Betriebsrat kommt per Gesetz die Aufgabe zu, die Interessen aller
Arbeitnehmer zu vertreten und sie somit auch vor Mobbing zu schützen.
Die vorliegende Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, welche rechtlichen
Handlungsmöglichkeiten dem Betriebsrat im Kampf gegen Mobbing zur
Verfügung stehen.
1.2
Gang der Arbeit
Im Folgenden soll der Gang der Arbeit dargestellt werden:
Um das Phänomen Mobbing verständlich zu machen, wird einleitend der Begriff
erläutert und von anderen alltäglichen Konflikten abgegrenzt. Weiterhin werden
typische Mobbinghandlungen, ein klassischer Mobbingverlauf und die vielfältigen
Ursachen und Folgen, die mit Mobbing einhergehen, beschrieben (Kapitel 2).
Die nachfolgenden Kapitel konzentrieren sich auf die rechtlichen Aspekte von
Mobbing:
Kapitel 3 widmet sich der Frage, wie Mobbing rechtlich und insbesondere
arbeitsrechtlich zu bewerten ist. Diesbezüglich werden zwei Grundsatzurteile des
LAG Thüringen erläutert, die sich ausführlich mit Mobbing am Arbeitsplatz
auseinandergesetzt und verbindliche Regeln für die rechtliche Bewertung von
Mobbing aufgestellt haben.
Die weiteren Ausführungen beschäftigen sich dann explizit mit den rechtlichen
Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung. Hierbei wird
zwischen präventiven und reagierenden Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats
gegen Mobbing unterschieden, wobei der Fokus auf der Prävention liegt
(Kapitel 4).
Einleitung
4
Am Schluss der Arbeit stehen eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte
und ein Ausblick.
Ich möchte darauf hinweisen, dass sich alle Personenbezeichnungen in dieser
Arbeit auf beide Geschlechter beziehen, wenn nicht ausdrücklich auf die
männliche oder weibliche Form hingewiesen wird.
Mobbing verstehen
5
2
Mobbing verstehen
Der Begriff Mobbing
7
hat in den letzten Jahren, u.a. auch durch die zunehmende
Berichterstattung in den Medien, eine starke Verbreitung in unserer
Alltagssprache erfahren. Mobbing wird in unserer Zeit fast inflationär verwendet.
Trotzdem herrscht noch wenig Klarheit darüber, was man konkret darunter
versteht und welche überaus dramatischen Folgen ,,Mobbing - der Kampf am
Arbeitsplatz" mit sich bringen kann.
8
2.1
Der Mobbingbegriff
In dieser Arbeit soll zunächst eine in der allgemeinen wissenschaftlichen Literatur
vorherrschende Definition von Mobbing gegeben werden, die überwiegend von
Beratungsstellen verwendet wird. Seit den 90er Jahren beschäftigen sich auch
deutsche Arbeitsgerichte mit dem Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz und
prägten in ihren Entscheidungen Rechtsprechungs-Definitionen, die nun auch eine
rechtliche Betrachtung des Phänomens erlauben und auf die man sich vor Gericht
berufen kann.
2.1.1
Allgemeine Definition
Der Ursprung des Begriffs ,,Mobbing" liegt in dem englischen Verb ,,to mob",
was übersetzt so viel bedeutet wie ,,angreifen, anpöbeln, attackieren"
9
. Die
deutsche Rechtschreibung beschreibt das ,,mobben/Mobbing" als
,,Arbeitskollegen ständig schikanieren, mit der Absicht, sie von ihrem
Arbeitsplatz zu vertreiben"
10
. Der schwedische Sozialpsychologe und ,,Erfinder
der Mobbing-Wissenschaft"
11
L
EYMANN
führte bis Ende der 80er Jahre in
7
Nach Brinkmann 2002, S. 1 f., etablierten sich neben ,,Mobbing" eine Vielzahl weiterer Begriffe
zur Beschreibung des Phänomens der ,,Schikane am Arbeitplatz". ,,Bossing" beispielsweise
bedeutet ,,gesundheitsgefährdende Führerschaft" und bezeichnet das Mobbing durch Vorgesetzte.
Der Begriff ,,Bullying" der sich im angelsächsischen Sprachraum durchgesetzt hat und heute
synonym zu Mobbing gebraucht wird, bedeutet so viel wie tyrannisieren, einschüchtern oder
schikanieren. Die grausame Behandlung oder Beschimpfung von Mitarbeitern wird im anglo-
amerikanischen Sprachraum auch als ,,(employee) abuse" bezeichnet. In dieser Arbeit wird der
von Leymann geprägte Begriff Mobbing verwendet, der sich in der Forschung zwischenzeitlich
etabliert hat und beispielsweise sehr viel weiter greift als der Begriff des ,,Bossing".
8
Hartmann, AuA 2003, S. 8.
9
Langenscheidts Handwörterbuch Englisch.
10
Duden 2000, S. 659.
11
Kollmer 2003, S. 4.
Mobbing verstehen
6
Schweden umfangreiche Untersuchungen zum Thema ,,Mobbing in der
Arbeitswelt" durch und hat damit maßgeblich den ,,Weg zu einer systematischen
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Mobbing in der
arbeitswissenschaftlichen Diskussion bereitet"
12
.
Aufbauend auf diesen Studien und deren Resultate definierte L
EYMANN
in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für psychosozialen Stress und Mobbing e.V.
Mobbing am Arbeitsplatz als ,,eine konfliktbelastete Kommunikation am
Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei
der die angegriffene Person unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen
systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (mindestens sechs Monate lang
und einmal pro Woche) (3) mit dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus
dem Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen wird und dies als
Diskriminierung empfindet"
13
. Mobbing ist nach L
EYMANN
also kein neuer
Begriff für alltäglich, vereinzelt vorkommende Konflikte, sondern bezeichnet
einen langzeitigen Verlauf systematischer Schikanen.
14
Auf die einzelnen
Elemente der oben genannten Definition wird im Rahmen dieser Arbeit noch
näher eingegangen.
2.1.2
Rechtsprechungs-Definition
Problematisch für die arbeitsrechtliche Betrachtung des Mobbing im Sinne der
oben genannten Definition ist, dass es sich nicht um eine Begriffsbestimmung ,,im
juristischen Sinne" handelt.
15
Arbeitsrechtliche Entscheidungen zum Phänomen
Mobbing gab es bis vor einigen Jahren kaum. Erstmalig hat das
Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 15.01.1997
16
eine Definition
von Mobbing unternommen. Danach ist Mobbing das:
-
systematische Anfeinden,
-
Schikanieren oder Diskriminieren
-
von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte;
12
Wagner/Bergmann, AiB 2004, S. 103.
13
Leymann 1995, S. 18.
14
Vgl. Leymann 1995, S. 15 ff.
15
Vgl. Wolmerath 2001, S. 24.
16
BAG, Urteil vom 15.01.1997 7 ABR 14/96; NZA 1997, S. 781.
Mobbing verstehen
7
-
wobei Mobbing durch Stresssituationen am Arbeitsplatz, deren
Ursachen u.a. in einer Über- oder Unterforderung einzelner
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen, in der
Arbeitsorganisation oder im Verhalten von Vorgesetzten liegen
können, begünstigt wird.
17
Diese Definition wurde vom LAG Thüringen in seinem Grundsatzurteil vom
10.04.2001
18
im arbeitsrechtlichen Sinne weiterentwickelt. Danach erfasst der
Begriff Mobbing ,,fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander über-
greifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltens-
weisen, die nach Art und Ablauf im Regelfall einer übergeordneten, von der
Rechtsordnung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in ihrer
Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte
Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen, verletzen"
19
.
Beim Mobbing handelt es sich also nach jetziger Rechtslage nicht um einen
eigenständigen juristischen Tatbestand,
20
sondern um einen Sammelbegriff für
verschiedene Verhaltensweisen, die je nach Sachlage für die Opfer sowohl
rechtliche, gesundheitliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen haben
können
21
und die sich durch systematisches Vorgehen auszeichnen.
22
Ein
einmaliger Akt kann noch kein Mobbing sein, auch wenn er eine Verletzung
darstellt, aus der ein Schadensersatzanspruch resultiert.
23
Das LAG Thüringen konkretisiert seine Mobbing-Definition abweichend von
bisherigen Definitionsversuchen folgendermaßen:
24
1. ,,Es lehnt ab, dass Mobbing über einen längeren Zeitraum, also mindestens
über ein halbes Jahr lang", vorgenommen werden müsse. Erfahrungs-
berichte von Betroffenen zeigen,
dass auch systematische und
17
BAG, Urteil vom 15.01.1997 - 7 ABR 14/96; NZA 1997, S. 781-783.
18
LAG Thüringen, Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S. 274-278.
19
Leitsatz 5 des LAG Thüringen im Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S.
274.
20
Leitsatz 4 des LAG Thüringen im Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S.
274.
21
Vgl. Pirntke 2004, S. 72; Kollmer 2003, S. 6.
22
Vgl. Benecke, NZA-RR 2003, S. 226.
23
Vgl. Benecke, NZA-RR 2003, S. 226.
24
Schneppendahl, AiB 2002, S. 303.
Mobbing verstehen
8
kontinuierliche Mobbinghandlungen bei einer Dauer von weniger als sechs
Monaten durchaus schwerwiegende Folgen haben können.
25
2. Wichtig sei die ,,objektive Beurteilung", ob eine Rechtsverletzung vorliege,
auch wenn sich das Opfer nicht zwingend durch die Handlungen des
Mobbers diskriminiert fühlt (subjektives Empfinden).
26
3. Mobbing kann auch vorliegen, wenn es sich um versteckte
Verhaltensweisen handelt,
27
die nicht offensichtlich werden, aber auch zu
Rechtsverletzung führen und besonders heimtückisch sein können.
28
Zu
beachten ist, dass Mobbing eine klare Täter-Opfer-Konstellation verlangt,
29
Fälle des ,,gegenseitigen Anfeindens oder der wechselseitigen Eskalation"
scheiden aus.
30
Ob tatsächlich ein Fall von Mobbing vorliegt, bestimmt sich also immer nach den
Umständen des Einzelfalls. Eine Abgrenzung ist laut Leitsatz 5 des LAG
Thüringen-Urteils ,,zu dem im gesellschaftlichen Umgang im allgemeinen
üblichen oder rechtlich erlaubten und deshalb hinzunehmenden Verhalten" dabei
stets erforderlich.
31
Im Folgenden werden einige Unterscheidungsmerkmale
herausgearbeitet, die bei der Abgrenzung zwischen Mobbing und alltäglichen
psychosozialen Belastungen behilflich sein können.
2.2
Abgrenzung des Mobbing von anderen Konflikten
Wenn viele Menschen miteinander arbeiten, sind einzelne Konflikte, Reibereien,
Spannungen sowie Tratsch und Klatsch fast unvermeidlich. Oft sind die
Beschäftigten bei der Erledigung ihrer Arbeitspflichten zudem erheblichem
Zeitdruck ausgesetzt und entsprechend gestresst.
32
So kann es leicht passieren,
dass man sich im Ton gegenüber anderen Kollegen vergreift, um ,,Dampf"
25
Schneppendahl, AiB 2002, S. 303; Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 22.
26
Vgl. Benecke, NZA-RR 2003, S. 226.
27
Vgl. LAG Thüringen, Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S. 277.
28
Vgl. Schneppendahl, AiB 2002, S. 303 f.
29
Leitsatz 5 des LAG Thüringen im Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S.
274.
30
Benecke, NZA-RR 2003, S. 226.
31
Leitsatz 5 des LAG Thüringen im Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S.
274.
32
Vgl. Hüske-Wagner/Wagner, AiB 2004, S. 89.
Mobbing verstehen
9
abzulassen.
33
Einzelne Konflikte und Spannungen können noch nicht als Mobbing
bezeichnet werden. Zwar gibt es kein Patentrezept um festzustellen ob Mobbing
vorliegt oder nicht, man kann sich jedoch bei der Analyse des Einzelfalls stets an
den in Kapitel 2.1 genannten Merkmalen orientieren. Die Arbeitskammer des
Saarlandes hat zusätzlich die folgenden Merkmale definiert, um den Unterschied
zwischen alltäglichen psychosozialen Belastungen und Mobbing kenntlich zu
machen:
34
-
Die Angriffe betreffen eine bestimmte Person oder Gruppe
Bei Mobbing werden einzelne Personen ,,oft plötzlich und scheinbar willkürlich
zur Zielscheibe" von Anfeindungen und Aggressionen.
35
Es kristallisiert sich eine
Täter-Opfer-Beziehung heraus. Greift dagegen ein Beschäftigter ständig die
gesamte Belegschaft an oder nörgelt er gegen den ganzen Betrieb, so spricht man
wegen fehlender Konkretisierung des Betroffenen (Opfers) noch nicht von
gezieltem Mobbing.
36
-
Es wird die Würde der Person angegriffen
Durch die Mobbinghandlungen wird dem Betroffenen gezeigt, dass er nicht
respektiert wird. Auch wenn der Betroffene deutlich macht, wie verletzend er die
Angriffe und ständigen Demütigungen empfindet, werden entsprechende
Handlungen nicht eingestellt.
37
-
Die Angriffe sind zielgerichtet,
systematisch und negativ-
kommunikativ
Mit Mobbing wird eine destruktive Absicht verfolgt. Der Betroffene wird
systematisch, gezielt, häufig und negativ-kommunikativ, beispielsweise durch
aktives Tun oder auch durch Unterlassen (z.B. Vorenthalten von Informationen),
angegriffen.
38
Zum besseren Verständnis werden in Kapitel 2.3 zahlreiche
Erscheinungsformen schikanösen Handelns am Arbeitsplatz aufgelistet.
39
33
Vgl. Hüske-Wagner/Wagner, AiB 2004, S. 89.
34
Vgl. Arbeitskammer des Saarlandes 2003, S. 1.
35
Arbeitskammer des Saarlandes 2003, S. 1.
36
Vgl. Kollmer 2003, S. 12.
37
Vgl. Arbeitskammer des Saarlandes 2003, S. 1.
38
Vgl. Kollmer 2003, S. 11 f.
39
Vgl. Kollmer 2003, S. 13.
Mobbing verstehen
10
-
Die Angriffe finden regelmäßig über einen längeren Zeitraum statt
Von Mobbing kann man sprechen, wenn die Angriffe auf den Betroffenen nicht
mehr die Ausnahme sind,
40
sondern zur alltäglichen Routine werden,
41
und diese
destruktiven Handlungsweisen durch einen ,,Gesamtzusammenhang miteinander
verbunden" sind
42
. Das LAG Thüringen
43
lehnt jedoch ab, dass die Schikanen
mindestens ein halbes Jahr andauern müssen. Diesbezüglich wurde keine zeitlich
klare Grenze gesetzt, so dass stets der Einzelfall zu prüfen ist.
44
Von Mobbing kann also nur gesprochen werden, wenn die oben genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. So handelt es sich bei einer einmaligen ungerechten
Behandlung durch den Vorgesetzten, wie beispielsweise eine nicht gerechtfertigte
Abmahnung oder Kritik, noch nicht um Mobbing.
45
Jedoch können einzelne
Konflikte, Reibereien und Schikanen, die nach h.M. nicht als Mobbing bezeichnet
werden, durchaus Auslöser eines schleichenden Mobbingprozesses sein. Nach
H
ÜSKE
-W
AGNER
/W
AGNER
kann schon ein gereiztes Arbeitsklima einen guten
,,Nährboden für Mobbing" bieten.
46
2.3
Mögliche Mobbinghandlungen
Wie bereits angesprochen, ist es eine Besonderheit von Mobbing, dass Betroffene
systematisch,
zielgerichtet und wiederholt feindseligen Handlungen von
Kollegen/Vorgesetzten ausgesetzt sind.
Um herauszufinden, was konkret beim Mobbing geschieht, haben sowohl
L
EYMANN
als auch E
SSER
/W
OLMERATH
Untersuchungen und Befragungen
durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz skizziert.
40
Vgl. Holzbecher/Meschkutat 1998, S. 5.
41
Vgl. Arbeitskammer des Saarlandes 2002, S. 1.
42
Vgl. Benecke, NZA-RR 2003, S. 226.
43
Vgl. LAG Thüringen, Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S. 274-278.
44
Vgl. LAG Thüringen, Urteil vom 10.04.2001 - Az: 5 Sa 403/2000; AuR 2001, S. 277.
45
Vgl. Wolmerath 2001, S. 26.
46
Vgl. Hüske-Wagner/Wagner, AiB 2004, S. 89.
Mobbing verstehen
11
2.3.1
Die 45 Handlungen was Mobber tun
Anhand von 300 Interviews mit Betroffenen hat L
EYMANN
1993 einen Katalog
mit 45 Erscheinungsformen von Mobbing erarbeitet und diese in fünf Gruppen
zusammengefasst. Hierbei handelt es sich überwiegend um:
47
1.
Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen
2.
Angriffe auf soziale Beziehungen
3.
Angriffe auf das soziale Ansehen
4.
Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation
5.
Angriffe auf die Gesundheit
Diese Liste der 45 Mobbinghandlungen ist im Anhang
48
vollständig aufgeführt.
Sie hat seit ihrem Erscheinen ,,weite Verbreitung in Broschüren und Büchern
sowie in Betriebs- und Dienstvereinbarungen gefunden" und fungiert auch heute
noch als ,,konzentriertes Anschauungsmaterial" für alle, die sich mit Mobbing
beschäftigen.
49
Die Auffassung L
EYMANN
s, er habe mit dieser Liste alle
vorkommenden Mobbingangriffe abschließend und umfassend katalogisiert, wird
jedoch von E
SSER
/W
OLMERATH
kritisiert.
50
2.3.2
Katalog der 100+... Mobbinghandlungen
Im Laufe der Zeit haben Berichte von Mobbingbetroffenen und Gespräche mit
Betriebsratsmitgliedern gezeigt, dass es eine wesentlich größere, ,,zahlenmäßig
nicht beschränkbare Bandbreite von Mobbinghandlungen gibt"
51
, als L
EYMANN
angenommen hatte.
Demzufolge haben E
SSER
/W
OLMERATH
im August 2000 einen neuen Katalog mit
weit mehr als 120 Mobbinghandlungen veröffentlicht, der bis zum heutigen
Zeitpunkt stetig überarbeitet wird und ebenfalls im Anhang
52
aufgeführt ist.
E
SSER
/W
OLMERATH
haben unter ,,kritischer Mitwirkung von Betriebs- und
47
Vgl. Leymann 2002, S. 22 ff.
48
Siehe im Anhang Punkt 1a) Die 45 Mobbinghandlungen nach Leymann.
49
Esser/Wolmerath 2003, S. 25.
50
Vgl. Esser/Wolmerath 2003, S. 25.
51
Wolmerath/Esser, AiB 2000, S. 390.
52
Siehe Anhang Punkt 1b) Der Katalog der 100+... Mobbinghandlungen nach Esser/Wolmerath.
Mobbing verstehen
12
Personalräten"
53
zehn Kategorien von Mobbinghandlungen unterschieden.
Hierbei handelt es sich um:
54
1.
Angriffe gegen die Arbeitsleistung und das Leistungsvermögen
2.
Angriffe gegen den Bestand des Beschäftigungsverhältnisses
3.
Destruktive Kritik
4.
Angriffe gegen die soziale Integration am Arbeitsplatz
5.
Angriffe auf das soziale Ansehen im Beruf
6.
Angriffe gegen das Selbstwertgefühl
7.
Angst, Schreck und Ekel erzeugen
8.
Angriffe gegen die Privatsphäre
9.
Angriffe gegen die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit
10. Versagen von Hilfe
Laut E
SSER
/W
OLMERATH
soll dieser Katalog der 100+... Mobbinghandlungen vor
allem ,,als Werkzeug zur Analyse von Mobbing"
55
dienen.
Im konkreten Fall können feindselige Handlungen und Unterlassungen von
Mobbingbetroffenen und deren Mobbingberatern systematisch zusammengestellt
werden und als Beweismaterial gegenüber Kollegen, Betriebs- und Personalrat,
Vorgesetzten, Geschäftsleitung und Gerichten dienen.
56
Jedoch muss an dieser
Stelle nochmals darauf verwiesen werden, dass einzelne destruktive
Mobbinghandlungen zunächst nur ein Indiz für Mobbing sind.
57
Um von Mobbing
als Geschehensprozess sprechen zu können, sind die in der Definition in Kapitel
2.1 angesprochenen Elemente im Einzelfall stets zu prüfen.
Auch der von E
SSER
/W
OLMERATH
erarbeitete Katalog der Mobbinghandlungen
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einerseits, weil die Phantasie beim
Erfinden von Schikanen keine Grenzen kennt, andererseits, weil sich durch
stetigen
Wandel betrieblicher Verhältnisse immer andere bzw. neue
Mobbinghandlungen und Angriffsmöglichkeiten entwickeln.
58
53
Esser/Wolmerath 2003, S. 29.
54
Vgl. Esser/Wolmerath 2003, S. 25 ff.;Wolmerath/Esser, AiB 2000, S. 389.
55
Esser/Wolmerath 2003, S. 29.
56
Vgl. Esser/Wolmerath 2003, S. 30.
57
Esser/Wolmerath 2003, S. 30.
58
Vgl. Esser/Wolmerath 2003, S. 31.
Mobbing verstehen
13
2.4
Der Verlauf von Mobbing
Mobbing tritt nach h.M nicht plötzlich auf, sondern kann als schleichender,
langwieriger Prozess betrachtet werden, in dem sich aus einem anfangs harmlosen
Konflikt schwerwiegende Folgen entwickeln. L
EYMANN
hat diesen schleichenden
Geschehensprozess des Mobbing aufgrund umfangreicher Untersuchungen in fünf
Phasen unterteilt.
59
Am Anfang eines klassischen Mobbingverlaufs stehen meist
ungelöste Konflikte bzw. einzelne Unstimmigkeiten, aus denen zunächst
Schuldzuweisungen und vereinzelt persönliche Angriffe gegen eine bestimmte
Person resultieren.
60
Diese Differenzen weiten sich im Verlauf zur
systematischen, gezielten Schikane gegen diese Person aus.
61
Der Betroffene wird
zunehmend isoliert und ausgegrenzt. Seine Rolle als Sündenbock festigt sich mehr
und mehr und er reagiert im Zeitablauf mit typischen psychosomatischen
Symptomen, wie beispielsweise depressiven Verstimmungen oder Magen- und
Darmstörungen, die durch Stress und Ängste ausgelöst werden. Das Mobbing-
opfer ist durch die ständigen Demütigungen verunsichert, so dass seine Arbeit
erheblich darunter leidet und er als zunehmend ,,problematisch" gilt.
62
Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die offiziellen Stellen des Betriebes nicht um
die destruktive Situation gekümmert. Nun, da bereits Arbeitsabläufe negativ von
den Mobbingvorgängen beeinflusst sind, versucht die Personalführung durch
arbeitsrechtliche Sanktionen, wie beispielsweise Abmahnungen, Versetzungen
und Degradierungen gegenüber dem vermeintlichen Störenfried, der Situation
Herr zu werden.
63
Zumeist kommt es hier zu gravierenden Fehlentscheidungen,
weil zu diesem Zeitpunkt nach außen nicht mehr erkennbar ist, ,,wer oder was
Auslöser des Mobbing war, wer zu den `Tätern´ gehört und wer unfreiwillig zum
`Opfer´ geworden ist"
64
. Diese oft einseitigen Interventionen des Managements in
den Mobbingprozess verschlechtern die Lage des Schikanierten nachhaltig.
65
Die Betroffenen reagieren auf die ungerechtfertigten Beschuldigungen und neuen
Ungerechtigkeiten ihrer Umwelt (z.B. Abmahnung) mit dem Gefühl der
59
Vgl. Leymann 1995, S. 20; Leymann 2002, S. 57 ff.; Resch 1994, S. 107 ff.
60
Vgl. Holzbecher/Meschkutat 1998, S. 11; Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 53 f.
61
Vgl. Holzbecher/Meschkutat 1998, S. 11; Wolmerath 2001, S. 30 f.
62
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 53 f.
63
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 53 f.; Schild/Heeren 2003, S. 19.
64
Holzbecher/Meschkutat 1998, S. 11.
65
Vgl. Schild/Heeren 2003, S. 19.
Mobbing verstehen
14
Ohnmacht oder gar aggressiven Abwehrreaktionen.
66
Aufgrund der immer stärker
werdenden psychischen und physischen Belastungen kommt es zu ersten
krankheitsbedingten Fehlzeiten. Ärzte und Therapeuten sind mit dieser Situation
oft überfordert und es kommt nicht selten zu Falschdiagnosen, die die Situation
weiter verschlimmern.
67
Das Mobbingopfer ist den beruflichen und sozialen
Anforderungen nicht mehr gewachsen. Schwächen, die bislang nur unterstellt
wurden, sind nun tatsächlich als Folge der Mobbingattacken beobachtbar. In der
überwiegenden Anzahl der Fälle folgen nun Abschiebung und Kaltstellung,
Frührente, langfristige Krankschreibung, Versetzung, Abfindung oder in
besonderen Härtefällen die Einweisung in die Psychiatrie.
68
Obwohl dieser klassische Mobbingverlauf immer wieder auftritt, beansprucht das
geschilderte Entwicklungsmuster, keine Allgemeingültigkeit.
69
Trotz dieser häufig
vorfindbaren Systematik hat jeder Mobbingfall seine ,,eigene Geschichte und
seinen höchst individuellen Verlauf"
70
. Es ist durchaus möglich, dass einzelne
Phasen übersprungen, und der Mobbingprozess unterbrochen oder gestoppt
werden kann.
71
Dies kann beispielsweise durch ein klärendes Gespräch oder
konsequentes Eingreifen der Verantwortlichen erfolgen. Dem Arbeitgeber und der
betrieblichen Interessenvertretung (Betriebsrat) stehen vielfältige rechtliche
Interventions- und Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen Mobbing zur
Verfügung, die möglichst frühzeitig und umfassend genutzt werden müssen.
Entsprechende rechtliche Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung bei
der Mobbingprävention und intervention werden in Kapitel 3 und 4 ausführlich
erläutert.
66
Vgl. Resch 1994, S. 110 ff.
67
Vgl. Wolmerath 2001, S. 30 f.
68
Vgl. Wolmerath 2001, S. 30 f.
69
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 53.
70
Wolmerath/Esser, AiB 2000, S. 390.
71
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 53.
Mobbing verstehen
15
2.5
Wer sind die Beteiligten?
Prinzipiell können alle, die am Arbeitsplatz miteinander in Kontakt stehen, am
Mobbingprozess beteiligt sein. Mobbing findet auf allen Hierarchieebenen
72
des
Betriebs statt und kann auch in allen Branchen und Betriebsarten auftreten
73
.
Der aktuelle ,,Mobbing-Report"
74
, eine Repräsentativstudie für die Bundes-
republik Deutschland aus dem Jahr 2002, zeigt, dass aktuell drei von 100 Be-
schäftigten systematisch schikaniert werden. Bei einer Erwerbstätigenzahl von ca.
37 Millionen sind also ca. eine Million Menschen betroffen. Addiert man hierzu
die Mobbingopfer der Vergangenheit, so wird deutlich, dass 11,3 % aller
Erwerbstätigen von Mobbing betroffen sind oder schon einmal von Mobbing
betroffen waren.
75
Bei der Frage, von wem die Mobbingbetroffenen gemobbt
wurden, ergibt sich die folgende Verteilung:
38,2%
12,8%
22,3%
20,1%
2,3%
4,2%
0,0%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
nur Vorgesetzte
Vorgesetzte und Kollegen
nur ein Kollege
Gruppe Kollegen
nur "Untergebene"
weiß nicht/keine Angabe
Abbildung 1:
Hierarchische Position der Mobber
(Quelle: M
ESCHKUTAT
/S
TACKELBECK
/L
ANGENHOFF
2000, S. 65)
72
Vgl. Leymann 2002, S. 47 f.
73
Nach Leymann 2002, S. 86 f., können Mobbingfälle in allen Branchen und Betriebsarten
auftreten. Tendenziell liegt jedoch die Zahl der Mobbingopfer im öffentlichen Dienst und im
Verwaltungsbereich höher als in der Wirtschaft. Auch sind große Unternehmen bzw.
Verwaltungen mit stark hierarchischen Strukturen oft so unübersichtlich, dass Mobbing-
handlungen nicht rechtzeitig erkannt werden können. Brommer 1995, S. 26, geht zudem davon
aus, dass in Wirtschaftbetrieben viel schneller in innerbetriebliche Konflikte eingegriffen wird, da
hier oftmals Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen.
74
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002.
75
Vgl. Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff 2002, S. 24.
Mobbing verstehen
16
Die Wahrscheinlichkeit, von Vorgesetzen gemobbt zu werden, ist also ebenso
hoch, wie die Wahrscheinlichkeit des Mobbing durch Kollegen. Die Hauptursache
des ,,Vorgesetztenmobbings" ist die ,,potentielle Konkurrenz um die eigene oder
eine höhere Position, die vorsorglich beseitigt werden soll"
76
.
2.6
Ursachen und Folgen
2.6.1
Ursachen
Die Motive, die dazu führen, dass man Arbeitskollegen systematisch verleumdet,
schikaniert und drangsaliert, sind sehr vielfältig und in einem ,,komplexen
Geflecht von persönlichen Beziehungen und institutionellen Rahmen-
bedingungen" nicht immer leicht zu lokalisieren.
77
Betriebsratsmitglieder sehen mögliche Ursachen für Mobbing vor allem in der seit
Jahren ständig wachsenden Angst um den Arbeitsplatz, die durch die angespannte
Situation auf dem Arbeitsmarkt verursacht wird.
78
Die Erhaltung des eigenen
Arbeitsplatzes ist für viele Arbeitnehmer zu einem täglichen Überlebens- bzw.
Existenzsicherungskampf geworden.
Neue Managementstrategien und
Arbeitsstrukturen bringen den Abbau von Stellen mit sich und führen bei den
verbleibenden Beschäftigten zu einer Arbeitsverdichtung und zu einem erhöhten
Leistungsdruck.
79
Antipathien gegen einen Kollegen, einzelne Unstimmigkeiten,
Neid, eigene Misserfolge oder Frustrationen können außerdem Auslöser für die
Entstehung von Mobbing sein.
80
Damit sich Mobbing ausbreiten kann, bedarf es
aber auch eines günstigen, mobbingfördernden Umfeldes im Betrieb.
81
76
Philipsenburg 2001, S. 19.
77
Vgl. Holzbecher/Meschkutat 1998, S. 22.
78
Vgl. Wolmerath 2000, S. 33 f.
79
Vgl. Wolmerath 2000, S. 33 f.; Wolmerath 2001, S. 41 f.
80
Vgl. BAUA 2003, S. 17 f.
81
Vgl. BAUA 2003, S. 17.
Mobbing verstehen
17
Betriebliche Auslöser von Mobbing, sieht L
EYMANN
vor allem in einer schlechten
Arbeitsorganisation
82
, mangelhafter Gestaltung
83
sowie Leitung
84
der Arbeit.
85
Obwohl die Ursachen für Mobbing stets vom konkreten Einzelfall abhängig sind
und einem stetigen Wandel unterliegen, will die folgende Übersicht von
W
OLMERATH
einen umfangreichen und verlässlichen Überblick über mögliche
Ursachen für Mobbing bieten.
86
Abbildung 2:
Mögliche Ursachen für Mobbing
(Quelle: W
OLMERATH
2000, S. 35)
82
Die BAUA 2003, S. 17, versteht unter einer schlechten Arbeitsorganisation: wenn Abläufe
schlecht organisiert sind, wenn Personalmangel die Regel ist und immer weniger Beschäftigte die
gleiche oder mehr Arbeit bewältigen müssen. Dann werden Überforderung, Leistungsdruck und
Stress zum ständigen Begleiter der Beschäftigten. In einer solch angespannten Atmosphäre wird
bei Fehlern gern ein Sündenbock gesucht.
83
Wenn die Arbeit schlecht gestaltet ist, wenn also die Beschäftigten ihre Qualifikationen nicht
einbringen können, die Arbeit monoton und langweilig ist, dann steigt die Gefahr, dass sich die
Beschäftigten eine Abwechslung suchen und aus Frust oder Langeweile, so die BAUA 2003, S.
18, mobben.
84
Hierbei spielt der Führungsstil des Vorgesetzen eine wichtige Rolle. Oft zeigen sich Defizite im
Führungsverhalten, beispielsweise aufgrund mangelnder sozialer Kompetenzen.
85
Vgl. Leymann 2002, S. 131 ff.
86
Vgl. Wolmerath 2000, S. 34 f.
1. Ursachen in den Rahmenbedingungen
- Über- oder Unterforderung
- Fehler im Führungsverhalten
- äußere Arbeitsbedingungen
- schlechtes Betriebsklima
- soziale Normen
- mangelnde Arbeitsorganisation
- unklare Kompetenzregelungen
- Angst um den Arbeitsplatz
- arbeitsrechtliche Bestimmungen
2. Ursachen im sozialen System
- soziale Zusammensetzung der Gruppe
- Neid
- Gruppendruck
- Feindseligkeit
- Missgunst
- Sündenbocksyndrom
3. Ursachen im persönlichen System
- moralisches Niveau
- Stigmatisierbarkeit
- soziale Kompetenz
- Stabilität der Persönlichkeit
- Qualifikation
4. Ursachen im Täter
- Überforderung/Selbstwertprobleme
- persönliche Ziele und Motive
- soziopathische Persönlichkeit
- mögliche Ängste
5. Ursachen im Opfer
- wenig soziale Kompetenz
- soziopathische Persönlichkeit
- Krankheiten
- Leistungsprobleme
- äußere Erscheinung
Mobbing verstehen
18
Zusammenfassend kann man sagen, dass es keine monokausale Erklärung für die
Entstehung von Mobbingprozessen gibt. Meist ist das Geschehen im Betrieb
abhängig von allen Komponenten im Interaktionssystem Arbeitsplatz. Um
wirkungsvoll gegen Mobbing vorgehen zu können, ist im ersten Schritt eine
gründliche und kritische Analyse der im Betrieb vorherrschenden
Arbeitsbedingungen, der Unternehmenskultur und des Führungsstils
erforderlich,
87
da die arbeitsorganisatorische Gestaltung ein wichtiger Faktor bei
der Entstehung von Mobbing darstellt. Mobbing kann sich nur etablieren, wenn es
geduldet wird und Kommunikationsprobleme in der Belegschaft sowie
organisatorische Mängel ignoriert werden.
88
Aus diesem Grund sollten Arbeit-
geber und Betriebsrat bestrebt sein, die Ursachen für Mobbing in ihrem Betrieb zu
lokalisieren, um anschließend ,,geeignete Maßnahmen zur Ursachenbewältigung
ergreifen zu können".
89
2.6.2
Folgen
Das Phänomen Mobbing, hat nicht nur zahlreiche Ursachen, sondern ebenso
vielfältige Auswirkungen. Neben gravierenden persönlichen Folgen für die
Betroffenen ergeben sich auch negative Folgen für den betrieblichen,
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlich-ethischen Bereich.
90
Individuelle Folgen
Der Psychoterror am Arbeitsplatz kann für den Einzelnen neben dem Ausschluss
aus dem beruflichen Wirkungskreis auch dauerhaft gesundheitliche Schäden zur
Folge haben. 90 % aller Gemobbten, so die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, klagen nach oder während des Mobbingprozesses über
körperliche und psychosomatische sowie psychische Beschwerden.
91
Herz- und
Kreislauferkrankungen, Magen- und Darmbeschwerden, Störungen der psy-
chischen Funktionen wie beispielsweise Depressionen, Konzentrationsstörungen,
87
Vgl. Arbeitskammer des Saarlandes 2003, S. 2.
88
Laut BAUA 2003, S. 19, sind Firmen, die der Personalentwicklung und pflege wenig Auf-
merksamkeit widmen und schlechte Arbeitsbedingungen bieten, überdurchschnittlich von
Mobbing betroffen.
89
Esser/Wolmerath 2003, S. 42.
90
Vgl. Hartmann , AuA 2003, S. 10.
91
Vgl. BAUA 2003, S. 22; Kollmer 2003, S. 28.
Mobbing verstehen
19
Überempfindlichkeiten, mangelnder Antrieb und Angstzustände sind typische
Mobbingfolgen.
92
Um Angstzustände zu mindern und das Leid erträglicher zu
machen, steigt die Bereitschaft von Mobbingbetroffenen, zu Suchtmitteln wie
Alkohol und Medikamenten zu greifen.
93
Neben diesen gravierenden gesundheitlichen Folgen wirkt sich die
Mobbingsituation des Betroffenen natürlich auch negativ auf sein soziales Umfeld
aus. Familie, Freunde und Bekannte leiden erheblich unter diesem Zustand.
94
Fortgeschrittene Mobbingfälle enden fast immer mit dem Ausschluss aus dem
Arbeitsleben. Selbstmord bzw. der Selbstmordversuch stellt für viele Betroffene
oft die letzte Möglichkeit dar, ihrer ausweglos erscheinenden Situation zu
entrinnen.
95
Nach K
RATZ
können 20 % der Selbstmorde in Deutschland auf
Mobbingaktivitäten zurückgeführt werden.
96
Wirtschaftliche Folgen
Abgesehen von den tragischen individuellen Folgen für die Mobbingbetroffenen
soll im Folgenden gezeigt werden, dass sich auch kein Unternehmen und keine
Volkswirtschaft Mobbing leisten kann.
97
Betriebswirtschaftliche Folgen
Mobbing hat auch für das Unternehmen gravierende Folgen. Nach B
RINKMANN
werden die psychischen Energien der Beteiligten gebunden und können so nicht
im vollen Maße zur betrieblichen Zielerreichung genutzt werden.
98
Beispielsweise
können häufige krankheitsbedingte Fehltage der Gemobbten zu
Produktionsstörungen und Mehrkosten für den Betrieb führen. Weiterhin sinkt
durch den ständigen psychischen Terror die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter,
woraus wiederum eine geringere Leistungsmotivation bzw. bereitschaft
resultiert, die sich in einer niedrigen Produktivität niederschlägt.
99
Die Folgen sind
92
Vgl. Resch 1994, S. 121 ff.; Kollmer 2003, S. 27 f.
93
Vgl. Resch 1994, S. 122.
94
Vgl. Kollmer 2003, S. 28.
95
Vgl. Resch 1994, S. 120 ff.
96
Vgl. Kratz 2003, S. 7.
97
Vgl. BAUA 2003, S. 22.
98
Vgl. Brinkmann 2002, S. 167.
99
Vgl. Hartmann, AuA 2003, S. 10; BAUA 2003, S. 21 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832485450
- ISBN (Paperback)
- 9783838685458
- DOI
- 10.3239/9783832485450
- Dateigröße
- 743 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg – Fakultät Sozial- Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- mobbinghandlung betreibsverfassungsgesetz handlungsmöglichkeit anti-mobbing betriebsvereinbarung
- Produktsicherheit
- Diplom.de