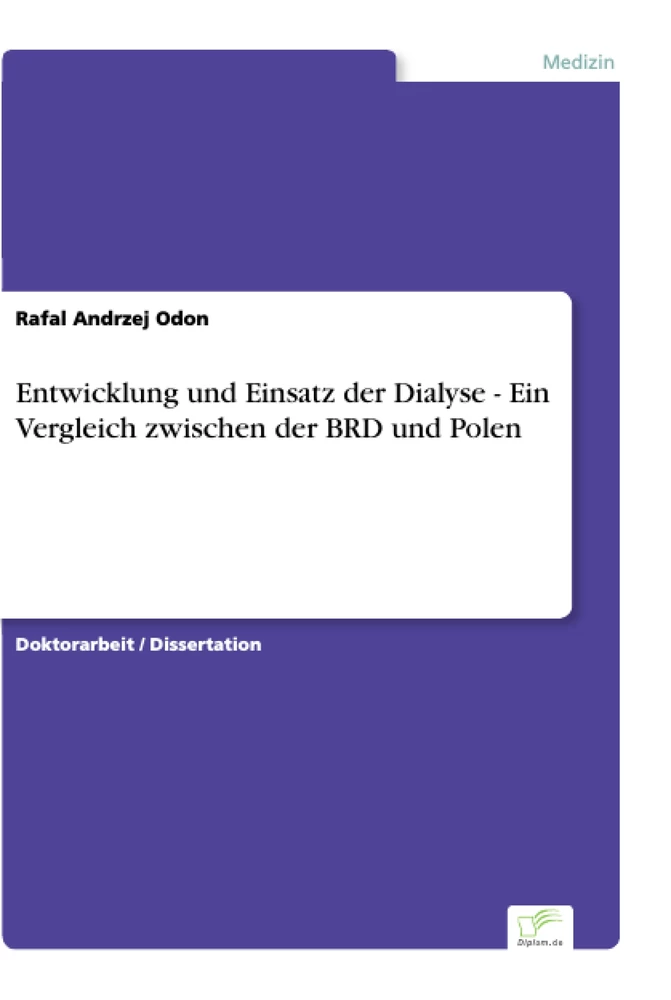Entwicklung und Einsatz der Dialyse - Ein Vergleich zwischen der BRD und Polen
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit ist also der Vergleich der historischen Entwicklung der Dialyse in zwei benachbarten Ländern - Deutschland und Polen, in der Zeitspanne von den Anfängen der Dialyse bis zum Jahre 1980. Der Vergleich der Dialyseentwicklung fällt in die Zeit, wo beide Länder in verschiedenen gesellschaftlich-politischen Systemen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen verortet waren, was eine interessante Fragestellung ergibt. Die zeitliche Grenze im Jahre 1980 schien mir deshalb angebracht zu sein, weil die Dialyse zu diesem Zeitpunkt sich in beiden Ländern auf fortgeschrittenem Niveau befand und ganz verbreitet war.
Die Entwicklung der Dialyse in der ehemaligen DDR, wie auch in den anderen sozialistischen Ländern wurde nicht in die Untersuchung mit einbezogen, da es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.
Im einleitendem Teil (I.) meiner Arbeit im 2. Kapitel in der Einleitung wird der Begriff der Dialyse erklärt und erläutert, worin die dialytische Trennung besteht und wie sie in der Medizin gebraucht wird.
Das 3. Kapitel Vorgeschichte der Dialyse greift dagegen in die weite Vergangenheit zurück und erläutert, wie, wann und von wem die Grundlagen zum Einsatz der Dialyse in der Medizin geschaffen wurden, also wie die Dialyse als Methode entdeckt wurde.
Der Hauptteil meiner Arbeit gliedert sich in zwei Teile: der erste befasst sich mit der Entwicklung und dem Einsatz der Dialyse in der BRD, der zweite behandelt die Entwicklung und Anwendung der Dialyse in Polen.
Kapitel 6 und 7 beinhalten den Vergleich der Entwicklung der Dialyse in der BRD und Polen. Kapitel 6 - Statistischer Vergleich enthält eine Darstellung der Statistiken, die sich auf die Dialyse beziehen, einschließlich des Versuchs entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das 7. Kapitel Zusammenfassung dient der Zusammenstellung der Erkenntnisse über die Entwicklung der Dialyse, dabei werden die Ergebnisse meiner Arbeit rekapituliert. Dieses Kapitel enthält eine Tabelle, die die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs in übersichtlicher Form darstellt.
In der Geschichte der Entwicklung der Dialyse gab es drei Methoden des Dialyseverfahrens: Intestinaldialyse, Peritonealdialyse und Hämodialyse, wobei sich bis heute nur die zwei letzten durchgesetzt haben.
In der Intestinaldialyse versuchte man durch die Darmwandschleimhaut zu dialysieren.
In der Peritonealdialyse wird ein Katheter in die Bauchhöhle eingeführt und das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung
- 1. Ziel der Arbeit und Methoden
- 2. Einleitung
- 3. Vorgeschichte der Dialyse
- 3.1 Von den Anfängen bis zur Entdeckung der dialytischen Trennung
- 3.2 Die ersten Versuche der Hämodialyse im Tierversuch
- 3.3 Untersuchungen über die Dialyse, die zur Entdeckung der Peritonealdialyse beigetragen haben
II. Hauptteil
4 . Entwicklung und klinische Anwendung der Dialyse
in der BRD
- 4.1 Intestinaldialyse und andere historische Dialyseverfahren
- 4.2 Peritonealdialyse
- 4.3 Hämodialyse
- 4.3.1 Diskussion über die Hämodialyse in den 50er Jahren in Deutschland
- 4.3.2 Weitere technische Entwicklung
- 4.3.3 Heimdialyse
- 4.3.4 Dialyse im Kinderalter
- 4.3.5 Ein grundlegendes Problem: der Gefäßzugang
- 4.3.6 Bedarf und Umfang des Therapieangebots
- 4.3.7 Komplikationen, welche die Dialyse begleitet haben
- 4.3.8 Andere gegenwärtige Urämiebehandlungsverfahren
- 4.3.9 Statistische Auswertung der Fachliteratur von 1965-1984 nach Themenschwerpunkten
- 4.3.10 Hämodialyse in Bezug auf den Patienten
- 4.3.10.1 Die ethische Dimension – das Patientenauswahlverfahren
- 4.3.10.2 Der Dialysepatient
- 4.3.11 Hämodialyse und was weiter ... ???
5 . Entwicklung und klinische Anwendung der Dialyse in Polen
-5.1 Vorbemerkung
-5.2 Hämodialyse in Polen
-5.2.1 Technische Ausstattung
-5.2.2 Indikationen
-5.2.3 Shunt
-5.2.4 Dialyse von Kindern
-5.2.5.1 Die Psyche
-5.2.5.2 Fallberichte
-5.2.6 Ausstattung der Dialysezentren
-5.3 Andere Methoden der Dialyse in Polen
-5.3.1 Lymphdialyse
-5.3.2 Intestinaldialyse
-5.3.3 Peritonealdialyse
III. Ergebnisse
6 . Statistischer Vergleich
-6.1 Kommentar zu den statistischen Daten
7 . Zusammenfassung
IV. Literaturverzeichnis
V. Abkürzungenverzeichnis
VI. Curriculum vitae
I. Einführung
1 . Ziel der Arbeit und Methoden
Zur Entstehung dieser Arbeit hat die Partnerschaft zwischen den Universitäten in Gießen und in Łódź beigetragen. Als Austauschstudent habe ich in Gießen ein Jahr lang Humanmedizin studiert. Im Rahmen der medizinhistorischen Arbeit hat sich angeboten, eine Vergleichsstudie zwischen beiden Ländern zu machen. Zu dieser Zeit bekam ich von Frau PD Dr. phil. I. Sahmland ein Buch von H. Bach unter dem Titel: „Die Entwicklung der künstlichen Niere aus Hydrodiffusion und Hämodialyse - von J. A. Nollet bis G. Haas- Der Ursprung des ersten künstlichen Organs“[2]. Aus dem Buch erfuhr ich, wie es zur Entdeckung des Dialyseverfahrens, zur Erfindung des ersten Dialysators und schließlich zur Durchführung der ersten Hämodialyse am Menschen gekommen ist. Diese Lektüre gab den Anstoß, den geschichtlichen Verlauf der Entwicklung der Hämodialyse und der Dialysen überhaupt in der BRD weiter zu verfolgen. Meine Suche nach Studien, die sich mit dem Thema der Dialyseentwicklung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den weiteren Jahren befasst hätten, blieb nahezu ergebnislos. Ich stieß lediglich auf die Dissertation von W. Zenker “Die Entwicklungsgeschichte der extra-korporalen Hämodialyse von den Anfängen bis zur Routinetherapie in der Inneren Medizin“[3], die sich aber vor allem auf die Entwicklung der Dialyse in Holland bezog und auf den Vater der niederländischen Hämodialyse – Kolff orientiert war. Die BRD wurde in dieser Arbeit nicht mitbehandelt.
Ich nahm mir also vor, die Materialien zur Entwicklung und zum Einsatz der Dialyse in der BRD in verschiedenen literarischen Quellen zu finden, um sie später auszuwerten und eine Vergleichsarbeit in Bezug auf Deutschland und Polen schreiben zu können.
Wie es sich später zu meiner Überraschung herausstellte, galt es besonders für Polen Pionierarbeit zu leisten, da diese Thematik in ihrer historischen Entwicklung auch im Ansatz überhaupt noch nicht aufgearbeitet wurde.
Das Ziel dieser Arbeit ist also der Vergleich der historischen Entwicklung der Dialyse in zwei benachbarten Ländern - Deutschland und Polen, in der Zeitspanne von den Anfängen der Dialyse bis zum Jahre 1980. Der Vergleich der Dialyseentwicklung fällt in die Zeit, wo beide Länder in verschiedenen gesellschaftlich-politischen Systemen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen verortet waren, was eine interessante Fragestellung ergibt. Die zeitliche Grenze im Jahre 1980 schien mir deshalb angebracht zu sein, weil die Dialyse zu diesem Zeitpunkt sich in beiden Ländern auf fortgeschrittenem Niveau befand und ganz verbreitet war.
Die Entwicklung der Dialyse in der ehemaligen DDR, wie auch in den anderen sozialistischen Ländern wurde nicht in die Untersuchung mit einbezogen, da es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.
Im einleitendem Teil (I.) meiner Arbeit – im 2. Kapitel – in der „Einleitung“ wird der Begriff der Dialyse erklärt und erläutert, worin die dialytische Trennung besteht und wie sie in der Medizin gebraucht wird.
Das 3. Kapitel – „Vorgeschichte der Dialyse“ greift dagegen in die weite Vergangenheit zurück und erläutert, wie, wann und von wem die Grundlagen zum Einsatz der Dialyse in der Medizin geschaffen wurden, also wie die Dialyse als Methode entdeckt wurde.
Der Hauptteil meiner Arbeit gliedert sich in zwei Teile: der erste befasst sich mit der Entwicklung und dem Einsatz der Dialyse in der BRD, der zweite behandelt die Entwicklung und Anwendung der Dialyse in Polen.
Kapitel 6 und 7 beinhalten den Vergleich der Entwicklung der Dialyse in der BRD und Polen.
Kapitel 6 - „Statistischer Vergleich“ enthält eine Darstellung der Statistiken, die sich auf die Dialyse beziehen, einschließlich des Versuchs entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das 7. Kapitel „Zusammenfassung“ dient der Zusammenstellung der Erkenntnisse über die Entwicklung der Dialyse, dabei werden die Ergebnisse meiner Arbeit rekapituliert.
Dieses Kapitel enthält eine Tabelle, die die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs in übersichtlicher Form darstellt.
Die Informationen zu meinem Elaborat habe ich aus der medizinischen Fachliteratur gewonnen, indem ich die wichtigsten medizinischen Zeitschriften nach den Daten bezüglich der Dialyse in der mich interessierenden Zeitspanne durchsucht habe. In dem ersten Teil meiner Arbeit habe ich unter anderem folgende Zeitschriften benutzt: „Deutsche Medizinische Wochenschrift“, „Medizinische Welt“, „Münchener Medizinische Wochenschrift“.
Für Deutschland sind außer der Studie von Bach folgende weitere Arbeiten zur Geschichte der Dialyse zu nennen: Zenker (1990), Schmied (1988) und Siebert (2000).
In dem zweiten Teil habe ich die Auskünfte dagegen unter anderem aus: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej“, „Polski Tygodnik Lekarski“, „Wiadomości Lekarskie” und „Przegląd Lekarski” gewonnen.
Die Materialien zum ersten Teil meiner Arbeit habe ich ein Jahr lang in Deutschland gesammelt und zum zweiten Teil im darauf folgenden Jahr in Polen.
Darüber hinaus habe ich die Informationen auch durch die Kontaktaufnahme mit verschiedenen Institutionen (hier vor allem die statistischen Daten): Statistisches Bundesamt, Bundesgesundheitsministerium, Marienkrankenhaus in Hamburg, Kuratorium für Hämodialyse und Dialysepatienten Deutschlands erhalten.
2 . Einleitung
Diese Arbeit handelt von der Dialyse, für die auch als Bezeichnung „Blutwaschung” oder „Blutwäsche“ verwendet wird.
Der Begriff „Dialyse“ stammt von dem griechischen Wort - „dialyso“, was bedeutet – „ich trenne“.
Dialyse ist nichts anderes, als ein Vorgang der Separierung in der Lösung mittels Diffusion durch eine semipermeable Membran, wobei diese Membran in der medizinischen Anwendung entweder das Peritoneum des Patienten oder z. B. Zellophan in einem Dialysator sein kann. Im ersten Fall handelt es sich um die Peritonealdialyse, im zweiten dagegen um die Hämodialyse.
Die beiden Arten der Dialyse entwickelten sich nebeneinander und sind bis heute erhalten geblieben.
Beide Verfahren folgen auch demselben Prinzip: im Blut gelöste schädliche Substanzen des Stoffwechsels wie z. B. Harnstoff, Kreatinin oder Harnsäure werden durch eine Austauschmembran in eine wässerige Lösung abgeschieden und auf diese Weise aus dem Organismus entfernt.
Das alles vollzieht sich mittels selektiver Diffusion.
Die Selektivität erreicht man durch entsprechende Membraneigenschaften, die so gewählt werden, dass den bestimmten Stoffen Durchtritt gewährt wird, während andere Substanzen von der Membran zurückgehalten werden.
Diffusion wird bezeichnet als Bewegung von Molekülen, Atomen und Ionen vom Ort höherer zum Ort niedrigerer Konzentration. Der Diffusionsvorgang endet, wenn die Partikel, die der Diffusion unterzogen wurden, in dem verfügbaren Raum gleichmäßig verteilt sind- also überall die gleiche Konzentration erreichen.
Die Ursache der Diffusion erklärt die Brown`sche Theorie, nach der die Moleküle sich in stetiger Bewegung befinden.
Gemäß dem Fick`schen Diffusionsgesetz hängt die pro Zeiteinheit transportierte Substanzmenge von dem Diffusionskoeffzienten, der Austauschfläche, dem Konzentrationsgefälle und der Diffusionsstrecke ab[4]. Georg Haas (1886-1971), der als erster die Hämodialyse am Menschen durchgeführt hat[5], definiert Dialyse mit folgenden Worten:
„Das Prinzip der physikalischen Blutwaschung besteht darin, dass das strömende Blut an Membranen vorbeifließt, die für rote Blutkörperchen und Eiweißstoffe undurchlässig sind, während sie den harnfähigen Stoffen und allen kristalloiden Substanzen den Durchtritt gewähren. Da die Membranen sich innerhalb einer isotonischen und äquilibrierten Salzlösung befinden, so ist eine Abwanderung der Mineralbestandteile des Blutes nicht möglich, im Gegensatz zu den Stoffwechsel-produkten, die, zumal wenn sie eine krankhafte Erhöhung im Blute aufweisen, in mehr oder weniger großer Menge, entsprechend dem osmotischen Gefälle, in die umgebende Salzlösung übertreten.”[6]
“Das osmotische Gefälle” bezieht sich hier auf den verschiedenen osmotischen Druck an beiden Seiten der Membran, der von der Zahl der Moleküle oder Ionen abhängig ist. Eine größere Menge von Molekülen z. B. des Harnstoffes im Blut als in der Dialysierflüssigkeit geht mit dem höheren osmotischen Druck an dieser Seite der Membran einher. Weil die Membran für den Harnstoff durchlässig ist, kann der Überschuss von Molekülen mittels der Diffusion ins Dialysat übertreten, wodurch der osmotische Druck wieder ausgeglichen und das osmotische Gefälle aufgehoben wird.
Wäre aber die semipermeable Membran für den Harnstoff undurchlässig, müsste es zum Ausgleich des osmotischen Druckes kommen, indem entweder die Moleküle oder Ionen der anderen im Blut vorhandenen Substanzen durch die Membran in die Dialysierflüssigkeit übertreten würden, (vorausgesetzt, dass die Membran für sie durchlässig wäre), oder das Wasser (als Lösungsmittel) vom Ort der niedrigeren Harnstoffkonzentration (in diesem Fall Dialysat) in Richtung auf die höher konzentrierte Lösung (in diesem Fall Blut) übertreten würde.
Dieses Phänomen nennen wir Osmose.
Weil sich im Blut osmotisch aktive, aber durch die Membran undurchlässige Stoffe befinden, muss die Osmose in der Dialyse unbedingt in Betracht gezogen werden.
Dasselbe betrifft Filtrationsprozesse, die auch von Bedeutung sind. Diese hängen mit dem hydrostatischen Druck zusammen, durch den die Flüssigkeit in Richtung des Druckgradienten durch die Membran gepresst wird, bis Druckausgleich eingetreten ist. Alle Substanzen, deren entsprechende molekulare Größe die Poren der Membran zu passieren ermöglicht, folgen unabhängig von ihrer Konzentration dem Strom des Lösungsmittels. Nur nicht durchtrittfähige Stoffe werden zurückgehalten.
Daraus ergibt sich, dass während der Dialyse die drei Prozesse: Diffusion, Osmose und Filtration fortdauernd und zusammen stattfinden. Der Endeffekt ist also Ergebnis ihres Zusammenwirkens.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Das Prinzip der Hämodialyse[7]
In der Geschichte der Entwicklung der Dialyse gab es drei Methoden des Dialyseverfahrens: Intestinaldialyse, Peritonealdialyse und Hämodialyse, wobei sich bis heute nur die zwei letzten durchgesetzt haben.
In der Intestinaldialyse versuchte man durch die Darmwandschleimhaut zu dialysieren.
In der Peritonealdialyse wird ein Katheter in die Bauchhöhle eingeführt und das Peritoneum mit der Dialysierflüssigkeit gespült. Die Lösung verweilt dort eine gewisse Zeit, bis sie ausgetauscht wird. Die Behandlung dauert länger als Hämodialyse.
Während der Hämodialyse dagegen wird das Blut des Patienten in einen aus der semipermeablen Membran angefertigten Schlauch geleitet, der in einem Gefäß mit der Dialysierflüssigkeit eingetaucht ist. Das Blut wird aus der Arterie (z. B. Arteria radialis) abgenommen, und nach dem Dialysieren in die Vene (z. B. Vena cephalica) zurückgeführt. Heute werden zu diesem Zweck arteriovenöse Shunts oder subkutane arteriovenöse Fisteln verwendet.
Die Indikationen für die beiden Arten der Dialyse sind ähnlich. Bei den meisten Patienten sind beide Arten wirksam. Ausnahmen, bei denen die Peritonealdialyse weniger wünschenswert ist, sind Patienten mit verminderter Durchlässigkeit der Peritonealmembran, was bei der systemischen Sklerose der Fall ist, oder auch solche, bei denen die Schnelligkeit dieses langsameren Verfahrens bei akutem Krankheitszustand unzureichend ist.
Bei Blutgerinnungsstörungen ist die Peritonealdialyse zu bevorzugen, um gerinnungshemmende Mittel zu vermeiden, welche die Blutungsneigung noch vergrößern.
Die Dialyse ist notwendig, wenn beim chronischen Nierenversagen die GFR unter 5-8 ml/Min. sinkt. Viele Zentren beginnen mit der Dialyse, wenn der Patient nicht länger seinen gewohnten Aktivitäten nachgehen kann. Intoxikationen mit verschiedenen Giftsubstanzen sind auch oft eine Indikation für die Dialyse.
Eine “Akutindikation” für die Dialyse stellen auf jeden Fall die Symptome der Vergiftung des Organismus mit harnpflichtigen Stoffen dar: unbeeinflussbare Übelkeit und Erbrechen, urämische Enzephalopathie und Neuropathie, denen sich zudem noch Perikarditis und Pleuritis anschließen können.
Es braucht nicht erwähnt zu werden, wie nützlich die Erfindung der Dialyse sich für die Menschheit herausgestellt hatte. Dank ihr kann das Leben von Tausenden von Menschen gerettet werden …
3 . Vorgeschichte der Dialyse
3.1 Von den Anfängen bis zur Entdeckung der dialytischen Trennung
Es war ein langer Weg von der „Erfindung“ der Dialyse bis zu ihrem ersten klinischen Einsatz.
Der Fortschritt wird aber von Entdeckungen und Erfindungen bedingt, die in einer bestimmten Zeitspanne gemacht werden, wobei es oft vorkommt, dass eine Entdeckung oder Erfindung die andere zur Folge hat.
So sah es auch zweifellos mit der „Erfindung“ der Dialyse und dann mit ihrer Vervollkommnung aus. Auch hier gab es eine gewisse Abfolge von Ereignissen, die schließlich zu ihrer Erfindung und späteren Bewährung führten.
Bevor die Dialyse entdeckt worden ist, mussten die entsprechenden allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen geschaffen werden.
Am Anfang galt es, die Dialyse als physikalisches Phänomen zu erkennen, und es muss betont werden, dass die ersten Diffusions-, dann Dialyseforscher gar keine Mediziner waren. Sie befassten sich mit diesem Phänomen zur Erforschung der sie umgebenden Natur und der Gesetze, die sie regieren. Ihr Wissensdrang hat aber zur Entdeckung des Dialysephänomens geführt. Die Idee der Ausnutzung dieses Verfahrens in der Medizin ist erst viel später geboren.
In diesem Kapitel möchte ich die Ereignisse beschreiben, ohne welche die Dialyse nie zustande gekommen wäre, - die Ereignisse, welche die Vorgeschichte der Dialyse bilden.
Die weiteren Ausführungen an dieser Stelle sind im wesentlichen der Studie von Bach verpflichtet, der die Anfänge der Blutwäsche im Zusammenhang mit seiner Untersuchung über Georg Haas in Gießen, den tatsächlichen Erfinder der Hämodialyse, aufgearbeitet hat. Auch im Rahmen dieser Studie erscheint es unverzichtbar, bis auf die Anfänge des Verfahrens und die damit zusammenhängenden Probleme zurückzugehen, die erst im Laufe der Zeit einer Lösung zugeführt werden konnten.
Diese Vorgeschichte beginnt im Jahre 1748 mit der ersten Beschreibung der Diffusion des Wassers durch die Harnblase. Der Autor dieser Beschreibung war der französische Gelehrte Jean Antoine Nollet (1700-1770). Aus seinen Notizen kann man erfahren, dass vor ihm dieses Phänomen schon von den französischen Physikern und Biologen - R. A. Reaumur (1683-1753) und Ph. de La Hire (1640-1718) beobachtet wurde.[8] Trotzdem können diese ältesten Beobachtungen kaum als Entdeckung der Hydrodiffusion angesehen werden.
Die Diffusion hat Nollet ganz zufällig entdeckt, während er mit Untersuchungen über das Sieden von Flüssigkeiten befasst war. Nollet verschloss ein Zylindergläschen voll Weingeist mit Harnblase und tauchte es in einen Wasserbehälter, um auf diese Weise weiterem Luftzutritt vorzubeugen.
Nach fünf Stunden beobachtete er eine konvexe Wölbung des Blasenstückes. In umgekehrter Versuchsordnung, in der das mit dem Blasenstück zugebundene Zylindergläschen mit Wasser gefüllt und in einen Weingeistbehälter gestellt war, verhielt sich die Harnblase umgekehrt, indem sie sich konkav nach innen senkte, wobei ein Teil des Wassers aus dem Gläschen durch die Membran in den Weingeistbehälter übergetreten war. Nollet ist nach einigen Experimenten zu dem Schluss gekommen, dass Wasser und Weingeist um den Durchtritt durch die Membran konkurrieren.
Er hat festgestellt, dass die Membran für das Wasser größere Permeabilität hat als für den Weingeist.
Nollets Entdeckung geriet schnell in Vergessenheit. Erst Georg Friedrich Parrot (1767-1852) hat im Jahre 1802, also 50 Jahre nach Nollet, die Hydrodiffusion wieder ans Licht gezogen, wobei er den Bezug dieses am Anfang physikalisch-chemischen Phänomens zur medizinischen Grundlagenforschung herstellte. In dem Phänomen der Diffusion sah er die Grundlage vieler physiologischer Vorgänge. Das Thema der Hydrodiffusion hat er in seiner Veröffentlichung: “Über den Einfluss der Naturwissenschaft auf die Arzneykunde”[9] berührt, wonach er als der Entdecker der Hydrodiffusion zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt.
Den Vorwurf, dass seine Versuche bloße Wiederholung der Nollet’schen Experimente seien, wies er zurück, indem er sagte, dass nur der Versuch mit der Harnblase Nollet angehöre, der übrigens 30 Jahre lang ungenutzt geblieben sei.
Parrot hat tatsächlich das Gesetz der Hydrodiffusion mit mehreren Experimenten nachgewiesen.
Er bediente sich dabei unter anderem der Harnblase, die er mit dem menschlichen Urin füllte und in einen Behälter mit Wasser eintauchte. Dabei betrachtete er, dass ihr Gewicht nach 24 Stunden zugenommen hatte.
Einen ähnlichen Versuch machte er mit dem Ei, das, nachdem es im Wasser eingetaucht worden war, aufquoll.
Parrot hat den Begriff „Affinität der ersten Art” eingeführt:
„Die Affinität der ersten Art ist eine Anziehung der Stoffe zu einander, vermöge welcher die Stoffe sich freiwillig mischen ohne ihre Grundeigenschaften zu verlieren … Sie ist es, die Affinität der ersten Art, welche die tropfbaren Flüssigkeiten und die Gase unmerklich mischt…”[10]
Der nächste Beschreiber dieses Phänomens, der nicht unerwähnt bleiben soll, ist der Breslauer Arzt und Chemieprofessor Nicolaus Wolfgang Fischer (1782-1850), der im Jahre 1812 die Hydrodiffusion bei der Untersuchung der Metallreduktion durch galvanische Ketten beobachtet hat.
Zu dem wirklichen Durchbruch der neuen Forschungsrichtung kam es aber erst durch einen weiteren Mediziner, den französischen Arzt und Biologen René Joachim Henri Dutrochet (1776-1847).
H. Dutrochet wurde während biologischer Studien zufällig auf die Membrandiffusion aufmerksam. Danach hat er sehr viele Experimente durchgeführt. Von ihm wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Begriff Endosmose eingeführt.
H. Dutrochet durchforschte in ausgedehnten Versuchsreihen das endosmotische Verhalten von Säuren, Alkalien, Kochsalz- und Zuckerlösung, und vor allem Gummi- und Eiweißlösung waren Gegenstand seiner Versuche. Er versuchte, das Wesen der Endosmose zu klären. Anfangs glaubte er, dass die endosmotischen Erscheinungen durch Elektrizität hervorgerufen würden. Später korrigierte er seine Auffassung und sah nur die “gegenseitige Attraktion” der Flüssigkeiten als Ursache ihrer Wanderung. Trotz zahlloser Untersuchungen gelang es ihm nicht, eine schlüssige Erklärung der Endosmose zu geben. Es gelang ihm aber wohl einige gesetzmäßige Abhängigkeiten der Membrandiffusion anzugeben. Er hat erkannt, dass die Temperatur beschleunigend auf den Diffusionprozess einwirkt und dass die Volumenzunahme der Oberfläche der Scheidewand und darüber hinaus dem Unterschied der Dichte von Lösung und Wasser proportional ist.
Alle bisher erwähnten Forscher haben sich in ihren Experimenten nur tierischer Häute bedient, die ihnen als Scheidewand während der Diffusion dienten. Dutrochet war der erste, der sich nicht mehr nur auf tierische Membranen beschränkte. Er zog auch pflanzliche Septen und organisches Material in Form von Kautschuk- und auch Marmorlamellen zu Diffusionsversuchen heran.
Die tierischen Häute wiesen viele Nachteile auf. Sie trockneten schnell aus und vor allem setzte die Fäulnis ein, die sie für die weitere Anwendung unbrauchbar machte. Dutrochets Einsatzversuche der neuen Membranen schlugen auch fehl. Die pflanzlichen Häute rissen schnell ein, und organische Lamellen zeigten zu geringe endosmotische Aktivität. Sie ließen sich übrigens kaum in gewünschte Form bringen.
Der Herausforderung eine bessere Diffusionsmembran zu finden, wurden Rudolf Buchheim (1820-1879) und Adolf Fick (1829-1901) gerecht. Die beiden Forscher haben die Membranen aus Collodium[11] eingeführt. Das war umso bedeutender, da ausgerechnet Collodiummembranen später in der ersten von Georg Haas durchgeführten Hämodialyse eingesetzt wurden. Collodium ermöglichte die Herstellung gleichförmiger Membranen, stand in beliebiger Menge zur Verfügung und ließ sich formen. Die Voraussetzungen waren ausreichend, um eine effektive Diffusion durchzuführen.[12]
Rudolf Buchheim[13] begann die Experimente mit dem Collodium spätestens im Jahre 1850, was den literarischen Quellen zu entnehmen ist.[14]
Es ist dagegen schwer zu ermitteln, wann Adolf Fick[15] mit den Collodiummembranen zu experimentieren angefangen hat.
In seiner zweiten Veröffentlichung über Endosmose bestätigte er aber, dass außer ihm auch Buchheim mit Collodiumhäuten gearbeitet hatte.[16]
Die beiden deutschen Wissenschaftler haben außer den unbestrittenen Vorteilen den früheren Membranmaterialen gegenüber auch die Nachteile der Collodiummembranen bemerkt, die vor allem auf ihre Zerbrechlichkeit zurückzuführen waren.
Adolf Fick in seiner Veröffentlichung: “Versuche über Endosmose” schreibt:
„Die Vorzüge der Collodiumhäute sind so augenfällig, dass man sie nur zu erwähnen, nicht zu beweisen braucht. Sie sind vollkommen homogen und structurlos, aus einem chemisch nicht sehr complizierten Stoffe bestehend, der von den meisten Stoffen, deren endosmotische Eigenschaften man etwa zu prüfen wünscht, nicht angegriffen wird und sie sind was wichtig ist der Fäulnis nicht unterworfen…”[17]
An anderer Stelle dagegen schreibt er:
„Ich selbst war öfters auf dem Punkte, den Gedanken aufzugeben, mit Collodiumhäuten zu arbeiten, so widerspenstig zeigte sich das Material. Man hat zwar nicht mit der Veränderlichkeit, desto mehr aber mit Zerbrechlichkeit zu kämpfen, vorausgesetzt, dass man die Membrane hinlänglich dünn macht, um einem endosmotischen Strome von erheblicher Stärke Durchtritt zu verstatten…”[18]
Daraus ergibt sich, dass Collodium sowohl Vorteile als auch Nachteile hatte. Trotzdem war das das erste künstliche Material, aus dem Membranen angefertigt wurden.
Wilhelm Schuhmacher (1834-1881) war der nächste deutsche Gelehrte, der einen weiteren Beitrag zur Forschung über die Collodiummembranen geleistet hat. Diesem Bonner Agrikulturchemiker und Pflanzenphysiologen gelang es, den Collodiumhäuten Röhrenform zu geben. Außerdem befasste er sich weiter mit Endosmose. Er verglich die endosmotischen Aktivitäten tierischer, pflanzlicher (Bohnenhülsen, Blätter von Caulerpa prolifera) und schließlich künstlicher (Collodium) Membranen. Er hat festgestellt, dass Gummi und Dextrin zwar geringe, aber immerhin endosmotische Aktivität aufweisen.
Nicht unerwähnt sollen auch zwei Gießener Wissenschaftler: Justus von Liebig (1803-1873)[19] und Conrad Eckard (1822-1905) bleiben.
Die beiden Gelehrten setzten sich auch mit der Membrantheorie und Diffusion der Gummilösungen auseinander.
Der Durchbruch in den Untersuchungen hängt aber eindeutig mit dem schottischen Chemiker Thomas Graham (1805-1869) und genau genommen mit seiner Entdeckung der dialytischen Trennung zusammen. Er kann sicher als “der Vater” der Dialyse bezeichnet werden. Thomas Graham hat sich am Anfang nur mit der Diffusion von Gasen befasst. Erst dann wandte er sich den Flüssigkeiten zu. Zu dieser neuen Richtung seines wissenschaftlichen Interesses wurde er bis zu einem gewissen Grade von Dutrochet`s endosmotischen Untersuchungen angeregt. In seinen Versuchen hat er immer angenommen, dass Gase und Flüssigkeiten den gleichen Gesetzen unterliegen. Er experimentierte mit verschiedenen Stoffen, deren endosmotisches Verhalten er verglich. Er hat beobachtet, dass solche Substanzen wie Zucker, Alkohol und Salze verschiedener Säuren sich hinsichtlich der Diffusionsfähigkeit in eine gemeinsame Gruppe mit Gasen einstufen ließen. Nur die Diffusionsgeschwindigkeiten waren verschieden. Es gab aber Substanzen, deren Eigenschaften anders waren. Diese Gruppe von Stoffen hat Graham als Kolloiden und ihren Aggregatzustand als Kolloidzustand der Materie bezeichnet. Danach hat er die Kolloiden eingehend untersucht. Er entdeckte, dass sie in zwei Formen als Hydrosol und Hydrogel auftreten können.
Nach zahlreichen Versuchen hat er festgestellt, dass Kolloiden auch als Diffusionsmedium dienen können. Die Diffusion von Kristalloiden verlief gleich wie im Wasser.
“Numerous experiments were made on the diffusion of crystalloids through various dialityc septa …
Which all tented to prove how little the diffusive process was interfered with the intervention of colloid matter.”[20]
Graham hat aber beobachtet, dass Stärke, tierischer Schleim und andere kolloidale Stoffe Gallerte bildeten, die anderen in der Lösung befindlichen Kolloiden den Durchtritt verwehren. Diese Tatsache hat sein Interesse erregt und sollte bald zur großen wissenschaftlichen Entdeckung führen.
Er hat ein Blatt französischen Briefpapiers mit einem Häutchen von Stärkemehl-Gallerte paniert. In der Mitte hat er es etwas eingedrückt, um in die in dieser Weise entstandene Vertiefung ein Gemisch aus 5% Rohrzucker und 5% arabischem Gummi zu bringen. Dann tauchte er es in das mit Wasser gefüllte Gefäß ein und ließ die Flüssigkeit 24 Stunden lang diffundieren. Es hat sich herausgestellt, dass 75% der gesamten Menge von Zucker in das Wasser hinüberdiffundiert sind, während nur Spuren vom arabischen Gummi nachgewiesen werden konnten. Graham nannte diese Scheidung kristalloider von kolloiden Stoffen Dialyse. Er selbst hat das mit folgenden Worten formuliert:
“It may perhaps be allowed to me to apply the convenient term dialysis to the method of separation by diffusion through a septum of gelatinous matter …”[21]
Thomas Graham hat auch die ersten Dialysatoren entworfen. Das erste Instrument, das überhaupt entstanden ist, war ein reifförmiger Dialysator, den Graham als “Hoop Dialyser” bezeichnete. (hoop, engl. = Reif.) In diesem Dialysator war eine Pergamentpapierscheibe über einen Gutta-Percha-Reif von zwei Zoll Tiefe (5 cm) und acht (20.32 cm) bis zehn Zoll (25.4 cm) Durchmesser gespannt. Die porösen Stellen dieser Scheibe waren durch Auftragen und anschließendes Koagulieren von flüssigem Eiweiß verschlossen worden. Wenn man ein so entstandenes Gefäß in einen größeren Behälter brachte, erhielt man den fertigen Dialysator.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das zweite zur Dialyse verwendete Gerät, das Thomas Graham erfunden und eingeführt hat, war ein glockenförmiger Dialysator - “Bulb Dialyser”. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass diese Vorrichtung früher als Osmometer angewandt war. Dieser Dialysator wurde von Thomas Graham in zwei Größen verwendet. Der erste hatte einen Durchmesser von 3.14 englische Zoll (8 cm), der zweite dagegen 4.44 Zoll (11.27 cm). Die dialytische Oberfläche war in beiden Arten des “Bulb-Dialysators” entsprechend 0.1 m2 und 0.2 m2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 “Bulb dialyser” von Thomas Graham (Quelle wie Fußnote 2, S. 69-76)
Die Entdeckung der Dialyse war wirklich ein unverkennbarer Fortschritt. Thomas Graham hat sie in seiner Veröffentlichung: “Liquid Diffusion applied to Analysis, Phil. Trans R. Soc. 1861” ausführlich beschrieben. Aber noch größeren Eindruck machte auf die damalige wissenschaftliche Welt ihre praktische Anwendbarkeit, die ebenfalls in seiner erwähnten Arbeit dargestellt wurde. In seinem Experiment ist es ihm gelungen, aus einem halben Liter Urin Harnstoff in reiner Form herauszudialysieren. Zu weiteren Versuchen ermutigt, versuchte er die Giftstoffe aus verschiedenen Lösungen mittels der Dialyse auszuscheiden. So gelang es ihm, arsenige Säure und Strychnin aus verflüssigtem Gummi arabicum, Leim, flüssigem Eier-Albumin zu isolieren. Er hatte die These aufgestellt, dass man sich die Dialyse in allen Fällen dienstbar machen könnte, in denen es ein Gift aus einer Flüssigkeit auszuscheiden gelte, und er untermauerte sie, indem er arsenige Säure, weinsaueres Antimonoxid-Kali und Strychnin aus defibriniertem Blut herausdialysierte. Diese Dialyse hat er mit dem reifförmigen Dialysator durchgeführt. Das war die erste Dialyse in der Geschichte, bei der Blut der Dialyse unterzogen wurde. Das war also auch zweifellos die erste Hämodialyse, die zwar noch nicht am Patienten durchgeführt wurde, noch nicht medizinischen Zwecken diente, aber trotzdem der große Schritt zu ihrem erfolgreichen Einsatz in der Medizin war. Thomas Graham war sich der Bedeutung seiner Entdeckung durchaus bewusst. Er sah auch die Möglichkeit ihrer späteren Anwendung in der Medizin. Seine Überlegungen über diese Möglichkeiten waren berechtigt, zumal wenn man bedenkt, dass die fraktionierte Hämodialyse, deren sich Haas 63 Jahre später[22] bediente, dem von ihm bearbeiteten Verfahren ganz ähnlich war.
An dieser Stelle muss auch der französische Professor der industriellen Chemie Auguste-Pierre Dubrunfaut (1797-1881) erwähnt werden. Mit ihm hat Thomas Graham einen Prioritätsstreit über die osmotische und dialytische Trennung ausgefochten. Dubrunfaut besaß mehrere Zuckersiedereien und Branntweinbrennereien. Seine chemischen Kenntnisse kamen ihm hierbei sehr gelegen. Im Jahre 1854 führte er ein neues Verfahren zur Weiterverarbeitung der Melasse, also Raffination von Zucker ein, das er patentieren ließ. Mit dieser neuen Methode wurde Zucker auf dem osmotischen Wege der Melasse (dem Rückstand bei der Zuckergewinnung aus Runkelrüben) entzogen. Um bei der Zuckerrübenverarbeitung anfallende Melasse von organischen und anorganischen Salzen zu reinigen, bediente er sich des Osmometers als des Gerätes, das die Trennung ermöglichte. Dubrunfaut wurde vorgeworfen, dass er die Methode von der Graham`schen abgeleitet habe, wogegen er im Jahre 1866 heftig aufbegehrte. In einem Schreiben an die Académie des Sciences wehrte er sich unter Hinweis darauf, dass die Graham`sche Dialyse nur ein Sonderfall der allgemeinen Methode der Scheidung mit Hilfe des Osmometers sei. Thomas Graham antwortete auf die Ausführung Dubrunfaut`s, dass das Dubrunfaut`sche industrielle Verfahren keine Vorwegnahme seiner eigenen analytischen Methode der Gefäßdiffusion sei, und dass das neue Prinzip auf keinen Fall dem französischen Chemieprofessor zugeschrieben werden könne.[23]
Dennoch scheint Dubrunfaut`s Prioritätsanspruch in gewisser Weise berechtigt zu sein, zumal wenn man bedenkt, dass Dubrunfaut vor Graham schon 1854 Substanzgemische mittels einer Membran getrennt hatte. Es soll sich um die kristalloiden Stoffe gehandelt haben[24]. Diese Substanzen soll aber auch Thomas Graham noch vor Dubrunfaut voneinander getrennt haben, wobei er jedoch keine Membranen verwendete. Der Name Auguste-Pierre Dubrunfaut soll also neben dem von Thomas Graham genannt werden.
3.2 Die ersten Versuche der Hämodialyse im Tierversuch
Mit den Untersuchungen des amerikanischen Forschers John Jacob Abel (1857-1938) schien die Dialyse ihrem Höhepunkt entgegenzustreben. Die Aussicht auf ihre Anwendung in der Medizin wurde immer realer.
Im Jahre 1893 wurde John Jacob Abel zum Professor der Pharmakologie der John Hopkins Medical School in Baltimore ernannt. Zu den Themen, mit denen er sich mit wissenschaftlicher Leidenschaft und großer Hingabe befasste, gehörten die endokrinen Organe und die von ihnen ausgeschütteten Hormone. Entsprechende Untersuchungen hat Abel in einem Speziallabor der John Hopkins School bis zu seinem Tode durchgeführt. Er hatte auch ein paar interessante Arbeiten über das Vorkommen von Epinephrin geschrieben und sich mit der Isolierung des Insulins in seiner kristallinen Form beschäftigt.
Seine bedeutungsvollste Entdeckung war aber die “Vividiffusion”. Mit seinen zwei Mitarbeitern L.G. Rowntree und B. B. Turner gelang es ihm, aus dem extrakorporalen Kreislauf eines lebenden Versuchstieres körpereigene und fremde Stoffe zu entfernen. Am 10. November 1912 hat John Abel seinen Kollegen ein zwei Stunden dauerndes Experiment an einem Kaninchen vorgestellt. Offiziell wurde die neue Methode am 6. Mai 1913 vor der Association of American Physicians in Washington während einer Vorlesung verlautbart. Die weiteren Vorführungen der Hämodialyse fanden im Sommer desselben Jahres in London und auf dem Physiologenkongress in Groningen in den Niederlanden statt.[25]
So wie vor einem halben Jahrhundert Thomas Graham, so ist John Jacob Abel zur Überzeugung gekommen, dass die Dialyse therapeutischen Zwecken dienen kann.
„Direction in which the method may be utilised, both for the study of problems in physiological chemistry, and as a promising therapeutical agent, have been indicated.“[26]
Diese Aussage hat er auch durch Experimente bekräftigt.
In einem seiner Versuche hat er dem 22.5 kg schweren Hund ein Gramm Natriumsalicylat intravenös verabreicht. Zum Experiment wurde ein Dialysierapparat mit 32 Collodiumröhren von jeweils 40 cm Länge und 8 mm Durchmesser verwendet. Nach der sieben Stunden dauernden Dialyse gelang es den Experimentatoren, 191 mg oder 19.1% des injizierten Natriumsalicylats aus dem Blut des Tieres zu entfernen. Im nächsten Versuch hat Abel einem anderen Hund dieselbe Menge von Natriumsalicylat intravenös appliziert. Diesmal wurde aber das Versuchstier der Dialyse nicht unterzogen, lediglich wurde bei dem Hund die Elimination der mit dem Urin ausgeschiedenen Testsubstanz beobachtet. Nach sechs Stunden betrug sie 17.5%.
John Jacob Abel kommentierte das mit den Worten:
“These data show that the aparatus can already compete with the kidneys on favorable terms, at least during the early hours of the dialysis.”[27]
Abel hat die zur Hämodialyse verwendete Apparatur „artificial kidney“ (künstliche Niere) genannt, weil sie von der Funktion her mit der Niere vergleichbar war.
Die Abel`sche Methode der Dialyse bestand darin, dass er das Blut eines Versuchstieres durch die vorausgehende intravenöse Verabreichung von Hirudin ungerinnbar machte und es danach aus einer großen Arterie in ein System aus Collodiumschläuchen leitete. Die Collodiumschläuche waren in einem Behälter untergebracht, der mit isotonischer Kochsalzlösung gefüllt war. Innerhalb von zehn Stunden konnten 30 cm3 Blut pro Kilogramm Körpergewicht dialysiert werden. Um das Schlauchsystem nach dem Abschluss der Dialyse von dem verbleibenden Blut zu entleeren, setzte man entweder die Dialysierflüssigkeit unter hydrostatischen Druck und presste so die Collodiumschläuche aus, oder man spülte das Schlauchsystem von der arteriellen Seite mit einer Bürette aus.
Wie früher schon A. Fick und A. Buchheim, die mit dem Collodium als Membranmaterial gearbeitet haben, so stieß auch John Jacob Abel auf große Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Material.[28]
Zur Ungerinnbarmachung verwendete Abel den Hirudinextrakt aus Köpfen der Blutegel. Wegen des hohen Preises des Extraktes entschloss sich Abel mit seinen Mitarbeitern den Extrakt selbst herzustellen. Ein solcher Extrakt wurde aus 200 Blutegeln gewonnen.
Abel verwendete ursprünglich einen Dialysierapparat, der vier Collodiumröhren besaß. Mit diesem Apparat hat er ein Dialyseexperiment an einem Kaninchen durchgeführt. Das Blut wurde von der Arteria carotis des Tieres abgenommen und in die Vena femoralis zurückgeleitet. Später modifizierte er seine Methode, indem er in dem Dialysator Collodiumschläuche u-förmig untergebracht hat. Erstens befanden sich der Einfluss und Ausfluss des Blutes in einem solchen verbesserten Dialysierapparat auf derselben Seite, was den Anschluss an den Kreislauf des Versuchstieres erleichterte, zweitens wurde dadurch die Oberfläche der vorgehenden Dialyse in solchem Apparat vergrößert, was zu besserer Leistung führte.
Abel versuchte solche Dialysatoren zu entwerfen, die bei maximaler dialysierender Oberfläche ein möglichst kleines Blutvolumen aufnahmen. Deshalb verwendete er die Collodiumschläuche, die kleinkalibriert waren. Manchmal drückte er sie auch mittels eines Metallrahmens zusammen. Während der Versuche an größeren Tieren, z. B. an Hunden, wendete Abel Dialysatoren an, die 16 bis 48 Collodiumröhren hatten, wobei er immer die Zweierpotenzen für die Zahl der Collodiumröhren wählte, damit sich jede dichotom, also gabelförmig aufteilen konnte. Dadurch konnte eine gleichförmige Blutströmung erreicht werden. Die Glasverbindungsstücke zwischen den Collodiumröhren mussten so kurz wie möglich gestaltet werden, weil sie zu den alkalischen Bestandteilen gehörten, die gerinnungsfördernd wirkten. Die Verweildauer des Blutes in dem Dialysator musste auch möglichst kurz sein, damit es nicht zur Gerinnung kam.
Die Länge der Collodiumschläuche in den Abel`schen Dialysatoren variierte von 20 cm (Dialysierapparat mit 16 Collodiumröhren) bis 54 cm, was in seinem kompliziertesten Dialysator mit 192 Collodiumschläuchen der Fall war.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Ein sogenannter „Vividiffusionsapparat“ von Abel[29]
Dieser letzte Apparat fasste drei Liter Blut und war für die Untersuchung von Tieren mit mehr als 100 kg bestimmt. In dem Dialysator mit 16 Collodiumröhren wurde die arterielle Kanüle mit dem Einlass in den Dialysierapparat verbunden. Das Blut teilte sich kurz nach dem Einfluss in den Apparat in acht Collodiumröhren auf und floss parallel bis zum Ende des Dialysators und wurde auf die gleiche Weise in die Vene zurückgeführt. Über das Ausflussrohr, das mit der venösen Kanüle verbunden war, verließ es schließlich den Apparat. Das walzenförmige Dialysatorgehäuse, in dem sich die Collodiumröhren befanden, war ein Behälter, der Dialysierflüssigkeit enthielt, die ein- oder ausgelassen werden konnte. Zu weiteren Bestandteilen der Abel´schen Dialysatoren gehörten Thermometer zur Messung der Temperatur der Dialysierflüssigkeit und eine Bürette, die der Zugabe von Hirudin diente. Mit dem zusätzlich oben angebrachten Auslass konnte man die angesammelte Luft aus dem Dialysierflüssigkeitsbehälter entweichen lassen.
Der beschriebene Bau des Dialysators war eigentlich für alle von Abel verwendeten Dialysiergeräte charakteristisch. Das einzige, was sie unterschieden hat, war die Zahl der im Dialysatorgehäuse untergebrachten Collodiumschläuche.
Als Gefäßzugang bevorzugte Abel besonders die Arteria carotis, wobei er unterhalb des Schlüsselbeins punktierte. Das Blut wurde dann normalerweise in die Vena jugularis externa zurückgeleitet.
Man muss zugeben, dass die meisten von Abel durchgeführten Experimente lediglich pharmakologisch-chemischen Analysen dienten, bei zwei Versuchen verfolgte er aber das Ziel, die Unschädlichkeit der Hämodialyse für das Versuchstier zu überprüfen. Ausnahmsweise verwendete er hierbei die Arteria und Vena femoralis als Gefäßzugänge. Als Waschlösung benutzte er 0.6% Kochsalz und 0.1% Kaliumchlorid. Mit der gleichen Lösung hat er die Collodiumschläuche vor der Dialyse vorgefüllt. Er ließ sich dabei die Asepsis besonders angelegen sein. Das weitere experimentelle Vorgehen war außerdem den vorherigen Experimenten ähnlich. Das Ergebnis dieser zwei Versuche wurde von ihm als durchaus erfreulich interpretiert.
„Both animals made quick recovery and in the weeks following during which they were kept under observation nothing abnormal was noted.”[30]
Wie bereits erwähnt, sind die meisten Abel´schen Experimente, die der Dialyse gewidmet waren, in der Zeitspanne von 1912 bis 1914 durchgeführt worden. Bis zum Jahre 1932 war Abel an der John Hopkins Medical School im Pharmakologischen Institut als Professor tätig. Das größte Problem, die Methode auf den Menschen anzuwenden, war die Blutgerinnung, die unbedingt aufgehoben werden musste, damit es nicht im Dialysierapparat zur Gerinnung kam. Abel hat Blutegelextrakte verwendet, die zwar ihrer Aufgabe gerecht wurden, aber für die tierischen und desto mehr menschlichen Organismen alles andere als harmlos waren. Die Nebenwirkungen waren beträchtlich und führten oft zum Tode, was die späteren Versuche von Georg Haas an Hunden bewiesen haben.[31] Erst 1923 war ein solches Hirudinpräparat (gereinigtes Blutegelextrakt) verfügbar, das zwar noch nicht völlig ohne Nebenwirkungen aber ausreichend sicher war, um ein Jahr später vom deutschen Wissenschaftler Georg Haas erstmals am Menschen angewendet zu werden.
Man muss zugeben, dass Abel danach nicht gestrebt hat, die Hämodialyse am Menschen durchzuführen, obschon seine Dialyseapparatur bereits alle Elemente enthielt, die zur erfolgreichen Hämodialyse erforderlich waren. Die Anzahl der Versuche in dieser Richtung bestätigt das. Nichtsdestoweniger wurde die zukunftsweisende Perspektive dieser Methode von ihm und seinen Mitarbeitern deutlich betont. Sie haben nämlich den Begriff “künstliche Niere” eingeführt, was aussagekräftig genug zu sein scheint, und auf die Möglichkeit der Anwendung in der Medizin hinweist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dieses amerikanischen Wissenschaftlers stand der klinische Einsatz der neuen Methode offensichtlich nicht. Vielmehr war die Dialyse ein Mittel im Rahmen seiner pharmakologischen Experimente, mit denen Abel sich mit leidenschaftlicher Hingabe beschäftigte. Mit diesen Versuchen wurde aber endgültig der vorletzte Schritt getan, der zur Einführung der Hämodialyse in die Medizin führte. Der letzte sollte dem Gießener Wissenschaftler Georg Haas vorbehalten sein.
3.3 Untersuchungen über die Dialyse, die zur Entdeckung der Peritonealdialyse beigetragen haben
Die beträchtlichen Erfolge in der Dialyseforschung von Thomas Graham angefangen schienen im Laufe der Zeit eine neue Richtung einzuschlagen. Das Ziel war die Anwendung der Methode in der Medizin als Therapieverfahren. Der amerikanische Wissenschaftler John Jacob Abel und seine Mitarbeiter haben die Hämodialyse zum ersten Mal in der Geschichte an Versuchstieren angewandt. Das Blut von Hunden wurde extrakorporal und im geschlossenen Kreislauf gereinigt. Die Methode konnte in dieser Zeit noch keine klinische Verwendung finden, weil es damals noch kein unschädliches Blutegelextrakt gab. Das bis zum Jahr 1923 verwendete gerinnungshemmende Hirudinpräparat war wegen vieler Nebenwirkungen gefährlich für das Leben und konnte nur in Tierversuchen angewendet werden. Möglicherweise hat ausgerechnet diese Tatsache dazu beigetragen, dass man nach einer anderen Dialysemethode suchte, die das Problem der Blutgerinnungsaufhebung zu umgehen vermochte. Als solche alternative Methode zeigte sich die Peritonealdialyse, die vom deutschen Arzt G. Ganter im Jahre 1923 zum ersten Mal am Menschen durchgeführt wurde. Weil die erste Hämodialyse nur ein Jahr später von Haas ausgeführt wurde, muss man zugeben, dass die beiden Arten der Dialyse sich beinahe zeitgleich und voneinander unabhängig entwickelten. Was aber noch wichtiger ist, sie erhielten sich bis auf den heutigen Tag und bewährten sich als zuverlässige Methoden.
Die Untersuchungen über die Eigenschaften des Peritoneum begannen im Jahre 1877 und wurden von Wegner[32] durchgeführt. Er hat Kaninchen physiologische Kochsalzlösung in die Bauchhöhle verabreicht, wobei die Menge der Lösung jeweils 10% des Körpergewichtes betrug. Wegner hat die Resorption des Bauchfells beobachtet und ist zur Erkenntnis gekommen, dass sie nach einer Stunde zwischen 3.3% und 8% schwankte. Darüber hinaus hat er festgestellt, dass das Einbringen der auf 4°C abgekühlten Lösung die Körpertemperatur des Tieres nach 80 min auf 24.3°C herabsetzte. Bei dem ähnlichen Versuch, in dem die Spüllösungstemperatur 16°C betrug, trat der gleiche Effekt erst nach 24 Stunden auf.
Dann versuchte er auch hochkonzentrierte Lösungen intraperitoneal zu instillieren. Er verwendete zu diesem Zweck entweder Zuckerlösung oder Glyzerin. Dabei hat er festgestellt, dass das gesamte Flüssigkeitsvolumen in der Bauchhöhle zunahm.
Dieses Phänomen wurde später 1894 ebenfalls von den amerikanischen Forschern Starling und Tubby beobachtet. Weiterhin haben sie aber erkannt, dass die intraperitoneale Verabreichung der hypotonen Lösung das Flüssigkeitsvolumen in der Bauchhöhle abnehmen lässt.
Im Jahre 1895 beobachtete Orlow die Konzentrationsänderungen verschiedener Anionen und Kationen in der Spüllösung und im Blut der Versuchstiere, nachdem er drei Stunden die Lösungen in der Peritonealhöhle hatte verbleiben lassen. Er schloss aus seinen Untersuchungen, dass die Resorption des Bauchfells ein vitaler Vorgang sei. Zu ähnlichen Untersuchungsergebnissen sind Hamburger, Putnam, Schechter, Carry, Carpentieri, Darrow und Cunnungham gekommen.[33]
Die erwähnten Wissenschaftler Starling und Tubby waren die ersten, die zum Schluss kamen, dass vorwiegend die Blutgefäße an der peritonealen Resorption teilnehmen.
Im Jahre 1902 stellte ein anderer Forscher Klapp fest, dass die Resorptionsfähigkeit des Peritoneum bei Hitzeeinwirkung zunimmt, während die Kälte die umgekehrte Wirkung hat. Clairmont und von Haberer 1905 haben die Abhängigkeit der Resorption von der Darmperistaltik geprüft. Nach der Verabreichung von Physostigmin, das die Peristaltik anregte, konnten sie bei Kaninchen die erhöhte Peritonealresorption beobachten. Durch Opium oder Pantopon konnte die Peristaltik dagegen herabgesetzt werden und mit ihr auch die Resorption.
Im Jahre 1922 hat Putnam das Auftreten von Harnstoff, Kreatinin und Harnsäure im Blut und in der peritonealen Spüllösung untersucht.[34] Er hat beobachtet, dass nach 1-7 stündiger Verweildauer rascher Harnstoffanstieg in der Lösung festzustellen ist. Die Experimente hat Putnam an Katzen, Hunden und Kaninchen durchgeführt.
Ein Jahr später sollte es zur ersten Anwendung der Peritonealdialyse am Menschen kommen, was aber dem deutschen Arzt und Professor G. Ganter vorbehalten blieb.
II. Hauptteil
4 . Entwicklung und klinische Anwendung der Dialyse in der brd
4.1 INTESTINALDIALYSE und andere historische Dialyseverfahren
Die Intestinaldialyse war eine der Abwandlungen der Dialyse. Sie wurde schon im Jahre 1923 von Mc Carthy als Dialysemethode an Menschen verwendet.[35]
In den fünfziger Jahren war diese Methode in der Bundesrepublik Deutschland sehr verbreitet. Die ersten Erfolge mit dieser Methode wurden von Martini mitgeteilt.[36]
Der Münchener Medizinischen Wochenschrift von dem Jahre 1954 ist zu entnehmen:
„Die intestinale Auswaschung lässt sich eigentlich in jedem gut eingerichteten Krankenhaus durchführen. Das Prinzip ist, im oberen Darmabschnitt durch einen dauernden Flüssigkeitsstrom einmal die in den Darm ausgeschiedenen Substanzen auszuwaschen und ferner durch eine Dialyse durch die Darmwand hindurch für das Absinken der harnfähigen Stoffe zu sorgen.“[37]
Das Verfahren bestand darin, dass man dem Patienten eine sog. Miller-Abott-Sonde in den Schlund einführte, die an ihrem vorderen Ende einen kleinen aufblasbaren Ballon besaß. Der Ballon wurde aufgeblasen, sobald die Sonde den Pylorus passierte. Dank der Peristaltik konnte die Sonde weiter durch das Jejunum hindurchgetrieben werden. Die Sonde musste 1.5 bis 2 Meter tief eingeführt werden. Danach wurde zusätzlich eine zweite dünne Sonde in das Duodenum eingelassen, mit deren Hilfe durch Tropfinfusion Flüssigkeit eingeführt wurde, die das Jejunum durchlief und von der Miller-Abott-Sonde wieder aufgesogen werden konnte. Auf diese Art und Weise konnten täglich 15 bis 20 Liter Flüssigkeit gespült werden.
[...]
[1] „Wenn die Ärzte alle Krankheiten heilen könnten, wären sie die glücklichsten Menschen.“ (Autor – unbekannt, Jędraszko Czesław, Łacina na co dzień, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988, S. 156)
[2] Bach, H., Die Entwicklung der künstlichen Niere aus Hydrodiffusion und Hämodialyse- von J. A. Nollet bis G. Haas- Der Ursprung des ersten künstlichen Organs, Arbeiten zur Geschichte der Medizin in Gießen Band 7, 1983
[3] Zenker, W., Die Entwicklungsgeschichte der extrakorporalen Hämodialyse von den Anfängen bis zur Routinentherapie in der Inneren Medizin, 1990
[4] Bach, H., ebd., S. 42-43
[5] Bach, H., ebd. S. 266
[6] Haas, G., Über Blutwaschung, Klin. WS., 7. Jg., Nr. 29, 1928, S. 1356
[7] Quelle: aus dem Großen Bertelsmann Lexikon 2000, CD-ROM 1999, Koch Media GmbH Österreich, 1999 Bertelmann Electronic Publishing im Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH.
[8] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 14-20
[9] Parrot, G.F., Ueber den Einfluss der Physik und Chemie auf die Arzneykunde nebst einer physikalischen Theorie des Fiebers und der Schwindsucht, Dorpat 1802, zit. nach Bach S. 21
[10] Parrot, G.F., Drei optische Abhandlungen, Anm. Phys. 51, 1815, S. 297 und 320, zit. nach Bach S. 26
[11] Für die Collodiumherstellung verwendete man Baumwolle, die man mit der konzentrierten Salpetersäure veresterte. Dadurch erfolgt die Nitrierung, wobei die Cellulose nicht weiter als bis zur Dinitrocellulose nitriert werden darf. Ansonsten bildet sich explosive Schießbaumwolle. Nach diesem Prozess lässt man die Collodiumwolle abtropfen und dann wäscht man sie anfangs im kalten, dann im heißen Wasser aus. Schließlich wird sie getrocknet und so einsatzbereit.
Die Glasgefäße müssen fest verschlossen und dann kühl und trocken gelagert werden. Sobald sich gelbe Stellen in der Wolle zu bilden beginnen, ist die Collodiumwolle nicht mehr brauchbar und muss entfernt werden.
Es erübrigt sich noch zu bemerken, dass die Collodiumwolle oft auch als Dinitrocellulose, Celloxilin oder Pyroxilin bezeichnet wurde.
[12] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 46-54
[13] Rudolf Buchheim (1820-1879) Begründer der wissenschaftlichen Pharmakologie und Gießener Ordinarius für Arzneimittellehre von 1867 bis 1879
[14] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 61
[15] Adolf Fick –geboren in Kassel, Professor für Anatomie und Physiologie an der Züricher Universität.
[16] Bach H., [wie Anm. 2], S. 20-80
[17] Bach, H. ebd.
[18] Bach, H. ebd.
[19] Justus von Liebig (1803-1873) geb. am 12. Mai 1803 in Darmstadt. Dank seines Vaters wurde er früh mit der Herstellung von Farben vertraut. In der Schule war er ein mittelmäßiger Schüler. Seit dem Jahre 1820 studierte er in Bonn, dann in Erlangen Chemie. Dann ermöglichte ihm der Großherzog Ludwig I. von Hessen einen einjährigen Studienaufenthalt in Paris. Dort hatte er die Gelegenheit, die Vorlesungen von solchen berühmten Gelehrten wie L. J. Gay-Lussac (1778-1850) und L. J. Thénard (1777-1857) zu hören. In Paris wurde Alexander von Humboldt (1769-1859) auf ihn aufmerksam, auf dessen Empfehlung und Einsatz beim hessischen Großherzog Justus von Liebig nach Ablauf seines Pariser Studienaufenthalts zum außerordentlichen Professor an der Landesuniversität Gießen ernannt wurde, wo er im Jahre 1824 mit 21 Jahren seine akademische Laufbahn begann. Ein Jahr später wurde er schon ordentlicher Professor. Liebig hat an der kleinen Landesuniversität 28 Jahre gewirkt, eher er nach München wechselte. Dank seiner Leistungen wurde die Gießener Universität weltberühmt. Im Jahre 1845 wurde er in den Freiherrnstand erhoben.
[20] Graham Th., Liquid Diffusion applied to Analysis, Phil.Trans. R. Soc., 1861, S. 200, zit. nach Bach S. 71
[21] Graham, Th., ebd. [wie Anm. 20], S. 200, zit. nach Bach S. 72
[22] Thomas Graham hat die Blutdialysen im Jahre 1861 durchgeführt. Im Sommer 1924 hat Georg Haas den ersten Patienten der Hämodialyse unterzogen
[23] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 81-82
[24] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 82-83
[25] Bach, H., [wie Anm. 2], S. 61
[26] Abel J. J, Rowntree L. G., Turner B. B., On the removal of diffusible substances from the circulating blood of living animals by dialysis, J. Pharmacol. Exp. Ther. 5, 1914, S. 316, zit. nach Bach, S. 116
[27] Abel J. J, Rowntree L. G., Turner B. B., ebd., zit. nach Bach S. 117
[28] Abel hat die Collodium in dieser Weise hergestellt, dass er 10 Gramm Collodium in 100 ml Äther und 100 ml Äthylalkohol auflöste. Dann hat er die Glasröhren mit der zubereiteten Lösung gefüllt und langsam austropfen lassen. An den Enden wurden dann die Röhren mit einigen Millimetern Collodium aufgefüllt, was die Collodiumschläuche haltbarer machen sollte. Wenn die Glasröhren nicht mehr nach Äther rochen, konnten sie in das Wasserbad gelegt werden und 10 Minuten später war es möglich, die Collodiumschläuche aus den Glaszylindern vorsichtig zu entbinden. Auf diese Weise hat Abel Collodiumschläuche mit 0.05 bis 0.1 mm dicken Wänden hergestellt. Die verdickten Enden maßen 2 mm Stärke.
[29] Diese Abbildung wurde entnommen aus: Jost Benedum: Die Frühgeschichte der künstlichen Niere; in Gießener Universitätsblätter, Jg. 33, Dezember 2000, S. 69-76
[30] Abel J. J, Rowntree L. G., Turner B. B., [wie Anm. 26], S. 305, zit. nach Bach S. 124
[31] Bach, [wie Anm. 2], S. 228
[32] Frederich Wegner (1843-1917) Deutscher Pathologe.
[33] Das ist den folgenden Literaturquellen zu entnehmen:
Cunnungham, R. S., Studies on absorption from serous cavities. Amer. J. Physiol. 53, 1920, S. 488; Hamburger, H. J., Über die Regelung der osmotischen Spannkraft von Flüssigkeiten in Bauch- und Pericardhöhlen. Arch. Phys. Du Bois-Reymond, 1895, S. 281 ; Putnam, T., The living peritoneum as a dialysing membrane. Amer. J. Physiol. 63, 1922, S. 548 Schechter, A. J., Carry M. K.,. Carpentieri A. L, Darrow D. C., Changes in composition of fluids injected into peritoneal cavity. Amer. J. Dis. Child 46, 1933, S. 1015
[34] Putnam, T., ebd.
[35] Boeminghaus, H., Akute Anurie, Medizinische Welt, Nr. 16, 17 April 1954, S. 530
[36] Martini, Bericht, Deutsche Medizinische Wochenschrift, 77, 1952, S. 1595
[37] Sarre, H., Die künstliche Niere und andere extrarenale Entschlackungsverfahren bei der Behandlung der Anurie und Urämie, Münchener Medizinische Wochenschrift, Jhg. 96, Nr. 6, 1954, S. 129
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832485108
- ISBN (Paperback)
- 9783838685106
- Dateigröße
- 5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen – Medizin
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- hämiodialyse hämodialyse geschichte weltgeschichte intestinaldialyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de