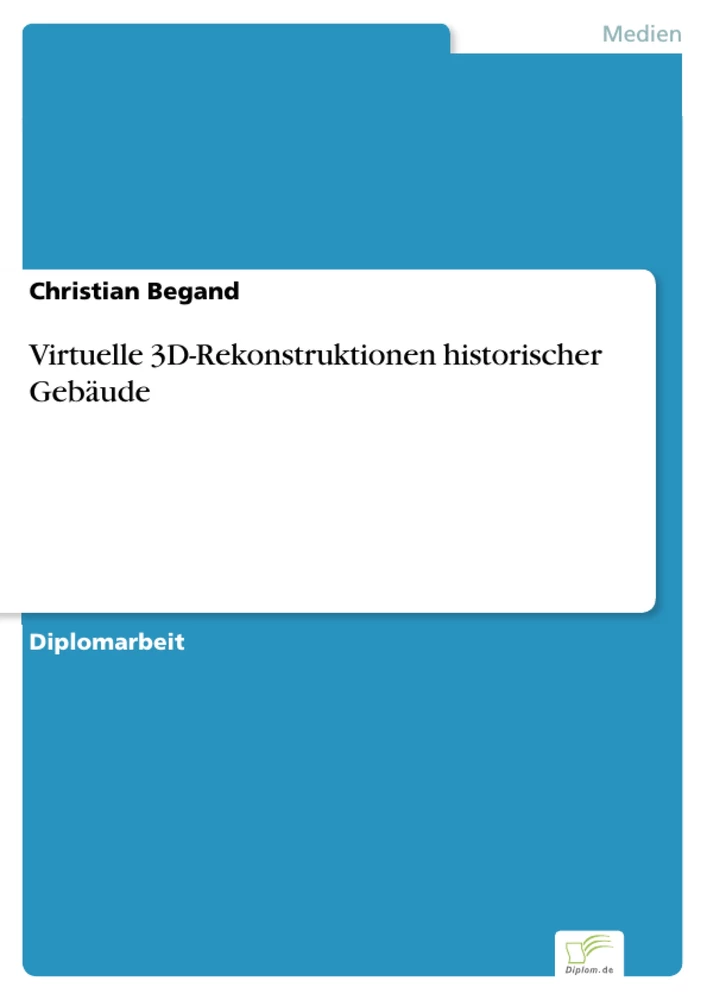Virtuelle 3D-Rekonstruktionen historischer Gebäude
©2004
Diplomarbeit
77 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Virtuelle Gebäuderekonstruktionen haben sich in den letzten Jahren als effektives Medium zur Darstellung historisch oder kunsthistorisch bedeutender Gebäude durchgesetzt.
Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Trend sind die in den letzten Jahren entwickelten Verfahren zur Bildsynthese in der 3D-Grafik. Diese sind in der Lage, Bilder zu erzeugen, die von Fotografien kaum zu unterscheiden sind. Aber auch andere Darstellungsarten, wie Liniengrafiken, werden bei virtuellen Rekonstruktionen angewendet, um das ursprüngliche Aussehen eines Gebäudes zu veranschaulichen.
Die vorliegende Arbeit wird einige virtuelle Rekonstruktionen vorstellen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Anhand der ausgewählten Projekte werden die Entwicklung der virtuellen Gebäuderekonstruktion, sowie die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Präsentation aufgezeigt.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand eines Beispieles die Methodik und die Vorgehensweise bei der Erstellung einer solchen Gebäuderekonstruktion zu untersuchen. Dazu wird die Entstehung der Rekonstruktion der beiden Wallfahrtskirchen auf dem Burgstein beschrieben, sowie auf die dabei aufgetretenen Probleme und die erarbeiteten Lösungswege hingewiesen.
Sobald ein historisch bedeutendes Bodendenkmal aufgespürt und freigelegt wurde, beteiligen sich Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen an den Arbeiten, die Aufschluss über den Ursprung, Form und Funktion des einstigen Gebäudes geben sollen. Dabei kommen unzählige Einzelergebnisse zusammen, die nur in ihrer Gesamtheit eine umfassende Antwort geben können. Um ein solches Gesamtergebnis anschaulich darzustellen, bietet sich eine bildliche oder gegenständliche Umsetzung der einzelnen, zunächst voneinander isolierten Ergebnisse an. Aus einer abstrakten Zeichnung oder einem Modell des rekonstruierten Gebäudes wird durch die Vorstellungskraft des Betrachters das Gebäude wieder zum Leben erweckt.
Seit einigen Jahren bieten spezielle Computerprogramme die Möglichkeit, die verschiedenen Einzelergebnisse im Computer an einem virtuellen Modell zusammenzufügen. Den Möglichkeiten des neuen Mediums entsprechend, führt die Darstellung immer mehr von den abstrakten, verallgemeinerten Formen hin zu konkreten, die, in den Worten von Marcus FRINGS, wie Gebäude rezipiert werden.
Den neuen Möglichkeiten stehen aber auch neue Probleme gegenüber, denn Archäologen haben bislang nur […]
Virtuelle Gebäuderekonstruktionen haben sich in den letzten Jahren als effektives Medium zur Darstellung historisch oder kunsthistorisch bedeutender Gebäude durchgesetzt.
Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Trend sind die in den letzten Jahren entwickelten Verfahren zur Bildsynthese in der 3D-Grafik. Diese sind in der Lage, Bilder zu erzeugen, die von Fotografien kaum zu unterscheiden sind. Aber auch andere Darstellungsarten, wie Liniengrafiken, werden bei virtuellen Rekonstruktionen angewendet, um das ursprüngliche Aussehen eines Gebäudes zu veranschaulichen.
Die vorliegende Arbeit wird einige virtuelle Rekonstruktionen vorstellen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Anhand der ausgewählten Projekte werden die Entwicklung der virtuellen Gebäuderekonstruktion, sowie die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Präsentation aufgezeigt.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand eines Beispieles die Methodik und die Vorgehensweise bei der Erstellung einer solchen Gebäuderekonstruktion zu untersuchen. Dazu wird die Entstehung der Rekonstruktion der beiden Wallfahrtskirchen auf dem Burgstein beschrieben, sowie auf die dabei aufgetretenen Probleme und die erarbeiteten Lösungswege hingewiesen.
Sobald ein historisch bedeutendes Bodendenkmal aufgespürt und freigelegt wurde, beteiligen sich Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen an den Arbeiten, die Aufschluss über den Ursprung, Form und Funktion des einstigen Gebäudes geben sollen. Dabei kommen unzählige Einzelergebnisse zusammen, die nur in ihrer Gesamtheit eine umfassende Antwort geben können. Um ein solches Gesamtergebnis anschaulich darzustellen, bietet sich eine bildliche oder gegenständliche Umsetzung der einzelnen, zunächst voneinander isolierten Ergebnisse an. Aus einer abstrakten Zeichnung oder einem Modell des rekonstruierten Gebäudes wird durch die Vorstellungskraft des Betrachters das Gebäude wieder zum Leben erweckt.
Seit einigen Jahren bieten spezielle Computerprogramme die Möglichkeit, die verschiedenen Einzelergebnisse im Computer an einem virtuellen Modell zusammenzufügen. Den Möglichkeiten des neuen Mediums entsprechend, führt die Darstellung immer mehr von den abstrakten, verallgemeinerten Formen hin zu konkreten, die, in den Worten von Marcus FRINGS, wie Gebäude rezipiert werden.
Den neuen Möglichkeiten stehen aber auch neue Probleme gegenüber, denn Archäologen haben bislang nur […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8503
Begand, Christian: Virtuelle 3D-Rekonstruktionen historischer Gebäude
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Bibliografischer Nachweis
Begand, Christian: Virtuelle 3D-Rekonstruktionen historischer Gebäude
Diplomarbeit, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
Fachbereich Polygrafische Technik, Studiengang Medientechnik, 2004
75 Seiten, 23 Bilder, 3 Tabellen
Autorreferat
Virtuelle Gebäuderekonstruktionen haben sich in den letzten Jahren als effektives
Medium zur Darstellung historisch oder kunsthistorisch bedeutender Gebäude durch-
gesetzt. Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Trend sind die in den letzten Jahren
entwickelten Verfahren zur Bildsynthese in der 3D-Grafik. Diese sind in der Lage, Bilder
zu erzeugen, die von Fotografien kaum zu unterscheiden sind. Aber auch andere
Darstellungsarten, wie Liniengrafiken, werden bei virtuellen Rekonstruktionen
angewendet, um das ursprüngliche Aussehen eines Gebäudes zu veranschaulichen.
Die vorliegende Arbeit wird einige virtuelle Rekonstruktionen vorstellen, die in den
letzten Jahren entstanden sind. Anhand der ausgewählten Projekte werden die
Entwicklung der virtuellen Gebäuderekonstruktion, sowie die unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten der Präsentation aufgezeigt. Ziel dieser Arbeit ist es,
anhand eines Beispieles die Methodik und die Vorgehensweise bei der Erstellung einer
solchen Gebäuderekonstruktion zu untersuchen. Dazu wird die Entstehung der Rekon-
struktion der beiden Wallfahrtskirchen auf dem Burgstein beschrieben, sowie auf die
dabei aufgetretenen Probleme und die erarbeiteten Lösungswege hingewiesen.
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mich bei der Arbeit an meiner Diplom-
arbeit und der Rekonstruktion der Wallfahrtskirchen auf dem Burgstein unterstützt
haben. An erster Stelle soll deshalb Wolfgang Günther genannt werden, von dem der
Vorschlag zu einer Zusammenarbeit bei der Rekonstruktion ausging. Ohne die uneigen-
nützige und sachverständige Hilfe von Uwe Schmidtke, Udo Müller und Martina
Bundszus wären die Kirchen nie rekonstruiert worden. Für die wissenschaftliche
Beratung möchte ich mich außerdem bei Gabriele Buchner, Frank Weiß, Anne Schaich
und Ralph Knickmeyer bedanken.
Weiterhin danke ich für die anschaulichen und herausfordernden Vorlesungen über 3D-
Grafik meinem Dozenten Prof. Jörg Bleymehl, der mich auch als Betreuer meiner
Diplomarbeit während dieser Zeit unterstützt hat. Besonderer Dank gilt Michael
Rauschenbach für seine fantastischen Tutorials und Ronny Schröder für die Satelliten-
bilder und die interessanten Gespräche über Landschaftsmodellierung. Vielen Dank an
Andreas Krause für die Aufmunterungen, die Neuigkeiten über den Burgstein und die
Zeichnungen von Hermann Vogel. Bedanken möchte ich mich auch bei Andreas Gold-
hahn für die Bereitstellung seiner Vogtland-Panoramaaufnahmen für die 3D-Animation.
Meiner Freundin Anja Schubert bin ich sehr dankbar, dass sie mich während der Diplom-
arbeit ganz besonders unterstützt hat und mich mit den Regeln von RAK-WB zur
Erstellung meines Literaturverzeichnisses vertraut gemacht und schließlich meine Arbeit
korrekturgelesen hat. Für das Korrekturlesen möchte ich mich außerdem bei Silvia
Schmiedel und Chris Gebel bedanken.
Nicht zuletzt möchte ich mich natürlich auch bei meinen Eltern bedanken, die mit ihrer
finanziellen Unterstützung mein Studium und diese Arbeit erst ermöglichten.
Selbständigkeitserklärung
Hiermit versichere ich, dass ich, Christian Begand (Matrikel-Nr. 25824), die vorliegende
Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen angefertigt habe.
Leipzig, 1. September 2004
Christian Begand
Inhaltsverzeichnis
v
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung 7
1.1 Problemstellung und Ziele der Arbeit
8
1.2 Vorbilder und klassische Rekonstruktionen
9
1.3 Gliederung der Arbeit
10
2
Grundlagen 11
2.1 Rekonstruktion historischer Gebäude
12
2.1.1 Voraussetzungen
13
2.1.2 Methoden der Entscheidungsfindung
14
2.1.3 Möglichkeiten und Grenzen
15
2.2 Visualisierungen mit Hilfe von 3D-Grafik
15
2.2.1 Geschichte
der
3D-Grafik
17
2.2.2 Objektmodellierung mit Hilfe von 3D-Programmen
24
2.2.3 Oberflächengestaltung
26
2.2.4 Beleuchtung
29
2.2.5 Fotorealistische
Bilderzeugung
32
2.2.6 Nicht-fotorealistische
Bilderzeugung
33
2.3 Computeranimation
34
2.3.1 Geschichte
der
Animation
35
2.3.2 Methoden der Computeranimation
37
3
Anwendungsgebiete der 3D-Rekonstruktion
38
3.1 Wissenschaft und Forschung
38
3.2 Museen und andere Bildungseinrichtungen
39
3.3 Film und Fernsehen
40
3.4 Unterhaltung
41
4
Vergleich mit anderen Rekonstruktionsweisen
42
4.1 1:1 Rekonstruktionen bzw. ,,Wiederaufbau"
42
4.2 Modell-Rekonstruktionen
43
4.3 Zeichnungen
44
Inhaltsverzeichnis
vi
5
Beispiele bisheriger Arbeiten auf dem Gebiet
45
5.1 Die Abteikirche in Cluny
45
5.2 Tenochtitlán / Mexiko-Stadt
46
5.3 Jülich
48
5.4 Die Magdeburger Kaiserpfalz
49
5.5 Synagogen in Deutschland
50
6
Vorgehensweise bei der Erstellung einer virtuellen Gebäuderekonstruktion 52
6.1 Problemstellung
52
6.2 Dokumentation und Recherche
53
6.3 Rahmenbedingungen und Befunde
54
6.4 Erstellung des Geometriemodells
55
6.5 Gestaltung der Oberflächen
56
6.6 Animation der Außenszenen
57
6.6.1 Erstellung der Szenen
58
6.6.2 Beleuchtung
58
6.6.3 Animation
59
6.7 Animation der Innenszenen
60
6.7.1 Erstellung der Szenen
60
6.7.2 Beleuchtung
60
6.7.3 Animation
61
6.8 Weitere Möglichkeiten der Präsentation
62
7
Zusammenfassung und Ausblick
63
Literaturverzeichnis 66
Abbildungsverzeichnis 71
Tabellen 72
Thesen zur Diplomarbeit
75
1 Einleitung
7
1 Einleitung
Als virtuelle Rekonstruktion oder virtuelle Archäologie wird die seit einiger Zeit genutzte
Methode der grafischen Darstellung nicht mehr vorhandener Gebäude bezeichnet. Mit
Hilfe der Computergrafik werden Modelle erstellt, die das ursprüngliche Aussehen der
Gebäude repräsentieren. Diese Modelle existieren nur in Form einer abstrakten Beschrei-
bung durch digitale Daten, und werden deshalb aufgrund ihrer immateriellen Beschaf-
fenheit virtuell genannt. Die Frage nach der ursprünglichen Form und Funktion eines
Gebäudes beantworten verschiedene wissenschaftliche Disziplinen auf unterschiedliche
Weise, in Form von Texten und Illustrationen. Einzig ein Nachbau in Form eines drei-
dimensionalen (materiellen oder virtuellen) Modells kann all diese Einzelergebnisse in
ihrer Gesamtheit darstellen.
Die virtuellen Rekonstruktionen sind jedoch nicht nur in der Lage, wissenschaftliche
Forschungsergebnisse zu präsentieren, vielmehr vermitteln sie ein lebendiges Bild
vergangener Welten; teilweise bieten sie dem Betrachter sogar eine interaktiv erlebbare
Darstellung. Doch werden trotz ständig steigender Bildqualität die virtuellen Räume
meist als das wahrgenommen, was sie sind nämlich Kunstprodukte. ,,Man erlebt Bilder,
keine Architektur", so beschreibt Marcus F
RINGS
die Wirkung virtueller Architektur auf
den Betrachter und stellt gleichzeitig in Aussicht, dass zukünftig dank steigender
Leistungsfähigkeit von Hard- und Software die virtuellen Modelle ,,wie Gebäude
rezipiert werden."
1
In einem anderen Bereich ist man der realistischen Wirkung der virtuellen Architektur-
modelle bereits sehr nahe gekommen. In modernen Spielfilmproduktionen sind am
Computer erschaffene Szenenbilder keine Seltenheit mehr, um eine erdachte oder
vergangene Realität wirkungsvoll umzusetzen. Virtuelle Gebäude oder ganze Städte sind
hier schon nicht mehr von reellen Kulissen zu unterscheiden. Auch im wissenschaft-
lichen Bereich ist die Qualität der Bilder in geradezu atemberaubenden Maße gestiegen.
Noch vor wenigen Jahren schrieb Kurt D
ENZER
von der Christian-Albrechts-Universität
Kiel enttäuscht: ,,Der virtuelle Gang übers Forum glich einem Gespenster-Spaziergang,
weil nichts zu sehen war: keine Menschen, kein Licht und Schatten, ja noch nicht einmal
eine erkennbare Struktur der Grundfläche des Platzes."
2
Solche detailarmen, abstrakten
Bilder haben aller technischen Errungenschaften zum Trotz nicht ausgedient, sie können
1
FRINGS 2001, S. 16
2
RIECHE 2002, S. 122
1 Einleitung
8
sogar einen eigenen ästhetischen Reiz besitzen. Je konkreter und glaubwürdiger dagegen
die Darstellung der virtuellen Architektur gelungen ist, um so mehr sieht sie sich dem
Vorwurf ausgesetzt, eine spekulative, ja sogar manipulierende Wirklichkeit erschaffen zu
wollen. Denn meist ist es unmöglich, definitive Aussagen über jedes Detail zu treffen,
wenn die originale Bausubstanz nicht mehr vorhanden ist ,,vieles bleibt offen, weil es
offen bleiben muss, oder weil man keine Festlegung verantworten möchte."
3
1.1 Problemstellung und Ziele der Arbeit
Sobald ein historisch bedeutendes Bodendenkmal aufgespürt und freigelegt wurde, betei-
ligen sich Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen an den Arbeiten, die
Aufschluss über den Ursprung, Form und Funktion des einstigen Gebäudes geben sollen.
Dabei kommen unzählige Einzelergebnisse zusammen, die nur in ihrer Gesamtheit eine
umfassende Antwort geben können. Um ein solches Gesamtergebnis anschaulich darzu-
stellen, bietet sich eine bildliche oder gegenständliche Umsetzung der einzelnen,
zunächst voneinander isolierten Ergebnisse an. Aus einer abstrakten Zeichnung oder
einem Modell des rekonstruierten Gebäudes wird durch die Vorstellungskraft des
Betrachters das Gebäude wieder zum Leben erweckt. Seit einigen Jahren bieten spezielle
Computerprogramme die Möglichkeit, die verschiedenen Einzelergebnisse im Computer
an einem virtuellen Modell zusammenzufügen. Den Möglichkeiten des neuen Mediums
entsprechend, führt die Darstellung immer mehr von den abstrakten, verallgemeinerten
Formen hin zu konkreten, die, in den Worten von Marcus F
RINGS
, ,,wie Gebäude
rezipiert werden."
4
Den neuen Möglichkeiten stehen aber auch neue Probleme gegenüber, denn
,,Archäologen haben bislang nur rekonstruiert, was sie wissenschaftlich belegen konnten,
und im sprachlichen Kommentar auf jene Unsicherheiten hingewiesen; demgegenüber
beleben jetzt virtuelle Welten auch die Lücken und das Leere archäologischer Lagen",
schreibt Wolfgang E
RNST
5
. Das Füllen der Lücken in den wissenschaftlichen Befunden
ist gleichzeitig die größte Herausforderung und das größte Problem der virtuellen Rekon-
struktion, und bietet auch Grund zur Kritik durch die Wissenschaftler. Andererseits
besitzen die realistischen Darstellungen virtueller Architektur, zu denen die heutige
Computergrafik in der Lage ist, einen Reiz, dem sich nur wenige Betrachter entziehen
3
FRINGS 2001, S. 16
4
FRINGS 2001, S. 16
5
RIECHE 2002, S. 111
1 Einleitung
9
können. Anliegen dieser Arbeit ist es daher, den Wunsch eines breiten Publikums nach
einer wirklichkeitsnahen Darstellung den Befürchtungen der Wissenschaftler gegenüber-
zustellen, dass ihre Arbeit verfälscht oder banalisiert wird. Den Interessen beider Seiten
gerecht zu werden, ein konkretes, plastisches Bild zu vermitteln, ohne Spekulationen
breiten Raum zu lassen, steht deshalb im Mittelpunkt dieser Untersuchung.
Dazu werden in einer Einführung in das Themengebiet alle wesentlichen Arbeitsschritte
zum Erstellen einer virtuellen Gebäuderekonstruktion aufgeführt, und abschließend
anhand eines Beispiels erläutert. Weiterhin werden einige bedeutende Arbeiten auf dem
Gebiet vorgestellt, um einen kurzen Überblick über die Entwicklung der virtuellen
Rekonstruktionen zu geben. Um die unterschiedlichen Möglichkeiten dieser noch sehr
jungen Technologie aufzuzeigen, sollen außerdem die Anwendungsgebiete sowie das
Verhältnis zu den traditionellen Rekonstruktionsweisen untersucht werden.
1.2 Vorbilder und klassische Rekonstruktionen
,,Die moderne abendländische Gesellschaft ist eine ,erinnerungsfreudige Kultur', die ihre
Vergangenheit ständig aufsammelt und festhalten möchte eine verständliche Reaktion
auf die rationale Dynamik der Moderne"
6
, schreibt Prof. Dr. Gerd-C. W
ENIGER
vom
Neanderthal Museum. So entwickelte sich beispielsweise die Rekonstruktion historischer
Gebäude mit dem Beginn des Industriellen Zeitalters. Als erste derartige Rekonstruktion
nennt Anita R
IECHE
das Pompejanum in Aschaffenburg, ein Mitte des 19. Jahrhunderts
entstandener Nachbau eines pompejanischen Hauses.
7
Auch die Herausbildung des
Museums als Institution zur Bewahrung und Präsentation unseres kulturellen Erbes fällt
in diese Zeit. Dabei waren maßstäblich angefertigte Modelle ,,von Beginn an Bestandteil
der musealen Darstellung"
8
und sind es bis heute geblieben.
Seit etwa Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts werden die traditionellen Rekon-
struktionen
9
durch die computergrafisch erstellte Variante ergänzt, von der sie sich ledig-
lich ,,durch ihre materielle Existenz, ihre definierte Größe und ihre Unbeweglichkeit"
10
unterscheiden. Wurden die virtuellen Darstellungen anfangs nur als Ersatz für die gegen-
6
RIECHE 2002, S. 96
7
RIECHE 2002, S. 93
8
RIECHE 2002, S. 93
9
siehe Kapitel 4
10
RIECHE 2002, S. 93f
1 Einleitung
10
ständlichen genutzt, so entstand bereits nach kurzer Zeit ein neues Fachgebiet ,,virtuelle
Archäologie", das sich mit den Möglichkeiten der neuen Medien beschäftigt.
1.3 Gliederung der Arbeit
Nach dieser Einleitung gibt das zweite Kapitel einen Überblick über die für die vor-
liegende Arbeit bedeutenden Grundlagen. Dabei wird zuerst darauf eingegangen, wie
eine historische Rekonstruktion eines Gebäudes entsteht. Danach folgt eine Einführung
in das Gebiet der dreidimensionalen Computergrafik sowie der Computeranimation.
Im dritten Kapitel werden die unterschiedlichen Anwendungsgebiete der virtuellen
Rekonstruktionen aufgezeigt. Dabei geht es vor allem um die unterschiedlichen
Ansprüche der Zielgruppen und die Anforderungen der verschiedenen Präsentationsme-
dien, wie Film, Fernsehen, CD-ROM, interaktive Kiosksysteme oder Internet.
Das vierte Kapitel wird verschiedene Alternativen zur virtuellen Rekonstruktion
vorstellen und diese mit ihren Vor- und Nachteilen gegenüberstellen.
Danach werden im fünften Kapitel herausragende Arbeiten auf dem Gebiet behandelt.
Die Auswahl beschränkt sich auf einige der bisherigen Arbeiten, die selbst als Meilen-
steine oder Wegbereiter für die Weiterentwicklung der virtuellen Rekonstruktionen
gelten können.
Im sechsten Kapitel wird die Entstehung einer solchen Rekonstruktion am Beispiel der
beiden Wallfahrtskirchen auf dem Burgstein beschrieben. Dieses Beispiel belegt
eindrücklich die Schwierigkeiten, ein konkretes Bild der Gebäude zu geben, von denen
heute kaum mehr als die Reste der Grundmauern erhalten geblieben sind.
Das siebte Kapitel gibt schließlich eine Zusammenfassung der erreichten Ergebnisse und
stellt einige Aspekte vor, die in weiterführenden Arbeiten behandelt werden könnten.
2 Grundlagen
11
2 Grundlagen
Schon seit einiger Zeit nutzen Architekten sogenannte CAD-Software für den Entwurf
von Gebäuden. Das ermöglicht ihnen nicht nur die einfache Umsetzung verschiedener
Konzeptionen oder die Berechnung der Statik sowie der Lichtverhältnisse im Verlauf der
Jahreszeiten. Vielmehr kann der Auftraggeber bereits ein Bild des fertigen Gebäudes
sehen, solange es sich noch im Planungsstadium befindet. Seitdem die erreichbare Bild-
qualität in den letzten Jahren durchaus als fotorealistisch bezeichnet werden kann, hat
sich die Architekturvisualisierung auch in anderen Bereichen durchgesetzt. So wie diese
immateriellen, virtuellen Gebäudemodelle in der Lage sind, noch nicht vorhandene
Gebäudeentwürfe darzustellen, bedienen sich Kunsthistoriker und Archäologen verstärkt
dieser Technik, um nicht mehr vorhandene Gebäude darzustellen.
,,Oft ist es kaum möglich, sich Dinge vorzustellen, weil man sich mit zweidimensionalen
Ansichten, mit Plänen und Schnittzeichnungen, komplizierter dreidimensionaler Objekte
behelfen muss"
11
, sagte Steffen K
IRCHNER
in seinem Vortrag über die ,,Virtuelle
Archäologie" auf der Internationalen Statustagung "Virtuelle und Erweiterte Realität" in
Leipzig über die Notwendigkeit, wissenschaftlichen Forschungsergebnissen eine Gestalt
zu geben. Eine hervorragende Möglichkeit bieten die virtuellen Modelle aufgrund ihrer
Flexibilität und ihrer breiten Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur für die Darstellung rekon-
struierter Gebäude hat sich diese Technik durchgesetzt, sondern auch in anderen Berei-
chen, um beispielsweise ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken oder
Funktionsmodelle von rekonstruierten Geräten oder Maschinen zu erstellen.
Hergestellt werden solche virtuellen Modelle mit üblicher CAD- bzw. 3D-Software, wie
sie auch von Architekten benutzt wird. Die unterschiedliche Bezeichnung der Software in
den verschiedenen Fachrichtungen kommt durch die unterschiedliche Genese in den
Bereichen Entwurf (Computer Aided Design, CAD) sowie Bilderzeugung (3D-Grafik).
12
Während Archäologen und Kunsthistoriker oft von CAD oder Virtueller Realität
sprechen, wird in dieser Arbeit vorrangig auf die Begriffe aus der Computergrafik
zurückgegriffen. Da es bisher keinen gemeinsamen Fachwortschatz der verschiedenen
beteiligten Fachrichtungen aus Wissenschaft und Technik gibt, fehlen oft eindeutige
Bezeichnungen besonders für Vorgänge, die sich virtuell und an immateriellen Objek-
ten abspielen. In ihrer Arbeit über die ,,Fachsprache der neuen Archäologie" schreibt
11
KIRCHNER 2002
12
siehe Abschnitt 2.2.1 Gesch
ichte der 3D-Grafik
2 Grundlagen
12
Tina Z
AWADIL
deshalb: ,,Die Erfassung der Terminologie zum Wortfeld virtuelle
Archäologie befindet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Anfangsphase."
13
Für die virtuellen Rekonstruktionen ergeben sich im wesentlichen zwei Arbeitsfelder:
Zum einen die eigentliche Rekonstruktion, die sich auf die vorhandenen Quellen stützt,
und deren Ergebnis die Beschreibung des darzustellenden Bauwerks ist, zum anderen die
Umsetzung mit Hilfe von CAD bzw. 3D-Grafik sowie der Computeranimation.
2.1 Rekonstruktion historischer Gebäude
Jede Gebäuderekonstruktion stützt sich auf Annahmen, die anhand vorliegender Beweise
und Indizien aufgestellt werden. Ist ein Gebäude einmal zerstört, so lassen sich nur noch
für wenige Tatsachen Beweise finden, beispielsweise durch archäologische Grabungen,
oder durch Untersuchungen und Vermessungen der verbliebenen Bausubstanz. Eine
gesicherte Annahme lässt sich allerdings nur auf der Grundlage von unmittelbaren
Belegen aufstellen. Dazu zählen z.B. alle Messungen, die an noch vorhandenen Gebäude-
resten vorgenommen werden können. Mittelbare Beweise, wie Altersbestimmungen von
organischen Materialien oder historische Quellen, lassen aufgrund ihrer möglichen
Fehlerquellen nur Schlüsse zu, die im besten Fall durch weitere Hinweise bekräftigt
werden müssen. Für nicht belegbare Details müssen alle Möglichkeiten in Betracht
gezogen werden, um die wahrscheinlichste Alternative zu bestimmen.
In den wenigsten Fällen lassen sich definitive Festlegungen zu allen Details treffen, die
für eine vollständige Rekonstruktion notwendig wären. Daher gibt es vier verschiedene
Möglichkeiten der Umsetzung:
· Die Umsetzung der Variante, die von Fachleuten bzw. Laien als die glaub-
würdigste und wahrscheinlichste Alternative angenommen wird.
· Die Offenlassung nicht belegbarer Fakten. Dabei wird die Rekonstruktion nur
teilweise ausgeführt, wobei aber alle umgesetzten Details wissenschaftlich nach-
weisbar sind. In manchen Fällen, besonders wenn kaum belegbare Fakten
vorhanden sind, wäre das Ergebnis aber nur wenig anschaulich.
· Die Visualisierung von Unsicherheiten. Dies wurde bei der Rekonstruktion der
Magdeburger Kaiserpfalz angewendet.
14
Denkbar wäre beispielsweise der Einsatz
13
ZAWADIL 2003, S. 191
2 Grundlagen
13
von Liniengrafiken mit Skizzencharakter oder von Bildkompositionen, wie es
Tobias I
SENBERG
in seiner Arbeit ,,Visualisierung von Modellierungsunsicher-
heiten und Unsicherheiten in virtuellen Rekonstruktionen" beschrieben hat.
15
· Die Umsetzung mehrerer Möglichkeiten. Dabei entstehen unterschiedliche Re-
konstruktionen, bei denen jeweils eine der denkbaren Varianten umgesetzt wird.
2.1.1 Voraussetzungen
Erste wesentliche Voraussetzung für die Rekonstruktion eines Gebäudes ist die bauge-
schichtliche Einordnung. Eine Analyse der Baustile ermöglicht wiederum weitere Rück-
schlüsse auf das Aussehen des Bauwerks, ebenso wie von bestimmten Details auf den
Baustil geschlossen werden kann. Jeder Baustil, ob Romanik, Gotik oder Barock, hat
seine eigene, unverwechselbare Formensprache, die sich in typischen, immer wieder-
kehrenden Formen für Bögen, Gewölben, Säulen und andere Bauelemente manifestiert.
Da die verschiedenen Baustile zeitlich begrenzt sind, kann damit schon eine erste Fest-
stellung über das Alter des betreffenden Bauwerks gemacht werden. Eine genauere
Datierung gelingt mit Hilfe unterschiedlicher Methoden, wie der Radiokarbon-Methode
(anhand der Konzentration des Kohlenstoffisotops C-14 in organischen Materialien)
16
oder der Dendrochronologie (anhand der Jahresringe evtl. vorhandener Holzreste)
17
sowie weiterer Datierungsmethoden, wie etwa dem Thermolumineszenz-Verfahren.
18
Auch aus der ursprünglichen Funktion eines Gebäudes lassen sich Schlüsse auf das
einstige Aussehen ableiten. Diese Entsprechung von Form und Funktion muss bei der
Rekonstruktion mit einbezogen werden, da z.B. ein religiöses Bauwerk andere Schlüsse
zulässt, als ein profanes. Das gilt ebenso für die Unterscheidung von repräsentativer und
funktionaler Architektur.
Weiterhin können alle erforderlichen Maße und Größenverhältnisse von evtl. vor-
handenen Fundamenten oder Grabungsberichten übernommen werden. Wo dies nicht
mehr möglich ist, können statt dessen mittelbare Quellen, wie Grund- und Aufrisse, alte
Ansichten oder Luftbilder verwendet werden. Als weitere Quellen kommen außerdem
14
siehe Abschnitt 5.4
15
ISENBERG 1999
16
ZAWADIL 2003, S. 164ff
17
ZAWADIL 2003, S. 95f sowie ROBIN 1992, S. 131
18
PM 2000, S. 46f
2 Grundlagen
14
historische Urkunden und Akten in Frage, die in den entsprechenden Archiven oder in
Regesten
19
einsehbar sind.
2.1.2 Methoden der Entscheidungsfindung
Nachdem alle Spuren des Gebäudes vor Ort sowie alle Hinweise in den Quellen ausrei-
chend dokumentiert wurden, beginnt die eigentliche Arbeit an der Rekonstruktion. Auf
Grundlage der Dokumentation kann nun das Aussehen des rekonstruierten Gebäudes
festgestellt bzw. abgeleitet werden. Die hier vorgestellte Methodik beruht auf der Arbeit
,,Virtual Reconstruction of Medieval Architecture" von Maic M
ASUCH
u.a.
20
Danach
können die Quellen, die sich für eine Rekonstruktion anbieten, in die folgenden Katego-
rien unterteilt werden:
· Befunde bzw. Feststellungen: Hierunter fallen alle am Gebäude bzw. Aus-
grabungsplatz gefundene Artefakte (,,findings").
· Schlussfolgerungen: Alle Fakten, die sich unmittelbar aus den Befunden ableiten
lassen, werden als Schlussfolgerungen (,,deductions") bezeichnet.
· Analogien bzw. Entsprechungen: Hier handelt es sich um Fakten, die sich nicht
mehr am betreffenden Gebäude selbst nachweisen lassen, sondern statt dessen
von ähnlichen Gebäuden aus der gleichen Stilepoche abgeleitet werden
(,,analogies").
· Annahmen: Alle Details, die sich nicht aus einem vergleichbaren Vorbild ableiten
lassen, und auf reinen Vermutungen basieren, gehören in diese Kategorie
(,,assumptions").
Eine hundertprozentig stichhaltige Rekonstruktion könnte daher nur auf der Basis von
Befunden erstellt werden. Dies würde jedoch voraussetzen, dass noch einhundert Prozent
der originalen Bausubstanz vorhanden sind was eine Rekonstruktion von vornherein
unnötig erscheinen lässt. Die Klassifizierung der verwendeten Quellen in diese oder
eine ähnliche Systematik ist erforderlich, um eine spätere Fehlerabschätzung zu
ermöglichen. Hierfür erscheint es wichtig, nachvollziehen zu können, unter welchen
Umständen die verschiedenen Einzelergebnisse zustande gekommen sind.
19
Regesten: Zusammenfassungen von Quellen und Urkunden durch einen modernen Bearbeiter (nach
GOETZ 1993, S. 103)
20
MASUCH 1999
2 Grundlagen
15
2.1.3 Möglichkeiten und Grenzen
Die wesentliche Beschränkung geht schon aus dem vorherigen Abschnitt hervor: Eine
vollständige und vollständig belegbare Rekonstruktion zu erstellen, ist ebenso unmöglich
wie unnötig. So sehen sich alle Rekonstruktionen dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden
mit den wissenschaftlichen Fakten nicht sorgfältig genug umgehen, wenn nicht aus-
drücklich auf ihre mehr oder weniger spekulative Natur hingewiesen wird. Doch gerade
dieser relativ freie Umgang mit den zur Verfügung stehenden Fakten gibt auch den
Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse und Annahmen anhand eines Mo-
dells zu verifizieren, und erlangt damit Bedeutung in der experimentellen Archäologie.
21
Eine weitere Möglichkeit bietet die Gebäuderekonstruktion zur Darstellung verschie-
dener aufeinanderfolgender Bauabschnitte. Somit lassen sich die gewonnenen Erkennt-
nisse nicht nur systematisch, sondern auch chronologisch einordnen. Dies ermöglicht
unter anderem die Visualisierung einer Stadtentwicklung, wie es beispielsweise in Form
einer virtuellen Rekonstruktion für die Stadt Jülich umgesetzt wurde.
22
2.2 Visualisierungen mit Hilfe von 3D-Grafik
Schon seit der Antike beflügelt der Wunsch, die Realität abzubilden, Künstler und
Mathematiker gleichermaßen. Die ersten perspektivischen Darstellungen sind bereits aus
dem 7. und 6. vorchristlichen Jahrhundert überliefert.
23
Der griechische Gelehrte E
UKLID
(ca. 325-270 v. Chr.) veröffentlichte mit seinem Werk ,,Structura" eines der bedeu-
tendsten mathematischen Grundlagenwerke.
24
In diesem Buch sind die wichtigsten
mathematischen Erkenntnisse der antiken Welt zusammengefasst. Besonders seine
geometrischen und stereographischen Darlegungen sind Voraussetzungen für die
perspektivische Darstellung auf der Leinwand und auf dem Bildschirm.
Aus dem Mittelalter sind dagegen kaum perspektivisch korrekte Abbildungen überliefert.
Die zumeist religiösen Bildnisse aus dem Mittelalter sind weniger eine Darstellung der
Wirklichkeit, als ein Kommunikationsmedium für die Menschen, die meist weder lesen
noch schreiben konnten. Um Geschichten oder Gleichnisse im Bild festzuhalten, bediente
21
vgl. MÜLLER 1999a, 1999b, 2000
22
siehe Abschnitt 5.3
23
LEISTER 1991, S. 2
24
ROBIN 1992, S. 153
2 Grundlagen
16
man sich daher meist der ,,Bedeutungsperspektive".
25
Die früheste nachantike Form der
perspektivischen Darstellung befindet sich im Chambre du Cerf im ehemaligen Papst-
palast in Avignon. Das päpstliche Arbeits- und Wohnzimmer ließ Papst C
LEMENS
VI. im
Jahre 1343 mit einem Fresko einer Jagdlandschaft ausgestalten.
26
Zu einem erneuten Höhepunkt der perspektivischen Darstellung kam es während der
Renaissance. Besonders hervorzuheben sind die Arbeiten von Leon Battista A
LBERTI
, der
in seinem 1435 erschienenen Werk ,,De pictura" erstmals die perspektivische Zentral-
projektion beschrieb.
27
Schon Albrecht D
ÜRER
(1471-1528) war mit der perspektivischen
Darstellung vertraut (siehe Abbildung 1). Die räumliche Wirkung seiner Holzschnitte
entsteht nicht nur aus der richtigen Perspektive, sondern auch aus der natürlichen Licht-
wirkung.
28
Abbildung 1: Il pittore studia la prospettiva,
Albrecht Dürer 1525
Auch spätere Stilrichtungen, wie der Illusionismus oder die sogenannte Trompe l'oeil,
haben die möglichst realistische Darstellung des dreidimensionalen Raums auf einer
zweidimensionalen Fläche zum Ziel. Diesen ,,Schein des Wirklichen"
29
erreichen die
damaligen Künstler mit verschiedenen Techniken, um einerseits die richtige Darstellung
der Perspektive zu finden und andererseits eine realistische Wirkung von Licht und
Schatten nachzubilden. Der Eindruck von der Tiefe des Raumes soll beim Betrachter
durch eine täuschend echte Abbildung hervorgerufen werden.
25
LEISTER 1991, S. 2
26
GRAU 2000, S. 32
27
LEISTER 1991, S. 2
28
ROBIN 1992, S. 202
29
GRAU 2000, S. 16
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832485030
- ISBN (Paperback)
- 9783838685038
- DOI
- 10.3239/9783832485030
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig – Polygraphische Technik
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- gebäudekonstruktionen architektur-visualisierung archäologie beleuchtung
- Produktsicherheit
- Diplom.de