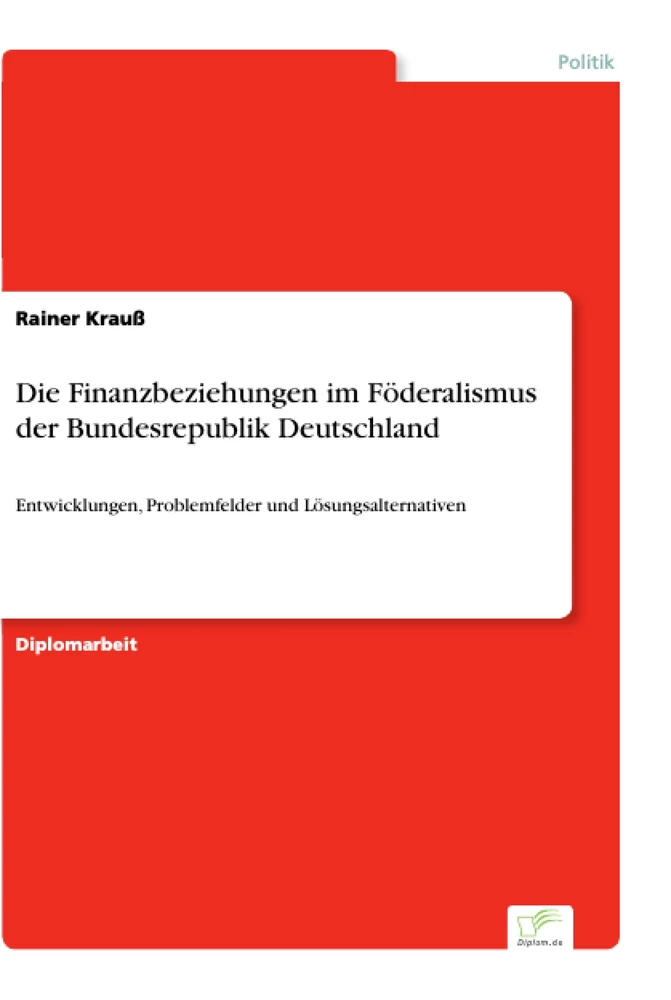Die Finanzbeziehungen im Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland
Entwicklungen, Problemfelder und Lösungsalternativen
©2004
Diplomarbeit
150 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Trotz manch eines radikalen Befürworters im Stile Kinskys: Der deutsche Föderalismus hat es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht allzu leicht, sein Erhalt in jetziger Form ist ungewiss. Die Bewahrer der föderalen Staatsidee befinden sich in einem harten Ringen mit Kritikern der Staatsgliederung. Das Bundesstaatsprinzip, einst als rechtspolitischer Exportschlager 1787 in den USA verwirklicht, ist als Organisationsprinzip Deutschlands anno 2004 zwar grundsätzlich unangefochten, seine Einzelelemente sind aber regelmäßig Gegenstand heftiger Diskussionen.
Bald von dieser, bald von jener Seite werden sie oft wohl aus machtpolitischem Eigeninteresse öffentlich in Frage gestellt. So wird gefordert, den Anteil der mittlerweile rund 60 % zustimmungspflichtigen Gesetze einzuschränken und so den Ländereinfluss im sonst blockadefähigen Bundesrat zurückzuschrauben. Ein anderer Vorschlag von Bundesseite besagt, aus finanziellen Gründen besser auf ein Stück bundesstaatlicher Vielfalt zu verzichten: Die Anzahl der deutschen Bundesländer solle im Sinne einer kostensparenderen Verwaltung deutlich reduziert werden. Auf der Strecke bliebe in beiden Fällen ein Teil des vom Parlamentarischen Rat 1949 eingeforderten Gegengewichtes zum Zentralstaat, der Einfluss des Bundestages würde dagegen bei einer Verwirklichung solcher Pläne augenblicklich anwachsen.
Ob sachliche Überlegungen hinter diesen Forderungen stehen oder doch nur ein ausgeprägtes Interesse sich - von Seiten der bundesweit Regierenden - die Arbeit zu erleichtern, das ist oft nicht zu unterscheiden und liegt von Fall zu Fall im Auge des Betrachters. Man könnte allerdings argumentieren, dass in Zusammenhängen der demokratischen Problemverarbeitung generell eine lineare Zentralisierung der Entscheidungskompetenzen unübersehbar sei. Nicht wenige Föderalismus-Wissenschaftler warnen allerdings davor, dynamische Veränderungsprozesse im föderativen Staat vorschnell als Auflösung des Föderalismus aufzufassen.
Der Hinweis ergeht mit Recht, denn die unteren föderalen Ebenen machen ihre vielfältigen Einflussmöglichkeiten genauso geltend. Allerdings: Die meisten Forderungen aus der Länderebene sind auf den ersten Blick lediglich dazu geeignet, das föderative Ziel Machtaufgliederung, nicht aber die solidarische Zielsetzung der Integration heterogener Gesellschaften, zu erreichen. Schließlich vermittelt sich dem interessierten Betrachter nicht selten das Bild, es gehe in den […]
Trotz manch eines radikalen Befürworters im Stile Kinskys: Der deutsche Föderalismus hat es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht allzu leicht, sein Erhalt in jetziger Form ist ungewiss. Die Bewahrer der föderalen Staatsidee befinden sich in einem harten Ringen mit Kritikern der Staatsgliederung. Das Bundesstaatsprinzip, einst als rechtspolitischer Exportschlager 1787 in den USA verwirklicht, ist als Organisationsprinzip Deutschlands anno 2004 zwar grundsätzlich unangefochten, seine Einzelelemente sind aber regelmäßig Gegenstand heftiger Diskussionen.
Bald von dieser, bald von jener Seite werden sie oft wohl aus machtpolitischem Eigeninteresse öffentlich in Frage gestellt. So wird gefordert, den Anteil der mittlerweile rund 60 % zustimmungspflichtigen Gesetze einzuschränken und so den Ländereinfluss im sonst blockadefähigen Bundesrat zurückzuschrauben. Ein anderer Vorschlag von Bundesseite besagt, aus finanziellen Gründen besser auf ein Stück bundesstaatlicher Vielfalt zu verzichten: Die Anzahl der deutschen Bundesländer solle im Sinne einer kostensparenderen Verwaltung deutlich reduziert werden. Auf der Strecke bliebe in beiden Fällen ein Teil des vom Parlamentarischen Rat 1949 eingeforderten Gegengewichtes zum Zentralstaat, der Einfluss des Bundestages würde dagegen bei einer Verwirklichung solcher Pläne augenblicklich anwachsen.
Ob sachliche Überlegungen hinter diesen Forderungen stehen oder doch nur ein ausgeprägtes Interesse sich - von Seiten der bundesweit Regierenden - die Arbeit zu erleichtern, das ist oft nicht zu unterscheiden und liegt von Fall zu Fall im Auge des Betrachters. Man könnte allerdings argumentieren, dass in Zusammenhängen der demokratischen Problemverarbeitung generell eine lineare Zentralisierung der Entscheidungskompetenzen unübersehbar sei. Nicht wenige Föderalismus-Wissenschaftler warnen allerdings davor, dynamische Veränderungsprozesse im föderativen Staat vorschnell als Auflösung des Föderalismus aufzufassen.
Der Hinweis ergeht mit Recht, denn die unteren föderalen Ebenen machen ihre vielfältigen Einflussmöglichkeiten genauso geltend. Allerdings: Die meisten Forderungen aus der Länderebene sind auf den ersten Blick lediglich dazu geeignet, das föderative Ziel Machtaufgliederung, nicht aber die solidarische Zielsetzung der Integration heterogener Gesellschaften, zu erreichen. Schließlich vermittelt sich dem interessierten Betrachter nicht selten das Bild, es gehe in den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8690
Krauß, Rainer: Die Finanzbeziehungen im Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland
- Entwicklungen, Problemfelder und Lösungsalternativen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Ludwig-Maximilians-Universität München, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
2
Inhalt
I. EINLEITUNG___________________________________________________________4
II. THEORETHISCHER HINTERGRUND_ ___________________________________9
1.
Föderalismus
als
modernes
Ordnungsprinzip
9
1.1 Die Wegbereiter
9
1.1.1
Pierre
Joseph
Proudhon
10
1.1.2
Constantin
Frantz
12
1.2 Definitionen des Föderalismusbegriffes
13
1.2.1 Der verfassungsrechtliche Ansatz
14
1.2.2 Der politikwissenschaftliche Ansatz
15
1.2.3 Der ökonomische Ansatz
16
1.3 Die politökonomische Theorie des Föderalismus
18
2.
Weitere
notwendige
Begriffsdefinitionen
21
2.1 Das Subsidiaritätsprinzip
21
2.2 Das Äquivalenzprinzip
22
3. Historische Grundlagen des Föderalismus
in
der
BRD
23
3.1
Die Entwicklung der bundesstaatlichen Ordnung
23
3.1.1 Historische Verfassungen im
Kurzüberblick
24
3.1.1.1 Die Paulskirchen-Verfassung von 1849
24
3.1.1.2 Die Reichsverfassung von 1871
25
3.1.1.3 Die Verfassung der Weimarer Republik
26
3.1.2 Prozesse der Systemfindung nach 1945
27
3.2
Das Föderalstaatsprinzip der Bundesrepublik
30
3.3
Ziele der föderalen Gliederung in Gesetz und Wirklichkeit
35
4. Fazit:
Der Zielkonflikt ,,Gleichheit
vs.
Effizienz" 38
III. FÖDERALE FINANZBEZIEHUNGEN IM WANDEL_______________________43
1. Finanzpolitische Grundsatzentscheidungen nach der Deutschen Einheit
43
1.1 Finanzwirtschaftliche
Komponenten im 1. Staatsvertrag
44
vom
18.05.1990
1.2
Der Einigungsvertrag vom 31.08.1990
44
1.3
Der West-Ost-Solidarpakt vom 13.03.1993
45
1.4
Das Finanzausgleichsgesetz vom 23.06.1993
47
2. Die Finanzbeziehungen in der geltenden Finanzverfassungsordnung
48
und die realen Finanzströme seit 1990
(eine Gegenüberstellung von Zielanspruch, Verfahren und Ergebnissen)
2.1
Die
Gesetzgebungskompetenzen
49
2.2
Aufteilung
der
Finanzierungslasten
51
2.2.1 Die Ausgabenentwicklung von Bund, Ländern und Gemeinden 54
2.2.2 Die Entwicklung der Mischfinanzierungstatbestände
58
2.3
Die 1. Stufe des Ausgleichs Die Verteilung der Steuererträge 59
2.3.1
Die
vertikale
Steuerverteilung
60
2.3.2 Die horizontale Steuerverteilung
63
2.3.3 Die Einnahmenentwicklung von Bund, Ländern und Kommunen 64
3
2.4
Die 2. Stufe des Ausgleichs Die Angleichung der Finanzkraft
68
2.4.1
Ziele
und
Aufgaben
68
2.4.2 Das Verfahren im horizontalen Finanzausgleich
71
2.4.3 Vertikaler Finanzausgleich durch Bundesergänzungszuweisungen 73
2.4.4 Das Verfahren im kommunalen Finanzausgleich
74
2.4.5 Die Entwicklung im horizontalen Finanzausgleich
77
2.4.6 Die Entwicklung der Ergänzungszuweisungen
81
2.4.7 Die Entwicklung im kommunalen Finanzausgleich
84
2.5
Die Verschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden
86
3. Änderungsbestrebungen der näheren Zukunft einige Ausblicke
90
3.1 Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
zum Länderfinanzausgleich vom 11.11.1999
90
3.2 Nivellierung des Länderfinanzausgleiches ab 2005
93
3.3
Die
Gemeindefinanzreform
95
3.4 Die
Föderalismus-Kommission
des Deutschen Bundestages
97
4. Fazit:
Oft unsinnig, meist undurchschaubar und viel zu lange unbeweglich
der gesamtdeutsche Bundesstaat bedarf der raschen Neuordnung
98
IV. WETTBEWERBSFÖDERALISMUS ALS ALTERNATIVMODELL_________106
1.
Das
Konzept
des
Wettbewerbsföderalismus
106
1.1
Geschichte des Begriffs und fortschreitende
Diskussionsverengung 107
1.2
Zielsetzung
und
Rahmenbedingungen 108
1.3
Die
Idee
der
Steuerautonomie 109
1.3.1
Aktuelle
Relevanz
109
1.3.2
Das
Tiebout-Modell
110
1.4
Mögliche praktische Anwendungsbereiche
112
2.
Gegenpositionen
zum
föderalen
Wettbewerbsmodell
115
2.1
Die Kritik an der Anreizthese
115
2.2
Das MacDougall-Kemp-Modell
-
,,the
race
to
the
bottom"
117
2.3
Die Kritik am kommunalen
Steuerwettbewerb
118
2.4
Die Kritik am internationalen Steuerwettbewerb
120
3. Fazit:
Wettbewerbselemente drängen sich auf in Fiskalpolitik und Legislative
122
V. SCHLUSSFOLGERUNGEN____________________________________________127
BIBLIOGRAPHIE________________________________________________________132
NACHBEMERKUNG ZU DATEN UND GRAPHIKEN ________________________147
LEBENSLAUF___________________________________________________________148
4
,,Die Krisen und Konflikte, mit denen wir
konfrontiert sind, stellen uns vor die Frage, ob denn
andere Lösungen als diejenigen des Föderalismus
überhaupt wünschenswert sind, wenn die
Menschheit nicht in einem perfekten Totalitarismus
oder in der totalen Selbstzerfleischung untergehen
soll."
1
(Ferdinand Kinsky)
I. Einleitung
Trotz manch eines radikalen Befürworters im Stile Kinsky's: Der deutsche Föderalismus hat
es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht allzu leicht, sein Erhalt in jetziger Form ist ungewiss.
Die Bewahrer der föderalen Staatsidee befinden sich in einem harten Ringen mit Kritikern der
Staatsgliederung. Das Bundesstaatsprinzip, einst als ,,rechtspolitischer Exportschlager"
2
1787 in den USA verwirklicht, ist als Organisationsprinzip Deutschlands anno 2004 zwar
grundsätzlich unangefochten, seine Einzelelemente sind aber regelmäßig Gegenstand heftiger
Diskussionen. Bald von dieser, bald von jener Seite werden sie oft wohl aus
machtpolitischem Eigeninteresse öffentlich in Frage gestellt. So wird gefordert, den Anteil
der mittlerweile rund 60 % zustimmungspflichtigen Gesetze
3
einzuschränken und so den
Ländereinfluss im sonst blockadefähigen Bundesrat zurückzuschrauben. Ein anderer
Vorschlag von Bundesseite besagt, aus finanziellen Gründen besser auf ein Stück
bundesstaatlicher Vielfalt zu verzichten: Die Anzahl der deutschen Bundesländer solle im
Sinne einer kostensparenderen Verwaltung deutlich reduziert werden. Auf der Strecke bliebe
in beiden Fällen ein Teil des vom Parlamentarischen Rat 1949 eingeforderten
Gegengewichtes zum Zentralstaat
4
, der Einfluss des Bundestages würde dagegen bei einer
Verwirklichung solcher Pläne augenblicklich anwachsen. Ob sachliche Überlegungen hinter
diesen Forderungen stehen oder doch nur ein ausgeprägtes Interesse sich - von Seiten der
bundesweit Regierenden - die Arbeit zu erleichtern, das ist oft nicht zu unterscheiden und
1
Ferdinand Kinsky: Integraler Föderalismus als Mittel permanenter Konfliktregelung. In: Esterbauer,
Fried/Guy Heraud/Peter Pernthaler (Hrsg): Föderalismus als Mittel permanenter Konfliktregelung. Wien 1977,
S. 49.
2
Heiderose Kilper/Roland Lhotta: Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung.
Opladen 1996, S. 40.
3
Vgl. Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 175.
4
Vgl. Heinz Laufer: Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1974, S. 43.
5
liegt von Fall zu Fall im Auge des Betrachters. Man könnte allerdings argumentieren, dass in
Zusammenhängen der demokratischen Problemverarbeitung generell eine lineare
Zentralisierung der Entscheidungskompetenzen unübersehbar sei.
5
Nicht wenige
Föderalismus-Wissenschaftler warnen allerdings davor, ,,dynamische Veränderungsprozesse
im föderativen Staat vorschnell als Auflösung des Föderalismus" aufzufassen.
6
Der Hinweis ergeht mit Recht, denn die unteren föderalen Ebenen machen ihre vielfältigen
Einflussmöglichkeiten genauso geltend. Allerdings: Die meisten Forderungen aus der
Länderebene sind auf den ersten Blick lediglich dazu geeignet, das föderative Ziel
,,Machtaufgliederung", nicht aber die solidarische Zielsetzung der ,,Integration heterogener
Gesellschaften"
7
, zu erreichen. Schließlich vermittelt sich dem interessierten Betrachter nicht
selten das Bild, es gehe in den tagesaktuellen und allgegenwärtigen Streitkonflikten des
föderativen Systems oft nur um Auseinandersetzungen zwischen armen und reichen
Bundesländern. Seit der Deutschen Einheit 1990 ließ sich dieser Vorgang bedauerlicherweise
auf einen noch deutlicheren Nenner bringen: ,,Reich gegen arm", das hieß sehr häufig ,,West
gegen Ost". Allein eine Frage bestimmte hinter vorgehaltener Hand die Diskussion: Wie viel
sind einige westdeutsche Länder im Stande oder willens für den Aufbau Ost zu leisten? Eine
finanzpolitische Gretchenfrage. Und das, obwohl ein großer Teil der Anschubfinanzierung für
das Großprojekt Einheit nicht von den Bundesländern, sondern vom Bund selbst bezahlt
wurde und wird.
Es hat allen Anschein, als ob in Bundes- und Landespolitik rein monetäre Aspekte und
Machtinteressen den - zugegeben sehr idealistischen - Solidaritätsgedanken zwischen den
verschiedenen Regionen und Gesellschaften längst überlagert haben.
In schöner Regelmäßigkeit steht das komplizierte deutsche Finanzgeflecht, allem voran der
Finanzausgleich am Pranger. Arme Länder und Gemeinden, die sogenannten ,,Nehmer",
versuchen angesichts flauer Konjunktur und der so reduzierten Steuereinnahmen ihre
Einnahmeausfälle über vertikale und horizontale Verteilungsmechanismen zu kompensieren.
Die ,,Geber", also Länder und Kommunen mit - gemessen am Bundesergebnis -
überdurchschnittlichem Steueraufkommen, versuchen andererseits sich so wenig wie möglich
von ihrem positiven Saldo wegnehmen zu lassen. An dieser Schwelle verlaufen die Grenzen
5
Vgl. Arthur Benz: Föderalismus als dynamisches System. Zentralisierung und Dezentralisierung im
föderativen Staat. Westdeutscher Verlag, Opladen 1985, S. 87.
6
Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 16.
7
Dieter Nohlen (Hrsg.): Wörterbuch Staat und Politik. Bonn 1998, S. 155 ff.
6
fließend, an denen aus gebotener wirtschaftlicher Hilfe fast planwirtschaftliche
Gleichmacherei, oder umgekehrt argumentiert, aus berechtigtem Eigeninteresse fast
rücksichtsloser Egoismus zu entstehen scheint. Es stellt sich also die Frage nach der
,,Intensität und den Grenzen eines föderativen Finanzausgleiches".
8
Fast tagtäglich füllt der scharf und unnachgiebig ausgetragene Konflikt zwischen
Solidaritätsgedanken und Leistungsprinzip die Kommentarspalten der Zeitungen oder die
Nachrichtensendungen des Fernsehens. Gegner und Verfechter des gerade aktuellen
Verteilungssystems operieren mit genauso verwirrenden wie beeindruckenden
Zahlenkolonnen. Doch trotz der Präsenz des Themas in der täglichen Diskussion: Die
Finanzsituation in der BRD war lange vor allem durch rechtliche ,,Kontinuität", im
erkenntnistheoretischen Sinne einer bruchlosen und fortlaufenden Entwicklung
9
, aber
keinesfalls durch eine bloße ,,Zusammenreihung abgrenzbarer Einzelvorgänge"
10
gekennzeichnet. Nicht ohne Grund tat sich lange nicht viel Entscheidendes: Die Differenzen
und Interessensgegensätze sind in föderalen Finanzfragen traditionell so groß, dass sie keine
oder nur sehr marginale Kompromisse zulassen. In Ermangelung politischer Lösungen
konnten bislang allein Urteile des Bundesverfassungsgerichtes Bewegung in den Prozess der
zweifellos notwendigen Neugliederung des deutschen Föderalismus bringen. Letztmals
geschah dies mit dem Spruch der Karlsruher Richter zur Neugestaltung des
Länderfinanzausgleiches vom 11. November 1999. Dieses Datum stellt in der Geschichte der
föderativen Finanzbeziehungen einen zukunftweisenden Wendepunkt dar, auf den in der
vorliegenden Arbeit ähnlich detailliert eingegangen werden soll wie auf die Einbeziehung der
Neuen Länder in den Länderfinanzausgleich zum 1.1.1995.
Allerdings, dies sei als kleiner Einschub erlaubt: Die Finanzverfassung der Bundesrepublik
bildet nicht nur den am meisten angegriffenen Teil des Grundgesetzes, sondern auch ein
unabdingbares Herzstück und den Motor des gesamten deutschen Verfassungswerkes. Auch
diese Tatsache darf bei aller Bezugnahme auf kritische Stimmen nicht unterschlagen werden.
Die Verfassungs-Artikel 104 ff. sind die Basis der staatlichen Aufgabenerfüllung und wohl
der Rechtsbereich mit der höchsten Regelungsdichte weltweit.
11
Allerdings liefert gerade
dieses letzte Faktum bereits wieder Nahrung für Kritiker. Schließlich ist die bundesdeutsche
8
Otto-Erich Geske: Der Länderfinanzausgleich wird ein Dauerthema. In: Wirtschaftsdienst, 72. Jahrgang,
1992/V, S. 251 f. Auch: Rolf Peffekoven: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum
Länderfinanzausgleich, in: Wirtschaftsdienst, 72. Jahrgang, 1992/VII, S. 349 ff.
9
Vgl. Fritz Wagner: Geschichtswissenschaft. Freiburg i. Breisgau 1951, S. 356.
10
Fritz Wagner, Geschichtswissenschaft, S. 356.
11
Vgl. Alexander Jörg: Finanzverfassung und Föderalismus in Deutschland und in der Schweiz. Baden-Baden
1998, S. 34 ff.
7
Finanzverfassung mitverantwortlich dafür, dass 60 Prozent der globalen Steuerliteratur in
Deutschland verfasst wurde und vieles den Bundesbürgern nicht transparent genug, ja
eigentlich eher komplett undurchsichtig erscheint.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Bogen zu spannen, ausgehend von den Grundlagen des
Föderalismus, über die Rechtsbasis im Grundgesetz, bis hin zum derzeit gültigen
Finanzausgleich. Dabei soll die Frage geklärt werden, inwiefern das Ergebnis noch den
zugrunde liegenden Prinzipien entspricht. Anspruch der Arbeit ist es auch, die finanzielle
Lebensfähigkeit des föderalen Systems in der Bundesrepublik Deutschland unter dem
Gesichtspunkt der Langfristigkeit einer Prüfung zu unterziehen. Können in absehbarer
Zukunft noch deutschlandweit die verfassungsgemäß erwünschten ,,gleichwertigen
Lebensverhältnisse"
12
garantiert werden? Sollte dies unter den gegebenen Umständen nicht zu
leisten sein, schließt sich die Frage nach Alternativen zum bisherigen Modell an. Wie
umfassend oder gar gravierend müssen Reformen im föderalen Verteilungsmodus sein, um
Ansprüchen der Bürger und Finanzierungsgrenzen in Zukunft gerecht werden zu können?
Anders gefragt: Reichen mittlerweile in die Wege geleitete Änderungen aus oder sind diese
nur die zwangsläufigen Vorboten noch weiter gehender Umstrukturierungen? Endziel ist also,
einen konkreten Einblick in Nachhaltigkeit des föderalen Systems und seiner Finanzströme zu
geben. Es ist ausdrücklich nicht das Ziel der Arbeit, sich allein rückblickend mit
Folgeerscheinungen der deutschen Einheit zu beschäftigen. Die Abhandlung soll gegenwarts-
bzw. zukunftsorientiert gestaltet sein. Nicht die Auslöser momentaner Probleme stehen im
Mittelpunkt, sondern die Vergegenwärtigung möglicher Missstände und Ansätze zu deren
Bewältigung.
Ich möchte mich zunächst mit den Grundgedanken der föderalen Staatsidee, sowie mit den
föderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen. In diesem Teil
sollen theoretische Grundlagen, rechtliche Maßgaben und Ziele des deutschen
Ordnungsprinzips erläutert werden. Auch die für den weiteren Fortgang notwendigen
Begriffsdefinitionen, wie die des Subsidiaritäts- und des Äquivalenzprinzips sollen einleitend
geleistet werden.
Den zweiten Teil der Arbeit bildet das deskriptiv-analytische Kernstück: Ausgehend von der
Situation 1990 werden die Wandlungen der finanziellen Beziehungen der föderativen Ebenen
dargestellt. Angereichert durch zahlreiche Statistiken und Graphiken werden hier
12
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
München 2002, Art. 106, 3.
8
Veränderungen plastisch erläutert und interpretiert. Dies gilt sowohl für horizontale, wie für
vertikale Ausgleichszahlungen der föderalen Ebenen. In der Folge sollen in diesem Abschnitt
Problemfelder der deutschen Finanzverfassung isoliert werden.
Der abschließende dritte Block setzt sich dann analytisch und kontrovers mit potentiellen
Verbesserungsmöglichkeiten auseinander. Intensiv sollen hier die Alternativen
Steuerautonomie und Wettbewerbsföderalismus behandelt werden. Im Stile einer Kosten- und
Nutzenabwägung werden Chancen und Risiken dementsprechender Reformen
gegenübergestellt. Eines muss aber deutlich von vornherein zugestanden sein: Ein Königsweg
zur Lösung aktueller Probleme ist nicht zu erwarten. Aber am Ende vielleicht doch ein
bisschen mehr als die gleichwohl philosophische wie ironische Erkenntnis, dass der
Föderalismus eben eine Idee ist, die man zwar nicht beweisen kann, an die man aber gerade
deshalb glauben muss.
13
Der deutsche Föderalismus befindet sich im Punkt seiner Finanzierung nicht in der
glücklichen Lage selbst ein effektives Mittel zur ,,permanenten Konfliktregelung"
14
zu sein.
Ganz im Gegenteil: Dank seiner Machtaufteilung sorgt er selbst für seinen ureigenen
Konflikt, den des Geldes nämlich. Es geht mir auf den folgenden Seiten keinesfalls um eine
Wertung, ob und inwieweit bestehende Regelungen - zum Beispiel die zum
Länderfinanzausgleich - im juristischen Sinne ,,angemessen"
15
sind oder nicht.
Bewertungsmaßstab dürfen allein von der Verfassung festgelegte Ansprüche und die
Gewährleistung essentieller staatlicher Aufgabenerfüllung sein. Die ökonomisch definierte
Effizienz und die politische Funktionalität bilden somit die übergeordneten Kriterien, nicht
etwa staatsrechtliche Detailfragen.
13
Vgl. Rudi Fischer: Föderalismus im Spannungsfeld von Stabilisierung und öffentlichem Leistungsangebot.
Inauguraldissertation, Augsburg 1978, S. 4
14
Vgl. Ferdinand Kinski, Integraler Föderalismus als Mittel permanenter Konfliktregelung. S. 43 ff.
15
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Art. 107,2
9
II. Theoretischer Hintergrund
Konflikte über Zuständigkeiten und die Verteilung von Steuereinnahmen haben essentielle
Fragen überlagert. Der Betrachtung der bestmöglichen Struktur der Finanzbeziehungen muss
deshalb die Klärung einiger Grundlagen vorausgehen. Was versteht man unter dem oft
willkürlich benutzten Terminus ,,Föderalismus"? Welchem Zweck dient der deutsche
Staatsaufbau ursprünglich? Erst wenn über dieses Fundament Klarheit besteht, kann die
Ausgestaltung der Finanzverfassung diskutiert werden. Im Folgenden sollen Grundlagen
gelegt und föderale Zielkonflikte sowie Widersprüche dargelegt werden. Dabei kann aus
Platzgründen selbstverständlich nur ein Abriss der Ideengeschichte und der deutschen
Föderalismus-Historie vermittelt werden.
1. Föderalismus als modernes Ordnungsprinzip
Zunächst möchte ich in diesem Unterpunkt einige grundlegende Weichenstellungen durch
zwei ausgewählte Vordenker des Föderalismus rückblickend in Erinnerung rufen. Von diesen
Wurzeln ausgehend folgt eine Eingrenzung beziehungsweise Annäherung des heutigen
Föderalismus-Begriffes auf der Basis von Literatur aus den letzten Jahrzehnten. Den
Abschluss bildet eine überblicksartige Schilderung der zeitgenössischen politökonomischen
Theorie, einer für diese Arbeit unverzichtbaren Forschungsrichtung. Auf ihre
Schwerpunktsetzung wird in dieser Arbeit noch häufiger verwiesen.
1.1 Die Wegbereiter
Wie bereits angedeutet, stand die Wiege des angewandten Föderalismus nicht in Europa,
sondern in den USA. Mit der Umbildung des zehn Jahre zuvor konstituierten Staatenbundes
gelang es 1787 der damals noch sehr jungen Nation, die herrschende Lehre der unteilbaren
Souveränität von Einzelstaaten aufzubrechen.
16
Bis heute findet sich der Gedanke eines
zentralisierten Föderalismus konsequenterweise schon im Namen des Staatsgebildes, den
,,Vereinigten Staaten von Amerika". Es dauerte, bis sich der Bundesstaats-Gedanke der
,,Federal Papers"
17
, einer Serie von Zeitungsartikeln der Autoren Hamilton, Jay und Madison,
auch auf dem alten Kontinent durchsetzen sollte. In Europa galt es erst einmal endgültig die
überkommenen Strukturen des Absolutismus zu überwinden. Schlussendlich war der Einfluss
16
Vgl. Heiderose Kilper/R. Lhotta, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 40 ff.
17
Vgl. Helmut Lecheler: Das Subsidiaritätsprinzip. Berlin 1993, S. 37.
Die Literatur verweist hier auf ein grundlegendes Missverständnis, das auch ich ausräumen möchte: Die
Federal Papers warben nicht etwa für die Betonung der Besonderheiten von Gliedstaaten, sondern stritten
für die Berechtigung und Stärkung der Zentralgewalt. In diesem Sinn entsprechen sie trotz ihres
wegweisenden Charakters keinesfalls klassisch-föderalen Zielsetzungen.
10
der amerikanischen Föderalisten unübersehbar. Ein erstes lockeres Bündnis gab es mit den
,,Vereinigten Niederlanden" (1579 - 1795) zwar schon verhältnismäßig früh, allerdings ohne
die für den Föderalismus typische Abtretung innerer Herrschaftsgewalten.
18
Auch spätere
Staatenbünde wie die ,,Schweizerische Eidgenossenschaft" (1803 - 1848) oder der ,,Deutsche
Bund" von 1815 bis 1866 entsprachen im Kern noch nicht föderalen Merkmalen.
Der erste theoretische Vordenker des neuen Systems findet sich in Johannes Althusius. Er
beschreibt in seiner ,,Politica methodice digesta" bereits Mitte des 16. Jahrhunderts einen in
die ständische Gesellschaft integrierten Föderalismus.
19
Und auch bei Kant findet in dessen
Werk ,,Zum ewigen Frieden" bereits der Gedanke Ausdruck, dass in erster Linie föderale
Staatsordnungen der Vermeidung militärischer Gewalt und damit einem zukunftssichernden,
nachhaltigen Frieden zuträglich sind.
20
Der deutsche und europäische Föderalismus hatte zweifellos viele Väter. Zum Beispiel auch
Montesquieu, der 1748 im Kampf gegen den absolutistischen Staat erstmals die
Gewaltenteilung forderte (,,De l'esprit de lois"). Ideengeschichtlich sollen an dieser Stelle
jedoch zwei noch nicht genannte Personen kurz hervorgehoben werden: Der Franzose Pierre
Joseph Proudhon und der Deutsche Constantin Frantz beeinflussten gerade mit ihren
Hauptwerken die Entwicklung des föderalen Staatsbegriffs immens. Und das, obwohl sie sich
politisch alles andere als nahe standen.
1.1.1 Pierre Joseph Proudhon
Die Demokratie- und Föderalismustheorie P. J. Proudhons (1809 - 1865) und sein Werk
,,Über das föderative Prinzip und die Notwendigkeit, die Partei der Revolution
wiederherzustellen" steht in der Tradition Descartes und der Französischen Revolution.
Letztere wollte er politiktheoretisch vollenden. Schon früh wurde er zu einem der schärfsten
,,Kritiker des autoritär-zentralistischen Sozialismus"
21
, allein dessen Existenz er als ,,Drohung
des Totalitarismus"
22
auffasste. Allerdings vertrat Proudhon aus tiefster Überzeugung einen
sozialistischen Freiheitsbegriff, in dem die Freiheit keinen individualistischen oder gar
liberalen Charakter hat, sondern als eine, die ,,Menschen und Völker vereinigende, föderative
Kraft"
23
im republikanischen Sinn beschrieben wird. Freiheit einerseits und Autorität
18
Vgl. Klaus Stern: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Band 1 und 2. Völlig neu bearbeitete
Auflage, München 1984, S. 654.
19
Vgl. Franz Wilhelm Jerusalem: Die Staatsidee des Föderalismus. Tübingen 1949, S. 17 ff.
20
Vgl. http://homepages.compuserve.de/eckhartarnold/foederalismus.html
21
Karl Hahn: Föderalismus die demokratische Alternative. Eine Untersuchung zu P.J. Proudhons sozial-
republikanisch-föderativem Freiheitsbegriff. München 1975, S. 27.
22
Ebd.
23
Ebd., S. 17.
11
andererseits sind die Basis jeder politischen Ordnung. Beide Elemente bilden einen ,,polaren,
antithetischen und antinomischen Dualismus"
24
und bedingen sich gegenseitig. Zwar geht die
Autorität als das die Geschichte formende Prinzip voran. Doch die Freiheit erweist sich mit
ihrem Eintritt für Gewaltenteilung und Wahlen als bestimmendes Kernstück des
gesellschaftlichen Fortschritts, der in gleichem Maße von geistiger Beweglichkeit und
wirtschaftlichen Bedingungen abhängt. Da Proudhon seine Vorstellung von Freiheit und ihren
Geltungsanspruch für alle Bereiche der Gesellschaft so energisch befürwortete wie kein
anderer politischer Theoretiker, sah er sich selbst als Revolutionär. Er sah in seiner Theorie
die einzige Möglichkeit, die Krise der jungen europäischen Demokratie zu überwinden.
25
In Proudhon's Gesellschaftstheorie und dem darin enthaltenen Menschenbild ist der föderale
Gedanke ganz deutlich determiniert. Im Gegensatz zum Individualismus definiert er den
Menschen nicht als isoliert und nur Zweckgemeinschaften bildend. Durch identisches
Gewissen und identische Würde sind vielmehr die Menschen in einer unabänderlichen
Solidarität miteinander verbunden. Damit widerspricht der Franzose besonders dem vom
Egoismus als stärkster Triebfeder bestimmten Menschenbild des Thomas Hobbes. Die
Gemeinsamkeiten aller gelten Proudhon als der innerste Kern der Freiheit. Schließlich findet
die Solidarität ihre Manifestation im föderalen Gedanken, der wiederum die angestrebte
republikanische Freiheit erst ermöglicht. Denn: Im Föderalismus sieht Pierre Joseph Proudhon
seine Hauptforderungen nach der Vermeidung eines Willkürregimentes, der Gleichwertigkeit
der Personen, der Gleichheit der Bedingungen und der Gleichwertigkeit der ökonomischen
und politischen Kräfte erfüllt.
26
Das auf Vernunft, Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit basierende politische System lieferte
als sozial-republikanisch-föderative Demokratie bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eine aus
den Grundgedanken der Französischen Revolution entsprungene Politiktheorie. Pierre Joseph
Proudhon schaffte es, die Parole ,,Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" philosophisch zu
begründen und in föderale Formen zu transformieren. Er lehnte jede Art staatlicher Gewalt
rigoros ab und kämpfte besonders zu Zeiten der Februarrevolution 1848 und nach dem Sturz
Louis Philippes für eine Entwicklung zum Sozialismus .
27
Zeitlos populär und zugleich
hochgradig umstritten ist sein Credo ,,Eigentum ist Diebstahl".
24
Ebd. S. 48 ff.
25
Vgl. Pierre Joseph Proudhon: Bekenntnisse eines Revolutionärs. Hamburg 1969, S. 7.
26
Vgl. Karl Hahn, Föderalismus die demokratische Alternative, S. 53 ff.
27
Vgl. http://www.weltchronik.de/bio/cethegus/p/proudhon.html
12
1.1.2 Constantin Frantz
Ganz im Gegensatz zum Anarchisten Proudhon und dessen ,,sozialistisch-syndikalistischer
Auffassung"
28
, gehört der Halberstädter Constantin Frantz (1817 1891) zu einer langen
Reihe von konservativen Theoretikern. Als zeitgenössischer Gegner Bismarcks und dessen
Kleindeutscher Lösung forderte Frantz die Trias, also die Koalition der mittleren und
kleineren Staaten im Deutschen Bund als Gegengewicht zu Preußen und Österreich.
29
Er
betrachtete Sozialismus, Liberalismus und Demokratie als zutiefst verwerfliche Varianten des
Staatsabsolutismus, unter denen sich erst ,,die schreienden Missstände in der
Volkswirtschaft"
30
des 19. Jahrhunderts entwickeln konnten. In reaktionären und teils
antisemitischen Schriften wetterte er gegen die ,,Constitutionellen" und stellte ihrem
Repräsentativsystem den ,,gesellschaftlichen Föderalismus" gegenüber. In seinen Augen war
das Repräsentativsystem zur Staatslenkung ungeeignet, da in ihm weder echte
Volksvertretung möglich ist, noch die Wahl von Abgeordneten durch Personen erfolgt, die
etwas von Gesetzgebung verstehen (hier: das in seiner Betrachtung ungebildete, unmündige
und gewöhnliche Volk).
31
Alle deutschen Volksgruppen von wenigen Delegierten vertreten zu
lassen, war für Frantz nichts weiter als eine zutiefst unzulässige und folgenschwere
Egalisierung:
,,Besteht da ein Reichstag, dessen Mitglieder schlichtweg das sogenannte deutsche
Volk (freilich einschließlich gegen drei Millionen Slawen, wie ausschließlich acht
Millionen deutsche Österreicher!) zu vertreten haben, gerade, als ob es besondere
deutsche Staaten überhaupt nicht mehr gäbe, - worauf kann das hinauslaufen, als dass
solcher Reichstag wie mit innerer Notwendigkeit zur Absorbierungsmaschinerie wird,
welche die den Einzelstaaten einstweilen noch verbliebenen Kompetenzen Stück für
Stück verschwinden macht, so dass zuletzt ganz Deutschland sich in eine uniforme
Masse verwandelt? Das ist die Perspektive."
32
Aus dieser damals populären Kritik entwickelte Constantin Frantz seine Alternative: Er
propagierte ein mehrstufiges System, in dem jeweils Delegierte der unteren Ebenen die
Vertretungsorgane der übergeordneten Ebenen bilden sollen. Wahlen gibt es nur auf der
niedrigsten, der Gemeindeebene. Als kontrollierende zweite Kammer empfahl Frantz eine Art
Senat aus Vertretern von Berufsvertretungen und Ständen. Die Funktionalität der
Staatsorganisation ist das übergeordnete Ziel. In seinem autoritären Entwurf steht der Bürger
28
Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 35.
29
Vgl. Constantin Frantz: Der Föderalismus als das leitende Princip für die sociale, staatliche und
internationale Organisation. Aalen 1962, S. 254 ff.
30
Ebd., S. 109.
31
Vgl. Constantin Frantz, Der Föderalismus als das leitende Princip für die sociale, staatliche und
internationale Organisation, S. 131 ff.
32
Constantin Frantz, Der Föderalismus als das leitende Princip für die sociale, staatliche und internationale
Organisation, S. 131.
13
also nur zur untersten Einheit des Staates in direkter Beziehung, weitere Partizipationsrechte
werden ausgeschlossen.
33
Zwar stellt dies nach heutigen Maßstäben eine nicht hinnehmbare
Bevormundung der Bürger dar, dennoch: Frantz weitet den Föderalismusbegriff gemäß dem
Titel seines Hauptwerkes zu einem, ,,die soziale wie die staatliche und internationale Ordnung
umfassenden Prinzip"
34
aus. Genau darin liegt der Verdienst Constantin Frantz's für die
Entwicklung der föderalen Staatsidee, wenn auch seine Person selbst durchaus als umstritten
gelten darf.
1.2 Definitionen des Föderalismusbegriffes
Schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist es, für den Begriff ,,Föderalismus" trotz enormer
terminologischer Vielfalt einen begrifflichen Konsens zu finden. Zumal schon allein im
deutschen Sprachraum verschiedene Begriffe wie ,,Föderation", ,,Bundesstaat" oder
,,Konföderation" teilweise synonym verwendet werden.
35
Kurzum: Studiert man die Literatur,
so wird schnell einsehbar, dass es klar abgrenzbare, unumstrittene oder gar allgemeingültige
Definitionen des Begriffes ,,Föderalismus" nicht gibt. Einigkeit besteht lediglich darin, dass
dem Föderalismus der Unitarismus, also die Zusammenfassung der Zuständigkeiten auf einer
Ebene bei gleichzeitiger Dekonzentration, diametral gegenübersteht.
36
Darüber hinaus haben
diverse Forschungsrichtungen selbstverständlich unterschiedliche Fragestellungen in den
Mittelpunkt der Diskussion gestellt, was naturgemäß zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen
führte. Es gab natürlich Versuche, die so entstandenen Definitionsvarianten zu vereinen.
Nach der gängigsten Ausprägung versteht man unter Föderalismus eine ,,auf Dauer
angelegte Vereinigung von eigenständigen Körperschaften zu einer größeren Gesamtheit zur
Verfolgung bestimmter Aufgaben, wobei eine gewisse gesetzgeberische Selbstständigkeit auch
nach der Verbindung aufrecht bleibt."
37
Wie in diesem - etwas schwammigen - Versuch zu
sehen, erhält man zwar Näherungen über durchaus vorhandene gemeinsame Merkmale, eine
Schilderung unterschiedlicher Herangehensweisen an die Begriffsdiskussion bleibt aber als
Grundbaustein einer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Themengebiet Föderalismus
unabdingbar. Hierbei möchte ich drei Kernbereiche unterscheiden: die Staatslehre, die
Politikwissenschaften und die Wirtschaftslehre.
33
Vgl. http://homepages.compuserve.de/eckhartarnold/foederalismus.html
34
http://homepages.compuserve.de/eckhartarnold/foederalismus.html
35
Vgl. Emanuel Richter: Leitbilder des Europäischen Föderalismus. Bonn 1983, S. 17.
Richter erwähnt außerdem die immense Vielfalt an zugehörigen fremdsprachigen Begriffen.
36
Vgl. Franz Wilhelm Jerusalem, Die Staatsidee des Föderalismus, S. 5.
37
Erich Thöni: Politökonomische Theorie des Föderalismus. Eine kritische Bestandsaufnahme. Baden-Baden
1986, S. 30.
14
Des weiteren - dies darf der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben - erfasst die
Literatur auch explizit soziologische und sozial-philosophische Definitionen. Sie sehen
Föderalismus als Soziallehre und als ein gesellschaftliches Gestaltungsprinzip, das
Tendenzen der Anonymisierung und Gleichmacherei entgegenwirkt. Stattdessen wird ein
überschaubarer Gesellschafts- und Staatsaufbau bevorzugt. Auf diese Weise sollen auch
kleinste Gruppen weitgehende Autonomie entwickeln können.
38
Diese Überlegungen
erscheinen für die Erarbeitung des ökonomisch geprägten Themas aber eher sekundär und
werden deshalb an dieser Stelle bewusst vernachlässigt.
1.2.1 Der verfassungsrechtliche Ansatz
Die lange Zeit bestimmende Forschungstradition besteht auf dem Gebiet der
Rechtswissenschaften. Die sogenannte konstitutionell-gewaltenteilige Betrachtungsweise
beurteilt das föderalistische Prinzip zunächst ausschließlich aus der Sicht des jeweils gültigen
Verfassungsrechts. So stand die Abgrenzung des Staatenbundes vom Bundesstaat
39
(siehe
auch Gliederungspunkt 1.1) und die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund und
Gliedstaaten im Mittelpunkt der Diskussion.
40
Danach sind politische Systeme dann föderal
organisiert, wenn ,,die entscheidenden Strukturelemente des Staates (darunter werden primär
die Legislative, die Exekutive und die Judikative verstanden) sowohl im Gesamtstaat als auch
in den Gliedstaaten vorhanden sind, ihre Existenz verfassungsrechtlich geschützt ist und
durch Eingriffe der jeweils anderen Ebene nicht beseitigt werden können."
41
Zusammengefasst heißt das also: Der Rechtsgrundsatz der Gleichheit findet als Teil der
demokratischen Rechtsidee auch hier Anwendung und sei es zunächst nur bezüglich
formaler Kriterien. Die gleichgestellte Staatlichkeit von Bund und Ländern ist in diesem
Forschungszweig das hervorgehobene konstitutive Merkmal einer föderalistischen
Organisation.
42
Dynamische Interaktionsprozesse spielen in dieser ,,normativen
38
Vgl Heinrich Oberreuther: Föderalismus. In: Staatslexikon, Görres-Gesellschaft (Hrsg.), Freiburg 1986,
S. 632.
Er verweist in diesem Zusammenhang auf Föderalismus als ,,Soziallehre", die bis in den Bereich des
Politischen eindringt.
39
Lamprecht, Christa-Maria: Die Funktion des Föderalismus im Verfassungs- und Regierungssystem der
Bundesrepublik Deutschland. Dissertation. Berlin 1975, S. 164 ff.
Als strukturtypische Merkmale des Bundesstaates gelten demnach im Rahmen der Staatsrechtslehre das
Prinzip funktionaler Gewaltenteilung, die Vertretung regionaler Bevölkerungsgruppen, die demokratische
Beteiligung und die Wirksamkeit demokratischer Konfliktregelung.
40
Vgl. Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 9.
41
Heiderose Kilper/Roland Lhotta: Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 24.
42
Vgl. Erich Thöni, Politökonomische Theorie des Föderalismus, S. 31.
Nach Thöni bezeichnet der Begriff des Föderalismus eine Organisationsform des Bundesstaates, bei der nur
ein Teil der staatlichen Aufgaben vom Gesamtstaat wahrgenommen wird. Die übrigen Aufgabengebiete
werden dagegen von den Gliedstaaten erfüllt. Beide verfügen über eigene Gesetzgebungshoheiten.
15
Bundesstaatskonzeption"
43
untergeordnete Rollen beziehungsweise waren lange überhaupt
nicht Teil der Forschung. Dies ist auch der Grund, weshalb die verfassungsrechtliche
Föderalismusforschung in weitgehend statischen Analysen verharrte. Sie erfuhren erst im
späten 20. Jahrhundert eine Erweiterung durch diverse Aspekte, die jenseits der
Staatsrechtslehre angesiedelt waren.
1.2.2 Der politikwissenschaftliche Ansatz
Einen davon etwas abweichenden Ansatzpunkt sieht die Politikforschung, die sich allerdings
erst Mitte der 70er Jahre intensiver mit diesem Forschungsfeld beschäftigte. Als ,,ganz
bestimmte Art der Machtverteilung auf eine zentrale und mehrere regionale Regierungen"
44
unterscheidet sich hier der Föderalismus von einem nicht genauer charakterisierten
dezentralen Gebilde. Primärziel eines solchen politischen Systems ist die Vermittlung
gegensätzlicher gesellschaftlicher Ziele und Ansprüche, sowie die Autonomie der regionalen
Körperschaften. Dabei versteht man Autonomie keinesfalls als totale Entscheidungsfreiheit,
sondern allenfalls als ,,ausreichenden Entscheidungsspielraum"
45
. ,,Federalism provides for
multiple arenas of collective decisionmaking and preserves local diversity within a framework
of nationally shared values."
46
In der politiktheoretischen Konzeption befindet sich das föderale System im dauernden
Widerstreit eines bipolaren Kraftfeldes aus zentrifugalen und zentripetalen Kräften.
47
Zentrifugale Kräfte sind demnach auf Autonomie und Vielfalt der Lebensbedingungen
gerichtet. Zentripetale Kräfte dagegen konzentrieren sich auf die Erreichung von Integration
und die Gleichheit der Lebensbedingungen. Je nachdem, in welche Richtung sich das Gefüge
verschiebt, entwickelt sich das politische System hin zu einer Allianz im Sinne des
Staatenbundes, d. h. ohne die Abtretung von Herrschaftsrechten durch die Gliedstaaten
(,,interstaatlicher Föderalismus"
48
), oder eben zu einem klassischen Einheitsstaat ohne
ausgeprägte Autonomie (,,intrastaatlicher Föderalismus)"
49
.
43
Vgl. Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 9.
44
Erich Thöni, Politökonomische Theorie des Föderalismus, S. 31 f.
45
Rudi Fischer, Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Stabilisierung und öffentlichem Leistungsangebot,
S. 4 f.
46
Timothy Conlan: New Federalism. Washington 1988, S. 237.
47
Vgl. Dieter Nohlen, Wörterbuch Staat und Politik, S. 155 ff.
48
Marie Annerose Jung: Die Reform des Finanzausgleiches zum Jahr 2005. Modellvorschlag für einen
konsensfähigen Finanzausgleich der Zukunft. München 2000, S. 11.
49
Ebd.
16
Zentrifugal-Kräfte FÖDERALISMUS Zentripetal-Kräfte
Eigenständigkeit und Vielfalt
Integration u. Gleichheit
als oberste Ziele
der Lebensbedingungen
Staaten- / konföderaler // unitarischer / dezentraler
Bund Bundesstaat Bundesstaat Einheitsstaat
Abbildung 1 (Quelle: Dieter Nohlen, Wörterbuch Staat und Politik, S. 156)
Gemeinsames Kennzeichen aller föderativen Ideen ist aus politikwissenschaftlicher Sicht der
Grundsatz, die Eigenständigkeit jedes Mitglieds zu erhalten und es zugleich zu Leistungen
nach eigenem Vermögen und Fertigkeit für das Gemeinwohl zu verpflichten (siehe auch 2.1;
Das Subsidiaritätsprinzip).
1.2.3 Der ökonomische Ansatz
Die wirtschaftswissenschaftliche Definition des Föderalismusbegriffes basiert - wie der Name
bereits vermuten lässt - im Kern auf der ökonomischen Theorie. Diese wiederum ist Teil der
großen Gruppe, der aus dem amerikanischen Raum stammenden Rational-Choice-Modelle
(dt.: Konzepte der rationalen Wahlhandlung). Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Erklärung
und Voraussage sozialer Prozesse. Letztere werden auf das Entscheidungsverhalten von
Individuen und deren handlungsbestimmenden Motiven zurückgeführt. Als Theorien des
,,methodologischen Individualismus" stehen sie der Systemtheorie oder dem Marxismus
diametral gegenüber.
50
Ideengeschichtlich haben Rational-Choice-Theorien ihre Wurzeln in
der Aufklärung. Wie ihre Vorgänger, darunter Hobbes und Machiavelli, gehen die Autoren
dieser Richtung der Frage nach, wie ,,Gesellschaft, politische Ordnung und allgemeine
Wohlfahrt erreichbar sein könnten, wenn man sich den Menschen als ein ausschließlich durch
eigene Interessen geleitetes Subjekt vorstellen müsse".
51
Auslöser für das Verhalten sind
deshalb der Wunsch nach Nutzenmaximierung und die Interessen des Einzelnen.
,,Rationalität" lässt sich im ökonomischen Zusammenhang am besten mit Max Webers
,,Zweckrationalität" erklären. Weitere Formen rationalen Verhaltens gibt es nicht, alles
Abweichende ist irrational. Die Ausblendung ,,wertrationaler, affektiver und traditioneller
50
Vgl. Heribert Schatz, Robert Chr. Van Ooyen, Sascha Werthes: Wettbewerbsföderalismus. Baden-Baden
2000, S. 43.
51
Heribert Schatz, Robert Chr. Van Ooyen, Sascha Werthes, Wettbewerbsföderalismus, S. 43.
17
Verhaltensorientierungen"
52
ist es auch, die Kritiker gegen die Lehre vom ,,Homo
oeconomicus" vorbringen.
Für die Vertreter der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsrichtung besteht der Kern des
Föderalismus in erster Linie aus der Erfüllung der staatlichen Aufgaben. Es interessiert zwar
genauso die Frage der Machtverteilung, allerdings nur im Sinne der Unabhängigkeit von
Konsum und Produktion. Die formale rechtliche Autonomie ist zweitrangig. Die Zielsetzung
dieses Ansatzes lautet, die bestmögliche Verteilung von Zentralisierung und
Dezentralisierung staatlicher Aufgaben zu eruieren, um so größtmögliche Wohlfahrt zu
gewährleisten.
53
Thöni versteht Föderalismus im ökonomischen Zusammenhang gar schlicht
als ,,gegebener Selbstbestimmungsspielraum mehrerer, auch unterer Gebietskörperschaften
zur Aufgabenerfüllung".
54
Nach Fischer ist eine Staatsorganisation im ökonomischen Sinne in
erster Linie dann optimal, wenn an den Entscheidungen all jene Bürger mitwirken können, die
letztlich die Kosten einer Maßnahme tragen oder von ihr profitieren. Kosten- und Nutzen-
Spill-over-Effekte sollten in idealer Ausprägung also ausgeschlossen sein.
55
Man könnte in
Anlehnung an Kilper/Lhotta und im Sinne eines institutionell-funktionalistischen Ansatzes
auch formulieren: Föderalismus ist eine Organisationsform, in der die Wahrnehmung der
staatlichen Aufgabenbereiche so zwischen Teilstaaten und Gesamtstaat aufgeteilt ist, dass alle
staatlichen Ebenen zumindest in Teilbereichen wohlstandsfördernde und bindende
Entscheidungen zu treffen in der Lage sind.
56
,,Daneben wird im dezentralen Wettbewerb eine
Bremse gegen einen ständig wachsenden Staatsanteil gesehen."
57
Dieser, auf Effizienz
ausgerichtete Entwurf, stellt die theoretische Basis eines jeden föderalen Finanzausgleiches
und ist damit automatisch Teil eines Beurteilungsmaßstabes für die Entwicklung der
bundesdeutschen Finanzströme.
Insgesamt liefert die Literatur eine ganze Reihe normativer Analysen, die sich vor allem mit
der Allokation, also der Entscheidung über die effiziente Bereitstellung von Gütern und
Leistungen, oder mit Fragen der Verteilung und Stabilisierung im föderalen System
52
Ebd., S. 46. Schatz geht in seiner Kritik der ökonomischen Theorie auch dezidiert darauf ein, dass die
vorhandene Komplexität der Politik die unterstellte Handlungsfreiheit der Individuen stark behindert.
53
Vgl. Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 16 ff.
54
Erich Thöni, Politökonomische Theorie des Föderalismus, S. 33 f.
55
Vgl. Rudi Fischer, Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Stabilisierung und öffentlichem
Leistungsangebot, S. 6 f. Unter ,,Kosten-Spill-over" versteht Fischer den unerwünschten Effekt, dass
Aufwendungen für spezielle Maßnahmen von Personen getragen werden müssen, die am Beschluss dieser
Maßnahme nicht mitwirken durften und sich so auch nicht dagegen aussprechen konnten. Unter Nutzen-
Spill-over-Effekt versteht man, dass Personen von Maßnahmen profitieren, die weder an der Entscheidung
mitgewirkt haben, noch mögliche Kosten dafür mittragen müssen.
56
Heiderose Kilper / Roland Lhotta: Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 23.
57
Marie Annerose Jung, Die Reform des Finanzausgleiches zum Jahr 2005, S. 8.
18
beschäftigen. Da die allermeisten jedoch nur wenige Kriterien untersuchen, gelten sie heute
als ,,wenig realistisch und erweiterungsbedürftig"
58
. Ich verzichte deshalb auf eine explizite
Schilderung.
1.3 Die politökonomische Theorie des Föderalismus
Alle bislang geschilderten Ansätze sind - allein für sich - zu kurz gegriffen. Speziell die
Unzulänglichkeiten der rein wirtschaftlichen Föderalismustheorie wurden schnell
offensichtlich. Um ein Beispiel zu nennen: Die Ökonomie ignoriert den Willen politischer
Entscheidungsträger gänzlich und vermag so viele Änderungen des Staatsaufbaus nicht zu
erklären, da jene oftmals den scheinbar gebotenen Erfordernissen einer auf Effizienz
ausgelegten Theorie widersprachen. Generell gilt, dass isolierte Betrachtungsweisen aus
verfassungsrechtlicher, ökonomischer oder politischer Sicht die Föderalismus-Forschung
zunehmend in die Sackgasse führten. Mehr und mehr setzte sich aus diesem Grund die
Erkenntnis durch, Föderalismus besser als verbindendes gesellschaftliches Phänomen zu
betrachten.
59
Deshalb versucht die Forschung in jüngster Zeit speziell politische und
ökonomische Aspekte zu einer Symbiose zu vereinen. Jede Form von wirtschaftlichen
Abläufen wird darin als direkte Folgeerscheinung politischer Vorgänge anerkannt. Dies ist ein
Grundsatz, an den auch die vorliegende Arbeit schon allein aus pragmatischen
Gesichtspunkten anschließen möchte.
60
Die Entwicklung des föderalen Gebildes wird zudem
nicht vorrangig durch philosophische oder institutionelle Diskussionen geprägt, sondern
erfährt ihre Lenkung vielmehr durch das Ringen um größere Funktionalität und den
Widerstreit politischer Positionen im Willensbildungsprozess. Ein Faktum, welches speziell
auf die Diskussionen rund um die deutsche Finanzverfassung in besonderem Maße
zuzutreffen scheint.
Einige politökonomische Theorien versuchen bisherige Untersuchungen durch eine Analyse
von politischen Entscheidungsverfahren auf Körperschaftsebene zu erweitern. Es wird klar:
Der Weg der Entscheidung ist nicht nur durch objektive Erfordernisse, sondern auch durch
persönliche und politische Interessen, sowie durch ebenenspezifisches Verhalten determiniert.
58
Erich Thöni, Politökonomische Theorie des Föderalismus, S. 140.
59
Vgl. Rudi Fischer, Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Stabilisierung und öffentlichem
Leistungsangebot, S. 13 ff.
60
Die Ökonomie beinhaltet für die Beratung der Politik zweifellos wichtige Hilfestellungen. Dies gilt
besonders für die Reformierung bestehender Strukturen. Auch hierin zeigt sich die Bedeutung der
ökonomischen und der politökonomischen Theorie für eine Arbeit über bundesstaatliche
Finanzbeziehungen. Vgl. dazu: Dirk Sauerland: Föderalismus zwischen Freiheit und Effizienz. Berlin 1997,
S. 263.
19
Darauf verweist auch Benz, wenn er Zentralisierungs- und Dezentralisierungstendenzen im
föderalen Staat zu politischen Prozessen erklärt, die allein auf ,,die Verteilung von
Einflusschancen und Machtanteilen zwischen den organisatorischen Einheiten im System"
61
gerichtet sind. Durch die Einbeziehung viel zu oft verleugneter gesellschaftlicher Einflüsse
erhofft man sich, optimale Zuständigkeitsverteilungen erst zu ermöglichen. Schließlich wird
durch die Integrierung ganz alltäglicher Struktur- und Organisationsabläufe auch theoretisch
deutlich, ,,wer, welche Aufgaben, wie gut erfüllen kann".
62
Um es ganz deutlich zu
formulieren: Die ideale Zielsetzung aller ökonomischer Ansätze, die bestmögliche Verteilung
staatlicher Aufgaben zur Erreichung größtmöglichen Wohlstands, wird erst durch die
Einbeziehung politischer und gesellschaftspolitischer Aspekte überhaupt erreichbar. Auch die
Beschreibung des Verhaltens politischer Akteure war bis dato allenfalls Teil der Politik- und
Kommunikationsforschung, wurde aber zu lange nicht in wirtschaftliche Erklärungsansätze
integriert. Das Individuum muss aber ,,als allein maßgebende Handlungseinheit"
63
anerkannt
werden. Verständlicher gesagt heißt das: Die Rolle von Bürgern, Wählern, Politikern, Medien
und anderen Meinungs- und Entscheidungsmachern darf nicht auf andere wissenschaftliche
Teilbereiche beschränkt bleiben, sondern muss in politökonomischen Untersuchungen
generell akzeptiert und einbezogen werden.
Insbesondere Thöni zeigt erstmals, was sonst nur empirisch deutlich wurde: Die
Zuständigkeiten eines politischen Gesamtbereiches sind keinesfalls auf eine föderale Ebene
verteilt. Stattdessen gibt es eine geradezu exorbitante Anzahl von vertikalen und horizontalen
Verflechtungen
64
und damit einen schlecht überschaubaren Wust von Kompetenzen. Doch
nicht nur bürokratische Hemmnisse, auch eine immer größer werdende Anspruchslage führt
zu steigenden Komplikationen in föderalen Abläufen. Ein Beispiel:
,,Der Wettbewerb der Parteien um die politische Macht auf den verschiedenen Ebenen
und in den einzelnen Gebietskörperschaften, die vermehrten informellen Beziehungen
zwischen Bürger und Politiker (...) tragen dazu bei, dass auch Bedürfnisse, hinter
61
Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 255.
62
Vgl. Erich Thöni, Politökonomische Theorie des Föderalismus, S. 140.
63
Charles B. Blankart: Öffentliche Finanzen in der Demokratie. München 1998, S. 10.
64
Vgl. Fritz Scharpf/Bernd Reissert/Bernd Schnabel: Politikverflechtung. Theorie und Empirie des
kooperativem Föderalismus in der Bundesrepublik. Kronberg 1976, S. 29. Den Begriff
,,Politikverflechtung" definieren Scharpf/Reissert/Schnabel als die Tatsache, dass staatliche Aufgaben nicht
mehr von den einzelnen Körperschaften des föderalen Systems in getrennter Zuständigkeit wahrgenommen
werden, sondern dass Kompetenzverschränkungen stattfinden und eigentlich autonome
Entscheidungseinheiten bei der Lösung von Problemen zusammenwirken.
20
denen nur ein geringes Sanktionspotential steht, von den Politikern und Parteien in
ihre Programmatik aufgenommen werden."
65
Den zeitlichen Verschleppungen sowie den durch Verflechtung und Anspruchsniveau
entstandenen vielfältigen Kosten des Föderalismus begegnet die politökonomische Theorie
mit dem Lösungsansatz einer weiteren Dezentralisierung und Föderalisierung des politischen
Systems. Dies hätte gleich mehrere Vorteile: Durch die größere Transparenz einer dezentralen
Lösung wäre es für Entscheidungsträger nur sehr schwer möglich eigennützige Interessen zu
verfolgen (d. h. gesenkte Transaktionskosten). Dagegen geht man von einer steigenden
politischen Partizipation der Bürger auf lokaler und regionaler Ebene aus (d.h. gesenkte
Informationskosten). Durch Dezentralisierung könnte so auch die Möglichkeit kleinerer, nur
lokal in Überzahl befindlicher Gruppen gestärkt werden, die eigenen politischen
Vorstellungen zu verwirklichen. Ernüchterungen ob der eigenen politischen Ohnmacht
blieben viel häufiger aus (d.h. gesenkte Frustrationskosten). So mancher in zentral
organisierten Staaten notwendige Kompromiss wäre zudem nicht mehr obligatorisch (d.h.
gesenkte Konsens-Findungs-Kosten).
66
Demnach wären durch konsequente Föderalisierung
und Dezentralisierung gleich vier ,,Kostenfaktoren" eines zu stark verflochtenen Systems
reduziert.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die politökonomische Theorie ist auf dem Gebiet der
Föderalismusforschung die wahrscheinlich umfassendste und flexibelste Denkrichtung, da sie
sich nicht allein auf ein Bewertungskriterium beschränkt. Allerdings, so geben Kritiker zu
bedenken, stößt sie bei ihrer Umsetzung, das heißt bei der Verwirklichung eines höheren
Dezentralisierungsgrades, rasch an die Grenzen der Machbarkeit. Insbesondere die starken
Zentralinstanzen sind natürlich durchgängig an der Beibehaltung eines hierarchischen
Systems und der Vermeidung von dezentraler Bürokratie interessiert. Sie würden sich gegen
einen Machtverlust mit aller Kraft sperren. Eine weitere hohe Hürde bestünde zweifellos im
,,hohen Formalisierungs- und Verrechtlichungsgrad des bestehenden Planungssystems"
67
.
Es gilt im weiteren Verlauf zu prüfen, inwieweit die Politökonomische Theorie bei einer
Neuordnung der deutschen Finanzbeziehungen Anwendung finden kann oder muss. Dies gilt
sowohl in Hinblick auf ihre Problemanalyse als auch in Hinblick auf die Übertragbarkeit ihrer
Lösungsstrategie.
65
Rudi Fischer, Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Stabilisierung und öffentlichem Leistungsangebot,
S. 93. Das Zitat stammt aus Fischers Schilderung der Funktionalität des föderal-verflochtenen Systems. Es
findet in diesem Zusammenhang nur Anwendung, wenn man das System der Bundesrepublik als föderal-
verflochten, nicht aber als föderal-dezentralisiert bezeichnen möchte.
66
Vgl. Nils Otter. In: http://www.wiwi.uni-
marburg.de/Lehrstuehle/VWL/FIWI/LEHRANGB/VORLES/THEORIE/Blatt-8.pdf
67
Arthur Benz, Föderalismus als dynamisches System, S. 238 ff.
21
2. Weitere notwendige Begriffsdefinitionen
Einige näher zu behandelnde Begrifflichkeiten - dies meint insbesondere Prinzipien, die heute
in der Gesetzgebung der Bundesrepublik Gültigkeit besitzen - werden im Kernteil der
Abhandlung über Wandlungen im deutschen Finanzsystem wiederholt Erwähnung finden. Um
weder Stringenz noch Verständlichkeit der folgenden Kapitel durch lähmende Einschübe zu
gefährden, möchte ich diesen Teil der theoretischen Erklärarbeit bereits an dieser Stelle
vornehmen.
2.1 Das Subsidiaritätsprinzip
,,Zurückbleibende Hilfe." Die lateinische Bedeutung der ,,Subsidiarität", einem aus der
christlich-katholischen Soziallehre entsprungenen Terminus
68
, verrät bereits viel über seine
Verwendung. Auf die Politik übertragen, postuliert die ,,Kompetenzausübungs -
verteilungsregel Subsidiarität"
69
einen Regelungsvorbehalt zugunsten kleinerer
Körperschaften und Einheiten. Die Gesellschaft soll die Tätigkeit ihrer Glieder nicht ersetzen,
sondern allenfalls unterstützend fördern. Dem liegt ein Verständnis zugrunde, dass den
Menschen als ,,eigenständige, selbstverantwortliche Person"
70
sieht. Speziell auf den
Föderalismus gemünzt bedeutet dies, dass eine Machtverteilung von ,,unten nach oben"
anderen Prinzipien des Staatsaufbaues vorgezogen wird. Praktischer ausgedrückt: Der Staat
soll sich nur dann in alltägliche politische Prozesse einmischen, wenn die nächstkleineren
Einheiten nicht alleine in der Lage sind Probleme zu bewältigen. Einmischung kann also nur
als ,,Hilfe" stattfinden, keinesfalls als zentralistische Bevormundung. Grundsätzlich sollen
also kleinere Einheiten möglichst viele Aufgaben übernehmen ganz im Geiste von
Bürgernähe, Effektivität und Effizienz
71
. Eine bedeutende Verankerung findet sich im
Grundgesetz, wonach der Bund im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung das
Gesetzgebungsrecht hat, "soweit eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner
Länder nicht wirksam geregelt werden kann"
72
. Das Prinzip begründet ,,die wirtschaftliche
68
Vgl. Helmut Lecheler, Das Subsidiaritätsprinzip, S. 30 f.
Hier wird insbesondere darauf verwiesen, dass Subsidiarität als gesellschaftsformendes Prinzip zwar erst
1931 in der Sozialenzyklika ,,Quadragesimo anno" ausformuliert wurde, dass sie ihre Wurzel aber in der
alttestamentarischen Bibelstelle Exodus, Vers 18 22 hat.
69
Michael W. Schröter: Das Subsidiaritätsprinzip als verfassungsgenerierender Modus. In:
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung: Arbeitspapiere - Mannheimer Zentrum für
Europäische Sozialforschung, Nr. 54, Mannheim 2002, S.1.
70
Helmut Lecheler, Das Subsidiaritätsprinzip, S. 42.
71
Vgl. Michael W. Schröter, Das Subsidiaritätsprinzip als verfassungsgenerierender Modus, S.7. Obwohl
ursprünglich im Zusammenhang mit der Europäischen Verfassung geäußert, hat diese Feststellung wohl
allgemeinen Charakter.
72
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Art. 72,II
22
und politische Vielfalt, aus deren Konkurrenz die Gemeinschaft ihre Kraft gewinnt"
73
und es
verfügt über eine integrative Funktion, indem es die Wettbewerbskräfte auf ein gemeinsames
Wohlstandsziel hin stärkt.
Politische Bedeutung in Deutschland erhielt das Subsidiaritätsprinzip mit der Weimarer
Verfassung, in hohem Maße jedoch erst mit seinem Einfluss auf das Bundessozialhilfegesetz
aus dem Jahre 1961. Seither sind zahlreiche soziale Leistungen durch die Kommunen zu
tätigen, selbstverständlich sehr zum Leidwesen der Gemeinden. In der Föderalismusforschung
und in der aktuellen Politdiskussion liegt die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in seiner
Argumentationskraft. Nicht selten werden unter Hinweis auf das Gebot der Subsidiarität
Übergriffe von übergeordneten Verwaltungs- oder Gesetzgebungsebenen erfolgreich
abgewehrt. Nachdem sich auch die EU-Verfassung in Artikel 3 b ausdrücklich des
Subsidiaritätsprinzips bedient, versuchen EU-Mitgliedsstaaten mit seiner Hilfe der
Überregulierung durch Brüssel zu entgehen. Das Prinzip ist heute sowohl ,,Rechtsprinzip, als
auch politische Leitlinie"
74
, neben seiner verfassungsrechtlichen birgt es auch eine nicht zu
unterschätzende ,,verfassungspolitische Qualität"
75
.
2.2 Das Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip ist die ,,älteste Norm, nach der ein Gemeinwesen Steuern und
Abgaben erheben kann."
76
Sein Ursprung liegt in der Fragestellung nach einer gerechten
Verteilung der öffentlichen Finanzierungslast auf die Mitglieder der Gesellschaft. Äquivalenz
sollte im Sinne der Idee des Tausches einen Ausgleich zwischen Leistungen des Staates und
Leistungen seiner Bürger schaffen.
77
Im Zusammenhang mit Föderalismus heißt das, dass die
Bürger nur in Bezug auf die von ihnen empfangenen Staatsleistungen belangt werden sollen.
Einnahmen- und Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte sollten so gleichzeitig und
effizient bestimmt werden. Äquivalenz ist theoretisch fähig, im Bereich der kollektiven Güter
und Leistungen die bestmögliche Verteilung sicherzustellen. Die Praxis und
allokationstheoretische Analysen haben dies jedoch widerlegt
78
. Das Prinzip wird vor allem
aufgrund seiner ,,verteilungspolitischen Implikationen" kritisiert. Es bietet keine Handhabe,
73
Helmut Lecheler, Das Subsidiaritätsprinzip, S. 69.
74
Martin Große-Hüttmann: Das Subsidiaritätsprinzip in der EU eine Dokumentation. In: Europäisches
Zentrum für Föderalismus-Forschung (Hrsg.): Occasional Papers Nr. 5, Tübingen 1996, S. 116.
75
Ebd.
76
Horst Hanusch: Äquivalenzprinzip und kollektive Güter - Allokationstheoretische Aspekte. In: Dieter
Pohmer (Hrsg.): Beiträge zum Äquivalenzprinzip und zur Zweckbindung öffentlicher Einnahmen. Berlin
1981, S. 37.
77
Vgl. Horst Hanusch, Äquivalenzprinzip und kollektive Güter - Allokationstheoretische Aspekte, S. 38.
78
Vgl. Horst Hanusch, Äquivalenzprinzip und kollektive Güter - Allokationstheoretische Aspekte, S. 82.
23
den Status quo der Verteilung zu verändern.
79
Besondere Schwierigkeiten bei der
Verwirklichung macht zudem die Findung ,,geeigneter Bemessungsgrundlagen"
80
für
empfangene Leistungen. Hier stößt Bürokratie an ihre Grenzen. So ist es nicht verwunderlich,
dass das Äquivalenzprinzip gerade im Kernbereich der Steuerbelastung außer Kraft gesetzt
wurde. Stattdessen wird das Leistungsfähigkeitsprinzip und sein ,,Grundsatz der horizontalen
Gerechtigkeit"
81
vorgezogen. Die Steuern werden nach Jahreseinkommen, nicht nach in
Anspruch genommenen Leistungen erhoben. Dagegen findet die Äquivalenz zumindest im
Bereich einiger Gebühren noch Anwendung. Insgesamt aber gilt: das Äquivalenzprinzip führt
heute nur noch ein ,,fiskalisches Schattendasein"
82
.
Der Grundgedanke der Äquivalenz blieb allerdings lange Zeit Bestandteil aktueller
Diskussionen und schlug sich in mehreren Ausprägungen nieder. Wollten ältere Vertreter das
Prinzip auf die Gesamtheit des öffentlichen Leistungswesens übertragen, greifen moderne
Verfechter auf die Idee zurück, Äquivalenz auf einzelne Güter- und Leistungsangebote
anzuwenden.
3. Grundlagen des Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland
Ausgehend von den Erläuterungen zu Ideengeschichte und theoretischen Ausprägungen der
Föderalismusdiskussion soll nun auf pragmatischere Bezüge erweitert werden. Die
Schilderung der Entwicklung föderativer Elemente in der Bundesrepublik, rechtliche
Grundlagen des Ordnungsprinzips in der Verfassung sowie föderale Zielvorgaben stehen nun
im Mittelpunkt des folgenden Kapitels und leiten zu den Detailfragen der föderalen
Finanzsituation über.
3.1 Die Entstehung der bundesstaatlichen Ordnung
Dieser Abschnitt widmet sich primär den Entwicklungen nach Ende des 2. Weltkrieges.
Einige überdimensional wichtige Eckpunkte der früheren Geschichte können aber nicht
außenvorgelassen werden. Die zunächst anstehenden historischen Verweise erachte ich
deshalb für notwendig, da die Streitpunkte des deutschen Föderalismus ihre Ausgangspunkte
unbestritten in geschichtlichen Entwicklungen haben.
79
Vgl. Charles B. Blankart, Öffentliche Finanzen in der Demokratie, S. 188.
80
Peter Bohley: Praktische Probleme bei der Anwendung des Äquivalenzprinzips. In: Dieter Pohmer (Hrsg.):
Beiträge zum Äquivalenzprinzip und zur Zweckbindung öffentlicher Einnahmen. Berlin 1981, S. 105.
81
Charles B. Blankart, Öffentliche Finanzen in der Demokratie, S. 180.
82
Horst Hanusch, Äquivalenzprinzip und kollektive Güter - Allokationstheoretische Aspekte, S. 37.
24
3.1.1 Historische Verfassungen im Kurzüberblick
Ich möchte mich hier auf föderale Bestandteile der deutschen Gesetzestexte ab der
Märzrevolution von 1848 konzentrieren, sofern diese demokratischer und föderaler Prägung
waren. Die zwölfjährige Epoche des Nationalsozialismus findet keine Berücksichtigung.
3.1.1.1 Die Paulskirchen-Verfassung von 1849
Der föderale Entwicklungsprozess auf deutschem Boden war spätestens mit der Frankfurter
Reichsverfassung vom 28.03.1849 unaufhaltsam. Das Gesetzeswerk war der erste Versuch,
das US-amerikanische Vorbild der ,,Federal Papers" nicht nur ideologisch, sondern auch
rechtlich auf das Gebiet des bisherigen Deutschen Reiches zu übertragen. Das bedeutete in
erster Linie einen Bundesstaat mit gleichzeitiger konstitutioneller Monarchie ins Leben zu
rufen, der die bisherigen souveränen Teilstaaten integrierte. Schon diese erste föderale
Verfassung befand sich bereits im Dilemma, unitarische Bestrebungen einerseits und
partikularistische Tendenzen andererseits vereinen zu müssen. Der letztendlich dominierende
unitarische Grundzug machte sich in der umfassenden Kompetenzausstattung des Reiches
bemerkbar.
83
Die Zentralgewalt entschied über Krieg und Frieden und hatte generell
gegenüber dem Ausland die alleinige Vertretung des neuen Landes inne. Auch die Aufsicht
über Schifffahrt, Wehrwesen und Post lag bei der obersten Ebene.
84
Dem Kaiser und seiner
ministerialen Reichsregierung stand ein in zwei Kammern, in Volks- und Staatenhaus,
geteilter Reichstag gegenüber. Beide letztgenannten waren jedoch gegenüber der
Reichsregierung unterprivilegiert. Das Staatenhaus darf als Vorgänger des späteren
Bundesrates gesehen werden, bestand es doch aus Vertretern der Mitgliedsstaaten. Zwar
zerbrach die Gesetzgebung nur wenige Jahre nach ihrer Einführung am weiterhin bestehenden
Konkurrenzverhältnis Preußen Österreich und dessen ,,gegenrevolutionären Kräften"
85
. Der
Meilenstein aber war trotz dieser Auseinandersetzungen um Größe und Form des zukünftigen
Reiches gesetzt. Die Verwendung des Terminus ,,Meilenstein" ist nicht übertrieben, da die
Paulskirchen-Verfassung bereits einen klassischen und bis heute gültigen Wesenszug des
deutschen Föderalismus in sich trägt: Den Gliedstaaten bleibt die Ausführung der
Bundesgesetze überlassen.
86
Etwaig anfallende Konflikte sollten von einem Reichsgericht als
83
Vgl. Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 46.
84
Vgl. Heinz Laufer: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. München 1985, S. 26.
85
Bertelsmann-Verlag (Hrsg.): Das große Bertelsmann-Online-Lexikon 2002. München / Gütersloh 2002.
Stichwort ,,Frankfurter Nationalversammlung".
86
Vgl. Hans Boldt: Der Föderalismus in den Reichsverfassungen von 1849 und 1871. In: Wellenreuther,
Hermann und Claudia Schnurmann (Hrsg.): Die amerikanische Verfassung und Deutsch-Amerikanisches
Verfassungsdenken. Oxford 1991, S. 307 ff. Boldt sieht die beabsichtigte Einflusserhaltung des Königtums
als Hauptgrund für diese funktionale Teilung von legislativen und exekutiven Elementen. Zudem könnten
25
höchster juristischer Instanz geklärt werden. Das Gericht sollte gleichberechtigt neben Kaiser
und Reichstag stehen. Als ein ,,Bundesverfassungsgericht"
87
sollte es unter anderem für
mögliche Klagen eines Gliedstaates gegen die Reichsgewalt zuständig sein.
3.1.1.2 Die Reichsverfassung von 1871
Die Verfassung vom 16.4.1871 und ihr fast gleichlautender Vorläufer des Norddeutschen
Bundes von 1867 verfügten ebenso über eine Kompetenzteilung zwischen Bund und Ländern.
Der Katalog der genauen Zuständigkeiten orientierte sich dabei stark am Vorbild von 1849.
88
Weiterhin fanden sich die Länder damit in einer hierarchischen Ordnung dem Deutschen
Reich als Zentralinstanz unterstellt. Preußens Ministerpräsident stellte zugleich den
Reichskanzler, wie sich überhaupt Preußen einer ungeheueren Machtfülle sicher sein konnte.
Das Deutsche Reich war eine ,,monarchische Föderation mit einer hegemonialen
Grundstruktur aufgrund der politischen, geographischen und verfassungsrechtlichen
Vorrangstellung des Königreichs Preußen"
89
. Die Gesetzgebungskompetenzen und die
Ausführung der Gesetze wurden weiter nach Gebietskörperschaften getrennt. Allerdings: Zu
Kontrollzwecken räumte man dem Reich ein Beaufsichtigungsrecht für die Verwirklichung
der Gesetze ein. Man wollte hiermit gemachten Erfahrungen Rechnung tragen: Ohne die
Kontrollklausel hatte sich die Gesetzgebungskompetenz als bloßer Papiertiger erwiesen. Die
Trennung von Gesetzgebung und Verwaltung barg indes immenses Streitpotential in sich. Für
diese Problematik hatte die Verfassung keine Lösung parat, da sie keine juristische, sondern
lediglich politische Lösungen zur Schlichtung vorsah
90
. In diesem Kontext trat erneut der
noch heute bedeutsame Bundesrat auf die Bühne des föderalen Geschehens. Wie heute
bestand er aus Vertretern der Länderregierungen, die über ein abgestuftes Stimmrecht
verfügten. Als ,,Bindeglied zwischen dem föderativen Gedanken und der preußischen
Hegemonie"
91
stand er zusammen mit dem Reichstag dem deutschen Kaiser als
gesetzgebende Institution gegenüber. Als verfassungsrechtlich oberstes Organ übertraf er die
aber auch schlicht praktische Überlegungen der Umsetzbarkeit zu der beschriebenen Regelung geführt
haben.
87
Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 27.
Laufer verwendet den Begriff an dieser Stelle seiner historischen Abhandlung zum ersten Mal. Die in etwa
vergleichbaren Kompetenzen zwischen Reichsgericht und heutigem Bundesverfassungsgericht erscheinen
das zu rechtfertigen, wenngleich Struktur, Arbeitsweise und Zusammensetzung beider Institutionen sehr
verschieden waren.
88
Vgl. Jörg-Detlef Kühne: Die Reichsverfassung der Paulskirche. Vorbild und Verwirklichung im späteren
deutschen Rechtsleben. Frankfurt am Main 1985, S. 61 f.
89
Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 29.
90
Vgl. Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 47 ff.
91
Udo Scholl: Der Bundesrat in der deutschen Verfassungsentwicklung. Reichsverfassung von 1871 und
Grundgesetz. Berlin 1982, S. 27.
26
Letztgenannten in punkto Kompetenzen aber um ein Vielfaches.
92
Der Bundesrat war
besonders aufgrund seines absoluten Vetorechtes im Gesetzgebungsprozess ,,Grundtypus und
Modell der Zweiten Kammer"
93
. Trotz schwacher Stellung des Reichstags und preußischer
Übermacht in einem System mit ,,stark dynastischer Komponente"
94
: Das maßgeblichste
Hindernis für eine reibungslose Funktionsweise des neuen Reiches lag in der
Finanzverfassung. Im Gegensatz zum heutigen Status quo war das Deutsche Reich finanziell
von seinen Teilstaaten abhängig, da ihm allein Einnahmen aus Zöllen zustanden. Die Länder
überwiesen deshalb je nach Bevölkerungszahl unterschiedlich hohe Beiträge. Ein adäquater
Finanzausgleich kam auch aufgrund der klaren Trennung der Steuerquellen nicht zustande,
der Gesamtstaat hing am Tropf der Länder.
95
3.1.1.3 Die Verfassung der Weimarer Republik
Das Ende des ersten Weltkrieges war zugleich der Beginn des Versuches, den deutschen Staat
auf neue und zugleich tragfähigere Beine zu stellen. Man vollzog den Übergang zu einer
parlamentarischen Regierung, stellte aber ,,neben den Reichstag einen direkt gewählten
Reichspräsidenten, führte darüber hinaus den Volksentscheid ein und schuf damit drei
konkurrierende demokratische Legitimationen"
96
. Dies stellte sich als eine unglückliche
Vorkehrung heraus, die den späteren Eintritt in die NS-Diktatur ungewollt begünstigte.
Die Weimarer Verfassung präsentierte sich trotz der Betonung der nationalen Einheit als
bundesstaatliche Lösung. Die Länderregierungen konnten ihren Einfluss insgesamt aber nicht
halten, wenngleich zumindest das flächen- und bevölkerungsreiche Preußen immer noch eine
hervorgehobene Stellung beanspruchte. Die Bedeutung des vormaligen ,,Bundesrates" wurde
stark beschnitten, so dass die Möglichkeiten der Länderregierungen stark eingeschränkt
waren.
97
Der ,,Reichsrat" verfügte in der Legislative nur über ein suspensives Vetorecht. Die
Gesetzgebungskompetenzen waren zwar in der Hauptsache konkurrierender Natur, allerdings
konnte das Reich Richtlinien für die Ländergesetzgebung vorgeben. Auch bei der Ausführung
der Reichsgesetze standen die Länderverwaltungen erneut unter der Oberaufsicht des Reiches.
Mit der Einführung eines Staatsgerichtshofes sah die Weimarer Verfassung nun wieder die
juristische Klärung von politischen Differenzen vor. Das Modell der Vorgängerverfassung
hatte sich - zumindest in diesem Punkt - in keiner Weise bewährt.
92
Ebd., S. 39.
93
Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland , S. 30.
94
Ines
Marie Annerose Jung, Die Reform des Finanzausgleiches zum Jahr 2005, S. 8.
95
Vgl. Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 32 f.
96
Wolfgang Rudzio: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 2000, S. 49 ff.
97
Vgl. Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 34 f.
27
Das Weimarer Modell entsprach alles in allem eher einem unitarischen, denn einem
dezentralisierten Verfassungsentwurf. Erkennbar ist dies auch am Aufbau seiner
Finanzverfassung: Anders als in der Reichsverfassung von 1871 waren die Länder durch die
Schaffung einer Reichsfinanzverwaltung zu Kostgängern des Reiches geworden. Die
Nationalversammlung in Weimar hatte durch die Vereinnahmung der Finanzverwaltung die
Möglichkeit ein umfangreiches Steuersystem zu schaffen, das zunächst allein die
Einnahmenseite des Gesamtstaates begünstigen sollte. Die Länder dagegen hatten nicht mehr
die Gelegenheit selbst Steuern zu erheben. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer oder
Umsatzsteuer waren von nun an Reichssteuern. Die Gliedstaaten waren deshalb auf ein
staatliches Überweisungssystem angewiesen, welches die Finanzausstattung der Länder
sichern sollte. Die ,,Perversion der Bundesstaatlichkeit"
98
nahm ihren Lauf und erfuhr 1933
ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit der Machtergreifung Hitlers wurden zum Ende der
Weimarer Republik auch die letzten föderalen Elemente zugunsten eines ,,rigiden
Einheitsstaates"
99
aus der deutschen Gesetzgebung entfernt. Gleichschaltung aller staatlichen
Ebenen und Bereiche hieß das politische Prinzip der Stunde.
3.1.2 Prozesse der Systemfindung nach 1945
Dem Ende des 2. Weltkrieges am 9. Mai 1945 folgte in Deutschland die Herrschaft der vier
Besatzungsmächte. Ihnen oblag es, die politische Gestalt Deutschlands für die Zukunft
festzulegen. Die USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion waren sich in der
Frage des zu installierenden Ordnungsprinzips für das zerschlagene Land keineswegs einig.
Im Kern der Diskussion stand die Entscheidung, ob das neue Deutschland unitarisiert oder
föderalisiert, ob es eher zentralisiert oder eher dezentralisiert sein sollte.
100
Einigkeit bestand
nur darin, das fast 80 Jahre lang übermächtige Preußen zu zerschlagen und somit eine
mögliche Quelle neuerlichen Machtmissbrauchs auszuschalten. Obwohl lange bezüglich der
Neuordnung gespalten Amerika schwankte zwischen einem föderativen Einheitsstaat und
stark dezentralisierten Nord- und Südteilen einigte sich die amerikanische mit der britischen
Regierung in Jalta über den Begriff ,,föderative Dezentralisierung"
101
. Auch auf der
Konferenz von Potsdam, im Juli und August 1945, wurde diese Zielvorstellung nochmals
bestätigt. Danach allerdings war keine gemeinsame Position mehr zu finden:
98
Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 38.
99
Ines Marie Annerose Jung, Die Reform des Finanzausgleiches zum Jahr 2005. S. 8
100
Vgl. Heinz Laufer, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 17.
101
Heinz Laufer, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 18.
28
,,Frankreich betrieb in Deutschland eine extreme Dezentralisierungspolitik; die UDSSR
trat für einen zentralistischen Einheitsstaat ein; Großbritannien bereitete einen
dezentralisierten Einheitsstaat vor; die USA empfahlen einen Bundesstaat
amerikanischer Observanz."
102
Erst die Konferenz zwischen den westlichen Alliierten sowie Belgien, Luxemburg und
Holland entschied sich im Juni 1948 endgültig für die Errichtung eines westdeutschen Staates
mit einer föderalistischen Konzeption. Man bejahte damit langfristig die drei normativen
Hauptbegründungen
103
für Föderalismus und erkannte, dass föderale Lösungen besonders in
punkto Allokation und Distribution fast uneingeschränkt auf das zerschlagene Deutschland
anwendbar und wahrscheinlich vorteilhaft waren. Es war klar: Beide Formen Zentralstaat
und Föderalstaat - verfügen sowohl über Vor- wie auch über Nachteile: So ist eine
Zentralregierung zweifellos besser in der Lage Stabilisierungs- und Verteilungsprobleme zu
lösen. Man wusste aber auch: Ohne lokale Regierungen als Repräsentanten untergeordneter
Gebietskörperschaften sind ,,Wohlfahrtsverluste aus dem einheitlichen Konsum öffentlicher
Güter sehr wahrscheinlich"
104
, da nur untere Ebenen die regionalen Gegebenheiten
angemessen berücksichtigen können.
Wenig später folgte ein einschneidendes Ereignis: Die Westmächte übergaben die
sogenannten ,,Frankfurter Dokumente" an die Regierungschefs der westdeutschen Länder. In
ihnen präsentierte man die Ergebnisse der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz und forderte
die Ministerpräsidenten auf, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Es sollte
,,eine Regierungsform des föderalistischen Typs" geschaffen werden, ,,die am besten geeignet
ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen"
105
. Trotz
dieses hehren Zieles: Die Spaltung Deutschlands war ab diesem Zeitpunkt fast unumgänglich
geworden. Das ,,Diktat der Systemauseinandersetzungen"
106
hatte nunmehr zwei
Gesellschaftssysteme auf deutschem Boden geschaffen.
102
Ebd., S.19
103
Vgl. Charles B. Blankart, Öffentliche Finanzen in der Demokratie, S. 555 f.
Die Theorie sieht drei normative Begründungen für die Installation eines föderalen Systems: Es soll es
erlauben (1), regional unterschiedlichen Präferenzen nachzukommen (2), zu neuen Erkenntnissen über die
Organisation des Staates und die Bereitstellung staatlicher Leistungen zu gelangen und (3) durch
institutionelle Kongruenz Anreize für eine sparsame Ressourcenverwendung geben. Bei Bothe
(Föderalismus ein Konzept im geschichtlichen Wandel, S. 24 f.) wird diese Systematik in enormen
Ausmaß erweitert.
104
Tilo Müller-Overheu: Der bundesstaatliche Finanzausgleich im Rahmen der Deutschen Einheit. Frankfurt
a.M. 1994, S. 21.
105
Büro der Ministerpräsidenten des amerikanischen, britischen und französischen Besatzungsgebietes (Hrsg.):
Dokumente betreffen die Begründung einer neuen staatlichen Ordnung in den amerikanischen, britischen
und französischen Besatzungszonen (Frankfurter Dokumente). Wiesbaden 1948, S. 15.
106
Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 79.
29
Der anschließende Verfassungskonvent von Herrenchiemsee erarbeitete eine ,,kaum zu
überschätzende",
107
aber von schweren Auseinandersetzungen gezeichnete Grundlage für die
nun folgende Arbeit des Parlamentarischen Rates in Bonn. Gerade der angestrebte
Finanzausgleich zwischen den ökonomisch unterschiedlich starken Ländern führte zu
vielfältigen Vorschlägen und heftigsten Kontroversen quer durch alle politischen Parteien.
Allen war klar: Die Kompetenzen in Finanzverwaltung und Finanzgesetzgebung sowie die
Aufteilung des Steueraufkommens entschieden über die zukünftige Machtverteilung. Man
hatte zwischen drei widerstrebenden Zielvorstellungen zu vermitteln: Der Forderung nach
Einheitlichkeit im Bereich von Recht und Ökonomie, der Forderung nach vergleichbaren
Bedingungen für alle Bürger und der Forderung nach Länder-Finanzhoheit.
108
Die Resultate
des Parlamentarischen Rates (65 Mitglieder, Vorsitzender Konrad Adenauer) kamen erst unter
enormem Druck der Westmächte zustande. Man entschied sich für eine zwischen den
Gebietskörperschaften geteilte Finanzverwaltung und für einen Ausgleich zwischen den
Ländern. Damit hatte die SPD durch die Drohung, notfalls das ganze Grundgesetz
abzulehnen, letztendlich einen Kompromiss erzielt. Die Besatzungsmächte und die CDU
hatten nämlich ursprünglich auf dezentralisiertere Finanzzuständigkeiten hingewirkt.
109
Zudem wurde der Vorrang des Bundes in der Finanzgesetzgebung manifestiert, wenngleich
der Bundesrat in der Steuergesetzgebung gleichberechtigt wurde. Auch bezüglich der zweiten
Kammer gingen die Meinungen auseinander: Die SPD-geprägte Minderheit schlug einen
Senat aus direkt gewählten Mitgliedern vor, die CDU/CSU wollte in großen Teilen einen
Bundesrat als Vertretung der Länderregierungen. Eine tatsächliche Mehrheit für eine der
beiden Lösungen lag aber lange in keiner der Fraktionen vor.
110
Weitgehende
Übereinstimmung bestand lediglich in der Aufteilung legislativer Kompetenzen in
ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung.
111
Der Hauptunterschied zwischen
Herrenchiemsee und Bonn lag darin, dass auf dem oberbayerischen See die Probleme
theoretisch erörtert und dargelegt werden konnten, in Bonn aber politische Entscheidungen
und Kompromisse gefunden werden mussten. Trotz dieser Dichotomie: Das Verfahren hatte
Erfolg. Von der Übergabe der ,,Frankfurter Dokumente" bis zur Verabschiedung des
eigentlich nur als Provisorium gedachten Grundgesetzes am 8. Mai 1949 vergingen ganze
zehn Monate. Manche Kritiker meinen allerdings, der Mangel an Zeit sei noch heute klar
107
Wolfgang Benz: Zwei Staatsgründungen auf deutschem Boden. In: Bundeszentrale für politische Bildung:
Deutschland 1945 1949 Besatzungszeit und Staatsgründung. Heft 259, Bonn. Online-Ausgabe o.
Seitenangabe.
108
Vgl. Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 96 ff.
109
Vgl. Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, S. 43.
110
Vgl. Udo Scholl, Der Bundesrat in der deutschen Verfassungsentwicklung, S. 32 f.
111
Vgl. Heinz Laufer, Der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 26 ff.
30
erkennbar: Das Ergebnis sei ,,ein konfuses, schlampiges Gewirr von Artikeln in einer elenden
Sprache."
112
Andere artikulieren, es sei der größte Fehler der Staatsgründung gewesen, dass
im Grundgesetz nicht die Bundesländer neu und gleich leistungsstark zugeschnitten
wurden.
113
Zweifellos: Gerade spätere Auseinandersetzungen um die Verteilung von
Steuereinnahmen hätten so stark vermindert werden können. Diese Kritikpunkte waren aber
sicher nicht dafür ausschlaggebend, dass sich Bayern im Mai 1949 als einziges Bundesland
weigerte das Werk zu ratifizieren und dies trotz der anerkannten Rechtsverbindlichkeit des
Grundgesetzes. Die CSU im Bayerischen Landtag forderte an vielen Stellen - auch in Sachen
Finanzverwaltung - mehr Einfluss für die Länder.
114
Münchener Rufe nach mehr
Föderalismus haben also Tradition.
3.2 Das Föderalstaatsprinzip der Bundesrepublik
Aus der Absicht der Siegermächte heraus, ,,checks and balances zu schaffen"
115
, durchziehen
föderale Elemente das Grundgesetz wie der so vielbeschriebene rote Faden. In knapp 50
Artikeln zu den unterschiedlichsten Rechts - und Gesellschaftsgebieten findet man Verweise
auf die politische Ordnung Deutschlands, wenn auch ein klar und gleichsam
unmissverständlich formuliertes Postulat des Föderalismus fehlt. Die föderale Struktur der
Bundesrepublik, genauer gesagt ihr bundesstaatliches Prinzip, ist in Artikel 20 festgelegt.
Danach ist die Bundesrepublik ein ,,demokratischer und sozialer Bundesstaat"
116
. Diese
Regelung ist unabänderlich. Die ,,Ewigkeitsgarantie" besagt, dass neben den ersten zwanzig
Artikeln auch die ,,Gliederung des Bundes in Länder" und die ,,grundsätzliche Mitwirkung
der Länder bei der Gesetzgebung"
117
von einer Verfassungsänderung ausgeschlossen ist. Eine
Neuordnung der Staatlichkeit könnte also allein über eine ganz neue Verfassungsgebung
erfolgen. Die vorgeschriebene Bundesstaatlichkeit setzt übrigens einige Charakteristiken
voraus, ohne welche die Länder lediglich abhängige Provinzen des Gesamtstaates wären. So
müssen zum Beispiel die finanzielle Selbstständigkeit und einige unbeschränkte
112
Urs Bernetti: Das deutsche Grundgesetz. Eine Wertung aus Schweizer Sicht. Würenlos 1994, S. 8.
113
Vgl. Karl Hahn / Manfred Hölscher: Föderalisierung der Bundesrepublik Deutschland. In: Fried Esterbauer /
Guy Heraud / Peter Pernthaler (Hrsg.): Föderalismus als Mittel permanenter Konfliktregelung.
Wien 1977, S. 117.
114
Vgl. Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, S. 44.
115
Uwe Wagschal / Hans Rentsch: Der Preis des Föderalismus, Zürich 2002, S. 12.
116
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
Art. 20, 1
117
Ebd., Art. 79, 3.
31
Herrschaftsrechte der Gliedstaaten gewährleistet sein.
118
Generell bemühte man sich, den
,,finanziellen Einfluss von Bund und Ländern auszubalancieren"
119
.
Typisch für den bundesdeutschen Föderalismus ist die eminent einflussreiche Stellung des
Bundesrates als Vertretung der Länderparlamente. Bei über 60 Prozent aller durch den
Bundestag verabschiedeten Gesetze muss die Länderkammer ihre Zustimmung erteilen.
Andere setzen diese Zahl sogar noch deutlich höher an. Der Bundesrat wirkt im Sinne der
Gewaltenhemmung, kann aber selbstverständlich auch als Blockadeinstrument eingesetzt
werden. Letzteres gilt vor allem dann, wenn die Bundestagsopposition im Bundesrat die
Mehrheit stellt.
120
Die Position des Bundesrates, so wichtig sie aus demokratietheoretischen
Gründen auch sein mag, verzögert durch die Notwendigkeit umfangreicher Konsultationen
zwischen Bund und Ländern die politische Arbeit. Der Vermittlungsausschuss, eine in
Deutschland vorher weitgehend unbekannte Institution des Ausgleichs zwischen Bundestag
und Bundesrat
121
, gilt unter Experten nicht umsonst als eines der mächtigsten Gremien
überhaupt.
Trotz mancher Ausgleichsmechanismen: Politisch unüberwindbare Streitigkeiten - gerade
zwischen föderalen Ebenen - bleiben nicht aus. Um die Funktionsfähigkeit des Bundesstaates
dennoch zu sichern, fungiert das Bundesverfassungsgericht als oberster Streitschlichter und
,,föderativer Friedenswahrer"
122
. Es entscheidet im Streitfall über Kompetenzen und
Befugnisse von Ebenen und Institutionen. Zu seinen Aufgaben gehört die Schlichtung von
Organstreitigkeiten, also zum Beispiel Konflikten zwischen Bundesrat und Bundespräsident,
sowie die Schlichtung direkter Bund-Länder-Streitigkeiten. Zu letzteren zählen sehr oft
sogenannte Normenkontrollklagen. Sie ersuchen das Gericht, die Vereinbarkeit von Bundes-
oder Landesrecht mit dem Grundgesetz zu prüfen. Vor allem im hartumkämpften Bereich der
Finanzverfassung erhält die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe
eine bisweilen überdimensionierte Bedeutung.
Erwähnt werden sollte: Die Tendenz zum Föderalismus ist beileibe nicht so ausgeprägt, wie
das klare Bekenntnis der Ewigkeitsgarantie glauben machen möchte. Die Autoren der
Verfassung glaubten, durch einige unitaristische, wenn nicht gar zentralistische Tendenzen
118
Vgl. Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 66 f.
119
Hans-Wolfgang Arndt: Wie der Finanzausgleich einen föderativen Wettbewerb behindert - der Fall
Deutschland. In: Uwe Wagschal / Hans Rentsch (Hrsg): Der Preis des Föderalismus. Zürich 2002, S. 253.
120
Vgl. Franz Fallend, Vielfältiger Föderalismus. S. 15.
121
Vgl. Heiderose Kilper/Roland Lhotta, Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, S. 126 f.
122
Heinz Laufer, Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, S. 67.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832486907
- ISBN (Paperback)
- 9783838686905
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Sozialwissenschaftliche Fakultät, Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaften
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- wettbewerbsföderalismus bundesstaat finanzverfassung föderalstaat gleichheitsprinzip
- Produktsicherheit
- Diplom.de