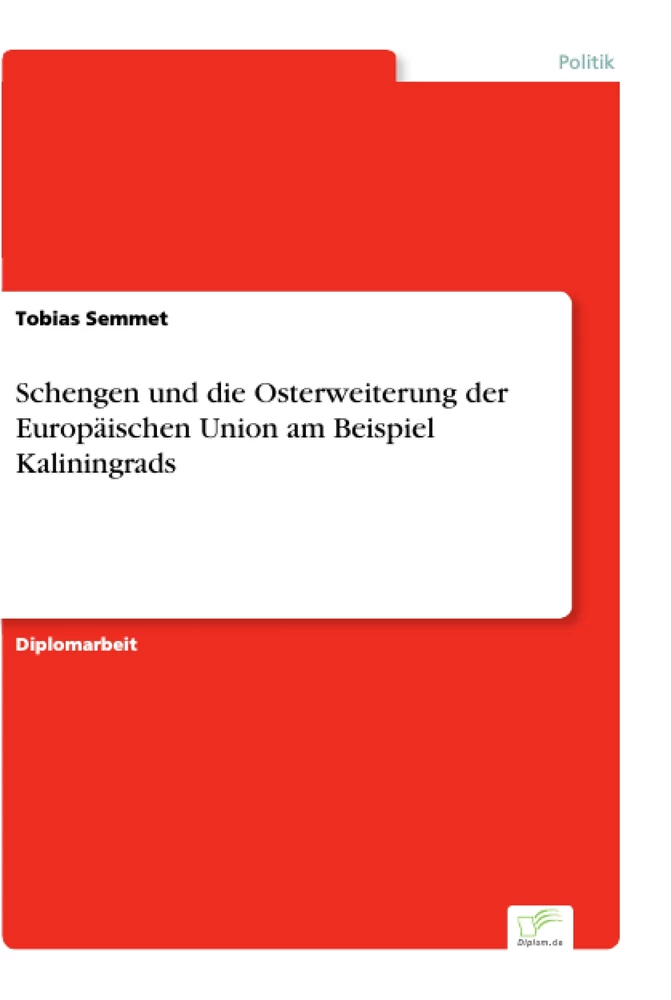Schengen und die Osterweiterung der Europäischen Union am Beispiel Kaliningrads
©2004
Diplomarbeit
134 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Mit der Erweiterung der Europäischen Union (EU) um zehn neue Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa sowie dem Mittelmeerraum wird sich der östliche Abschnitt der EU-Außengrenze um mehr als 700 km nach Osten verschieben. Die erweiterte EU wird dann an Staaten wie Kroatien, Serbien und Montenegro, Rumänien, Russland, Ukraine und Weißrussland angrenzen. Darüber hinaus wird erstmals in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses eine Exklave eines Drittstaates vollständig von EU-Territorium umgeben sein. Denn durch den Beitritt Litauens und Polens wird mit Kaliningrad eine russische Enklave innerhalb der EU entstehen. Die zukünftigen EU-Mitgliedstaaten haben sich im Zuge der Beitrittsverhandlungen dazu verpflichtet, den gemeinschaftlichen Besitzstand (acquis communautaire) der EU vollständig zu übernehmen. Teil des acquis communautaire ist seit der Vertragsreform von Amsterdam auch der Schengen-acquis. Alle Staaten, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, müssen seit Amsterdam den Schengen-acquis spätestens mit dem Datum des Beitritts in nationales Recht übernehmen und uneingeschränkt anwenden. Ausnahme- und Übergangsregelungen, welche den Transfer von einer eher liberalen Praxis der Grenzkontrollen und Visumpolitik in Mittel- und Osteuropa zu den strengen Regelungen des Schengen-acquis erleichtern würden, werden hierbei nicht eingeräumt. Die Beitrittsländer sind also verpflichtet, ihren jeweiligen Abschnitt der zukünftigen EU-Außengrenze gemäß den Bestimmungen des Schengen-acquis zu schützen. Dies bedeutet aber nicht, dass gleichzeitig die Binnengrenzkontrollen zu den derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten aufgehoben werden. Die EU behält sich vielmehr das Recht vor, die Binnengrenzkontrollen erst nach einer mehrjährigen Evaluierungsperiode und einem weiteren Beschluss des Ministerrates aufzuheben.
Die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) befinden sich damit in einer Situation, welche ihnen eine strenge Kontrolle der zukünftigen EU-Ostgrenze abverlangt, ohne dass aber gleichzeitig eine Aufhebung der Binnengrenzkontrollen zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern stattfindet. Neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit wird den Bürgern der neuen Mitgliedsstaaten dadurch einer der am unmittelbarsten erfahrbaren Vorteile einer EU-Mitgliedschaft mittelfristig vorenthalten. Darüber hinaus wirft die Ausdehnung des Schengen-Raumes eine Reihe weiterer Probleme auf. Zum einen zeichnet sich die Bevölkerungsstruktur in den östlichen […]
Mit der Erweiterung der Europäischen Union (EU) um zehn neue Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa sowie dem Mittelmeerraum wird sich der östliche Abschnitt der EU-Außengrenze um mehr als 700 km nach Osten verschieben. Die erweiterte EU wird dann an Staaten wie Kroatien, Serbien und Montenegro, Rumänien, Russland, Ukraine und Weißrussland angrenzen. Darüber hinaus wird erstmals in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses eine Exklave eines Drittstaates vollständig von EU-Territorium umgeben sein. Denn durch den Beitritt Litauens und Polens wird mit Kaliningrad eine russische Enklave innerhalb der EU entstehen. Die zukünftigen EU-Mitgliedstaaten haben sich im Zuge der Beitrittsverhandlungen dazu verpflichtet, den gemeinschaftlichen Besitzstand (acquis communautaire) der EU vollständig zu übernehmen. Teil des acquis communautaire ist seit der Vertragsreform von Amsterdam auch der Schengen-acquis. Alle Staaten, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, müssen seit Amsterdam den Schengen-acquis spätestens mit dem Datum des Beitritts in nationales Recht übernehmen und uneingeschränkt anwenden. Ausnahme- und Übergangsregelungen, welche den Transfer von einer eher liberalen Praxis der Grenzkontrollen und Visumpolitik in Mittel- und Osteuropa zu den strengen Regelungen des Schengen-acquis erleichtern würden, werden hierbei nicht eingeräumt. Die Beitrittsländer sind also verpflichtet, ihren jeweiligen Abschnitt der zukünftigen EU-Außengrenze gemäß den Bestimmungen des Schengen-acquis zu schützen. Dies bedeutet aber nicht, dass gleichzeitig die Binnengrenzkontrollen zu den derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten aufgehoben werden. Die EU behält sich vielmehr das Recht vor, die Binnengrenzkontrollen erst nach einer mehrjährigen Evaluierungsperiode und einem weiteren Beschluss des Ministerrates aufzuheben.
Die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) befinden sich damit in einer Situation, welche ihnen eine strenge Kontrolle der zukünftigen EU-Ostgrenze abverlangt, ohne dass aber gleichzeitig eine Aufhebung der Binnengrenzkontrollen zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern stattfindet. Neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit wird den Bürgern der neuen Mitgliedsstaaten dadurch einer der am unmittelbarsten erfahrbaren Vorteile einer EU-Mitgliedschaft mittelfristig vorenthalten. Darüber hinaus wirft die Ausdehnung des Schengen-Raumes eine Reihe weiterer Probleme auf. Zum einen zeichnet sich die Bevölkerungsstruktur in den östlichen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8403
Semmet, Tobias: Schengen und die Osterweiterung der Europäischen Union
am Beispiel Kaliningrads
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Autorenprofil
Zur Person
Name
Tobias Semmet
Geburtsdatum
11. Dezember 1976
Geburtsort
Frankfurt am Main
Familienstand
Ledig
Beruf
Student (Diplom-Politologie)
Adresse
Dahlmannstrasse 20, 60385 Frankfurt am Main
Festnetz
069/94943872
Mobiltelefon
0177/2153532
Email
t.semmet@web.de
Schul- und Hochschulausbildung
1983 - 1987
Villa Kunterbunt-Grundschule, Maintal
1987 - 1993
Erich-Kästner-Gesamtschule, Maintal
1993 - 1996
Albert-Einstein-Gymnasium, Maintal
Abitur
Seit Oktober 1998
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Studium der Politikwissenschaft
Oktober 2000 -
Juli 2001
University of Southampton, GB
ERASMUS-Stipendium
Anstellungen und Praktika
Juli 1996 -
August 1997
Zivildienst, Mobiler Sozialer Hilfsdienst (MSHD) Stadt Maintal
September 1997 -
März 1998
Vollzeitanstellung, London Hostel Association (LHA), London, GB
April 1998 -
Mai 1998
Redaktionspraktikum, Contex-Verlag, Stockstadt am Main
Juni 1998 -
Oktober 1998
Vollzeitanstellung, Deutsche Bank, Eschborn
August 1999 -
August 2000
Teilzeitanstellung, Deutsche Bank, Eschborn
August -
September 2000
Praktikum, Fritz Bauer Institut, Frankfurt am Main
November 2001-
März 2002
Bereitschaftsdienst, Frankfurter Fußwegreinigung (FFR)
November 2001 -
März 2002
Teilzeitanstellung, SAL Service GmbH, Kelsterbach
April 2002 -
September 2003
Anstellung, Fachbereichsbibliothek Gesellschaftswissenschaften,
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
November 2002 -
September 2003
Hilfswissenschaftliche Tätigkeit, Hessischen Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HSFK), Frankfurt am Main
Juli 2003 -
August 2003
Redaktionspraktikum, Wirtschaft und Soziales (WISO), ZDF, Mainz
November 2003 -
März 2004
Bereitschaftsdienst, Frankfurter Fußwegreinigung (FFR)
November 2003 -
März 2004
Hilfswissenschaftliche Tätigkeit, Universität Konstanz
Mai 2004 -
Dezember2004
Hilfswissenschaftliche Tätigkeit, Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte (MPIER), Frankfurt am Main
Kenntnisse und Interessen
Hobbys und
Interessen
Sport (Mountainbiking, Basketball, Fitnesstraining), Musik,
Fotographie, Lesen und Reisen
Fremdsprachen
Englisch, fließend in Konversation und Schrift
Französisch, Grundkenntnisse
EDV-Kenntnisse
MS-Office, Outlook, IE, Mozilla, Opera, Star Office, Adobe-
Photoshop, Adobe-Pagemaker, Reference Manager 10, Linux 5.2.,
Windows 95/98/ME/2000/XP
Gliederung
A. Einleitung ... 1
I. Schengen im Rahmen der Osterweiterung als Untersuchungsgegenstand ... 1
II. Forschungsstand ... 4
III. Herangehensweise und Gliederung der Arbeit ... 5
B. Hauptteil ... 8
I. Die Politik der inneren Sicherheit der EU im Erweiterungsprozess Erklärungsmodelle ... 8
1. Die Zwei-Stufen Strategie der Europäischen Union ... 8
2. Die Gewährleistung von Sicherheit als zentrales Staatsziel - Konsequenzen für die euro-
päische Integration ... 11
3. Securitization im Politikfeld innere Sicherheit ... 15
4. Soft Security Ein erweitertes Verständnis von Sicherheit in Europa ...18
5. Schengen und das Konzept der positiven und negativen Integration ... 20
II. Schengen im Erweiterungsprozess ... 24
1. Die Entwicklung des Schengen-Regimes bis zum Vertrag von Amsterdam ... 24
2. Die Bestimmungen des Schengen-acquis und die gemeinsame Visumpolitik der EU .. 30
3. Stabilitätsexport im Rahmen der EU-Osterweiterung ... 37
4. Der Schengen-acquis im Erweiterungsprozess: Herausforderungen für die EU und die
mittel- und osteuropäischen Staaten ... 41
a. Herausforderungen für die Europäische Union ... 43
b. Die Komplexität der ethnischen und ökonomischen Verhältnisse entlang der zukünf-
tigen Ostgrenze der EU ... 52
c. Die Implementierung des Schengen-acquis: Herausforderungen für die mittel- und
osteuropäischen Staaten ... 55
III. Die Fallstudie Kaliningrad: Eine russische Exklave im Schengen-Raum ... 66
1. Aufbau der Fallstudie ... 66
2. Multiple Peripherie innerhalb und außerhalb der erweiterten EU ... 67
3. Kaliningrad, der Schengen-acquis und die gemeinsame Visumpolitik der EU ... 74
4. Optionen für Kaliningrad innerhalb eines erweiterten Schengen-Raumes ... 79
5. Die Kaliningrad-Politik der EU ... 84
6. Russland und Kaliningrad: Spielball in der strategischen Partnerschaft mit der EU ... 90
7. Der Brüsseler Kompromiss in der Visum- und Transitfrage ... 95
C. Schluss ... 99
I. Ergebnis der Arbeit Schengen und die Notwendigkeit flexibler Integrationsmodelle ... 99
II. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen ... 109
D. Anhang ... 115
I. Abkürzungsverzeichnis
... 115
II. Literatur- und Quellenverzeichnis ... 117
,,Wo immer Freiheit je als eine greifbar weltliche Realität existiert hat, war sie räumlich
begrenzt. Dies tritt nirgends deutlicher hervor als bei der Bewegungsfreiheit, der elementarsten und
wichtigsten der negativen Freiheiten, denn Stadtmauern und nationale Grenzen dienen immer nur dem
Zweck, einen Raum ein- und auszugrenzen, innerhalb dessen Menschen sich frei bewegen können.
Natürlich kann dieser Raum durch Verträge und internationale Übereinkommen, die immer auf
Gegenseitigkeit beruhen, beliebig erweitert werden; aber auch unter modernen Bedingungen bleibt
Freiheit räumlich begrenzt [und] ist nur unter gleichen möglich, und Gleichheit ist keineswegs ein
universell gültiges Prinzip, sondern ist gleichfalls nur unter Einschränkungen und vor allem nur in
räumlichen Grenzen anwendbar."
Hanna Arendt, Über die Revolution
1
A. Einleitung
I. Schengen im Rahmen der Osterweiterung als Untersuchungsgegenstand
Mit der Erweiterung der Europäischen Union (EU)
1
um zehn neue Mitglieder aus Mittel-
und Osteuropa sowie dem Mittelmeerraum wird sich der östliche Abschnitt der EU-Außengrenze
um mehr als 700 km nach Osten verschieben. Die erweiterte EU wird dann an Staaten wie Kroatien,
Serbien und Montenegro, Rumänien, Russland, Ukraine und Weißrussland angrenzen. Darüber hin-
aus wird erstmals in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses eine Exklave eines
Drittstaates vollständig von EU-Territorium umgeben sein. Denn durch den Beitritt Litauens und
Polens wird mit Kaliningrad eine russische Enklave innerhalb der EU entstehen.
2
Die zukünftigen
EU-Mitgliedstaaten haben sich im Zuge der Beitrittsverhandlungen dazu verpflichtet, den gemein-
schaftlichen Besitzstand (acquis communautaire) der EU vollständig zu übernehmen. Teil des ac-
quis communautaire ist seit der Vertragsreform von Amsterdam auch der Schengen-acquis. Er be-
inhaltet alle Regelungen bezüglich des gemeinsamen Außengrenzschutzes, der Beseitigung der
Binnengrenzkontrollen und schreibt die Vereinheitlichung der Visumpolitik aller am Schengen-
Regime teilnehmenden Staaten vor. Bis zur Eingliederung in die Europäischen Verträge war
Schengen ein vollständig außerhalb des institutionellen Rahmens der EU angesiedeltes intergouver-
nementales Regime. Dementsprechend war bis 1999 die Teilnahme an Schengen sowohl für Bei-
trittsländer als auch EU-Mitgliedsstaaten nicht verpflichtend. Ein der EU beitretender Staat musste
also nicht automatisch die Bestimmungen des Schengen-acquis in nationales Recht übernehmen.
Mit der Vertragsreform von Amsterdam hat sich dies grundlegend geändert. In Zukunft müssen alle
Staaten, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, den Schengen-acquis spätestens mit dem Datum des
Beitritts in nationales Recht übernehmen und uneingeschränkt anwenden. So hat die EU im derzei-
tigen Erweiterungsprozess größten Wert darauf gelegt, dass die zehn neuen Mitgliedstaaten den
Schengen-acquis möglichst zeitgleich mit ihrem Beitritt im Mai 2004 effektiv implementieren. Aus-
nahme- und Übergangsregelungen, welche den Transfer von einer eher liberalen Praxis der Grenz-
kontrollen und Visumpolitik in Mittel- und Osteuropa zu den strengen Regelungen des Schengen-
acquis erleichtern würden, werden nicht eingeräumt. Die Beitrittsländer sind also dazu verpflichtet,
ihren jeweiligen Abschnitt der zukünftigen EU-Außengrenze gemäß den Bestimmungen des
Schengen-acquis zu schützen. Dies bedeutet aber nicht, dass gleichzeitig die Binnengrenzkontrollen
1
In dieser Arbeit wird für die Zeit nach Maastricht die Bezeichnung EU verwendet. Für frühere Abschnitte des europäischen Integrationsprozesses
wird dagegen die zutreffendere Bezeichnung Europäische Gemeinschaft (EG) benutzt.
2
Die Begriffe Enklave und Exklave können Verwirrung stiften. Per definitionem handelt es sich bei einer Enklave um Gebietsteile eines fremden
Staates, welche vollständig vom Territorium des eigenen Staates umgeben sind. Folglich ist Kaliningrad aus Sicht der EU - welche natürlich kein
Staat im konventionellen Sinne ist - eine Enklave innerhalb der Union. Bei einer Exklave handelt es sich um Gebietsteile des eigenen Staates, welche
vollständig vom Territorium eines fremden Staates umgeben sind. Folglich ist Kaliningrad aus Russlands Perspektive eine Exklave. Entscheidend ist
somit der Standpunkt der Betrachtung.
2
kontrollen zu den derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten aufgehoben werden. Die EU behält sich viel-
mehr das Recht vor, die Binnengrenzkontrollen erst nach einer mehrjährigen Evaluierungsperiode
und einem weiteren Beschluss des Ministerrates aufzuheben.
Die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL)
3
befinden sich damit in einer Situation,
welche ihnen eine strenge Kontrolle der zukünftigen EU-Ostgrenze abverlangt, ohne dass aber
gleichzeitig eine Aufhebung der Binnengrenzkontrollen zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern
stattfindet. Neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit wird den Bürgern der neuen Mitgliedsstaaten da-
durch einer der am unmittelbarsten erfahrbaren Vorteile einer EU-Mitgliedschaft mittelfristig vor-
enthalten. Darüber hinaus wirft die Ausdehnung des Schengen-Raumes auf die Region Mittel- und
Osteuropa eine Reihe weiterer Probleme auf. Zum einen zeichnet sich die Bevölkerungsstruktur in
den östlichen Grenzregionen der einzelnen MOEL als Folge zahlreicher Grenzverschiebungen in
der Vergangenheit durch ein hohes Maß an ethnischer Heterogenität aus. Zum anderen entstand
aufgrund der hohen Permeabilität der Grenzen in der Region im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
eine ausgeprägte Ökonomie des grenzüberschreitenden Kleinhandels, welche die Subsistenz vieler
hunderttausend Menschen in den Grenzräumen Mittel- und Osteuropas gewährleistet. Darüber hin-
aus stellt die Implementierung des Schengen-acquis für die MOEL eine hohe finanzielle, administ-
rative und technische Herausforderung dar. Denn an vielen Abschnitten der zukünftigen EU-
Ostgrenze ist, wenn überhaupt, nur ein rudimentärer Grenzschutz vorhanden. Die neuen EU-
Mitglieder müssen größte Anstrengungen unternehmen, um die sich bei der Anpassung des Außen-
grenzschutzes an Schengen stellenden Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Neben die-
ser Innenwirkung in den MOEL bringt die Expansion Schengens auch negative Auswirkungen auf
die östlichen Nachbarstaaten der erweiterten EU mit sich. Allzu deutlich wird dies am Beispiel der
russischen Exklave Kaliningrad. Deren Bewohner profitierten in der Vergangenheit in hohem Maße
von der Permeabilität der Grenzen in der Region. So konnten sie ohne Visum in die Nachbarstaaten
Litauen und Polen reisen. Ein Transit in das russische Kernland über Litauen oder Polen war prob-
lemlos möglich. Auch entlang der Grenzen Kaliningrads entstand im Laufe des letzten Jahrzehnts
eine ausgeprägte Ökonomie des grenzüberschreitenden Kleinhandels. Mit der Erweiterung der EU
wird sich dies schlagartig ändern. Bewohner Kaliningrads werden in Zukunft für die Einreise nach
Litauen und Polen sowie den Landtransit ins russische Kernland Schengen-Visa benötigen. Es ist zu
erwarten, dass die Verschärfung der Kontrollen an der zukünftigen EU-Ostgrenze sowie die Einfüh-
rung der Visumpflicht den lebensnotwendigen grenzüberschreitenden Kleinhandel in den Grenz-
räumen Kaliningrads nahezu lahm legen wird. Gilt dies gleichermaßen für alle Grenzräume entlang
der zukünftigen EU-Ostgrenze, so bietet sich Kaliningrad doch in besonderer Weise für eine Fall-
3
Die Bezeichnung MOEL steht als Synonym für alle mittel- und osteuropäischen EU-Beitrittsländer. Malta und Zypern werden nicht zu dieser Grup-
pe kontinentaleuropäischer Staaten gezählt. Die Implementierung des Schengen-acquis in diesen beiden Beitrittsländern wird nicht Gegenstand der
Arbeit sein.
3
studie an. Denn die Kaliningrader Oblast
4
(KO) stellt so etwas wie einen Kristallisationspunkt dar.
In ihr akkumulieren sich nahezu alle politischen, administrativen und ökonomischen Konsequenzen
negativer Art, welche der Prozess der Ausdehnung des Schengen-Raumes für Drittstaaten und deren
an die erweiterte EU angrenzenden Region hervorruft.
Die Ausdehnung des Schengen-Raumes im Rahmen der Osterweiterung der EU lässt sich
daher als ein durchaus problem- und konfliktbehafteter Prozess charakterisieren. Dieser Prozess soll
im Rahmen der Arbeit am Beispiel der MOEL sowie der russischen Exklave Kaliningrad untersucht
werden. Dabei sollen folgende zentrale Forschungsfragen zu Grunde gelegt werden: Ist die Erweite-
rungsstrategie der EU, welche eine frühestmögliche effektive Implementierung des Schengen-
acquis durch die MOEL verlangt, adäquat und praktikabel angesichts der komplexen sozialen, öko-
nomischen und ethnischen Verhältnisse in den Grenzräumen entlang der zukünftigen EU-
Ostgrenze? Zu fragen ist auch, weshalb Schengen in der aktuellen Erweiterungsrunde eine so pro-
minente Stellung einnimmt. Warum erlaubt die EU keine Flexibilisierung und Abstufung bei der
Implementierung des Schengen-acquis durch die zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten zu? Warum ver-
folgt die EU eine Politik, welche weder den Verhältnissen in den zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten
gerecht wird, noch die weitere Isolation der KO innerhalb einer erweiterten EU stoppt? Ergebnis
der Arbeit soll sein, dass die repressive Stoßrichtung der Politik der inneren Sicherheit der EU fle-
xible und differenzierte Lösungen bei der Ausdehnung des Schengen-Raumes weitgehend aus-
schließt. Trotz alledem stellt sich eine berechtigte, wenn auch weitgehend theoretische Frage: Sind
Modelle flexibler Integration in Zukunft nicht angebrachter, um der zunehmenden Heterogenität in
einer sich fortlaufend erweiternden EU gerecht zu werden?
Die Arbeit muss sich weitgehend auf die Untersuchung des Prozesses der Ausdehnung des
Schengen-Raumes beschränken. Für eine detaillierte Untersuchung der Auswirkungen und Konse-
quenzen der Expansion Schengens ist es derzeit noch zu früh. Sie kann aber Gegenstand zukünfti-
ger Forschungen sein. Der Schwerpunkt der Untersuchung soll zudem, auch wenn dies teilweise nur
schwer zu bewerkstelligen ist, eindeutig auf der Analyse des Schengen-acquis im Erweiterungspro-
zess liegen. Die Einbeziehung anderer Aspekte der Justiz- und Innenpolitik wie z.B. der Polizeiko-
operation oder der Flüchtlings- und Asylpolitik würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Auf sie
kann allenfalls am Rande eingegangen werden. Die von Schengen strikt zu trennende Arbeitneh-
merfreizügigkeit wird ebenfalls nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. In der öffentlichen und politi-
schen Diskussion werden beide Gegenstände häufig vermischt. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und
der Abbau der Binnengrenzkontrollen stehen jedoch in keinem direkten Zusammenhang. Die in Art.
39 EGV gewährleistete Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist ein Recht, das grundsätzlich allen EU-
Bürgern unabhängig vom Status der Binnengrenzkontrollen garantiert wird. Bezeichnenderweise
4
Der Begriff Oblast steht im russischen für ein größeres Verwaltungsgebiet.
4
haben die derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten auch auf diesem Gebiet von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, die Mobilität der zukünftigen EU-Bürger aus den MOEL für mehrere Jahre zu beschrän-
ken.
5
II. Forschungsstand
In der Vergangenheit dominierten hauptsächlich Studien aus der Rechtswissenschaft (A-
ckermann et al. 1995; Hailbronner 1996) sowie Beiträge aus der politischen bzw. polizeilichen Pra-
xis (Krüger 1994; Taschner 1997; Schäuble 1990; Seiters 1992) die Forschung zu den Bereichen
Schengen und der europäischen Integration im Politikfeld innere Sicherheit. Eine Ausnahme bilde-
ten Nanz (1994) und Gehring (1998), welche das Schengen-Regime aus politikwissenschaftlicher
Perspektive untersuchten. Die zunehmende Dynamisierung des Integrationsprozesses im Politikfeld
innere Sicherheit auf europäischer Ebene seit Amsterdam und den Anschlägen von September 2001
spiegelt sich jedoch auch in der politikwissenschaftlichen Literatur wider (Boer/Wallace 2000; Mo-
nar 2001; Wagner 2002). In jüngerer Zeit ist eine Reihe von Monographien erschienen, welche sich
detailliert dem Integrationsprozess im Politikfeld innere Sicherheit aus politikwissenschaftlicher
Perspektive annähern (Boer 2000; Knelangen 2001; Mitsilegas et al. 2003; Müller 2003).
6
Die Aus-
dehnung des Schengen-Raumes im Rahmen der EU-Osterweiterung nimmt bei Knelangen (2001)
jedoch gar keinen und bei Müller (2003) nur einen geringen Raum ein. Einzig Mitsilegas et al.
(2003) beschäftigen sich ausführlich mit diesem Prozess. Darüber hinaus liegen kleinere Studien
vor, welche sich teils ausführlich der Expansion Schengens im Rahmen der EU-Osterweiterung
widmen (Boer/Kerchove 2001; Borissova 2003; Grabbe 2000; Knelangen 2002; Krenzler/Wolczuk
2001; Rabenschlag 2003). Vor allem Borrissova (2003) und Krenzler/Wolczuk (2001) bieten eine
fundierte Erörterung und Analyse des Untersuchungsgegenstandes unter ausreichender Berücksich-
tigung der rechtlichen Aspekte. Einigen anderen Arbeiten haftet dagegen das Manko an, sich dem
Untersuchungsgegenstand ausschließlich aus politikwissenschaftlicher Perspektive zu widmen, oh-
ne ausreichend die rechtlichen Rahmenbedingungen des Schengen-acquis zu berücksichtigen. Dabei
ist eine ausreichende Kenntnis der Bestimmungen des Schengen-acquis sowie der gemeinsamen
Visumpolitik der EU unerlässlich, will man fundiert die Alternativen zu bestehenden Regelungen
5
Die Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit stößt auf zunehmende Frustration in den zukünftigen EU-Mitgliedsstaaten. Irland ist mittlerweile
das einzige EU-Mitglied, welches Arbeitnehmern aus den neuen Mitgliedsstaaten keinerlei Beschränkungen auferlegen wird. Die meisten der derzei-
tigen EU-Mitgliedsstaaten haben jedoch von dieser in den Beitrittsverträgen festgeschriebenen Option Gebrauch gemacht. Danach wird die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit der neuen EU-Bürger für mindestens fünf Jahre beschränkt. Diese Frist kann jedoch um weitere zwei Jahre verlängert werden,
wenn ernsthafte Störungen des Arbeitsmarktes in den derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten vorliegen (Carter 2004). Angesichts der derzeitigen Massenar-
beitslosigkeit und des innenpolitischen Drucks wird die Bundesrepublik diese sieben Jahre wohl voll ausschöpfen. Zumal im innenpolitischen Diskurs
regelmäßig angeführt wird, dass ohne Beschränkungen unkontrollierte Wellen von Arbeitsimmigranten den deutschen Arbeitsmarkt überfluten und
dadurch die Sozialsysteme sprengen würden. ,,Yet all the data suggest that migration flows from Central and Eastern Europe candidate countries to
the west are not huge. They will probably remain stable at their present levels, and in some respects may decline (following the pattern of previous
EU enlargements to the poorer countries of southern Europe)" (Amato/Batt 1999: 48f). Nach Zielonka (2001: 520) halten sich ca. 850.000 Personen
aus den MOEL in der EU-15 auf. Davon sind nur 300.000 in festen Arbeitsverhältnissen beschäftigt, was 0.2% aller Arbeitnehmer in der EU ent-
spricht und nur 6% der Arbeitnehmer aus Drittstaaten ausmacht.
6
Für eine ausführliche Rezension der drei letztgenannten Monographien vgl. Wagner 2003.
5
diskutieren. Hier besteht innerhalb der Forschung durchaus eine Lücke. Ziel dieser Arbeit wird da-
her auch sein, durch eine hinreichende Erörterung der rechtlichen Rahmenbedingungen diese For-
schungslücke zu schließen. Einige der hier aufgeführten Studien berücksichtigen in ausreichendem
Maße die soziale, ökonomische und ethnische Situation in den Grenzregionen Mittel- und Osteuro-
pas. Weitere wertvolle Analysen hierzu stammen von Anderson (1996), Bort (1999), Dietrich
(2002), Grajewski (1999) und Kempe et al. (1999).
Zur Situation der KO in einer erweiterten EU gibt es eine Reihe von Studien aus der Poli-
tikwissenschaft. Wertvolle Ansätze stammen hierbei von Birckenbach/Wellmann (2001; 2003a;
2003b) bzw. Wellmann (2000). Wichtige Erkenntnisse liefern daneben die Studien von Cichocki et
al. (2001), Fairlie/Sergounin (2001), Huisman (2002), Joenniemi et al. (2000a; 2000b), Timmer-
mann (2001) und Vetter (2000). Zu nennen ist an dieser Stelle auch der Sammelband von Baxenda-
le (2001). Der wohl aktuellste Beitrag stammt von Müntel (2003), der sich auf die Visum- und
Transitproblematik konzentriert und den zwischen der EU und Russland in dieser Frage gefundenen
Kompromiss einer Bewertung unterzieht. Die meisten der angeführten Studien untersuchen die Si-
tuation der russischen Exklave innerhalb einer erweiterten EU unter den verschiedensten Gesichts-
punkten. Einbezogen werden oftmals sicherheits- und außenpolitische, soziale und ökonomische
Gesichtspunkte. Den problematischen Folgen einer Implementierung des Schengen-acquis in den
Nachbarstaaten der KO kommt dabei nur selten eine herausragende Bedeutung zu. Oftmals ist dies
nur ein Aspekt unter vielen. Zudem wird in den meisten der genannten Studien nicht ausreichend
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Anders ist nicht zu erklären, weshalb oftmals
Lösungen bezüglich des Status der KO in einem erweiterten Schengen-Raum angeboten werden,
obwohl das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) und die EU-Visumpolitik diese rein
rechtlich gar nicht erlauben. So bietet beispielsweise die ausführliche Studie von Fairlie/Sergounin
(2001) zwar einen sehr guten politikwissenschaftlichen Ansatz. Sie zeugt aber von weitgehender
Unkenntnis der rechtlichen Aspekte. Eine Untersuchung des Prozesses der Ausdehnung des Schen-
gen-Raums im Rahmen der EU-Osterweiterung, die hinreichend die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen einbezieht, hat innerhalb der politikwissenschaftlichen Forschung bisher nicht in zufriedenstel-
lendem Maße stattgefunden. In der Fallstudie zu Kaliningrad soll dieser Prozess und dessen Aus-
wirkungen auf die KO schwerpunktmäßig aus justiz- und innenpolitischer Perspektive untersucht
werden. Dabei soll den rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend Rechnung getragen werden.
III. Herangehensweise und Gliederung der Arbeit
Der Prozess der Ausdehnung des Schengen-Raumes im Rahmen der EU-Osterweiterung
soll auf der Basis von Primär- und Sekundärquellen untersucht und bewertet werden. Eigene empi-
6
rische Forschungen in Form von Interviews oder Befragungen werden nicht Bestandteil dieser Ar-
beit sein. Sie ist dementsprechend als eine Primär- und Sekundäranalyse zu verstehen. Die Grund-
lage hierfür bilden offizielle Dokumente der EU-Institutionen, Rechtsquellen wie das SDÜ oder die
europäischen Verträge. Hinzukommen die Ergebnisse der verschiedensten politikwissenschaftlichen
Arbeiten und Studien zu diesem Thema. Aufgrund der Aktualität des Untersuchungsgegenstandes
wird es notwendig sein, auf Beiträge und Meldungen aus der Tagespresse zurückzugreifen. Viele
der hier verwendeten Sekundärquellen legen ihren Schwerpunkt nicht ausdrücklich auf die Untersu-
chung der Ausdehnung des Schengen-Raumes im Zuge der EU-Osterweiterung. Ihre Ansätze zu
diesem Thema sind daher oftmals unpräzise und oberflächlich. Eine eingehende Auseinanderset-
zung mit dem Untersuchungsgegenstand unter ausreichender Berücksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen findet selten bis gar nicht statt. Eine Aufgabe dieser Arbeit wird deshalb darin
bestehen, die bestehenden Ansätze und Ergebnisse der politikwissenschaftlichen Arbeiten und Stu-
dien zusammenzuführen, aufzuarbeiten und anhand des rechtlichen Rahmens zu bewerten. Die
Komplexität gerade dieser rechtlichen Aspekte des Untersuchungsgegenstandes wird teilweise er-
läuternde Wiederholungen erforderlich machen.
Selbstverständlich soll eine theoretische Einordnung des Untersuchungsgegenstandes ver-
sucht werden. Gilt es doch, die Dynamisierung des Politikfeldes innere Sicherheit im europäischen
Integrationsprozess und die daraus resultierende Prominenz des Politikfeldes im aktuellen Erweite-
rungsprozess auch theoretisch herzuleiten. Dies ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, denn viele
der bekannten Arbeiten wagen eine solche theoretische Einordnung nicht. Sie fallen eher in den
Bereich der angewandten Politikwissenschaft und sind meistens empirisch-deskriptiv angelegt. Er-
schwerend kommt hinzu, dass sich keine der großen Integrationstheorien für eine theoretische Her-
leitung des Untersuchungsgegenstandes anbietet. Dennoch gibt es in der Literatur verschiedene An-
sätze, deren Transfer auf den Untersuchungsgegenstand gewinnbringend ist, will man die Ausdeh-
nung des Schengen-Raumes und die hierbei dominanten Akteursinteressen theoretisch ergründen.
Die Beschränkung auf ein einziges theoretisches Modell zur Erklärung der Politik der inneren Si-
cherheit der EU im Rahmen der EU-Osterweiterung ist jedoch nur schwer möglich und erscheint
auch nicht sinnvoll. Die in dieser Arbeit ausgewählten theoretischen Modelle verhalten sich eher
komplementär als exklusiv zueinander.
Die Arbeit wird folgendermaßen aufgebaut sein. Im ersten Teil soll der beschriebene Ver-
such einer theoretischen Herleitung der Politik der inneren Sicherheit der EU im Erweiterungspro-
zess vorgenommen werden. Begonnen wird mit einer einleitenden Erläuterung der Herangehens-
weise der EU bei der Ausdehnung des Schengen-Raumes (Zwei-Stufen Strategie). Hierauf folgt
eine Erörterung einzelner staatstheoretischer, konstruktivistischer, regimetheoretischer und sicher-
heitspolitischer Ansätze. Die Politik der inneren Sicherheit der EU im Zuge der Ausdehnung des
7
Schengen-Raumes soll dabei unter die jeweiligen Ansätze subsumiert werden. Der zweite Teil der
Arbeit ist dem Schengen-acquis im Erweiterungsprozess gewidmet. Einführend soll hier die histori-
sche Entwicklung Schengens bis zu dessen Eingliederung in den acquis communautaire im Zuge
der Vertragsreform von Amsterdam nachgezeichnet werden. Hierauf folgt eine Erläuterung der
zentralen Bestimmungen des SDÜ sowie der Grundsätze der EU-Visumpolitik. Wie bereits betont
worden ist, erscheint eine solche Auseinandersetzung mit den rechtlichen Aspekten Schengens not-
wendig. Hiernach wird kurz auf den Erweiterungsprozess der EU im allgemeinen eingegangen.
Dies ist notwendig, weil sich aus der allgemeinen Erweiterungsstrategie der EU (Stabilitätsexport)
die politischen Rahmenbedingungen ergeben, auf deren Grundlage die Ausdehnung des Schengen-
Raumes vollzogen wird. Schließlich wird ausführlich auf den Schengen-acquis im Erweiterungs-
prozess eingegangen. Neben den politischen und praktischen Herausforderungen, welche sich der
EU und den MOEL im Zuge der Expansion Schengens stellen, soll hier auch auf die Komplexität
der ethnischen und ökonomischen Verhältnisse entlang der zukünftigen EU-Ostgrenze eingegangen
werden. Dieser Abschnitt untersucht primär die Auswirkungen der Implementierung des Schengen-
acquis innerhalb der MOEL. Der Hauptteil der Arbeit schließt mit einer ausführlichen Fallstudie zur
russischen Exklave Kaliningrad innerhalb des erweiterten Schengen-Raumes. Aufbauend auf den
bisherigen Ergebnissen der Arbeit sollen hier die sich abzeichnenden negativen externen Auswir-
kungen Schengens anhand der KO erörtert werden. Die Fallstudie beginnt mit einem kurzen histori-
schen Abriss sowie einer Erörterung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse in Kaliningrad.
Betont werden soll hier der periphere Status der Region. Hierauf folgt eine Analyse der Auswirkun-
gen des Schengen-acquis und der EU-Visumpolitik auf die KO. Dabei wird auch auf die Positionen
Litauens und Polens zur Kaliningrad-Problematik eingegangen. Danach folgt eine Diskussion der
praktischen und theoretischen Optionen für die KO innerhalb eines erweiterten Schengen-Raums.
Hieran schließt sich eine Analyse der Kaliningrad-Politik der EU und des Verhältnisses Russlands
zu seiner westlichsten Region an. Die Fallstudie schließt mit einer Bewertung und Kritik der im
November 2002 zwischen der EU und Russland ausgehandelten Visum- und Transitregelung. Im
Schlussteil der Arbeit soll vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse die Frage diskutiert
werden, ob nicht Modelle flexibler Integration angebrachter wären, angesichts der sich bei der Aus-
dehnung des Schengen-Raumes abzeichnenden negativen Auswirkungen in der Region Mittel- und
Osteuropa.
Die Analyseebene dieser Arbeit wird weitgehend die systemische, d.h., die internationale
Ebene sein.
7
Im Gegensatz zu theoretischen Ansätzen in den internationalen Beziehungen (Mor-
genthau 1963; Waltz 1979), nach denen nationale Politik aus den Zwängen des internationalen Sys-
7
Nach dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Verständnis muss zwischen drei Ebenen unterschieden werden: der nationalen, der europäischen und
der internationalen Ebene. Europäische Ebene meint die EU-Ebene und darf aufgrund des hohen Maßes an Integration nicht mit der internationalen
Ebene gleichgesetzt werden - daher in der politischen Praxis auch die Unterscheidung zwischen Außen- und Europapolitik. Systemisch bedeutet
diesem Verständnis zufolge, die Ebene auf der die EU mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen interagiert.
8
tems (Krell 2003: 159) resultiert,
8
soll hier die innerstaatliche bzw. EU-Ebene nicht vollkommen
ausgeblendet werden. Die EU und die Nationalstaaten werden nicht als ,,Black Boxes" begriffen,
deren innere Präferenzbildungsprozesse völlig zu vernachlässigen sind. Gerade der noch zu be-
schreibende Prozess der ,,Securitiziation" (Buzan et al. 1998) im Politikfeld innere Sicherheit auf
nationaler und europäischer Ebene verdeutlicht, dass für die Herangehensweise der EU bei der
Ausdehnung Schengens nicht ausschließlich systemische Zwänge ausschlaggebend sind. Vielmehr
ist die Politik der EU in dieser Frage Resultat von Präferenzbildungsprozessen und der Durchset-
zung von Partikularinteressen innerhalb der Mitgliedsstaaten und auf europäischer Ebene. Gleich-
wohl soll der Schwerpunkt der Arbeit nicht auf der Untersuchung dieser auf der mitgliedsstaatli-
chen und auf europäischen Ebene stattfindenden Prozesse liegen.
9
Die Untersuchung wird sich des-
halb weitgehend auf folgende Akteure beschränken: die EU, die MOEL, Russland und einige ex-
emplarisch ausgewählte Nationalstaaten. Dies gilt umso mehr für die Fallstudie zu Kaliningrad.
Zwar können hier neben der EU und Russland noch Litauen, Polen und Kaliningrad als Akteure
identifiziert werden. Entscheidend für das Zustandekommen der Visum- und Transitregelung waren
jedoch nur die EU vertreten durch die jeweilige Präsidentschaft und die Kommission und dip-
lomatische Vertreter Russlands. Auch wenn andere Akteure aus der Region versuchten, sich in den
Verhandlungsprozess einzuschalten, so konnten sie den Verlauf der Verhandlungen nicht zu ihren
Gunsten beeinflussen. Dies wird auch am Ergebnis der bilateralen Verhandlungen deutlich.
B. Hauptteil
I. Die Politik der inneren Sicherheit der EU im Erweiterungsprozess - Erklärungsmodelle
1. Die Zwei-Stufen Strategie der Europäischen Union
Die Mittel- und Osteuropäischen Staaten (MOEL) haben sich in den Beitrittsverhandlungen
verpflichtet, die Kopenhagener Kriterien zu erfüllen. Dazu zählt die vollständige Übernahme des
sogenannten acquis communautaire, d.h., der gesamten primärrechtlichen und sekundärrechtlichen
Regelungen des Europäischen Rechts (Knelangen 2002). Seit der Inkorporierung in den Amsterda-
mer Vertrag 1999 ist auch das vormals außerhalb des institutionellen Rahmens der EU angesiedelte
Schengen-Regime Teil des acquis communautaire und muss daher von allen Beitrittskandidaten mit
dem Tag des Beitritts in nationales Recht übernommen werden. So heißt es in Art. 8 des Schengen
8
Hier muss jedoch einschränkend angemerkt werden, dass Morgenthau als Vertreter des klassischen Realismus neben der systemischen auch die
anthropologische Ebene berücksichtigte (Vgl. Morgenthau 1963: 76).
9
Eine integrationstheoretische Einordnung des Politikfelds innere Sicherheit und der hier stattfindenden Präferenzbildungsprozesse wurde im Rah-
men einer Empirie-Arbeit, die 2002 am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der J.W.G-Universität Frankfurt am Main eingereicht wurde, an-
hand der Theorie des liberalen Intergouvernementalismus versucht (Vgl. Moravcsik 1993).
9
Protokolls, welches dem Amsterdamer Vertrag angefügt ist:
,,For the purposes of the negotiations for the admission of new Member States into the European Union, the
Schengen acquis and further measures taken by the institutions within its scope shall be regarded as an acquis
which must be accepted in full by all States candidates for admission."
Was hierbei von den Beitrittskandidaten verlangt wird, bleibt auch in der Literatur unge-
klärt. Wie Boer/Kerchove (2001: 317) bemerken, kann darunter verstanden werden, dass die voll-
ständige Übernahme des Schengen-acquis nicht nur Voraussetzung für die Abschaffung der Bin-
nengrenzkontrollen, sondern generelle Voraussetzung für den Beitritt zur EU. Nach Borissova
(2003: 111) schreibe Art. 8 des Schengen Protokolls einerseits die komplette Implementierung des
Schengen-acquis zum Beitrittsdatum vor. Andererseits impliziere diese Formulierung, dass den
MOEL keine Übergangsfristen eingeräumt werden. Folgt man dieser Interpretation, dann kann auch
davon ausgegangen werden, dass den Beitrittskandidaten keine Ausnahmen - sogenannte Opt-outs -
zugestanden werden. Obwohl sich die MOEL in der Vergangenheit um die Einräumung von Über-
gangsfristen bei der Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik und der Verschärfung der Außen-
grenzkontrollen bemüht haben, hat dies im Ministerrat und der Kommission keinen Zuspruch ge-
funden (Borissova 2003: 111). Diese harte Haltung erscheint verwunderlich, denn zum einen wur-
den Großbritannien und Irland großzügige Opt-Outs im Rahmen von Schengen gewährt. Zum ande-
ren waren alle bisherigen Beitrittsländer nicht dazu verpflichtet, den kompletten Schengen-acquis
mit dem Beitrittsdatum zu übernehmen. Darüber hinaus nehmen mit Norwegen und Island zwei
Nicht-EU-Mitgliedern am Schengen-Regime teil. Seit geraumer Zeit wird auch mit der Schweiz
über einen Schengen-Beitritt des Landes verhandelt (Holenstein 2004).
10
Dieses hohe Maß an Fle-
xibilisierung und Differenzierung lässt die EU im aktuellen Erweiterungsprozess vermissen. Ihre
Haltung bezüglich der Übernahme des Schengen-acquis durch die MOEL ist äußerst unflexibel und
rigide. Übergangsfristen hat sie nur sich selbst eingeräumt, nicht jedoch den Beitrittskandidaten. So
heißt es im Erweiterungsbericht der EU-Kommission (European Commission 2003b: 71) im Kapitel
24 (Justiz und Inneres):
,,However, accession to the EU will not immediately lead to the lifting of border controls between old and new
member states; as with previous enlargements, this will be the subject of a separate Council unanimous deci-
sion, some time after accession, and after a careful examination of the legal and practical readiness of the new
members. [...] Negotiations on the Justice and Home Affairs acquis are not about transition periods"
10
Die Schweiz wäre bei einem Schengen-Beitritt bereits das dritte Land außerhalb der EU, das den Schengen-acquis anwenden würde. In bilateralen
Gesprächen verhandeln die Schweiz und die EU seit längerer Zeit über eine Schengen-Teilnahme des Landes. Die Schweiz zeigte bisher ein großes
Interesse an einer Schengen-Mitgliedschaft. In letzter Zeit stieß die Idee einer Schweizer Schengen-Mitgliedschaft jedoch zunehmend auf Kritik des
Bundesratsmitglieds und erklärten EU-Gegners Christoph Blocher. In der Praxis werden an der Schweizer Grenze von den rund 700.000 täglichen
Grenzübertritten gerade einmal 2 bis 3 Prozent stichprobenartig kontrolliert. Eine Abschaffung der Grenzkontrollen zur EU würde somit keinen
Sicherheitsverlust mit sich bringen (Vgl. Holenstein 2004).
10
Dies ist die Zwei-Stufen Strategie der EU. In einer ersten Stufe müssen die Beitrittsländer
den Schengen-acquis voll übernommen und effektiv an ihrem jeweiligen Abschnitt der zukünftigen
EU-Ostgrenze implementiert haben. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, wird die zweite Stufe
dieses Schengener Inkraftsetzungsprozesses greifen und die Binnengrenzkontrollen zwischen alten
und neuen Mitgliedstaaten nach einem Beschluss des Ministerrates aufgehoben (Borissova 2003:
111).
11
Damit steht die endgültige Teilnahme am integrierten Reiseraum des Schengen-Regimes
unter einem Ratsvorbehalt. Denn der Ministerrat wird erst dann positiv über eine Aufhebung der
Binnengrenzkontrollen entscheiden, wenn ,,the Council is satisfied that the new Member State is
able to fulfill all the requirements in the Schengen acquis". Die neuen Mitgliedstaaten müssen vor-
her unter Beweis stellen, dass sie den Schengen-acquis in ,,a uniform, correct, consistent and effi-
cient manner" anwenden (Spiteri 2002a; 2002c). Die Frage, ob ein Neumitglied den Schengen-
acquis ausreichend und effizient anwendet, ist jedoch weitgehend eine Frage des Vertrauens. Ein-
deutige Indikatoren, wann eine Grenze ausreichend gesichert ist, existieren nicht. Ob ein Neumit-
glied eine ausreichende Schengen-Reife erlangt hat, bleibt daher eine größtenteils politische Ent-
scheidung, welche ausschließlich die derzeitigen Schengen-Teilnehmer treffen werden (Krenz-
ler/Wolczuk 2001: 12). Die Neumitglieder werden hierauf nur geringen Einfluss haben, da sie so
lange nicht über ein Stimmrecht im Ministerrat verfügen, wie sie nicht am operativen Teil des
Schengen-Regimes teilnehmen. Da die Ratsentscheidung über eine vollständige Teilnahme am
Schengen-Verbund darüber hinaus einstimmig getroffen werden muss, können die vorgesehenen
Übergangsfristen und Evaluierungsphasen relativ lange ausfallen. Einen politischen Konsens zu
dieser Frage herzustellen, wird aufgrund der Sicherheitsinteressen der derzeitigen EU-
Mitgliedstaaten schwierig werden.
Die EU ist somit sehr rigide, was die Öffnung der Binnengrenzen zwischen den alten und
neuen Mitgliedern nach Aufnahme der MOEL anbelangt. Wie lässt sich diese Rigidität erklären?
Wie begründet sich das Misstrauen, welches die EU gegenüber der Implementierungswilligkeit und
-fähigkeit der Beitrittskandidaten hegt? Warum spielen Fragen der inneren Sicherheit und des Au-
ßengrenzschutzes im Rahmen der EU-Osterweiterung eine zentralere und prominentere Rolle als in
allen bisherigen Erweiterungsrunden? Wie lässt sich die Zwei-Stufen-Strategie der Europäischen
Union theoretisch einordnen? Hierfür sollen im folgenden theoretische Erklärungsmodelle angebo-
ten werden, die sich weniger exklusiv als vielmehr komplementär zueinander verhalten.
11
Vgl. auch BMI (1998: 17), wo es unter dem Titel ,,Beibehaltung des Schengener Inkraftsetzungsmechanismus" heißt: ,,Der Wegfall der Grenzkon-
trollen an den Binnengrenzen [...] gegenüber neuen Mitgliedern der Europäischen Union ist nur möglich, wenn und soweit diese Staaten ihren Ver-
pflichtungen bei der Kontrolle und Sicherung der Außengrenzen verantwortlich auch für die übrigen Teilnehmerstaaten des Schengener Verbundes
nachkommen. Die Fähigkeit zur Teilnahme am Schengener Informationssystem (SIS) als einer der wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen für den
Abbau der Binnengrenzen sowie weitere Voraussetzungen treten hinzu. Erst wenn ein Beitrittskandidat nachgewiesen hat, dass er diese Vorausset-
zungen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich erfüllt, kommt eine praktische Teilnahme am europäischen Freizügigkeits- und Sicherheitsver-
bund in Betracht. In Fragen der inneren Sicherheit kann es im Interesse der weiteren Festigung der europäischen Einheit keinen diplomatischen Rabatt
geben."
11
2. Die Gewährleistung von Sicherheit als zentrales Staatsziel - Konsequenzen für
die europäische Integration
Die Bereitstellung von Sicherheit war von je her konstitutiv für das moderne Staatsverständ-
nis. Erst durch die Bereitstellung innerer Sicherheit und die Abwehr äußerer Bedrohungen begrün-
dete der moderne Staat seine Notwendigkeit und erlangte damit ein hohes Maß an Legitimität in-
nerhalb der seinem Gewaltmonopol unterworfenen Bevölkerung (Knelangen 2001: 36). Thomas
Hobbes begründete im Leviathan erstmals in der modernen Staatsphilosophie die Zentralität des
Sicherheitsbegriffs für die Legitimität des Staates. ,,Die Verpflichtung der Untertanen gegen den
Souverän dauert nur so lange, wie er sie auf Grund seiner Macht schützen kann, und nicht länger
[...] Der Zweck des Gehorsams ist Schutz" (Hobbes 1998: 171). Nach Hobbes unterwerfen sich die
Menschen dem Gewaltmonopol des Staates, weil dieser ihre physische Unversehrtheit garantiert.
Die Legitimität und Notwendigkeit staatlicher Herrschaft schwindet jedoch, wenn der Staat innere
Sicherheit nicht mehr in ausreichendem Maße bereitstellen kann. Der Begriff der Sicherheit ist zent-
ral für die meisten der moderneren Staatstheorien:
,,Similar arguments can be found in John Locke's Second Treatise of Government, which places greater em-
phasis on the rule of law ensuring the individual's security, and in Jean-Jacques Rousseau's Du contrat social,
which identifies the defence and protection of the person and the property of each citizen as the central rational
of the `Social Contract'" (Mitsilegas et al. 2003: 8).
Die Bedeutung des Gewaltmonopols für den Staat und dessen politische Legitimität hat auch
Max Weber (1984: 91) mit seiner bekannten Aussage herausgestellt, dass die erfolgreiche Inan-
spruchnahme des ,,Monopol[s] legitimen physischen Zwanges" das zentrale Merkmal des Staates
ist. Weber hat damit nicht nur das Gewaltmonopol als das Spezifische der modernen Staatlichkeit
hervorgehoben, sondern auch die Zentralität des Gewaltmonopols für staatliche Herrschaft und
staatliches Handeln überhaupt aufgezeigt (Knelangen 2001: 36). Kritisiert werden diese staatstheo-
retischen Annahmen von Bigo (1998: 149). Hobbes' Sicherheitspakt, Lockes Gesellschaftsvertrag
und die Legitimität des Gewaltmonopols als Kennzeichen des modernen Staates bei Weber sind
nach Bigo fern jeder Realität. Sie seien vielmehr als Gründungsmythen zu verstehen, welche nur
dazu dienten die Autorität und den Herrschaftsanspruch des Staates gegenüber seinen Bürgern zu
rechtfertigen. Teil dieses Herrschaftsanspruchs sei auch die Kontrolle von Menschen an den Gren-
zen des Staates. Wie Zürn (1998: 95) jedoch entgegnet, erkennen selbst Vertreter radikal staatskriti-
scher Positionen wie Nozick (1974) Sicherheit als Ziel staatlichen Regierens an. Sicherheit ist damit
der einzige Bereich in dem selbst die ultra-liberale Staatstheorie Eingriffe akzeptiert. Unterschieden
werden muss jedoch zwischen der ,,Verteidigungsaufgabe" und der ,,Schutzaufgabe" des Staates
12
(Zürn 1998: 111). Erstere meint die Abwehr äußerer und von Staaten ausgehenden militärischen
Bedrohungen. Schutzaufgabe meint dagegen, die Bereitstellung von innerer Sicherheit und soll hier
von primärem Interesse sein. Festhalten lässt sich aber, dass das vorherrschende Staatsverständnis
eng mit dem Begriff des Gewaltmonopols und der Bereitstellung von Sicherheit verknüpft ist. Auch
ein Staatenverbund wie die EU erlangt umso mehr Legitimität in den Augen der EU-Bürger, je
mehr er eine Schutzaufgabe wahrnimmt und innere Sicherheit gewährleistet.
Innere Sicherheit meint die Abwehr von Tendenzen und Erscheinungen, die als Bedrohung
des staatlichen und gesellschaftlichen Gefüges betrachtet werden und von Individuen oder Gruppen
von Individuen ausgehen können. Innere Sicherheit steht vor allem für ,,Prozesse, Institutionen und
Maßnahmen in der Innenpolitik" [...] die dem Anspruch und/oder der Funktion nach hauptsächlich
darauf gerichtet sind, Schutz, Gefahrlosigkeit, Verlässlichkeit und Abwehr von Gefahren für Indivi-
duen, auch für politische, soziale und wirtschaftliche Ordnungen sicherzustellen" (Schmidt 1998:
285). Gestärkt werden soll das subjektive Sicherheitsgefühl des Einzelnen. Objektive und absolute
Sicherheit ist vor allem in liberalen Gesellschaften nicht herstellbar, wo die Gewährleistung innerer
Sicherheit und die Wahrung bürgerlicher Freiheiten in einem permanenten Spannungsverhältnis
stehen. Es kann daher allenfalls der Eindruck von Kontrolle und objektiver Sicherheit erzeugt wer-
den (Anderson 1996: 187), was jedoch vollkommen ausreicht, um staatliches Handeln zu legitimie-
ren. Darüber hinaus stellt Blankenburg (1992: 162) fest, dass zwischen einem konservativen und
einem liberalen Verständnis von innerer Sicherheit unterschieden werden müsse. Politik der inneren
Sicherheit bedeute neben Bereithaltung auch Begrenzung und Kontrolle des staatlichen Gewaltmo-
nopols. Denn auch der Staat könne zur Bedrohung der inneren Sicherheit werden und damit die
Freiheit und Sicherheit des Individuums gefährden.
12
Welche Konsequenzen haben diese Überle-
gungen für das Politikfeld innere Sicherheit auf europäischer Ebene? Welches Verständnis von in-
nerer Sicherheit dominiert innerhalb der EU?
Die EU ist zwar kein Staat im konventionellen Verständnis, kann aber dennoch als politi-
sche Entität begriffen werden, die den Handlungsrahmen für eine sich herausbildende europäische
Politik der inneren Sicherheit bildet.
13
Das Politikfeld innere Sicherheit auf europäischer Ebene
kann durchaus als ein ,,souveränitätsgeladener Kooperationsgegenstand" beschrieben werden (Kne-
langen 2001: 32). Dies hat Auswirkungen auf die institutionelle Ausgestaltung dieses Politikfeldes
auf europäischer Ebene und schränkt die Integrations- und Kooperationswilligkeit gegenüber Dritt-
12
Lange (1999: 236) hat diese Gefahr treffend beschrieben und zwischen einem normativ-affirmativen und normativ-kritischen Verständnis von
innerer Sicherheit unterschieden. Das normativ-affirmative Verständnis betrachtet es als notwendige Aufgabe des Staates, den Schutz seiner Bürger
vor Übergriffen zu gewährleisten sowie den innerstaatlichen Frieden generell zu gewährleisten. Das normativ-kritische Verständnis dagegen sieht in
einer Politik der inneren Sicherheit, den zu Übergriffen tendierenden Herrschaftsanspruch des Staates gegenüber seinen Bürgern, welchen es politisch
und bürgerlich abzuwehren gilt.
13
Die Frage, was die Europäische Union ist, soll hier nicht diskutiert werden. Zur Einführung in die Diskussion vgl. Caporaso (1996). Vgl. hierzu
auch Zielonka (2001), der die Frage der Staatlichkeit unter besonderer Berücksichtung des Charakters der zukünftigen EU-Außengrenzen diskutiert.
13
staaten ein.
14
Hilfreich ist hierbei die aus dem intergouvernementalistischen Strang der Integrations-
theorie stammende Unterscheidung zwischen High und Low politics. ,,High politics issues are those
which touch on the fundamental definition, identity and security of the nationstate" (Hix 1999:
322). Zweifellos kann die Justiz- und Innenpolitik neben der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) und der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zum Bereich der High poli-
tics gezählt werden. Den Low politics können dagegen Bereiche der Wirtschaftsintegration wie der
Binnenmarkt oder die Landwirtschaftspolitik zugeordnet werden. Integration im Bereich der High
politics greift in den Kernbereich nationaler Souveränität ein und ruft daher Kooperationswider-
stände hervor. Je mehr die europäische Integration damit von peripheren Bereichen (Low politics)
in die Kernbereiche nationaler Souveränität vordringt (High politics), desto größer werden die nati-
onalen Widerstände von Bürokratien und Regierungen (Scharrer 1981: 123). Dies gilt gleicherma-
ßen für die Integration der etablierten EU-Mitgliedsstaaten im Gemeinschaftsrahmen, als auch für
die Integration der MOEL in den bestehenden Schengen-Raum.
Zum anderen nennen Mitsilegas et al. (2003: 128f) zwei aufschlussreiche Faktoren, die bei
der Einordnung der Politik der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene, aber auch für die Aus-
dehnung des Schengen-Raumes hilfreich sein können. Den ersten Faktor bildet die ,,security ratio-
nale" des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR), welcher gemäß Art. 2 EUV
zu den zentralen Zielen der EU gehört. Sowohl der RFSR als auch das Schengen-Regime basieren
auf einer Konzeption eines sich herausbildenden Raumes der inneren Sicherheit, der sich durch eine
scharfe Trennlinie zwischen einem sicheren Inneren und einem unsicheren Außen auszeichnet. Das
innere Sichere bildet dabei die derzeitige EU; das unsichere Äußere die MOEL. Zwar stehen die
Begriffe Freiheit, Sicherheit und Recht dem Wortlaut zufolge gleichberechtigt in Art. 2 EUV. Doch
die politische Ausgestaltung des RFSR innerhalb der EU und die Politik der Union gegenüber den
MOEL im Beitrittsprozess lässt auf eine Überbetonung von Sicherheit gegenüber Freiheit schließen.
So steht z.B. im Wiener Aktionsplan von 1998, welcher der effektiven Umsetzung des in Art. 2
EUV postulierten RFSR dient, unter dem Leitsatz ,,A wider concept of freedom":
"The Treaty of Amsterdam also opens the way to giving `freedom' a meaning beyond free movement of people
across internal borders. It is also freedom to live in a law-abiding environment in the knowledge that public au-
thorities are using everything in their individual and collective power [nationallly, at the level of the Union and
beyond] to combat and contain those who seek to deny or abuse that freedom" (Council of the European Union
1999a: 3).
14
Die Frage, wie sich das Politikfeld innere Sicherheit aufgrund seiner Souveränitätsgeladenheit und als Bereich der ,,High politics" auf EU-Ebene
institutionell ausgestaltet, soll nicht Gegenstand der Arbeit sein. Vgl. aber Hoffmann (1966), der aus intergouvernementaler Perspektive argumen-
tiert, und Giering (1997: 69ff).
14
Auch an anderer Stelle lassen sich Hinweise für die sicherheitsorientierte Ausgestaltung des
RFSR finden. Beispielsweise heißt es in den Schlussfolgerungen des Rates von Tampere: "The
challenge of the Amsterdam treats is now to ensure that freedom, which includes the right to move
freely throughout the Union, can be enjoyed in conditions of security and justice accessible to all"
(European Council 1999). Und in Art. 29 EUV heißt es, die EU verfolge das Ziel, ,,den Bürgern in
einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten".
Erwähnt werden müssen hier natürlich auch die Ereignisse des 11. September 2001, die der Justiz-
und Innenpolitik auf EU-Ebene einen zusätzlichen repressiven Schub gegeben haben (Wagner
2002: 1). Aus den hier genannten Zielsetzungen und Faktoren lässt sich unschwer ableiten, dass
nicht die Gewährleistung von Personenfreizügigkeit die Dynamik des Politikfeldes innere Sicher-
heit in der EU bestimmt. Im Zentrum dieses Politikfeldes steht vielmehr die Bereitstellung von Si-
cherheit. Sicherheit wird dabei als konstitutiv für Freizügigkeit im RFSR betrachtet. Was hierbei
zur Geltung kommt, ist ein konservatives Verständnis von innerer Sicherheit. Resultat dieses Ver-
ständnisses des RFSR ist eine Politik der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene, die ausgehend
von der Zentralität des Rechts auf Sicherheit, eine repressive und kontrollorientierte Strategie ver-
folgt.
15
Die europäische Politik der inneren Sicherheit hat eine ,,tendency towards restriction and
exclusion" (Monar 2001: 761). Und der Diskurs über die Ausgestaltung dieses Politikfeldes ist
,,heavily securitized" (Wagner 2003: 1037f).
Was bedeutet dies nun für die Integration der Beitrittskandidaten in den RFSR sowie die
Übernahme des Schengen-acquis durch die MOEL? Zum einem greift das Integrationsfeld innere
Sicherheit tief in den Kernbereich nationaler Souveränität der Mitgliedstaaten ein. Gestaltet sich
Kooperation in diesem Politikfeld aufgrund dessen Souveränitätsgeladenheit schon innerhalb der
EU-15 schwierig, so externalisieren sich die bestehenden Kooperationsvorbehalte auch gegenüber
den MOEL. Resultat ist, dass in diesem Integrationsbereich hohe rechtliche und politische Hürden
für die MOEL errichtet werden. Denn seitens der EU besteht großes Misstrauen gegenüber den Fä-
higkeiten der MOEL, die derzeit hohen Standards an innerer Sicherheit innerhalb einer erweiterten
EU aufrechtzuerhalten. Den derzeitigen und zukünftigen Außengrenzen der EU fällt hierbei eine
zentrale Rolle zu. Für die MOEL bedeutet das, dass die EU einen hohen Maßstab bei der Übernah-
me und Implementierung des Schengen-acquis anlegt. Die derzeitigen Schengen-Grenzen bilden die
scharfen Kanten eines ,,safe inside" gegenüber einem ,,unsafe outside" (Mitsilegas et al. 2003: 128).
Die EU wird dieses ,,safe inside" nicht vorschnell aufweichen. Das erlauben die Präferenzen der
Protagonisten des Politikfeldes innere Sicherheit innerhalb der EU nicht.
15
Zur Konstruktion eines ,,Grundrechts auf Sicherheit" in der Bundesrepublik vgl. Bendrath (1997).
15
3. Securitization im Politikfeld innere Sicherheit
Wie konnten justiz- und innenpolitische Fragen sowie damit verknüpfte Themen wie illegale
Immigration, organisierte Kriminalität und die Gewährleistung des Außengrenzschutzes so hoch in
der EU-Agenda aufsteigen? Denn die Annahme und effektive Implementierung des Schengen-
acquis ist de facto zu einer conditio sine qua non des EU-Beitritts der MOEL geworden. Dies ist
durchaus bemerkenswert, wenn man die Opt-outs berücksichtigt, welche Großbritannien, Irland und
Dänemark bei der Überführung des Schengen-acquis in den gemeinschaftlichen Besitzstand ausge-
handelt haben (Knelangen 2001: 292). Wie lässt sich diese hohe Priorität justiz- und innenpoliti-
scher Fragen im Erweiterungsprozess theoretisch einordnen? Ein hilfreiches theoretisches Erklä-
rungsmodell für die Prominenz des Politikfeldes innere Sicherheit im Rahmen der EU-
Osterweiterung kommt aus der konstruktivistischen Schule der internationalen Beziehungen. Zent-
ral für diesen Ansatz ist der sogenannte Prozess der Securitization. Buzan et al. (1998) beschreiben
Securitization folgendermaßen:
,,'Security' is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either
as a special kind of politics or above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of
politization. In theory any public issue can be located on the spectrum ranging from nonpoliticized (meaning
the state does not deal with it and it is not in any other way made an issue of public debate and decision)
through politicized (meaning the issue is part of public policy, requiring government decision and resource al-
locations [...] to securitizied (meaning the issue is presented as an existential threat, requiring emergency
measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure)" (Buzan et al. 1998: 23f).
Nach diesem Ansatz wird ein bestimmtes Thema zuerst politisiert, d.h., in den politischen
Raum eingeführt, um in einem weiteren Schritt securitisiert zu werden, d.h., den normalen politi-
schen Prozessen und Debatten wieder entzogen zu werden. Dahinter steht die Motivation, dass au-
ßergewöhnliche Problemlagen nur durch außergewöhnliche Maßnahmen abzuwehren sind, deren
Ergreifung im normalen politischen Prozess nicht möglich ist. Securitization ist darüber hinaus ein
selbst-referenzieller Prozess. Der securitisierende Akteur konstruiert einen Sachverhalt erst im Pro-
zess der Securitization als eine außergewöhnliche Bedrohung. Das Vorliegen einer objektiven Be-
drohung ist hierbei nicht von Bedeutung. Entscheidend ist, dass ein Sachverhalt als bedrohlich kon-
struiert und von der Öffentlichkeit dementsprechend wahrgenommen wird (Buzan et al. 1998: 24).
Durch Securitization suggeriert ein bestimmter Akteur in einem intersubjektiven Prozess anderen
Akteuren das Vorhandensein einer außergewöhnlichen Bedrohung, welche Sachzwänge erzeugt, die
dem üblichen politischen Prozess entzogen werden müssen (Buzan et al. 1998: 30).
16
In Anlehnung an Buzan et al. haben Huysmans (2000) und Mitsilegas et al. (2003) diese
theoretischen Überlegungen auf das Politikfeld innere Sicherheit im europäischen Integrationspro-
zess übertragen. Der konstruktivistische Ansatz ist durchaus hilfreich bei der Beantwortung der
Frage, wie bestimmte innen- und justizpolitische Akteure Fragen des Binnen- und Außengrenz-
schutzes mit Themen wie organisierter Kriminalität und illegaler Immigration verknüpfen konnten.
Huysmans (2000: 752f) identifiziert im ,,technocratic and politically manufactured spillover of the
economic project of the internal market into a internal security project" das Schlüsselereignis für die
Entstehung des Politikfeldes innere Sicherheit auf europäischer Ebene. Durch einen Prozess der
Securitization wurde ein rein ökonomisches Integrationsprojekt wie der Binnenmarkt als Sicher-
heitsrisiko präsentiert. Dies wiederum ermöglichte im Zuge des Maastrichter Vertrages die Schaf-
fung eines demokratisch schwach legitimierten und kontrollierten institutionellen Gefüges auf euro-
päischer Ebene, welches weitgehend den nationalen politischen Prozessen entzogen wurde.
16
Bei-
spielhaft hierfür waren der anfänglich nicht vorhandene Datenschutz und die mangelnde richterliche
Kontrolle (Wagner 2003: 1037). Zentraler Bestandteil dieses Prozesses der Securitization auf euro-
päischer Ebene war die Annahme, dass der freie Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und
Personen (vier Freiheiten) im Rahmen des Binnenmarktes eine Bedrohung für die Sicherheit und
öffentliche Ordnung der EU-Mitgliedstaaten darstellten (Huysmans 2000: 758). Daher bedürfe es
Ausgleichsmaßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene. Hinter dieser
Securitization verbergen sich zwei Logiken. Eine dieser Logiken besagt, dass mit der Herausbil-
dung eines gemeinsamem Marktes auch ein einheitlicher Aktionsraum für organisierte Kriminalität
und illegale Immigration herausbildet. Ergo bedarf es zur Bekämpfung dieser Bedrohungen auch
einer europäischen Politik der inneren Sicherheit.
17
Die andere Logik verhält sich hierzu komple-
mentär und besagt: ,,if we diminish internal border controls then we must harmonize and strengthen
the control at the external borders [...] to guarantee a sufficient level of control of who and what
can legitimately enter the space of free movement" (Huysmans 2000: 759). Beide Logiken gelten
gleichermaßen für das Projekt des Binnenmarktes als auch für das damals noch außerhalb der Ge-
meinschaft angesiedelte Schengen-Regime. Beide sind konstitutiv für die Herausbildung einer Poli-
tik der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene. Sie werden auch gegenüber den Beitrittskandida-
ten aus Mittel- und Osteuropa kommuniziert. Zumal die MOEL im öffentlichen Diskurs häufig mit
illegaler Immigration und organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden (Bort 1999:
82). Vielfach wird dabei ein Sicherheitskontinuum konstruiert. Auf diesem Kontinuum werden
dann Begriffe wie Grenzkontrollen, Terrorismus, organisiertes Verbrechen, illegale Migration, Mit-
16
Fragen der demokratischen Legitimation und Kontrolle der im 3. Pfeiler (PJZS) der EU getroffenen Entscheidungen werden in dieser Arbeit nicht
diskutiert. Andere Autoren haben sich aber dieser Frage angenommen (Vgl. Maurer/Monar 1999; Monar 2001; Boer/Wallace 2000). Zur aktuellen
Diskussion nach dem 11. September 2001 und im Rahmen des EU-Verfassungskonvents vgl. Wagner (2002).
17
Erstaunlich und signifikant ist dabei vor allem das zeitliche Zusammenfallen von Binnenmarkt (1993) und Maastricht-Vertrag (1992), welcher im
Rahmen des Drei-Säulen-Modells der EU auch das Politikfeld innere Sicherheit innerhalb der dritten Säule wenn auch schwach institutionalisier-
te.
17
tel- und Osteuropa sowie die Osterweiterung aneinander gereiht, beliebig variiert und kombiniert.
Die den Prozess der Securitization vorantreibenden Akteure agieren primär auf nationaler
Ebene. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Parteipolitiker, Ministerialbeamte sowie Akteure
aus dem Polizei- und Sicherheitsbereich. Ihre Einschätzungen bezüglich der Bedrohungen und Si-
cherheitslage sind meistens kongruent. Sie alle stellen ein Kontinuum zwischen organisierter Kri-
minalität, illegaler Immigration und Abbau der Grenzkontrollen her und forderten schon im Rah-
men des Binnenmarktprojektes und Schengens eine stärkere Integration im Politikfeld innere Si-
cherheit (Schäuble 1990; Seiters 1992; Krüger 1994; BMI 1998). Diese Akteure bringen Informati-
onen und Meinungen in den nationalen Diskurs ein. Aufgrund ihrer Autorität können sie die öffent-
liche Meinung und den politischen Willensbildungsprozess maßgeblich beeinflussen (Mitsilegas et
al. 2003: 50). Die räumliche und institutionelle Nähe zur Exekutive erleichtert eine solche Einfluss-
nahme (Lange 1999). Aufgrund des weitestgehend intergouvernementalen Kooperationsrahmens
auf europäischer Ebene dominieren wiederum nationale Akteure die Agenda im Politikfeld innere
Sicherheit.
Hinzukommt ein institutionelles Eigeninteresse der Akteure und Vertreter aus dem Polizei-
und Sicherheitsbereich. ,,Whereas politicians seek reelection, bureaucrats seek more influence over
policy outcomes through higher budgets [...] or through greater freedom to `shape' their own or-
ganizational structures and policy choices" (Hix 1999: 325). Schengen, das Binnenmarktprojekt und
die mittelfristige Aufhebung der Binnengrenzkontrollen im Zuge der Osterweiterung der EU impli-
zierten in der Vergangenheit, dass den Polizei-, Grenzschutz- und Sicherheitsorganen in Zukunft
tendenziell weniger Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Alle drei Projekte waren und sind
Bedrohungen für den Status und die Ressourcen dieser Einrichtungen. Obwohl zum Beispiel eine
objektive Bedrohung der inneren Sicherheit durch das Binnenmarktprojekt und die Schaffung des
Schengen-Regimes weder feststellbar noch messbar war (Mitsilegas et al. 2003: 51; Hix 1999: 325),
politisierten und securitisierten die betreffenden Akteure aus institutionellem Eigeninteresse diese
beiden Integrationsprojekte. Ziel war es, einen Sicherheitsdiskurs zu konstruieren, der ihren institu-
tionellen Eigeninteressen entsprach (Bigo 1998: 155). So lässt sich auch erklären, weshalb das
Schengen-Regime in der Literatur weniger mit Freizügigkeit als mit Kontrolle und Ausgleichsmaß-
nahmen assoziiert wird. Die konstruierte Notwendigkeit von Kontrolle und innerer Sicherheit legi-
timieren die Rolle der Organe des Gewaltmonopols und sichern diesen den Status und die notwen-
digen Ressourcen. Dies gilt auch für die Ausdehnung des Schengen-Raumes im Rahmen der EU-
Osterweiterung. Ein Abbau von Binnengrenzkontrollen zwischen alten und neuen EU-
Mitgliedstaaten würde den Grenzschutz an der derzeitig streng bewachten EU-Ostgrenze offensicht-
lich erst einmal überflüssig machen. So sind am deutschen Abschnitt der derzeitigen EU-Ostgrenze
mehr Grenzschutzbeamte stationiert als an irgendeiner anderen Grenze in Europa. Neben 6.500
18
BGS-Beamten sind hier 1.500 nicht ausgebildete Grenzunterstützungskräfte im Einsatz (Bort 1999:
84). Ob ein zügiger Abbau der Binnengrenzen in einer erweiterten EU dem institutionellen Eigenin-
teresse der deutschen Grenzschutzorgane entspricht, kann durchaus bezweifelt werden.
Die theoretischen Überlegungen der konstruktivistischen Schule und ihre Anwendung auf
das Politikfeld innere Sicherheit auf EU-Ebene können dazu beitragen, die Rigidität der EU bezüg-
lich der Übernahme und Implementierung des Schengen-acquis durch die Beitrittskandidaten aus
Mittel- und Osteuropa zu erklären. Diese sicherheitsfixierte Politik ist Resultat eines Diskurses,
welcher sich durch Securitization, also die Konstruktion von Bedrohungen, auszeichnet. Dabei wer-
den Schlagworte wie illegale Immigration und organisierte Kriminalität mit der Öffnung der Gren-
zen in Mittel- und Osteuropa verknüpft, um den Abbau der Binnengrenzen innerhalb der erweiter-
ten EU möglichst lange hinauszuzögern
18
. De facto wird damit eine Flexibilisierung und Abstufung
bei der Implementierung des Schengen-acquis durch die MOEL ausgeschlossen. Die Dominanz
innen- und sicherheitspolitischer Akteure in diesem Prozess sowie deren institutionelles Eigeninte-
resse verhindern, dass die EU den MOEL in dieser Frage entgegenkommt. Der Schwerpunkt wurde
bewusst hin zu einer ,,concentration upon improved security rather than the counterbalancing issues
of greater freedom" verschoben (Misilegas/Monar/Rees 2003: 60).
4. Soft Security Ein erweitertes Verständnis von Sicherheit in Europa
Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion (SU) hat sich
auch ein Wandel im Verständnis von Sicherheit vollzogen. War Sicherheitspolitik zu Zeiten der
Blockkonfrontation vor allem auf die Verteidigung des eigenen Territoriums und die Abwehr mili-
tärischer Bedrohungen ausgerichtet, so hat sich das Sicherheitsverständnis im Laufe des letzten
Jahrzehntes grundlegend verändert (Peterson 1997: 273). Vollzogen hat sich hier eine Ausweitung
des Sicherheitsbegriffs (Buzan et al. 1998), welche auf die Kopenhagener Schule der Internationa-
len Beziehungen zurückgeht. Dieses Verständnis von Sicherheit weicht davon ab, den Staat als das
einzige oder hauptsächliche Referenzobjekt für Sicherheit zu betrachten. Stattdessen wird z.B. die
Bedeutung des Individuums als Referenzobjekt betont (Archer 2001: 8). Bezeichnet man traditio-
nelle Sicherheitspolitik als ,,Hard Security", so kennzeichnet der Begriff ,,Soft Security" die Ab-
wehr aller von nicht-staatlichen Akteuren ausgehenden nicht-militärischen Risiken. Festzuhalten ist,
dass bei Soft Security nicht mehr die Sicherheit des Staates im Mittelpunkt steht. Bedrohungen
können nicht mehr nur von anderen Staaten ausgehen. Die Sicherheit des Einzelnen innerhalb einer
Gesellschaft kann vielmehr auch durch andere Individuen oder Gruppen von Individuen bedroht
18
Diese Annahme wird auch durch den Report des EU-Select Committee des House of Lords (2000) gestützt. Darin wird festgestellt, dass die ,,Com-
mon Evaluation Mechanisms", die seit 1998 dazu dienen, ein klareres Bild über die Grenzkontrollkapaziten und Implementierungsdefizite der Bei-
trittskandidaten zu erlangen, ,,tend to focus on problems and deficits rather than on the progress made by the candidate countries. They form the basis
for a current (and arguably somewhat alarmist) picture rather than for an assessment of the situation as it may be at the time of accession".
19
sein.
19
Zur Beschreibung dieser Bedrohungen werden in der Literatur verschiedene Begrifflichkei-
ten verwendet. Während Peterson (1997) den Ausdruck ,,Soft Security" bevorzugt, verwenden Mit-
silegas et al. (2003) den Begriff ,,Low Security". Grabbe wiederum spricht von ,,Micro-level
Security" (2000).
20
Am umfassendsten ist jedoch Petersons (1997: 273) Definition von Soft
Security: ,,'Soft Security' in this context is understood as all aspects of security short of military
combat operations including the defence of the national territory. That is, everything ranging from
internal stability to the execution of the Petersberg tasks."
21
Diese umfassende Definition ist jedoch
kritisch zu bewerten. Ob die Erfüllung der Petersberger Aufgaben, welche in der Praxis mit
militärischen Mitteln geschieht, eine passende Antwort auf primär von Individuen ausgehenden
weichen Sicherheitsrisiken ist, erscheint zweifelhaft. Bei der Beschreibung weicher
Sicherheitsrisiken ist Peterson wiederum auf einer Linie mit den anderen Autoren. Weiche
Sicherheitsrisiken sind nach seiner Definition ,,political and economic instability, ethnic conflict,
minority conflicts, border disputes, the influx of refugees, trans-border environmental problems and
organised criminality." Im neuen erweiterten Sicherheitsverständnis der EU ist die militärische
Bedrohung durch Streitkräfte jenseits des eisernen Vorhangs einer Bedrohung durch unkontrollierte
Immigration und grenzüberschreitendes organisiertes Verbrechen gewichen (Grabbe 2000: 520).
Beide Phänomene sind zwar nicht neu, wurden jedoch im Rahmen der Blockkonfrontation
weitgehend vernachlässigt. Ursächlich für diese weichen Sicherheitsrisiken seien primär Individuen
oder organisierte Gruppen von Individuen, welche durch ihre Aktivitäten westeuropäische
Gesellschaften destabilisieren könnten. Mitsilegas et al. (2003: 46) identifizieren zudem zwei
gegenläufige Trends. Den ersten bezeichnen sie als Deterritorialisierung von Sicherheit. Hiernach
entzieht sich Sicherheit mehr und mehr nationalen Grenzen. Der zweite Trend lässt sich als
Internalisierung von Sicherheit bezeichnen und entspricht weitgehend dem Konzept der Soft
Security. Sicherheit meint damit weniger die Abwehr einer äußeren Bedrohung als vielmehr die
Bereitstellung eines sicheren inneren Umfeldes. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
mit dem Ende der Blockkonfrontation die Abwehr weicher Sicherheitsrisiken die traditionelle und
militärisch ausgerichtete Sicherheitspolitik weitgehend verdrängt hat.
Für die politische Praxis bedeutet dies, dass sich die westeuropäische Sicherheitsagenda zu-
nehmend verändert, wobei die EU diese veränderte Agenda in immer stärkeren Maße dominiert. Im
Zentrum steht nicht mehr die Abwehr einer militärischer Bedrohung, sondern die Abwehr von Cha-
os, illegaler Einwanderung und organisierter Kriminalität (Anderson 1996: 187). Folglich erhält das
Politikfeld innere Sicherheit auch im Zuge der Osterweiterung eine herausragende Bedeutung. In
19
Für eine ausführlichere Diskussion des Begriffs Sicherheit aus verschiedenen theoretischen Perspektiven vgl. Lipschutz (1995).
20
In dieser Arbeit wird der Begriff Soft Security nach Peterson (1997) gegenüber den anderen Bezeichnungen bevorzugt.
21
Die Petersberger Aufgaben sind: ,,humanitarian and rescue tasks; peacekeeping tasks; tasks of combat forces in crisis management, including
peacemaking (WEU 1992).
20
keiner der bisherigen Erweiterungsrunden spielte das Thema innere Sicherheit eine so bedeutende
Rolle wie im aktuellen Erweiterungsprozess. War das europäische Integrationsprojekt ursprünglich
als ein Friedensprojekt angelegt, welches zwischenstaatliche Kriege in Europa unmöglich machen
sollte, versteht sich die EU heute vielmehr als ,,soft security provider" (Kempe et al. 1999: 10). Die
Akteure im Politikfeld innere Sicherheit begreifen die EU als eine ,,Sicherheitsgemeinschaft", wel-
che Soft Security im inneren der Union bereitstellt.
22
Diese Sicherheitsgemeinschaft soll im Rah-
men der Osterweiterung zum einen nach Mittel- und Osteuropa expandieren. Zum anderen soll die
Aufnahme der MOEL in die EU die bestehende Sicherheitsgemeinschaft keinesfalls gefährden. Als
elementar für die Aufrechterhaltung einer solchen Sicherheitsgemeinschaft gelten dabei strenge
Außengrenzkontrollen. Sie sollen als eine Art ,,First line of defence" (Grabbe 2000: 520) verhin-
dern, dass weiche Sicherheitsrisiken in Form von organisierter Kriminalität und illegaler Immigrati-
on von außen in die EU eindringen.
5. Schengen und das Konzept der positiven und negativen Integration
Neben der wachsenden Bedeutung von weichen Sicherheitsrisiken für das Handeln der EU
gegenüber den Beitrittskandidaten bietet auch das Konzept der positiven und negativen Integration
eine hilfreiche theoretische Erklärung für die Herangehensweise der EU bei der Ausdehnung des
Schengen-Raumes.
23
Dieses Konzept taucht in der Literatur in den verschiedensten Variationen auf.
Corbey (1995: 263) versteht unter negativer Integration die Schaffung von Regeln ,,that prohibit
national policies or intervention". Unter positiver Integration versteht sie ganz allgemein ,,the estab-
lishment of common policies". In der Rechtsphilosophie wiederum wird die Unterscheidung zwi-
schen negativer und positiver Integration verwendet, um zwischen ,,negativen Freiheitsrechten" -
Abwehrrechten, welche staatliche Eingriffe unterbinden - und ,,positiven Geboten" - welche staatli-
che Intervention gebieten - zu unterscheiden (Peters 1991: 283). Scharpf (1999) hat das Konzept der
negativen und positiven Integration auf die ökonomische Integration im Rahmen des Binnenmark-
tes übertragen und dabei die Problemlösungsfähigkeit von Maßnahmen der positiven Integration
untersucht. Er versteht Maßnahmen negativer Integration als ,,marktschaffend" und Maßnahmen
positiver Integration grundsätzlich als ,,marktkorrigierend" (Scharpf 1999: 49). Danach zielen Maß-
nahmen negativer Integration im Bereich des Binnenmarktes hauptsächlich auf die ,,Beseitigung
von Zöllen, von quantitativen und qualitativen Beschränkungen des freien Handels und von Behin-
derungen des freien Wettbewerbs" ab. Positive Integration bedeutet bei Scharpf vor allem ,,die
22
Der Begriff Sicherheitsgemeinschaft geht auf Deutsch (1957: 5) zurück.
23
Die Begriffe positiv und negativ implizieren keineswegs ein normatives Werturteil. Maßnahmen positiver Integration sind nicht per se besser als
Maßnahmen negativer Integration (Vgl. Gehring 1998: 46).
21
Ausübung wirtschaftspolitischer und regulativer Kompetenzen" auf europäischer Ebene.
24
Auf
europäischer Ebene sind Maßnahmen positiver Integration schwerer durchsetzbar als Maßnahmen
negativer Integration. Denn Erstere sind sehr stark vom Konsens der nationalen Regierungen ab-
hängig und benötigen im allgemeinen eine größere politische Legitimation zu ihrer Durchsetzung
(Scharpf 1999: 53). Folglich ist die Problemlösungsfähigkeit von Maßnahmen positiver Integration
begrenzt, da es zu ihrer Annahme und Implementierung eines breiten Konsenses bei ,,potentiell di-
vergierenden nationalen und Gruppeninteressen" bedarf (Scharpf 1999: 71).
Zürn (1998) hat diese ökonomisch ausgerichtete Konzeption der negativen und positiven In-
tegration auf internationale Umweltregime übertragen. Nach Zürn (1998: 180) zeichnen sich nega-
tive Regelungen dadurch aus, dass sie ,,neue, größere soziale und wirtschaftliche Handlungszu-
sammenhänge ermöglichen, indem sie politische Grenzen durchlässiger machen und protektionis-
tisch motivierte staatliche Eingriffe unterbinden". Dagegen unterwerfen positive Regelungen einen
gegebenen sozialen Handlungszusammenhang einer kollektiven Regelung, um unerwünschte Effek-
te von Interaktionen zu vermeiden. Anhand von diversen internationalen Umweltregimes verdeut-
licht Zürn (1998: 182) dabei die Interessensasymmetrien und Implementierungsprobleme im Rah-
men positiver Regelungen. Häufig divergiert die subjektive Betroffenheit der potentiellen Teilneh-
mer einer positiven Regelung sehr stark. Hieraus resultieren asymmetrische Interessenskonstellatio-
nen, die eine gemeinsame und möglichst verbindliche Regelung erschweren. So präferieren z. B.
wohlhabende Staaten, die durch Umweltverschmutzungen sehr stark betroffen sind, Regelungen auf
möglichst hohem Niveau. Ärmere und weniger stark betroffene Länder präferieren dagegen gar
keine Regelungen bzw. Regelungen auf möglichst niedrigen Niveau. Diese Länder ziehen den Sta-
tus quo jeglicher Verregelung vor, da sie mehr Kosten als Nutzen verursachen würde (Zürn 1998:
187). Kommt dennoch eine Regimebildung zustande, weil beispielsweise ein mächtiger und ein-
flussreicher Akteur existiert, der den Regelungsgegenstand mit anderen Themen koppeln und da-
durch Druck auf Regelungsverweigerer ausüben kann, bleibt immer noch das Problem, dass sich
Status quo orientierte Staaten äußerst passiv und unkooperativ bei der Implementierung verhalten
werden. Damit ist die Implementierung neben bestehenden Interessensasymmetrien ein weiteres
Hindernis positiver Regelungen. Anders als bei negativen Regelungen sind die Umsetzungsschwie-
rigkeiten bei positiven Regelungen weitaus größer. ,,Die Staaten müssen sich im Falle der negativen
Regelung häufig nur zur Unterlassung verpflichten, durch eigene Regeln den freien Austausch zu
behindern" (Zürn 1998: 189). Dagegen implizieren positive Regelungen stets Kosten für eine be-
stimmte Anzahl von Teilnehmern. Wobei die ,,politische Implementation" in Form von Gesetzen
weniger problematisch und kostenintensiv ist als die ,,effektive Implementation", also die Bereit-
24
Scharpf schränkt jedoch ein, dass Maßnahmen positiver Integration sowohl ,,marktschaffend" als auch ,,marktkorrigierend" wirken können.
Marktkorrigierend wirken diese Maßnahmen dann, wenn sie produkt- und standortbezogene Vorschriften zu Arbeitsbedingungen oder im
Umweltbereich festschreiben. Marktschaffend wirken diese Maßnahmen, wenn sie darauf abzielen nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen
(Scharpf 1999: 49).
22
stellung ausreichender finanzieller, administrativer und technischer Kapazitäten zur Umsetzung
einer positiven Regelung. Darüber hinaus verweisen ärmere Staaten häufig auf mangelnde Ressour-
cen zur Umsetzung der vereinbarten Regelungen und verlangen nach internationaler Unterstützung
(Zürn 1998: 191). Neben bestehenden Interessensasymmetrien behindert also auch die Unfähigkeit
oder Unwilligkeit zur effektiven Implementierung die Durchsetzung positiver Regelungen (Zürn
1998: 192).
Gehring (1998: 46) hat die Unterscheidung zwischen positiver und negativer Integration
erstmals auf das Politikfeld innere Sicherheit und das Schengen-Regime übertragen. Auch er hat
sich an der Konzeption von Scharpf orientiert und dabei die Genese des Schengen-Regimes in zwei
Phasen unterteilt. In einer ersten Phase handelten die beteiligten Regierungen marktschaffend, in
dem sie die Herausbildung eines integrierten Reiseraumes in Westeuropa durch die endgültige Ab-
schaffung der Binnengrenzkontrollen zwischen den beteiligten Staaten beschleunigen wollten. In
einer zweiten Phase begannen die beteiligten Staaten und Exekutiven jedoch in zunehmendem Ma-
ße zu kooperieren und marktkorrigierend zu handeln, um befürchtete Sicherheitsverluste durch den
Abbau der Binnengrenzkontrollen zu kompensieren. Durch negative Integration entstandene Kon-
trollverluste sollten durch Maßnahmen positiver Integration ausgeglichen werden. Gehring meidet
jedoch eine eindeutige Charakterisierung des Schengen-Regimes als Maßnahme positiver oder ne-
gativer Integration. In dieser Arbeit wird jedoch die Einschätzung vertreten, dass das Schengen-
Regime eindeutig durch einen repressiven Überhang gekennzeichnet ist, und daher als eine Maß-
nahme positiver Integration zu verstehen ist.
25
Diese ,,tendency towards restriction", welche für den
gesamten Bereich der Justiz- und Innenpolitik auf europäischer Ebene charakteristisch ist (Monar
2001: 762), lässt sich auch für das Schengen-Regime ausmachen.
Werden die hier angestellten handlungstheoretischen bzw. akteurszentrierten Überlegungen
zur negativen und positiven Integration nun auf die Ausdehnung des Schengen-Raumes im Rahmen
der EU-Osterweiterung übertragen, lässt sich feststellen, dass das Schengen-Regime in seiner prak-
tischen Ausformung als Maßnahme positiver Integration zu charakterisieren ist. Wie sich noch zei-
gen wird, spielte das Ideal der Personenfreizügigkeit und damit der Aspekt der negativen Integrati-
on bei der Genese des SDÜ nur eine marginale Rolle. Zum anderen lässt sich im Zuge der Ausdeh-
nung des Schengen-Raumes eine Konstellation ausmachen, welche die klassischen Merkmale und
Probleme einer Maßnahme positiver Integration aufweist. Die Expansion des Schengen-Raumes hat
eine Situation hervorgebracht, in der sich zwei Akteursgruppen mit asymmetrischen Interessen und
Motivationen gegenüberstehen. Die Ausdehnung des Schengen-Raumes ist eine sehr kostenintensi-
ve Angelegenheit, deren effektive Implementierung zum Beitrittstermin nicht im Interesse aller teil-
25
Diese Überlegungen basieren auf der in Fußnote 9 erwähnten Empirie-Arbeit. Gestützt wird diese Annahme auch dadurch, dass nur Art. 2 Abs. 1
SDÜ (Schengener Durchführungsabkommen) von 1990 als Maßnahme negativer Integration zu verstehen ist: ,,Die Binnengrenzen dürfen an jeder
Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden". Alle restlichen 141 Art. beziehen sich ausschließlich auf den Kontrollverlust kompensierende
Maßnahmen positiver Integration (Vgl. auch Busch 1998: 8).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832484033
- ISBN (Paperback)
- 9783838684031
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Gesellschaftswissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- innere sicherheit schengen-acquis grenzschutz integration osteuropa
- Produktsicherheit
- Diplom.de