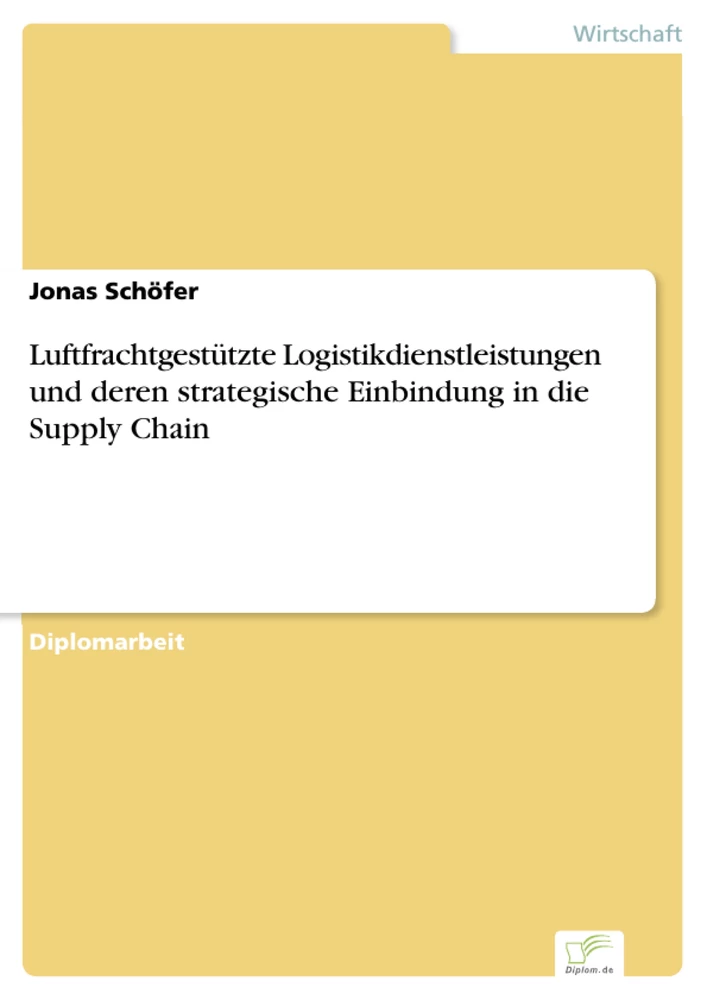Luftfrachtgestützte Logistikdienstleistungen und deren strategische Einbindung in die Supply Chain
©2004
Diplomarbeit
104 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Fluggesellschaften und Spediteure werden im Lichte von wachsenden Frachtallianzen und einer höheren Marktkonzentration ihre strategischen Möglichkeiten überprüfen müssen. Die Gründung und der Erfolg der Frachtallianzen wie WOW-The World und SkyTeam Cargo bestätigt die Notwendigkeit der Neuorientierung in einem sich wandelnden Marktgefüge.
Mit integrierten Partnerschaftslösungen sprechen Spediteure und Luftfrachtgesellschaften gemeinsam Versender an und bieten globale Logistiklösungen aus einer Hand an. Lufthansa Global Partners ist über ein Geflecht von Partnerschaften bereits heute in der Lage, Door-to-Door-Lieferungen aus einer Hand anzubieten und ein Gegengewicht zu den in ihren Markt drängenden Integrators zu bilden. Speditionskonzerne wie Panalpina betreiben Insourcing, integrieren den Hauptlauf und bieten Transportleistungen im Selbsteintritt mit eigenen Frachtflugzeugen an.
Im Rahmen von Partnerschaften sind die Erfolgsfaktoren des Supply-Chain-Managements sowie der Dienstleistungserstellung in der Logistik ausschlaggebend für den Erfolg. Cost-Benefit-Sharing und Collaboration, standardisierte Prozessabläufe und die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur eröffnen Rationalisierungspotenziale. Océ Printing Systems ist durch eine enge Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo AG in der Lage, einen Großteil der Neugeräte und Ersatzteile direkt vom Produktionsstandort ohne Zwischenlagerung weltweit in kürzester Zeit zum Kunden zu liefern.
Insbesondere im europäischen Luftverkehrsmarkt steigt der Konsolidierungsdruck zunehmend. Der Zusammenschluss von Air France und KLM ist Ausdruck hiervon. Gemeinsame strategische Partnerschaften und die Bildung eines Virtual Integrators kann nicht nur aus operativer Sicht eine Möglichkeit zur Vorbereitung auf zukünftige Fusionen sein, sondern auch Unterschiede der Firmenkultur zwischen potenziellen Fusionspartnern frühzeitig ausgleichen.
Wie auch auf dem Passagiermarkt werden in Zukunft nicht mehr einzelne Luftfrachtdienstleister, sondern branchenübergreifende Verbünde und Allianzen miteinander konkurrieren. Die weiter fortschreitende Liberalisierung wird mittel- bis langfristig Beschränkungen der internationalen Kapitalverflechtung und der Kabotageverkehre aufheben. Strategische Partnerschaften bieten heute die Möglichkeit, für zukünftige Marktveränderungen auch im Schatten des globalen Terrorismus gerüstet zu […]
Fluggesellschaften und Spediteure werden im Lichte von wachsenden Frachtallianzen und einer höheren Marktkonzentration ihre strategischen Möglichkeiten überprüfen müssen. Die Gründung und der Erfolg der Frachtallianzen wie WOW-The World und SkyTeam Cargo bestätigt die Notwendigkeit der Neuorientierung in einem sich wandelnden Marktgefüge.
Mit integrierten Partnerschaftslösungen sprechen Spediteure und Luftfrachtgesellschaften gemeinsam Versender an und bieten globale Logistiklösungen aus einer Hand an. Lufthansa Global Partners ist über ein Geflecht von Partnerschaften bereits heute in der Lage, Door-to-Door-Lieferungen aus einer Hand anzubieten und ein Gegengewicht zu den in ihren Markt drängenden Integrators zu bilden. Speditionskonzerne wie Panalpina betreiben Insourcing, integrieren den Hauptlauf und bieten Transportleistungen im Selbsteintritt mit eigenen Frachtflugzeugen an.
Im Rahmen von Partnerschaften sind die Erfolgsfaktoren des Supply-Chain-Managements sowie der Dienstleistungserstellung in der Logistik ausschlaggebend für den Erfolg. Cost-Benefit-Sharing und Collaboration, standardisierte Prozessabläufe und die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur eröffnen Rationalisierungspotenziale. Océ Printing Systems ist durch eine enge Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo AG in der Lage, einen Großteil der Neugeräte und Ersatzteile direkt vom Produktionsstandort ohne Zwischenlagerung weltweit in kürzester Zeit zum Kunden zu liefern.
Insbesondere im europäischen Luftverkehrsmarkt steigt der Konsolidierungsdruck zunehmend. Der Zusammenschluss von Air France und KLM ist Ausdruck hiervon. Gemeinsame strategische Partnerschaften und die Bildung eines Virtual Integrators kann nicht nur aus operativer Sicht eine Möglichkeit zur Vorbereitung auf zukünftige Fusionen sein, sondern auch Unterschiede der Firmenkultur zwischen potenziellen Fusionspartnern frühzeitig ausgleichen.
Wie auch auf dem Passagiermarkt werden in Zukunft nicht mehr einzelne Luftfrachtdienstleister, sondern branchenübergreifende Verbünde und Allianzen miteinander konkurrieren. Die weiter fortschreitende Liberalisierung wird mittel- bis langfristig Beschränkungen der internationalen Kapitalverflechtung und der Kabotageverkehre aufheben. Strategische Partnerschaften bieten heute die Möglichkeit, für zukünftige Marktveränderungen auch im Schatten des globalen Terrorismus gerüstet zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8244
Schöfer, Jonas: Luftfrachtgestützte Logistikdienstleistungen und deren strategische
Einbindung in die Supply Chain
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Technische Universität Berlin, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
I
NHALTSVERZEICHNIS
III
Luftfrachtgestützte Logistikdienstleistungen und deren strategische Ein-
bindung in die Supply Chain
Abkürzungsverzeichnis ... VII
Abbildungsverzeichnis ... VIII
Tabellenverzeichnis ... IX
1
Einleitung ...10
1.1
Problemstellung ... 10
1.2
Aufbau dieser Arbeit ... 12
2
Einführung in die grundlegenden Konzepte der Arbeit ...13
2.1
Logistik und Supply Chain Management ... 13
2.2
Strategische Einbindung durch Partnerschaften... 16
2.3
Logistikdienstleistungen in der Luftfracht... 18
2.4
Marktumfeld der Luftfracht ... 20
I
NHALTSVERZEICHNIS
IV
3
Die Steuerung der Supply Chain ...26
3.1
Partnerschaften bilden Supply Chain Netzwerke... 26
3.2
Ziele des Supply Chain Managements ... 28
3.3
Instrumente und Systeme des Supply Chain Managements ... 29
3.4
Systeme des Supply Chain Managements ... 30
3.5
Modelle und Netzwerkkonzepte des Supply Chain Managements ... 32
3.5.1
Das Supply-Chain-Operations-Reference-Modell ... 32
3.5.2
Fraktale Unternehmen ... 34
3.5.3
Best-of-Everything-Organisation ... 36
3.5.4
Synthese der Modelle ... 37
3.6
Erfolgsfaktoren des Supply Chain Managements ... 38
4
Erstellung von Luftfrachtdienstleistungen...40
4.1
Leistungsmerkmale des Verkehrsträgers Flugzeug... 40
4.2
Luftfrachtaffine Güter und Branchen... 42
4.3
Die Transportkette Luftfracht ... 44
4.4
Die Hub-and-Spoke-Netzwerke der Luftfahrt... 45
4.5
Luftfrachtersatzverkehre ... 48
4.6
Akteure und Dienstleister im Luftfrachtgeschäft... 49
4.6.1
Versender und Empfänger ... 52
4.6.2
Klassische Luftfrachtgesellschaften als Transporteure ... 54
4.6.3
Spediteure... 56
4.6.4
Integratoren, die Systemdienstleister der Luftfracht ... 58
4.6.5
IuK-Systeme und IT-Dienstleister... 59
4.6.6
Fourth Party Logistics Provider ... 60
4.6.7
Sonstige Dienstleister im Luftfrachtgeschäft ... 61
4.7
Erfolgsfaktoren für Luftfrachtlogistikdienstleistungen... 61
I
NHALTSVERZEICHNIS
V
5
Strategische Partnerschaften...64
5.1
Klassifizierung von Partnerschaften... 64
5.1.1
Horizontale, vertikale und laterale Partnerschaften... 64
5.1.2
Weitere Unterscheidungsmerkmale von Partnerschaften ... 66
5.2
Schichten und Phasen einer Partnerschaft... 68
5.2.1
Das Drei-Ebenen-Modell der Kooperation ... 68
5.2.2
Das Advanced Logistic Partnership-Modell... 69
5.3
Zielsetzung von strategischen Partnerschaften ... 72
5.4
Bestehende Partnerschaften in der Luftfrachtlogistik... 73
5.4.1
Vertikale Partnerschaften ... 73
5.4.1.1
Lufthansa Global Partners ... 73
5.4.1.2
Océ Printing Systems und Lufthansa Cargo AG... 74
5.4.2
Horizontale Partnerschaften... 75
5.4.2.1
Verkehrsträgerübergreifende Partnerschaften... 75
5.4.2.2
Interlining-Abkommen... 76
5.4.2.3
Poolabkommen... 77
5.4.2.4
Block Agreements ... 77
5.4.2.5
Frachtallianzen ... 78
5.4.3
Laterale Partnerschaft: Elektronischer Marktplatz GF-X ... 79
I
NHALTSVERZEICHNIS
VI
6
Potentiale für zukünftige Partnerschaften...80
6.1
Potentiale auf der strategische Ebene ... 80
6.1.1
Strategische Partnerschaften zur Vorbereitung von Fusionen ... 80
6.1.2
One-Stop-Shopping als Virtual Integrator ... 81
6.1.3
Stärkeres Wachstum durch Partnerschaft... 82
6.2
Potentiale auf der Systemebene... 82
6.2.1
Einsatz von Interorganisationssystemen... 82
6.2.2
Gemeinsames Informationsmanagement entlang der Supply Chain 83
6.2.3
Realisierung von Available-to-Promise und Capable-to-Promise... 84
6.3
Potentiale auf den übrigen Ebenen... 84
6.3.1
Frühzeitige Transportanmeldung erleichtert Konsolidierung ... 85
6.3.2
Effizientere Nutzung des Fluggerätes und der Infrastruktur ... 85
6.3.3
Effizienzsteigerung durch frühzeitigen Containereinsatz... 86
6.3.4
Einsatz von modernen Containersystemen im Netzwerk ... 88
7
Zusammenfassung und Ausblick...90
8
Quellenverzeichnis ...93
A
BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
VII
Abkürzungsverzeichnis
3PL
Third Party Logistics Provider
4PL
Fourth Party Logistics Provider
ALP Advanced-Logistic-Partnership-Modell
AWB Air
Waybill
EDI Electronic
Data
Interchange
EDV Elektronische
Datenverarbeitung
et. al.
Et aliud, lat. für ,,und andere"
IATA
International Air Transport Association
ICAO
International Civil Aviation Organisation
IT Informationstechnologie
KEP
Kurier-, Express- und Paket
km Kilometer
LEV Luftfrachtersatzverkehr
LLP
Lead Logistics Provider
PC Personal
Computer
PDA
Personal Data Assistant
RPK
Revenue Passenger Kilometres
RTK
Revenue Tonne Kilometres
SCC
Supply Chain Council
SCM
Supply Chain Management
SCP
Supply Chain Planning
SCOR Supply-Chain-Operations-Reference-Modell
ULD Unit
Load
Device
WTO
World Trade Organisation
XML Extended
Markup
Language
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
VIII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Supply Chain mit geringer Komplexität... 15
Abbildung 2: Merkmale einer Partnerschaft... 16
Abbildung 3: Merkmale von strategischen Partnerschaften... 18
Abbildung 4: Das SCOR-Modell basiert auf fünf Managementprozessen ... 33
Abbildung 5: Netzwerke als ,,Best-of-Everything-Organisation ... 36
Abbildung 6: Boeing 747-400 Passagierversion... 41
Abbildung 7: Boeing 747-400F Frachterversion ... 41
Abbildung 8: Transportkette Luftfracht... 45
Abbildung 9: Direktverbindungsnetz mit 6 Flugplätzen... 46
Abbildung 10: Hub-and-Spoke-Netzwerk mit einem Hub und 5 weiteren
Flugplätzen... 47
Abbildung 11: Dienstleister entlang der Transportkette Luftfracht ... 51
Abbildung 12: Unterteilung von Luftfrachtgesellschaften... 55
Abbildung 13: Grundsätzliche Einteilungskriterien für strategische
Partnerschaften ... 65
Abbildung 14: Sieben Variablen von Partnerschaften nach Klein... 67
Abbildung 15: Die drei Ebenen der Kooperation ... 68
Abbildung 16: Modell einer strategischen Partnerschaft nach Frigo-Mosca ... 70
T
ABELLENVERZEICHNIS
IX
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Marktanteile Luftfracht
22
E
INLEITUNG
10
1 Einleitung
Ziel des ersten Kapitels ist es, den Leser für die Problematik der strategischen
Entwicklungsoptionen innerhalb der Luftfrachtbranche zu sensibilisieren und
die Herangehensweise der vorliegenden Arbeit darzulegen.
1.1 Problemstellung
Die Luftfracht stellt eine für die Weltwirtschaft lebensnotwendige Transportart
dar. Luftfracht stellt die Wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg
einer großen Anzahl von Branchen sicher und sorgt für den Transport von
über einem Drittel Welthandelsaufkommens nach Wert. Infolge der Globalisie-
rung nutzen eine steigende Anzahl von verladenden Unternehmen regelmäßig
Luftfrachttransporte, um ihre international verteilten Produktionsstätten mitein-
ander zu verbinden. Auf der Anbieterseite haben ebenfalls tiefgreifende Ver-
änderungen in den vergangenen Jahren stattgefunden. Luftfrachtdienstlei-
stungen werden nunmehr nicht nur von Fluggesellschaften und Spediteuren
angeboten, sondern auch von Integratoren wie UPS oder FEDEX aus dem
Paket- und Kurierbereich, die den Versendern Tür-zu-Tür-
Frachtdienstleistungen aus einer Hand anbieten.
Fluggesellschaften und Spediteure werden, wie in der Vergangenheit, auch
weiterhin in Abhängigkeit voneinander koexistieren. Allerdings kann erwartet
werden, daß sich diese Beziehungen unter dem Einfluß von wachsenden Alli-
anzen zwischen den Fluggesellschaften und somit einer höheren Konzentrati-
on von Marktanteilen verändern werden. Der Konsolidierungstrend auf der Sei-
te der Spediteure setzt sich ebenfalls weiterhin fort, so daß auch hier stärkere
Marktmächte entstehen. Die Gründung von Allianzen zwischen Passagierflug-
linien führte in den vergangenen Jahren zu besonderen Marktveränderungen.
Obwohl diese Allianzen auf den Passagierverkehr fokussiert sind, erscheint
eine engere Zusammenarbeit auf dem Frachtmarkt unausweichlich. Die Grün-
dung von Frachtallianzen wie ,,WOW-The World" aus Star Alliance-Partnern
und ,,SkyTeam Cargo" aus Partnern der konkurrierenden Passagierallianz
SkyTeam bestätigt diese Annahme. In den Frachtallianzen sind bisher nur ein
kleiner Teil der führenden Fluggesellschaften wie Lufthansa Cargo, KLM Car-
go und Singapore Airlines Cargo vertreten. Der Erfolg der geschlossenen Alli-
anzen läßt jedoch vermuten, daß in den kommenden Jahren auch diese Ge-
sellschaften nach internationalen Partnern suchen müssen, um gegen die
Marktmacht der Allianzen bestehen zu können.
E
INLEITUNG
11
Die angespannten Beziehungen zwischen Fluggesellschaften und Spediteuren
haben sich in den vergangenen Jahren verbessert. Die Bestrebungen seitens
der Fluggesellschaften, durch Direktverträge mit den Versendern die Spediteu-
re als Zwischenhändler zu umgehen, verschlechterten die Beziehungen inner-
halb der Branche. Die engere Kooperation zwischen Fluggesellschaften und
Spediteuren im Rahmen von Partnerprogrammen hat zu Lockerungen der be-
lasteten Verhältnisse geführt. Mit Partnerprogrammen sprechen die Partner
gemeinsam Versender an und können globale Logistiklösungen aus einer
Hand anbieten. Entgegen diesem Trend unternahmen einige Spediteure
Schritte zur vertikalen Integration und bauten eigene internationale Flugver-
bindungen mit eigenem Gerät auf.
Luftfracht unterscheidet sich in vielen Bereichen vom Passagierverkehr. Der
Luftfrachtmarkt unterliegt schwächeren nationalen Orientierungen und weist
eine höhere Wettbewerbsintensität auf. Darüber hinaus ist der Frachtverkehr
bereits wesentlich liberaler orientiert, was sich in einer Vielzahl von bilateralen
Partnerschaften innerhalb der Branche zeigt. Durch den stärker werdenden
globalen Wettbewerb und das Erscheinen neuer Wettbewerber auf dem Welt-
markt nimmt die Bedeutung von innovativen Unternehmensstrategien nicht nur
für die verladende Wirtschaft, sondern auch für die Transportbranche zu.
Welche Möglichkeiten bieten sich den Marktteilnehmern, um auf die gestiege-
nen Kundenanforderungen und den gesteigerten internationalen Wettbewerb
zu reagieren? Partnerschaften zwischen Unternehmen können eine Antwort
auf diese Frage sein. Im Rahmen dieser Arbeit werden die strategischen Mög-
lichkeiten betrachtet, Logistikdienstleistungen durch Partnerschaften in Supply
Chain Management Konzepte zu integrieren und damit die Wettbewerbsfähig-
keit der gesamten Supply Chain und seiner Teilnehmer zu sichern.
E
INLEITUNG
12
1.2
Aufbau dieser Arbeit
Nach der Problemdarstellung und der Erläuterung des Aufbaus dieser Arbeit
werden dem Leser zunächst die thematischen Grundlagen der Arbeit darge-
legt. Dabei werden die Themenbereiche Logistik und Supply Chain Manage-
ment, strategische Einbindungsoptionen durch Partnerschaften sowie Logi-
stikdienstleistungen in der Luftfracht erläutert. Ein Überblick über das Marktge-
schehen in der Luftfrachtbranche rundet die Einführung ab.
Im darauf folgenden Abschnitt wird näher auf die Steuerung einer Supply
Chain eingegangen. Dazu sind eine Herleitung des grundsätzlichen Supply-
Network-Gedankens und seiner Ziele, Systeme und Mittel notwendig. Darauf
aufbauend werden verschiedene Theorien zur Bildung von Unternehmens-
netzwerken herangezogen und zu Erfolgsfaktoren des Supply Chain Manage-
ments zusammengefaßt.
Für das Verständnis der Luftfrachtbranche ist ein Einblick in die operative
Transport- und Dienstleistungserstellung in der Luftfracht erforderlich. Dazu
werden im vierten Kapitel die technischen Grundlagen der Leistungserstellung,
die Transportkette Luftfracht, sowie die daran teilnehmenden Akteure mit ihren
Interessen dargestellt. Im Anschluß werden Erfolgsfaktoren für die Dienstlei-
stungserstellung in der Luftfracht entwickelt.
Im fünften Kapitel wird dem Leser das Konzept der strategischen Partnerschaft
näher gebracht. Hierzu werden Unterteilungskriterien für verschiedene Arten
von Partnerschaften analysiert. Zur Struktur und Entwicklungsphasen von
Partnerschaften wird ein theoretischer Hintergrund dargelegt, um im Anschluß
Beispiele für aktuell bereits bestehende Partnerschaften anhand der vorher
beschriebenen Theorien und Kriterien zu kategorisieren.
Die Ergebnisse der in den vorangegangenen Kapiteln durchgeführten Recher-
che werden genutzt, um im sechsten Kapitel Potentiale für zukünftige Partner-
schaften in der Luftfrachtbranche zu entwickeln. Dazu werden die entwickelten
Erfolgsfaktoren für Dienstleister sowie des Supply-Chain-Managements und
die Theorien zur Struktur von Partnerschaften und Netzwerken zur Einordnung
der Potentiale einbezogen.
Zuletzt werden die Ergebnisse zusammengefaßt und dem Leser ein Ausblick
möglicher Veränderungen der Luftfrachtbranche unter dem Gesichtspunkt der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit geboten.
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
13
2 Einführung in die grundlegenden Konzepte der Arbeit
Gegenstand dieses Kapitels sind einführende Bemerkungen über die Thematik
der Arbeit. Zunächst wird eine Einweisung in das Themengebiet der Logistik
sowie des Supply Chain Managements (SCM) gegeben. Dabei wird der Zu-
sammenhang der prozeßorientierten Logistik zum Supply Chain Management
erläutert. Im Anschluß daran werden die Begriffe Strategie und Partnerschaft
im Sinne dieser Arbeit erklärt. Zuletzt wird die Transporterstellung mit dem
Verkehrsträger Flugzeug einführend erläutert, ein Überblick über das aktuelle
Marktgeschehen sowie eine Prognose für die Marktentwicklung des Luft-
frachtmarktes bis 2020 gegeben.
2.1
Logistik und Supply Chain Management
Der Begriff Logistik wird in der Literatur verschieden verwendet. Ursprünglich
entstammt der Begriff aus dem militärischen Bereich, wo er als Bezeichnung
für den Transport und Umschlag militärischer Güter und Truppentransporte
dient. In der angelsächsischen Managementlehre wurde die Logistik zuerst auf
Gütertransportvorgänge im betrieblichen Umfeld übertragen. Pfohl definierte
1990 den Umfang der Logistik mit allen ,,Transport-, Lager- und Umschlags-
vorgängen im Realgüterbereich in und zwischen sozialen Systemen".
1
Damit
werden die Warenflüsse als einzige Bestandteile der Logistik genannt, jedoch
keine Aussage über die Qualität der Vorgänge gemacht. Ballou erweitert diese
Aussage um einen qualitativen Anspruch sowie um logistische Dienst-
leistungen: ,,The mission of logistics is to get the right goods or services to the
right place, at the right time, and in the desired condition".
2
Parallel zu jedem
Güterfluß erfolgt zwangsläufig ein Informationsfluß, ohne den keine Kontrolle
oder Steuerung eines komplexen Güterflusses möglich wäre. Baumgarten
führt den Güter- und den Informationsfluß zusammen und führt eine planeri-
sche Komponente ein: ,,Die Unternehmenslogistik umfaßt die ganzheitliche
Planung, Steuerung, Durchführung und Kontrolle aller unternehmensinternen
und -übergreifenden Güter- und Informationsflüsse. Die Logistik stellt für Ge-
samt- und Teilsysteme in Unternehmen, Konzernen, Netzwerken und virtuellen
Unternehmen kunden- und prozeßorientierte Lösungen bereit".
3
Demnach be-
1
(Pfohl 1990b), S. 11
2
Engl.: "Die Aufgabe der Logistik ist es, die richtigen Güter oder Dienstleistungen an den rich-
tigen Ort, zur richtigen Zeit und in der geforderten Qualität zu bringen", (Ballou 1999), S. 6
3
(Baumgarten, Wiendahl et al. 2003), S. 9
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
14
schäftigt sich die Logistik nicht nur mit der operativen Durchführung, sondern
auch mit der strategischen Planung der Güter- und Informationsflüsse. Die
strategische Planung umfaßt dabei die räumliche Anordnung und Ausgestal-
tung von Anlagen und Systemen im Rahmen von Investitionen. Gerade hier
zeigt sich das Auslagerungspotential zu Dienstleistern, die bereits über ent-
sprechende Anlagen oder notwendiges Know-how verfügen.
4
Nachdem im
Laufe der 1990er Jahre bereits große Teile der einfachen Transportleistungen
ausgelagert worden sind, geben heute ca. 20% der Industrieunternehmen an,
Kernaufgaben wie Lagerhaltung oder Logistikplanung zu externen Dienstlei-
stern auslagern zu wollen.
5
Im Rahmen dieser Arbeit erscheint die ganzheitli-
che Betrachtungsweise nach Baumgarten als günstige Grundlage für die Be-
trachtung von interorganisationalen Partnerschaften und Prozessen vom Her-
steller bis zum Endkunden.
Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre beschäftigt sich die Logistik nicht mehr
nur mit einzelnen Insellösungen, sondern es treten integrierte Lösungen ent-
lang der Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt. Dabei werden Lieferanten-,
Angebots-, Versorgungs- oder Logistikketten betrachtet. Die Wertschöpfung
erfolgt dabei stufenweise durch verschiedene Entscheidungsträger.
6
Am Ende
dieser Wertschöpfungskette oder ,,Supply Chain" steht immer der Endkunde
beziehungsweise der Konsument.
Obwohl der Kunde eigentlich erst am Ende der Supply Chain steht, beginnt
grundsätzlich ein Supply-Chain-Prozeß mit einer Kundenbestellung. Aufgrund
der benötigten Durchlaufzeit der Zeit, die die Güter zum Durchlaufen des
Wertschöpfungsprozesses mit allen Lieferanten und Vorlieferanten benötigen
werden Kundenbestellungen mit Hilfe von Nachfrageprognosen möglichst
treffend vorgeplant. Die Entwicklung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung
der Supply Chain wird allgemein als Supply Chain Management bezeichnet
(SCM). Das SCM ist ein ganzheitlicher Lösungsansatz und mündet in effizien-
teren Steuerungsverfahren für die Abläufe der gesamten Logistik. Im Rahmen
des SCM wird nicht nur der physische Güterfluß, sondern zusätzlich der Infor-
mations- und Zahlungsmittelfluß betrachtet. Baumgarten definiert das SCM als
,,Konzept zur Planung, Integration und Steuerung aller Waren-, Informations-
4
Vgl. (Brauer 1988), S.43
5
Vgl. (Baumgarten 2003), S. 18
6
Vgl. (Busch, Dangelmaier et al. 2003), S. 5
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
15
und Finanzflüsse entlang einer Wertschöpfungskette".
7
Abbildung 1 zeigt eine
solche, nicht verzweigte Supply Chain.
Abbildung 1: Supply Chain mit geringer Komplexität
8
Da bereits große Teile der Wirtschaft komplex über Zulieferbeziehungen mit-
einander verflochten sind, ist das Modell eines Versorgungsnetzwerkes tref-
fender als das einer unverzweigten Kette. Diese Entwicklung spiegelt sich in
der Definition der Logistik nach Baumgarten bereits wieder. Die nähere Erläu-
terung des Netzwerkbegriffes erfolgt in Abschnitt 3.5. Dabei setzt die Bildung
eines Netzwerkes nicht zwingend voraus, daß die Zulieferbeziehungen sich
über eine reine Geschäftsbeziehung hinaus entwickeln. Geschäftsbeziehun-
gen sind sämtliche zwischen zwei Unternehmen ablaufende Transaktionen.
Dementsprechend stellt die Partnerschaft eine Untermenge der Geschäftsbe-
ziehungen dar. Im Folgenden wird eine Erläuterung des Partnerschafts-
Begriffes durchgeführt.
7
Vgl. (Baumgarten 2000), S. 1ff.
8
Eigendarstellung, in Anlehnung an (Busch, Dangelmaier et al. 2003), S. 5
Rohstoff-
Lieferant
Teile-
Lieferant
Endprodukt-
Hersteller
Händler Endkunde
Güterfluß
Informationsfluß
Zahlungsmittelfluß
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
16
2.2 Strategische
Einbindung
durch Partnerschaften
Unter einer Partnerschaft ist die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Un-
ternehmen zu verstehen, die zur Erzielung größerer Rentabilität durch Ratio-
nalisierung oder Arbeitsteilung unter Erhalt der Selbständigkeit bestimmte Un-
ternehmensfunktionen gemeinsam wahrnehmen.
9
Der Begriff Partnerschaft wird im deutschen Sprachraum häufig synonym mit
Kooperation, Allianz oder Zusammenarbeit verwendet. Im englischen Sprach-
raum gilt ähnliches für ,,partnerships", ,,alliances" und ,,cooperations".
10
Die
Verwendung dieser Begriffe suggeriert ein stärkeres gemeinsames Vorgehen
als z.B. der Begriff ,,Geschäftsbeziehung". Abbildung 2 stellt die drei grund-
sätzlichen Eigenschaften einer Partnerschaft dar. Im Unterschied zu einer
klassischen Hersteller-Lieferantenbeziehung werden nicht nur einzelne Hand-
lungen mit dem Ziel einer auf Leistung und Vergütung basierenden Geschäfts-
beziehung koordiniert. Die weitergehende Verknüpfung der Partnerunterneh-
men erfolgt mit Hinblick auf die Umsetzung von strategischen Zielen.
11
Abbildung 2: Merkmale einer Partnerschaft
12
Strategisches Handeln dient einer pro-aktiven Zielerreichung und der langfri-
stigen Absicherung von Wettbewerbsvorteilen.
13
Eine Strategie umfaßt in der
Regel mehrere Ziele, die mittel- bis langfristiger Natur sind. Von Clausewitz
prägte den Begriff der Strategie im 19. Jahrhundert als ein ,,zielorientiertes
Rahmenkonzept für eine Folge von Handlungen, das unter Ungewißheit for-
9
Vgl. (Schmidt 1969), S. 16
10
Vgl. (Iyer 2003), S. 41
11
Vgl. (Killich 2002), S. 7
12
Eigendarstellung
13
Vgl. (Becker 1999), S. 121
Partnerschaft
2+ Unternehmen
Gemeinsame Unter-
nehmenstätigkeiten
Langfristigkeit
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
17
muliert und im Lichte aktueller Informationen stets zu überprüfen ist.".
14
Die
Übertragung des Begriffs auf marktwirtschaftlich arbeitende Organisationen
erfolgte bereits in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Erst durch Porter
rückte die Strategieentwicklung in den Fokus wirtschaftswissenschaftlicher
Forschung als ,,Ziel-Mittelkombinationen, die dem wirtschaftlichen Umfeld ad-
äquat sind".
15
Wright et al. setzen Strategie gleich mit ,,den Plänen des Top-
Managements, jene Ergebnisse zu erreichen, die sich mit der Mission und den
Zielen der Organisation decken".
16
Heutzutage wird der Begriff Strategie häufig
mit Langfristigkeit, Relevanz, Rationalität, Proaktivität, Selektivität und Kom-
plexität verbunden.
17
Mintzberg et al. unterstreichen den Aspekt der Langfri-
stigkeit damit, daß sie Strategie als ein ,,Muster, ein über die Zeit hinweg kon-
sistentes Verhalten" beschreiben.
18
Oliver definiert Strategie als ein Verständ-
nis für die Struktur und die Dynamik der Branche, das Erkennen der relativen
Position des Unternehmens innerhalb dieser sowie die Vornahme von Hand-
lungen zur Verbesserung der Position und der Effektivität der Organisation.
19
Weitläufig bekannt ist das grundsätzliche Verständnis von Strategie als einem
Plan, der die Organisation von einem Punkt in der Gegenwart zu einem be-
stimmten Punkt in der Zukunft führt.
20
Zusammenfassend lassen sich strategische Partnerschaften als auf langfristi-
ge Zielerreichung und Wettbewerbsvorteilen ausgerichtete Zusammenarbeit
mehrerer Unternehmen auf früherer, gleicher oder späterer Wertschöpfungs-
stufe definieren (vergleiche Abbildung 3).
14
(von Clausewitz 2000), S. 157
15
(Porter 1980), S. 17ff.
16
Vgl. (Wright, Boyd et al. 1992), S.77
17
Vgl. (Baumgarten und Bott 1999), S. 237ff.
18
Vgl. (Mintzberg, Ahlstrand et al. 1999), S. 23
19
Vgl. (Oliver 2001), S. 7
20
Vgl. (Beckham 2000), S. 55
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
18
Abbildung 3: Merkmale von strategischen Partnerschaften
21
2.3
Logistikdienstleistungen in der Luftfracht
Der Luftverkehr allgemein stellt sich als komplexes Konstrukt bilateraler Ver-
träge, nationaler Interessen und öffentlicher Aufgaben dar. Die weitgehende
Deregulierung und die Akkumulation unterschiedlicher privatwirtschaftlicher
Unternehmensstrategien tragen zur Komplexität bei. Als Oberbegriff des Luft-
frachtverkehrs ist der Luftverkehr definiert als die Gesamtheit aller Dienstlei-
stungen, die zur Raumüberwindung von Personen, Fracht und Post auf dem
Luftwege notwendig sind.
22
Luftfracht als Teilmarkt des Luftverkehrs kann als
,,Transport von Gütern mit Flugzeugen" bezeichnet werden
23
, oder als Ge-
samtheit aller Lufttransport-Dienstleistungen, die keine Fluggastbeförderung
bzw. deren Gepäck darstellen.
24
Logistikdienstleistungen sind Tätigkeiten der effizienten Planung, Steuerung,
Durchführung und Kontrolle von Material-, Waren- und Informationsflüssen
entlang der logistischen Kette, die zur Erfüllung der Kundenanforderungen
21
Eigendarstellung
22
Vgl. (Pompl 1998), S. 8f.
23
(Klaus und Krieger 1998), S. 336
24
Vgl. (Biermann 1985), S. 187
2+ Unternehmen
Langfristigkeit
Sicherung von
Wettbewerbs-
vorteilen
Erreichung von
Topmanagement-
Zielen
Strategische
Partnerschaft
Gemeinsame Unter-
nehmenstätigkeiten
Proaktivität, Ra-
tionalität, Selekti-
vität, Komplexität
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
19
notwendig sind und durch Unternehmen mit dem primären Zweck der Dienst-
leistungserstellung erbracht werden. Das Spektrum logistischer Dienstleistun-
gen reicht von der reinen Transportleistung über wertsteigernde Dienstleistun-
gen bis zur komplexen Prozeßverantwortung und Gestaltung von globalen
Netzwerken. Abnehmer logistischer Dienstleistungen können sowohl Privat-
kunden als auch Unternehmen und Unternehmensnetzwerke sein.
25
Ein Luftfrachttransport muß nicht auf den Transport von Flughafen zu Flugha-
fen beschränkt sein. Häufig gibt der Versender die zu transportierenden Güter
nicht direkt am Abgangsflughafen ab bzw. der Empfänger holt sie nicht am
Empfangsflughafen ab. Ein direkter Haus-Haus-Verkehr per Flugzeug dürfte in
den wenigsten Fällen möglich sein. Solche Transporte werden mit Vor- und
Nachlauf per LKW abgeholt beziehungsweise zugestellt. Daraus ergibt sich
eine Transportkette. Auf die Luftfrachttransportkette wird in Abschnitt 4.3 näher
eingegangen. Das Hauptinteresse der Transportbeteiligten an der Luftfracht
liegt in der schellen und sicheren Überbrückung langer Distanzen. Dabei wird
durch Luftfrachtersatzverkehre (LEV) mit dem LKW und vereinzelt auch mit
der Bahn vermehrt das Flugzeug mit der Absicht der Gesamtoptimierung der
Kette ersetzt.
26
Im Rahmen dieser Arbeit werden Transportketten betrachtet, in
denen mindestens eine Teilstrecke des Gesamttransportes per Flugzeug oder
LEV ausgeführt wird.
Ein Luftfrachttransport kann als Kuppelprodukt von Passagierflügen im Unter-
flurbereich als so genannter ,,Belly-Transport"
27
durchgeführt werden. Da-
bei werden die Freiräume unterhalb des Passagierdecks für Fracht genutzt.
Fracht kann bei Combi-Flugzeugen auch in abgetrennten Abschnitten des
Passagierdecks oder mittels reiner Frachtflugzeuge befördert werden. Der
Fluggeräteeinsatz ist vom Transportaufkommen auf der jeweiligen Relation
abhängig. Kombinierte Passagier-Fracht-Flugzeuge bedienen in der Regel die
aufkommensschwächeren Relationen. Dabei wurden 1997 53% des flugplan-
mäßigen Weltluftfrachtaufkommens als Belly-Fracht auf Passagierflügen be-
fördert.
28
25
Vgl. (Baumgarten 2000), S. 1-15
26
Der LEV per LKW betrifft ausschließlich Kontinentalverkehre. Im Europa-Asienverkehr wur-
den kombinierte Verkehrslösungen per Schiff und Flugzeug (z.B. Umschlag in Abu Dhabi)
entwickelt (vergleiche Abschnitt 5.4.2)
27
(Schüller 2003), S. 7
28
Vgl. (Bjelcic 2001), S. 7
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
20
Luftfrachttransporte können von Linien- oder Charterfluggesellschaften ausge-
führt werden.
29
Linienflugverkehr ist in diesem Sinne eine ,,öffentliche,
zwischen bestimmten Flugplätzen eingerichtete, regelmäßige Flugverbindung
für Personen, Fracht und Post, für die dem Luftfahrtunternehmen eine
Liniengenehmigung oder eine Genehmigung für Bedarfsluftverkehr nach
festen Abflugzeiten erteilt wurde."
30
Im Gegensatz dazu erfolgt der Charterflugverkehr unregelmäßig und nur nach
Bedarf. Supply-Chain-Management-Konzepte basieren auf der Planbarkeit
und Vorhersagbarkeit der involvierten Prozesse und widersprechen somit dem
grundsätzlichen Gedanken des Charterflugverkehrs. Das Hauptaugenmerk
dieser Arbeit liegt auf dem Linienverkehr. Die Erkenntnisse können jedoch in
Teilen auf den Charterverkehr übertragen werden.
2.4
Marktumfeld der Luftfracht
Das Marktumfeld der Luftfracht kann als komplex bezeichnet werden. Histo-
risch gewachsene Strukturen beeinflussen noch heute das legislative und or-
ganisatorische Umfeld der Luftfracht. Die Preisbildung des Produktes ,,Luft-
fracht" erfolgt unter Einbeziehung einer Vielzahl von Faktoren, während die
Dienstleister danach streben, ihre Produkte durch weitere Dienstleistungen zu
differenzieren. Auch technische und infrastrukturelle Faktoren sind bei der
Dienstleistungserstellung zu beachten. In diesem Abschnitt wird auf die ver-
schiedenen Aspekte näher eingegangen.
Der europäische Luftverkehr unterlag ursprünglich einer besonders strengen
Regulierung und wurde erst Ende der siebziger Jahre, dem Trend der USA
folgend, schrittweise liberalisiert. Als eigentlicher Anstoß zur Deregulierung
des europäischen Flugverkehrs gilt das Urteil des EuGH vom 22.05.1985 zur
Dienstleistungsfreiheit in Europa. Schrittweise wurden legislative sowie organi-
satorische Hürden abgebaut. Im Liberalisierungsprozeß spielte die IATA als
Vertreter der Luftverkehrsgesellschaften und treibende Kraft eine tragende
Rolle. Die IATA (,,International Air Transportation Association") wurde 1945
von den Fluggesellschaften vieler Länder gegründet. Sie hat die Funktion der
ehemaligen ,,International Air Traffic Association" übernommen, die 1919 in
Den Haag zu Beginn des planmäßigen Luftverkehrs ins Leben gerufen worden
29
Vgl. (Pfohl 1990a), S. 245
30
(Flughafen Stuttgart GmbH 2003), S. 46
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
21
war. Die Mitgliedschaft in der IATA ist freiwillig und steht allen Gesellschaften
offen, die von einem Staat, der für die Mitgliedschaft in der ICAO (,,Internatio-
nal Civil Aviation Organisation", Teilorganisation der UN) wählbar ist, zum
planmäßigen internationalen Luftverkehr zugelassen wurden. Hauptziel der
IATA ist, sicherzustellen, daß sich der Luftverkehr sicher, schnell und mit
höchster Effizienz zum wirtschaftlichen Nutzen der Fluggesellschaften und der
Öffentlichkeit abwickelt. Dabei ist insbesondere die Zulassung mehrerer Airli-
nes im grenzüberschreitenden Verkehr, eine Änderung des Akkreditierungs-
rechtes für Niederlassungen von IATA-Luftfrachtspeditionen in anderen euro-
päischen Ländern sowie die Freigabe der Frachtraten zu nennen.
31
Nach der
Gestattung der Kabotageverkehre
32
1997 erfolgte die stufenweise Deregulie-
rung der Bodenverkehrsdienste, die Ende 2003 mit dem Auslaufen des Flug-
hafenabfertigungsmonopols endete.
Auf den deutschen Flughäfen wurden in 2002 insgesamt 2.197.445 Tonnen
Luftfrachtgüter abgefertigt. Diese Menge verteilt sich nahezu gleich auf Impor-
te und Exporte. Nur eine kleine Menge (77.312 Tonnen) wurde innerdeutsch
per Flugzeug transportiert, wobei es sich zum überwiegenden Teil um An-
schlußfrachten handelte. Weltweit wurden im Jahr 2000 täglich durchschnitt-
lich 118.200 Tonnen Waren per Luftfracht befördert.
33
Der Luftfrachtmarkt ist stark fragmentiert.
34
Fusionen zwischen internationalen
Fluglinien sind trotz Deregulierung in vielen Bereichen immer noch durch ge-
setzliche Verbote von Mehrheitsbeteiligungen von ausländischen Unterneh-
men in fast allen Ländern der Welt behindert. Tabelle 1 verdeutlicht die Zer-
splitterung und gibt die Marktanteile der 20 größten Fluglinien im Luftfrachtbe-
reich an.
31
Vgl. (Becker 1999), S.20f.
32
Ein Kabotageverkehr ist eine Transportdienstleistung, deren Start- und Endpunkt nicht im
Heimatland des durchführenden Dienstleisters liegen.
33
Vgl. (Statistisches Bundesamt 2003)
34
Vgl. (Taverna 2002), S. 52
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
22
Tabelle 1: Marktanteile Luftfracht
35
Durch die Bildung von strategischen Alli-
anzen versuchen einige Fluglinien, ähn-
lich wie im Passagierbereich, trotz Fusi-
onsverbot Synergieeffekte zu erzielen.
Dabei bündelte die Allianz WOW, hervor-
gegangen aus der Passagierverkehr-
Allianz Star Alliance, in 2003 trotzdem nur
einen Marktanteil von 20,3%.
Die anhaltende Steigerung des Welthan-
dels sowie die Einführung von Just-in-
Time-Prozessen in produzierenden Un-
ternehmen führen zu einer positiven Er-
wartungshaltung zur Entwicklung des
Luftfrachtmarktes der kommenden Jahre.
Der Abbau von Welthandelsschranken
wie zum Beispiel der Beitritt der Volksrepublik China in die World Trade Orga-
nisation (WTO) wird zu einer Steigerung des globalen Luftfrachtaufkommens
führen. Volkswirtschaftlich betrachtet führt die Erhöhung der allgemeinen Le-
bensstandards durch den erleichterten Handel zu einer Steigerung des ver-
fügbaren Einkommens und somit einer gesteigerten Nachfrage nach inländi-
schen Waren sowie Importgütern. Gleichzeitig werden Unternehmen globaler
Konkurrenz ausgesetzt und zur Optimierung ihrer Produktionsprozesse ge-
zwungen.
36
Dies führt zur Verlagerung von Produktionsstandorten in Niedrig-
lohnländer sowie zur Aufteilung von Produktionsprozessen über verschiedene
Standorte, um deren spezifische Standortvorteile ausnutzen zu können. In
2003 wurden zwei Drittel aller Güter, die grenzüberschreitend mit Luftfracht
befördert worden sind, zwischen Unternehmen in Zulieferbeziehungen oder
innerhalb desselben Unternehmens ausgetauscht.
37
Mit der durch die Verlage-
rung der Produktion gesteigerten Entfernung des Produktionsstandortes vom
Verbrauchsstandort ergibt sich eine weitere Steigerung des Transportaufkom-
35
Quelle: (Baumgart 2003), S. 13
36
Vgl. (Airbus S.A.S. 2002), S. 47
37
Vgl. (Keane 2003), S. 1
Fluglinie
Marktanteil 2003
Lufthansa
8,0%
Singapore Airlines
6,5%
Korean Airlines
5,9%
Air France
5,2%
FedEx 4,9%
British Airways
4,4%
Cathay Pacific
4,3%
KLM 4,3%
JAL 4,3%
Cargolux 4,2%
UPS
2,6%
United Airlines
2,5%
American Airlines
2,5%
Northwest 2,3%
Nippon Cargo
2,2%
Swissair 1,8%
Thai Airways
1,8%
Alitalia 1,7%
Emirates 1,7%
Malaysian Airlines
1,6%
sonstige 27,3%
E
INFÜHRUNG IN DIE GRUNDLEGENDEN
K
ONZEPTE DER
A
RBEIT
23
mens.
38
Obwohl die Einflüsse der Anschläge in New York im September 2001
immer noch die Nachfrage nach Luftfrachtkapazität drücken, geht Airbus von
einer Verdreifachung der Fracht-Tonnenkilometer auf Basis 2001 bis 2021
aus. Dies würde einer jährlichen Steigerung von 5,5% entsprechen. Dabei wird
das Aufkommen auf den Verbindungsstrecken von Europa und Nordamerika
mit Asien am stärksten steigen.
39
Die im Passagierbereich stark expandierenden No-Frills-Carrier
40
haben bisher
keinen direkten Einfluß auf den Luftfrachtmarkt.
41
Diese Unternehmen fokus-
sieren ihre Leistungen auf die für Luftfracht weniger attraktiven Regional- und
Kontinentalverbindungen sowie auf Nebenstrecken. Zudem ist das Konzept,
für geringere Preise auf Flexibilität oder Komfort zu verzichten, schwer auf die
Luftfracht zu übertragen. Hier sind die Versender und Empfänger bereit, für
zuverlässigen, schnellen und sicheren Service höhere Preise zu zahlen und
sehen dies als Mehrwert an. Indirekt führte der Nachfragerückgang bei den
Fracht- und Passagierfluglinien zu einer Reduktion der angebotenen Flüge
und somit zu einer Verknappung der Belly-Kapazität.
42
Passagierverkehre erfolgen im Gegensatz zu Frachtverkehren grundsätzlich
symmetrisch. Das bedeutet, es wird ein Hin- und Rückflug durch denselben
Passagier vorgenommen. Ausnahmen bestehen in Falle von Gabelflügen, der
Rückkehr zum Ausgangspunkt mit einem anderen Verkehrsmittel oder einem
Verbleib am Zielort im Falle von Auswanderung und ähnlichem. Dies ist im
Frachtverkehr grundsätzlich anders, sofern nicht Rohstoffe zur Weiterbearbei-
tung oder Güter zur Veredelung zum anschließenden Export per Luftfracht
zum ursprünglichen Versender zurück transportiert werden. Damit ergeben
sich Schwierigkeiten der Kapazitätsauslastung auf bestimmten Routen wie
z.B. im Südostasien-Europaverkehr, der von einem starken Frachtaufkommen
nach Europa gekennzeichnet ist, während das Aufkommen auf den Transat-
lantikrouten nahezu ausgeglichen ist.
43
38
Vgl. (Chazin 2003), S. 4
39
Vgl. (Airbus S.A.S. 2002), S. 47
40
No-frills-carrier: Engl. für Fluggesellschaften, die nur die Transportleistung (Sitz), aber keine
weiteren Services wie Bonusprogramme, Mahlzeiten oder Sitzplatzreservierungen anbieten.
41
Vgl. (Leeuwen und Polycarpou 2004), S. 14
42
Vgl. (O'Reilly 2003), o.S.
43
Vgl. (Becker 1999), S. 30
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832482442
- ISBN (Paperback)
- 9783838682440
- DOI
- 10.3239/9783832482442
- Dateigröße
- 877 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Berlin – Wirtschaft und Management
- Erscheinungsdatum
- 2004 (September)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- supply chain management strategische partnerschaft luftfracht vertikale logisitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de