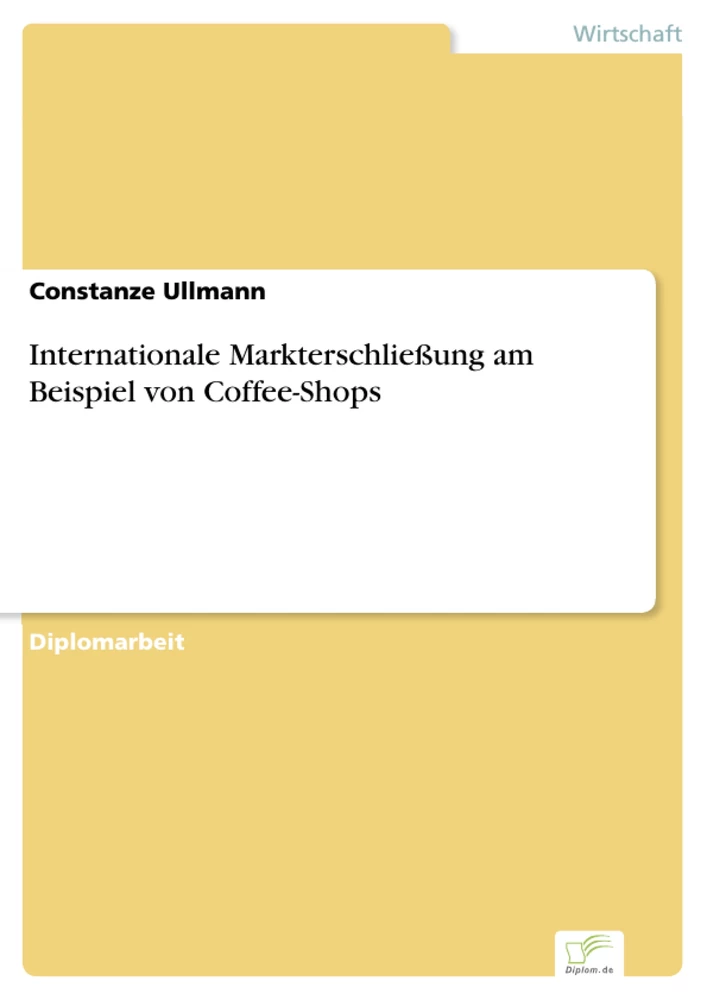Internationale Markterschließung am Beispiel von Coffee-Shops
©2004
Diplomarbeit
139 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Internationalisierung und den Veränderungen im Konsumentenverhalten ergibt sich das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit, bei dem es gilt herauszufinden, wie internationale Coffee-Shops mit diesen Herausforderungen umgehen, und in welcher Form sich Coffee-Shop Unternehmen internationale Märkte erschließen. Der zentrale Fokus soll darin liegen, mögliche Markterschließungsstrategien hinsichtlich der Entscheidungsfelder Marktwahl, Markteintrittsform und Marktbearbeitung aufzuzeigen und anhand von Beispielen aus der Praxis die Umsetzung darzustellen. Der deutsche Coffee-Shop Markt ist noch jung, und die Presse beleuchtet nahezu ausschließlich den nationalen Markt mit einem Fokus auf operative Elemente zum Betreiben einer Kaffeebar.
Die vorliegende Arbeit setzt sich inhaltlich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Zur Bearbeitung der Fragestellung wurden zum einen Expertengespräche mit Vertretern internationaler Coffee-Shops über ihre Markterschließungsstrategien durchgeführt. Zum anderen wurden im Rahmen einer schriftlichen Befragung die Hinderungsgründe national tätiger Coffee-Shops in Deutschland ermittelt (Transkripte der Expertengespräche, Fragebögen und Auswertung, siehe Anhang).
In Kapitel 2 wird zunächst eine Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes durchgeführt. Relevante Ländermärkte werden ebenso beleuchtet wie einige international tätige Unternehmen. Hierbei wird in Abschnitt 2.3 auch auf die Problematik nationaler Coffee-Shop Unternehmen bei einer Internationalisierung eingegangen. Ziel der dazu durchgeführten Befragung in Deutschland war die Analyse einzelner Motive bei der Entscheidungsfindung für eine Internationalisierung und möglicher Hinderungsgründe für eine Internationalisierung.
In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen einer internationalen Markterschließungsstrategie erläutert. Dazu werden zunächst die Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl dargestellt, die zur Selektion geeigneter Ländermärkte beitragen. Den zentralen Bestandteil dieses Kapitels bildet die Darstellung verschiedener Markteintrittsformen, die für Coffee-Shops relevant sein können. Abgerundet wird der theoretische Teil durch die Darstellung möglicher Marktbearbeitungsstrategien. Die in Wissenschaft und Praxis häufig diskutierte Frage Standardisierung vs. Differenzierung wird am Ende dieses Kapitels ebenso mit in die […]
Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Internationalisierung und den Veränderungen im Konsumentenverhalten ergibt sich das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit, bei dem es gilt herauszufinden, wie internationale Coffee-Shops mit diesen Herausforderungen umgehen, und in welcher Form sich Coffee-Shop Unternehmen internationale Märkte erschließen. Der zentrale Fokus soll darin liegen, mögliche Markterschließungsstrategien hinsichtlich der Entscheidungsfelder Marktwahl, Markteintrittsform und Marktbearbeitung aufzuzeigen und anhand von Beispielen aus der Praxis die Umsetzung darzustellen. Der deutsche Coffee-Shop Markt ist noch jung, und die Presse beleuchtet nahezu ausschließlich den nationalen Markt mit einem Fokus auf operative Elemente zum Betreiben einer Kaffeebar.
Die vorliegende Arbeit setzt sich inhaltlich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Zur Bearbeitung der Fragestellung wurden zum einen Expertengespräche mit Vertretern internationaler Coffee-Shops über ihre Markterschließungsstrategien durchgeführt. Zum anderen wurden im Rahmen einer schriftlichen Befragung die Hinderungsgründe national tätiger Coffee-Shops in Deutschland ermittelt (Transkripte der Expertengespräche, Fragebögen und Auswertung, siehe Anhang).
In Kapitel 2 wird zunächst eine Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes durchgeführt. Relevante Ländermärkte werden ebenso beleuchtet wie einige international tätige Unternehmen. Hierbei wird in Abschnitt 2.3 auch auf die Problematik nationaler Coffee-Shop Unternehmen bei einer Internationalisierung eingegangen. Ziel der dazu durchgeführten Befragung in Deutschland war die Analyse einzelner Motive bei der Entscheidungsfindung für eine Internationalisierung und möglicher Hinderungsgründe für eine Internationalisierung.
In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen einer internationalen Markterschließungsstrategie erläutert. Dazu werden zunächst die Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl dargestellt, die zur Selektion geeigneter Ländermärkte beitragen. Den zentralen Bestandteil dieses Kapitels bildet die Darstellung verschiedener Markteintrittsformen, die für Coffee-Shops relevant sein können. Abgerundet wird der theoretische Teil durch die Darstellung möglicher Marktbearbeitungsstrategien. Die in Wissenschaft und Praxis häufig diskutierte Frage Standardisierung vs. Differenzierung wird am Ende dieses Kapitels ebenso mit in die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8223
Ullmann, Constanze: Internationale Markterschließung am Beispiel von Coffee-Shops
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Fachhochschule Wiesbaden, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Glossar ... IV
Tabellenverzeichnis ... VI
Abbildungsverzeichnis ...VII
1
Einleitung und Problemstellung ...1
2
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes ...6
2.1
Entwicklung und Ausgestaltungsformen der Coffee-Shops ...6
2.1.1
Die Geschichte der Coffee-Shops...6
2.1.2
Italienische vs. anglo-amerikanische Coffee-Shop Konzepte ...8
2.1.3
Der Coffee-Shop als Third Place-- ...9
2.2
Allgemeine weltweite Marktsituation...11
2.2.1
Marktsituation in relevanten Ländern...11
2.2.2
Der deutsche Coffee-Shop Markt ...14
2.2.3
Relevante internationale Marktteilnehmer...15
2.3
Status quo der Internationalisierung deutscher Coffee-Shops ...17
2.3.1
Motive der Internationalisierung ...18
2.3.2
Hinderungsgründe bei der Internationalisierung ...19
3
Theoretische Grundlagen der Markterschließungsstrategien...20
3.1
Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl ...20
3.1.1
Umweltbezogene Einflussfaktoren ...20
3.1.2 Unternehmensbezogene Einflussfaktoren...22
3.2
Formen des Markteintritts...23
3.2.1
Lizenzvergabe ...23
3.2.2
Franchising...24
3.2.3
Joint Venture...25
3.2.4
Direktinvestitionen...26
3.2.5
Die Wahl der geeigneten Markteintrittsstrategie ...28
3.3
Timing des internationalen Markteintritts ...29
3.4
Internationale Marktbearbeitungsstrategien ...30
3.4.1
Internationale Marketing-Mix-Strategie ...31
3.4.2
Standardisierung vs. Differenzierung ...33
II
Inhaltsverzeichnis
4
Markterschließungsstrategien internationaler Coffee-Shops...35
4.1
Die internationale Markterschließung von Costa Coffee ...36
4.1.1
Unternehmensdarstellung ...36
4.1.2
Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl ...36
4.1.4
Timing des Markteintritts ...38
4.1.5
Marktbearbeitungsstrategie...38
4.2
Die internationale Markterschließung von Segafredo Zanetti Espresso42
4.2.1
Unternehmensdarstellung ...42
4.2.2
Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl ...43
4.2.3
Markteintrittsstrategie ...44
4.2.4
Timing des Markteintritts ...45
4.2.5
Marktbearbeitungsstrategie...45
4.3
Die internationale Markterschließung von Starbucks...48
4.3.1
Unternehmensdarstellung ...48
4.3.2
Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl ...49
4.3.3
Markteintrittsstrategien ...50
4.3.4
Timing des Markteintritts ...52
4.3.5
Marktbearbeitungsstrategie...53
5
Zusammenfassung und Ausblick...58
ANHANG
Die Tabellen ...62
Die Abbildungen ...74
Die Fragebögen ...83
Hinweise zu den Fragebögen ...83
Verwendeter Fragebogen ...84
Die Expertengespräche...88
Hinweise zu den Expertengesprächen ...88
Transkript Costa Coffee 05.03.2004...89
Transkript Segafredo Zanetti 15.03.2004 ...99
Transkript Nannini 16.03.2004 ...110
Transkript Cup&Cino 03.04.2004 ...116
Transkript Costa Coffee 08.04.2004...118
6
Literaturverzeichnis ...121
III
Glossar
Glossar
Barista
Beverage
Bundling
Corporate Identity
Espresso
Ethnozentrisch
Fast-Food
Flagshipstore
Food
Geozentrisch
Grande
Latte Macchiato
Location
Menueboard
Opinion Leader
[ital.] Barkeeper, hier: Facharbeiter an der Espressomaschine
[engl.] Getränk
[engl.] Bündelung, hier: Zusammenstellung von meistens
einem Getränk mit einem Snack.
[engl.] Unternehmensidentität
[ital.] starker Kaffee nach italienischer Art
Bei einer ethnozentrischen Orientierung des Managements
handelt es sich um die begrenzte Fähigkeit des
Unternehmens, sich auf länderspezifische Besonderheiten
einzustellen.
[engl.] schnelles Essen
hier verwendet als großer Coffee-Shop, meist in stark
frequentierter Lage
[engl.] Nahrung, Essen, Verpflegung
Globale Orientierung am Weltmarkt ohne Berücksichtigung
nationaler Bedürfnisse
[ital.] groß
[ital.] Kaffee mit Milch
[engl.] Standort
[engl.] Speisekarte, in diesem Kontext die Angebotstafel, die
im Store hinter der Theke hängt
[engl.] Meinungsführer, Mitglieder einer sozialen Gruppe, die
für den Meinungsbildungsprozess eine besondere Stellung
einnehmen.
IV
Glossar
Outlet
[engl.] Verkaufsstelle
Polyzentrisch
Bei einer polyzentrischen Orientierung des Managements
werden die Auslandsmärkte differenziert und mit Fokus auf
den nationalen Markt bearbeitet.
SMS
Short Message Service
Store
[engl.] Laden, Geschäft
Tall Latte
latte-- = [ital.] Milch, tall-- = [engl.] groß
To-go
[engl.] zum Mitnehmen
UK
United Kingdom
Units
[engl.] Einheiten, in diesem Zusammenhang synonym für
Outlets oder Coffee-Shops
V
Tabellenverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 03:
Größte Fast-Food-Ketten im Mittleren Osten...64
Tabelle 04:
Top 15: Coffee-Shops in Deutschland 2003...65
Tabelle 05:
Die Bedeutung verschiedener Internationalisierungsmotive
für produzentenorientierte Dienstleistungsunternehmen ...66
Tabelle 07:
Internationalisierungsmotive deutscher Coffee-Shops ...68
...68
Tabelle 08:
Hinderungsgründe deutscher Coffee-Shops
Tabelle 09:
Starbucks Tall-Latte Index und McDonald`s Big-Mäc Index
(Über-/unterbewerte Währungen im Vergleich zum US-Dollar
Tabelle 10:
Vor- und Nachteile der Standardisierung ...70
Tabelle 11:
Zeitliche Reihenfolge der Markterschließung von
Segafredo Zanetti Espresso (ausgewählte Städte) ...71
Tabelle 12:
Starbucks: Internationale Markeintrittsformen und Partner ...72
...73
Tabelle 13:
Starbucks-Partner in Europa
Tabelle 01:
Produktsortiment im Foodbereich: italienische vs.
anglo-amerikanische Konzepte...62
Tabelle 02:
Pro-Kopf-Verbrauch von Rohkaffee in ausgewählten
Ländern 2002 ...63
Tabelle 06:
Allgemeine Fragen zur Geschäftstätigkeit und der Markt-
situation in Deutschland ...67
in %) ...69
VI
Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 04a:
Zeitliche Markteintrittsstrategien - Wasserfall-Strategie...77
Abbildung 04b:
Zeitliche Markteintrittsstrategien - Sprinkler-Strategie ...77
Abbildung 04c:
Zeitliche Markteintrittsstrategien - Kombinierte-Strategie...78
Abbildung 05:
Standardisierungspotenzial der Kerndienstleistung und
des sonstigen Marketing-Mix in
Dienstleistungsunternehmen ...79
Abbildung 07:
Franchisepartner Segafredo Zanetti Espresso...81
Abbildung 08:
Kombinierte Strategie am Beispiel der Markterschließung
von Starbucks in Asien ...82
Abbildung 01:
Regionale Verteilung ausgewählter Coffee-Shop Ketten
in Deutschland ...74
Abbildung 02:
Typologisierung internationaler Dienstleistungen auf
Basis konstitutiver Dienstleistungsmerkmale ...75
Abbildung 03:
Übersicht der Bestimmungsfaktoren der
Markteintrittsstrategie ...76
Abbildung 06:
Normstrategien internationaler
Dienstleistungskooperationen ...80
Abbildung 09:
Kombinierte Strategie am Beispiel der Markterschließung
von Starbucks in Europa ...82
VII
Einleitung und Problemstellung
1
Einleitung und Problemstellung
In nahezu allen internationalen Großstädten sprießen Coffee-Shops wie Pilze aus
dem Boden und gehören mittlerweile zum Stadtbild der Metropolen. Auch auf die
kleineren Städte scheint sich dieser Trend aus den USA nach und nach zu übertra-
gen. Die Frage stellt sich, wie diese internationale Markterschließung stattfindet?
Vorab ist zu erwähnen, dass veränderte soziale Normen
1
dazu beitragen, dass dem
Außer-Haus-Verzehr eine neue Bedeutung zukommt. Die gewohnten Riten, wie
das gemeinsame Essen mit der Familie, verlieren an Bedeutung.
2
Der Trend geht
in Richtung Multi-Event-Konsum--, die Aneinanderreihung flüchtiger, wechseln-
der und ständig neuer Konsumbedürfnisse.
3
Das Entweder-Oder-- ist in der Kon-
sumhaltung von dem Sowohl-als-Auch-- abgelöst worden. Mit der Masse der
Freizeit- und Produktangebote wächst die Entscheidungsnot beim Konsumenten;
eine Multioptionalität-- entsteht.
4
Diese Trends sind nicht nur für den deutschen
Markt, sondern auf einer internationalen Ebene zu beobachten. Vorreiter für den
Fast Food- und den Fast Casual-Trend
5
- eine Symbiose aus der Produktivität der
Fast-Food Anbieter mit der Tradition klassischer Restaurants - ist seit einigen Jah-
ren die USA.
6
Dass auch Konsum Zeit kostet, dringt allmählich ins Bewusstsein der Verbraucher
vor. Mit wachsenden Konsumansprüchen der Gesellschaft nimmt die Zeitknapp-
heit zu und bei den Konsumenten entsteht ein subjektiv empfundener Zeitmangel.
Die Trendforscherin Faith Popcorn konstatiert, dass heutzutage kaum ein Erwach-
sener nicht das Gefühl hat, 99 Leben zu leben.
7
Die Lebensqualität eines jeden
Einzelnen soll durch den Trend zu mehr Convenience
8
(engl. Bequemlichkeit)
steigen. Wachsende Spontaneität gepaart mit einer Tendenz zum geselligen
Cocooning--
9
(engl. Zurückziehen in die eigenen vier Wände) unterstützt den
1
z.B. die Individualisierung-- und die Singelisierung--
2
Gruenewald (2003), S. 1
3
vgl. o.V. (2002c) Coffee-Shop Welten 2002, S. 34
4
vgl. o.V. (2004) Die Marketing Zukunft, http://www.deinflyer.de/modules.php?
name=News&file=article&sid=55 (13.04.04)
5
vgl. Rützler, H. (2003)http://www.zukunftsinstitut.de/1/Down_Print_Besprechung/
LZSpezial.pdf (02.04.04)
6
vgl. o.V. (2004g) Zahlen, die neidisch machen, S. 14
7
vgl. Popcorn (1991), S. 78ff und o.V. (2002c)Coffee Shop Welten 2002, S. 27
8
Convenience-- steht hier für eine Stressvermeidung in allen Lebenslagen.
9
vgl. Popcorn (1991), S. 7
1
Einleitung und Problemstellung
Convencience Trend. Coffee-Shops übernehmen dabei die Funktion halböffentli-
cher Orte (Third Places)
10
. Sie dienen zunehmend als ausgelagerte Wohnzimmer,
bieten aber auch die Möglichkeit des spontanen und schnellen Verzehrs. Spontan-
genuss wird für viele Konsumenten immer wichtiger und geht einher mit einer
steigenden Mobilität der Verbraucher. Diesem geänderten Verbraucherverhalten
kommen die Coffee-Shops entgegen. Neben zahlreichen Distributoren von Im-
pulsartikeln (Tankstellen, Bäckereien etc.) ist auch der Besuch eines Coffee-
Shops als Impulskauf zu bewerten und nicht als geplantes Einzel-Event (wie z.B.
der Restaurantbesuch). Der Coffee-to-go Anteil liegt in Deutschland bei 25 % mit
steigender Tendenz.
11
In den USA oder auch in London werden bereits 90 Pro-
zent des systemgastronomischen Kaffeegeschäfts mit tragbaren Bechern abgewi-
ckelt [...]--.
12
Nicht nur in Großbritannien und den USA, sondern nahezu auf allen
Kontinenten breiten-- sich die Coffee-Shops aus. Selbst Teetrinker-Nationen wie
China, Japan und Großbritannien partizipieren an der Kaffeebarkultur.
Neben den Änderungen im Konsumentenverhalten zählt die Internationalisierung
von Unternehmen zu den signifikantesten Entwicklungen im letzten Jahrhundert.
Der Begriff der Internationalisierung ist in der Literatur jedoch nicht eindeutig de-
finiert und findet auf unterschiedliche Phänomene Anwendung. So werden unter
dieser Definition z.B. Formen des Markteintritts oder die Führung ausländischer
Tochtergesellschaften verstanden. Des Weiteren werden Einschränkungen hin-
sichtlich verschiedener Funktionsbereiche (hauptsächlich des Marketings) vorge-
nommen, die jedoch zu eng sind, da eine Internationalisierung das Unternehmen
als Ganzes umfasst.
13
Nach einer Abgrenzung von Köhler werden Bei internati-
onalem Engagement [...]die Leistungen eines Unternehmens in mehr als einem
Land angeboten.
14
Für die vorliegende Arbeit soll jedoch in Anlehnung an Perlitz
unter Internationalisierung die länderübergreifende Ausdehnung des unterneh-
merischen Aktionsfeldes verstanden werden.--
15
Um eine Internationalisierung zu
erreichen und konsequent auszuweiten, sind konsistente Markterschließungsstra-
tegien notwendig. Nach Ausführungen von Pues ist unter dem Terminus Markter-
schließung neben dem Eintritt eines Unternehmens in einen bislang noch nicht
10
vgl. Kapitel 2.1.3
11
vgl. o.V. (2003b) G+J-Märkte + Tendenzen Kaffee, S.3
12
Nixdorf, A. (2003), S. 48
13
vgl. Perlitz, M. (2000), S. 8ff
14
Köhler, L. (1991), S. 52
15
Perlitz, M. (2000), S. 10
2
Einleitung und Problemstellung
bearbeiteten Markt auch die Bearbeitung desselben, unter Fortführung bestehen-
der Aktivitäten, zu verstehen.
16
Sie ist somit durch zwei Charakteristika gegen-
über der Markteintrittsstrategie und der Marktbearbeitungsstrategie abgegrenzt:
die zeitlich umfassendere Betrachtungsweise [...] sowie die Berücksichtigung
[...] des Marktumfeldes.--
17
Der Begriff internationale Markterschließung wird im
folgenden verwendet als Eintritt eines Unternehmens in einen noch nicht er-
schlossenen Auslandsmarkt-- und beinhaltet die strategischen Entscheidungsfelder
Marktwahl (Selektion geeigneter Auslandsmärkte), die Form des Markteintritts
(Markteintrittsstrategie) und die Marktbearbeitungsstrategie. An diesen drei Kern-
elementen der Markterschließung orientieren sich die Darstellungen im theoreti-
schen Teil der vorliegenden Arbeit.
Zur dauerhaften Verbesserung der Wettbewerbssituation, und der damit verbun-
denen Sicherung der Unternehmensexistenz, ist sowohl für international tätige, als
auch für national agierende Unternehmen eine permanente Überprüfung des aktu-
ellen und potentiellen Auslandsengagements zielgerichtet. Für die Unternehmen
ist deshalb eine integrierte, strategische Konzeption unter Berücksichtigung um-
welt- und unternehmensbezogener Rahmenbedingungen nahezu unerlässlich. Zum
anderen ist die Festlegung einer konsistenten Strategie zur internationalen Markt-
erschließung ein zentraler Erfolgsfaktor für das Auslandsengagement. Hierbei
dürfen die internationalen Strategien nicht nur auf den Marketingbereich be-
schränkt bleiben, da mit der Entscheidung zum Going international--
18
eine prin-
zipielle Änderung für das Unternehmen und das Management eintritt (Änderung
der Organisation, der Abläufe etc.).
Hauptmotive für eine Internationalisierung liegen in der Sättigung des Heimat-
marktes, dem Wachstumspotenzial anderer internationaler Märkte, einer zuneh-
menden Mobilität der Konsumenten und einer Angleichung der weltweiten Kon-
sumentenbedürfnisse. Des Weiteren sind die neuen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, die Deregulierung der Märkte, die EU-Erweiterung, die
Risikostreuung und Erzielung zusätzlicher Gewinne generelle Gründe für eine in-
ternationale Expansion. Unternehmensspezifische Fähigkeiten und Kompetenzen
können mehrfach genutzt werden (Synergie) und eventuell ist eine Verlängerung
16
vgl. Pues, C. (1994), S. 31ff
17
Pues, C. (1994), S. 34
18
vgl. Backhaus/Büschken/Voeth (2001), S. 115ff
3
Einleitung und Problemstellung
des Lebenszyklusses einheimischer Produkte und Dienstleistungen durch den
Transfer des Konzeptes in ausländische Märkte möglich. Trotz dieser Vorteile
müssen bei der Internationalisierung von Coffee-Shops zahlreiche kulturelle und
dienstleistungsbezogene Besonderheiten Berücksichtigung finden. Im Dienstleis-
tungskontext werden in der vorliegenden Arbeit insbesondere die Markteintritts-
und die Marktbearbeitungsstrategien diskutiert. Dienstleistungs-spezifika, auch als
konstitutive Merkmale von Dienstleistungen bezeichnet, bedingen im Rahmen der
Internationalisierung eine Vielzahl von Besonderheiten, die vor allem im Hinblick
auf die Gestaltung des internationalen Marketing-Mixes zu beachten sind. Beson-
derheit kommt dem Merkmal Intangibilität-- zu, das im Rahmen der Marktbear-
beitungsstrategie in ein Making the Service tangible-- münden soll.
19
Innerhalb der
Klassifikation von Coffee-Shops als Dienstleistungsunternehmen lassen sie sich in
den Bereich der Systemgastronomie
20
einordnen.
Der in dieser Arbeit verwendete Begriff des Coffee-Shops bezeichnet nur Syste-
me, die bereits über mehrere Verkaufsstellen verfügen und eine Multiplikation des
Konzepts auf nationaler bzw. internationaler Ebene erlauben. Das deutsche Syn-
onym Kaffeebar wird in den nachfolgenden Ausführungen gleichbedeutend für
den anglo-amerikanischen Begriff Coffee-Shop verwendet. Nicht berücksichtigt
werden kleine, in Distributionsstellen integrierte Kaffeeausschankstellen.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich das Forschungsinteresse der vorliegenden Ar-
beit, bei dem es gilt herauszufinden, wie internationale Coffee-Shops mit diesen
Herausforderungen umgehen, und in welcher Form sich Coffee-Shop Unterneh-
men internationale Märkte erschließen. Der zentrale Fokus soll darin liegen,
mögliche Markterschließungsstrategien hinsichtlich der
Entscheidungsfelder
Marktwahl, Markteintrittsform und Marktbearbeitung aufzuzeigen und anhand
von Beispielen aus der Praxis die Umsetzung darzustellen. Der deutsche Coffee-
Shop Markt ist noch jung, und die Presse beleuchtet nahezu ausschließlich den na-
tionalen Markt mit einem Fokus auf operative Elemente zum Betreiben einer Kaf-
feebar. Unternehmensstrategien werden hierbei nicht näher dargestellt. Das bei
der Erstellung dieser Arbeit gezeigte Interesse von Coffee-Shops und Journalisten
der Fachpresse bestätigt meine Einschätzungen.
19
vgl. Stauss, B. (2001), S. 565
20
vgl. Dettmer (2000), S. 2
4
Einleitung und Problemstellung
Die vorliegende Arbeit setzt sich inhaltlich aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil zusammen. Zur Bearbeitung der Fragestellung wurden zum einen
Expertengespräche mit Vertretern internationaler Coffee-Shops über ihre Markt-
erschließungsstrategien durchgeführt. Zum anderen wurden im Rahmen einer
schriftlichen Befragung die Hinderungsgründe national tätiger Coffee-Shops in
Deutschland ermittelt (Transkripte der Expertengespräche, Fragebögen und Aus-
wertung, siehe Anhang).
In Kapitel 2 wird zunächst eine Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop
Marktes durchgeführt. Relevante Ländermärkte werden ebenso beleuchtet wie ei-
nige international tätige Unternehmen. Hierbei wird in Abschnitt 2.3 auch auf die
Problematik nationaler Coffee-Shop Unternehmen bei einer Internationalisierung
eingegangen. Ziel der dazu durchgeführten Befragung in Deutschland war die
Analyse einzelner Motive bei der Entscheidungsfindung für eine Internationalisie-
rung und möglicher Hinderungsgründe für eine Internationalisierung.
In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen einer internationalen Markter-
schließungsstrategie erläutert. Dazu werden zunächst die Einflussfaktoren auf die
internationale Marktwahl dargestellt, die zur Selektion geeigneter Ländermärkte
beitragen. Den zentralen Bestandteil dieses Kapitels bildet die Darstellung ver-
schiedener Markteintrittsformen, die für Coffee-Shops relevant sein können. Ab-
gerundet wird der theoretische Teil durch die Darstellung möglicher Marktbear-
beitungsstrategien. Die in Wissenschaft und Praxis häufig diskutierte Frage
Standardisierung vs. Differenzierung-- wird am Ende dieses Kapitels ebenso mit
in die Überlegungen einbezogenen, wie die internationale Ausrichtung und Koor-
dination des klassischen Marketing-Mixes.
Drei Fallbeispiele internationaler Markterschließungen von Coffee-Shops werden
in Kapitel 4 in Bezug zu den theoretischen Ausführungen gesetzt. Zur Erstellung
von drei Unternehmensbeispielen wurden Expertengespräche in den deutschen
Tochtergesellschaften von Segafredo und Costa Coffee durchgeführt, die die In-
formationsgrundlage der Darstellung dieser Markterschließungsstrategien bilden.
Starbucks Coffee Company hat die Durchführung eines Expertengesprächs abge-
lehnt. Aufgrund der hohen Relevanz des Marktführers, wurden die notwendigen
Informationen in anderen Quellen recherchiert. Anschließend werden die Ergebnis-
se diskutiert und in den Untersuchungsrahmen der vorliegenden Arbeit eingeordnet.
5
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
2
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
2.1
Entwicklung und Ausgestaltungsformen der Coffee-Shops
2.1.1 Die Geschichte der Coffee-Shops
Die Geschichte der Kaffeehäuser, in denen man sich dem öffentlichen Genuss
des Getränks hingeben konnte--
21
, beginnt Anfang des 16. Jhds. in Arabien, sowie
Kleinasien, Syrien und Ägypten. Auf europäischem Boden eröffnete das erste
Kaffeehaus 1554 in Konstantinopel.
22
Von dort aus eroberte der Muntermacher
aus dem Orient--
23
Italien (1645 das erste Kaffeehaus in Venedig) und das restli-
che Europa.
24
In Deutschland entstand 1673 das erste Kaffeehaus in Bremen. Al-
lerdings konnten die deutschen Kaffeehäuser mit den literarischen Zirkeln von Pa-
ris und London nicht Schritt halten.
25
Später als in die anderen europäischen Met-
ropolen gelangte der Kaffee nach Wien. Die heute noch bekannte Wiener
Kaffeehaus-Tradition geht zurück auf das Jahr 1683, als die Türken die Stadt be-
lagerten.
26
Grund für die schnelle Ausbreitung und die Beliebtheit der Kaffeehäu-
ser im Mittleren Osten und Europa ist die Tatsache, dass es zuvor keine ähnlichen
Treffpunkte gab.
27
Auf amerikanischem Boden wurde 1658 das erste Kaffeehaus
im heutigen New York eröffnet.
28
In allen großen Städten der USA etablierten
sich während der 1920er-Jahre, aufgrund der Prohibition und des weit verbreiteten
Wunsches nach Geselligkeit, Kaffeehäuser.
29
Bereits um 1700 erlebte die Kaffee-
hauskultur in London ihren Höhepunkt, als man in den 2000 Kaffeehäusern, die
damals als Penny Universities-- bekannt wurden, für diesen Preis eine Tasse Kaf-
fee bekam und dabei stundenlang außergewöhnlichen Unterhaltungen zuhören
konnte.
30
In Asien konnte sich die Kaffeehauskultur erst später als in Europa
21
vgl. o.V. (o.J.): Kaffeewissen, http://www.kaffeeverband.de/393.htm (13.02.04)
22
vgl. Rosenblatt/Meyer/Beckmann (2003), S. 17ff
23
Rosenblatt/Meyer/Beckmann (2003), S. 18
24
1652 eröffnete das erste Kaffeehaus in London, 1659 folgte ein weiteres in Marseille und 1666
eröffnete das erste Kaffeehaus in Paris. Vgl. o.V. http://www.kaffeeverband.de/393.htm (13.02.04)
25
vgl. o.V. (o.J.): Kaffeewissen, http://www.kaffeeverband.de/393.htm (13.02.04)
26
vgl. Schoolmann (2003): Kaffeebars und Coffee Shops, http://www.abseits.de/kaffee_bars.html
(15.02.04)
27
vgl. o.V. (o.J.): Die Kaffeehäuser, http://www.kaffeezentrale.ch/d/kaffeehaus/detail.cfm?ID=
62D9ABB8-7EF3-4A7C-B3DC85AF68F4B1C4 (02.03.04)
28
vgl. Klein, S. (2001), S. 6
29
vgl. Pendergrast (2001), S. 181
30
vgl. Pendergrast (2001), S. 30ff
6
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
durchsetzen. 1888 eröffnete das erste Kissaten (Kaffeehaus) in Tokio.
31
Ab der
ersten Hälfte des 18. Jhds. gewannen die in jeder größeren europäischen Stadt
etablierten Kaffeehäuser kontinuierlich an Bedeutung, da sie nicht nur die Trink-
sitten grundlegend veränderten, sondern auch neue Formen des gesellschaftlichen
Lebens ermöglichten: Im Kaffeehaus gab nicht mehr die Ausgelassenheit des
Rausches, sondern die Aufgewecktheit des Geistes den Ton an.--
32
Sie wurden
Brennpunkte der Aufklärung und Politik, Umschlagplätze von Neuigkeiten,
Informationsbörsen, in denen zahlreiche ausländische Zeitungen auslagen und
man Geschäftsverbindungen knüpfen konnte.
33
Die Bedeutung des Kaffeehauses
als öffentlichem Treffpunkt für unzufriedene Intellektuelle, Literaten, Künstler,
Politiker, Philosophen und Möchtegern-Revolutionäre, für die Entstehung des
Pressewesens und einer eigenen Musikkultur wird dabei offensichtlich.
34
Die Gründe für einen Kaffeehausbesuch waren schon immer unterschiedlichster
Natur und unterliegen gruppenspezifischen Charakteristika und Erwartungshal-
tungen, denen das Kaffeehausgewerbe im Laufe der Zeit mit der Etablierung ver-
schiedener Kaffeehaustypen entgegenkam. Auch in heutiger Zeit steht der moder-
ne Coffee-Shop sowohl für die Auszeit vom Alltag, als auch für die schnelle Ver-
sorgung zwischendurch. Der Begriff des typischen Kaffeehauses-- ist somit
zeitlich, räumlich, national und sozial determiniert und fällt entsprechend varian-
tenreich aus.
35
Das Spektrum reicht von klassisch traditionell, gemütlich, avant-
gardistisch bis absolut modern. Nachfolger der traditionellen Kaffeehäuser sind
die um 1900 aus den USA importierte Café-Bar mit Schnellimbiss und Thekenbe-
reich und die italienische Espresso-Bar. Die vielfache Prophezeiung, dass die Zeit
der Kaffeehäuser, in denen man früher stundenlang verweilte, vorbei sei, hat sich
als Irrtum erwiesen. Auch heute erfüllt das Café
36
verschiedene soziale Funktio-
nen. Mit den unterschiedlichen Ausprägungsformen der Espressobar oder des
Coffee-Shops nach amerikanischem Vorbild hat sich das Gaststättengewerbe den
Bedürfnissen des modernen Lebens angepasst. In Deutschland etablierten sich die
ersten Espresso Bars und Coffee-Shops Anfang der 90er Jahre.
31
vgl. Pendergrast (2001), S. 297
32
vgl. o.V. (1996):Coffeehouse Culture http://www.coffeereview.com/reference.cfm?ID=183 (10.02.04)
33
Das Café de Foy und das Café Corazza in Paris waren wichtige Versammlungsorte für Beteilig-
te der französischen Revolution, und im Merchants Coffee House in New York wurde am
19.5.1774 der Entschluss zur virtuous and spirited Union-- gefasst. In vielen weiteren europäi-
schen Kaffeehäusern wurden ähnliche Entscheidungen getroffen. vgl. Heise (2002), S. 127
34
vgl. Heise (2002), S. 197
35
vgl. Heise (2002), S. 155ff
36
Zum Begriff Café:Vgl. Heise (2002), S. 160
7
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
2.1.2 Italienische vs. anglo-amerikanische Coffee-Shop Konzepte
Die Coffee-Shop Konzepte zeichnen sich im Wesentlichen durch zwei Stilrich-
tungen aus: amerikanische Coffee-Shops-- und italienische Espresso-Bars--.
37
Je
nach Konzept sind Ambiente und Produktangebot -dies vor allem im Food-
Bereich- zusammengestellt.
38
Eine klare Abgrenzung der Systeme ist nicht mög-
lich, da mitunter Stilelemente unterschiedlicher Traditionen verwendet werden.
39
Sichtbar bleibt die italienische Basis bei nahezu allen Coffee-Shops und zeigt sich
deutlich in den Ausprägungen der Kaffeegetränke.
40
Das Food-Sortiment ist in der
Praxis oftmals nicht ganz so typisch wie in Tabelle 01 dargestellt, sondern eine
Kombination aus italienischen und amerikanischen Speisen.
41
Eine Typologisie-
rung des jeweiligen Konzepts lässt sich dann nur nach ihrem historischen Ur-
sprung vornehmen. Häufig ist eine Differenzierung zwischen den beiden Konzep-
ten bereits durch den Namen möglich. Italienische Konzepte implizieren meist im
Namen ihre Herkunft, während anglo-amerikanische Konzepte oft das Wort
Coffee-- als Namenszusatz beinhalten.
42
Italienische Konzepte
Wie der Name impliziert, ist Italien das Vorbild dieser Kaffeebar Konzepte, die
italienisches Lebensgefühl international übertragen sollen. Repräsentativ für die-
sen Stil sind Segafredo und Lavazza. Segafredo beschreibt sich als Botschafter
italienischer Espressokultur--. Charakteristisch sind die authentischen italienischen
Espressomaschinen (Halbautomaten mit typisch italienischen Siebträgern), im
Gegensatz zu den in anglo-amerikanischen Konzepten eingesetzten Vollautoma-
43
ten . Die Kaffeemaschinen werden von versierten Baristas bedient und sollen
durch Geruch und Geräusch typisch italienisches Flair vermitteln. Häufig weisen
die italienischen Konzepte eine geringe Größe (10 bis 60 qm) auf, teilweise sind
sie als Stehkaffeebar konzipiert.
44
Auf dem internationalen Markt sind in Anleh-
37
Anm.: Zusätzlich gibt es eine Reihe von Varianten oder Kombinationen, wie z.B. Konzepte in
Anlehnung an Wiener Kaffeehäuser (Wiener`s)
38
vgl. Tabelle 01, Seite 62
39
vgl. Schoolmann (2003): Kaffeebars und Coffee Shops, http://www.abseits.de/kaffee_bars.html
(15.02.04)
40
Anm.: Die Bandbreite der Kaffeevariationen ist bei beiden Konzepten sehr ähnlich.
41
vgl. Tabelle 01, Seite 62
42
z.B. Starbucks Coffee Company, San Francisco Coffee Company, Woyton Coffee, World Coffee
43
Anm.: Der Kaffe wird hier per Knopfdruck gemahlen und mit Dampfdruck aufgebrüht.
44
Anm.: Lavazza beispielsweise definiert sich als typisch italienische Stehkaffeebar.
8
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
nung an dieses Konzept noch Costa Coffee (allerdings mit großflächigeren Lö-
sungen) Testa Rossa, Illy und Nannini zu finden.
45
Anglo-amerikanische Konzepte
Eine Mischung aus Latte Macciato und Lifestyle--
46
steht für dieses aus den USA
und Großbritannien importierte Konzept. Der charakteristische Unterschied zu
den italienischen Kaffeebars ist die Größe. Teilweise findet man Shops mit einer
Fläche von 250 qm. Dies bedeutet vor allem Platz für mehr Gäste, und im Ver-
gleich zu den kleinen Espressobars eine großzügigere Gestaltung der Sitzmög-
lichkeiten. Pionier für diese Form der Coffee-Shops ist zweifelsohne Starbucks.
Anstelle des typischen Mobiliars der italienischen Konzepte, bestehend aus Steh-
tischen und Barhockern, findet man in den großen Coffee-Shops nach amerikani-
schem Prinzip Tische, Stühle, Sessel und Sofas.
47
Damit nähern sich vor allem
diese Konzepte dem Third-Place-Gedanken--.
48
Weitere Merkmale sind der höhe-
re Anteil des Coffee-to-go-- und die etwas kultig-kühlere Atmosphäre als in den
italienischen Kaffeebars. Auf dem deutschen Markt eröffnete World Coffee bereits
1997 in Frankfurt am Main die erste Bar nach amerikanischem Vorbild. Weitere
anglo-amerikanische Konzepte in Deutschland sind Balzac Coffee, san francisco
coffee company, FrazerCoffee, Meyerbeer Coffee, Woyton und Cafétiero.
49
2.1.3 Der Coffee-Shop als Third Place--
Der Begriff Third Place-- wurde von Soziologen geprägt und bezeichnet halb-
öffentliche Orte, in Abgrenzung zum First Place--, dem Zuhause und dem
Second Place--, dem Arbeitsplatz. Früher bildeten diese zwei Orte den zentralen
Mittelpunkt des Alltagslebens, doch aufgrund der höheren Mobilität der Konsu-
menten verlieren sie zunehmend an Bedeutung. Third Places--, die in der moder-
nen Konsumlandschaft entstehen, dienen nun an deren Stelle als neue Orte der
Verwurzelung und des gesellschaftlichen Austauschs. Als homes away from ho-
me-- kommen sie dem Trend zu einem Soft-Individualismus--, in dem soziale
45
vgl. Abbildung 01, S. 74
46
Schoolmann (2003): Kaffeebars und Coffee Shops http://www.abseits.de/kaffee_bars.html (15.02.04)
47
vgl. Siepmann (2002): Angriff des grünen Kaffeeriesen, http://www.welt.de/daten/2002/03/10/
0310b02319274.htx?print=1, (08.03.04)
48
vgl. Kapitel 2.1.3
49
vgl. Abbildung 01, S. 74
9
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
Komponenten eine Rolle spielen, entgegen.
50
Nach der These von Oldenburg
51
brauchen die Menschen informelle öffentliche Orte, wo sie zusammenkommen
können und wo Unterhaltung die wichtigste Beschäftigung ist. Ohne solche Orte
können im Stadtgebiet die Art von Beziehungen und die Vielfalt des zwischen-
menschlichen Kontakts nicht aufrechterhalten werden, die aber die Quintessenz
des Stadtlebens ausmachen.--
52
Der Fernsehkonsum ist zeitlich ausgereizt und
stagniert seit Jahren in der täglichen Nutzungsdauer. Auch Sportvereine, Fitness-
studios, Kinos, Theater, Discos etc. können einen Teil im Alltagsleben der Men-
schen einnehmen, aber keinen wirklich konstanten. Unter die Kategorie der
Third Places-- fallen u.a. Shopping-Malls, inszenierte Shops, Restaurants, Buch-
läden, Friseure, Museen, Erlebnishotels und Cafés. Meist definieren sie sich nicht
ausschließlich durch ihr Angebot, sondern durch das Verhalten der Besucher, die
dort zunehmend ihre Freizeit verbringen. Sie sind komplexe, interaktive Systeme,
die auf Beziehungen zwischen Menschen basieren. Ein wesentliches Merkmal von
Third Places-- ist der Besuch aufgrund unterschiedlicher Motivationen. Die popu-
lärsten Third Places-- stellen die Coffee-Shops dar. Sie sind Treffpunkte und
Zwischenstationen. Für Studenten und Großstadtbewohner bilden sie ausgelagerte
Wohn- und Arbeitszimmer. Darüber hinaus werden sie von Geschäftsleuten auf-
gesucht, die z.T. auch Besprechungen dort abhalten. Gemütliche Sessel und Sofas
sorgen bei Starbucks oe dem Synonym für den Third Place--- für eine heimische
Atmosphäre; in einer Filiale in London lodert sogar ein Kaminfeuer. Durch diese
Sinnlichkeit und Wohnlichkeit werden die halböffentlichen Plätze als persönlicher
Lebensraum wahrgenommen. Sie laden einerseits zum Verweilen ein (z. T. mit
der Möglichkeit eines Internetzugangs), andererseits kann man in aller Schnelle
Kaffee und Snacks mitnehmen. Damit bieten die Coffee-Shops neben dem Kern-
produkt Kaffee, etwas ganz Wesentliches: Zeitautonomie. Das ist für eine mobile,
ständig in Zeitnot befindliche Generation entscheidend. [...] Selbstbedienung in
privater Wohlfühlatmosphäre--
53
macht Starbucks & Co deshalb so erfolgreich.
Über die eigentliche Dienstleistung, den Verkauf von Kaffee, hinaus sind sie ver-
fügbarer Raum für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Gerade die junge Genera-
tion sucht Nestwärme in der Öffentlichkeit--
54
, da sie sich immer seltener zu Hau-
50
vgl. Romeiß-Stracke (2003), S. 51
51
vgl. dazu auch Oldenburg (1989)
52
vgl. Schultz/Jones Yang (2003), S. 123
53
vgl. Steinle/Wippermann/Trendbüro (2003), S. 110
54
vgl. Steinle/Wippermann/Trendbüro (2003), S. 203
10
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
se aufhält. So erklärt Starbucks Gründer Howard Schultz den Erfolg seiner Kette
wie folgt: Wir verkaufen keinen Kaffee, sondern 15 Minuten Zeit--.
55
2.2
Allgemeine weltweite Marktsituation
Neben Amerika, dem Ursprungsland der anglo-amerikanisch geprägten Coffee-
Shops, verfügt Großbritannien über den aktivsten Kaffeebar-Markt in Europa. Auf
dem restlichen europäischen Festland entwickelt sich der recht junge Markt für
Coffee-Shops erst seit Mitte der 90er Jahre. Europa ist momentan ein stark frag-
mentierter Markt. Zu stark differenziert sind nationale Trinkgewohnheiten, Kaf-
feetraditionen, Qualitätsansprüche und Geschmackspräferenzen, als dass europa-
weit eine Angleichung zu erwarten ist.
56
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee ist
in den skandinavischen Ländern mit Abstand am höchsten, gefolgt von Österreich
und der Schweiz. In den südeuropäischen Ländern ist der Kaffeeverbrauch pro
Kopf verhältnismäßig gering und liegt in den USA und Großbritannien über 40 %
bzw. fast 70 % unter dem deutschen Durchschnitt.
57
Doch gerade aus diesen Län-
dern kommen derzeit die Impulse für den Coffee-Shop Markt.
2.2.1 Marktsituation in relevanten Ländern
Bei der Analyse einzelner Ländermärkte konnte festgestellt werden, dass auf eu-
ropäischer Ebene der französische Markt eine untergeordnete Rolle für internatio-
nale Konzepte spielt.
58
Italien wird aufgrund zahlreicher traditioneller Espresso-
bars und des hohen Qualitätsanspruchs der Konsumenten von einer internationa-
len Bearbeitung ebenfalls weitestgehend ausgeklammert.
59
Städte mit der
höchsten Coffee-Shop Dichte sind neben Seattle London und Barcelona. Spanien
weist eine vergleichsweise lange Kaffeebartradition auf und ist von der Anzahl
55
Steinle/Wippermann/Trendbüro (2003), S. 203
56
vgl. o.V. (2002): Coffee Bars, ein Blick über die Grenzen, http://www.kaffeeverband.de/
433.htm (22.02.04)
57
Für die Ermittlung des gesamten Kaffeekonsums eines Landes spielt der Pro-Kopf-Verbrauch
nur insofern eine Rolle, als dass er mit der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes multipliziert
wird. Vgl. Tabelle 02, S. 63
58
Bedingt wird dies durch kulturelle Faktoren, wie der geringen Affinität zu dem Produkt Kaffee
und der Etablierung von Bistros, Brasseries, salon de thés oder Restaurants in denen die Franzo-
sen Kaffeetrinken. Größte nationale Anbieter sind Columbus Café und Balzac-Coffee.
59
Anm.: Segafredo, Illy und Lavazza sind derzeit die einzigen internationalen Coffee-Shops in
Italien. Viele anglo-amerikanische Konzepte scheuen-- sich vor diesem anspruchsvollen Markt.
11
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
der Outlets mit Deutschland vergleichbar.
60
In Japan (drittgrößter Kaffeeimpor-
teur der Welt) sind Coffee-Shops ein wesentlicher Teil der Kultur. Sie differenzie-
ren sich im Food-Sortiment von europäischen und amerikanischen Konzepten
unwesentlich durch Toasts, Sandwichs und leichte Mahlzeiten. Auch China ist als
Wachstumsmarkt zu bewerten. Darüber hinaus kommt den ehemaligen Ostblock-
ländern eine steigende Bedeutung zu. Russland, Polen und Ungarn sind Märkte, in
denen bereits einige internationale Coffee-Shops vertreten sind.
61
Relevanz haben
allerdings nur die großen Ballungszentren und Großstädte. Alle künftigen EU-
Beitrittsländer können als Wachstumsmärkte für Coffee-Shops eingestuft werden.
Wesentlicher Einflussfaktor ist das Ansteigen der Kaufkraft und die wachsende
Internationalität in diesen Ländern.
Großbritannien
Der gesamte britische Kaffeebar Markt wurde im Mai 2003 auf 7.603 Betriebe
geschätzt (Vorjahr: 7.057 Stores).
62
Gemessen an der Anzahl der Outlets ist er
mehr als zwölfmal so groß wie der deutsche oder der schwedische Markt. Damit
ist UK (hinter den USA) zweitgrößter Markt für Coffee-Shops. Seit sieben Jahren
in Folge ist ein Marktwachstum zu verzeichnen und bis Ende 2005 rechnet
Allegra Strategies mit einem akkumulierten Wachstum von 5,1 %. Die meisten
Wachstumschancen werden hierbei allerdings außerhalb Londons liegen, da in der
Stadt selbst kaum noch Platz für neue Stores ist. Starbucks ist Marktführer mit
350 Stores und 24 % Marktanteil, gefolgt von Costa Coffee (310 Stores und
21,2 % Marktanteil). Es ist zu erwarten, dass sich die starken Marken in UK wei-
terhin durchsetzen werden. Schon jetzt halten die vier großen Coffee-Shop Ketten
Starbucks, Costa Coffee, Coffee Republic und Caffè Nero einen Marktanteil von
über 60 %. Getragen wird die Entwicklung in Großbritannien, einem Land mit
sehr junger Kaffeetradition, von dem Wunsch vieler Verbraucher nach einer
"Coffee Culture". Coffee Bars lösen die Pubs als neue soziale Treffpunkte ab.
63
60
Anm.: Die momentan größten Anbieter Jamaica (rund 130 Betriebe), Il Caffè di Roma (ca. 50),
Café y Te (ca. 44) und Illycafé mit Expresso (65) starteten im Jahr 1993/94.
61
Anm.: In Russland (Moskau) sind derzeit Café Nescafé und Segafredo vertreten.
62
Angaben der Managementberatung Allegra Strategies Ltd. Vgl. o.V. (2004): Market overview
and Key Statistics, http://www.allegra.co.uk/project-cafe4-keyfindings.html (12.03.04)
63
vgl. o.V. (2002): Coffee Bars, http://www.kaffeeverband.de/ 433.htm (22.02.04)
12
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
Nordeuropa
Durch den hohen Pro-Kopf-Verbrauch an Kaffee und den ausgeprägten Qualitäts-
anspruch der Nordeuropäer an Kaffee sind diese Länder als Wachstumsmarkt zu
bezeichnen. Die großen internationalen Ketten sind gegenwärtig noch nicht auf
diesem anspruchsvollen Markt vertreten, aber es existieren zahlreiche nationale
und regionale Kaffeebars.
64
In Norwegen hat sich die Zahl der Coffee-Shops zwi-
schen 1999 und 2002 auf ca. 400 erhöht. Finnland dürfte sich aufgrund des hohen
Qualitätsanspruchs als das schwierigste nordeuropäische Land erweisen.
65
Ange-
sichts des Interesses der Bevölkerung an amerikanischem Lifestyle und der
Akzeptanz neuer Kaffeegetränke stehen dagegen die Chancen für einen Coffee-
Shop-Kult in Schweden sehr gut.
66
Die Zahl der Outlets wächst dort jährlich um
mehr als 30 %. Wirklich interessant dürfte es in Nordeuropa werden, wenn
Starbucks in diesen Markt eintritt.
67
Mittlerer Osten
Der Mittlere Osten umfasst insgesamt 14 Länder mit ca. 240 Millionen Einwoh-
nern, und ist eines der attraktivsten Tourismusgebiete der Welt. Dubai gilt als das
Handelszentrum der Region mit 3 Mio. Touristen im Jahr 2003 und 10 Mio.
erwarteten für 2010. Das Pro-Kopf-Einkommen und die Kaufkraft in diesen Län-
dern sind sehr hoch, die Mobilität der Einwohner wächst. Die Mehrheit der Kon-
sumenten in der Region ist unter 25 Jahre alt, was einen starken Einfluss auf die
Kauf- und Verbrauchsgewohnheiten ausübt. Seit den letzten 20 Jahren ist nicht
nur in der Tourismus- sondern auch in der Gastronomiebranche ein enormes
Wachstum zu verzeichnen. Die Verschiedenheit der einzelnen Länder und Kultu-
ren bedingt eine Vielfalt des Angebots im Gastronomiebereich. Es gibt niedrige
Markteintrittsbarrieren und die Länder des Mittleren Ostens sind westlichen Pro-
dukten und Ideen gegenüber sehr offen.
68
Dies zeigt sich auch im Gastronomiebe-
reich, in dem mehr Fast-Food-Ketten vertreten sind als in Europa, und in dem das
Fast-Food-Franchising hohe Wachstumspotenziale aufweist.
69
Zahlreiche bei den
64
Anm.: z.B. Robert`s Coffee in Finnland, Schweden und Dänemark (über 30 Stores)
65
Marktexperten rechnen mit einem längeren Zeitraum für die Durchsetzung von Coffee-Shop
Ketten. vgl. o.V. (2002): Coffee Bars, http://www.kaffeeverband.de/ 433.htm (22.02.04)
66
vgl. o.V. (2002): Coffee Shops in Schweden, http://www.kaffeeverband.de/430.htm (14.03.04)
67
Starbucks sieht dort ein Potenzial von 300 eigenen Coffee-Shops. Vgl. ebenda
68
vgl. Bitar (2004), S. 40
69
vgl. Bitar (2004), S. 42 und Tabelle 03, S. 64
13
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
Konsumenten beliebte Fast-Food-Ketten sind in Großstädten präsent, allerdings
bieten die vielen Shopping-Malls und Luxushotels Platz für weitere Angebote.
2.2.2 Der deutsche Coffee-Shop Markt
Nach Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes umfasst der deutsche Markt
derzeit über 600 Coffee-Shops. Branchenkenner sehen jedoch Potenzial für ca.
1000 weitere Bars.
70
Gegenwärtig ist der Markt stark fragmentiert, die 15 führen-
den Anbieter betreiben 269 Coffee-Shops (ein Wachstum von 33 Outlets im Ver-
gleich zum Vorjahr).
71
Neben den internationalen Systemen, die bundesweit agie-
ren, gibt es viele individuelle Marktteilnehmer, teils junge Entrepreneure mit regi-
onal konzentrierten Konzepten
72
, die sich erst in der Startphase mit geringer
Markt- und Markendurchdringung, befinden. Marktführer (gemessen an der An-
zahl der Stores) sind die beiden Pioniere
73
: Segafredo mit 81 Outlets, gefolgt von
Lavazza mit 39 Standorten.
74
Eine wichtige Rolle spielt auch in Deutschland der
Weltmarktführer und Expansionssieger Starbucks, der erst 2002 in diesen Markt
eingetreten ist und allein 2003 17 neue Stores eröffnete. Für 2004 wird mit 20
weiteren Stores gerechnet. Während Starbucks in Deutschland sehr schnell
wächst, mussten viele nationale Anbieter ihre Expansionspläne drosseln--. Der
jährliche Kaffeekonsum pro Person beträgt in Deutschland ca. 6,7 kg (das ent-
spricht ca. 160 l oder täglich vier Tassen). Er wird sich, so Branchenkenner, nicht
erhöhen, aber vermehrt auf den Außer-Haus-Verbrauch verlagern.
75
Die positive
Entwicklung des Außer-Haus-Konsums von Kaffee hält unverändert an, der
Verbrauch lag 2002 bei 20 bis 25 % des Gesamtmarktes mit steigender Tendenz.
76
Dementsprechend befindet sich das Segment der Coffee-Shops - anknüpfend an
den amerikanischen und englischen Markt - in einer Entwicklungsphase. Aller-
70
Nach telefonischer Auskunft von Hans-Jörg Müller, Pressesprecher des Deutschen Kaffeever-
bandes, am 09.03.04. Mit berücksichtigt wird hierbei auch Tchibo (mit ca. 250 Filialen), die auf-
grund des hohen Nonfood-Anteils nicht als klassischer Coffee-Shop bezeichnet werden.
71
Anm.: Ohne Tchibo-Outlets
72
vgl. Abbildung 01, S. 74
73
Anm.: Der Eintritt von Segafredo in Deutschland erfolgte 1990, Lavazza folgte 1992.
74
vgl. Tabelle 04, S. 65
75
Damit ist Kaffee seit 15 Jahren das meist konsumierte Getränk in Deutschland, vor Bier (125,5 l
pro Kopf/Jahr) und Wasser (102,3 l pro Kopf/Jahr). Vgl. o.V. (2003b) G+J-Märkte + Tendenzen
Kaffee, S.1 und o.V. (2003): Der deutsche Kaffeemarkt, http://www.kaffeeverband.de/
pdf/kapitel8.pdf (06.03.04)
76
vgl. o.V. (2003b) G+J-Märkte + Tendenzen Kaffee, S.3
14
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
dings geht die Entwicklung nach einem starken Boom Ende der 90er Jahre seit
zwei Jahren weniger dynamisch voran. Eine Marktsättigung ist dennoch noch lan-
ge nicht erreicht. Kritisch muss auch auf die aktuellen Schwierigkeiten hingewie-
sen werden. Die Konzentration der Anbieter auf 1a-Standorte, sowie die limitier-
ten Pro-Kopf-Umsätze, die oft zu niedrig sind um die teuren Lagen zu finanzieren,
sind neben dem allgemein schwachen Konsum Gründe für ein gehemmtes Wachs-
tum. Auf der anderen Seite ergeben sich bedingt durch den gesellschaftlichen
Wandel auch Chancen für dieses Segment. Der Wunsch nach Abwechslung im
Alltag, der Bedarf nach zwanglosen Kommunikationsräumen und die veränderten
Ansprüche der Konsumenten an bestimmte Produkte, tragen nach einer Studie der
BBE-Unternehmensberatung zu einer höheren Akzeptanz der Coffee-Shops bei.
77
2.2.3 Relevante internationale Marktteilnehmer
Ebenso uneinheitlich wie die Begriffsdefinition der Internationalisierung stellt
sich in Theorie und Praxis der Begriff des internationalen Unternehmens dar.
Durch die Darstellung verschiedener Auffassungen wird versucht, sich einer für
diese Arbeit gültigen Definition zu nähern. Eine der ersten Begrifferklärungen
stammt von Lilienthal aus dem Jahr 1960, der multinationale Unternehmungen als
corporations, which have their home in one country but which operate and live
under the laws and customs of other countries as well.--
78
beschreibt. Sieber cha-
rakterisierte 1970 multinationale Unternehmungen, dass [...] sie dadurch ge-
kennzeichnet [sind], dass sie in mehreren Ländern in einem substantiellem Um-
fange Güter oder Dienstleistungen aller Art produzieren und auf den Markt brin-
gen [...]. Sie müssen in mindestens sechs Länder Produktionsstätten unterhalten
und wenigstens 25% ihrer Gesamtinvestitionen im Ausland tätigen. Als internati-
onal (im Sinne einer Steigerung von multinational) soll eine Unternehmung dann
gelten, wenn mehr als die Hälfte des Kapitals im Ausland investiert wurde (50%-
75%).--
79
Vor dem Hintergrund eines multinationalen, globalen oder transnationalen Un-
ternehmens, wird ein internationales Unternehmen als ein Unternehmen mit noch
schwach ausgeprägten internationalen Aktivitäten definiert--.
80
77
vgl. o.V. (2002c) Coffee-Shop Welten 2002, S. 74
78
Kutschker/Schmid (2002), S. 228
79
Sieber (1970), S. 415ff
80
vgl. Kutschker (2002), S. 47ff
15
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
Eine internationale Unternehmung soll im folgenden bereits vorliegen, wenn ein
Teil der Leistungen in einem Land erbracht wird, in dem das betreffende Unter-
nehmen nicht seinen Hauptsitz hat.--
81
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des internationalen Unternehmens in
Anlehnung an Kutschker/Schmid
82
wie folgt definiert: Ein internationales Unter-
nehmen ist dadurch gekennzeichnet, dass es in substantiellem Umfang in Aus-
landsaktivitäten in mindestens drei unterschiedlichen Volkswirtschaften involviert
ist. Damit einher gehen regelmäßige Transaktionsbeziehungen mit Wirtschafts-
subjekten im Ausland.--
83
In der nachstehenden Tabelle werden relevante internationale Marktteilnehmer
aufgeführt. Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da zahlreiche
Coffee-Shops nur in wenigen Ländermärkten vertreten sind. Bedingt durch eine
hohe internationale Marktfragmentierung bestimmen neben dem Weltmarktführer
Starbucks oeamazingly, there is no real Pepsi to Starbucks` Coke, anywhere in
the world--
84
- einige mit Abstand kleinere, aber dennoch internationale Konzepte
und sehr viele nationale und regionale Anbieter den Markt.
85
81
Köhler (1991), S. 53
82
vgl. Kutschker/Schmid (2002), S. 237
83
Kutschker (2002), S. 237
84
Pendergrast (2002): The Starbucks Experience http://www.teaandcoffee.net/0202/coffee2.htm
(30.03.04)
85
Tully`s ist ein starker Wettbewerber für Starbucks im US-Markt (über 100 Stores). Weitere
Märkte wie Japan und Südkorea erschloss sich Tully`s über Lizenzen. Doutor ist größter Anbieter
in Japan, Dôme in Australien und Barista in Indien. In nahezu jedem Land gibt es große nationale
Coffee-Shop Ketten, die über eine Expansion nachdenken.
16
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
Tabelle: Übersicht Internationale Marktteilnehmer
Coffee-
Heimat-
Anzahl
Anzahl
Start
Erste Auslands-
Grün-
Form des Markteintritts
Shop
markt
der
Outlets
bearbei-
teter
der
Ex-
filiale
dungs-
jahr
Länder
pan-
sion
1. Starbucks
USA,
Seattle
7834
35
1996
86
Japan, Tokio
1971
Joint Ventures, eigene
Filialen, Lizenzen
2. Segafredo
Italien,
Bologna
375
32
1988
Frankreich, Paris
1973
Franchising
3. Costa
UK,
395
10
2000
Deutschland,
1978
Eigene Filialen und
Coffee
London
Oberhausen
Franchising
4. McCafé
Austra-
400
23
1995
Portugal
1993
Shop-in-Shop`s in be-
lien
stehenden McDonald`s
Betrieben
5. Café
Nescafé
Schweiz
250
15
1999
Kobe, Japan
1867
Eigene Filialen und
Franchising
6. Cup&Cino
Deutsch-
land
23
7
2001
Österreich, Wels
1995
Franchising
7. Nannini
Italien,
Siena
30
8
2001
Portugal, Lissa-
bon
1989
Franchising
8. Testa
Öster-
28
6
1999
Deutschland,
1999
Franchising und eigene
Rossa
reich
München
Filialen
9. Illy
Italien,
Triest
14
6
2001
Frankreich,
Paris
1933
Lizenzen
Quelle: eigene Recherche (Homepages, Presseberichte und Unternehmens-
präsentationen mit Stand vom 29.03.04)
2.3
Status quo der Internationalisierung deutscher Coffee-Shops
Unter Bezugnahme auf die in Kapitel 2.2.3 dargestellten internationalen Unter-
nehmen und die bereits erläuterte nationale Konzentration zahlreicher Coffee-
Shops lässt sich weltweit ein relativ geringer Internationalisierungsgrad der Bran-
che feststellen. Diese Tatsache bietet die Grundlage für nachstehende Ausführun-
gen und versucht hierfür Erklärungen zu liefern. Pars pro toto werden die ange-
stellten Überlegungen am Beispiel des deutschen Marktes vorgenommen.
Betrachtet man deutsche Kaffeebar-Konzepte, lässt sich eine Internationalisierung
nur bei Cup&Cino, einem Unternehmen aus Hövelhof/Westfalen, feststellen. Ne-
ben Deutschland ist Cup&Cino in sechs weiteren Auslandsmärkten
87
aktiv, der
Markteintritt erfolgt in Form des Franchisings.
88
In den sieben Ländermärkten be-
86
Das erste nicht-US-Engagement-- erfolgte 1987 in Vancouver (Kanada). Japan wird jedoch all-
gemein als der Beginn der internationalen Expansion angesehen.
87
Anm.: Österreich, Schweiz, Portugal, Spanien, Indonesien, Katar (ab Mai 2004)
88
vgl. Kapitel 3.2.2
17
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
treibt Cup&Cino insgesamt 23 Coffee Houses und fokussiert sich auf einen Aus-
bau des Konzepts innerhalb der bereits erschlossenen Gebiete.
89
Um die Probleme der Internationalisierung deutscher Coffee-Shops analysieren zu
können, wurde eine schriftliche Befragung bei den neun national tätigen Anbie-
tern in Deutschland durchgeführt. Diese neun Unternehmen (Balzac Coffee,
World Coffee, Meyerbeer Coffee, Cafétiero, san fransisco coffee company, Wie-
ner`s, Black Bean, Woyton und Einstein Kaffee) befinden sich in Deutschland un-
ter den 15 größten Kaffeebar-Konzepten und verfügen über mindestens sieben na-
tionale Stores.
90
Acht Unternehmen nahmen an der Befragung teil, Black Bean hat
keine Auskunft erteilt.
Des Weiteren sind auf dem deutschen Markt sechs internationale Coffee-Shop
Ketten vertreten (Segafredo, Lavazza, Starbucks, Café Nescafé, Costa Coffee,
Testa Rossa). Die internationalen Coffee-Shops verfügen meist über eine größere
Erfahrung im Kaffeemarkt, nahezu alle Gründungsjahre internationaler Ketten
liegen ca. 30 Jahre zurück.
91
Deutsche Systeme befinden sich hingegen häufig
noch in der Aufbauphase, das durchschnittliche Gründungsjahr ist 1998, somit
rund 20 Jahre später.
92
Die auf dem deutschen Markt tätigen Unternehmen betreiben im Durchschnitt 11
Filialen, und expandieren im Heimatmarkt vor allem durch eigene Filialen
(87,5%). Franchising nutzen 50 %, um eine Multiplikation ihres Konzeptes in
Deutschland zu realisieren. Die Befragung ergab, dass 37,5 % der nationalen
Coffee-Shops innerhalb der nächsten drei Jahre eine Expansion ins Ausland planen.
93
2.3.1 Motive der Internationalisierung
Ein wichtiges Ziel der Untersuchung war es, zu analysieren, welche Bedeutung
einzelne Motive bei der Entscheidungsfindung für eine Internationalisierung auf-
weisen. Hierbei griff man auf die von Köhler entwickelten Internationalisie-
rungsmotive zurück, da er damit einen breiten Bogen über eine Vielzahl mögli-
89
vgl. Transkript Cup&Cino 03.04.2004. Siehe Anhang, S.116ff
90
vgl. Tabelle 04, S. 65
91
vgl. Kapitel 2.2.3, Tabelle S. 17
92
vgl. Tabelle 06, S. 67
93
vgl. Tabelle 06, S. 67
18
Situationsanalyse des internationalen Coffee-Shop Marktes
cher Gründe für ein Internationalisierungsvorhaben spannt.
94
Wichtigstes Motiv
der Internationalisierung deutscher Coffee-Shops ist die Erschließung neuer
Märkte (21 % der Befragten). Die Sättigung des Heimatmarktes und die Erzielung
höherer Gewinne als im Inland sind für die Befragten weitere relevante Motive
zur Internationalisierung (je 17 %).
95
Inwieweit das Motiv Erschließung neuer
Märkte-- aufgrund der Tatsache, dass es einer Internationalisierung immanent ist
und unternehmerisches Idealverhalten ausdrückt, von vielen Unternehmen ge-
nannt wird, und ob es wirklich das Hauptmotiv darstellt, lässt sich nicht beantwor-
96
ten.
2.3.2 Hinderungsgründe bei der Internationalisierung
Gleichzeitig wurde in Anlehnung an Köhler untersucht, welche Schwierigkeiten
beim Eintritt in Auslandsmärkte sowie bei ihrer Bearbeitung auftreten können.
97
Innerhalb dieses Teils der Untersuchung ist die Analyse möglicher Hinderungs-
gründe zur Internationalisierung von Interesse. Rund 29 % der Befragten sahen als
Markteintrittsbarriere
98
die hohen Kosten einer Internationalisierung. Ein weiterer
Hinderungsgrund wird darin gesehen, dass der deutsche Markt noch nicht ausge-
schöpft ist. 21 % der Befragten gaben an, dass sie zuerst in Deutschland flächen-
deckend vertreten sein möchten, bevor sie über eine Expansion nachdenken. Eine
weitere Barriere wird in der begrenzten Managementkapazität des Unternehmens
gesehen (17 %). Aufgrund des recht jungen Marktes für Coffee-Shops und dem
kurzen Bestehen der Systeme, gaben 13 % der Befragten als Hinderungsgrund an,
dass sich ihr Konzept in Deutschland erst in der Aufbauphase befindet. Alle ande-
ren abgefragten Hinderungsgründe sind eher nachgelagert. Nur die oben genann-
ten Hindernisse scheinen entscheidend dafür zu sein, dass keine Internationalisie-
rung stattfindet.
94
Tabelle 05, S. 66
95
vgl. Tabelle 07, S. 68
96
vgl. Köhler (1991), S. 87
97
vgl. Köhler (1991), S. 109
98
Unter einer Marketeintrittsbarriere verstehen wir jede Art von Behinderung, mit der sich zum
einen Unternehmen konfrontiert sehen, die den entsprechenden Markt noch nicht bearbeitet ha-
ben.-- Köhler (1991), S. 109
19
Theoretische Grundlagen der Markterschließungsstrategien
3
Theoretische Grundlagen der Markterschließungsstrategien
3.1
Einflussfaktoren auf die internationale Marktwahl
Die internationale Marktwahl wird als Entscheidungsproblem definiert, dessen
Ziel es ist, anhand geeigneter Kriterien jene Marktsegmente zu bestimmen, deren
Bearbeitung erfolgsversprechend erscheinen.
99
Die Kriterien schlüsseln sich auf in
umweltbezogene und unternehmensbezogene Einflussfaktoren. Nach Meinung der
Autoren kommt, aufgrund der Verkürzung von Produktlebenszyklen und einer
Vielzahl von Markteintrittsbarrieren, der räumlichen Marktwahl als zentraler Ent-
scheidungstatbestand im internationalen Marketing eine immer höhere Bedeutung
100
zu.
In Anlehnung an Meffert lässt sich der zweistufige Prozess zur Auswahl re-
levanter Ländermärkte in eine Grobauswahl und eine Feinanalyse aufteilen.
101
Die
internationale Marktwahl bildet den Anfang im Prozess der internationalen
Markterschließung, und ist damit Ausgangspunkt für die Ableitung nachgelagerter
Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien.
102
3.1.1 Umweltbezogene Einflussfaktoren
Ökonomische Merkmale
Unter ökonomischen Merkmalen lassen sich absatzorientierte Größen wie Markt-
volumen und oepotenzial
103
, das erwartete Marktwachstum sowie die Abnehmer-
struktur als Anzahl, Bedarf und Kaufkraft potentieller Kunden subsumieren.
104
Bei der Frage nach Größe und generellen Eigenschaften eines Ländermarktes,
nehmen ökonomische Merkmale einen hohen Einfluss auf die internationale
Marktwahl. Daneben bestimmen Struktur und Verhalten der Konkurrenz (inländi-
sche und internationale) in einem Ländermarkt die Erfolgschancen eines Unter-
nehmens, bzw. Produktes in diesem Markt.
105
Als weiteres Kriterium kann die
Lieferantensituation in den jeweiligen Ländern genannt werden, die zumeist nur
99
vgl. Meffert/Althans (1982), S. 69
100
vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 107. Gründe für die hohe Bedeutung: Vgl. Douglas/Craig (1992), S. 291ff
101
vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 108 ff und Bernd /Fantapié Altobelli/Sander (2003), S. 114
102
vgl. Backhaus/Büschken/Voeth (2001), S. 115
103
vgl. Breit (1991), S. 198ff
104
Weitere Größen vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 49
105
Vermehrt ist eine Globalisierung des Wettbewerbs-- festzustellen, und eine Profilierung wird
vornehmlich gegenüber anderen internationalen Wettbewerbern gesucht. vgl. Meffert/Bolz (1998),
S. 60 und Bradley (1991), S. 165
20
Theoretische Grundlagen der Markterschließungsstrategien
für Unternehmen mit eigenen Niederlassungen oder angestrebten Direktinvestiti-
onen relevant ist.
Sozio-kulturelle Merkmale
Die sozio-kulturelle Umwelt wird definiert als die konsistente Gesamtheit aller er-
lernten, kollektiv geteilten und gültigen Werte, Normen und Symbole, die sich in
bestimmten Elementen wie z.B. der Sprache, der Religion, den Verhaltensweisen,
den Institutionen und der grundsätzlichen sozialen Struktur niederschlagen kön-
106
nen.
Für die internationale Marktwahlentscheidung sind sozio-kulturelle Merk-
male eines Landes von zentraler Bedeutung, da sie die Ausprägungen der Bedürf-
nisse und letztlich das Kauf- und Verbrauchsverhalten der Bevölkerung
beeinflussen und Aufschluss über die Akzeptanz einzelner Produkte oder Dienst-
leistungen liefern. Bei Ländern mit gleichen kulturellen Wurzeln kann auf ähnli-
che oder vergleichbare Verhaltensweisen geschlossen werden.
107
Zunehmende
Mobilität und intensivere Kommunikationsmaßnahmen sind dafür verantwortlich,
dass lokal geprägte Einstellungen immer mehr verschwimmen, und über Kultur-
grenzen hinweg gleiche Verhaltensmuster bei Konsumenten vorzufinden sind. Im
Rahmen der Markterschließung besteht dadurch für Unternehmen die Möglich-
keit, über kulturelle Barrieren hinwegzusteigen und ihre Marketingprogramme
global zu standardisieren.
108
Politisch-rechtliche Merkmale
Insbesondere im Zusammenhang mit der Investitionssicherheit kommt der politi-
schen Lage und Stabilität (Länderrisiko) eines Landes große Bedeutung zu. Bür-
gerkriege, Unruhen und militärische Auseinandersetzungen etc. führen zu einem
politischen und in Folge auch wirtschaftlich instabilen Klima, welches ein Enga-
gement in den einzelnen Ländern unattraktiv macht oder gar ausschließt. Rechtli-
che Rahmenbedingungen umfassen das Rechtsystem, zwischenstaatliche Verein-
barungen, das Recht im Heimatland und des jeweiligen Auslandsmarktes, interna-
106
Kultur beinhaltet alle Errungenschaften im sozialen Leben eines Menschen; sie wird gelernt,
geteilt und von einer Generation zur anderen übertragen.-- Bernd/Fantapié Altobelli/Sander
(2003), S. 27. Nach Czinkota/Ronkainen (1998, vgl. S. 67ff) umfasst sie folgende Elemente: Spra-
che, Religion, Werte und Normen, Gepflogenheiten, Gesellschaftsstruktur, Ästhetik, Bildung, so-
ziale Institutionen und Sozialverhalten und Keegan/Schlegelmilch/Stöttinger (2002), S. 96
107
vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 113 und Berekoven (1985), S. 80ff
108
vgl. Kapitel 3.4
21
Theoretische Grundlagen der Markterschließungsstrategien
tionale Handelsbräuche, sowie das internationale Wirtschaftsrecht. Im Hinblick
auf die Beurteilung von Ländermärkten stellen politische Risiken und rechtliche
Hindernisse mögliche Einschränkungen der unternehmerischen Handlungsauto-
nomie dar.
109
Auch steuerliche Aspekte spielen für die internationale
Markteintrittsentscheidung eine Rolle, da sie die Kaufvoraussetzungen für be-
stimmte Produkte in den einzelnen Ländern unterschiedlich beeinflussen können.
Natürlich-technische Merkmale
Wesentliche natürlich-technische Einflussgrößen sind neben den topographischen
und klimatischen Verhältnissen, die Rückschlüsse auf das Konsumentenverhalten
erlauben, die Ressourcenausstattung des Landes sowie die infrastrukturellen Ge-
gebenheiten.
110
Des Weiteren sollten der Grad der Verstädterung und der techni-
sche Entwicklungsstand bei der internationalen Marktwahl Beachtung finden.
3.1.2 Unternehmensbezogene Einflussfaktoren
Unternehmensziele und Unternehmenskultur beeinflussen zum einen die grund-
sätzliche Haltung zu Auslandsaktivitäten, die Risikobereitschaft, wie auch die ge-
nerelle Einstellung zu bestimmten Ländern bzw. Ländergruppen,
111
zum anderen
determinieren sie die strategische Ausrichtung eines Unternehmens, d.h. ob eine
ethno-, poly-, oder geozentrische Orientierung des Managements vorherrscht
[...].--
112
Die Größe des Unternehmens stellt einen Indikator für die im Prozess
der Markterschließung wichtige Komponente Kapitalkraft und die Risikokompen-
sationsmöglichkeit dar. Stehen dem Unternehmen nur geringe Ressourcen zur
Verfügung, bietet sich insbesondere das geographisch nähere Ausland an. Eine
zentrale Rolle spielt ebenso das Marktwissen des Unternehmens, das die Erfah-
rung in einzelnen Ländermärkten und die internationale Qualifikation des Perso-
nals widerspiegelt.
109
vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 112
110
vgl. Meffert/Bolz (1998), S. 52ff
111
vgl. Ludwig (1995), S. 69ff
112
Bernd/Fantapié Altobelli/Sander (2003), S. 38. Ethnozentrisch orientierte Unternehmen werden
sich eher auf Märkte mit Ähnlichkeit zum Heimatmarkt konzentrieren, im Gegensatz zu geozent-
risch orientierten, die häufig Wert auf das Kriterium Möglichkeit zur Standardisierung-- legen.
Backhaus/Büschken/Voeth (2001), S. 152ff
22
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832482237
- ISBN (Paperback)
- 9783838682235
- DOI
- 10.3239/9783832482237
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule RheinMain – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2004 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- marketing absatzwirtschaft unternehmensführung starbucks markteintritt
- Produktsicherheit
- Diplom.de