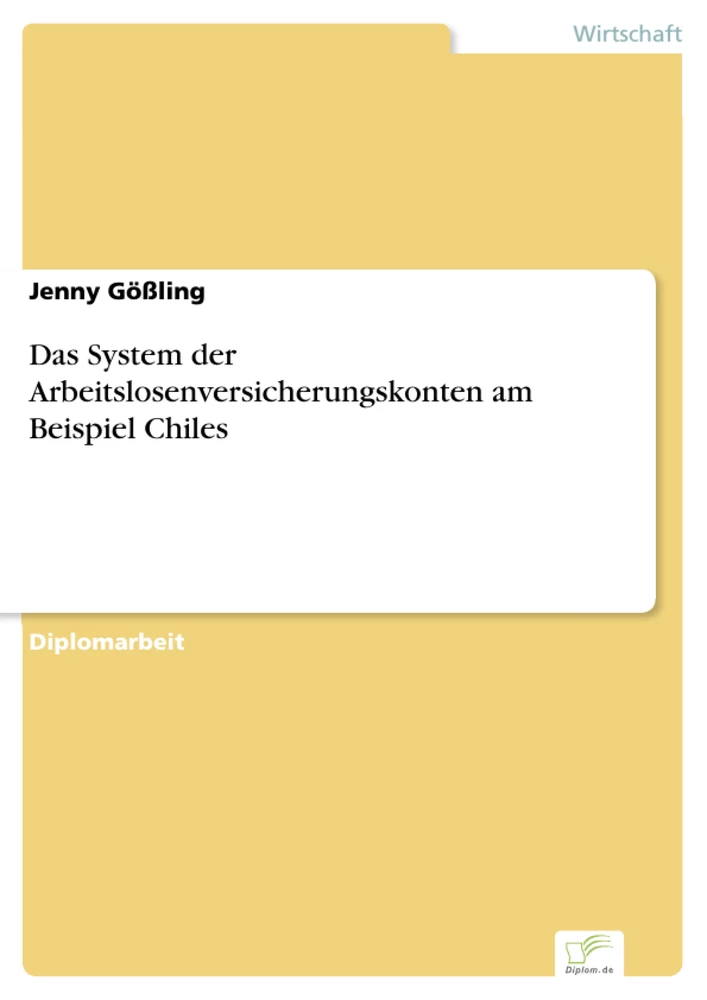Das System der Arbeitslosenversicherungskonten am Beispiel Chiles
©2004
Diplomarbeit
70 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere am Beispiel Chiles mit Arbeitslosenversicherungskonten (Unemployment Insurance Savings Accounts) als einer Form kapitalgedeckter Arbeitslosenversicherung. Dabei handelt es sich um ein System mit persönlichen Konten, auf die die Versicherten ihre Beiträge einzahlen und von denen sie im Falle der Arbeitslosigkeit Leistungen beziehen können. Das angesparte Guthaben wird am Ende des Erwerbslebens an den Versicherten vollständig ausgezahlt. Durch diese Internalisierung der Kosten der Arbeitslosigkeit werden diejenigen Versicherten finanziell belohnt, die selten oder gar nicht arbeitslos sind. Die Finanzierung der Arbeitslosigkeit aus den eigenen Ersparnissen schafft den Anreiz, sich um schnelle Wiedereinstellung zu bemühen und damit persönliche Ressourcen zu schonen.
Die bisherige Literatur zum Thema beschäftigt sich hauptsächlich mit der Darstellung von theoretischen Modellen und fiktiven Berechnungen, ob sich eine Umstellung auf UISA aus einem bisherigen System lohne. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es hingegen, anhand einer umfassenden Diskussion der wichtigsten theoretischen Modellansätze, sowie der Charakteristika des 2002 in Chile in der Praxis eingeführten Systems, einen Überblick über diese Form der Arbeitslosenversicherung zu geben. Mit Hilfe von Praxisdaten der staatlichen chilenischen Aufsichtsbehörde über die Arbeitslosenversicherung (SAFP), die eine Auswertung der Einführungsphase ermöglichen, soll hier eine Bewertung des Systems bezüglich der Realisierbarkeit in der Praxis vorgenommen werden.
Die Arbeit beginnt mit einer Diskussion der Notwendigkeit staatlicher Arbeitslosenversicherung im Vergleich zu freiwilliger Vorsorge und privater Absicherung. Daran schließt sich eine Darstellung der Behandlung der Unemployment Insurance Savings Accounts (UISA) in der wichtigsten Literatur an, wobei neben einer ausführlichen Diskussion der Vor- und Nachteile Rentabilitätsberechnungen erläutert werden. Der folgende Praxisteil beschäftigt sich mit der Umsetzung des Systems der UISA in Chile. Ausgehend von der bisherigen Form der Arbeitslosenunterstützung werden die Charakteristika der neuen UISA aufgezeigt und die Daten des ersten Laufzeitjahres ausgewertet. Unterschiede zwischen den theoretischen Modellen und dem chilenischen System werden aufgezeigt und mögliche Gründe dargestellt. Das letzte Kapitel fasst die Kernpunkte noch einmal zusammen und geht auf die […]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere am Beispiel Chiles mit Arbeitslosenversicherungskonten (Unemployment Insurance Savings Accounts) als einer Form kapitalgedeckter Arbeitslosenversicherung. Dabei handelt es sich um ein System mit persönlichen Konten, auf die die Versicherten ihre Beiträge einzahlen und von denen sie im Falle der Arbeitslosigkeit Leistungen beziehen können. Das angesparte Guthaben wird am Ende des Erwerbslebens an den Versicherten vollständig ausgezahlt. Durch diese Internalisierung der Kosten der Arbeitslosigkeit werden diejenigen Versicherten finanziell belohnt, die selten oder gar nicht arbeitslos sind. Die Finanzierung der Arbeitslosigkeit aus den eigenen Ersparnissen schafft den Anreiz, sich um schnelle Wiedereinstellung zu bemühen und damit persönliche Ressourcen zu schonen.
Die bisherige Literatur zum Thema beschäftigt sich hauptsächlich mit der Darstellung von theoretischen Modellen und fiktiven Berechnungen, ob sich eine Umstellung auf UISA aus einem bisherigen System lohne. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es hingegen, anhand einer umfassenden Diskussion der wichtigsten theoretischen Modellansätze, sowie der Charakteristika des 2002 in Chile in der Praxis eingeführten Systems, einen Überblick über diese Form der Arbeitslosenversicherung zu geben. Mit Hilfe von Praxisdaten der staatlichen chilenischen Aufsichtsbehörde über die Arbeitslosenversicherung (SAFP), die eine Auswertung der Einführungsphase ermöglichen, soll hier eine Bewertung des Systems bezüglich der Realisierbarkeit in der Praxis vorgenommen werden.
Die Arbeit beginnt mit einer Diskussion der Notwendigkeit staatlicher Arbeitslosenversicherung im Vergleich zu freiwilliger Vorsorge und privater Absicherung. Daran schließt sich eine Darstellung der Behandlung der Unemployment Insurance Savings Accounts (UISA) in der wichtigsten Literatur an, wobei neben einer ausführlichen Diskussion der Vor- und Nachteile Rentabilitätsberechnungen erläutert werden. Der folgende Praxisteil beschäftigt sich mit der Umsetzung des Systems der UISA in Chile. Ausgehend von der bisherigen Form der Arbeitslosenunterstützung werden die Charakteristika der neuen UISA aufgezeigt und die Daten des ersten Laufzeitjahres ausgewertet. Unterschiede zwischen den theoretischen Modellen und dem chilenischen System werden aufgezeigt und mögliche Gründe dargestellt. Das letzte Kapitel fasst die Kernpunkte noch einmal zusammen und geht auf die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8157
Gößling, Jenny: Das System der Arbeitslosenversicherungskonten am Beispiel Chiles
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Gliederung
1 Einleitung...1
1.1 Ziel
der Arbeit...2
1.2 Aufbau
der Arbeit ...2
2 Notwendigkeit
staatlicher
Arbeitslosenversicherung ...3
2.1
Argumente für staatliche Arbeitslosenversicherung ...3
2.2
Probleme durch staatliche Arbeitslosenversicherung...5
2.3 Bewertung...7
2.4 Optimale
Arbeitslosenversicherung nach Hopenhayn...8
3
Unemployment Insurance Savings Accounts in der Theorie ...9
3.1 Definition ...10
3.2
Modell zum Vergleich der UISA mit umlagefinanzierter
Arbeitslosenversicherung...11
3.3 Vorteile
der UISA ...14
3.4 Probleme
bei UISA...14
3.5 Effizienzberechnungen...16
3.5.1 Rentabilität der UISA ...16
3.5.2 Umverteilungseffekte der UISA...19
3.6 Sind
UISA
optimal? ...20
3.7 Severance
Payments
Savings
Accounts in Kolumbien ...22
3.8 Integrated
Unemployment Insurance System ...23
4
Praktische Umsetzung der UISA in Chile ...24
4.1
Politische und wirtschaftliche Situation in Chile ...24
4.2 Bisherige
Arbeitslosenunterstützung...25
4.2.1 Unemployment Subsidy ...25
4.2.2 Severance
Payments...25
4.2.3 Sonstige
Programme ...26
4.3 UISA
in
Chile...27
4.3.1 Entstehungsgeschichte...27
4.3.2 Das
neue
System...28
4.3.2.1 Persönliche Konten ...28
4.3.2.2 Degressive Leistungen...29
4.3.2.3 Umverteilender
Solidaritätsfonds...30
4.3.2.4 Privates Management ...31
4.3.2.5 Sonderbehandlung
von Zeitverträgen ...33
4.3.3
Auswertung der ersten sechzehn Laufzeitmonate ...34
4.3.4
Unterschiede zu den theoretischen Modellen ...36
4.3.5 Probleme
bei
der Umsetzung...37
5
Schlussbemerkung unter dem Aspekt der Übertragbarkeit auf Deutschland ...38
6 Anhang...41
7 Literaturverzeichnis ...51
Abbildungsverzeichnis
Abbildung Nr. 1
Zur Theorie der
Arbeitssuche
5a
Abbildung Nr. 2
Verteilung der Beschäftigten nach Bereichen
27a
Abbildung Nr. 3
Finanzierungs- und Leistungsübersicht für
unbefristete
Verträge
27a
Abbildung Nr. 4
Finanzierungs- und Leistungsübersicht für
befristete
Verträge
32a
Abbildung Nr. 5
Anzahl der Versicherten und Privatwirtschaftlich
Beschäftigten 33a
Abbildung Nr. 6
Anzahl der Versicherten mit befristeten und
unbefristeten
Verträgen
33a
Abbildung Nr. 7
Verteilung der Versicherten nach Monats-
Einkommen
34a
Abbildung Nr. 8
Verteilung der Versicherten
nach
Alter
34a
Abbildung Nr. 9
Verteilung der Versicherten nach Branchen
35a
Abbildung Nr. 10
Verteilung der Leistungsbezieher nach Branchen
35a
Abbildung Nr. 11
Bestandsentwicklung auf den persönlichen Konten
der
Versicherten
36a
Tabellenverzeichnis
Tabelle Nr. 0
Übersicht der Variablen des Orszag-Snower Modells
10a
Tabelle Nr. 1
Vergleich des Konsums in Periode 2
11a
Tabelle Nr. 2
Leistungshöhe in Prozent des Guthabens
auf
dem
persönlichen
Konto
29a
Tabelle Nr. 3
Leistungshöhe in Prozent des durchschnittlichen
Verdienstes
30a
Tabelle Nr. A1
Anzahl der Versicherten und privatwirtschaftlich
Beschäftigten
in
Chile
41
Tabelle Nr. A2
Verteilung der Versicherten auf die Regionen Chiles
42
Tabelle Nr. A3
Anzahl der Versicherten nach Alter
43
Tabelle Nr. A4
Anzahl der Versicherten nach Vertragsform
44
Tabelle Nr. A5
Anzahl der Versicherten nach Geschlecht
44
Tabelle Nr. A6
Anzahl der Beitragszahler nach Vertragsform
44
Tabelle Nr. A7
Anzahl der Beitragszahler nach Regionen in Chile
45
Tabelle Nr. A8
Anzahl der Beitragszahler nach Einkommen in
Chilenischen
Pesos
46
Tabelle Nr. A9
Anzahl der Beitragszahler nach Branchen
47
Tabelle Nr. A10
Anzahl der Leistungsempfänger im Januar 2004
nach
Vertragsform
48
Tabelle Nr. A11
Anzahl der Leistungsempfänger im Januar 2004
nach
Regionen
in
Chile
48
Tabelle Nr. A12
Anzahl der Leistungsempfänger im Januar 2004
nach
Branchen
48
Tabelle Nr. A13
Durchschnittliche Leistungshöhe in Chilenischen
Pesos
nach
Branchen
49
Tabelle Nr. A14
Gesamtsumme der ausgezahlten Leistungen
nach
Herkunftsart
in
US-Dollar
50
Tabelle Nr. A15
Gesamtkapital der persönlichen Konten nach
Vertragsform in Tsd. US-Dollar
51
Abkürzungsverzeichnis
AFCChile
Administradora de Fondos de Cesantia Chile (Manag-
mentunternehmen zur Anlage der Arbeitslosenversiche-
rungs-Fonds)
AFP
Administradora des Fondos de Pensiones (Management-
unternehmen zur Anlage der Rentenversicherungsfonds)
UB Unemployment
Benefits
(Leistungen aus umlagefinan-
zierter Arbeitslosenversicherung)
UISA
Unemployment Insurance Savings Accounts
(Arbeitslosenversicherungskonten)
SAFP Superintendencia
de
Administradoras de Fondos de Pen-
siones (Staatliche Aufsichtsbehörde über die Anlagema-
nagementgesellschaften AFPs und AFCChile)
SPSA
Severance Payments Savings Accounts (Abfindungszah-
lungensparkonten)
1
1 Einleitung
Steigende Arbeitslosenzahlen und Verschiebungen in der Alterspyramide verursa-
chen gerade in Ländern mit umlagefinanzierter Arbeitslosenversicherung erhebliche
Probleme. In Deutschland soll die Absenkung der Arbeitslosenunterstützung auf So-
zialhilfeniveau (Hartz IV)
1
als Grundsicherung für Arbeitsuchende die Arbeitsfähigen
unter den Arbeitslosen anreizen, sich intensiver um einen neuen Arbeitsplatz zu be-
mühen.
Bei der Suche nach Alternativen findet man Verfechter einer völligen Abschaffung
von Arbeitslosenversicherung, die eine freiwillige Vorsorge propagieren. Des Weite-
ren finden sich in der südamerikanischen Praxis innovative Beispiele kapitalgedeck-
ter Arbeitslosenversicherung, deren Theorie seit einigen Jahren von führenden Ar-
beitsmarktökonomen hinsichtlich einer Übertragbarkeit auf andere Länder geprüft
wird.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere am Beispiel Chiles mit Arbeits-
losenversicherungskonten (Unemployment Insurance Savings Accounts (UISA)) als
einer Form kapitalgedeckter Arbeitslosenversicherung. Dabei handelt es sich um ein
System mit persönlichen Konten, auf die die Versicherten ihre Beiträge einzahlen
und von denen sie im Falle der Arbeitslosigkeit Leistungen beziehen können. Das
angesparte Guthaben wird am Ende des Erwerbslebens an den Versicherten voll-
ständig ausgezahlt. Durch diese Internalisierung der Kosten der Arbeitslosigkeit wer-
den diejenigen Versicherten finanziell belohnt, die selten oder gar nicht arbeitslos
sind. Die Finanzierung der Arbeitslosigkeit aus den eigenen Ersparnissen schafft den
Anreiz, sich um schnelle Wiedereinstellung zu bemühen und damit persönliche Res-
sourcen zu schonen.
Im Gegensatz zur kapitalgedeckten Arbeitslosenversicherung setzt die weit verbreite-
te umlagefinanzierte Versicherung Fehlanreize. Zum einen gibt es keine finanziellen
Vorteile für die Vermeidung von Arbeitslosigkeit, denn alle Arbeitnehmer zahlen den
gleichen Prozentsatz ihres Bruttoeinkommens an Beiträgen ein, Leistungen erhalten
aber nur diejenigen Versicherten, die arbeitslos werden. Zum anderen fehlt ein finan-
zieller Anreiz durch eine möglicherweise aufwendige Suche schnell von der Arbeits-
losigkeit in ein Beschäftigungsverhältnis zurückzukehren.
1
Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, auch bekannt als Hartz IV
2
Dieser aus einem fehlenden Anreiz resultierende Mangel an Suchintensität wird als
Moral Hazard bezeichnet, der, obwohl erst durch die Existenz der Versicherung her-
vorgerufen, als das Hauptproblem des Umlageverfahrens angesehen werden kann.
1.1 Ziel der Arbeit
Die bisherige Literatur zum Thema der UISA beschäftigt sich hauptsächlich mit der
Darstellung von theoretischen Modellen und fiktiven Berechnungen, ob sich eine
Umstellung auf UISA aus einem bisherigen System lohne
2
. Ziel der vorliegenden Ar-
beit ist es hingegen, anhand einer umfassenden Diskussion der wichtigsten theoreti-
schen Modellansätze, sowie der Charakteristika des 2002 in Chile in der Praxis ein-
geführten Systems, einen Überblick über diese Form der Arbeitslosenversicherung
zu geben. Mit Hilfe von Praxisdaten der staatlichen chilenischen Aufsichtsbehörde
über die Arbeitslosenversicherung (SAFP), die eine Auswertung der Einführungs-
phase ermöglichen, soll hier eine Bewertung des Systems bezüglich der Realisier-
barkeit in der Praxis vorgenommen werden.
1.2 Aufbau der Arbeit
Das folgende Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Notwendigkeit staatlicher Arbeitslo-
senversicherung im Vergleich zu freiwilliger Vorsorge und privater Absicherung. Dar-
an schließt sich eine Darstellung der Behandlung der UISA in der wichtigsten Litera-
tur an, wobei neben einer ausführlichen Diskussion der Vor- und Nachteile Rentabili-
tätsberechnungen erläutert werden. Den Praxisteil bildet das vierte Kapitel, das sich
mit der Umsetzung der UISA in Chile beschäftigt. Ausgehend von der bisherigen
Form der Arbeitslosenunterstützung werden die Charakteristika der neuen UISA auf-
gezeigt und die Daten des ersten Laufzeitjahres ausgewertet. Unterschiede zwischen
den theoretischen Modellen und dem chilenischen System werden aufgezeigt und
mögliche Gründe dargestellt. Das letzte Kapitel fasst die Kernpunkte noch einmal
zusammen und geht auf die Möglichkeiten der Umsetzung in Deutschland als Alter-
native zum bisherigen umlagefinanzierten System ein. Eine persönliche Einschät-
zung beendet die Arbeit.
2
Berechnungen für die USA: Feldstein/Altman (1998), ,,Unemployment Insurance Savings Accounts"
für Estland: Vodopivec/Rejec (2001), ,,Unemployment Insurance Savings Accounts: Simulation results
for Estonia"
3
2 Notwendigkeit staatlicher Arbeitslosenversicherung
Bevor man unterschiedliche Formen von Arbeitslosenversicherung darstellen kann,
sollte die grundsätzliche Notwendigkeit der staatlichen Organisation einer solchen
Absicherung der Beschäftigten aufgezeigt werden. Eine Arbeitslosenversicherung
leistet finanzielle Unterstützung, wenn Lohnzahlungen aufgrund von Arbeitslosigkeit
ausbleiben. Es stellt sich die Frage, ob durch diese Leistungen Effizienzgewinne er-
zielt werden können. Einerseits sind Arbeitslose auf diese Weise nicht dazu gezwun-
gen, jede mögliche Arbeit anzunehmen, sondern können einen Zeitraum überbrü-
cken, um auf ein als akzeptabel empfundenes Angebot zu warten. Andererseits ist es
möglich, dass die Suchzeit der Arbeitslosen auf diese Weise unnötig verlängert wird,
da sie durch die Zahlungen der Versicherung auf Kosten der Allgemeinheit ihren Le-
bensunterhalt bestreiten können. Das führt zu der Überlegung, ob eine zwangsweise
umverteilende Arbeitslosenversicherung die richtigen Anreize biete, sich intensiv um
eine optimale Stelle zu bemühen. Oder ob die hohen Arbeitslosenzahlen, wie sie
derzeit zum Beispiel in Deutschland zu finden sind, auf die Existenz dieser Versiche-
rung zurückzuführen seien. Im Folgenden werden Vor- und Nachteile der staatlichen
Arbeitslosenversicherung am Beispiel Deutschlands dargestellt und gegen andere
Organisationsformen abgewogen.
2.1 Argumente für staatliche Arbeitslosenversicherung
Primärziel einer Arbeitslosenversicherung ist die zeitweise Sicherung des Lebensun-
terhalts im Falle der Arbeitslosigkeit. Dabei ist zunächst unerheblich, in welcher Form
diese finanzielle Absicherung organisiert ist. Durch das weiterhin regelmäßige Ein-
kommen kann der Versicherte weiter konsumieren. Da der Arbeitslose Beiträge in die
Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, kann man dies als intertemporale Umvertei-
lung sehen. In Zeiten der Beschäftigung hat er auf Konsum verzichtet, um in Zeiten
der Arbeitslosigkeit davon zu profitieren. Allerdings ist eine solche intertemporale
Umverteilung auch ohne Arbeitslosenversicherung möglich, indem der Beschäftigte
selber privat vorsorgt. Berechnungen einer Studie der Bertelsmann Stiftung, Heinz
Nixdorf Stiftung und Ludwig-Erhard-Stiftung
3
zufolge, kann ein Arbeitnehmer in drei
Jahren mit den derzeit in Deutschland üblichen Arbeitslosenversicherungsbeiträgen
eine sechsmonatige Arbeitslosigkeit selbständig überbrücken.
3
Siehe Bertelsmann Stiftung et al. (2003)
4
Gleichzeitig bietet die umlagefinanzierte Arbeitslosenversicherung den Vorteil einer
interpersonellen Umverteilung von Reich zu Arm, von Beschäftigten zu Arbeitslosen.
Diese Art der Umverteilung kann von einer privaten Vorsorge nicht geleistet werden.
Neben den angesprochenen Versicherungsaspekten bietet eine Arbeitslosenversi-
cherung positive Effekte für die Wirtschaft. Hansen und Imrohoroglu haben in ihrer
Studie
4
einer Modell-Wirtschaft herausgefunden, dass die Existenz einer Arbeitslo-
senversicherung bei Annahme einer gewissen Risikoaversion und einem niedrigen
Absicherungsniveau wie in den USA
5
für die Wirtschaft optimal ist.
Eine andere Argumentation für Arbeitslosenversicherung stellen Acemoglu und Shi-
mer (1999) dar. Sie argumentieren, dass Arbeitslosenversicherung Beschäftigte an-
reizt, sich für höher bezahlte Stellen zu bewerben, auch wenn diese mit einer höhe-
ren Entlassungswahrscheinlichkeit verbunden sind. Durch eine Verschiebung von
Risiko von dem Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer wird eine effizientere Verteilung
des Gesamtrisikos erreicht. Aufgrund dieses ,,risk sharing" und dem damit einherge-
henden Anstieg des wirtschaftlichen Outputs wird der Gesamtnutzen durch die Exis-
tenz der Arbeitslosenversicherung gesteigert.
Die Autoren des ,,Jahresgutachten 2003/2004 des Sachverständigenrates zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland" kommen zu dem Ergebnis,
dass weder eine private Versicherung noch die gänzliche Abschaffung der Arbeitslo-
senversicherung geeignet sei, die in der umlagefinanzierten Versicherung bestehen-
den Fehlanreize zu verringern und gleichzeitig die nötige Absicherung zu gewährleis-
ten. Sie argumentieren, dass eine private Versicherung vor schwerwiegenden Prob-
lemen stünde, aufgrund derer es eine ,,höchst riskante sozialpolitische Strategie"
darstelle, das Zustandekommen privater Versicherungen ,,als wahrscheinlich anzu-
nehmen"
6
. Als Probleme werden dabei das systemische Risiko und die Selektions-
verzerrung angesehen.
Unter systemischem Risiko versteht man, dass die Risiken, die den Arbeitsmarkt be-
lasten, nicht unabhängig voneinander vorkommen. Dadurch wird das Risiko versi-
cherungsmathematisch schwer kalkulierbar. Eine private Versicherung wäre nur mit
einem starken Rückversicherungssystem oder staatlichen Bürgschaften möglich.
Unter Selektionsverzerrung versteht man den Informationsnachteil der Versicherung
gegenüber dem Versicherungsnehmer. Schwer zu messende Faktoren sind bei-
4
Hansen, Gary D. und Imrohoroglu, Ayse (1992) ,,The Role of Unemployment Insurance in an Econ-
omy with Liquidity Constraints and Moral Hazard"
5
finanzielle Unterstützung in Höhe von etwa 50% des durchschnittlichen Einkommens der letzten 12
Monate für maximal 6 Monate
6
Siehe Sachverständigenrat (2003)
5
spielsweise die Arbeitsmoral, der wahre Gesundheitszustand sowie die Anstrengung,
den Arbeitsplatz zu behalten bzw. einen neuen zu finden. Aber gerade diese Deter-
minanten haben einen sehr großen Einfluss auf das individuelle Arbeitslosigkeitsrisi-
ko. Das Ergebnis wäre, dass die Prämien nur anhand von messbaren Bestimmungs-
größen errechnet würden und eine Ungleichbehandlung entstehen würde. Durch
Kündigung der Versicherung durch diejenigen Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslo-
sigkeitsrisiko würde sich die Risikoverteilung soweit verschieben, bis die Versiche-
rung zusammenbricht. Diese Argumente lassen eine private Versicherung als Ersatz
für die umlagefinanzierte Arbeitslosenversicherung nicht sinnvoll erscheinen.
Eine weitere Alternative wäre die private Vorsorge durch freiwillige individuelle Er-
sparnisbildung. Auch in diesem Punkt argumentieren die Autoren des Jahresgutach-
tens dagegen. Ihrer Meinung nach sind gerade junge Arbeitnehmer am Beginn ihres
Erwerbslebens einem größeren Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt. Doch ausgerech-
net diese Gruppe mit hohem Risiko und geringen Einkommen habe nur wenig Zeit zu
sparen.
Wenn die Möglichkeit der persönlichen Sparleistung als Alternative zur staatlichen
Arbeitslosenversicherung in Betracht gezogen wird, dann sollte diese auf jeden Fall
gesetzlich verpflichtend sein. Allerdings stellt sich bei einer solchen ,,Verpflichtung
zum Sparen" dann wieder das Problem der aufwendigen Kontrolle.
2.2 Probleme durch staatliche Arbeitslosenversicherung
,,Grundsätzlich stellt jede Art der Arbeitslosenunterstützung eine Subvention der
Nicht-Arbeit dar"
7
. Diese These von Glismann und Schrader in ihrer Studie zur Re-
form der Arbeitslosenversicherung ist so plakativ wie einleuchtend. Durch Arbeitslo-
senunterstützung steigt der Anspruchslohn, der manchmal auch als Akzeptanzlohn
bezeichnet wird
8
. Darunter versteht man die Ansprüche an potentielles Einkommen
aus Beschäftigung, die unter anderem durch die Höhe der Arbeitslosenunterstützung
bestimmt werden. Durch die Arbeitslosenunterstützung erhält auch die Freizeit einen
,,Barwert"
9
ähnlich dem Barwert des Arbeitseinkommens bei Beschäftigung. Aller-
dings muss dem Freizeitbarwert noch der individuelle Nutzen der Freizeit hinzuge-
zählt werden. Je höher der Barwert der Freizeit - also hier die Arbeitslosenunterstüt-
zung - desto höher liegt auch der Anspruchslohn und desto schwieriger ist es, eine
7
Siehe Glismann und Schrader (2000)
8
Akzeptanzlohn, weil zu diesem Lohn ein Stellenangebot akzeptiert wird
9
Der Barwert ist der abdiskontierte Wert aller zukünftigen Zahlungen. Details zu Berechnung und
Interpretation siehe Glismann/Schrader (2000) sowie Franz (1996).
5a
Marktlöhne
Zahl der
Arbeitsangebote
Opportunitäts-
kosten
der Arbeit
Opportunitätskosten
der Arbeitssuche
Akzeptanzlohn
Abgangsrate
Lohn-
ersatzrate
Arbeitslosenquote
+
+
+
-
-
-
-
(-)
Abbildung Nr. 1 Zur Theorie der Arbeitssuche
Quelle: Glismann, H. H. und K. Schrader (2000) ,,Zur Reform der Deutschen Arbeits-
losenversicherung"
6
Stelle mit entsprechender Vergütung zu finden. Ebenso wie der Anspruchslohn ist
auch die Lohnersatzrate positiv korreliert mit der Höhe der Arbeitslosenunterstüt-
zung. Unter der Lohnersatzrate versteht man den Quotienten aus der Höhe der Ar-
beitslosenunterstützung zum durchschnittlichen Netto-Arbeitseinkommen
10
. Das
heißt also, dass finanzielle Arbeitslosenunterstützung die Suche nach einer neuen
Stelle erschwert, da sich der Lohn, bei dem man eine neue Stelle akzeptiert, erhöht.
Arbeitslosenversicherung erschwert daher die Stellensuche.
Eine negative Korrelation besteht zwischen der Höhe der Arbeitslosenunterstützung
und der Abgangsrate. Diese beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der Arbeitslose in
einem definierten Zeitraum in die Erwerbstätigkeit wechseln
11
. Das bedeutet, dass je
höher die Arbeitslosenunterstützung ist, desto weniger Arbeitslose wechseln von der
Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung. Diese Abgangsrate wiederum ist negativ korre-
liert mit der Arbeitslosenquote. Je niedriger die Abgangsrate ist, desto höher steigt
die Arbeitslosenquote. Daraus ergibt sich theoretisch, dass die Existenz von Arbeits-
losenversicherungsleistungen die Arbeitslosenquote erhöht und sich somit schädlich
auf den Arbeitsmarkt auswirkt.
Die Abbildung Nr. 1 aus Glismann und Schrader (2001) veranschaulicht diese Zu-
sammenhänge. Dabei wird deutlich, dass der Akzeptanzlohn die zentrale Größe ist,
die positiv von Marktlöhnen, Arbeitsangebot und Opportunitätskosten der Arbeit
12
beeinflusst wird, sowie negativ von den Opportunitätskosten der Arbeitssuche. Damit
sind solche Kosten gemeint, die dem Arbeitslosen entstehen, wenn er keine Arbeits-
suche betreibt.
Diese theoretischen Erkenntnisse können allerdings bisher kaum in empirischen
Studien nachgewiesen werden. Franz (1982) konnte keine Evidenz finden, dass der
Anspruchslohn in irgendeiner Weise korreliert ist mit der Höhe der Arbeitslosenunter-
stützung. Das Ergebnis verwundert, da die Opportunitätskosten für Arbeitssuche sin-
ken, wenn die Arbeitslosenunterstützung steigt.
13
Glisman und Schrader (2001) stellen in einem Vergleich unterschiedlicher Studien
auf dem deutschen Arbeitsmarkt fest, dass keine der Untersuchungen einen gene-
rellen Zusammenhang zwischen Länge der Arbeitslosigkeit und anderen Faktoren
erkennen ließ, sondern maximal gruppenspezifische Aussagen gemacht werden
konnten. Vor allem lassen diese Arbeiten den Schluss zu, dass Zusammenhänge
10
In Deutschland ist die Lohnersatzrate festgelegt durch Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe in
Prozent des letzten Arbeitseinkommens.
11
Vgl. Schneider, Hujer (1998)
12
u.a. Arbeitslosenunterstützung
13
Siehe Glisman/Schrader (2000)
7
zwischen Details der jetzigen Lösung in Deutschland, wie z. B. Dauer und Höhe des
Anspruchs auf Arbeitslosenunterstützung, kaum Einfluss auf die Arbeitslosenquote
haben.
Franz (2004) dagegen spricht von zahlreichen empirischen Studien, die belegen,
dass eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auch zu einer längeren
Dauer der Arbeitslosigkeit führt. Grund sei die weniger intensive Suche nach einem
neuen Arbeitsplatz.
Keine der bisherigen empirischen Studien lässt erkennen, dass Arbeitslosenunter-
stützung die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt. Die Theorie unterstützt wie oben
beschrieben genau das Gegenteil, nämlich die Verschlechterung des Arbeitsmark-
tes durch Arbeitslosenversicherung.
2.3 Bewertung
Grundsätzlich überwiegen derzeit die Argumente, die für eine Beibehaltung der staat-
lichen Arbeitslosenversicherung in Deutschland sprechen. Eine freiwillige Sparleis-
tung, um Arbeitslosigkeit mit eigenen Mitteln zu finanzieren, benachteiligt vor allem
Geringverdiener und junge Beschäftigte. Eine private Arbeitslosenversicherung kann
erst dann eine Alternative sein, wenn die Versicherungswirtschaft bereit und in der
Lage ist, die Risiken so einzuschätzen, dass eine gerechte Prämienberechnung vor-
gelegt werden kann. Sie müsste grundsätzlich als gesetzlich verpflichtend erhoben
werden, ähnlich dem Prinzip der Autohaftpflicht, bei der ebenfalls eine Pflicht be-
steht, sich privat zu versichern.
Weder die eigene freiwillige Absicherung durch Ersparnisse noch die Privatversiche-
rung können umverteilende Funktionen übernehmen. Aber gerade diese Elemente
sind es auch, die die Arbeitslosenversicherung in Deutschland immer wieder in
Schwierigkeiten bringen. Die Erhöhung der Leistungen beispielsweise, wenn Kinder
im Haushalt sind, sowie die Finanzierung der als aktive Arbeitsmarktpolitik geltenden
Maßnahmen strapazieren die Kassen der Bundesagentur für Arbeit. Diese versiche-
rungsfremden Leistungen sollten durch das Steuer- und Transfersystem des Staates
und nicht von der beitragsfinanzierten Bundesanstalt für Arbeit erbracht werden.
Das größte Problem der umlagefinanzierten Versicherung unabhängig davon, ob
sie nun staatlich oder privat organisiert ist liegt im Verhaltensrisiko
14
(Moral Ha-
zard). Durch die Existenz der Versicherung ändert sich das Verhalten der Versiche-
rungsnehmer, die damit die Eintrittswahrscheinlichkeit des Versicherungsfalles be-
14
Vgl. Sachverständigenrat (2003)
8
einflussen können. In der Arbeitslosenversicherung bedeutet das, dass Beschäftigte
eine Entlassung provozieren oder eine Wiedereinstellung verzögern, da sie durch die
Lohnersatzleistungen abgesichert sind. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Höhe der Leistungen von der Länge der aktuellen und vorhergehenden Arbeitslosen-
zeiten unabhängig ist. Eine Lösung dieses Problems ist nur durch radikale Änderung
der Anreizstrukturen möglich, die in der Umlagefinanzierung schwer umsetzbar sind.
2.4 Optimale Arbeitslosenversicherung nach Hopenhayn
15
Ein theoretisches Modell zur Lösung des Arbeitslosenversicherungsproblems ist ur-
sprünglich von Shavell und Weiss
(1979) und später auch von Hopenhayn und Nico-
lini (1997) beschrieben worden. Darin wird dieses Problem als wiederholtes Moral
Hazard Problem dargestellt. Der Arbeitnehmer ist risikoavers und hat folgende Präfe-
renzen:
( )
[
]
=
-
0
t
t
t
t
a
c
U
E
(1)
wobei
t
c
den Konsum und
t
a die Such-Bemühung nach einer neuen Anstellung zum
Zeitpunkt t beschreibt,
1
<
einen Diskontfaktor und E die Erwartung bezüglich ei-
nes möglichen zufälligen Konsumpfades. Die Wahrscheinlichkeit eine Anstellung zu
finden ist eine Funktion der Such-Bemühung
t
a des arbeitslosen Arbeitnehmers mit
( )
t
t
a
p
p
=
(2)
wobei p streng monoton steigend in a ist.
Als Vereinfachung wird angenommen, dass alle Arbeitnehmer den gleichen Lohn w
erhalten. Der Arbeitslosenversicherungsvertrag regelt alle Zahlungsverpflichtungen
(Beiträge) und Leistungen (Arbeitslosenunterstützung) zwischen der Versicherungs-
anstalt und dem Arbeitnehmer. Ausgangslage ist das US-amerikanische Arbeitslo-
senversicherungssystem, das Arbeitslosen sechs Monate lang etwa
2
/
w
an Leis-
tungen gewährt, danach sinkt die Leistung auf Null. Die Beiträge werden in Form ei-
ner Steuer vom Arbeitslohn einbehalten, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer in
der Vergangenheit arbeitslos war oder nicht.
15
Siehe Hopenhayn, Hugo A. (2000)
9
Ein optimaler Vertrag maximiert den ex-ante Nutzen des Arbeitnehmers für eine be-
stimmte Summe an Leistungen der Versicherungsgesellschaft. Nehmen wir nun an,
dass die Steuern
16
, die vom Lohn der nächsten Anstellung gezahlt werden müssen,
von der Länge der Arbeitslosigkeit unabhängig sind. Shavell und Weiss (1979) zei-
gen für diesen Fall, dass im Optimalfall die Leistungen im Verlauf der Arbeitslosigkeit
abnehmen. Hopenhayn und Nicolini (1997) betrachten den Fall, dass die Beiträge
und Leistungen von der Länge der vorhergegangenen Arbeitslosigkeit abhängig sind.
Es stellt sich heraus, dass der optimale Vertrag so gestaltet sein muss, dass die
steuerliche Belastung bzw. die Höhe der Beiträge mit der Länge der Arbeitslosigkeit
steigen muss. Um intertemporale Anreize für möglichst kurze Arbeitslosigkeit und
möglichst hohe Such-Intensität zu setzen, müssen Arbeitnehmer für lang anhaltende
Arbeitslosigkeit bestraft werden, indem zukünftiger Konsum verringert wird. Damit
diese finanzielle Bestrafung sowohl dann greift, wenn der Arbeitnehmer weiterhin
arbeitslos bleibt, als auch dann, wenn er wieder eine Anstellung annimmt, werden
zwei Instrumente nötig: Einmal nimmt die Höhe der Leistungen mit jedem Monat der
Arbeitslosigkeit ab und des Weiteren wird die Steuerlast auf die folgenden Einkom-
men immer höher, je länger die Arbeitslosigkeit dauert.
17
In einer Erweiterung des Modells zeigen Hopenhayn und Nicolini (1997), dass die
Höhe der Leistungen eine abnehmende Funktion und die Höhe der steuerlichen Be-
lastung für Arbeitslosenversicherung eine zunehmende Funktion der Dauer aller ver-
gangenen Arbeitslosenperioden ist.
18
Dieses Modell zeigt, dass die Umlagefinanzierung, in der keinerlei Verbindung zwi-
schen Höhe und Dauer der Einzahlungen und dem Erhalt von Leistungen gegeben
ist, nicht optimal sein kann. Eine Möglichkeit, diese Verbindung zu schaffen, sind
Unemployment Insurance Savings Accounts, die im folgenden Kapitel eingehend
dargestellt und erläutert werden.
3 Unemployment Insurance Savings Accounts in der
Theorie
In diesem Kapitel werden die UISA so vorgestellt, wie sie bisher in der Theorie dar-
gestellt worden sind. Neben einer Definition werden Vor- und Nachteile aufgezeigt
und schließlich eine Diskussion über die Realisierbarkeit, Effizienz und Optimalität
der UISA geführt.
16
in anderen Systemen, wie z.B. Deutschland, Höhe der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
17
siehe Hopenhayn (2000)
18
siehe Hopenhayn (2000)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832481575
- ISBN (Paperback)
- 9783838681573
- DOI
- 10.3239/9783832481575
- Dateigröße
- 725 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Juli)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- umemployment accounts alternative arbeitslosenversicherung kapitalgedeckte uisa
- Produktsicherheit
- Diplom.de