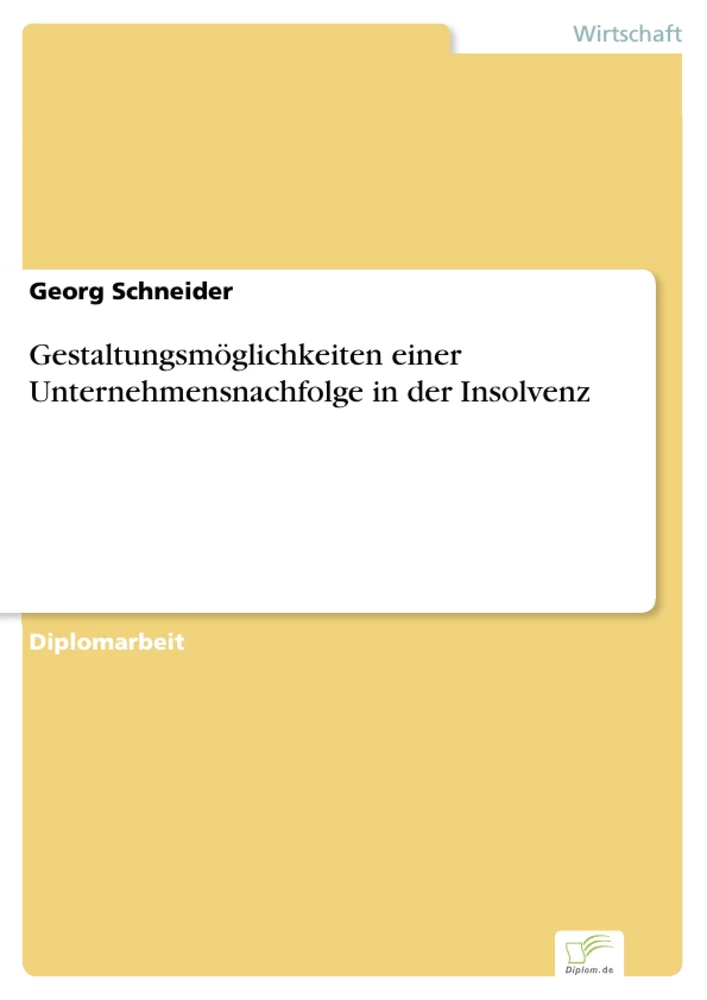Gestaltungsmöglichkeiten einer Unternehmensnachfolge in der Insolvenz
Zusammenfassung
Das Insolvenzverfahren wird in Deutschland seit dem 01.01.1999 bundeseinheitlich durch die Insolvenzordnung (InsO) geregelt. Ziel des Insolvenzverfahrens ist die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger eines in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Schuldners. Die Befriedigung erfolgt durch Verwertung und Verteilung des Schuldnervermögens oder durch eine im sog. Insolvenzplan getroffene, abweichende Regelung (§ 1 InsO).
Gehört zum Vermögen des Schuldners ein Unternehmen, so besteht eine Verwertungsmöglichkeit darin, das Unternehmen als Ganzes zu verkaufen. Gegenüber einer Zerschlagung des Unternehmens durch Einzelverkauf läßt sich mit der Gesamtverwertung ein höherer Erlös erzielen, sofern das Unternehmen zukünftige Erträge verspricht. In diesem Fall verbessert sich die Befriedigung der Gläubiger. Ein weiterer Vorteil ist gegeben, wenn der neue Unternehmensträger das Unternehmen tatsächlich weiterführt und hierdurch Arbeitsplätze erhalten bleiben und ggf. Folgeinsolvenzen vermieden werden. In der Praxis spielt der Verkauf insolventer Unternehmen aufgrund der genannten Vorteile eine wichtige Rolle,. Zusätzliche Bedeutung hat diese Form der Verwertung dadurch erlangt, daß die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den letzten Jahren ständig gestiegen ist.
Voraussetzung für einen Verkauf in der Insolvenz ist, daß der Insolvenzantrag gestellt bzw. das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Außerdem muß das Unternehmen bis zum Verkauf fortgeführt werden und verkaufsfähig sein. Zur Behandlung dieser Voraussetzungen stellt die vorliegende Arbeit zunächst das Insolvenzverfahren in seinen Grundzügen vor und zeigt anschließend Aspekte der Unternehmensfortführung bis zum Verkauf auf.
Danach werden die insolvenzrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten des Unternehmensverkaufs aufgezeigt und im Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile untersucht. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den verschiedenen Verfahrensstadien, während derer ein Verkauf erfolgen kann.
Der Begriff des Unternehmens wird in der Insolvenzordnung an verschiedenen Stellen benutzt, ohne dort oder in einem anderen deutschen Gesetz normiert zu sein. In dieser Arbeit soll unter einem Unternehmen eine Gesamtheit von Sachen und Rechten, tatsächlichen Beziehungen und Erfahrungen sowie unternehmerischen Handlungen verstanden werden. Diese Definition umfaßt die immateriellen Vermögenswerte (z. B. Know-how, Kundenstamm und Bekanntheitsgrad der Firma), die einen großen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Unternehmensverkauf in der Insolvenz
2. Verfahrensablauf nach der Insolvenzordnung
2.1. Insolvenzeröffnungsverfahren
2.2. Insolvenzverfahren
2.3. Insolvenzplanverfahren
3. Unternehmensfortführung bis zum Verkauf
3.1. Fortführung im Eröffnungsverfahren
3.2. Fortführung im Insolvenzverfahren
4. Gestaltungsmöglichkeiten
4.1. Verkaufsart
4.1.1. Share Deal
4.1.2. Asset Deal
4.2. Verkauf im Eröffnungsverfahren
4.3. Verkauf im Insolvenzregelverfahren
4.3.1. Verkauf vor dem Berichtstermin
4.3.2. Verkauf nach dem Berichtstermin
4.4. Verkauf im Insolvenzplanverfahren
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der verwendeten Gesetze
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Unternehmensverkauf in der Insolvenz
Das Insolvenzverfahren wird in Deutschland seit dem 01.01.1999 bundeseinheitlich durch die Insolvenzordnung (InsO) geregelt. Ziel des Insolvenzverfahrens ist die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger eines in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Schuldners. Die Befriedigung erfolgt durch Verwertung und Verteilung des Schuldnervermögens oder durch eine im sog. Insolvenzplan getroffene, abweichende Regelung (§ 1 InsO).
Gehört zum Vermögen des Schuldners ein Unternehmen, so besteht eine Verwertungsmöglichkeit darin, das Unternehmen als Ganzes zu verkaufen. Gegenüber einer Zerschlagung des Unternehmens durch Einzelverkauf läßt sich mit der Gesamtverwertung ein höherer Erlös erzielen, sofern das Unternehmen zukünftige Erträge verspricht. In diesem Fall verbessert sich die Befriedigung der Gläubiger. Ein weiterer Vorteil ist gegeben, wenn der neue Unternehmensträger das Unternehmen tatsächlich weiterführt und hierdurch Arbeitsplätze erhalten bleiben und ggf. Folgeinsolvenzen vermieden werden[1]. In der Praxis spielt der Verkauf insolventer Unternehmen aufgrund der genannten Vorteile eine wichtige Rolle[2],[3]. Zusätzliche Bedeutung hat diese Form der Verwertung dadurch erlangt, daß die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den letzten Jahren ständig gestiegen ist[4].
Voraussetzung für einen Verkauf in der Insolvenz ist, daß der Insolvenzantrag gestellt bzw. das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Außerdem muß das Unternehmen bis zum Verkauf fortgeführt werden und verkaufsfähig sein. Zur Behandlung dieser Voraussetzungen stellt die vorliegende Arbeit zunächst das Insolvenzverfahren in seinen Grundzügen vor und zeigt anschließend Aspekte der Unternehmensfortführung bis zum Verkauf auf.
Danach werden die insolvenzrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten des Unternehmensverkaufs aufgezeigt und im Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile untersucht. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den verschiedenen Verfahrensstadien, während derer ein Verkauf erfolgen kann.
Der Begriff des „Unternehmens“ wird in der Insolvenzordnung an verschiedenen Stellen benutzt[5], ohne dort oder in einem anderen deutschen Gesetz normiert zu sein[6]. In dieser Arbeit soll unter einem Unternehmen eine „Gesamtheit von Sachen und Rechten, tatsächlichen Beziehungen und Erfahrungen sowie unternehmerischen Handlungen“ verstanden werden[7]. Diese Definition umfaßt die immateriellen Vermögenswerte (z. B. Know-how, Kundenstamm und Bekanntheitsgrad der Firma), die einen großen Anteil am Unternehmenswert besitzen und damit auch zum Gelingen eines Verkaufs beitragen können. Durch das Merkmal der „Gesamtheit“ wird klar gestellt, daß rechtlich unselbständige Teile eines Unternehmens nicht unter den Unternehmensbegriff fallen[8].
Trotz des fehlenden Unternehmensbegriffs in den Gesetzestexten besteht Einigkeit darüber, daß das Unternehmen Gegenstand des Rechtsverkehrs und somit kauf- und verkaufsfähig ist[9]. Rechtliche Grundlage für den Unternehmenskauf ist nach herrschender Meinung[10] das Kaufvertragsrecht gem. § 433 BGB ff.. Unter dem Begriff „Unternehmensverkauf“ ist im Sinne dieser Arbeit also der Abschluß eines Kaufvertrages über das weiter oben definierte Unternehmen zu verstehen[11].
Der Begriff „Insolvenz“ umfaßt schließlich die in der InsO definierten Zeiträume des Eröffnungs- und des Insolvenzverfahrens[12],[13].
2. Verfahrensablauf nach der Insolvenzordnung
2.1. Insolvenzeröffnungsverfahren
Antrag auf Eröffnung
Das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Schuldners wird nur auf Antrag eingeleitet. Als Schuldner kommen insbesondere natürliche und juristische Personen (z. B. GmbH, AG) sowie Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. OHG, KG, GbR) in Betracht (§ 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 InsO).
Der Antrag ist beim zuständigen Insolvenzgericht einzureichen (§§ 2, 3 InSO). Antragsberechtigt sind die Gläubiger oder der Schuldner selbst (§ 13 Abs. 1 InsO). Bei juristischen Personen oder Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit ist jedes Mitglied des Vertretungsorgans (Geschäftsführer, Vorstand) und jeder persönlich haftende Gesellschafter antragsberechtigt. Nicht in der InsO, sondern in den jeweiligen Spezialgesetzen ist die Pflicht zur Antragsstellung z. B. für Kapitalgesellschaften und Gesellschaften ohne persönlich haftende natürliche Person geregelt[14]. Verstöße gegen die Antragspflicht können zu Schadensersatzverpflichtungen führen und strafbar sein[15].
Antragsprüfung
Das Gericht prüft den Antrag auf Zulässigkeit und Begründetheit. Die Zulässigkeit richtet sich nach den allgemeinen Prozeßvoraussetzungen (§ 4 InsO i. V. m. der ZPO). Geprüft wird insb. die Insolvenzfähigkeit des Schuldners (§ 11 InsO) sowie beim Gläubigerantrag die Berechtigung der Forderung und die Glaubhaftigkeit des vorgebrachten Eröffnungsgrundes (§ 14 InsO)[16].
Ist der Antrag zulässig, so muß der Schuldner vom Insolvenzgericht gehört werden (§ 20 InsO).
Begründet ist der Antrag, wenn mindestens einer der drei Eröffnungsgründe
- Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO),
- drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder
- Überschuldung (§ 19 InsO)
vorliegt und die Insolvenzmasse die Verfahrenskosten deckt (§ 26 InsO).
Die Insolvenzmasse ist das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung gehört und das er während des Verfahrens erlangt (§ 35 InsO)[17].
Sicherungsmaßnahmen
In der Zeit bis zum Entscheid über den Eröffnungsantrag hat das Insolvenzgericht die Pflicht, Maßnahmen zur Sicherung des Schuldnervermögens zu treffen (§ 21 InsO). Das Gericht kann bei Zulässigkeit des Eröffnungsantrages[18] einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, dem Schuldner ein Verfügungsverbot auferlegen und Zwangsvollstreckungen gegen den Schuldner untersagen oder einstweilen einstellen. Es macht die Sicherungsmaßnahmen gem. § 23 InsO bekannt.
Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt und dem Schuldner zugleich ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt, spricht man in der Literatur vom „starken“, ansonsten vom „schwachen“ vorläufigen Insolvenzverwalter.
Der starke vorläufige Verwalter übernimmt die Befugnisse des Schuldners vollständig und hat daher weitgehende Kompetenzen und Aufgaben, insb. die Sicherung der Masse, die Weiterführung des Unternehmens und die Prüfung, ob die Masse die Verfahrenskosten deckt (§ 22 Abs. 1 InsO).
Die Pflichten des schwachen vorläufigen Insolvenzverwalters werden vom Gericht fallabhängig festgelegt. Sie dürfen die des starken vorläufigen Insolvenzverwalters nicht überschreiten (§ 22 Abs. 2 InsO). Das Gericht kann über die definierten Befugnisse hinaus bestimmte oder sämtliche Verfügungen des Schuldners von der Zustimmung des schwachen Verwalters abhängig machen (§ 21 Abs. 2 Satz 2).
Für die Entwicklung und den Ausgang des Insolvenzverfahrens ist die Qualifikation des Insolvenzverwalters von entscheidender Bedeutung[19].
2.2. Insolvenzverfahren
Eröffnungsbeschluß
Liegen die Eröffnungsvoraussetzungen vor, beschließt das Gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und macht den Beschluß sofort bekannt (§ 30 Abs.1 InsO)[20]. Im Eröffnungsbeschluß werden Schuldner und Insolvenzverwalter benannt. In der Regel nimmt der vorläufige Insolvenzverwalter die Stellung des endgültigen Insolvenzverwalters ein[21].
Die Gläubiger werden mit dem Beschluß zur Geltendmachung ihrer Forderungen und Sicherungsrechte innerhalb einer vorgegebenen Frist aufgefordert (§ 28 InsO). Weiterhin werden der Berichtstermin und der Prüfungstermin festgelegt.
Wirkung der Eröffnung
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse auf den Insolvenzverwalter über (§ 80 Abs. 1 InsO)[22], der das zur Masse gehörende Vermögen sofort in Besitz nimmt (§ 148 Abs. 1 InsO).
Einzelzwangsvollstreckungen in die Insolvenzmasse und in das sonstige Vermögen sind ab Verfahrenseröffnung unzulässig (§ 89 Abs. 1 InsO). Der Gläubigerwettlauf wird beendet. Ein Erwerb von Rechten an Gegenständen der Insolvenzmasse ist nicht mehr möglich (§ 91 Abs. 1 InsO). Darüber hinaus greift die sog. Rückschlagsperre des § 88 InsO, nach der Sicherungen, die im letzten Monat vor Antragstellung durch Zwangsvollstreckung erlangt wurden, rückwirkend unwirksam werden, so daß sich die den Gläubigern zur Verfügung stehende Masse erhöht.
Berichtstermin
Der Insolvenzverwalter erstellt Verzeichnisse der Massegegenstände und der Gläubiger sowie eine Vermögensübersicht, die jeweils spätestens eine Woche vor dem Berichtstermin ausgelegt werden (§§ 151 ff. InsO). Im Berichtstermin berichtet er der Gläubigerversammlung über die wirtschaftliche Lage des Schuldners und erläutert die Möglichkeit eines Unternehmenserhalts und eines Insolvenzplans[23] (§ 156 InsO).
Die Gläubigerversammlung entscheidet auf Grundlage des Berichtes über den Fortgang des Insolvenzverfahrens (§ 29 Abs. 1 Satz 1 InsO), insb. über Stillegung oder Fortführung des Schuldnerunternehmens (§ 157 InsO). Sie setzt sich aus den Gläubigern[24], dem Schuldner, dem Verwalter und dem evtl. vorher durch das Insolvenzgericht eingesetzten Gläubigerausschuß zusammen (§ 74 InsO).
Prüfungstermin
Der Insolvenzverwalter nimmt die Forderungsanmeldungen der Gläubiger entgegen (§ 174 InsO) und trägt diese in die Forderungstabelle ein, die allen Beteiligten zur Einsicht offen steht (§ 175 InsO). Im Prüfungstermin werden im Rahmen einer Gläubigerversammlung die angemeldeten Forderungen nach Betrag und Rang geprüft (§ 29 Abs. 1 Satz 2, § 176 InsO). Wenn weder der Verwalter noch ein Insolvenzgläubiger einer Forderung widersprechen, gilt sie als festgestellt und wird in die Tabelle mit Rang und Betrag eingetragen (§ 178 InsO). Im Falle eines Widerspruchs kann der betroffene Gläubiger Klage auf Feststellung erheben (§§ 179 ff. InsO).
Massebereinigung
Gegenstände, die sich im Fremdeigentum befinden (z. B. Mietsachen und Vorbehaltseigentum[25] ) werden vom Insolvenzverwalter aus der Masse ausgesondert (§ 47 InsO) und an den Berechtigten herausgegeben.
Mit Absonderungsrechten (z. B. Pfandrechten, Sicherungseigentum[26] ) behaftete Gegenstände verwertet der Verwalter außerhalb der Insolvenz einzeln oder durch Zwangsversteigerung (§§ 165, 166 InsO). Die absonderungsberechtigen Gläubiger (§§ 49-51 InsO) erhalten den Verkaufserlös unter Abzug der Kosten für Feststellung und Verwertung[27].
Der Insolvenzverwalter zieht zur Massemehrung Forderungen des Schuldners kraft seiner Verwaltungsbefugnis ein. Gem. § 129 InsO kann er unter den Voraussetzungen der §§ 130 ff. InsO Rechtshandlungen, die vor der Verfahrenseröffnung zu Ungunsten der Gläubiger vorgenommen wurden, anfechten und so veräußertes Schuldnervermögen wieder der Insolvenzmasse zuführen.
Vermögensgegenstände, die unverwertbar sind oder deren Verwertung die Insolvenzmasse sogar belasten würde (z. B. durch Ausbaukosten), kann der Insolvenzverwalter durch Freigabe von der Masse abtrennen und dem Schuldner wieder zur Verfügung überlassen[28].
Verwertung
Nach dem Berichtstermin setzt ohne gegenteiligen Beschluß der Gläubigerversammlung die Verwertung der Masse ein (§ 159 InsO).
Der Verwalter kann Wirtschaftsgüter ohne Zustimmung der Gläubigerversammlung einzeln freihändig verkaufen oder – bspw. durch Verwertungsgesellschaften - versteigern lassen. Plant der Verwalter hingegen eine Veräußerung des Unternehmens oder eines Betriebes, so hat er gem. § 160 InsO die Zustimmung des Gläubigerausschusses oder, falls dieser nicht bestellt ist, der Gläubigerversammlung einzuholen. Die Veräußerung hat zur Folge, daß das Unternehmen nicht mehr zur Insolvenzmasse zählt, dafür aber der Verkaufserlös die Masse erhöht[29].
Verteilung
Ist die Masse in Geld umgesetzt, so werden ihr zuerst die Kosten des Insolvenzverfahrens entnommen (§ 53 InsO). Hierzu zählen die Vergütungen des vorläufigen und des endgültigen Verwalters sowie die Gerichtskosten (§ 54 InsO). Im nächsten Schritt werden die sonstigen Masseverbindlichkeiten berichtigt, die z. B. durch Handlungen des vorläufigen starken oder des endgültigen Insolvenzverwalters entstanden sind (§ 55 InsO).
Aus der verbleibenden Teilungsmasse werden schließlich die Insolvenzgläubiger als diejenigen befriedigt, deren Anspruch bereits bei Verfahrenseröffnung bestand (§ 38 InsO). Die Befriedigung der Insolvenzgläubiger beginnt frühestens nach dem Prüftermin (§ 187 InsO). Der Verwalter erstellt ein Verzeichnis der Forderungen, die bei der Verteilung zu berücksichtigen sind (§ 188 InsO). Die Verteilung kann in Abschlägen erfolgen, sobald die Kassenlage dies erlaubt (§ 187 Abs. 2 InsO), wobei der Gläubigerausschuß - so vorhanden – zustimmen muß und die Quote festlegt (§ 195 InsO).
Nachdem die Verwertung der Masse beendet ist, erfolgt mit Zustimmung des Insolvenzgerichts die Schlußverteilung (§ 196 InsO). Über nicht verwertbare Gegenstände wird in einer abschließenden Gläubigerversammlung entschieden (§ 197 InsO).
Nach Vollzug der Schlußverteilung beschließt das Gericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens (§ 200 InsO). Nach Aufhebung des Verfahrens können die Gläubiger ihre restlichen Forderungen wieder unbeschränkt (z. B. im Wege der Einzelzwangsvollstreckung) geltend machen. Das Regelverfahren sieht keine Restschuldbefreiung des Schuldners vor[30].
2.3. Insolvenzplanverfahren
Alternativ zum bisher beschriebenen Regelverfahren bietet die Insolvenzordnung das neu geschaffene Institut des Insolvenzplans an (§§ 217 ff. InsO). Im Insolvenzplan können die Verfahrensbeteiligten in weitgehender Autonomie vom Regelverfahren abweichende Vereinbarungen treffen. Insbesondere kann in einem Insolvenzplan eine Regelung zum Erhalt des Unternehmens getroffen werden (§ 1 InsO).
Ein Insolvenzplan kann dem Insolvenzgericht vom Schuldner oder vom Insolvenzverwalter vorgelegt werden (§ 218 InsO). Der Insolvenzverwalter kann außerdem von der Gläubigerversammlung mit der Planerstellung beauftragt werden (§ 157 InsO)[31].
Der Insolvenzplan besteht aus einem darstellenden und einem gestaltenden Teil (§ 219 InsO). Bestandteil des darstellenden Teils sind die Beschreibung der Unternehmenslage, der Insolvenzursachen und der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen[32]. Die Gläubiger und das Insolvenzgericht sollen über das Ziel des Plans und den Weg zu dessen Erreichung unterrichtet werden[33]. Planziele können z. B. die Eigensanierung[34], die übertragende Sanierung[35], die Liquidation[36] oder ein Moratorium zur Stundung von Forderungen sein. Der gestaltende Teil legt fest, wie die Rechtsstellung der Beteiligten durch den Plan verändert wird (§ 221 InsO).
Die Gläubiger werden durch den Plan in Gruppen unterteilt. Vom Gesetz vorgegebene Gruppen sind absonderungsberechtigte, nicht nachrangige und nachrangige Insolvenzgläubiger (§ 222 Abs. 1 InsO). Der Planverfasser kann Gläubiger gleicher Rechtsstellung und gleichartiger wirtschaftlicher Interessen zu weiteren Gruppen zusammenfassen (§ 222 Abs. 2 InsO). Eine Gleichbehandlung der Gläubiger findet im Unterschied zum Regelverfahren nur noch innerhalb der jeweiligen Gruppe statt[37].
Das Gericht prüft den Plan auf formale und konzeptionelle Mängel (§ 231 InsO) und leitet ihn – sofern es ihn nicht zurückweist – an Gläubigerausschuß, Verwalter und Schuldner zur Stellungnahme weiter (§ 232 InsO). Insolvenzplan und Stellungnahmen werden zur Einsichtnahme der Beteiligten niedergelegt (§ 234 InsO).
Das Gericht bestimmt einen Termin, in dem nach der Erörterung und etwaigen Änderungen durch den Planverfasser über den Plan abgestimmt wird (§ 235 InsO).
Gläubiger, deren Forderungen durch den Plan nicht beeinträchtigt werden, haben kein Stimmrecht (§ 237 InsO). Die Gläubiger stimmen in den vom Plan vorgesehenen Gruppen ab (§ 243 InsO). Der Plan wird angenommen, wenn sich in jeder Gruppe eine Mehrheit nach Köpfen und Forderungssumme findet (§ 244 InsO).
Wird in einer Gruppe keine Mehrheit erzielt, so gilt die Zustimmung dieser Gruppe nach § 245 InsO gleichwohl als erteilt, wenn sich z. B. die Stellung der Gruppe durch den Plan nicht verschlechtert oder wenn die Mehrheit der Gruppen zustimmt. Hierdurch soll der Widerstand sanierungsunwilliger Gläubiger gebrochen[38] und die Annahme des Plans erleichtert werden.
Der Schuldner kann dem Plan widersprechen. Sein Widerspruch ist aber unbeachtlich, wenn er durch den Plan keine Verschlechterung seiner Stellung erfährt (§ 247 InSO).
Das Insolvenzgericht bestätigt den Plan nach Annahme durch die Gläubiger (§ 248 InsO). Mit Rechtskraft des Beschlusses treten die Wirkungen des Planes für und gegen alle Beteiligte ein (§ 254 InsO). Anschließend wird das Verfahren vom Gericht aufgehoben (§ 258 InsO).
Sofern im Insolvenzplan keine andere Vereinbarung getroffen wird, erfährt der Schuldner eine Restschuldbefreiung (§ 227 Abs. 1 InsO). Der Insolvenzplan kann vorsehen, daß seine Erfüllung vom Insolvenzverwalter überwacht wird (§§ 260 ff.).
3. Unternehmensfortführung bis zum Verkauf
3.1. Fortführung im Eröffnungsverfahren
Fortführungsverpflichtung
Die Verpflichtung des vorläufigen starken Verwalters zur Fortführung des Unternehmens im Eröffnungsverfahren ist in § 22 Abs. 1 Satz 2 InsO positiv normiert. Zur Stillegung ist er nur mit Zustimmung des Gerichts befugt. Aber auch den schwachen Verwalter trifft diese Pflicht, nachdem die Entscheidung über Fortführung oder Stillegung regelmäßig erst durch die Gläubigerversammlung getroffen werden soll (§ 157 InsO).
Vertragsbehandlung
Die Unternehmensfortführung erfordert vom vorläufigen Verwalter den Abschluß neuer Verträge (z. B. den Kauf von Rohstoffen und Betriebsmitteln zur Fertigstellung von Halbfertigungserzeugnissen) oder die Inanspruchnahme von Leistungen aus Dauerschuldverhältnissen (z. B. Mietverträge über Geschäftsräume).
Um trotz des erhöhten Insolvenzrisikos Vertragspartner für solche Geschäfte zu finden, werden die Verbindlichkeiten, die ein starker vorläufiger Verwalter eingeht, durch § 55 Abs. 2 InsO in den Status sog. sonstiger Masseverbindlichkeiten erhoben, d. h. die betroffenen Geschäftspartner werden im Falle der Insolvenzeröffnung bevorzugt aus der Masse befriedigt (§ 53 InsO). Kommt es zu einem Forderungsausfall, weil die Masse zur Befriedigung der Masseverbindlichkeiten nicht ausreicht, so ergibt sich für den starken Insolvenzverwalter ein Haftungsrisiko. Er ist gem. § 61 InsO zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er bei Begründung der Verbindlichkeit einen voraussichtlichen Mangel der Masse erkennen konnte.
Der schwache vorläufige Insolvenzverwalter kann nach h. M. vom Gericht zur Masseschuldbegründung besonders ermächtigt werden, wobei § 61 InsO dann auch auf ihn anzuwenden ist[39].
Lohnzahlungen
Ein wesentlicher Aspekt der Unternehmensfortführung ist die Lohn- und Gehaltsfortzahlung der Arbeitnehmer. Ohne die Fortzahlung wären die Arbeitnehmer kaum bereit, das Unternehmen durch ihre Mitarbeit am „Leben“ zu erhalten und so einen späteren, gesamthaften Verkauf zu ermöglichen. Insbesondere die Abwanderung besonders qualifizierter Arbeitskräfte muß vermieden werden, um die Fortführung nicht zu gefährden.
Die Bundesanstalt für Arbeit zahlt Insolvenzgeld für die letzten drei Monate vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. Abweisung des Insolvenzantrags (§ 183 Abs. 1 SGB III). Ausgezahlt wird das Insolvenzgeld aber erst bei Eröffnung des Verfahrens bzw. bei Abweisung des Insolvenzantrages. Deshalb wird das Insolvenzgeld häufig vorfinanziert[40]: Eine Bank erwirbt die Lohnforderungen, auf die später Insolvenzgeld bezahlt wird, und gewährt einen Kredit in entsprechender Höhe. Dadurch kann das Unternehmen – von den Zinsen abgesehen – günstigstenfalls drei Monate personalkostenfrei gehalten werden. Bis zum 01.12.2001 stellte die Weiterbeschäftigung für den starken Insolvenzverwalter ein hohes Risiko dar, denn die resultierenden Lohnforderungen waren Masseschulden, welche die Masse schnell aufzehren und so die Haftung gem. § 61 InsO auslösen konnten. In der Praxis wurden deshalb überwiegend schwache Verwalter bestellt[41], die keine Masseverbindlichkeiten begründen können. Nach Änderung der InsO am 1.12.2001[42] ist das Haftungsrisiko des starken vorläufigen Verwalters durch Weiterbeschäftigung jedoch stark reduziert, weil die Lohnforderungen auf die Bundesanstalt für Arbeit übergehen, welche gem. § 55 Abs. 3 InsO kein Massegläubiger ist.
Personalabbau
Im Hinblick auf die Unternehmensfortführung kann im Eröffnungsverfahren der Abbau von Personal erforderlich sein (z. B. zur Senkung der Kosten im Insolvenzverfahren oder zur Erhöhung der Verkaufschancen). Zu dieser Maßnahme ist der starke vorläufige Verwalter befugt, weil die Arbeitgeberfunktion auf ihn übergeht[43]. Dem schwachen Verwalter kann diese Funktion vom Gericht zugeteilt werden. Im Gegensatz zum Insolvenzverfahren stehen im Eröffnungsverfahren die vereinfachten Kündigungsregelungen der §§ 113 und 120 ff. InsO nicht zur Verfügung, d. h. es ist der übliche arbeits- und betriebsverfassungsrechtliche Ablauf einzuhalten, der hier nicht näher vertieft werden soll.
Vor Durchführung eines Personalabbaus wird der vorläufige Verwalter sicherheitshalber das Insolvenzgericht um Zustimmung ersuchen, um nicht gegen das Stillegungsverbot des § 22 Abs. 1 Satz 2 InsO zu verstoßen. Um im eröffneten Verfahren die vereinfachten Möglichkeiten des Personalabbaus schneller nutzen zu können, kann der Verwalter bereits im Eröffnungsverfahren vorbereitende Maßnahmen treffen, wie z. B. mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich vorbereiten.
Liquidität
Ein wichtiger Aspekt der Unternehmensfortführung im Eröffnungsverfahren ist die Schaffung bzw. Aufrechterhaltung der Liquidität.
Die Liquiditätssituation eines Unternehmens ist nach Stellung des Insolvenzantrages meist schlecht. Mit Bekanntwerden des Antrages drohen Umsatzeinbrüche[44]. Kunden werden die korrekte Abwicklung neuer Geschäfte skeptisch beurteilen und versuchen, auf andere Lieferanten auszuweichen. Ein weiterer Abwanderungsgrund kann die Befürchtung sein, zukünftig keine Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können.
Lieferanten werden meist nur noch gegen Vorkasse liefern, insb. wenn sie wegen Fehlens eines starken Verwalters keine Stellung als Massegläubiger erlangen können. Nicht selten wird eine Belieferung von der Bezahlung rückständiger Forderungen abhängig gemacht. Diese Tendenzen können die Liquidität und damit die Fortführung gefährden. Das verloren gegangene Vertrauen muß vom vorläufigen Verwalter möglichst schnell zurückgewonnen werden. Zur Aufrechterhaltung der Kunden- und Lieferantenbeziehungen muß der Verwalter eine Zukunftsperspektive vermitteln, z. B. durch Vorlage eines überzeugenden Fortführungskonzeptes[45].
Der konsequente Forderungseinzug durch die im Falle der Fortführung noch funktionierende Debitorenbuchhaltung trägt ebenso wie die Ausproduktion und der Verkauf halbfertiger Erzeugnisse zur Verbesserung der Liquidität bei[46]. Die bereits behandelte Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes ermöglicht die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter ohne Liquiditätseinbuße. Auch zulässige Notverwertungen (bspw. verderblicher Waren[47] oder nicht betriebsnotwendiger Anlagegüter[48] ) leisten einen Beitrag zur Liquiditätsverbesserung.
Häufig bedarf es zur Fortführung einer zusätzlichen Finanzierungshilfe von dritter Seite, vor allem durch die Gläubigerbanken des Schuldners[49]. Für diese kann eine Darlehensvergabe zum Zwecke der Unternehmensfortführung dann sinnvoll sein, wenn eine Stillegung zu einer erheblichen Wertminderung ihrer bestehenden Sicherungsrechte führt und sie zudem als Massegläubiger abgesichert werden.
3.2. Fortführung im Insolvenzverfahren
Fortführungsverpflichtung
Die Entscheidung über Stillegung oder Weiterführung des Unternehmens soll erst im Berichtstermin durch die Gläubigerversammlung gefällt werden (§ 157 InsO). Auch der endgültige Insolvenzverwalter hat daher die Aufgabe, das Unternehmen zumindest bis zu diesem Termin fortzuführen. Einer ausnahmsweisen Stillegung muß - falls vorhanden – der Gläubigerausschuß zustimmen (§ 158 InsO).
Vertragsbehandlung
Auch im eröffneten Verfahren erfordert die Unternehmensfortführung den Abschluß neuer Geschäfte. Der Verwalter begründet mit Neuverträgen Masseverbindlichkeiten (§ 55 Abs. 1 Nr.1). Reicht die Masse für die Erfüllung nicht aus, ist er dem persönlichen Haftungsrisiko des § 61 InsO ausgesetzt. Insoweit bestehen ähnliche Regeln wie für den vorläufigen starken Insolvenzverwalter im Eröffnungsverfahren.
Ein wichtiger Unterschied zum Eröffnungsverfahren besteht in der Behandlung von gegenseitigen Verträgen, die der Schuldner vor Verfahrenseröffnung geschlossen hat und die noch nicht beiderseits erfüllt sind. Nach § 103 Abs. 1 InsO hat der Insolvenzverwalter hier freies Wahlrecht, ob er diese Verträge erfüllen will oder nicht. Bei der Ausübung ist der Verwalter den Interessen der Insolvenzgläubiger verpflichtet, d. h. er darf sich nur von der Frage leiten lassen, ob die Erfüllung zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Masse führt[50].
[...]
[1] Für diesen Fall wird in der Literatur der Begriff der „übertragenden Sanierung“ benutzt. Vgl. Schmidt, K. (1980), S. 336, der diesen Begriff prägte und damit ursprünglich die Übertragung des Unternehmens auf eine eigens zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft bezeichnete.
[2] Vgl. Kammel, V. (2000), S. 102.
[3] Vgl. Angermann, T. (1987), S. 19.
[4] Vgl. Statistisches Bundesamt (2002, 2003a, 2003b): Die Zahl der Unternehmensinsolvenzverfahren betrug in den Jahren 2000 bis 2003 (Jahreszahl in Klammern): 28.235 (2000), 32.278 (2001), 37.579 (2002), 19.953 (1. Halbjahr 2003).
[5] Vgl. §§ 1, 19, 22, 104, 122, 151, 156, 157, 158,160, 162, 163, 229, 230, 260 InsO.
[6] In der wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Literatur konkurrieren verschiedene Definitionsansätze, die hier nicht diskutiert werden können. Vgl. auch Bringezu, J. (1997), S. 57–101.
[7] Vgl. Picot, G. (1998), S. 4 und Beisel, W., Klumpp, H.-H. (1996), S. 4.
[8] Für solche Unternehmensteile wird der Begriff „Betrieb“ verwendet. Vgl. Beisel, W., Klumpp, H.-H. (1996), S. 6.
[9] Vgl. Beisel, W., Klumpp, H.-H. (1996), S. 5.
[10] Vgl. Bringezu, J. (1997), S. 11.
[11] Häufig werden die Begriffe „Verkauf“ und „Veräußerung“ synonym verwendet. Die Veräußerung stellt aber einen Oberbegriff dar und umfaßt auch andere Rechtsgeschäfte, z.B. den Tausch.
[12] Das Eröffnungsverfahren beginnt mit dem Eröffnungsantrag (§ 13 InsO) und endet mit dem Eröffnungs- bzw. Abweisungsbeschluß (§§ 26, 27 InsO).
[13] Das Insolvenzverfahren beginnt mit dem Eröffnungsbeschluß (§ 27 InsO) und endet durch Aufhebung gem. §§ 200, 258 InsO oder durch Einstellung gem. §§ 207 ff. InsO.
[14] Vgl. z. B. § 130a HGB, § 92 Abs. 2 AktG, § 64 Abs.1 GmbHG.
[15] Vgl. Braun, E., Uhlenbruck, W. (1997), S. 80-82.
[16] Vgl. Foerste, U. (2003), S. 46, Rz. 92.
[17] Unpfändbare Gegenstände zählen gem. § 36 InsO nicht zur Insolvenzmasse.
[18] Vgl. Pape, G., Uhlenbruck, W. (2002), S. 281, Rz. 360.
[19] Vgl. Pape, G., Uhlenbruck, W. (2002), S. 306, Rz. 395.
[20] Die Eröffnungsstunde ist gem. § 27 Abs. 2 Satz 2 im Beschluß angegeben. Ansonsten wird sie gem. § 27Abs. 3 InsO auf die Mittagsstunde des Beschlußtages gelegt.
[21] Vgl. Ehlers, H., Drieling, I. (1998), S. 18.
[22] Dies gilt nicht bei Anordnung der Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO). In diesem Fall bleibt der Schuldner unter Aufsicht eines Sachwalters verwaltungs- und verfügungsbefugt.
[23] Vgl. Kapitel 2.3. dieser Arbeit.
[24] Nachrangige Gläubiger, die § 39 InsO definiert, nehmen nicht teil.
[25] Vgl. Häsemeyer, L. (2002), S. 259.
[26] Vgl. Pape, G., Uhlenbruck, W. (2002), S. 403, Rz. 530.
[27] Pauschal werden 4% des Erlöses für die Feststellung und 5% für die Verwertung abgezogen (§ 171 InsO).
[28] Die Freigabe ist in der InsO nicht geregelt, wird aber allgemein anerkannt.
[29] Vgl. Kapitel 4.3.2. dieser Arbeit.
[30] Natürliche Personen können jedoch gem. §§ 286 ff. Restschuldbefreiung erlangen.
[31] Damit können im Grenzfall drei konkurrierende Pläne existieren.
[32] Vgl. Smid, S., Rattunde, R. (1998), S. 79, Rz. 274 ff..
[33] Vgl. Maus, K.-H. (1999), S. 579, Rz. 1062.
[34] Darunter ist die Sanierung und Fortführung des Unternehmens unter Beibehaltung des Unternehmensträgers zu verstehen, wobei die Gläubiger aus zukünftigen Erträgen befriedigt werden.
[35] Vgl. Kapitel 4.4. dieser Arbeit.
[36] Mit Liquidation ist hier der Einzelverkauf gemeint, der auch im Regelverfahren durch den Verwalter erfolgen kann. Demgegenüber ermöglicht ein Liquidationsplan den Gläubigern mehr Mitspracherecht, z. B. die Vereinbarung einer Restschuldbefreiung oder die Beteiligung an Verwertungsentscheidungen.
[37] Vgl. Wellensiek, J. (1999c), S. 410.
[38] Vgl. Wellensiek, J. (2002), S. 238.
[39] Vgl. Marotzke, W. (2000), S. 87-88, Rz. 163-164.
[40] Vgl. Wellensiek, J. (1999a), S. 358, Rz. 649.
[41] Vgl. Foerste, U. (2003), S. 52, Rz. 100.
[42] Vgl. Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze vom 26. Oktober 2001 (BGBl. I 2710).
[43] Vgl. Pape, G., Uhlenbruck, W. (2002), S. 316, Rz. 407.
[44] Vgl. Wellensiek, J. (1999a), S. 356, Rz. 644.
[45] Vgl. Wellensiek, J. (2002), S. 236.
[46] Vgl. Wellensiek, J. (1999c), S. 406.
[47] Vgl. Uhlenbruck, W. (1995), S. 200.
[48] Vgl. Mönning, R.-D. (1997), Betriebsfortführung in der Insolvenz, S. 82, Rz. 312.
[49] Vgl. Wellensiek, J. (1999a), S. 357, Rz. 647.
[50] Vgl. Pape, G. (2000), S. 538.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832481537
- ISBN (Paperback)
- 9783838681535
- DOI
- 10.3239/9783832481537
- Dateigröße
- 280 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Juli)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- konkurs insolvenzordnung sanierung betriebsübergang insolvenzrecht
- Produktsicherheit
- Diplom.de