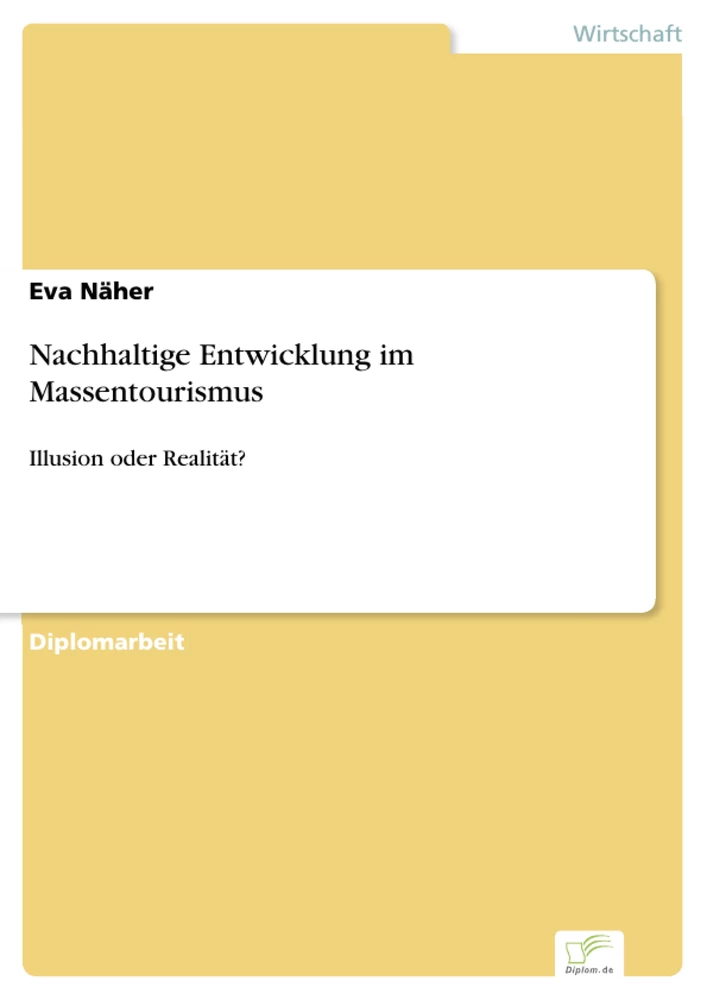Nachhaltige Entwicklung im Massentourismus
Illusion oder Realität?
©2003
Diplomarbeit
200 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
In der Wahrnehmung der Allgemeinheit werden Nachhaltigkeit und Massentourismus als unvereinbare Gegensätze deklariert. Nachhaltigkeit wird mit verträglichen, langfristigen und kleindimensionierten Projekten assoziiert; Massentourismus hingegen mit einfallenden Touristenhorden und verheerenden ökologischen sowie soziokulturellen Auswirkungen auf die bereiste Region. Ist trotz dieser scheinbaren Dissonanz eine nachhaltige Gestaltung des Massentourismus überhaupt möglich?
Die Notwendigkeit einer derartigen Konzeption zeigt die allgegenwärtige Präsenz und Dominanz des Massentourismus. Die westliche Welt verreist alljährlich, bringt damit die touristischen Massen hervor. Die bereisten Länder heißen die Touristen in Anbetracht des quellenden Devisenstromes mehr oder weniger willkommen. Beide Seiten profitieren vom Tourismus: die einen sehen ihre wichtigsten Regenerationsbedürfnisse in fernen Ländern befriedigt Ruhe, das exotische, einzigartige Erlebnis und die Abwechslung vom tristen Alltag zuhause; die anderen tolerieren die Massen als wichtige Existenzgrundlage.
Alle profitieren vom Tourismus allen voran die Reiseveranstalter aus den touristischen Quellländern. Dies erweckt Missmut bei den Bereisten und der wirtschaftlich gelenkte touristische Raubbau vernichtet die Attraktivität der Landschaft und Kultur das touristische Kapital der Region und damit nicht zuletzt deren zukünftige Einnahmequelle.
Dieser typische Zyklus der touristischen Erschließung mit einem ungezügelten Massentourismus in der Hochphase, der alle weiteren Perspektiven für die Region vernichtet, muss unterbunden werden. Vor dem Hintergrund einer unausweichlichen Dependenz zahlreicher Regionen vom Massentourismus, bleibt einzig dessen verträgliche Gestaltung mit einer nachhaltigen Entwicklung im Massentourismus, welche touristische mit ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten vereint.
Ziel der Arbeit ist das Aufzeigen nachhaltiger Handlungsweisen für den Massentourismus unter Einbindung der konzeptionellen Organisationsstrukturen in Nationalparks. Besuchermagnete wie der Grand Canyon Nationalpark in den USA oder der Kakadu-Nationalpark in Australien müssen trotz der zu bewältigenden Besucherströme ihren Auftrag zur Erhaltung des ökologischen Erbes erfüllen. Eine Adaption auf das allgemeine Tourismusgeschehen erscheint somit nicht nur sinnvoll, sondern auch realisierbar.
Bislang wurden vorrangig Nischenprodukte wie der […]
In der Wahrnehmung der Allgemeinheit werden Nachhaltigkeit und Massentourismus als unvereinbare Gegensätze deklariert. Nachhaltigkeit wird mit verträglichen, langfristigen und kleindimensionierten Projekten assoziiert; Massentourismus hingegen mit einfallenden Touristenhorden und verheerenden ökologischen sowie soziokulturellen Auswirkungen auf die bereiste Region. Ist trotz dieser scheinbaren Dissonanz eine nachhaltige Gestaltung des Massentourismus überhaupt möglich?
Die Notwendigkeit einer derartigen Konzeption zeigt die allgegenwärtige Präsenz und Dominanz des Massentourismus. Die westliche Welt verreist alljährlich, bringt damit die touristischen Massen hervor. Die bereisten Länder heißen die Touristen in Anbetracht des quellenden Devisenstromes mehr oder weniger willkommen. Beide Seiten profitieren vom Tourismus: die einen sehen ihre wichtigsten Regenerationsbedürfnisse in fernen Ländern befriedigt Ruhe, das exotische, einzigartige Erlebnis und die Abwechslung vom tristen Alltag zuhause; die anderen tolerieren die Massen als wichtige Existenzgrundlage.
Alle profitieren vom Tourismus allen voran die Reiseveranstalter aus den touristischen Quellländern. Dies erweckt Missmut bei den Bereisten und der wirtschaftlich gelenkte touristische Raubbau vernichtet die Attraktivität der Landschaft und Kultur das touristische Kapital der Region und damit nicht zuletzt deren zukünftige Einnahmequelle.
Dieser typische Zyklus der touristischen Erschließung mit einem ungezügelten Massentourismus in der Hochphase, der alle weiteren Perspektiven für die Region vernichtet, muss unterbunden werden. Vor dem Hintergrund einer unausweichlichen Dependenz zahlreicher Regionen vom Massentourismus, bleibt einzig dessen verträgliche Gestaltung mit einer nachhaltigen Entwicklung im Massentourismus, welche touristische mit ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten vereint.
Ziel der Arbeit ist das Aufzeigen nachhaltiger Handlungsweisen für den Massentourismus unter Einbindung der konzeptionellen Organisationsstrukturen in Nationalparks. Besuchermagnete wie der Grand Canyon Nationalpark in den USA oder der Kakadu-Nationalpark in Australien müssen trotz der zu bewältigenden Besucherströme ihren Auftrag zur Erhaltung des ökologischen Erbes erfüllen. Eine Adaption auf das allgemeine Tourismusgeschehen erscheint somit nicht nur sinnvoll, sondern auch realisierbar.
Bislang wurden vorrangig Nischenprodukte wie der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8110
Näher, Eva: Nachhaltige Entwicklung im Massentourismus - Illusion oder Realität?
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Katholische Universität Eichstätt/Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt,
Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Inhalt
Inhalt ...iii
Danksagung ... vi
Abkürzungen ...vii
Vorwort... viii
Kapitel 1 Nachhaltigkeit im Massentourismus im wissenschaftlichen Kontext . 1
1
Grundlagen des Tourismus ... 1
1.1
Psychologie des Reisens... 1
1.1.1
Motivations- und Bedürfnisstruktur ... 2
1.1.2
Das Konzept der Landschaftsbewertung und Landschaftspräferenz nach Kaplan und
Kaplan ... 6
1.2
Die historische Entwicklung des Tourismus... 8
1.2.1
Die Entwicklung des Reisens bis 1945... 8
1.2.2
Der moderne Tourismus nach 1945 ... 11
1.3
Tourismusformen und ihre Abgrenzung ... 14
1.3.1
Definition des Tourismus... 14
1.3.2
Massentourismus als Hauptreiseform... 15
1.3.3
Alternativer Tourismus und Ökotourismus ... 17
1.4
Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen... 20
1.4.1
Touristische Aktionsräume als Planungsgrundlage ... 20
1.4.2
Das Lebenszyklusmodell von Tourismusregionen nach R. B
UTLER
... 21
1.4.3
Das ,,broad context model" der Destinationsentwicklung nach W
EAVER
... 24
2
Die Entwicklung der Nachhaltigkeit als internationales Leitbild... 29
2.1
Nachhaltigkeit und ihre Wurzeln... 29
2.2
Der Brundtland Bericht und die Entstehung eines ganzheitlichen Leitbildes ... 30
2.3
Das ,,development triangle" als Grundlage der Nachhaltigkeit ... 31
3
Das Phänomen ,,Massentourismus" ... 34
3.1
Der Begriff Massentourismus... 34
3.2
Die Entwicklung des Massentourismus ... 35
3.3
Auswirkungen und Folgen des Massentourismus ... 37
3.3.1
Ökonomische Bedeutung des Massentourismus ... 37
3.3.2
Soziokultureller Einfluss des Massentourismus ... 39
3.3.3
Ökologische Auswirkungen des Massentourismus... 40
3.4
Alternativen zum Massentourismus... 42
3.4.1
Unterbindung des Massentourismus... 42
3.4.2
Transformation des Massentourismus ... 43
iii
4
Nachhaltigkeit im Tourismus ... 47
4.1
Grundzüge des nachhaltigen Tourismus ... 47
4.2
Wandel des Verständnisses vom ,,Nachhaltigen Tourismus" ... 50
4.3
,,Nachhaltiger Massentourismus" illusionär oder realisierbar?... 54
4.4
Nationalparke als Vorbild für nachhaltiges Agieren im Tourismus ... 55
5
Zusammenfassung... 59
Kapitel 2 Ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung im Massentourismus ... 61
1
Einleitende Anmerkungen ... 61
2
Zielgruppe... 62
3
Quantitative und qualitative Analyse der Expertenbefragung... 63
3.1
Methodik... 64
3.2
Allgemeine Ergebnisse der quantitativen Befragung ... 66
3.3
Auswertung der offenen Fragen... 69
4
Nachhaltige Entwicklung im Massentourismus ... 74
4.1
Ökologische Dimension ... 74
4.1.1
Ökologisch verträgliches Besuchermanagement... 76
4.1.1.1
Direkte Besucherlenkung ... 76
4.1.1.1.1
Kommunikationszentren... 78
4.1.1.1.2
Wegesystem... 80
4.1.1.1.3
Zonierungssystem und gezielte Platzierung von Attraktionen ... 84
4.1.1.1.4
Besondere Einrichtungen: Virtual-Reality und Pseudo-Sites... 87
4.1.1.1.5
Regulierungs- und Restriktionssysteme ... 90
4.1.1.1.6
Angebot des öffentlichen Verkehrs ... 91
4.1.1.2
Indirekte Besucherlenkung ... 93
4.1.1.2.1
Information ... 93
4.1.1.2.2
Aus- und Fortbildung des Personals ... 95
4.1.2
Energie- und Ressourcenmanagement ... 96
4.1.2.1
Energiemanagement ... 97
4.1.2.2
Abfall- und Wasserwirtschaft ... 99
4.1.2.3
Bewahrung des ökologischen und kulturellen Erbes ... 101
4.1.3
Monitoring und Forschung... 102
4.1.3.1
Carrying Capacity Studien und Limits of Acceptable Change ... 103
4.1.3.2
Aufbau eines strukturellen Rahmengerüstes... 107
4.2
Ökonomische Dimension... 108
4.2.1
Regionale Strukturförderung ... 110
4.2.1.1
Stärkung lokaler Strukturen... 111
4.2.1.2
Ausgeglichene Ressourcenverteilung... 113
4.2.1.3
Regionalförderung durch touristische Dienstleister... 115
4.2.2
Touristische Strukturförderung ... 116
iv
4.2.2.1
Effektive organisatorische Netzwerke im Tourismus ... 117
4.2.2.2
Festlegung von Standards und Kodizes... 120
4.3
Soziokulturelle Dimension ... 124
4.3.1
Gesellschaftspolitische Förderungsmaßnahmen ... 126
4.3.2
Förderung der lokalen Integrität ... 129
4.3.3
Soziokulturelles Besuchermanagement ... 134
4.4
Zusammenfassung und Ausblick... 136
5
Nachhaltiger Massentourismus auf Mallorca? ... 140
5.1
Entwicklung und derzeitige Situation des Tourismus ... 140
5.2
Nachhaltige Lösungsansätze und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten ... 143
5.3
Zusammenfassung und Ausblick... 146
Resumée ... 148
Literaturverzeichnis ... 150
Abbildungsverzeichnis... 157
Tabellenverzeichnis... 159
Anhang... 160
v
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Professor Dr. Josef Steinbach für die
interessante Themenstellung dieser Diplomarbeit bedanken. Seine Aufmerksamkeit, die er
mir zuteil werden lies, waren mir eine große Unterstützung.
Ein großes Dankeschön geht an alle, die sich konstruktiv an der Expertenbefragung
beteiligten, auch wenn an dieser Stelle nicht alle namentlich erwähnt werden können.
Großer Dank gebührt hierbei den Herren Sinner und Wanninger aus der Nationalpark-
Verwaltung Bayerischer Wald, Herrn Hasslacher vom Österreichischen Alpenverein sowie
Herrn Mussnig aus der Nationalpark-Verwaltung Hohe Tauern für ihre
Diskussionsbereitschaft in den persönlichen Interviews und ihre bereitwillige
Unterstützung.
Für das Korrekturlesen dieser Arbeit, für wichtige Anregungen und ihre
immerwährende Unterstützung möchte ich mich besonders bei meinem Bruder Thomas
Näher und meinem Freund Markus Ruppel herzlich bedanken.
Abschließend gilt mein besonderer Dank meiner Familie für ihre Unterstützung und
Markus für seinen Beistand, welcher mir manch lange arbeitsame Stunde verkürzte.
vi
Abkürzungen
AT Alternativer
Tourismus
Signifikanzniveau
*
empirische asymptotische Signifikanz
BAT Bewusst
Alternativer Tourismus
bzw.
beziehungsweise
CAST
Caribbean Alliance for Sustainable Tourism
CHA
Caribbean Hotel Association
CPR Canadian
Pacific
Railway
FÖNAD
Föderation der Natur- und Nationalparke Europas e.V.
IITF
Institut für Integrative Tourismus-Forschung
IO
Internationale Organisationen (IUCN, IITF)
IUCN
International Union for the Conservation of Nature
IV Individualverkehr
LAC
Limits of Acceptable Change
M Ministerien
Mio. Millionen
MW Mittelwert
NMT
Nachhaltiger
Massentourismus
NP AE
Außereuropäische Nationalparke
NP EU
Europäische Nationalparke
ÖV Öffentlicher
Verkehr
Standardabweichung
TPI
Tourism Penetration Index
TV Tourismusverbände
UMT
Unnachhaltiger Massentourismus
ZAT
Zufällig Alternativer Tourismus
3S
Sonne-Sand-See-Urlaub (typischer dominanter Badeurlaub)
vii
Vorwort
Das Phänomen Massentourismus wird sowohl in der Gesellschaft als auch in der
wissenschaftlichen Diskussion heftigst kritisiert. Massentourismus beeinflusst die Kultur
und Gesellschaft seiner Zielregion in negativer Weise, er zerstört die dortige natürliche
Umwelt und auch seine ökonomischen Effekte sind nicht unumstritten als Vorteil für die
Bevölkerung zu werten. Dennoch spezialisieren sich aufgrund seines wirtschaftlichen
Wertschöpfungspotenzials gerade periphere Regionen auf diesen Sektor. Auch sein
Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität, seine relativ geringen ökologischen
Auswirkungen im Vergleich zu anderen Industriebereichen sowie die nahezu
allgegenwärtigen Etablierungsmöglichkeiten lassen die Verantwortlichen zahlreicher
Regionen zu seinen Fürsprechern werden. Dessen ungeachtet wird der Massentourismus
aber als Begriff möglichst verleugnet und verdrängt.
Massentourismus ist die unleidige Ausprägung des modernen Tourismus. Doch mag
man diese Reiseform emotional als Problem oder neutral als Phänomen betiteln, sie
existiert unweigerlich. Betrachtet man die derzeitigen weltweiten Touristenankünfte,
wird deutlich, dass die Konzentration der Touristen zu Massenanhäufungen
unumgänglich ist, sofern nicht größere Areale dem Tourismus geopfert werden sollen.
Hierin liegt der Ansatz der vorliegenden Arbeit: sicherlich ist Massentourismus keine
vorbildliche Reiseform, doch ist er im heutigen Tourismusalltag die einzige, die
momentane Reiseströme handhaben kann. Gewährt man allen Menschen das legitime
Recht auf Freiheit und damit auf Reisen, wird unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen Bedingungen stets die Masse auf Reisen sein. Ein
demokratisches Verständnis verbietet eine elitäre Flucht aus dem Alltag bei gleichzeitiger
Untersagung dieses Anspruches für die Masse. Dies würde die persönliche
Entfaltungsfreiheit einschränken und ließe erhebliche soziale Disparitäten aufkommen.
Die Umformung des Massentourismus in verträglichere Reiseformen zeigt sich einerseits
nach psychologischen Erkenntnissen über die mangelnde Aufgeschlossenheit vieler
Reisenden gegenüber Neuem und Andersartigem als illusionär mit der ,,Fremde"
würden sie schließlich im Falle des alternativen Tourismus eindringlich konfrontiert,
andererseits sind alternative Lösungen allzu oft keine wirkliche Alternative und darüber
hinaus logistisch nicht in der Lage die Menge der Massentouristen zu bewältigen.
Diese Erkenntnis erfordert die Akzeptanz des Massentourismus als heute
bedeutendste Ausprägung des Reisens. Ein Bedauern dieser Umstände genügt angesichts
der damit verbundenen Probleme sicherlich nicht; es besteht Handlungsbedarf. Und die
Vorgehensweise der Tourismusplanung sollte hierbei von den Prinzipien der
Nachhaltigkeit bestimmt sein, um ökonomische Erfolge zu sichern, die kulturelle und
natürliche Umwelt zu bewahren und die touristische Nachfrage als Basis des
wirtschaftlichen Erfolges zu befriedigen. Langfristiges Ziel nachhaltiger Entwicklung muss
viii
sein, der einheimischen Bevölkerung ein wirtschaftlich gesichertes Leben zu gewährleisten
sowie deren kulturelle Identität zu bewahren. Die Attraktivität der Region muss auch für
künftige Besucher erhalten und die negativen Auswirkungen der Masse auf die Region
vermieden beziehungsweise minimiert werden. Möglich wird dies nur durch die
Etablierung eines effektiven politischen Planungsgerüstes als Rahmen eines konstruktiven
Netzwerkes aus Tourismusindustrie und einheimischer Bevölkerung unter besonderer
Berücksichtigung der Umwelt als Fundament aller touristischen und regionalen
Interessen. An diesem Punkt stellt sich die für diese Arbeit entscheidende Frage, ob
Massentourismus tatsächlich nachhaltig gestaltet werden kann, oder ob Nachhaltigkeit
und Massentourismus unvereinbar bleiben?
Im Zuge dieser Arbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen des
Tourismus, des Massentourismus und der Nachhaltigkeit erörtert, um darauf aufbauend
ein Planungs- und Organisationskonzept für nachhaltige Entwicklung im
Massentourismus aufzustellen. Dieses soll ausdrücklich nicht den Massentourismus
glorifizieren oder als Marketinginstrument dessen verstanden werden, sondern lediglich
als Leitfaden für touristische Entwicklungen und als Lösungsansatz zur Bewältigung der
heutigen Probleme des Massentourismus fungieren. Als Vorbild für einzelne
Komponenten des vorgestellten Konzeptes dienten zum einen Nationalparke mit ihrer
länger währenden Erfahrung mit der Kombination von Tourismus und Umweltschutz als
auch Tourismusregionen, die im Bereich der nachhaltigen Entwicklung eine Vorreiterrolle
spielen.
Das hier diskutierte Konzept für nachhaltige Entwicklung im Massentourismus soll
helfen derzeitige Probleme im Umgang mit der Masse zu beheben. Die angeführten
Beispiele sollen die Durchführbarkeit der einzelnen Aspekte unterstreichen. Denn
nachhaltige Entwicklung im Massentourismus ist heute keine Utopie mehr, doch ist sie
auch erst in Anfängen Realität.
ix
Kapitel 1
Nachhaltigkeit im Massentourismus
im wissenschaftlichen Kontext
1 Grundlagen des Tourismus
Entscheidend für das Verständnis der heutigen Reisetätigkeit sind deren psychologische,
soziologische und historische Wurzeln, deren Darlegung und Diskussion Inhalt dieses
Kapitels sein wird. Des weiteren werden die entscheidenden Begrifflichkeiten definiert
und abgegrenzt. Im Anschluss wird auf bedeutende Entwicklungsmodelle eingegangen,
welche heutige Tourismuserscheinungen zu erklären versuchen und eine wichtige
Planungsgrundlage für touristische Regionen darstellen.
1.1 Psychologie
des
Reisens
Warum verreisen Menschen? Was bewegt Menschen dazu zum Teil erhebliche
Anstrengungen einer Reise auf sich zu nehmen? Um die Motivation und das Verhalten der
Reisenden verstehen zu können, ist es unabdingbar sich diesen Fragen zu stellen.
Schließlich stellen die Bedürfnisse und Motive neben den wirtschaftlichen Möglichkeiten
der Finanzierung und Freizeiteinteilung sowie dem touristischen Angebot eine gewichtige
Antriebskraft des Tourismus dar (siehe Abbildung 1-1).
Abbildung 1-1: Antriebskräfte des Tourismus
Quelle: F.U.R. 2000, S. 22.
Mit Hilfe psychologischer und soziologischer Ansätze zur Bedürfnis- und
Motivationsstruktur sowie einem Konzept aus der Umweltpsychologie zur
Landschaftsbewertung soll ein Versuch unternommen werden der Beantwortung dieser
essentiellen Fragen der Tourismuspsychologie näher zu kommen.
1
Kapitel 1
2
1.1 Psychologie des Reisens
1.1.1 Motivations- und Bedürfnisstruktur
Generell ist das Handeln des Menschen von Aktionen zur Bedürfnisbefriedigung geleitet.
In der Psychologie wird Bedürfnis als Ausdruck eines Mangelzustandes bezeichnet und ist
damit grundlegender Auslöser für jegliche Handlungen, die zur Bedürfnisbefriedigung
führen sollen (vgl. F
RÖHLICH
2000).
M
ASLOW
unterscheidet fünf hierarchisch angeordnete Bedürfniskategorien: die
fundamentalen biologisch-physiologischen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wasser und
Sexualität, das Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz, Beständigkeit und Vertrautheit, die
sozialen Bindungsbedürfnisse bezüglich Liebe und Zugehörigkeit, die psychologischen
oder Ich-Bedürfnisse nach persönlicher Anerkennung sowie das Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung als höchstes Ziel. Diese Hierarchie wurde von Z
IMBARDO
und
G
ERRIG
um die kognitiv-wissensorientierten und ästhetischen Bedürfnisse sowie das
Bedürfnis nach Transzendenz erweitert (siehe Abbildung 1-2).
Abbildung 1-2: Die Hierarchie der Bedürfnisse nach MASLOW
Quelle: nach Z
IMBARDO
, G
ERRIG
1999, S. 324.
Die wesentliche Aussage dieser Bedürfnispyramide ist die notwendige Erfüllung der
jeweils primitiveren Bedürfnisse zum Erreichen eines Bedürfnisses einer höheren
Kategorie. Denn während die jeweils niederen Bedürfnisse Mangelsituationen ausdrücken
sofern sie nicht erfüllt werden bedeuten unerfüllte Bedürfnisse der anspruchsvolleren
1.1 Psychologie des Reisens
Kapitel 1
3
Kategorien keine lebensbedrohende Situation; die Erfüllung dieser dient der psychischen
Wertsteigerung
1
.
Nachdem in der modernen westlichen Gesellschaft eine faktische Garantie für die
Sättigung der Primärbedürfnisse besteht, werden zunehmend Wachstumsbedürfnisse, wie
die kognitiven, ästhetischen oder die Bedürfnisse nach Selbstwert und
Selbstverwirklichung als grundlegendste Bedürfnisse erachtet. Luxus und entbehrlicher
Konsum erlangen dadurch einen neuen herausragenden Stellenwert in den
Handlungsmaßstäben der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund wird dem Individuum
die Urlaubsreise heute beinahe als eines seiner Grundbedürfnisse zugestanden, wodurch
der Tourismus beträchtlich an Bedeutung gewinnen konnte.
O
PASCHOWSKI
(1977) leitet aus der M
ASLOWSCHEN
Bedürfnis-Grundstruktur acht
Bedürfnisgruppen ab, die Relevanz für den Urlauber besitzen: zunächst gilt das
Rekreationsbedürfnis nach Erholung, Entspannung und Wohlbefinden allen Urlaubern als
wichtigstes Motiv. Das Kontemplationsbedürfnis nach Selbstbesinnung, Selbsterfahrung und
Selbstfindung vervollständigt die Suche nach Erholung und Ruhe im Urlaub. Generell
scheint in der heutigen Zeit die Motivationsstruktur aber zweigeteilt: zum einen wird dem
Ruhe- und Erholungsbedürfnis im modernen Tourismus ein wichtiger Stellenwert
beigemessen, doch andererseits möchte der Urlauber während seiner Reise Neues
erfahren und aufregende Eindrücke sammeln. Damit ist das Kompensationsbedürfnis nach
Ausgleich und Ablenkung vom tristen, eintönigen Alltag beinahe ebenso bedeutungsvoll.
Gerade bei den Bildungs- und Studienreisenden zählt das Edukationsbedürfnis mit dem Ziel
der Wissenssteigerung durch die Erfahrung von Neuem und dem Weiterlernen als
entscheidende Urlaubsmotivation. Mit zunehmender Verstädterung wird zudem eine
sinkende Dichte von Sozialkontakten in den Städten bemängelt. Deshalb versuchen gerade
Stadtbewohner diese Anonymität des Alltages im Urlaub zur Erfüllung ihres
Kommunikationsbedürfnisses zu durchbrechen, indem Sozialkontakte intensiviert werden
und Geselligkeit auf begrenzte Zeit praktiziert wird. Entsprechend strebt auch das
Integrationsbedürfnis steigende Sozialorientierung, Gruppenbezug und gemeinsame
Lernerfahrung im Urlaub an, das Partizipationsbedürfnis Beteiligung, Mitbestimmung und
Engagement. Letztlich ist für gewisse Urlaubergruppen das Enkulturationsbedürfnis nach
kultureller Beteiligung, kreativer Erlebnisentfaltung und Produktivität entscheidend, was
beispielsweise bei Teilnehmern an alternativen Kunstworkshops beobachtet werden kann.
Die Motive des Einzelnen, sich letztlich für eine Urlaubsreise zu entscheiden, greifen
stark auf diese Bedürfnistypen zurück. Während die Bedürfnisse die Ursachen des
Handelns durch einen elementaren Mangel begründen, sind Motive ,,komplexe
Beweggründe des menschlichen Verhaltens, die sich in gedanklichen Vorwegnahmen
eines angestrebten Zielzustandes bzw. Veränderungserwartungen in bezug auf bestimmte
Situationen äußern" (F
RÖHLICH
2000, S. 303). Als stereotypes Motiv für die Urlaubsreise
gilt die Erholung. H
ARTMANN
gruppiert die Reisemotive in vier Einheiten nach den vital-
1
Zu einer vertieften Diskussion der Bedürfnisstruktur nach M
ASLOW
siehe S
TEINBACH
2003.
1.1 Psychologie des Reisens
Kapitel 1
4
biotischen, psychisch-explorativen, sozialen sowie den Erlebnis- und Interessensaspekten
(siehe Tabelle 1-1):
Tabelle 1-1: Gruppen von Reisemotiven
1. Erholungs- und Ruhebedürfnis
- Ausruhen, Abschalten, Herabsetzung geistig-seelischer Spannung, Minderung des Konzentrationsgrades;
- Abwendung von Reizfülle
2. Bedürfnis nach Abwechslung und Ausgleich
- Tapetenwechsel, Veränderung gegenüber dem Gewohnten;
- Neue Anregungen bekommen, etwas Neues ganz anderes erfahren und erleben als das Alltägliche, neue
Eindrücke gewinnen;
- Im Alltag nicht beanspruchte Fähigkeiten verwirklichen, sich selbst entfalten, zu sich selbst kommen.
3. Befreiung von Bindungen
- Unabhängigkeit von sozialen Regelungen, tun, was man will, sich frei und ungezwungen bewegen, auf
niemanden Rücksicht nehmen;
- Befreiung von Pflichten, Ausbrechen aus den alltäglichen Ordnungen.
4. Erlebnis- und Interessenfaktoren
- Erlebnisdrang, Neugierde, Sensationslust;
- Reiselust, Fernweh, Wanderlust;
- Interesse an fremden Ländern, Menschen und Kulturen;
- Kontaktneigung;
- Geltungsstreben, ,,oben sein", sich bedienen lassen.
Quelle: H
ARTMANN
1962 in S
TEINBACH
2003, S. 82.
Die Bedürfnisse nach Erholung und Ruhe, nach Abwechslung und Ausgleich sowie
nach Befeiung von Bindungen werden in der Tourismuspsychologie vielfach als Konträr-
oder Push-Motive zusammengefasst und synonym mit der Flucht aus dem Alltag
verwendet. Die Erlebnis- und Interessenfaktoren repräsentieren Anreize beispielsweise
der Tourismusregionen oder spezieller Tourismusformen und werden daher als
Komplementär- oder Pull-Motive bezeichnet (vgl. F
REYER
2001).
Die Flucht aus dem Alltag wird neben der Erholung allgemein als dominantes Motiv
der Reisetätigkeit genannt. Schließlich stellt der Tourismus die letzte ,,Fluchtburg der
Hoffnungen, Träume [und] Sehnsüchte" (K
UBINA
1990, S. 1) des überwiegend negativ
empfundenen Alltags dar aus dessen Zwängen und Begrenzungen der Reisende
wenigstens für begrenzte Zeit flüchten möchte. Allerdings ist diese Flucht aus den
heimischen Zwängen trügerisch, da auch am Urlaubsort dem Reisenden bestimmte
Verhaltensnormen abverlangt werden und er wiederum in bestimmte Rollen gedrängt
wird. Zudem führt ,,die Flucht aus der Masse [...] für viele paradoxerweise wieder in die
Masse hinein" (K
RIPPENDORF
1975, S. 56). Auf der Suche nach Erholung und Ruhe
bedeutet der Tourismus bei der Erfüllung der ursprünglichen Motivation und der
grundlegenden Bedürfnisse seiner Reisenden daher oft ein Hindernis seiner selbst.
Obwohl heute eine verstärkte Individualität propagiert wird, ist in Wirklichkeit eine
Vielzahl von Reisenden eher dem Herdentrieb unterworfen, um in der Masse ein Gefühl
der Sicherheit zu verspüren, aber auch um im Kollektiv die touristischen Highlights zu
konsumieren.
Kapitel 1
5
1.1 Psychologie des Reisens
Auch die Verlockungen der Tourismusregionen und der Urlaubsformen, welche die
,,Flucht in die Fremde" bewirken, erweisen sich als fragwürdige Motive, denn
Urlaubsziele werden mit standardisierten Angeboten in der heutigen Urlaubswelt
zunehmend ähnlicher und damit austauschbar. Oftmals fungieren sie lediglich noch als
Kulisse und stellen somit nicht das eigentliche Ziel der Touristen dar. Abgesehen davon
interessieren sich die Touristen kaum für die Destination an sich, sondern bestätigen
durch ihre selektive Wahrnehmung lediglich ihre ,,schöne Scheinwelt" (K
UBINA
1990, S.
169), um im Tourismus nicht mit den Problemen der Zielregion belastet zu werden.
Diese Ambivalenz der touristischen Wunschvorstellung einerseits und der
tatsächlichen touristischen Realität andererseits zeigt K
UBINA
mit ihrer Gegenüberstellung
der ,,Illusion der Prospektwelt" bzw. der touristischen Traumwelt und der touristischen
Wirklichkeit (siehe Tabelle 1-2), wie es auf das Gros der Touristen mit Ausnahme des
Abenteurers und Entdeckers angewandt werden kann.
Tabelle 1-2: Touristische Ambivalenz
Touristische Traumwelt
Touristische Wirklichkeit
Einsamkeit
Touristisch erschlossen
Abenteuer
Sicherheit
Exotik
Gewohntes
Quelle: K
UBINA
1990, S. 150.
Wie aus der Darstellung hervorgeht, soll die Urlaubsreise nach außen wahre Ideale
und Entdeckergeist vermitteln, in der Durchführung überzeugen aber einfache Komfort-
und Sicherheitsaspekte. Auslöser für dieses dissonante Verhalten ist der mit der Reise
verbundene Prestigegewinn, der umso größer ausfällt, je einmaliger, gewagter und
exotischer die Reise verlief. Das Motiv Prestige wird besonders in der heutigen
,,außengeleiteten Gesellschaft" (K
UBINA
1990, S. 94), in der Medien und Werbung das
Konsumverhalten des Einzelnen entscheidend prägen, oder gar diktieren, eine wichtige
Antriebskraft für die Reiseentscheidung.
Abbildung 1-3: Modell des Flow-Zustands
Quelle: A
NFT
1993, S. 142.
1.1 Psychologie des Reisens
Kapitel 1
6
Zusammenfassend ist der Genuss ein wichtiges Motiv. Während der Urlaubsreise
sollen positive Empfindungen und Erlebnisse überwiegen, man möchte ,,die schönsten
Wochen des Jahres" genießen. Daher ist gemeinsames Ziel aller Touristen und damit das
originärste aller Urlaubsmotive das Flow-Erlebnis. Das Flow-Konzept des Psychologen
C
SIKSZENTMIHALYI
beschreibt Situationen, in denen durch die Übereinstimmung der
Handlungsanforderungen mit den Fähigkeiten des Individuums, dieses die völlige
Kontrolle über die jeweilige Situation empfindet, sich alle Abläufe stimmig, wie ,,im Fluss"
ereignen und dadurch ein Zustand der Selbstvergessenheit eintritt (vgl. A
NFT
1993).
Das Erlebnis muss sich hierbei angemessen im Spannungsfeld zwischen
Anforderungen und Fähigkeiten verhalten, damit weder Langeweile noch ein
Angstzustand sondern wahre Erholung und Freude eintreten und die Motive des
Reisenden befriedigt werden (siehe Abbildung 1-3). Dieses angestrebte ausfüllende
Erlebnis suchen die Reisenden jedes Jahr aufs neue im Urlaub, aktiviert durch die
finanziellen Möglichkeiten und die langweiligen Charakteristika der modernen
Gesellschaft. Der Tourismus soll auf diese Weise die eigentlichen Lebensziele der
Selbstverwirklichung und des Genusses erfüllen, welche im Alltag scheinbar keine
Realisierungsmöglichkeiten mehr erfahren.
1.1.2 Das Konzept der Landschaftsbewertung und Landschaftspräferenz
nach Kaplan und Kaplan
Ziel der Reisen vieler Touristen sind heute bevorzugt landschaftlich attraktive
Urlaubsregionen. Damit stellt die natürliche Umwelt die Hauptattraktion des
Tourismusproduktes für die Mehrzahl der Urlauber dar. Doch welche Landschaften
werden bevorzugt und was erwartet der Besucher von der Natur?
Nach dem Konzept der Landschaftsbewertung und Landschaftspräferenzen nach
K
APLAN
und K
APLAN
ordnen Menschen Landschaften anhand der folgenden Kriterien ein
(siehe Tabelle 1-3): Zusammengehörigkeit (coherence), Komplexität (complexity), Lesbarkeit
bzw. Verständlichkeit (legibility) und Rätselhaftigkeit (mystery).
Tabelle 1-3: Kriterien der Informationsverarbeitung der Landschaftsbewertung
Verstehen
Explorieren
unmittelbar
Kohärenz Komplexität
zukünftig
Lesbarkeit Rätselhaftigkeit
Quelle: H
ELLBRÜCK
, F
ISCHER
(1999), S. 258, nach K
APLAN
K
APLAN
.
Während Kohärenz und Komplexität die unmittelbaren Oberflächeneigenschaften
einer Landschaft beschreiben, bestimmen Lesbarkeit und Mystery die zukünftigen
Verhaltensweisen, die die jeweiligen Landschaftsszenen implizieren. Kohärenz bezeichnet
hierbei die Einfachheit mit der der Betrachter eine Landschaftsszene in ihre Elemente
gliedern kann. Bevorzugt werden demnach in wenige größere Einheiten mit
wiederkehrenden Mustern organisierte Landschaften, die ,,ohne schlussfolgerndes
1.1 Psychologie des Reisens
Kapitel 1
7
Denken erkennbare Einheitlichkeit und Sinnhaftigkeit" (H
ELLBRÜCK
, F
ISCHER
1999, S. 259)
vermitteln. Komplexität benennt dagegen die Anzahl der von einer Szene vermittelten
verschiedenen Reize, wobei Landschaften von mittlerer Komplexität bevorzugt werden.
Der Betrachter wird hiervon weder überfordert, abgeschreckt noch gelangweilt.
Um sich in einer Landschaft orientieren zu können und sein Verhalten auf die
jeweilige Situation abzustimmen, erwartet der Betrachter ihm einfach zugängliche
strukturelle Muster, die er für die Anwendung auf weitere Szenen mental speichert.
Lesbarkeit ,,ist somit eine kognitiv vermittelte, funktionsbezogene Eigenschaft einer
Landschaftsszene" (H
ELLBRÜCK
, F
ISCHER
1999, S. 260). Während die Lesbarkeit einer
Landschaft durch ein erforderliches Maß an Strukturiertheit dem Betrachter eine gewisse
Vertrautheit und Sicherheit vermittelt, weckt Mystery sein Neugier- und
Explorationsverhalten. Wie bei der Komplexität bereits erwähnt, muss eine Landschaft
verschiedene Reize vermitteln, um den Beobachter zu interessieren, Erwartungen in ihm
zu wecken und ihn folglich zu Entdeckungen zu verlocken. Allerdings darf eine Szene
nicht mit Reizen überhäuft sein. In diesem Falle würde eine Reizüberflutung Angstgefühle
hervorrufen und damit das Entdeckungsverhalten hemmen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bewertung von Landschaftsszenen
durch eine Mischung aus der Suche nach Vertrautheit und Zurechtfinden auf der einen
Seite und die Erwartung von neuen Reizen auf der anderen Seite geprägt ist, wobei weder
langweilende noch überfordernde Szenen präferiert werden. Die explizite Bedeutung der
beiden Kriterien für die Einschätzung von Landschaften variiert allerdings je nach
Betrachter und dessen persönlicher Einstellung. Generell dominiert der Versuch um
Konsonanz mit einem möglichst geringen Angstniveau einerseits und einer
größtmöglichen Stimulation andererseits das Explorationsverhalten (vgl. T
HOMAS
1993).
Damit relativiert sich das Motiv ,,Neues erleben". Häufig ist die Begegnung mit dem
Fremden und Neuen nur auf Ausschnitte begrenzt, nachdem viele Touristen schlichtweg
nicht bereit für die Fremde sind. So soll keine Reise, auch nicht in die entferntesten
Regionen, Bequemlichkeit und Vertrautes vermissen lassen (vgl. K
RIPPENDORF
1975).
Weltweit standardisierte Restaurantketten erfahren gerade unter den Reisenden große
Beliebtheit, heimische Getränke und Menüs werden in zahlreichen Urlaubsregionen
trotz vorhandener regionaler Spezialitäten vorausgesetzt. Wird dies oftmals von
erfahreneren Reisenden belächelt oder kritisiert, stellt dieser ,,Rückzug in die
Vertrautheit" für viele Reisende eine Garantie des richtigen, angepassten Verhaltens dar,
wodurch sie keine regionalen Bräuche oder Sitten verletzen. ,,In dem Maße, wie
Tourismus in organisierten Bahnen verläuft, verringert sich das Risiko des Kulturschocks.
Die typischen Kontakte des Touristen zu der fremden Kultur sind durch touristische
Arrangements und Moderatoren vermittelt und gefiltert, die Begegnung mit
Fremdartigem erfolgt oft in relativ sicheren, ritualisierten Bahnen" (V
ESTER
1993, S. 172 f.).
Für die Urlaubsreise ist die Suche nach Neuem und das Erleben neuartiger
Situationen losgelöst vom Alltag einer der wichtigsten Beweggründe. Dieses
Entdeckungsverhalten prägt die Menschheit und im speziellen das Reisen seit
Jahrhunderten. Hierbei darf jedoch nicht übersehen werden, dass trotz aller Neugierde
1.1 Psychologie des Reisens
Kapitel 1
8
und Begeisterung für Neues und Fremdes der Wunsch nach Sicherheit und Schutz ein
dominantes Anliegen bleibt. Dieser Wunsch nach Sicherheit in der Masse bietet die
Möglichkeit des Managements der Masse. In Ihr treten die Touristen geballt aber
vorhersehbar auf, wodurch an diesen Punkten und zu diesen Zeiten Reglements greifen
können.
1.2 Die
historische
Entwicklung des Tourismus
Gerade für die frühesten Reisenden stellte der Wunsch nach Sicherheit allzu oft ein
enormes Hindernis dar. In der Frühzeit des Reisens konnten keine Garantien für den
Erfolg einer Reise gewährt werden. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich die
Sicherheitslage und die Attraktivität des Reisens gewaltig, so dass sich die Urlaubsreise
bezüglich ihrer Größe und Bedeutung zu ihrem heutigen Ausmaß entwickeln konnte. Im
Folgenden wird die Geschichte des Reisens von ihren Anfängen bis zu den heutigen
Dimensionen dargelegt und zudem auf die mögliche zukünftige Entwicklung des
Tourismus verwiesen.
1.2.1 Die Entwicklung des Reisens bis 1945
Seit jeher begeben sich Menschen an Orte fernab von ihrem Zuhause. Während in der
Frühzeit des Menschen diese ,,Reisen" lediglich der Existenzsicherung mit dem
Ortswechsel zur Nahrungsbeschaffung oder zur Suche nach neuen Lebensräumen in Form
von Völkerwanderungen dienten, verreisten die Ägypter bereits im heutigen Sinne der
Urlaubsreisen. Diese Ausprägung des Reisens wurde erst mit einer zunehmenden
Spezialisierung und Arbeitsteilung möglich, wodurch sich eine Klassengesellschaft
etablierte und deren Oberschicht sich diverse Privilegien, wie das der Reise, sichern
konnten. Zwar wurde auch bei den Ägyptern noch der Großteil der Reisen
zweckgebunden als Handels- und Dienstreisen unternommen, doch sind ab 1500 vor
Christus erstmals auch Bildungs- und Vergnügungsreisen belegt, wie die der Königin
Hatshepsut (vgl. G
OELDNER
, R
ITCHIE
, M
C
I
NTOSH
2000).
Bei den Griechen dominierten die Reisen zu den überregional bedeutenden
Festspielen wie den Olympischen, Pythischen, Istmischen und Nemeischen Spielen. Trotz
der damals noch sehr ungünstigen Verkehrsbedingungen waren zu diesem Zwecke bereits
gewaltige Menschenmassen unterwegs (vgl. K
UBINA
1990). Abgesehen von diesen
Festspiel-Besuchern begaben sich lediglich Händler, Pilger, Staatsmänner und Feldherren
auf Reisen.
Im Römischen Reich erlangte der Reiseverkehr unter Kaiser Hadrian durch die
Sicherung des Friedens und die damit einhergehende Stabilisierung des Wohlstandes
einen deutlichen Aufschwung. Zudem wurde das Wegenetz unter den Römern ausgebaut
und verbessert, so dass das Reisen wesentlich bequemer, einfacher und schneller wurde.
Die Reisen der Römer beschränkten sich auf das eigene Reich, wobei der Süden und im
speziellen Ägypten zu den favorisierten Reisezielen avancierten. Unter diesen günstigen
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
Kapitel 1
9
Bedingungen entwickelten sich erstmals auch Reisebüros und Agenturen für die
Reiseorganisation entsprechend den modernen Strukturen des Tourismus (vgl. K
UBINA
1990).
Neuartig war im Römischen Reich die Zunahme der Bäder-, Bildungs- und
Vergnügungsreisen, nachdem im Altertum bislang zweckgebundene Reisen sowie private
Reisen mit religiösem Hintergrund überwogen. Trotz zahlreicher Parallelen zwischen den
Reiseformen im Römischen Reich und denen der heutigen Zeit gilt die römische
Reisebewegung nicht als Wiege des heutigen Tourismus. Die Prinzipien der damaligen
Gesellschaftsstruktur gestalteten das Reisen weiterhin als klassenspezifisches Privileg (vgl.
K
UBINA
1990).
Mit dem Niedergang der Herrschaft der Römer über weite Teile Europas und des
Mittelmeerraumes verfielen große Teile des Straßennetzes, das Reisen wurde wieder
strapaziöser und gefährlicher. Aus diesem Grunde versiegte im Mittelalter der Strom der
privaten Vergnügungsreisenden beinahe gänzlich. Die feudale Ständeordnung band in
ihrem Lehensystem große Bevölkerungskreise an Grund und Boden und verhinderte
somit eine ausgedehnte Reisetätigkeit. Lediglich Teile der Oberschicht begaben sich auf
Kriegszüge, Handels- und Dienstreisen besonders entlang der bekannten Handelswege
wie der Seidenstraße. Andere unternahmen ausgeprägte Entdeckungsreisen um die ganze
Welt, sowie die für das Mittelalter typische Pilgerreise. Generell wurde das Reisen zu
dieser Zeit keineswegs mit Vergnügen in Verbindung gebracht und die damit
verbundenen Strapazen wurden nur ungern in Kauf genommen, so dass sich das
Mittelalter durch eine sehr geringe Reiseintensität auszeichnet (vgl. G
OELDNER
, R
ITCHIE
,
M
C
I
NTOSH
2000).
Die Einstellung zum Reisen änderte sich mit der beginnenden Renaissance, in der die
religiöse Dominanz des Mittelalters versiegte, die Individualität und das Vergnügen
wieder in den Vordergrund rückten. Reisen wurden von nun an wieder zum Selbstzweck
durchgeführt. Besondere Bedeutung erlangte mit dieser Epoche die Kultur, weshalb
gerade junge Adelige und Gelehrte im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert auf
,,Grand Tour" bevorzugt in die kulturellen Zentren Frankreichs, Deutschlands und
Italiens wie Paris, Rom, Weimar und Florenz reisten, um dort das kulturelle Erbe zu
besichtigen und zu studieren. Neben der ,,Grand Tour" erlangte auch die
Gesellenwanderung als Ausbildungsreise an Einfluss (vgl. K
UBINA
1990).
Mit den Ideen der aufkeimenden Romantik Ende des achtzehnten Jahrhunderts
wurde die Natur wieder zunehmend positiv empfunden und als Reiseziel entdeckt. In
diesem Zuge sind besonders die Alpen mit dem beginnenden Alpinismus zu nennen.
Durch technische Errungenschaften zur Beherrschung der Natur und erste
Erschließungsmaßnahmen wurde die frühere Abneigung durch Interesse am Gebirge
abgelöst. Auch Bäderreisen zu den aufblühenden Kurorten wie Baden-Baden und
Wiesbaden sowie nach und nach auch zu den Seebädern an Nord- und Ostsee, zeigte ein
neues Naturverständnis und Begeisterung für Aktivitäten in attraktiven Landschaften. Die
Bäderreise erlangte nicht nur aus gesundheitlichen Gründen an Gewicht, nachdem
Mediziner eine positive Wirkung des Aufenthaltes an der See versprachen, sondern
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
Kapitel 1
10
besonders durch das aufkeimende soziale Leben für die Oberschichten mit Promenaden,
Theater und Casinos in den Küstenorten (vgl. G
OELDNER
, R
ITCHIE
, M
C
I
NTOSH
2000).
Tabelle 1-4: Epochen des Tourismus
Epoche Zeit
Transportmittel
Motivation Teilnehmer
Vorphase
bis 1850
zu Fuß,
Pferd, Kutsche, z. T.
Schiff
Nomadismus, Geschäft,
Kriegszüge, Pilgerreise,
Entdeckung, Bildung
Elite: Adel, Gebildete,
Geschäftsleute
Anfangsphase
1850 bis 1914 Bahn (Inland)
Dampfschiff (Ausland)
Erholung neue
Mittelklasse
Entwicklungsphase 1914 bis 1945 Bahn, Auto, Bus,
Flug (Linie)
Kur, Erholung
Wohlhabende,
Arbeiter (KdF)
Hochphase
ab 1945
Auto, Flug (Charter)
Regeneration,
Erholung, Freizeit
alle Schichten (der
Industrieländer)
Quelle: F
REYER
2001, S. 5.
Bis zu diesem Zeitpunkt, in der touristischen Vorphase (siehe Tabelle 1-4), blieb das
Reisen weitgehend als Privileg der Oberschicht vorbehalten, die sich vorwiegend aus dem
Adel zusammensetzte. Die beginnende Industrialisierung im neunzehnten Jahrhundert
reformierte diese Gesellschaftsstruktur grundlegend. Von nun an konnte das Bürgertum,
die neue Mittelklasse, durch Erwerbstätigkeit Besitz und Wohlstand mehren und sich
dadurch einen besseren Lebensstandard leisten. So vollzog sich eine Verbürgerlichung des
Reisens, die sich in der spezifisch deutschen Urlaubsform des Sommerfrische-Tourismus
wiederspiegelte. Hierbei handelte es sich vorzugsweise um Erholungsreisen der
städtischen Bevölkerung in die Alpen, die Mittelgebirge und ans Meer. Technischer
Fortschritt im Bereich der Mobilität mit der Einführung der Dampfschifffahrt und der
Entwicklung der Eisenbahn ermöglichte für breite Bevölkerungsschichten das Reisen zu
relativ billigen und bequemen Konditionen und unterstützte damit die touristische
Entwicklung in bedeutendem Maße.
Den Wunsch nach Urlaub und Erholung machte sich schließlich die
Nationalsozialistische Regierung mit der Gründung ihrer Freizeitorganisation
,,Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft durch Freude" 1933 zunutzen. Vordergründig
sollte allen Deutschen nach Inkrafttreten der Urlaubsregelung die Möglichkeit auf Urlaub
gewährt werden, um laut Doktrin ein ,,nervenstarkes Volk" (K
UBINA
1990, S. 56) zu
erhalten. Tatsächlich wurden diese KdF-Reisen vor allem zur politischen Prägung und
Kontrolle missbraucht. Trotz massiver staatlicher Finanzförderung und der Vorsätze
Mitgliedern aller Schichten Reisen zu ermöglichen, blieb auch unter den
Nationalsozialisten der Großteil der Reisen der Oberschicht vorbehalten, während die
Arbeiterschicht meist nur am Ausflugsverkehr teilnehmen konnte. Die deutschen Kur-
und Heilbäder blieben sogar gänzlich ,,KdF-frei" (vgl. K
UBINA
1990).
Kapitel 1
11
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
1.2.2 Der moderne Tourismus nach 1945
Die Nachkriegssituation in Deutschland verhinderte zunächst eine ausgeprägte
Reisetätigkeit: die zerstörte Infrastruktur, der Nahrungsmittel- und Energieengpass, die
Devisenknappheit verbunden mit der Instabilität der Währung waren bedeutende
Hindernisse für Urlaubsreisen. Erst mit dem Wirtschaftswunder in den fünfziger und
sechziger Jahren wuchs der allgemeine Wohlstand und die Kaufkraft der Bevölkerung.
Der Wiederaufbau der Infrastruktur und die rasch ansteigende Motorisierung förderten
die Mobilität der Bevölkerung. Seit den fünfziger Jahren forderten zudem die
erstarkenden Gewerkschaften die Reduzierung der Arbeitszeit. Die Umsetzung dessen
bedeutete eine der wichtigsten Voraussetzungen für Urlaubsreisen und läutete dadurch
die touristische Hochphase mit dem rasanten Anstieg der Reiseintensität ein (siehe Tabelle
1-4). Doch erst Anfang der sechziger Jahre wurde allen Arbeitnehmern der arbeitsfreie
Samstag und ein Mindesturlaub gesetzlich garantiert (vgl. K
UBINA
1990). Allerdings
vollzog sich der Wandel des Verhältnisses von Arbeits- zu Freizeit seit diesem Zeitpunkt
mit rascher Geschwindigkeit: während den Arbeiter 1950 durchschnittlich noch lediglich
zwölf Urlaubstage zur Verfügung standen, sind dies heute bereits circa 31 Tage (vgl.
F
REYER
2001).
Abbildung 1-4: Entwicklung der Verkehrsmittelnutzung bei den Haupturlaubsreisen (%)
Quelle: F.U.R. 2000, S. 87.
Mit der Abnahme der Arbeitszeit und der damit verbundenen Erweiterung der
Freizeit, mit der steigenden Mobilität der Bevölkerung, mit dem wachsenden Wohlstand
und nicht zuletzt mit der anwachsenden Verstädterung waren wichtige Grundlagen für
den Boom der Tourismusindustrie gegeben. Und die Bevölkerung verspürte zunehmend
den Wunsch für eine gewisse Zeit im Jahr ihr gewohntes Umfeld zu verlassen. Die
verbesserte wirtschaftliche Situation bot ihr zudem erstmals in großem Maßstab die
Möglichkeiten dazu. Die Grundbedürfnisse waren weitgehend befriedigt, womit der
Konsum von Luxusgütern zum bedeutenden Lebensinhalt avancieren konnte. In dieser
Kapitel 1
12
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
Zeit wurde die Bahn als wichtigstes Verkehrsmittel im Reiseverkehr vom PKW abgelöst,
der die individuelle Mobilität des Wirtschaftswunders verkörperte (siehe Abbildung 1-4).
Abbildung 1-5: Entwicklung des Fernreiseanteils (in Mio. und % der Urlaubsreisen insgesamt)
0
2
4
6
8
10
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2010
(Schätzung)
Mio.
0
2
4
6
8
10
12
%
in %
in Mio.
Basis: alle Urlaubsreisen
Fernreisen: alle Urlaubsreisen in Länder außerhalb Europas ohne die
an das Mittelmeer angrenzenden Länder Asiens und Afrikas.
Quelle: F.U.R. 2000, S. 40.
Die Erschließung neuer Verkehrsmittel in den folgenden Jahren führte wiederum zu
einem veränderten Reiseverhalten. Ab den siebziger Jahren konnten die Fernreisen durch
den Einsatz von Großraumflugzeugen einen enormen Anstieg verzeichnen (siehe
Abbildung 1-5). Sie konnten nun schnell, komfortabel und relativ billig durchgeführt
werden.
Dies läutete den Anfang des heutigen Reisetrends, der immer kürzeren Reisen (siehe
Abbildung 1-6) an immer entlegenere Ziele ein. Dieser Trend spiegelt sich auch in der
Reiseanalyse der F
ORSCHUNGSGEMEINSCHAFT
U
RLAUB UND
R
EISEN
(F.U.R.) wieder.
Abbildung 1-6: Entwicklung der durchschnittlichen Reisedauer 1980 bis 1999 (in Tagen)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1980/81 1983/85 1988/89 1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2010
(Schätzung)
Tage
Haupturlaubsreise
2. Reise
3. Reise
Anmerkung: Sofern mehrere Jahre angegeben sind, handelt es sich um die Durchschnittswerte.
Quelle: F.U.R. 2000, S. 56.
Kapitel 1
13
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
Generell sind die Touristenankünfte seit dem Zweiten Weltkrieg lediglich mit
kleinen Einschnitten zum Beispiel während der Wirtschaftskrise von 1966 oder während
des Golfkrieges 1991 aufgrund der technologischen Innovationen und der
wirtschaftlichen Umstände kontinuierlich bis heute angestiegen. Prognosen der W
ORLD
T
OURISM
O
RGANIZATION
(WTO) gehen darüber hinaus auch für die Jahre bis 2020 von
stetig steigenden Touristenzahlen aus (siehe Abbildung 1-7).
Abbildung 1-7: Internationale Touristenankünfte 1950 bis 2020
Quelle: WTO 2002, S. 7.
Nachvollziehbar erscheint dies vor allem vor dem Hintergrund, dass heute erst 3,5
Prozent der Weltbevölkerung Auslandsreisen unternehmen (vgl. S
UCHANEK
2001). Die
Tatsache, dass die Weltbevölkerung allgemein anwächst und der wirtschaftliche
Aufschwung in bisher unterentwickelten Schwellen- und Entwicklungsländern, den
sogenannten ,,emerging markets", zunehmend mehr Menschen Möglichkeiten eröffnet ihr
Einkommen für Konsum- und Luxusgüter zu verwenden, unterstütz diese Annahme.
Zusätzlich entfallen mit der Öffnung und der fortschreitenden westlichen Orientierung
kommunistischer Regime Barrieren für bevölkerungsreiche Staaten wie China, so dass
auch von dieser Seite Tourismuszuwächse zu erwarten sind.
Entsprechend hat die F
ORSCHUNGSGEMEINSCHAFT
U
RLAUB UND
R
EISEN
ihren ersten
Haupttrend der touristischen Nachfrage kommender Jahre mit ,,mehr Reisevolumen"
betitelt. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Senioren als touristische Zielgruppe
und einer Ausdifferenzierung der Motive findet eine neue Gewichtung der Zielgruppen
statt. Zunehmend passivere Urlaubsformen, geringere Saisonalität und dominierende
Veranstalterreisen werden zukünftige Urlaubsreisen prägen. Der Wunsch nach mehr
Qualität bei der Beherbergung, das neue Buchungsverhalten via Internet und eine
zunehmende Preissensibilität werden neben den bereits genannten Tendenzen der
kürzeren Reisedauer, der Zunahme der Flugreisen und der entfernteren Reiseziele als
weitere wichtige Trends der Zukunft aufgelistet (vgl. F.U.R. 2000).
1.2 Die historische Entwicklung des Tourismus
Kapitel 1
14
Rückblickend lässt sich festhalten, dass die Menschheit seit jeher den Wunsch zu
Verreisen verspürte. Und sofern sie die Gelegenheit zum Verreisen erfuhr, nutzte sie diese
und wird dies in Zukunft ebenfalls tun. Denn das ,,Fernweh wird [...] uns immer treiben,
zukünftig ebenso wie heute und früher" (K
UBINA
1990, S. 210 f.).
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
Im Folgenden sollen die für diese Arbeit entscheidenden Tourismusbegriffe definiert
werden. Es werden die Begriffe Tourismus und Massentourismus vorgestellt sowie als
Abgrenzung hierzu die Begriffe Alternativer und Ökotourismus näher diskutiert.
1.3.1 Definition des Tourismus
Für den Begriff Tourismus liegen zahlreiche, äußerst unterschiedliche Definitionen vor,
die bei weitem nicht alle das gleiche Phänomen beschreiben. Gemeinsam ist fast allen
Darlegungen der Ortswechsel für einen begrenzten Zeitraum. Darüber hinaus herrscht
allerdings kaum Einigkeit, welche Reiseformen unter dem Begriff zusammengefasst
werden sollten. Nach S
TEINBACH
(2003) handelt es sich hierbei lediglich um Erholungs-
und Vergnügungsreisen, so dass diejenigen Reisenden ausgrenzt werden, die zum Zwecke
der Gesundheit, der Berufs- oder Geschäftsbeziehungen sowie der routinemäßigen
Einkaufs- und Veranstaltungsfahrten unterwegs sind. Die deutlich unterschiedliche
Motivationsstruktur der Erholungs- und Vergnügungsreisenden von derjenigen der
Geschäftsreisenden begründet diese Einteilung. Gänzlich unberücksichtigt kann diese
Gruppe jedoch nicht bleiben, da sie häufig durch Kopplung verschiedener Reiseformen
ebenfalls touristische Aktivitäten ausführt.
Probleme ergeben sich ferner bei der Absteckung des zeitlichen Rahmens:
üblicherweise wird bei Reisen ab mindestens einer Übernachtung von Tourismus und bei
Reisen ohne Übernachtung von Ausflugsverkehr gesprochen. Allerdings ermöglichen
moderne schnelle Verkehrsnetze die Überwindung großer Strecken in sehr kurzer Zeit, so
dass interkontinentale ,,Tagesausflüge" möglich geworden sind, diese aber nicht im
eigentlichen Sinne des Ausflugsverkehrs gewertet werden können (vgl. S
TEINBACH
2003).
Entsprechend der Typologisierung der Touristen nach deren Hauptcharakteristika
untergliedert sich der heutige Tourismus in sechs Klassen: der Abenteuerurlauber (A-
Typ), der Bildungs- und Besichtigungsurlauber (B-Typ), der ferne- und flirtorientierte
Erlebnis- (F-Typ) und Erholungsurlauber (S-Typ nach der 3S-Urlaubsform ,,Sonne, Sand,
See") sowie der wald- und wanderorientierte Bewegungs- (W
1
-Typ) und der wald- und
wettkampforientierte Sporturlauber (W
2
-Typ) (vgl. S
TEINBACH
2003 nach H
AHN
). Es
empfiehlt sich jedoch eine weitergehende Untergliederung in die in Tabelle 1-5
aufgeführten Urlaubsstile auf Basis der unterschiedlichen Hauptaktivitäten der Touristen,
der charakteristischen Aktionsräume in denen sie sich aufhalten und der typischen Bündel
von Nebenaktivitäten.
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
Kapitel 1
15
Tabelle 1-5: Urlaubsstile
Badeurlaub
Urlaub in touristischen Freizeitwelten
Feier- und Unterhaltungsurlaub
Städtetourismus
Winteraktivurlaub
Veranstaltungsurlaub
Sommersporturlaub
Besichtigungsurlaub
Studienreisen
Kreuzfahrttourismus
Wallfahrtsreisen
Bootstourismus
Wandertourenurlaub
Gesundheits- und Wellnessurlaub
Erholungsurlaub
Abenteuer- und Entdeckerurlaub
Quelle: nach S
TEINBACH
2003, S. 302f.
Diese Urlaubsstile sind keineswegs als statisch anzusehen, sondern sind
entsprechend den sich ändernden Präferenzordnungen einem stetigen Wandel
unterworfen. Jener wird von dem jeweiligen Lebensabschnitt und den kulturellen,
sozialen, ökonomischen und technologischen Rahmenbedingungen geprägt und muss bei
allen touristischen Planungen berücksichtigt werden.
1.3.2 Massentourismus als Hauptreiseform
Wie oben festgestellt wurde, sucht der Tourist vornehmlich Ruhe und Erholung (siehe
Tabelle 1-9). Ist dies aber in der Masse möglich? Schließt nicht gerade die Masse das Ziel
ihrer eigenen Suche damit aus? Kann Tourismus in der Masse zusagende Eigenschaften
vermitteln?
Ebenso wie sich für den Tourismusbegriff Probleme bei der definitorischen
Einordnung ergeben, ist auch die Abgrenzung des Begriffes Massentourismus
problematisch. Im Grunde handelt es sich hierbei lediglich um Tourismus auf quantitativ
hohem Niveau als Ausdruck der Demokratisierung des Reisens und der touristischen
Aufrüstung nach dem Zweiten Weltkrieg in der spätkapitalistischen Gesellschaft.
Massentourismus ist daher Ausdruck der starken Partizipation großer Teile der
Bevölkerung der modernen Industriegesellschaft am Fremdenverkehr mit einer hohen
Reiseintensität. Aufgrund des geballten zeitlichen und räumlichen Auftretens der
Touristen an den touristischen ,,hot spots" entsteht Vermassung und damit auch die
negativen Aspekte des Massentourismus. L
ESER
(1998) greift deshalb die negativen
Assoziationen mit dem Massentourismus-Begriff auf und bezeichnet diesen als
,,Fremdenverkehr, der sich [überwiegend] in organisierter Form und in größeren Gruppen
abspielt und als Ziel stark frequentierte Fremdenverkehrsgebiete aufweist. Der Begriff
wird häufig abschätzig im Sinn einer Kritik an Auswüchsen des Tourismus gebraucht"
(L
ESER
1998, S. 497).
Es erscheint hier jedoch als sinnvoll von einer Wertung des Begriffes
Massentourismus abzusehen und sich auf die neutrale Definition des Massentourismus als
Tourismus auf quantitativ hohem Niveau zu beschränken. Eine qualitative Diskussion des
Begriffes würde zum einen die Bearbeitung des Themas von vorneherein zum Scheitern
Kapitel 1
16
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
verurteilen, zum anderen handelt es sich bei den negativen Auswirkungen um Folgen, die
das Phänomen ,,Massentourismus" nach sich ziehen kann, die aber nicht inhärent damit
verbunden sind.
Dem Massentourismus wird überwiegend die dominante Urlaubsform des 3S-
Urlaubs zugeordnet, die etwa in den großen spanischen Tourismuszentren und in anderen
Bereichen der Pleasure Periphery das Bild des Tourismus prägt. Doch auch andere
Urlaubsstile können sich durch massentouristische Charakteristika auszeichnen.
Abbildung 1-8: Idealisiertes Modell der Urlaubsstile mit zunehmender massentouristischen
Prägung
Quelle: eigener Entwurf.
Abbildung 1-8 zeigt eine idealisierte Darstellung der einzelnen Urlaubsstile gruppiert
nach deren zunehmenden massentouristischen Prägung. Während die Philosophie des
Abenteuer- und Entdeckerurlaubes als auch des Erholungs- und Gesundheitsurlaubes
(Cluster der Ruhe und Individualität) das Auftreten massentouristischer Tendenzen generell
ausschließt ein wirkliches Abenteuer und die psychische Erholung kann nicht in der
Sicherheit und Stresseinwirkung der Masse erfahren werden können diese in der Realität
jedoch auch hier in gewissem Umfang in Erscheinung treten (siehe Kapitel 1-3.4.2).
Das Cluster des Bewegungstourismus beinhaltet jene Urlaubsstile, die mit der
Bewegung auf touristischen Pfaden und Routen in Verbindung stehen (Wandertouren,
Studienreisen, Kreuzfahrten etc.). Diese zeichnen sich durch das temporäre Auftreten in
Massen an den entsprechenden Knoten (Attraktionen und sonstige touristische
Einrichtungen) dieser Hauptlinien aus. Pfade und Routen beschreiben hierbei jene Wege,
auf welchen sich die Touristen innerhalb der touristischen Aktionsräume bewegen, wobei
Routen den zeitlichen und räumlichen Verlauf einer Rundreise definieren.
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
Kapitel 1
17
Der Cluster des Hot-Spot-Tourismus ist durch eine nahezu durchgängige
massentouristische Prägung gekennzeichnet. Allen voran ist der klassische Badetourismus
durch eine hohe Konzentration von Touristen auf begrenztem Raum während des
gesamten Urlaubes charakterisiert. Einzig in den künstlichen Freizeitwelten, welche auch
als touristische Enklaven bezeichnet werden, ist diese Konzentration größer. Dieser Cluster
ist wesentlich durch eine starke räumliche und zeitliche Bindung an
Infrastruktureinrichtungen gekennzeichnet, weshalb an diesen Standorten stets die Masse
in Erscheinung tritt. Gerade die Urlaubsstile des Winteraktivurlaubes mit dem Ski- und
Snowboardurlaub sind in besonderem Maße von der Errichtung touristischer
Infrastruktur mit ihren technischen Aufstiegshilfen abhängig. Somit ist für den
Massentourismus vor allem der Cluster des Hot-Spot-Tourismus relevant, sowie die
Knoten der anderen Urlaubsstile.
Schließlich bleibt die Frage bestehen, was Masse ist und ab wann es sich um
Tourismus auf quantitativ hohem Niveau handelt. Explizite Antworten auf diese Frage
können auch hier nicht gegeben werden, denn die Ergebnisse sind äußerst situations- und
regionsabhängig. Beispielsweise können am Mount Everest in Nepal bereits 88 Bergsteiger
die massive Überlastung der Lokalität bedeuten (vgl. H
OLM
2003). In kaum einer anderen
Region egal ob mit touristischer Infrastruktur ausgestattet oder nicht würde diese
vergleichsweise geringe Anzahl von Besuchern ernsthafte Probleme auslösen. Damit ist
Masse nicht allgemeingültig und nur schwerlich abzugrenzen. Abgesehen davon
entstehen nicht notwendigerweise nur aus der Masse heraus Probleme für das Zielgebiet.
Kann Massentourismus in manchen Fällen und in mancher Hinsicht nicht doch vielleicht
auch verträglich sein?
1.3.3 Alternativer Tourismus und Ökotourismus
Alternativer Tourismus (AT) und Ökotourismus werden durchgängig als Gegenpol zum
Massentourismus genannt. Entsprechend der oben angesprochenen Strittigkeiten zur
definitorischen Abgrenzung, herrscht auch hier Uneinigkeit bei der Bestimmung der
Begrifflichkeiten. W
EAVER
(1998) stellt das Problem grafisch dar, indem er die Beziehung
der Tourismusarten zueinander aufzeigt (siehe Abbildung 1-9).
Alternativer Tourismus ist dem Begriff nach eine Alternative zum
Massentourismus und damit anders als dieser, vor allem von kleinerem Umfang.
Allerdings ist diese Bestimmung allein etwas wage, um davon auf eine verträglichere und
erholsamere Reiseform zu schließen. Wie die Grafik nach W
EAVER
zeigt, kann auch
alternativer Tourismus ähnliche negative Formen wie der Massentourismus
hervorbringen und stellt damit nicht immer eine anstrebenswerte Alternative dar.
Der bedeutendste Teilbereich des alternativen Tourismus ist zweifelsohne der
Ökotourismus. Er entstand aus einem veränderten Umweltbewusstsein und der
bewussten Ablehnung des Massentourismus. Ökotouristen wird zugeschrieben, dass sie
neue, abenteuerliche und persönliche Erfahrungen an einzigartigen, entlegenen oder
urtümlichen Orten suchen (vgl. B
LAMEY
2001).
Kapitel 1
18
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
Abbildung 1-9: Beziehung zwischen Massentourismus, alternativem und Ökotourismus
Quelle: W
EAVER
1998, S. 32, nach B
UTLER
1996.
Die Definitionen zum Begriff Ökotourismus gehen allerdings nicht durchgängig von
derart prägnanten Unterschieden zum Massentourismus aus. Im weitesten Sinne kann
Ökotourismus jegliche Form des Tourismus umfassen, deren Reiseinhalt unter anderem
der Naturgenuss oder das kulturelle Interesse an einer Gegend darstellt. Die
Ökotourismus-Gesellschaft hingegen definiert Ökotourismus als Reisen mit dem Ziel, die
kulturelle und natürliche Geschichte der aufgesuchten Räume zu verstehen. Gleichzeitig
soll die Integrität der Ökosysteme erhalten und wirtschaftliche Möglichkeiten zum Schutz
der Ressourcen erzielt werden (vgl. M
IDDLETON
1998). Damit zeichnet sich das breite
"Ökotourismus-Spektrum" ab, mit einer Spannbreite vom ,,hard ecotourist" hin zum ,,soft
ecotourist" (siehe Tabelle 1-6).
Tabelle 1-6: Charakteristika des harten (hard) und des sanften (soft) Ökotourismus
Hard
(Active)
Ökotourismus-Spektrum
Soft
(Passive)
Strong environmental commitment
Enhancement sustainability
Specialized trips
Long trips
Small groups
Physically active
Few if any services expected
Emphasis on personal experience
...
...
...
...
...
...
...
...
Moderate environmental commitment
Steady-state sustainability
Multi-purpose trips
Short trips
Large groups
Physically active
Service expected
Emphasis on interpretation
Quelle: W
EAVER
2001a, S. 106.
1.3 Tourismusformen und ihre Abgrenzung
Kapitel 1
19
Letzterer unterscheidet sich von ersterem dadurch, dass er die Urlaubsregion in dem
Zustand verlässt wie er sie vorgefunden hat, während ersterer versucht die Situation in
der Region zu verbessern. Zudem erwartet der sanfte Ökotourist im Gegensatz zu seinem
strengeren Pendant ein gewisses Maß an Dienstleistungen und ist nicht bereit sich
gänzlich der Kargheit einer Region hinzugeben. Damit bezeichnet der weniger strikte,
sanfte Ökotourist, der auch in Massen auftreten kann, den schleichenden Übergang zum
Massentourismus.
E
LLENBERG
ET
.
AL
. (1997) ordnen diesem Spektrum drei Gruppen von Ökotouristen
zu: die ,,sanften Stillen" unternehmen meist ausgedehnten Reisen in die Natur oder zu
traditionellen Kulturvölkern, bringen jedoch wenig Geld in die Zielregion und sind häufig
intolerant gegenüber anderen Urlaubern. Die ,,anspruchsvollen Naturkonsumenten"
verfügen über ein großes Reisebudget und über hohe Komfortansprüche. Während ihrer
relativ kurzen Reisedauer wird aber die einheimische Bevölkerung kaum gewürdigt und
die Natur lediglich als Urlaubs-Konsumgut betrachtet. Der ,,ideale Ökotourist"
unternimmt lange Reisen, stellt keine hohen Ansprüche an Komfort und Service und
konsumiert regionale Produkte. Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Gruppen ist
sich der ,,ideale Ökotourist" darüber hinaus vollends über seine Rolle als störender
Fremder und über seine Einwirkungen auf Umwelt und Kultur bewusst trotz jeglicher
Versuche seinerseits sich angepasst zu verhalten. Allerdings ist festzuhalten, dass dieser
Gruppe in der Realität niemand dauerhaft angehört, denn Urlaub bedeutet auch für die
meisten Ökotouristen weniger Verzicht als Genuss. Damit ist dem Großteil der Reisen
welche als Ökotourismus deklariert werden gemein, dass lediglich Naturräume das
Reiseziel darstellen (vgl. E
LLENBERG
ET
.
AL
. 1997).
Abschließend kann somit festgehalten werden, dass häufig kein entscheidender
Unterschied zwischen Öko- und Massentourismus existiert; besonders vor dem
Hintergrund, dass der sanfte, weniger strenge Ökotourismus im Grunde eine Variante des
Massentourismus darstellt (vgl. L
AWTON
2001). Wie sich die Reiseformen zu ihren
konkreten Ausprägungen entwickeln und wodurch bestimmt wird, welche
Tourismusform sich schließlich in der jeweiligen Region etabliert, ist Inhalt des folgenden
Kapitels.
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
20
Die Entwicklung von Tourismusregionen hat entscheidenden Einfluss auf die Etablierung
der dort anzutreffenden Urlaubsstile. Dieses Kapitel widmet sich daher den verschiedenen
Entwicklungsmöglichkeiten von touristischen Räumen.
1.4.1 Touristische Aktionsräume als Planungsgrundlage
Wie in Kapitel 1-1.1.1 erläutert, wird das Verhalten der Touristen von verschiedenen
Bedürfnissen und Motiven bestimmt, wobei sich dieses nach einem ähnlichen, immer
wiederkehrenden Muster entsprechend der touristischen Schlüsselaktivitäten abspielt
(vgl. S
TEINBACH
2003). Hierdurch ergibt sich eine Bündelung der touristischen Tätigkeiten
und damit bilden sich touristische Aktionsräume heraus. Der Tourist interessiert sich nicht
für die Ganzheit einer Region, sondern vorrangig für die ,,honey pots" oder ,,highlights"
und bewegt sich deshalb auf bestimmten Wegen, den touristischen Pfaden und Routen, zu
diesen unterschiedlichen Stationen. Dies ist zum einen auf das begrenzte Zeitbudget (vgl.
S
TEINBACH
2003, nach H
ÄGERSTRAND
) zurückzuführen. Denn innerhalb eines oft knapp
bemessenen Rahmens möchte der Besucher dennoch möglichst alle Besonderheiten und
Schönheiten einer Region bewundern. Zum anderen lotst die Informations- und
Werbepolitik der Reiseführer, der Tourismusregionen und Veranstalter, welche die
Sehenswürdigkeiten einer Region als touristisches Muss normen und diese gezielt
promoten, die Besucher zu diesen Highlights. Das Verhalten der Touristen lässt sich somit
leichter vorausbestimmen. Auf diese Weise bildet sich in den touristischen Regionen ein
,,zentraler" und ein ,,sekundärer Tourismusbereich" sowie eine ,,touristische Randzone"
heraus (vgl. S
TEINBACH
2003), die nur aufgrund punktueller Attraktionen am zentralen
Tourismusgeschehen beteiligt ist. Diese Zonierung ermöglicht die einfachere Kontrolle
und Management der Besucherströme und schützt zudem periphere Bereiche.
Entscheidend sind diese Erkenntnisse besonders für den Massentourismus, denn
durch die verschiedenen Verhaltensbeschränkungen in den Aktionsräumen tritt das
Phänomen der Masse überhaupt erst in Erscheinung: zum einen schränken
Kapazitätsbegrenzungen das vorhandene Zeitbudget ein, nachdem biologische und soziale
Grundbedürfnisse zunächst erfüllt werden müssen (siehe Kapitel 1-1.1.1). Des weiteren
erfordern Kopplungsbeschränkungen die Abstimmung der touristischen Aktivitäten auf
externe Vorgaben, wie Öffnungszeiten oder Ferienregelungen. Autoritätsbeschränkungen
fungieren schließlich beispielsweise mittels Eintrittspreise als soziales und ökonomisches
Kontrollinstrument (vgl. S
TEINBACH
2003). Mit den touristischen Aktivitäten ist somit eine
intrinsische Bündelung der Besucher an den verschiedenen Standorten der touristischen
Infrastruktur verbunden. Wichtig ist diese Erkenntnis speziell für die Planung,
insbesondere in Hinblick auf die touristische Leitung, Lenkung und Zonierung als
entscheidende Elemente der regionalen Tourismusplanung. Auf diese Steuerungselemente
soll in Kapitel 2-4.1.1.1 näher eingegangen werden.
Kapitel 1
21
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
1.4.2 Das Lebenszyklusmodell von Tourismusregionen nach R. B
UTLER
Die Tourismusregion im zeitlichen Kontext betrachtet B
UTLER
(1980) mit seinem
Lebenszyklusmodell für touristische Regionen. Ausgangspunkt ist deren Dynamik,
aufgrund sich ändernder Wünsche und Anforderungen der Gäste.
Die touristische Entwicklung einer Gegend beginnt meist mit deren Entdeckung
durch einzelne Künstler, Trendsetter und Eliten. Exemplarisch beschreibt C
HRISTALLER
(1963) den Wandel einer solchen Region:
Painters search out untouched and unusual places to paint. Step by step the place
develops as a so-called artist colony. Soon a cluster of poets follows, kindred to the
painters: then cinema people, gourmets, and the jeunesse dorée. The place becomes
fashionable and the entrepreneur takes note. The fisherman's cottage, the shelter-huts
become converted into boarding houses and hotels come on the scene. Meanwhile the
painters have fled and sought out another periphery periphery as related to space,
and metaphorically, as `forgotten´ places and landscapes. [...] More and more
townsmen choose this place, now en vogue and advertised in the newspapers. [...] At
last the tourist agencies come with their package rate travelling parties; now, the
indulged public avoids such places (C
HRISTALLER
1963, S. 103).
Die Analogie einer solchen typischen regionalen Tourismusentwicklung mit dem
Produktlebenszyklus mit Innovations-, Wachstums-, Reife- und Schrumpfungsphase aus
den Wirtschaftswissenschaften veranlasste B
UTLER
einen stereotypen Lebenszyklus für
touristische Räume aufzustellen (siehe Abbildung 1-10a).
Abbildung 1-10: Das Lebenszyklusmodell von Tourismusregionen
Quelle: eigener Entwurf nach B
UTLER
1980, S. 7.
Dieser Zyklus beginnt zunächst mit der ,,Entdeckung" (Exploration) neuer
Tourismusregionen durch vereinzelte Reisende. Zu diesem Zeitpunkt verfügt die Region
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
22
kaum über tourismusrelevante Einrichtungen, wodurch die Gäste gezwungenermaßen
lokale Einrichtungen mitbenutzten müssen. Hierdurch entsteht eine hohe
Kontakthäufigkeit zwischen Einheimischen und Gästen, die für manche Gäste eine
grundlegende Motivation für diese Reise sein kann. Mit zunehmender Beteiligung am
Tourismusgeschehen von Seiten der Touristen und der regionalen Bevölkerung in der
,,Erschließungsphase" (Involvement) steigt die Zahl der gezielten Investitionen zur
Förderung des Tourismus und erste Werbemaßnahmen werden durchgeführt.
Während zur Zeit der Erschließung der Kontakt zwischen Einheimischen und
Besuchern noch relativ ausgeprägt ist, büßt die ansässige Bevölkerung in der
,,Entwicklungsphase" (Development) zunehmend die Kontrolle über das Geschehen ein, ist
nicht mehr umfassend involviert und verliert deshalb nach und nach den Bezug zu den
Gästen. Die Region wird mittlerweile massiv beworben, die steigende Zahl der
Attraktionen wird verstärkt von externen Organisationen verwaltet und durch den
wachsende Arbeitskräftebedarf werden mehr und mehr regionsfremde Arbeitskräfte
rekrutiert. Damit entfremdet sich die Region zunehmend von ihrem ursprünglichen
Gesamtbild und eine Homogenisierung im Sinne internationaler Normen findet statt.
Schließlich festigt sich ihr Name in der ,,Konsolidierungsphase" (Consolidation), obwohl
bereits ein erster prozentualer Rückgang der Besucherzuwachsraten zu verzeichnen ist.
Über Werbung und Marketingaktionen wird versucht diese Zahlen wieder zu steigern, da
mittlerweile die gesamte Struktur meist sehr einseitig vom Tourismus abhängig ist.
Internationale Ketten und Betreiber besitzen einen Großteil der touristischen Infrastruktur,
was dazu führt, dass die Einwohner selbst immer weniger vom Tourismus profitieren.
Infolge dessen zeichnen sich erste Anzeichen von Ressentiments gegenüber den Touristen
ab. In der Phase der ,,Stagnation" (Stagnation) ist nun der Höhepunkt der Gästezahlen
erreicht. Die Region hat zwar ihren Markennamen in der Tourismusindustrie und bei den
Konsumenten gefestigt, doch zählt sie aufgrund der erreichten bzw. überschrittenen
Kapazitätsgrenzen und dem Bedeutungsgewinn neuer Urlaubsstile, welche sich in
anderen Regionen etablieren, nicht mehr zu den Trendreisezielen. Das ausufernde
touristische Wachstum führt zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Problemen in
der Region, weshalb lediglich noch Dauergäste, kaum aber neue Zielgruppen angelockt
werden können. Durch den fortgeschrittenen Infrastrukturausbau mit importierten und
artifiziellen Attraktionen kann das Image der Region von der geographischen Umwelt
gelöst sein, so dass keine eigenständigen Besonderheiten mehr vermittelt werden können.
Hierdurch sinkt die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen
Tourismusorten, was zum ,,Abschwung" (Decline) der Besucherzahlen führt. Infolge
dessen werden touristische Einrichtungen nach und nach geschlossen, andere werden in
ihrer Funktion umgewandelt. Der touristische Raum verliert seine Bedeutung und
verabschiedet sich zunehmend aus dem Tourismusgeschäft. In dieser Zeit entwickelt sich
eine Region entweder zum ,,tourist slum" (B
UTLER
1980, S. 9) oder wendet sich gänzlich
vom Tourismus ab. Die rückläufige Attraktivität der Region senkt derweil die
Investitionspreise, so dass wieder Einrichtungen in lokale Hände übergehen können.
Sofern zu diesem Zeitpunkt noch ein touristisches Bewusstsein in der Bevölkerung
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
23
vorhanden ist und sie daher einen Strukturwandel mit der Modifikation der touristischen
Infrastruktur bzw. die Verlagerung auf neue Urlaubsstile befürwortet und unterstützt,
kann die Destination eine ,,Verjüngung und Revitalisierung" (Rejuvenation) erleben. Eine
erneute Attraktivitätssteigerung ist entweder durch die Schaffung neuer künstlicher
Attraktionen, die Restaurierung bestehender oder die Inwertsetzung bislang
unberücksichtigter Ressourcen möglich. Für ersteres können die zahlreichen Freizeitparks
und Spaßbäder genannt werden, die in oder nahe bestehender Tourismusregionen
errichtet wurden. Um letzteres zu bewirken wird beispielsweise auf Mallorca über den
Bau mehrerer Golfplätze versucht, die landschaftliche Attraktivität, das ganzjährig
günstige Klima sowie die Nähe zu den europäischen Quellmärkten zu nutzen und
,,Qualitätstouristen" zu binden (siehe Kapitel 2-5). Um diesen neuen touristischen
Aufschwung zu erreichen sind weitreichende Initiativen und Bemühungen sowohl von
Seiten der einheimischen Bevölkerung als auch von Seiten der Regierungen erforderlich.
Dies zeigt sich jedoch oft erst erreichbar, wenn bereits massive Schäden und Einbußen
erfahren werden mussten.
So wie der Grad des infrastrukturellen Ausbaus, die Besitzverhältnisse und die Zahl
der Touristen im Laufe des Lebenszyklus der Tourismusregionen variiert, so verändern
sich auch die in der Region anzutreffenden Tourismusformen (siehe Abbildung 1-10b).
Während zu der Gruppe der ,,Explorer" in der ersten Phase der Entwicklung vor allem
,,hard ecotourists" gezählt werden können, reisen mit zunehmendem Grad der
touristischen Aufrüstung und dem steigenden Angebot touristischer Leistungen mehr und
mehr ,,soft ecotourists" in die Region. Die harten Ökotouristen, in der Literatur auch als
allozentrisch, also abenteuerlustig und offen für Neues bezeichnet (vgl. P
LOG
in R
OSACKER
1993, siehe Tabelle 1-7), wenden sich damit von ihr ab. Neue, noch periphere und
ursprüngliche Destinationen, die bislang ohne gezielte Umgestaltung für den Tourismus
auskamen, werden nun von ihren ersten Gästen entdeckt.
Tabelle 1-7: Merkmale der psycho- und allozentrischen Touristen
Psychozentrische Massentouristen
Allozentrische Alternativtouristen
Vertrauend / gehemmt / reserviert
Nervös
Nicht abenteuerlustig
Eingeengt
Selbstbewusst / offen
Stabil
Abenteuerlustig
In vielen Lebenslagen erfolgreich
Quelle: nach P
LOG
in R
OSACKER
1993.
In den bereits ergründeten Regionen werden aufgrund der neuen
Verdienstmöglichkeiten im Tourismus immer weitere Einrichtungen und Attraktionen
geschaffen oder erschlossen, wodurch verstärkt auch konventionelle, introvertiertere, an
Vertrautem festhaltende psychozentrische Massentouristen angesprochen werden. Diese
Gruppe erwartet ein bestimmtes Maß an Leistungen und Komfort, um sich ohne große
Umgewöhnung von zuhause auch in der Fremde zurecht zu finden und keine großen
Risiken im Urlaub eingehen zu müssen. Somit erweisen sich die harten Ökotouristen,
Kapitel 1
24
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
welche sich bewusst vom Massentourismus und anderen Tourismusformen absondern
möchten, gerade als deren Wegbereiter. Sie sind die Pioniere des folgenden intensiven
Infrastrukturausbaus in der Zielregion, der wachsenden Standardisierung des Angebotes
und somit der vielgeschmähten Eigenarten des Massentourismus an sich.
Die Relevanz dieses Konzeptes liegt in der Tatsache, dass eine Tourismusregion stets
mit Veränderungen bezüglich der externen Struktur in Hinblick auf Gästeerwartungen
und Markttrends konfrontiert wird. Auch von Seiten der internen Struktur der
demographischen, kulturellen und sozialen Durchmischung sowie von Seiten der
Angebotsgestaltung zeichnen sich stets neue Entwicklungen ab. Da der Tourismus in
zahlreichen Regionen einen wichtigen, oder gar den wichtigsten Wirtschaftsfaktor
darstellt, sollte jede Tourismusregion an der dauerhaften Attraktivität des eigenen
Angebotes interessiert sein. Vor diesem Hintergrund müssen sich die zuständigen Stellen
für Planung und Entwicklung dafür einsetzen Kapazitätsgrenzen nicht zu überschreiten
sowie das Angebot weiterzuentwickeln und zu verbessern um konkurrenzfähig zu
bleiben. Besonders entscheidend ist zudem ein Umdenken der gegenwärtig
dominierenden Politik des maximalen kurzfristigen Gewinns (vgl. B
UTLER
1980)
zugunsten langfristigerer Planungen und damit dauerhafter Prosperität.
1.4.3 Das ,,broad context model" der Destinationsentwicklung nach
W
EAVER
Das Konzept von W
EAVER
für die Entwicklung von Tourismusregionen basiert wie die
B
UTLER
-Kurve auf der grundlegenden Dynamik der regionalen Entwicklung. Allerdings
beschreibt W
EAVER
das B
UTLER
-Modell als lediglich eine von insgesamt acht möglichen
Varianten. Ausgangsbasis für diese Szenarien sind die vier wesentlichen Idealformen des
Tourismus (siehe Abbildung 1-11), welche sich aus dem Verhältnis zwischen der
jeweiligen Tourismusintensität und dem Ausmaß der angewandten
Regulationsmechanismen ergeben.
Abbildung 1-11: Idealformen des Tourismus
Quelle: nach W
EAVER
2000.
Kapitel 1
25
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Die Alternativen Tourismusformen der ersten Spalte der Matrix definieren sich
hierbei als Gegenteil zum Massentourismus und sondern sich von diesem durch
verschiedene Wesensmerkmale ab (siehe Tabelle 1-8). Dies wurde bereits bei dem Wandel
der Tourismusformen im B
UTLER
-Zyklus (siehe Kapitel 1-1.4.2) angedeutet.
Tabelle 1-8: Idealformen des Massen- und Alternativen Tourismus
Charakteristika Massentourismus Alternativer
Tourismus
AT-
Variante
Märkte
Segment
Volumen und Art
Saisonalität
Quellregionen
Psychozentrisch-midzentrisch
Groß; Reisepakete
Explizite Haupt- und Nebensaison
Wenige dominante Märkte
Allozentrisch-midzentrisch
Gering; individuelle Arrangements
Keine explizite Saisonalität
Keine dominanten Märkte
ZAT
BAT
Attraktionen
Betonung
Charakter
Ausrichtung
Äußerst kommerzialisiert
Unspezifisch, gekünstelt
Hauptsächlich oder nur Touristen
Gemäßigt kommerzialisiert
Regionsspezifisch, authentisch
Touristen und Einheimische
ZAT
BAT
Unterkunft
Größe
Räumliches Muster
Dichte
Architektur
Eigentumsverhältnis
Großmassstäbig
Konzentriert in Touristenzentren
Hohe Dichte
Internationaler Stil; aufdringlich
Extern, große Gesellschaften
Kleinmassstäbig
Verteilt über gesamte Region
Geringe Dichte
Einheimischer Stil, unauffällig
Lokal, kleine Unternehmen
ZAT
BAT
Ökonomischer Status
Rolle des Tourismus
Bindungen zur Region
Abflüsse aus Region
Multiplikatoreffekte
Dominiert lokale Wirtschaft
Vorwiegend extern
Extensiv
Gering
Ergänzt wirtschaftliche Aktivitäten
Vorwiegend intern
Minimal
Hoch
ZAT
BAT
Regulation
Kontrolle
Ausmaß
Ideologie
Betonung
Zeitlicher Rahmen
Externer privater Sektor
Gering; unterstützend für privaten
Sektor
Freie Marktkräfte
Wirtschaftliches Wachstum,
Profite; sektorspezifisch
Kurzfristig
Lokale `Gemeinschaft´
Extensiv; um negative
Auswirkungen zu minimieren
Öffentliche Eingriffe
Stabilität und Prosperität der
Region; integrativ, holistisch
Langfristig
Nur
BAT
Quelle: nach W
EAVER
2000.
Der zufällig alternative Tourismus (ZAT; ,,Circumstantial Alternative Tourism")
unterscheidet sich in Hinblick auf seine touristische Erscheinung somit grundlegend vom
Massentourismus: bezüglich der Märkte und Attraktionen, der Beherbergungsbetriebe
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
26
und ökonomischen Effekte in der Zielregion. Diese Tourismusform wird jedoch nicht oder
nur ungenügend reguliert, weshalb kein dauerhaft verträglicher Tourismus garantiert
werden kann. Nach dem B
UTLER
-Modell wäre diese Ausprägung mit noch geringen
Beteiligungszahlen von Touristen der Entdeckungs- und Erschließungsphase zuzuordnen.
Der bewusst alternative Tourismus (BAT; ,,Deliberate Alternative Tourism") unterscheidet
sich wiederum von seiner zufälligen Variante durch den Einsatz gezielter und nicht mehr
zufälliger Regulierungsmaßnahmen, um die Region auch zukünftig in einer möglichst
ursprünglichen Situation zu erhalten.
Entwickelt sich der Tourismus in einer Region ungebremst und unkontrolliert weiter,
so werden die ökologischen und soziokulturellen Grenzen überschritten. Eine solche
Tourismusform bezeichnet W
EAVER
als unnachhaltigen Massentourismus (UMT;
,,Unsustainable Mass Tourism"). Werden aber die Grenzen des akzeptablen Wandels und
Eingriffes trotz hoher Tourismusintensität eingehalten, kann von nachhaltigem
Massentourismus (NMT; ,,Sustainable Mass Tourism") gesprochen werden.
Da Tourismusregionen, wie bereits bei B
UTLER
festgestellt, keinesfalls statisch sind,
sondern sich willkürlich oder gelenkt verändern können, diskutiert W
EAVER
die
möglichen Varianten dieser Szenarien. Circa 95 Prozent der Erdoberfläche sind heute der
Gruppe der zufällig alternativen Tourismusregionen zuzuordnen. Die meisten dieser
besitzen kein nennenswertes Potenzial für die weitere touristische Entwicklung zu einer
bedeutenden Tourismusregion. Das wahrscheinlich häufigste, gleichwohl aber keineswegs
wünschenswerte Szenario ist der Wechsel vom zufällig alternativen zum unnachhaltigen
Massentourismus (ZAT UMT), der auch im klassischen B
UTLER
-Modell beschrieben
wird. Aufgrund der mangelnden Regulierungsmaßnahmen und der Nähe zu potenziellen
Destinationen, oder aufgrund der eigenen Attraktivität wachsen die Gästezahlen rasant
und unkontrolliert an. Die ökologischen und soziokulturellen Begebenheiten
verschlechtern sich daher am Höhepunkt dieser Entwicklung. Das Interesse der Touristen
an der Region sinkt, was rückläufige Nächtigungszahlen und einen Bedeutungsrückgang
des Tourismussektors zur Folge hat, sofern nicht aufwendige Rettungsmaßnahmen
gestartet werden. Besonders wärmere Küstenregionen und Inseln wie die Regionen der
sogenannten ,,Pleasure Periphery" mit der Karibik, den Hawaiianischen Inseln, dem
Mittelmeerraum, aber auch zentrale Gebiete wie alpine Täler und Gegenden an
Wasserflächen zeigen sich als außerordentlich anfällig für diesen Wandel.
Bei der Wende vom zufällig zum bewusst alternativen Tourismus (ZAT BAT)
wird der Fortgang der B
UTLER
-Sequenz in der Erschließungsphase und damit vor dem
drastischen Infrastrukturausbau der Entwicklungsphase unterbunden. Dies geschieht
vorwiegend in Regionen, die für eine fortschreitende Entwicklung zum Massentourismus
aufgrund mangelnder Attraktionen oder geringer Kapazitätsgrenzen nicht geeignet sind,
oder in Regionen, deren Bevölkerung und touristische Leistungsträger sich bewusst für
einen Tourismus auf quantitativ niedrigem Niveau entscheiden. Beispiele hierfür sind
Destinationen in sensiblen Ökosystemen, im Lebensraum von traditionellen Kulturvölkern
und bevorzugt in der Nähe von Nationalparks, wo die umweltbewussten Besucher
beherbergt werden.
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
27
Die Evolution vom zufällig alternativen zum nachhaltigen Massentourismus (ZAT
NMT) findet eher selten statt. Möglich ist dies in Zusammenhang mit großen Resorts oder
Freizeitanlagen, die von einem weitreichenden Regulationsrahmen umgeben sind, um
minimale ökologische als auch soziale Belastungen zu versichern. Für eine derartige
Steigerung der Tourismusintensität ist die gezielte Anpassung der Kapazitätsgrenzen nach
oben die wichtigste Voraussetzung.
Eine bewusst alternative Tourismusregion kann sich aus zwei Gründen zum
nachhaltigen Massentourismus (BAT NMT) entwickeln: um überhaupt Massen
anzuziehen, muss die Region zunächst das Interesse der Urlauber wecken. Zum einen ist
dies durch die Eignung für den 3S-Tourismus (Sonne, Sand, See) oder andere beliebte
Tourismusformen möglich. Zum anderen kann sich nachhaltiger Massentourismus auch
in Regionen etablieren, die als vorbildliche Orte des bewusst alternativen Tourismus
bekannt sind und auf diese Weise verstärkt Besucher in ihren Bann ziehen, wie in
manchen Naturreservaten Costa Ricas geschehen. Je attraktiver eine Destination mit ihren
landschaftlichen Besonderheiten oder kulturellen Eigenarten ist, desto mehr Besucher
werden von ihr angesprochen. Bei der Entwicklung vom anfänglich kleinmassstäbigen hin
zum Massentourismus sind allerdings umfassende Anforderungen an das Management
gestellt, um die Region an die veränderten Bedingungen anzupassen. Geschieht dies nicht,
entfaltet sich der Tourismus bei einem raschen Anstieg des Besucherverkehrs vom
bewusst alternativen Tourismus zum unnachhaltigen Massentourismus (BAT UMT).
Beispiele für dieses Szenario sind einige Nationalparke wie der Amboseli Nationalpark in
Kenia, der dem enormen Besucheranstieg keine entsprechenden Regelungen
entgegensetzen konnte.
Ist in einer Gegend nachhaltiger Massentourismus etabliert, bedeutet dies
keineswegs, dass er auf Dauer garantiert ist. Sobald Kapazitätsgrenzen gelockert, nicht der
aktuellen Situation angepasst oder nicht mehr berücksichtigt werden, ebnet dies schnell
den Weg vom nachhaltigen zum unnachhaltigen Massentourismus (NMT UMT).
W
EAVER
nennt hier exemplarisch die Tourismusentwicklung der Region Cancún.
Zunächst war dort die mexikanische Regierung an steigenden Touristenzahlen, damit
auch an steigender Attraktivität der Region interessiert und implementierte deshalb ein
ausführliches Regelwerk. Sobald die erhofften Übernachtungszahlen erreicht waren,
wurden staatliche Förderungen und Auflagen zurückgeschraubt und damit dem
unkontrollierten Wachstum die Pforten geöffnet. Diese Evolution kann sich auch durch
Einflüsse von außen vollziehen. Schließlich handelt es sich bei Tourismus um ein
zentrifugales Phänomen (vgl. C
OHEN
1978), das sich von einem Kern ausgehend ins
Umland ausbreitet. Um Disney World in Florida herum setzte beispielsweise ein derart
ausschweifendes Wachstum des Tourismussektors ein, dass der zuvor streng
reglementierte Komplex nun in einem unverträglichen Umfeld eingebettet liegt. Diese
mangelnden Planungs- und Managementkonzeptionen sind hingegen für die
Transformation des unnachhaltigen in einen nachhaltigen Massentourismus (UMT
NMT) von höchster Bedeutung. Dieses letzte Szenario erscheint als ziemlich
unwahrscheinlich, da zu neuen Planungs- und Managementaufgaben zusätzlich meist
1.4 Entwicklungskonzepte für Tourismusregionen
Kapitel 1
28
erhebliche Kosten zur Beseitigung der ,,Tourismusaltlasten" hinzukommen. Dennoch ist
diese Tendenz im mallorquinischen Calvià zu beobachten, dessen Methoden in Kapitel 2-5
näher dargelegt werden.
Nach dem oben gesagten wird deutlich, dass der bewusst alternative Tourismus und
der nachhaltiger Massentourismus die anzustrebenden Tourismusformen sind. Beide
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Regulationsmechanismen aus, die auch zukünftige
Entwicklungen in geregelten Bahnen und entsprechend der jeweiligen Belastungsgrenzen
lenken sollte. Da sowohl der zufällig alternative als auch der nicht nachhaltige
Massentourismus auf ein solches Regelkonzept verzichten, ist deren weitere Entfaltung
fraglich und hält zahlreiche Unwägbarkeiten für die entsprechenden Regionen bereit. Sie
können keine dauerhaft verträgliche respektive nachhaltige Entwicklung in Aussicht
stellen. Hiermit wirft sich die Frage nach den Grundzügen einer nachhaltigen
Entwicklung auf, die im nächsten Kapitel erläutert werden soll.
2 Die Entwicklung der Nachhaltigkeit als internationales
Leitbild
Seit einigen Jahren ist die Nachhaltigkeit ein oft verwendetes Schlagwort, mit welchem
viele Konzepte versehen werden. In diesem Abschnitt sollen die inhaltlichen Aspekte
dieses Begriffes dargelegt werden, um im weiteren Verlauf die Bedeutung der
Nachhaltigkeit für den Massentourismus zu diskutieren.
2.1 Nachhaltigkeit und ihre Wurzeln
Bereits Anfang des neunzehnten Jahrhunderts wurde die Idee der Nachhaltigkeit in der
Forstwirtschaft eingeführt. Wichtigste Prämisse war hierbei, dass die Produktionskraft des
Waldes auf einem optimalen Niveau gehalten, nicht überlastet nd damit die Qualität des
Standortes nicht langfristig gemindert oder geschädigt wird (vgl. B
AUMGARTNER
, R
ÖHRER
1998). Ziel war es, nicht mehr Holz innerhalb eines Zeitraumes einzuschlagen als in
diesem nachwachsen kann. Ursache für diese Tendenzen waren mittlerweile bemerkbare
Folgen eines massiven Raubbaus der Wälder für die industrielle Produktion. Die breite
Umsetzung dieser Prinzipen der nachhaltigen Forstwirtschaft erfolgte aber erst in jüngerer
Zeit. In den sechziger Jahren machte sich eine Ökologiebewegung mit einem wachsenden
Umweltbewusstsein in der Bevölkerung bemerkbar und erhielt Einzug in die politische
Diskussion. Im Jahre 1972 folgte als Anzeichen eines veränderten Entwicklungs-
verständnisses die erst Umweltkonferenz der Vereinten Nationen `Human Environment´
in Stockholm, in deren Zuge das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) ins
Leben gerufen und ein Aktionsplan zur internationalen Zusammenarbeit gegen
Umweltverschmutzung verabschiedet wurde (www.sueddeutsche.de, 20.08.2002). Diese
Konferenz prägte den Begriff des ,,Ecodevelopment", anhand dessen ein alternativer
Entwicklungsweg unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit und der
Befriedigung der Grundbedürfnisse beschritten werden sollte. Im selben Jahr wurde der
erste Bericht an den `Club of Rome´ unter dem Titel ,,Grenzen des Wachstums"
veröffentlicht, der anhand einer Computersimulation darlegte, dass bei einer
fortschreitenden Entwicklung des Status quo verbunden mit Bevölkerungswachstum,
Ressourcenraubbau und Umweltbeeinträchtigungen innerhalb von hundert Jahren die
Umwelt kollabieren werde. Diese beiden prägnanten Ereignisse des Jahres 1972 zeigen ein
gewandeltes Umweltbewusstsein und läuteten die internationale Diskussion um
verträgliche Entwicklung ein.
29
2.2 Der Brundtland Bericht und die Entstehung eines ganzheitlichen Leitbildes
2.2 Der Brundtland Bericht und die Entstehung eines ganzheitlichen
Leitbildes
Kapitel 1
30
Das modifizierte Umweltverständnis zeigte sich mit der Veröffentlichung des Berichtes
,,Our Common Future" der W
ORLD
C
OMMISSION ON
E
NVIRONMENT AND
D
EVELOPMENT
(WCED) unter dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem
Brundtland (Brundtland-Bericht). Eine Expertenkommission, zusammengesetzt aus
Wissenschaftlern und Politikern der Industrie- als auch der Entwicklungsländer,
erarbeitete einen Leitfaden für die zukünftige globale Entwicklung nach dem
Nachhaltigkeitsprinzip. Damit prägte diese Kommission erstmals den Begriff des
,,sustainable development" im heutigen Sinne, welcher anfänglich als ,,dauerhafte
Entwicklung", heute eher mit ,,nachhaltiger Entwicklung" übersetzt wird. Unter diesem
Begriff verstand die WCED:
development that meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs (W
ORLD
C
OMMISSION ON
E
NVIRONMENT
AND
D
EVELOPMENT
1987, S. 43).
Damit rückte die Definition von der rein ökologischen Interpretation ab, welche die IUCN,
der WWF und UNEP dem Begriff in ihrer "World Conservation Strategy" vorab
zugedacht hatten. Nachhaltige Entwicklung gründet sich nach M
URPHY
(1994) auf die
altbekannten Prinzipien des Erhalts und der Verwaltung, bietet jedoch gleichzeitig einen
dynamischeren Standpunkt, da sie fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung jedoch in
ökologischer und fairer Weise erlaubt. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde damit im
Brundtland-Bericht erstmalig mit der Zielsetzung gebraucht, die offenbar konträren
Konzepte der wirtschaftlichen Entwicklung und des Umweltschutzes zu verbinden (vgl.
G
ARROD
, F
YALL
1998). Auf diese Weise betonte der Bericht seinen Leitfaden für
,,sustainable development" explizit als dynamisches Entwicklungskonzept und berechtigt
dadurch besonders die Entwicklungs- und Schwellenländer zu fortführender
Entwicklung. So erhielten sie die Einwilligung die Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung
abzudecken entgegen den bislang geltenden Konservierungs- und Schutzbestimmungen.
Laut Kommission ist bei jeglichem Wachstum ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Aspekten zu bewahren. Bei
fortdauerndem Wirtschaftswachstum müsse dies über stets neue, innovative und
angepasste Technologien garantiert werden.
Aufgrund dieser entwicklungsliberalen Interpretation der Nachhaltigkeit, mangelte
es nicht an Kritik an der Arbeit der Kommission. Zahlreiche Umweltschützer forderten die
Abkehr von der Unterstützung des fortschreitenden Wachstums, da jegliche zusätzliche
Entwicklung in einem globalen Desaster enden würde. Ein zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern erforderlicher Kompromiss konnte jedoch nur erreicht werden,
indem den Entwicklungsländern ein Recht auf Wachstum gewährt wurde, weshalb die
Kommission nur in diesem Konzept eine Lösung sah.
2.2 Der Brundtland Bericht und die Entstehung eines ganzheitlichen Leitbildes
Kapitel 1
31
Aufgrund des umfangreichen Medieninteresses an der UN-Konferenz für Umwelt
und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro wurde der ,,Umweltgipfel" in der
Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen. Hier wurden die Klimarahmenkonvention, die
Biodiversitäts-Konvention, die Walderklärung, die Rio-Deklaration mit Grundsätzen zur
Umwelt und Entwicklung sowie die Agenda 21 als ausgedehntes Aktionsprogramm für
nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert unterzeichnet. Zwar stellten alle diese
Verträge lediglich Rahmenbedingungen ohne verbindliche Verpflichtungen für die
Unterzeichnerstaaten dar, doch ging von der Konferenz ein erheblicher Impuls aus. In
etlichen Ländern wurden nationale Aktionsprogramme gestartet und zahlreiche
Kommunen riefen lokale Agenden 21 ins Leben. Der Tourismus fand allerdings in den
Vereinbarungen von Rio noch keine spezifische Berücksichtigung, während bereits in der
ersten Folgekonferenz 1997 (,,Rio + 5") auch der nachhaltige Tourismus diskutiert wurde.
Auf den ,,Umweltgipfel" in Rio und die daraus erwachsene Popularität des
Nachhaltigkeitskonzeptes in, fanden zahlreiche, meist themenspezifische Konferenzen
statt, wie die Klimakonferenz von Kyoto (1997), die Konferenz von Lanzarote (1995) der
W
ORLD
T
OURISM
O
RGANIZATION
, der UNESCO und UNEP, welche die ,,Charta für
nachhaltigen Tourismus" verabschiedete, oder die Konferenz über biologische Vielfalt und
Tourismus in Berlin (1997) in deren Zuge die ,,Berliner Erklärung" zum nachhaltigen
Tourismus unterzeichnet wurde.
2.3 Das
,,development
triangle"
als Grundlage der Nachhaltigkeit
Seit dem Beginn der Diskussion im Jahre 1972 hat sich das Konzept der Nachhaltigkeit im
Laufe der Jahre etabliert. Dennoch besteht auch heute wegen kontroverser
Interpretationsmöglichkeiten noch keine einheitliche Meinung zur Auslegung und
Umsetzung des Konzeptes. Einerseits wird die Konzeption derart interpretiert, dass
künftige Generationen über ein größeres Know-how und bessere Technologien verfügen
und daher weniger Ressourcen benötigen werden als heute.
Abbildung 1-12: Das ,,Development triangle"
Quelle: F
ARRELL
1994, S. 116.
Andererseits steht dieser Auffassung die Meinung der strengen Nachhaltigkeitsauslegung
gegenüber, wonach trotz fortschrittlicher Innovationen ein gewisses Maß an Ressourcen
erforderlich sein wird und dem Wachstum deshalb drastische Restriktionen auferlegt
2.3 Das ,,development triangle" als Grundlage der Nachhaltigkeit
Kapitel 1
32
werden müssen. Gemein ist den Interpretationsvarianten, dass das ,,development
triangle" mit seinen Eckpfeilern Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zentraler Kern des
Nachhaltigkeitskonzeptes ist (siehe Abbildung 1-12). ,,And in theory, if not in practice, no
component may be more important than any other" (F
ARRELL
1994, S. 116).
Dennoch fordern gerade Umweltschützer die einseitige Betonung des
Umweltschutzes und vernachlässigen dabei oft die Bedeutung von Gesellschaft und
Wirtschaft. Wegen des integrierenden Ansatzes der Nachhaltigkeit verstößt diese Haltung
aber gegen das Konzept. F
ARRELL
kommt diesbezüglich zu folgendem Schluss:
To think narrowly of the human world order in terms such as the `natural
environment perturbed by human agencies´ omits so much, is unrealistic and artificial,
destroys an integrated approach, and by its restrictiveness all but denies sustainability
in its non-fundamental new sense. At the other extreme, to think narrowly [for
example] in terms of tourist management concerned only with tourism supply,
demand, infrastructure, and consumers [...] is to sadly misinterpret today's realities
(F
ARRELL
1994, S. 117).
Nur durch Berücksichtigung aller drei Säulen der Nachhaltigkeit (siehe Abbildung 1-13a)
in gleichberechtigter Weise kann der Weg der nachhaltigen Entwicklung eingeschlagen
werden. Denn nachhaltige Entwicklung basiert auf der zentralen Prämisse, dass
Wirtschaft und Umwelt natürlicher und kultureller Art zwei gegenüberliegende Seiten
ein und der selben Medaille und damit unweigerlich miteinander verknüpft sind (vgl.
M
URPHY
1994).
Abbildung 1-13: Grundpfeiler der Nachhaltigkeit
Quelle: eigener Entwurf.
Bei der Umsetzung dieses integrierenden Konzeptes wird dessen ungeachtet vor
allem der natürlichen Umwelt besondere Bedeutung eingeräumt (siehe Abbildung 1-13b).
Dies rührt zum einen von der Ökologiebewegung der siebziger und achtziger Jahre her, in
deren Umfeld die Wurzeln der Nachhaltigkeit zu suchen sind. Zum anderen ist die
unterschiedliche Betonung der drei Grundpfeiler der Nachhaltigkeit auf deren ungleiche
2.3 Das ,,development triangle" als Grundlage der Nachhaltigkeit
Kapitel 1
33
Eigenart zurückzuführen. Schließlich wird ein Entwicklungsprojekt, das keine materielle
Entwicklung und nicht die erwarteten ökonomische Effekte für eine Region nach sich
zieht, in der Regel nur wenige Befürworter finden. Aus diesem Grunde ist die
ökonomische Dimension eine inhärente Voraussetzung für jegliche Entwicklung. Zumal
gerade in der westlichen Welt fast alle Entwicklungsvorhaben besiedelte Gegenden
tangieren, gilt es darüber hinaus die betroffene Bevölkerung von den geplanten Absichten
zu überzeugen. Damit wäre die soziokulturelle Dimension oder auch die immaterielle
Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Normen, Werten und Traditionen berücksichtigt.
Wird die einheimische Bevölkerung jedoch nicht in Planungsprozesse oder Projekte mit
einbezogen, kann sie aktiv oder passiv zu deren Scheitern beitragen. Dagegen kann die
Natur nicht für sich selbst plädieren und die Folgeschäden mangelhafter Konzeptionen
zeigen sich oft erst nach Jahren. Des weiteren ist die Natur Grundlage für jegliche
Entwicklung, da weder Gesellschaft noch Wirtschaft ohne eine intakte Natur existenzfähig
sind und Wachstum für beide ohne diese von Anbeginn ausgeschlossen bleibt. Damit fällt
der ökologischen Grundlage auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine herausragende
Position zu, wobei sie niemals alleine, sondern immer in dem umfassenden Kontext des
,,development triangle" betrachtet werden muss.
Bei dem Konzept der Nachhaltigkeit muss zudem berücksichtigt werden, dass es sich
um einen Entwicklungsleitfaden handelt, der einen dynamischen Weg hin zur Erfüllung
der Nachhaltigkeitsziele und kein starres Gebilde bezeichnet. Eine ideale Verwirklichung
der Nachhaltigkeit kann vielleicht nie erreicht werden. Verschiedene Gruppen können
möglicherweise nie gänzlich in die nachhaltige Entwicklung integriert werden. Zudem
ändern sich Wertvorstellungen ständig, so dass stets neue Leitlinien das Handeln
dominieren (vgl. F
ARRELL
1994). Demnach muss Nachhaltigkeit fortwährend den neuesten
Erkenntnissen angepasst und entsprechend modifiziert werden. Sie befindet sich dadurch
aber auch zu keinem Zeitpunkt im finalen Endstadium. Die tatsächliche Erfüllung der
Nachhaltigkeitskriterien kann erst nach Jahren beurteilt werden, da es sich um eine
langfristige, dauerhafte Konzeption handelt, deren Erfolg erst von kommenden
Generationen bewertet werden kann. Hierin liegt wohl die größte Gefahr bei der
Umsetzung nachhaltiger Entwicklungskonzepte. Zum einen sind die Strategien der
politischen Entscheidungsträger oft an kurzfristigen Zielen zur Sicherung des
Machterhaltes ausgerichtet und somit stark von populistischen Strömungen abhängig
(siehe Kapitel 2-5.2). Zum anderen werden im Zuge der allgemeinen Globalisierungs- und
Deregulierungsbestrebungen Ansätze zur Wahrung regionaler Interessen erschwert. Die
vom ,,Shareholder Value"-Gedanken geleitete Wirtschaft mit ihrem wachsenden Einfluss
auf politische Entscheidungsprozesse richtet ihr Handeln ebenso wenig an langfristigen
Konzeptionen aus, welche keine kurzfristigen Ertragssteigerungen versprechen (vgl.
M
ALEBRANCHE
2002; M
ARTIN
, S
CHUMANN
2003)
2
.
2
Im Rahmen dieser Arbeit soll nicht näher auf die umfassende Problematik des
Globalisierungsprozesses eingegangen werden. Es wird an dieser Stelle auf die oben angeführte
Literatur verwiesen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832481100
- ISBN (Paperback)
- 9783838681108
- DOI
- 10.3239/9783832481100
- Dateigröße
- 7.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt – Mathematisch-Geographische Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Juli)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- tourismus nachhaltigkeit netzwerke ökotourismus mallorca
- Produktsicherheit
- Diplom.de