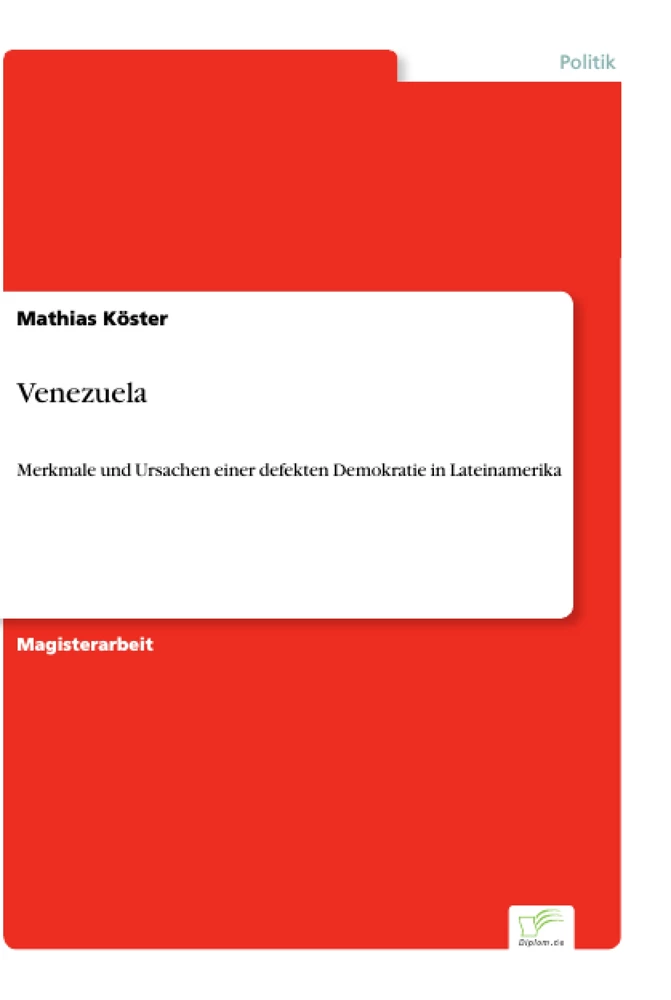Venezuela
Merkmale und Ursachen einer defekten Demokratie in Lateinamerika
Zusammenfassung
Seit der erneuten Etablierung eines demokratischen Systems 1958 galt Venezuela lange Zeit als Hoffnungsträger für eine stabile Entwicklung repräsentativ-demokratischer Regime in Lateinamerika, einer Region, die jahrzehntelang gezeichnet war von gewaltsamen Umstürzen, extremer Ungleichheit und ausgeprägter Instabilität. In nur wenigen Jahren hat das Land jedoch diesen Nimbus verloren und wird spätestens seit dem Präsidentschaftsantritt von Hugo Chávez Frías 1999 von einigen internationalen Beobachtern als Sorgenkind betrachtet. Wie konnte es kommen, dass dieses reiche Ölland mit seiner breiten Mittelschicht und relativ hohem Lebensstandard sich in so kurzer in eine stark polarisierte Gesellschaft verwandelte, in der sich Regierung und Opposition als feindliche Blöcke gegenüberstehen und rechtsstaatliche Standards regelmäßig verletzt werden? Warum traten in dem einst als konsolidierte Demokratie geltenden Land wieder Putschversuche des Militärs zutage, die längst in der Mottenkiste der Geschichte vermutet wurden?
Die Arbeit versucht sich diesen Fragen aus einer demokratietheoretischen Perspektive zu nähern. Die Regierung Chávez war angetreten, um in Venezuela eine wahre Demokratie zu errichten, die die bisherige oligarchische Demokratie ablösen sollte. Der Versuch, diese wahre Demokratie zu etablieren, wird von Regierungsgegnern jedoch vehement als undemokratisch, ja faschistisch bezeichnet. Um hier Klarheit zu gewinnen, wird in der Arbeit in einem ersten Schritt ein elaboriertes Demokratiekonzept herausgearbeitet. Das Konzept der defekten Demokratie wurde erst vor kurzem in die politikwissenschaftliche Diskussion eingeführt. Es erlaubt in taxonomischer Absicht eine detaillierte Analyse von politischen Regimen und wird der Arbeit zu Grunde gelegt, um zu evaluieren, inwieweit Venezuela sich als Demokratie qualifiziert.
Die gründliche Untersuchung des politischen Regimes ergibt, dass unter Chávez eine defekte Demokratie delegativen Typs etabliert wurde, die die vormals exklusive Demokratie abgelöst hat. Aufgrund der Ausschaltung aller die Exekutive kontrollierenden Instanzen ist diese Regimeform demokratietheoretisch hoch problematisch. Die stark majoritären Charakterzüge verschärfen überdies die Kluft zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung. Die anschließende Ursachenanalyse begründet den Niedergang des alten Regimes mit der erodierten Legitimationsbasis. So wurde das Feld bereitet für eine charismatische […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1. Einleitung
2. Demokratiebegriff
2.1 Ausbreitung der Demokratie und das Aufkommen von Regimen in der „Grauzone“
2.2 Konzeptuelle Möglichkeiten zur Erfassung demokratischer Grauzonen
2.2.1 Hybride Regime als Mischform von Demokratie und Autokratie
2.2.2 „Klassische“ Klassifikation
2.2.3 Bildung „unvollständiger Subtypen“
2.3 Ein mehrdimensionales Demokratiekonzept
2. 3. 1. Partizipation und politischer Wettbewerb
2. 3. 2. Effektives Herrschaftsmonopol
2. 3. 3. Zum Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
2.4 Defekte Demokratien
2.4.1 Typologie defekter Demokratien
2.4.2 Defekte Demokratien in Abgrenzung zu autoritären Regimen
3. Venezuelas defekte Demokratie
3.1 Die Phase der exklusiven Demokratie von 1958-1988
3.2 Die exklusive Demokratie in der Krise
3.3 Formen der defekten Demokratie seit dem Amtsantritt von Präsident Chávez
3.3.1 Das Wahlregime
3.3.2 Öffentliche Arena
3.3.3 Effektives Herrschaftsmonopol
3.3.4 Horizontale Verantwortlichkeit
3.3.5 Bürgerliche Freiheitsrechte
3.4 Der Regress der venezolanischen Demokratie und die Dynamik der Defekte
4. Wie lassen sich die Defekte erklären? Eine Ursachenanalyse
4.1 Der Zusammenbruch des etablierten Regimes von 1958
4.1.1 Sozioökonomische Faktoren
4.1.2 Soziokulturelle Faktoren
4.1.3 Politisch-institutionelle Faktoren
4.1.4 Die Rolle der Akteure
4.1.5 Morscher Entwicklungspfad und Legitimitätserosion: Das Ende politischer Stabilität in Venezuela
4.2 Krisensituation, charismatische Herrschaftslegitimation und das Erbe informeller Institutionen: Die Etablierung der delegativen Demokratie
4.2.1 Das Vorhandensein einer besonderen Krisensituation
4.2.2 Charismatische Herrschaftslegitimation
4.2.3 Verminderte Anzahl der Vetospieler
4.2.4 Die Kontinuität delegativer Praktiken
5. Entwicklungsszenarien
5.1 Annäherung an die liberal-rechtsstaatliche Demokratie
5.2 Die Verstetigung der Defektsyndrome
5.3 Abdriften in die Autokratie
6. Fazit
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Wahl- und Abstimmungsergebnisse in Venezuela
Auswahl ökonomischer Basisdaten Venezuelas
Zur Messung defekter Demokratien
Literaturverzeichnis
Tabellen und Abbildungen
Tabelle 1: Elektorale Demokratien 1974-2001
Abbildung 1: Teilregime und Kriterien der embedded democracy
Tabelle 2: Typologie defekter Demokratien
Tabelle 3: Auftretende Defekte unter Chávez und ihre Auswirkungen auf die demokratische Funktionslogik
Tabelle 4: Komponenten des politischen Systems und Unterstützungsarten
Abbildung 2: Schematische Darstellung der wesentlichen Faktoren zur Herausbildung und Aufrechterhaltung des politischen Regimes von 1958
1. Einleitung
In einer Region wie Lateinamerika, die über Jahrzehnte hinweg gekennzeichnet war durch häufige Putsche und Putschversuche, Guerillakriegführung, Massenproteste sowie extreme soziale Ungleichheit, galt Venezuela lange als Hoffnungsträger. Seit dem Sturz des Diktators General Pérez Jiménez 1958 hatte sich ein politisch, wirtschaftlich und sozial stabiles Regime ununterbrochen behaupten können. Die politische Führung wurde durch regelmäßig abgehaltene Wahlen bestellt, die Streitkräfte waren domestiziert und reiche Ölvorkommen, eine relativ breite Mittelschicht sowie sich verbessernde Bildungsmöglichkeiten verhießen eine anhaltende Prosperität.
Doch seit Anfang der Achtziger Jahre mehren sich die Krisensymptome in dem Land, das oftmals als Paradebeispiel einer liberalen Demokratie auf dem südamerikanischen Kontinent gehandelt wurde. Im Februar 1983 konnte die Kapitalflucht nur durch die Aufgabe des über Jahrzehnte stabilen Wechselkurs der venezolanischen Währung gegenüber dem US-Dollar gestoppt werden. Es war der sichtbare Ausdruck einer einsetzenden Wirtschaftskrise, die bis heute anhält. Sechs Jahre später lähmten blutige Aufstände gegen die Regierung in Caracas das Land, nachdem Präsident Carlos Andrés Pérez marktkonforme Wirtschaftsreformen angekündigt hatte. Im Jahr 1992 erlebte Venezuela gleich zwei Putschversuche durch Militärs. Schließlich gewann im Dezember 1998 mit Hugo Chávez Frías ein Mann die Präsidentschaftswahl, der angekündigt hatte, das politische System Venezuelas substanziell verändern zu wollen. Gewählt wurde er mit großer Mehrheit von den vielen Enttäuschten und Verarmten, die ihre Interessen im bisherigen Regime nicht repräsentiert sahen. Doch was bedeutete der Regierungsantritt des Mannes, der in deutschen Medien schon mal ebenso arrogant wie süffisant als „Revolutionsclown“ und „größte Nervensäge des Kontinents“ abgetan wird (Matussek 2002: 154), für die venezolanische Demokratie? Chávez initiierte den Prozess einer Verfassungsgebung, schickte derweil das amtierende Parlament nach Hause und entließ die Richter des Obersten Gerichts. Zugleich ist aber der Wortlaut der neuen Verfassung aus demokratietheoretischer Sicht unproblematisch. Nach der Annahme in einer Volksbefragung wurden darüber hinaus alle Staatsämter erneut durch Wahlen besetzt und Chávez dabei in seinem Amt bestätigt. Allerdings sitzen in den kontrollierenden Institutionen ausschließlich Anhänger des Präsidenten, der oftmals über Dekrete am Parlament vorbei regiert. Rechtsstaatliche Prozeduren werden durch informelle Regelungen unterlaufen, so dass Kritiker das Regime als autokratisch kennzeichnen, während Anhänger es als „wahre“ Demokratie bezeichnen, die ein elitäres System abgelöst habe.
Für die Politikwissenschaft wirft der Fall Venezuela zunächst die theoretische Frage auf, woran eine Demokratie eigentlich zu erkennen ist. Welche Kriterien entscheiden über die Klassifizierung eines Regimes als „demokratisch“ oder „autoritär“? Ist jedes System, in dem regelmäßig Wahlen abgehalten werden schon deshalb eine Demokratie? Oder müssen daneben nicht auch noch andere Merkmale existieren? Wenn ja, welche sind das? Dieser Begriffsproblematik von „Demokratie“ widmet sich das zweite Kapitel. Es wird argumentiert, dass Demokratien normativ auf den grundlegenden Prinzipien von Freiheit und Gleichheit beruhen, die durch institutionalisierte Kontrolle garantiert werden müssen. Dem Abschnitt liegt die These zugrunde, dass Demokratien einer komplexen institutionellen Funktionslogik folgen müssen, um diesen Prinzipien Geltung zu verschaffen. Ein mehrdimensionales Demokratiekonzept kann diese spezifische Logik erfassen und Kriterien bereitstellen, anhand derer Regime klassifiziert werden können. Politische Systeme, die nicht alle diese Kriterien erfüllen, werden nicht allein deshalb als Autokratien aufgefaßt. Weisen sie neben autokratischen Merkmalen die zentralen Merkmale demokratischer Regime auf, werden sie als Abweichungen von funktionstüchtigen, liberal-rechtsstaatlichen Demokratien verstanden. Systematisch dient das Konzept der „defekten Demokratie“ (Merkel 1999a) der Klassifizierung solcher Regime.
Venezuela ist eine solche defekte Demokratie, so die These, die dem dritten Kapitel zugrunde liegt. Dies ergibt sich aus der Untersuchung des venezolanischen politischen Systems anhand des zuvor erarbeiteten Konzepts. Es ist zugleich ein Versuch über die Anwendbarkeit des Konzepts der defekten Demokratie. Obgleich sich die Erörterungen auf die Gestalt des Regimes unter Chávez‘ Präsidentschaft konzentrieren, wird für die Untersuchung der gesamte Zeitraum seit der Transition zur Demokratie 1958 bis zum März 2002 herangezogen.[1] Die systematische Betrachtung zeigt, dass Venezuela unter Chávez trotz schwerer Funktionsverletzungen noch als Demokratie gelten muss. Die vorliegenden Defekte weisen es allerdings als delegative Demokratie aus. Zugleich wird festgestellt, dass auch im Vorgängerregime leichte Funktionsdefekte existierten, es wird als exklusive Demokratie klassifiziert. Da das Regime, das sich seit 1958 entwickelte, jedoch einer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie ziemlich nahe war, während das jetzige Regime zur Autokratie neigt, wird ein regressiver Prozess konstatiert.
Das vierte Kapitel fragt nach den Ursachen dieser Regression. Warum brach das alte System zusammen und weshalb etablierte sich Ende der Neunziger Jahre gerade eine delegative Variante der Demokratie? Die Annahme, dass Venezuela sich in feinster evolutionistischer Manier gemäß den Prämissen einer groben Lesart der Modernisierungstheorie entwickeln würde, hat sich nicht bestätigt, weil politisch-institutionelle Faktoren nicht in deren Blickfeld geraten. Die ökonomische Entwicklung allein kann den Zusammenbruch nicht hinreichend erklären. Es wird argumentiert, dass das alte Regime instabil wurde, weil es nicht mehr genügend Legitimität erzeugen konnte. Zur Erosion der Unterstützung trug die Struktur des politischen Systems selbst bei. Venezuela bildete einen umfassenden Parteienstaat aus, der es der politischen Elite ermöglichte, die öffentlichen Ressourcen unter Zuhilfenahme von Klientelismus und Korruption zur Sicherung ihrer Position zu nutzen. Erschien das Institutionengefüge deshalb der Mehrheit der WählerInnen nicht mehr als rechtmäßig, so führte die wirtschaftliche Krise dazu, dass dem Regime die nötigen Mittel zur Sicherung spezifischer Unterstützung ausgingen. Die sozioökonomische Krisensituation beförderte gleichfalls die Errichtung der delegativen Demokratie. Daneben wirkten die charismatische Legitimation der Herrschaft, die abnehmende Anzahl der Vetospieler und die Tradition delegativer Praktiken positiv auf die Ausbildung dieser Form einer defekten Demokratie.
Abschließend werden im fünften Kapitel die Entwicklungsmöglichkeiten des venezolanischen Regimes betrachtet. Ausgehend von der bereits erstellten Analyse und der Situation angesichts der jüngsten Entwicklungen werden drei Szenarien entwickelt und diskutiert. Diese Arbeit gelangt zu dem pessimistischen Schluss, dass Venezuelas politisches System mittelfristig nur beim Eintritt sehr vorteilhafter Begebenheiten eine Entwicklung hin zum Modell der liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie durchlaufen wird.
2. Demokratiebegriff
Der Begriff der Demokratie ist hochgradig normativ aufgeladen – nicht nur in der politischen Debatte. In der Geschichte des politischen Denkens durchlief er dabei ein weites Spektrum an Bewertungen. So sah Platon in der Demokratie eine „angenehme, herrscherlose und bunte Staatsform, die den Gleichen so gut wie den Ungleichen gleiche Rechte einräumt“ und einen Menschen hervorbringe, der unterschiedslos seinen kurzfristigen Begierden folgt: „Der Trieb, der sich gerade bemerklich macht, übernimmt die Leitung, als ob sie ihm gebühre.“ (Der Staat: 558, 561). Auch in der Hochzeit der Aufklärung wurde die Demokratie – verstanden als Teilhabe aller erwachsenen männlichen Bürger an der Herrschaftsausübung, die nicht rechtsstaatlich eingehegt ist – trotz der einsetzenden Etablierung des anthropozentrischen Weltbildes nicht immer positiv beurteilt. Unter dem Eindruck der Jakobinerherrschaft galt daher Kant die (nicht-repräsentative)[2] Demokratie als
„ Despotismus, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider einen (der also nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist“ (1979 (1795): 28; Hervorhebung im Original).
Positive Zuschreibungen erfuhr die Demokratie in der Neuzeit in den politischen Auseinandersetzungen während der großen bürgerlichen Revolutionen in Frankreich und den USA, insbesondere durch die Hervorbringung der Idee einer repräsentativen Demokratie, wie sie die Federalist Papers in Anschluss an Locke, Montesquieu und Sieyes formulierten (Göhler/Klein 1993: 370ff.; Held 1996: 78-94).
Mit der Inklusion immer weiterer Bevölkerungsteile in den politischen Prozess wurde Demokratie zunehmend als politischer Kampfbegriff gebraucht, den fast jede Richtung für sich vereinnahmte. Selbst Anhänger eines plebiszitären Führerstaates wie Carl Schmitt (1926) konnten sich als Demokraten verstehen, wenn in Rousseauscher Manier die Identität von Regierenden und Regierten zum Wesensmerkmal der Demokratie erhoben, und die Akklamation des Volkes gegenüber dem geheimen Wahlakt als überlegen angesehen wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Delegitimierung nationalsozialistischer und faschistischer Regime verstärkte sich diese Tendenz noch. Ein Symposium der UNESCO von 1951 stellte fest, dass Demokratie von allen Systemen als Idealbeschreibung in Anspruch genommen wird (McKeon/Rokkan 1951: 527). Solchermaßen entwickelte sich die Zuschreibung der Demokratie zur Leerformel und Klaus von Beyme konstatierte treffend: „Der Demokratiebegriff entwickelt mehr und mehr die Tendenz, synonym mit allem Guten, Schönen und Wahren in der Gesellschaft zu werden.“ (2000: 234; vgl. zur Begriffs- und Rezeptionsgeschichte der Demokratie Meier et al. 1972).
Dass die Werturteile über die Demokratie so unterschiedlich ausfallen, liegt nicht zuletzt an den stark variierenden Bedeutungen, die dem Begriff zugeschrieben werden.[3] Eine allseits akzeptierte Definition von Demokratie gibt es in der Forschung nicht. Die etymologische Wurzel findet sich im Griechischen. Demokratie setzt sich zusammen aus demos (Volk) und kratein (herrschen) und meint also Volksherrschaft (Guggenberger 1996: 81). In der klassischen Staatsformenlehre der Antike wurde Demokratie durch die Zahl der an der politischen Herrschaft Teilhabenden definiert. In Abgrenzung zur Monarchie/Tyrannis[4] sowie Aristokratie/Oligarchie, bezeichnete Demokratie – ebenso wie die Politie – in der berühmten Systematik des Aristoteles die Herrschaft der Vielen oder der Mehrheit des Volkes (Politik, Drittes Buch: 1279a). Der Begriff der Demokratie wurde in der griechischen Antike synonym zur isonomia (etwa: Gleichheit vor dem Gesetz) gebraucht. Denn es wurde angenommen, dass die rechtliche Gleichheit am besten durch die politische Gleichheit der Bürger und die Institution der Volksversammlung gesichert sei (Meier et al. 1972: 823).
Die etymologische Definition gibt Auskunft über die Quellen der legitimen Ausübung politischer Macht. Sie muss vom Volk ausgehen. Doch der Demokratiebegriff bleibt dadurch allein noch unterbestimmt. Denn wer gehört zum Volk, zum „ demos “? Mit welchen Mitteln kann die Herrschaft ausgeübt werden? Und gibt es Grenzen der demokratischen Herrschaftsausübung? Schon diese ersten Fragen zeigen, dass Demokratie auf vielfältige Weise gedeutet werden kann. Beispielsweise darf nicht vergessen werden, dass der Bürgerstatus in der antiken Demokratie zwar politisch und nicht ethnisch definiert wurde, aber dennoch in hohem Maße exklusiv war. Frauen gehörten ebensowenig zum demos wie Sklaven und Metöken. Eine solch restriktive Teilnahmebeschränkung findet sich auch in der Neuzeit. Als Abraham Lincoln in seiner berühmten Gettysburg-Ansprache 1863 formulierte, Demokratie meine „government of the people, by the people, for the people“, schloss „the people“ zwar die männliche schwarze Bevölkerung mit ein, nicht jedoch Frauen und Nicht-Steuerzahlende. Tatsächlich ist eine solche Definition analytisch unbrauchbar, denn es lassen sich zahlreiche Regime von direkten über repräsentative Demokratieformen bis hin zur stalinistischen Diktatur unter diese vermeintlich griffige Formel subsumieren (Sartori 1997: 44f.). Auf die Frage, wie die Volkssouveränität als Legitimationsprinzip der Demokratie gedeutet und institutionalisiert werden kann und soll, gibt es unterschiedliche Antworten. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass es eine Vielzahl von Demokratiebegriffen und Demokratietheorien gibt (vgl. Schmidt 2000; Held 1996).
In der Neuzeit beruht der hohe normative Gehalt der Demokratie nicht nur auf der Idee der Volkssouveränität, die jegliche politische Herrschaft von Fürsten oder auch Technokraten als illegitim ablehnt (Held 1996: 297). Er entspringt auch der Verknüpfung der Volkssouveränitätsidee mit dem Versprechen der Aufklärung, dass jedes Individuum sein Dasein selbst bestimmen können sollte. Dies wird deutlich in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution (vgl. Böckenförde 1992: 292f.). Da letztere die universelle Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer Vernunftfähigkeit begründet, scheint es geradezu selbstverständlich, dass mit der Durchsetzung aufklärerischer Ideen auch das Wahlrecht auf immer weitere Bevölkerungsschichten ausgedehnt wurde, wie im 20. Jahrhundert zu beobachten (Schmidt 2000: 392).[5] Für die moderne Demokratie ergibt sich dadurch – trotz aller Unterschiede ihrer jeweiligen Erscheinungsformen – eine inhärente Logik, die auf den Prinzipien von Freiheit (private und politische Selbstbestimmung) und (politischer und rechtlicher) Gleichheit aller StaatsbürgerInnen beruht (Sartori 1997: 291 ff.; vgl. auch Dahl 1989: 83-131). Zusätzlich bedarf es der routinisierten Kontrolle der politischen Herrschaftsträger und -inhalte, um den Bedingungen der Realisierung von Freiheits- und Gleichheitsrechten Geltung zu verschaffen.[6] An der Institutionalisierung dieser Funktionsprinzipien lassen sich Demokratien von anderen Herrschaftsformen unterscheiden. Die Notwendigkeit, Demokratien von anderen politischen Herrschaftsformen zu unterscheiden, ist durch die zunehmende Verbreitung demokratischer Regime drängender denn je geworden. Häufig tritt inzwischen das neue Phänomen auf, dass Regime, die kompetitive Wahlen abhalten, um die Herrschaftspositionen zu besetzen, nicht zugleich einen umfassenden Schutz der Grundrechte garantieren oder Prinzipien des Rechtsstaats verletzen. Trotz freier und fairer Wahlen werden die drei Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Kontrolle in der alltäglichen Herrschaftspraxis verletzt, die Selbstbestimmung im Extremfall auf den Wahltag begrenzt. Darüber hinaus wird der Wahlakt selbst bedeutungslos, falls die private und öffentliche Autonomie der Wählerinnen nicht vor und nach der Wahl garantiert werden.
Die Konzentration auf den Wahlprozess zur Qualifizierung politischer Systeme als demokratisch, die in der vergleichenden Forschung weit verbreitet ist, reicht mithin nicht mehr aus, sollen analytische Trennschärfe und die Möglichkeit gehaltvoller Aussagen über die Bedeutung des Regimetyps erhalten bleiben. Weil Venezuela zu eben diesen Regimen zählt, in denen die grundlegenden Prinzipien demokratischer Herrschaft institutionell verletzt werden, sollen im folgenden verschiedene Ansätze zur Erfassung dieser politischen Systeme, die nach herkömmlicher Klassifikation keinem Typus eindeutig zuzuordnen sind, dargestellt und bewertet werden. Anschließend wird ein mehrdimensionaler Demokratiebegriff entwickelt und das Konzept „defekter Demokratien“ herausgearbeitet, das geeignet ist, „Grauzonenregime“ wie Venezuela systematisch zu analysieren.
2.1 Ausbreitung der Demokratie und das Aufkommen von Regimen in der „Grauzone“
Seit der „Dritten Welle“ (Samuel Huntington) der Demokratisierung,[7] wird die Demokratie nicht mehr nur durch Lippenbekenntnis als ideale Regierungsform gepriesen, sondern es finden auch in immer mehr Staaten Wahlen zur Bestellung der Regierung statt. Insbesondere nach dem Zusammenbruch des „real existierenden“ Sozialismus hatte es den Anschein, als stünde das Modell liberaler, rechtsstaatlich verfasster Demokratien, wie es sich im Okzident seit der Aufklärung herausgebildet hatte, ohne Konkurrenz da. Dessen legitimatorischer und funktionaler Überlegenheit könne sich nun kaum ein politisches Regime auf lange Zeit entziehen. In der berühmten These Francis Fukuyamas (1992) wurde dieser Befund auf die teleologische Spitze getrieben, wenn er mit dem weltweiten Siegeszug von Demokratie und Marktwirtschaft gleichsam das „Ende der Geschichte” eingeläutet sah.[8]
Empirische Messungen von Regimetypen untermauern den Befund eines globalen Siegeszugs der Demokratie, obwohl zugleich irritierende Abweichungen vom liberal-demokratischen Modell wahrgenommen wurden. Anschließend an Schumpeters elitäre Demokratietheorie[9] wurde die Abhaltung von freien und fairen Wahlen in der vergleichenden Forschung zum Teil als einzig definierendes Kriterium von demokratischen Herrschaftsformen herausgestellt. Mit einem solchermaßen minimalisierten Demokratiebegriff konnte beispielsweise das US-amerikanische Freedom House-Institut eine stark zunehmende Verbreitung demokratischer Regime auf dem Globus feststellen. Waren am Beginn der dritten Demokratisierungswelle 1974 nach den Daten von Freedom House knapp über ein Viertel der Staaten demokratisch, so lag ihr Anteil 1990 bereits bei 46,1 Prozent und stieg bis 2001 weiter auf über 60 Prozent (vgl. Tabelle 1). Die starke Konzentration auf den Wahlprozess und dessen Gleichsetzung mit einem demokratischen Regime ohne weitere Qualifikationen wurde in der Forschung kritisiert. So befanden Philippe Schmitter und Terry Karl: „However central to democracy, elections occur intermittently and only allow citizens to choose between the highly aggregated alternatives offered by political parties“ (1991: 78). Dem trug auch das Freedom House-Institut Rechnung, indem es seine Klassifizierung der Demokratie für Staaten mit freien und fairen Wahlen mit dem Adjektiv electoral versah und von liberal democracies unterschied. Letztere Klasse umfaßt nur Regime, die neben der Abhaltung von freien und fairen Wahlen auch gewisse Bürger- und politische Rechte garantieren.[10] Obgleich Vorgehensweise und Fallbewertung von Freedom House nicht unumstritten sind, wird dennoch unisono der dort konstatierte Trend hin zu einer Verbreitung demokratischer Regime auch von anderen Ansätzen der Demokratiemessung bestätigt (Lauth/Pickel/Welzel 2000a).
Tabelle 1: Elektorale Demokratien 1974-2001
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Diamond 1999, 2002: 28; Freedom House: www.freedomhouse.org, besucht am 20. Juli 2002.
Dass relativ freie und faire Wahlen in immer mehr Staaten abgehalten werden, bedeutet aber nicht, dass sich diese Staaten auch zu liberalen Rechtsstaaten entwickelten. Wie aus Tabelle 1 deutlich hervorgeht, etablierten sich während der dritten Welle der Demokratisierung zunehmend elektorale Regime, die sich nicht als liberal-rechtsstaatlich qualifizierten. Das Auftreten von Wahlprozessen bei gleichzeitigem Verzicht auf rechtsstaatlich-liberal verfasste Ordnungen stellte für die Politikwissenschaft Anfang der 1990er Jahre ein neues Phänomen dar. Autoritäre Regime hatten klassischerweise bis in die 80er Jahre hinein auf die Legitimation durch Wahlen verzichtet (vgl. Linz 2000). Transitionsregimen, die einmal founding elections abhielten, wurde eine inhärente Tendenz zur Ausbildung eines liberalen Rechtsstaats, und ein Entwicklungspfad auf westliche Demokratien zu oder aber die Regression zurück zu einem autoritären Regime unterstellt. Gerade Länder der dritten Demokratisierungswelle weisen jedoch häufig Merkmale auf, die auf eine neue Variante der Demokratie schließen lassen: Missachtung von bürgerlichen Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit, routinemäßige Umgehung der Gewaltenkontrolle oder Einschränkungen des Gewaltmonopols der demokratisch legitimierten Regierungen. Die Beobachtung dieser „in der Grauzone von konsolidierter, liberaler Demokratie und offener Autokratie siedelnden Regime“ (Merkel/Croissant 2000: 4) offenbarte die Notwendigkeit, qualifizierte Demokratiekonzepte zu entwickeln, um die Differenz angemessen beschreiben zu können. Die Entdeckung der „Demokratie mit Adjektiv“ (Collier/Levitsky 1997) hat Konjunktur, wie die verschiedenen Versuche der Konzeptualisierung belegen. So wurden solche Regime als „hybrid“ (Karl 1995), sowie als „illiberale“ (Zakaria 1997; Bell et al. 1995), „delegative“ (O’Donnell 1994), „defekte“ (Merkel 1999a; Merkel/Croissant 2000; Thiery 2002) oder auch „Pseudodemokratie“ (Diamond 1996) bezeichnet.
Problematisch ist, dass solche Konzepte oftmals induktiv entwickelt wurden und regional- oder fallspezifischen Faktoren verhaftet blieben. Für den interregionalen Vergleich politischer Regime ist es jedoch notwendig, bei der Analyse solcher „Grauzonenregime“ (Croissant 2002) an die Typologie politischer Systeme anzuknüpfen. Diese setzt sich aus der Trias von demokratischen, autoritären und totalitären Regimen zusammen (vgl. Merkel 1999b: 23-56).[11] Um den Bereich zwischen Demokratie und Autoritarismus erfassen zu können, müssen zwei Fragen beantwortet werden:
1. Welches sind die definierenden Merkmale einer Demokratie, welches die einer Autokratie?
2. Welche Konzepte sind geeignet, Regimegebilde in der Grauzone voneinander, sowie von „eindeutigen“ Demokratien einerseits, „eindeutigen“ Autokratien andererseits trennscharf zu unterscheiden?
Um diesen beiden Fragen nachzugehen, sollen im weiteren Verlauf dieses Kapitels zunächst die verschiedenen Forschungsstrategien zur Erfassung solcher Regime in der Grauzone mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen referiert und beurteilt werden. Im zweiten Schritt wird ein mehrdimensionales Demokratiekonzept herausgearbeitet. Sodann wird der Konzeptualisierung verminderter Subtypen der Demokratie folgend das Konzept der „defekten Demokratie“ hergeleitet, wie es vor allem von Wolfgang Merkel, Aurel Croissant und Peter Thiery in der Literatur vorgeschlagen wurde. Es wird in der Typologie politischer Systeme verortet und von Autokratien abgegrenzt.
2.2 Konzeptuelle Möglichkeiten zur Erfassung demokratischer Grauzonen
Welche Forschungsstrategien bieten sich an, um den Raum zwischen eindeutig liberal-rechtsstaatlichen Demokratien und eindeutigen Autokratien klassifikatorisch zu besetzen? Die Devianz politischer Systeme[12] vom Modell liberaler, rechtsstaatlicher Demokratien wurde häufig anhand von Fallbeispielen beschrieben. Ohne ein theoretisches Fundament zu legen, das den zugrunde liegenden Demokratiebegriff thematisiert und dessen Zusammenhang mit dem wahrgenommenen Phänomenen in einen konzeptionellen Rahmen einbindet, werden der Demokratie immer mehr Adjektive beigegeben (vgl. Collier/Levitsky 1997), die oftmals das Unbehagen gegenüber solchen Regimen widerspiegeln. Forschungsstrategisch ist das unbefriedigend, weil keine generalisierbaren Aussagen gemacht, und komparativ getestet werden können. Um den systematischen Vergleich von Regimetypen zu ermöglichen und eine „ confusion of meanings “ (Sartori 1984: 26) zu vermeiden bzw. zu beheben, müssen Versuche zur typologischen Erfassung von Grauzonenregimen einer konsistenten konzeptionellen Logik folgen, die sich an die Klassifikation sämtlicher politischer Regime anschließt. Dies ist deshalb vonnöten, da solche Regime eine gewisse Verstetigung an den Tag legen und nur unzureichend als „Übergangsregime“ charakterisiert werden können, die sich entweder in Richtung Autokratie oder hin zur Demokratie mit voll ausgebildetem liberalem Rechts- und Verfassungsstaat entwickeln (O’Donnell 1996). Drei Forschungsstrategien lassen sich zusammenfassend unterscheiden (vgl. Collier/Levitsky 1997; Croissant 2002; Croissant/Thiery 2000b; Krennerich 2002; Rüb 2002). Erstens können Grauzonenregime als hybride Gebilde aufgefaßt werden, die verschiedene Merkmale von Demokratien und Autokratien aufweisen und typologisch gleichberechtigt neben ihnen stehen. Zweitens kann an der „klassischen“ Klassifikation festgehalten werden. Durch eine schmale und klare Bestimmung der definierenden Merkmale eines Typs, sollen alle Regime weiterhin entweder als Demokratien oder als Autokratien verstanden werden. Drittens können „unvollständige Subtypen“ gebildet werden, die nicht alle Klassifikationsmerkmale eines Regimetyps aufweisen, aber dennoch als Untergruppe der Demokratie oder Autokratie gelten.
2.2.1 Hybride Regime als Mischform von Demokratie und Autokratie
Hybride Regime sind klassifikatorisch auf derselben Ebene wie Demokratien und Autokratien angesiedelt. Sie stellen eine Mischform dar, die sowohl Merkmalsausprägungen demokratischer, wie autokratischer Regime aufweist, aber trotzdem analytisch von beiden zu trennen ist. Prominent wurde dieser Ansatz vor allem durch einen Aufsatz von Terry Lynn Karl, die damit die Regime Zentralamerikas mit Ausnahme Costa Ricas charakterisierte. Hybride Regime seien gekennzeichnet durch
„an uneven acquisition of the procedural requisites of democracy. Gains in the electoral arena have not been accompanied by the establishment of civilian control over the military or the rule of law. Elections are often free and fair, yet important sectors remain politically and economically disenfranchised“ (1995: 80).
Wurde das Konzept bei Karl noch wenig systematisiert, konstruierte Friedbert W. Rüb (2002) eine Typologie, die hybriden Regimen bestimmte Merkmalsausprägungen verschiedener Herrschaftskriterien zuwies. Demnach würden sich hybride Regime ebenso wie Demokratien durch freie und faire Wahlen legitimieren[13] und ihre Herrschaft durch gesatztes Recht ausüben. Gemeinsam mit autoritären Regimen ist ihnen jedoch, dass sie keine horizontale Gewaltenkontrolle ausbilden. Mit dem entgrenzten Herrschaftsumfang stehen hybride Regime den autoritären ebenfalls nahe (ebd.: 105-109). Somit können nach Rüb hybride Regime auf dem Kontinuum politischer Systeme klar verortet werden.
Problematisch an der Konzeption hybrider Regimetypen ist neben dem Verzicht auf die (auch normativ wünschenswerten) Unterscheidung von Demokratie und Autokratie in erster Linie die Ausweitung der Grauzone. Wenn jegliche Mischung von Merkmalsausprägungen demokratischer und autoritärer Regime als hybride Regime konzipiert werden – und nur so ließe sich das Universum der Grauzonenregime erfassen, ohne die Frage nach der Einordnung bestimmter Fälle wieder an die tradierten Kategorien der Regimetypologie von Demokratie, Autoritarismus und Totalitarismus zurückzugeben – besteht die Gefahr, dass diese als „Residualkategorie all‘ jene Fälle aufsaugt, die nicht den idealtypischen Vorstellungen eines autoritären oder demokratischen Systems entsprechen“ (Krennerich 2002: 60).[14] Es werden Regime, die sich in ihrer Funktionsweise stark voneinander unterscheiden, demselben Typ zugeordnet. Über die Auswirkungen des Regimetyps auf die innere Funktionsweise, sind dann nahezu keine gehaltvollen Aussagen mehr möglich.
2.2.2 „Klassische“ Klassifikation
Die zweite Strategie behandelt Grauzonenregime als Subtypen von Demokratie oder Autokratie, die durch unterschiedliche konnotative Merkmale unterschieden werden. Den Grundkategorien wird oftmals eine schmale Definitionsbasis zugrunde gelegt, um Fälle eindeutig einem Regimetypus zuordnen zu können. Alle politischen Systeme, die beispielsweise als demokratisch eingestuft werden, weisen dann zumindest einen Grundbestand an gemeinsamen Merkmalen – wie freie und faire Wahlen – auf. Sind Regime einmal klar einer Klasse zugeordnet, gerät die Differenz zwischen ihnen erst durch den Abstieg auf der „ ladder of abstraction “ (Sartori 1970: 1040) ins Blickfeld. In diesem Falle lassen sich dann demokratische oder autoritäre Subtypen (vgl. Linz 2000: 146ff.) des jeweiligen Ausgangskonzepts (root concepts) bilden. Als Variante dieser Strategie der „klassischen“ Klassifikation muss auch der Vorschlag Michael Krennerichs (2002) gelten, schmale Definitionen anzulegen, aber die Merkmalsausprägungen im gesellschaftlichen Kontext zu beurteilen. Erst durch den Vergleich mit Fällen, die ähnliche Rahmenbedingungen aufweisen, könne verstanden werden, ob Kriterien erfüllt werden. Auf dieser Grundlage könne die Kategorisierung von Demokratie und Autokratie vorgenommen werden.
Durch präzise Bestimmung der definierenden Merkmale kann das Problem des „ conceptual stretching “ (Sartori 1970: 1034; Collier/Mahon 1993) vermieden werden, indem die weitere Differenzierung von Fällen anhand kontingenter Merkmale des Ausgangskonzepts in einzelnen Subtypen vorgenommen wird. Problematisch ist jedoch, dass solchermaßen nur verschiedene Typen der Demokratie unterschieden werden können, nicht jedoch verschiedene Grade (Collier/Levitsky 1997: 435). Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, besitzen die verschiedenen, miteinander verflochtenen Regelsysteme einer Demokratie eine eigene Funktionslogik, die jeweils auf die Logik des Gesamtregimes einwirken. So lassen sich definierende und zentrale Merkmale in einem demokratischen Regime unterscheiden. Die einzelnen Merkmale erlangen erst dann volle Geltungskraft, wenn auch die anderen Merkmale gegeben sind. Eine solche Interdependenz zwischen den Merkmalen gerät bei der Strategie der „klassischen“ Klassifikation aus dem Blickfeld, da jedes Regime, das gewisse Merkmale aufweist, sofort als volle Demokratie oder volle Autokratie begriffen wird.[15]
2.2.3 Bildung „unvollständiger Subtypen“
Auch bei dieser Konzeptbildungsstrategie wird der kategoriale Unterschied zwischen Demokratie und Autokratie aufrechterhalten. Dem Vorschlag von David Collier und Steven Levitsky (1997) folgend, wird in einem ersten Schritt das Ursprungskonzept präzisiert. Davon ausgehend werden dann unvollständige Subtypen (diminished subtypes) gebildet, die nur einige, nicht aber alle der Klassifikationskriterien des Ursprungskonzepts erfüllen. So lassen sich beispielsweise politische Regime dem Systemtypus Demokratie zuordnen, obgleich sie nicht alle Merkmale aufweisen; sie bilden daher eine Kategorie unvollständiger Subtypen, die der Demokratie näher kommen als einem autoritären Regime.
Diese zunächst attraktiv erscheinende Möglichkeit zur Erfassung von Grauzonen läuft Gefahr, den kategorialen Unterschied zwischen Demokratie und Autokratie zu verwischen, wenn nicht mehr zwischen definierenden und kontingenten Merkmalen differenziert wird (Lauga 1999: 166-169). Mit der Unterscheidung von definierenden und zentralen Merkmalen (Merkel/Croissant 2000), wird dieser Gefahr der Unschärfe begegnet. Im Gegensatz zu kontingenten Merkmalen, repräsentieren zentrale institutionelle Merkmale darunter liegende demokratische Prinzipien, die in einem wechselseitigen, funktionslogischen Wirkungsverhältnis zueinander und zu den Prinzipien hinter den definierenden Merkmalen stehen. Nur wenn auch die zentralen Merkmale gegeben sind, entfalten die definierenden Merkmale ihre volle Geltungs- und Wirkungskraft. Die Bildung unvollständiger Subtypen der Demokratie hat diesen Zusammenhang im Blick und ermöglicht zugleich die differenzierte Erfassung der Grauzonenregime. Aufgrund dieses Vorteils ist es diese Strategie, der die vorliegende Arbeit methodisch folgt. Ein mehrdimensionaler Demokratiebegriff berücksichtigt die Interdependenz zwischen den verschiedenen Merkmalen. Die Bildung „unvollständiger Subtypen“ wird daraus systematisch im Konzept der „defekten Demokratie“ entwickelt.
2.3 Ein mehrdimensionales Demokratiekonzept
Demokratie beschreibt eine Form politischer Herrschaft,[16] deren Implikationen und institutionelle Ausgestaltung umstritten ist. Dem bereits angesprochenen Pluralismus von Demokratiebegriffen in der Demokratietheorie zum Trotz, avancierte in der vergleichenden Forschung und insbesondere in der aufkommenden Transitionsforschung das Dahlsche Polyarchiekonzept[17] zum gemeinsamen Ausgangspunkt der Analyse (Merkel 1996b: 33). Dieses in der Tradition von Schumpeters elitärer Demokratietheorie stehende Konzept, geht von einem schlanken Demokratiebegriff aus, denn Dahl (1971: 4) begreift Polyarchie wesentlich als politischen Wettbewerb (public contestation) und Partizipationsrecht (right to participate). Mit einer Aufstellung von acht – später sieben – institutionellen Minimalanforderungen lassen sich nach Dahl Polyarchien von autoritären Regimen unterscheiden.[18] Diese zwei Dimensionen fügen sich zu einer zusammen, da sie, insbesondere nach der neueren Fassung von 1989, nur die „vertikale Legitimitätsdimension zwischen Wählern und Gewählten wie Regierten und Regierenden” bezeichnen (Merkel 1999a: 364). So zentral diese Verknüpfung für die Demokratie auch ist, so wenig ist sie hinreichend, um eine Herrschaftsform als demokratisch zu qualifizieren.[19] Denn Legitimität kommt auch einer aus freien, fairen, allgemeinen und kompetitiven Wahlen hervorgegangenen Regierung erst dann zu, wenn sie die Aufrechterhaltung der privaten und öffentlichen Autonomie garantiert und als nicht-hintergehbar akzeptiert. Der Zwangscharakter des Rechts als Mittel der politischen Herrschaftsausübung ist also nur dann zu legitimieren, wenn sich die BürgerInnen auch als Autoren der Rechtsnormen verstehen können, denen sie als Adressaten Gehorsam leisten sollen (Habermas 1996). Der Herrschaftsausübung müssen deshalb rechtsstaatliche Grenzen gesetzt werden. Darüber hinaus muss die Ausübung politischer Macht allein bei den gewählten Mandatsträgern liegen, damit die Legitimation überhaupt denjenigen Institutionen zugeführt wird, die die Politik gestalten und vor dem souveränen Volk verantworten. Dieser Arbeit liegt dementsprechend ein Demokratiekonzept zugrunde, das sich über drei Dimensionen erstreckt (Merkel 1999a; Merkel/Croissant 2000):
- Partizipation und politischer Wettbewerb
- Effektives Herrschaftsmonopol
- Liberaler Rechts- und Verfassungsstaat[20]
Aus diesen drei Dimensionen hat Peter Thiery (2002; Croissant/Thiery 2000b) fünf Teilregime der Demokratie abgeleitet, die sich analytisch unterscheiden lassen. Diese Teilregime beinhalten dabei „charakteristische Komplexe von Funktionsregeln, die jeweils unhintergehbare Voraussetzungen für das Funktionieren einer Demokratie darstellen, letzteres aber auch nur im Set gewährleisten“ (Thiery 2002: 73f.; Hervorhebung im Original). Jedes Teilregime ist eingebettet in das Funktionsgeflecht des Gesamtregimes, so dass Thiery (2002; auch Croissant/Thiery 2000b) von einer eingebetteten Demokratie (embedded democracy) spricht. Ist ein Teilregime nicht wirksam, so hat dies dementsprechend eine Störung der Funktionslogik des Gesamtregimes zur Folge. Die Wirksamkeit der fünf Teilregime – (A) Wahlregime, (B) öffentliche Arena, (C) effektive Regierungsgewalt, (D) horizontale Verantwortlichkeit, (E) bürgerliche Freiheitsrechte – lässt sich anhand von Kriterien überprüfen (vgl. Abbildung 1). Ein solches Demokratiekonzept ist prozedural und nicht substanziell, da nur die „Spielregeln“ des Regimes (politische Normen, Verfahren und Institutionen), nicht aber inhaltliche Zielvorstellungen der politischen Herrschaft zur Grundlage gemacht werden.[21] Es dient dieser Arbeit als Grundlage zur Beschreibung einer funktionstüchtigen, liberal-rechtsstaatlichen Demokratie, da es die Interdependenz zwischen den verschiedenen Dimensionen erfasst.
Abbildung 1: Teilregime und Kriterien der embedded democracy
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Croissant/Thiery 2000a: 92; Thiery 2002: 74
2.3.1. Partizipation und politischer Wettbewerb
Freie und faire Wahlen[22] zeichnen unbestritten demokratische Regime aus. Durch die Rückbindung der politischen Entscheidungsträger an den souveränen demos werden erstere in einer Repräsentativverfassung überhaupt erst legitimiert, an Stelle des eigentlichen Souveräns politische Herrschaft auszuüben. So ist Dieter Nohlen zuzustimmen, dass es „ohne Wahlen, ohne den offenen Wettbewerb gesellschaftlicher Kräfte und politischer Gruppen um die politische Macht, keine Demokratie“ gibt (Nohlen 2000: 25). Im mehrdimensionalen Konzept der eingebetteten Demokratie gelten Wahlen, die eine Neubesetzung der Herrschaftspositionen aufgrund des Wahlakts ermöglichen, dementsprechend als definierendes, notwendiges Merkmal demokratischer Systeme. Damit Wahlen die genannte Legitimierungsfunktion voll erfüllen, müssen sie darüber hinaus einigen Ansprüchen genügen: Um die Präferenzen der BürgerInnen abzubilden, müssen sie erstens universell sein, d.h. dass kein Staatsbürger aufgrund seiner geschlechtlichen, ethnischen, sprachlichen, sozioökonomischen oder weltanschaulichen Eigenschaften vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen sein darf. Um den Erfordernissen des Freiheits- und Gleichheitspostulats der Demokratie gerecht zu werden, müssen sie darüber hinaus frei und fair sein. Dies impliziert, dass jede Stimme gleich gewichtet wird, die individuelle Wahlentscheidung keinerlei Zwang unterliegt und die Stimmen korrekt ausgezählt werden. Dem Konzept der embedded democracy folgend, ergeben sich hieraus die in Abbildung 1 dargestellten Kriterien (1) bis (4) eines funktionierenden Wahlregimes.
Darüber hinaus müssen Wahlen aber auch bedeutungsvoll sein (Hadenius 1992: 42-51; Rüb 2002). Erst mit der Garantie politischer Freiheiten, also der Meinungs-, Rede-, Presse- und Assoziationsfreiheit, die hier mit dem zweiten Teilregime der öffentlichen Arena erfasst werden, wird gewährleistet, dass politisch gleiche BürgerInnen ihre Präferenzen formulieren, im öffentlichen Raum artikulieren und sicher sein können, dass diese gleichermaßen gewichtet werden (Dahl 1971: 2). Diese politischen Kommunikations- und Organisationsrechte ermöglichen die Genese einer Zivilgesellschaft in der öffentlichen Sphäre. Sie ergänzen die „harte“ Kontrolle der Wahlen und Gewaltentrennung um die „weiche“ Kontrolle der Öffentlichkeit zwischen den Wahlen, in der sich der Prozess der politischen Willensbildung kontinuierlich entwickeln kann, zur Dimension der vertikalen Kontrolle der politischen Herrschaftsträger durch gesicherte Partizipationsrechte und politischen Wettbewerb (Thiery 2002: 76).
2. 3. 2. Effektives Herrschaftsmonopol
Das nächste Teilregime besteht aus der effektiven Gestaltungsmacht der gewählten Mandatsträger. Ihnen gegenüber dürfen Akteure oder Statusgruppen, die nicht demokratisch legitimiert sind und sich demzufolge nicht vor den Wählern verantworten müssen, keine Vetomacht in bestimmten Politikbereichen ausüben (Schmitter/Karl 1991: 81). In Lateinamerika betrifft diese Problematik insbesondere das Militär.[23] Es wurde argumentiert, dass die Herstellung der Suprematie von gewählten Mandatsträgern über das Militär nicht zu den konstituierenden Merkmalen einer Demokratie gehöre, sondern diese vielmehr erst in der weiteren Entwicklung der Demokratie als Ziel angestrebt werden könne, schon weil es die Stabilität eines demokratischen Regimes erhöhe (Lauga 2000; vgl. Lauga 1999: 226-229; Diamond/Plattner 1996). Dagegen bleibt einzuwenden, dass der Legitimationsfluss von Wahlen ins Leere läuft, wenn die Adressaten nicht identisch sind mit denjenigen Akteuren, die die politische Herrschaft tatsächlich ausüben.[24] Nur so sichert die effektive Regierungsgewalt demokratischer Mandatsträger die sinnvolle Legitimationsentfaltung von Partizipation und politischem Wettbewerb.
2. 3. 3. Zum Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
Die dritte und abschließende Dimension der Demokratie liegt im liberalen Rechts- und Verfassungsstaat. Über das Verhältnis von liberalem Rechtsstaat und Demokratie wurde viel diskutiert und gestritten (vgl. Habermas 1994, 1996; Dworkin 1995; Elster/Slagstad 1988; Becker et al. 2001), denn sowohl historisch als auch logisch lassen sich diese Prinzipien getrennt voneinander denken (Merkel 1999a: 368ff.). Zeichnet sich die Demokratie wesentlich durch das Mehrheitsprinzip aus, so zielt der Rechtsstaat
„auf Begrenzung und Bindung staatlicher Herrschaftsgewalt im Interesse der Sicherung individueller und gesellschaftlicher Freiheiten – vornehmlich durch die Anerkennung von Grundrechten, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte“ (Böckenförde 1992: 365).
Vergröbernd lassen sich in der Frage nach dem Verhältnis zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zwei Denkrichtungen unterscheiden. Die eine, „antinomische“ (Merkel/Croissant 2000: 13) Argumentation beruft sich vor allem auf Rousseau und betont das Spannungsverhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie erkennt in den rechtsstaatlichen und konstitutionellen Begrenzungen der Politik nur eine Begrenzung der Volkssouveränität. Dieses die Demokratie legitimierende Prinzip findet seinen Ausdruck in der Ausübung des volonté générale, der sich im Mehrheitswillen des demos gründet. Die Souveränität ist demnach unveräußerlich und unteilbar; künstlich erdachte Mechanismen, die diese Souveränität beschränken, sind daher illegitim.[25]
Demgegenüber steht die Auffassung, die eine Synthese von Liberalismus, Konstitutionalismus und Demokratie für notwendig hält. In der politischen Theorie geht diese Linie vor allem auf Locke, Montesquieu und die Verfasser der Federalist Papers zurück (vgl. Held 1996; Kap. 3). Grundlegend für den Liberalismus war theoriegeschichtlich die Vorstellung vorpolitischer Naturrechte, wie sie John Locke herausragend vertreten hat. Daraus ergeben sich individuelle Grundrechte, die staatlichen Eingriffen entzogen werden. Historisch geht damit die Abwehr absoluter Herrschergewalt einher. Der liberale Konstitutionalismus sann auf die Bewahrung erreichter Zustände, während die Demokratie unterprivilegierten Schichten über politische Teilhabe die Emanzipation versprach. Der bürgerliche Liberalismus konstituiert somit die Trennung von Öffentlichkeit und Privatsphäre. Für das demokratische Prinzip folgt daraus, dass die Volkssouveränität in einen konstitutionellen Rahmen eingebettet sein muss. Dieser Rahmen soll den Fortbestand der Demokratie garantieren sowie Minderheiten, und auch jeden Einzelnen, vor der sprichwörtlichen „Tyrannei der Mehrheit” (Tocqueville 1959: 289) schützen. Der liberale Rechts- und Verfassungsstaat wird als mit der Demokratie notwendig verknüpft verstanden, weil erst die Garantie der privaten Autonomie die legitimitätsstiftende Funktion der Demokratie ermöglicht (Habermas 1996; Dworkin 1995: 5).
Gegen die bindende Funktion einer Verfassung wurde eingewendet, es sei nicht legitim, zukünftige Generationen auf die Werte der Gegenwart zu verpflichten.[26] Jedoch muss dagegen angeführt werden, dass ein gewisses Set an bindenden Regeln notwendig ist, um zu garantieren, dass auch in Zukunft der demos souverän entscheiden kann – wenn auch nur im gewissen Rahmen. Die verfassungsmäßig gebundene Souveränität begnügt sich zwar freiwillig mit einer geringeren Reichweite der Entfaltungsmöglichkeiten und bleibt damit hinter einem absoluten Souveränitätsanspruch zurück. Andererseits schreibt sie sich in die Zukunft fort und erscheint damit um eine Dimension, nämlich die zeitliche, weiter gefaßt als der absolute Souveränitätsgedanke, der sich mit der Souveränität des Augenblicks begnügen muss.[27] Zudem ist der demos nicht statisch – er verändert seine Substanz ständig, Generationen wechseln einander ab. So können Verfassungsbestimmungen dazu beitragen, zukünftigen Bürgern die Rechte der politischen Selbstbestimmung zu sichern. „By means of a constitution, generation a can help generation c protect itself from being sold into slavery by generation b “ (Holmes 1988: 226). In diesem Sinne fungieren Verfassungen nicht so sehr als Kodifikation regulativer Regeln, die handlungsbeschränkend wirken, sondern als konstitutive Regeln, die erst zu gewissen Handlungen ermächtigen (ebd.: 227).
Im Konzept der embedded democracy schlägt sich der komplexe, aber eben komplementäre Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie in den Teilregimen D und E nieder. Der horizontalen Verantwortlichkeit liegt als Kriterium die institutionalisierte Kontrolle zwischen den drei Gewalten zugrunde. Die autonome Existenz von Legislative, Exekutive und Judikative sichert die Rechtmäßigkeit der politischen Herrschaft und verhindert in erster Linie die Gefahr eines Machtmißbrauchs seitens der Exekutive. Horizontal accountability beruht dabei auf
„the existence of state agencies that are legally empowered – and factually willing and able – to take actions ranging from routine oversight to criminal sanctions or impeachment in relation to possibly unlawful actions or omissions by other agents or agencies of the state“ (O’Donnell 1998: 117).
Nur mit der Existenz dieser Dimension wird sichergestellt, dass auch zwischen den Wahlen eine effektive, „harte“ Kontrolle der Herrschaftsträger möglich ist (vgl. Beetham 1994: 29). Ist die horizontale Verantwortlichkeit in der modernen, repräsentativen Demokratie absent, kann eine durchgehende Kontrolle über die Regierenden nur ungenügend ausgeübt werden, da ein solches „Monitoring“ der Herrschaftsausübenden mit sehr hohen Kosten für die Informationsbeschaffung verbunden ist (Ferejohn 1999) und kaum Sanktionsmöglichkeiten bereithält. Das souveräne Volk droht in diesem Fall, nur am Wahltag souverän und frei zu sein.
Schließlich bilden die bürgerlichen Freiheitsrechte das Teilregime E. Es umfaßt die klassisch Abwehr- und Schutzrechte des Individuums vor dem Träger politischer Herrschaft, also die negativen Freiheitsrechte (Berlin 1969: 122ff.). Erst wenn bestimmte Materien – wie die Garantie der Grundrechte – demokratischen Mehrheitsentscheidungen entzogen werden, wird der Staatsbürgerstatus überhaupt sinnvoll konstituiert. Die Beteiligung an Wahlen ohne wenigstens die Garantie, dass die physische und psychische Integrität des Individuums oder die Gleichbehandlung von Gruppen auch nach dem Wahlausgang nicht durch die politische Herrschaftsausübung in Frage gestellt wird, wird zur Schimäre. Diese Freiheitsrechte müssen auch gegenüber Dritten, also privaten Akteuren, vom Staat gewährleistet werden (Diamond 1999: 12). Weil die Demokratie auf der gegenseitigen Anerkennung der Rechtsgenossen als Gleiche beruht, muss der demokratische Rechtsstaat auch die Gleichbehandlung der BürgerInnen vor dem Gesetz garantieren, die das zehnte und letzte Kriterium des Demokratiekonzepts bildet. Wesentlich ist dabei, dass kein spezifisches Bevölkerungssegment diskriminiert wird. Funktioniert der Staatsapparat nicht nach den legal gesatzten Normen, sondern verfestigt durch die Zuweisung von Autoritätsrollen nur die privaten Machtasymmetrien, so werden die formal garantierten Rechte der Bürger hohl. Machtlosen, zumeist armen Bevölkerungsgruppen kommt dann nur eine „ low intensity citizenship “ (O’Donnell 1993) zu. Für sie drohen die demokratischen herbeigeführten Rechtssetzungen bedeutungslos zu werden.
Diesen Überlegungen folgend, lässt sich die rechtsstaatlich-liberale Demokratie definieren als politische Herrschaftsform, in der alles geltende Recht mittelbar oder unmittelbar aus dem Willen des souveränen Volkes entspringt, und zugleich die Autonomie des Einzelnen gewährleistet wird. Um dies zu garantieren, müssen verschiedene Mechanismen institutionalisiert sein, wie sie mit den vorgeschlagenen Teilregimen erfasst werden können. Die Herrschaftsträger müssen aus periodisch abgehaltenen, freien, fairen, allgemeinen und kompetitiven Wahlen hervorgehen, die kollektiv verbindliche Entscheidungen im Einklang mit den rechtlich kodifizierten Verfahren getroffen werden und für alle BürgerInnen gleichermaßen gelten. Unter keinen Umständen dürfen sie die private und öffentliche Autonomie des Einzelnen verletzen. Politische Amtsinhaber unterliegen bei ihrer Herrschaftsausübung der Kontrolle durch Gewaltentrennung und öffentliche Meinung. Zugleich existiert keine andere Quelle legitim gesetzten Rechts, das Herrschaftsmonopol liegt gänzlich bei den gewählten Mandatsträgern. Diesen idealtypisch konstruierten Anforderungen entsprechen existierende liberale Demokratien in hohem Maße, nicht aber „defekte“ Demokratien.
2.4 Defekte Demokratien
Anhand des entwickelten Modells der embedded democracy lassen sich Grauzonenregime präzise fassen. Es dient als root concept in der oben skizzierten Strategie der Bildung unvollständiger Subtypen. Voll ausgebildete, liberal-rechtsstaatlich verfasste Demokratien bestehen nur, wenn alle Teilregime die institutionellen Minima erfüllen. Sind eines oder mehrere der Teilregime nicht voll wirksam, gilt das gesamte Regime als defekte Demokratie.[28] Der Konzeptbildung verminderter Subtypen entsprechend, gelten auch defekte Demokratien noch als Demokratien – jedoch als Demokratien, deren Funktionslogik zur Regelung der als legitim anerkannten politischen Herrschaftsausübung nur eingeschränkt entfaltet ist. Diese der Demokratie inhärente Logik ist dann in einigen Teilregimen in bedeutsamer Weise wirksam. Doch andere Teilbereiche folgen Mustern, die den demokratischen Funktionsprinzipien der Freiheit, Gleichheit und Kontrolle entgegenlaufen (Croissant/Thiery 2000b: 24). Ein Kernbestand an demokratischen Institutionen muss allerdings existieren, damit „Scheindemokratien“ (Linz 2000: XXXIX), also autoritäre Regime, die ihre Herrschaft mit einer demokratischen Fassade schmücken, nicht als (defekte) Demokratien klassifiziert werden.[29] Hierzu werden „definierende“ von „zentralen“ Merkmalen unterschieden (Merkel/Croissant 2000: 7). Definierende Merkmale müssen notwendig vorhanden sein, damit ein Regime als demokratisch qualifiziert werden kann – sie sind aber nicht hinreichend. Bei zentralen Merkmalen handelt es sich um „konnotativ wichtige (aber nicht ausschließende) sowie begleitende (aber nicht notwendige) Eigenschaften“ (ebd.), die aber – gemäß der Logik des Konzepts der embedded democracy im Unterschied zu Annahmen der klassischen Subtypenbildung – im Funktionsgeflecht demokratischer Regime die Wirkungsweise der definierenden Eigenschaften beeinflussen. Im Konzept der embedded democracy nimmt das funktionierende Wahlregime die herausragende Stellung eines definierenden Merkmals ein. Folglich können defekte Demokratien definiert werden als
„Herrschaftssysteme, die sich durch das Vorhandensein eines bedeutsamen und wirkungsvollen Wahlregimes zur Regelung des Herrschaftszugangs auszeichnen, aber durch Störungen in der Funktionslogik der übrigen Teilregime die komplementären Stützen verlieren, die in einer funktionierenden Demokratie zur notwendigen Sicherung von Freiheit, Gleichheit und Kontrolle notwendig sind.“ (Thiery 2002: 80)
Ein bedeutsames und wirkungsvolles Wahlregime liegt in der Regel nur vor, wenn alle vier Kriterien – allgemeines aktives (1) und passives (2) Wahlrecht, (3) freie und faire Wahlen und (4) gewählte Mandatsträger – erfüllt werden. Jedoch gibt es Konstellationen, in denen eines dieser Kriterien verletzt wird und trotzdem ein bedeutsames Wahlregime vorliegt. Diese Einschränkung gilt nur, wenn zwei weitere Bedingungen erfüllt werden. Erstens müssen Wahlen, um bedeutsam zu sein, die Abwahl der Herrschaftsträger ermöglichen. Ist das Wahlregime so sehr beschädigt, dass eine bestimmte Gruppe ihre Herrschaftspositionen derart befestigen kann, dass sie auch durch Wahlen nicht essentiell verändert werden können, so ist das betreffende Gesamtregime autokratisch. Zweitens muss ein defektes Wahlregime in uneingeschränkt funktionierende Teilregime eingebettet sein, damit „die auf Exklusion beruhenden Herrschaftsmandate keine selbstreferentiellen Machtkreisläufe generieren können“ (Thiery 2002: 80) und die Herrschaftspraxis wirksame demokratische und rechtsstaatliche Grenzen beachten muss.[30]
Sind zentrale Merkmale nicht oder nur eingeschränkt gegeben, und bilden sich in einzelnen Teilregimen „je spezifische Verzerrungen demokratischer Machtkreisläufe“ (ebd.) aus, so liegt eine defekte Demokratie vor. Ein Gesamtregime lässt sich demnach als defekte Demokratie klassifizieren und von einer „funktionierenden“ Demokratie (Lauth 1997) unterscheiden, wenn bereits in einem Teilregime signifikante Defekte festgestellt werden können. Dabei darf nicht übersehen werden, dass der Befund, „signifikante Defekte“ lägen in einem bestimmten Regime vor, keineswegs immer eindeutig ist. Der Maßstab für die Kriterienerfüllung kann insbesondere durch einen kulturellen Bias an Konsistenz zu Wünschen übrig lassen.[31] Dieser Gefahr entgeht allerdings kaum ein Klassifizierungsversuch, der einigermaßen komplex verfährt. Ein Gegenmittel kann im intersubjektiven Austausch über die angewandten Maßstäbe liegen.
Eine Schwäche des Konzepts stellt die Ausblendung des gesellschaftlichen Kontextes dar. Es orientiert sich gänzlich an der Struktur der politischen Herrschaftsverhältnisse, während gesellschaftliche Machtverhältnisse nur dann berücksichtigt werden, wenn sie die Funktionslogik eines Teilregimes beeinträchtigen. Die unterschiedlichen Wirkungen, die dieselben Defektsyndrome in Abhängigkeit von den konkreten gesellschaftlichen Machtverhältnissen entfalten, geraten dadurch nicht ins Blickfeld. In einer weit gehend autonom organisierten, pluralistischen Zivilgesellschaft, die vom Staat nur wenig durchdrungen ist, können Verstöße gegen die institutionalisierten Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Kontrolle seitens des politischen Regimes weniger bedenklich wirken als in stark hierarchisch geordneten Gesellschaften.[32] Ebenso wirkt sich die fehlende horizontale Kontrolle der Regierung unterschiedlich stark aus. Abhängig von seiner Position gegenüber gesellschaftlichen Machtgruppen und der Stärke der eigenen Anhängerschaft, kann ein Regierungschef die institutionell kaum kontrollierte Gestaltungsmacht in unterschiedlich hohem Maße ausnutzen.
An den letzten Punkt schließt sich eine „Blindstelle“ des Konzepts an, die die Betrachtung des venezolanischen Falls offenbart: die interne Struktur der Parteien. Wie das folgende Kapitel aufzeigt, hat die Organisationsstruktur insbesondere der Regierungsparteien nicht nur erheblichen Einfluss auf die Wirksamkeit der Defektsyndrome, sondern kann darüber hinaus eine eigene Defektlogik ausbilden. Denn in Falle eines ausgeprägten Parteienstaats, in dem sämtliche Mandate nur durch Parteimitgliedschaft errungen werden können, ist der interne Aufbau der Parteien von erheblicher Relevanz für die demokratische Qualität des Gesamtregimes.
Nichtsdestotrotz bietet das Konzept der „defekten Demokratie“ ein starkes Instrument zur Klassifizierung politischer Systeme. Die vorgebrachte Kritik soll der Weiterentwicklung durch Hinweise auf konzeptionelle Schwächen dienen, wie sie der empirische Teil demonstriert.
2.4.1 Typologie defekter Demokratien
Zur präzisen Bestimmung der verschiedenen Regime in der Grauzone zwischen funktionierender Demokratie und autoritärem Regime lässt sich analog zum Demokratiebegriff eine Typologie defekter Demokratien entwickeln, die die Binnendifferenzierung solcher Systeme ermöglicht (Merkel/Croissant 2000: 8). Sie orientiert sich „im Sinne der Ordnungsfunktion von Typen nicht an Einzeldefekten, sondern an beschädigten Funktionslogiken“ (Thiery 2002: 83). Somit fungieren die verformten Teilregime und die dahinter liegenden Dimensionen der Demokratie als Ausgangspunkt der Subtypenbildung. Je nachdem, welche Dimension – Partizipation und Wettbewerb, Agendakontrolle oder liberaler Rechts- und Verfassungsstaat – verletzt wird, lassen sich drei Typen defekter Demokratien feststellen (vgl. Abb. 2): (1) exklusive Demokratien, (2) Enklavendemokratien und (3) illiberale Demokratien, wobei letztere zwei unterschiedliche Varianten ausbilden kann.[33]
Ist die vertikale Legitimationsdimension – institutionalisiert in einem funktionierendem Wahlregime und einer öffentlichen Arena, welche die Rechte der Kommunikation und Organisation garantiert – signifikant beschädigt, liegt eine exklusive Demokratie vor. Dieser Typus der defekten Demokratie ist also einerseits gekennzeichnet durch den Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen von den Wahlen – gleich ob de jure oder de facto – oder durch die (leichte) Störung des Postulats freier und fairer Wahlen. Eine zweite Möglichkeit liegt in der Missachtung der Organisations- und Kommunikationsrechte. Da hier die freie politische Meinungs- und Willensbildung zugunsten bestimmter Präferenzen verzerrt wird, wirkt eine solche Verletzung ebenfalls exklusiv.
Politische Herrschaft wird in rechtsstaatlichen Demokratien ausschließlich von den über die demokratischen Verfahren dazu bestellten Repräsentanten ausgeübt. Wird dieses effektive Herrschaftsmonopol durch Vetomächte wie Militärs, Guerillagruppen, Clans, Unternehmer oder auch Großgrundbesitzer beeinträchtigt, indem diese bestimmte politischen Domänen dem Zugriff demokratisch legitimierter Akteure entziehen, ist die Machtkontrolle eigentümlich verzerrt. Solche Fälle bilden den Typ der Enklavendemokratie.
Beim dritten Typ defekter Demokratien, den illiberalen Demokratien, lassen sich zwei Varianten unterscheiden, abhängig vom Teilregime, dessen Funktionslogik betroffen ist. In der einen, der delegativen Variante, ist die horizontale Gewaltenkontrolle nicht ausreichend gewährleistet, so dass die Balance insbesondere zwischen Exekutive und Legislative auf der einen, und Judikative auf der anderen Seite ausgehebelt wird. Empirisch zeigt sich dies oftmals an Regierungen, die ihre konstitutionell geregelten Kompetenzgrenzen überschreiten und mit dieser Aneignung einer großen Machtfülle die Spielregeln der rechtsstaatlichen Demokratie missachten.[34] Die zweite Variante – die illiberale Demokratie im engeren Sinne – ist geradezu anti-liberal, weil in ihrem Fall das Teilregime der bürgerlichen Freiheitsrechte, also die private Autonomie der Individuen nicht hinreichend geschützt wird oder werden kann. Unterminiert die erste Variante vor allem die institutionellen Garantien zur Bestandssicherung der Demokratie, so beschädigt die zweite das Prinzip der Staatsbürgerschaft und damit die eigentliche Basis liberalen Denkens. Denn die Idee individueller Selbstbestimmung bildet nach liberalem Verständnis die Grundlage für die politische Selbstbestimmung in der Demokratie.
Tabelle 2: Typologie defekter Demokratien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anmerkung: in Anlehnung an Croissant/Thiery 2000a: 102
(a) delegative Variante; (b) anti-liberale Variante
Diese Typologie bestimmt idealtypische Formen defekter Demokratien. Da in der empirisch bestimmten Wirklichkeit oftmals Mischformen mit verschieden stark ausgeprägten Defekten in einzelnen Teilregimen auftreten, orientiert sich die klassifikatorische Zuordnung an demjenigen Defekt, der der Funktionslogik rechtsstaatlicher Demokratien am schwerwiegendsten zuwiderläuft. Der Zusammenhang zwischen Demokratiedimension, beschädigtem Teilregime, anzutreffenden Defekten und Typus defekter Demokratien ist in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt.
2.4.2 Defekte Demokratien in Abgrenzung zu autoritären Regimen
Bisher beschäftigte sich die Arbeit in erster Linie mit der Darlegung des umfassenden Demokratiekonzepts der embedded democracy und den Möglichkeiten, vom Idealtyp abweichende Regime zu erfassen. Dem lag die Prämisse zugrunde, dass Regime existieren, die zwar nicht in toto der Funktionslogik rechtsstaatlicher Demokratien folgen, die aber nichtsdestotrotz als Demokratien – und eben nicht als Autokratien – gelten müssen. Wie lässt sich die Grenze zwischen demokratischen und autoritären Systemen präzise bestimmen? Dieser Frage wird hier nachgegangen. Die Trennung der beiden Regimetypen muss hinreichend geklärt werden, bevor im nächsten Kapitel zur Untersuchung des politischen Systems Venezuelas übergegangen wird.
Ein intaktes Wahlregime gilt – wie oben dargelegt – in der Regel als conditio sine qua non demokratischer Systeme. Dieses Kriterium jedoch als hinreichend anzusehen, hieße, für „gewählte autoritäre Regime“ (Linz 2000: XXXIX) blind zu sein und der „ electoral fallacy “ (Linz/Stepan 1996a: 4) anheimzufallen. Juan Linz hat demgegenüber autoritäre Regime anhand dreier Dimensionen definiert:[35] (1) begrenztem Pluralismus, (2) begrenzter Mobilisierung der Bevölkerung und (3) Legitimation durch Mentalitäten (Linz 1996), wobei ihm eingeschränkter Pluralismus als zentrales Abgrenzungsmerkmal gegenüber Demokratien und totalitären Regimen galt. Sein Ansatz lieferte jedoch keine Kriterien zur Präzisierung der einzelnen Dimensionen und die von ihm vorgelegte Subtypenbestimmung autoritärer Regime ist wenig stringent (Merkel 1999b: 36f.). Einen Vorschlag zur systematischen Abgrenzung von demokratischen sowie autoritären und totalitären Systemen hat Wolfgang Merkel vorgelegt. Dieser orientiert sich an verschiedenen Kriterien politischer Herrschaft,[36] die sich an das Konzept der embedded democracy anschließen lassen.[37] Wie bereits angedeutet, muss zunächst notwendig ein bedeutsames Wahlregime gegeben sein, um von einer Demokratie zu sprechen. Wird der Zugang zu Herrschaftspositionen signifikant durch Selbstrekrutierung oder Kooptation geregelt, liegt mit anderen Worten ein autoritäres Regime vor. Darüber hinaus liegt auch dann ein autokratisches Regime vor, wenn ein Teilregime so sehr beschädigt ist, dass es der demokratischen Funktionslogik diametral entgegen steht.
Eine plurale öffentliche Arena ermöglicht in der Demokratie die freie politische Präferenzbildung und die „weiche“ Herrschaftskontrolle durch die öffentliche Meinung. Werden Parteien, die sich zu den demokratischen Regeln bekennen, verboten oder anderweitig ausgeschlossen oder die Meinungs- und Pressefreiheit so weit eingeschränkt, dass ausschließlich die Herrschaftsträger das Agendasetting bestimmen können, ist das Gesamtregime nicht mehr demokratisch. Beim effektiven Herrschaftsmonopol ist die Schwelle zu autoritären Regimen überschritten, sobald einzelne Politikmaterien – nicht zu sprechen von der prinzipiellen Revozierbarkeit aller politischen Entscheidungen – nicht in demokratischen Verfahren geregelt werden.[38] Das Teilregime der horizontalen Verantwortlichkeit ist vollkommen außer Kraft gesetzt, wenn sich eine Gewalt die Kompetenzen der anderen auf Dauer aneignet und solchermaßen die Herrschaft einzig hierarchisch strukturiert. Besonderes Augenmerk muss hierbei der Ausschaltung einer unabhängigen Justiz durch die Exekutive zuteil werden. Dominiert die Exekutive als einziger Machtträger den politischen Prozess und die politische Willensbildung, wird die Logik der repräsentativen Demokratie außer Kraft gesetzt, da der Staatswille – eventuell ausgegeben als Volkswille, aber keiner schnell wirksamen Kontrolle unterworfen – der Gesellschaft oktroyiert wird, anstatt aus ihr hervorzugehen.[39] Schließlich muss der Herrschaftsanspruch auch durch Wahlen legitimierter Träger der politischen Herrschaft in einer Demokratie die Grenzen der bürgerlichen Freiheitsrechte anerkennen, da private und öffentliche Autonomie sich gegenseitig bedingen (Habermas 1996: 298). Der Übergang zur Autokratie ist vollzogen, falls politische Herrschaft zur Diskriminierung von Bevölkerungsteilen ausgeübt wird.
Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich durch die Mehrdimensionalität des zugrunde liegenden Demokratiekonzepts. Da von einem Funktionszusammenhang zwischen den einzelnen Teilregimen ausgegangen wird, müssen Defekte aus diversen Teilregimen daraufhin geprüft werden, ob sie sich gegenseitig verstärken oder einzelne Defekte durch andere Teilregime kompensiert werden können (Croissant/Thiery 2000a: 98). Eine solche Kumulation verschiedener Defekte ist in der Realität wahrscheinlich häufiger anzutreffen als die völlige Aushöhlung eines einzigen Teilregimes. In solchen Fällen muss darauf rekurriert werden, inwieweit solche autoritären Syndrome den Herrschaftszugang – also das definierende Merkmal der embedded democracy – schließen (ebd.).
Mit der Darlegung des Konzepts der defekten Demokratie ist die Abgrenzung zum Basiskonzept der embedded democracy als funktionstüchtige rechtsstaatliche Demokratie einerseits, zu autoritären Systemen andererseits präzise bestimmt worden. Am Fall Venezuela soll im folgenden gezeigt werden, dass das Konzept zur Klassifizierung politischer Systeme geeignet und anwendbar ist. Die Frage nach den Entstehungszusammenhängen defekter Demokratien wird im vierten Kapitel behandelt.
3. Venezuelas defekte Demokratie
Im vorigen Kapitel wurde ausgeführt, dass die intensive politikwissenschaftliche Beschäftigung mit Grauzonenregimen erst mit der „Dritten Welle der Demokratisierung“ einsetzte. Der Impetus bestand in dem empirisch nicht mehr zu übersehenden Phänomen von politischen Systemen, deren einsetzende Transition vom autoritären Regime nicht zur konsolidierten rechtsstaatlichen Demokratie führte, sondern dauerhaft in einem „Dazwischen“ steckenblieben, dessen Gestalt mit den vorhandenen Kategorien nicht präzise erfasst werden konnte. Es handelte sich dabei um Regime, die den Transitionspfad der Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung nicht bis zum Ende folgten – in der Terminologie von O’Donnell und Schmitter (1986: 9) tauchten solche Fälle als dictablandas (liberalisierter Autoritarismus) und democraduras (limitierte Demokratien) auf. Vom normativen Standpunkt aus, wurden diese politischen Systeme als Fälle betrachtet, die eine eingeschlagene positive Entwicklung frühzeitig abgebrochen haben. Nicht so Venezuela. Denn im Gegensatz zur Mehrzahl der Grauzonenregime, lässt sich im Fall Venezuelas ein Regress konstatieren: Von einer Demokratie, die vielen Beobachtern seit der Transition 1958 ob der Stabilität, aber auch der rechtsstaatlichen Verfasstheit lange Zeit als vorbildlich in Lateinamerika galt, entwickelte es sich bis Ende der Neunziger Jahre zu einem Regime, in dem noch immer regelmäßig Wahlen abgehalten werden, deren rechtsstaatlicher Charakter jedoch in hohem Maße durch eine übermächtige Exekutive ausgehöhlt wurde. Dieses Kapitel rekurriert auf das vorige, indem gezeigt wird, dass das politische System Venezuelas als defekte Demokratie zu begreifen ist. Mit der Darstellung der regressiven Entwicklung und der ausgeprägten Defektsymptome wird hier der Grundstein für die Ursachenanalyse gelegt, die im folgenden Kapitel vorgenommen wird.
3.1 Die Phase der exklusiven Demokratie von 1958-1988
Mit der Transition zur Demokratie im Jahr 1958 gehört Venezuela zu den Demokratien der Zweiten Welle. Die Bestellung der politischen Herrschaftsträger fand seitdem in regelmäßig abgehaltenen, kompetitiven, allgemeinen sowie relativ freien und fairen Wahlen statt. Zieht man die hohe politische Instabilität und häufigen Regimewechsel in Betracht, die die jüngste Geschichte praktisch aller Staaten Lateinamerikas prägten, so sticht Venezuela wegen der Dauerhaftigkeit seines demokratischen Regimes deutlich hervor.[40] Diese ungewöhnliche Stabilität basierte auf zwei Faktoren: Politisch-institutionell war die venezolanische Demokratie nach 1958 stark von einer konsensorientierten Entscheidungsfindung der Eliten geprägt, wie sie in verschiedenen Pakten explizit formuliert wurde und sich in einem kontrollierenden Parteienstaat manifestierte. Sozioökonomisch trug der Ölreichtum Venezuelas zur Stabilisierung bei, aus dessen Profit der Staat die notwendigen Mittel zur Konfliktschlichtung und -vermeidung extrahierte (Karl 1986). Die Stabilität wurde allerdings durch die Erschaffung eines exklusiven Demokratietyps gewährleistet.
[...]
[1] Die Ereignisse vom April dieses Jahres, in denen zunächst Massendemonstrationen für und gegen das Regime blutig verliefen und sich für wenige Stunden eine Übergangsregierung an die Macht putschte, bleiben damit außen vor. Aufgrund des geringen zeitlichen Abstands lässt sich nicht entscheiden, ob sich das Regime dadurch nachhaltig veränderte.
[2] Die Regierungsform (forma regiminis), in der die Gewalten geteilt sind, die Gesetzgebung durch repräsentative Organe erfolgt und das Gesetz herrscht, nennt Kant „Republik“ (Kant 1979 [1795]: 27f.), was nach heutigem Verständnis als repräsentative Demokratie bezeichnet wird.
[3] Die Kausalität verläuft dabei wechselseitig: Nicht nur variieren die Werturteile so stark, weil der Demokratiebegriff nicht eindeutig ist. Die maßgebliche Einigung auf eine einheitliche Definition fällt in der Wissenschaft auch deshalb so schwer, weil die Zuschreibung „demokratisch“ auf ein bestimmtes Objekt so starke normative Konnotationen beinhaltet.
[4] Bekanntlich klassifiziert Aristoteles die Staatsformen nicht nur nach dem Kriterium der Anzahl der Herrschaftsausübenden, sondern auch nach der Richtung der Herrschaft, ob diese dem Gemeinwohl oder dem egoistischen Interesse der Herrschenden diene. Daher ergibt sich für jede Verfassungsform eine korrespondierende „Entartung“. Hierzu zählt Aristoteles auch die Demokratie, in der die Vielen, die empirisch gleichbedeutend mit den Armen seien, nur zu ihrem eigenen Nutzen herrschen würden.
[5] Keinesfalls soll damit eine klare, naturgesetzmäßige Kausalität behauptet werden – die Ausweitung des Wahlrechts musste in politischen Auseinandersetzungen erst erkämpft werden. Doch mit der Durchsetzung der Idee einer universell gültigen Menschengleichheit, ließ sich die Exklusion erwachsener StaatsbürgerInnen vom politischen Prozess immer weniger begründen.
[6] Das teilweise schwierige Verhältnis dieser Prinzipien zueinander – viele Entwürfe der politischen Philosophie sind davon geprägt, den Primat insbesondere der Freiheit über die Gleichheit oder vice versa zu begründen – kann an dieser Stelle nicht näher herausgearbeitet werden (vgl. dazu u.a. Held 1996; Sartori 1997; Schmidt 2000).
[7] Diese beginnt nach Huntington mit dem einsetzenden Systemwechsel in Portugal, genauer am 25. April 1974 (1991: 3).
[8] Wobei auch Fukuyama einräumt, dass nun nicht kein Staat umhin könne, sich liberal-demokratische Institutionen anzueignen; jedoch hält er „das Ideal der liberalen Demokratie” für „nicht verbesserungsbedürftig” (Fukuyama 1992: 11).
[9] Bei Schumpeter heißt es, „die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben.“ (1993 [1942]: 428).
[10] Seit knapp drei Dekaden erstellt Freedom House einen „Freiheitsindex“ für alle souveränen Staaten. Durch Experteneinschätzungen werden auf einer Skala von 1 bis 7 jeweils die Dimension der politischen Rechte (political rights) sowie der Bürgerrechte (civil liberties) gemessen. Die beiden Indizes ergeben in der Summe einen Indikator für das Niveau eines liberaldemokratischen Verfassungsstaat. Freedom House klassifiziert anhand dieser Indizes die Staaten in drei Kategorien: „free“, „partly free“ und „not free“. Nur Politische Regime, die sowohl freie und faire Wahlen abhalten als auch mit free bewertet werden, qualifizieren sich hiernach als liberal democracy. Siehe zur Vorgehensweise die Website des Instituts unter www.freedomhouse.org und Karatnycky 1999.
[11] Autoritäre und totalitäre Regime werden auch als Autokratien zusammengefasst, die von Demokratien dichotomisch unterschieden werden.
[12] In dieser Arbeit werden die Begriffe politisches System und politisches Regime synonym benutzt. Der Systembegriff bezeichnet in der Politikwissenschaft die Strukturen und Interaktionen, durch die kollektive verbindliche Entscheidungen herbeigeführt werden. Die interdependenten Strukturen werden als Elemente eines sozialen Systems aufgefaßt, das in Abgrenzung zu anderen gesellschaftlichen Systemen die Funktion erfüllt, gesamtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen über die Allokation von Werten, die Ziele und die Selbstorganisation zu treffen. Ebenso wie der Regimebegriff, der die Herrschaftsordnung eines Staates beschreibt, bezeichnen politische Systeme Formen der Verarbeitungsprozesse gesellschaftlicher Konflikte, die als demokratisch oder autokratisch qualifiziert werden können.
[13] Im Unterschied zu Wahlen in demokratischen Regimen, seien die Wahlen allerdings nicht „bedeutsam“, da der öffentliche Meinungsbildungsprozess zuvor nur allenfalls eingeschränkt gegeben sei (Rüb 2002: 107)
[14] Hier entwickelt auch Rübs Typologie nur vermeintlich klare Grenzen zwischen den verschiedenen Regimetypen. Es sind ja auch andere „Rekombinationen zentraler Merkmale“ von demokratischen und autoritären Regimen denkbar als die von Rüb ausgeführten, wie beispielsweise autoritäre Rechtsstaaten wie ihn das deutsche Kaiserreich von 1871 verkörperte.
[15] Hinsichtlich der Bildung von Subtypen autoritärer Regime, wie Juan Linz sie jüngst vorgeschlagen hat (2000), ist dem Einwand von Aurel Croissant und Peter Thiery zuzustimmen (2000b: 18), dass sich Robert Dahls Polyarchiekonzept als Bezugspunkt der vergleichenden Regimeforschung zur Abgrenzung gegenüber Autokratien bewährt hat. Da viele Grauzonenregime Wahlen abhalten, sollte von einer pauschalen Zuordnung zu autoritären Regimen abgesehen werden.
[16] Politische Herrschaft meint hier die Setzung und Durchsetzung kollektiv verbindlicher Entscheidungen. Dazu wird in der Moderne die Existenz eines Staates als „diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebiets […] das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht“ (Weber 1972: 822), also ein Sanktionsapparat, der Gehorsam für die politische Herrschaft erzwingen kann, vorausgesetzt.
[17] Um den normativen Implikationen des Terminus „Demokratie” zu entkommen, reserviert Dahl ihn für einen Idealtyp von Demokratie. In der Realität vorkommende Regime seien demgegenüber bestenfalls „Polyarchien” (Dahl 1971: 8).
[18] Diese acht Kriterien sind: 1. Organisationsfreiheit; 2. Meinungsfreiheit; 3. aktives Wahlrecht; 4. passives Wahlrecht; 5. Recht der politischen Elite, um Wählerstimmen/Unterstützung zu konkurrieren; 6. alternative Informationsquellen; 7. freie und faire Wahlen und 8. Institutionen, die die Regierungspolitik von den Wählerstimmen und anderen Formen der Äußerungen der Präferenzen der Bürger abhängig machen (Dahl 1971: 3). In einer späteren Fassung seines Polyarchiekonzepts fällt dieses letzte Kriterium allerdings ersatzlos weg (Dahl 1989: 221).
[19] Jüngst wurde diesem Umstand in verschiedenen Artikeln des Journal of Democracy Rechnung getragen, die sich dem Phänomen des „Elections Without Democracy“ widmen (Diamond 2002; Schedler 2002; Levitsky/Way 2002). Vgl. dagegen Przeworskis griffige Bestimmung der Demokratie als „system in which parties lose elections“ und als „system of ruled open-endedness, or organized uncertainty“ (1991: 10 u. 13). Im Lichte des neueren empirischen Befunds, dass eben viele politische Regime Wahlen abhalten, aber dennoch keine rechtsstaatliche Demokratie hervorbringen, scheint Przeworskis Annahme, dass politischer Wettbewerb als hinreichendes Kriterium der Demokratie ausreiche, da die vollständige Etablierung politischer Freiheitsrechte dann schon folgen werde (ebd.: 10, Fn. 2), allzu optimistisch.
[20] Hans-Joachim Lauth (1997) entwickelt ebenfalls ein dreidimensionales Demokratiekonzept, wobei diese sich aber inhaltlich von den Merkelschen Dimensionen unterscheiden. Er differenziert den Aspekt der Partizipation in Freiheit und Gleichheit aus, und stellt ihnen die Dimension der Kontrolle beiseite, die sowohl das effektive Herrschaftsmonopol als auch die Rechtsstaatlichkeit umfaßt. Damit wird zwar einerseits der Partizipationsbegriff prima vista inhaltlich präzisiert, analytisch jedoch nichts gewonnen, da Lauth selbst, unter Hinweis auf die große Divergenz bei der Definition des Gleichheitsbegriffs, diesen nicht näher bestimmt (1997: 37). Andererseits strapaziert er gerade im Hinblick auf defekte Demokratien seine Kontrolldimension über. Wenn sowohl effektive Regierungsgewalt als auch Rechtsstaatlichkeit in einer gemeinsamen Dimension zusammengefaßt werden, ist ein solches Demokratiekonzept zu unsensibel. So unterschiedliche Phänomene wie Chile, wo sich das Militär in einigen wesentlichen Bereichen der demokratischen Regierung entziehen kann, die Slowakei in der Ära Meciar und eben auch Venezuela, in der die Exekutive rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, werden dann analytisch unter demselben Gesichtspunkt behandelt.
[21] In der Terminologie Martín Laugas handelt es sich um einen konkret-prozessualen, multidimensionalen Demokratiebegriff (Lauga 1999: 173-204).
[22] Zur Bestimmung freier und fairer Wahlen, siehe Elklit 1999, besonders die Übersicht auf S. 36.
[23] Beispielhaft ist hier der Fall Chile, in dem die Verfassung dem Militär auch nach dem Ende des autoritären Regimes unter General Pinochet erhebliche Prärogativen einräumt (Linz/Stepan 1996b). Wie im dritten und fünften Kapitel ausgeführt wird, drohen die Streitkräfte in jüngster Zeit auch in Venezuela gegen demokratisch legitimierte Mandatsträger aktiv zu werden.
[24] Zu trennen sind solche Politikdomänen nicht legitimierter Akteure allerdings von politischen Materien, die durch einen Verfassungskonsens der Verfügungsgewalt demokratischer Mehrheitsentscheidungen entzogen wurden, um beispielsweise Zentralbanken Handlungsautonomie gegenüber den Regierungen zu gewähren (Thiery 2002: 76, Fn. 4).
[25] „[E]s ist nämlich unsinnig, daß sich der Wille Ketten anlegt für die Zukunft.“ (Rousseau 1986 [1762]: 28)
[26] Dieser Einwand kam in der US-amerikanischen Verfassungsdiskussion von Paine und Jefferson, wurde aber auch zuvor von Hume und Locke formuliert, und schlug sich in der französischen Verfassung von 1793 nieder; vgl. Holmes 1988.
[27] In diese Richtung zielt auch John Stuart Mills Argument, wenn er den freiwilligen Verkauf eines Freien in die Sklaverei verbietet. Mit diesem letzten Akt der Souveränität vernichte dieser nämlich gleichzeitig die Grundlage der Freiheit (Mill 1985 [1859]: 173; vgl. auch die Nachzeichnung bei Merkel 1999a: 371f.).
[28] Gegen die Bezeichnung defekte Demokratien wurde eingewendet, sie impliziere die Existenz perfekter Demokratien (von Beyme 1999a: 303). Terminologisch ist das Gegenstück zur defekten Demokratie mit der funktionierenden Demokratie (Lauth 1997) gegeben, konzeptionell ist der Ausgangspunkt die rechtsstaatliche Demokratie (Merkel/Croissant 2000: 8). Das ändert jedoch nichts an den abwertenden Konnotationen, die mehrmals beklagt wurden, weil sie tendenziell ein beschönigendes Bild demokratischer Regime in den westlichen Industrieländern zeichneten und wenig Raum für die angemessene Berücksichtigung der Schwierigkeiten junger Demokratien ließen (Krennerich 2002: 63; Nohlen 1997; Nohlen/Thibaut 1994: 235ff.). Diese Kritik ist insofern berechtigt, als auch real existierende, rechtsstaatlich-liberale Demokratien immer in geringen Graden vom idealtypisch konstruierten Demokratiekonzept, wie es mit dem Kriterienraster der embedded democracy erfasst wird, abweichen. M.E. ist es aber wenig sinnvoll, neben den mehreren hundert Adjektiven, die der Demokratie in der Forschung bereits hinzugefügt wurden, noch weitere zu entwickeln. Daher wird in dieser Arbeit nicht nur am Konzept, sondern auch an der Terminologie der defekten Demokratie festgehalten.
[29] Zur Unterscheidung von defekten Demokratien und autoritären Regimen siehe die Ausführungen im Abschnitt 2.4.2
[30] Friedbert Rüb (2002: 102) hat in Auseinandersetzung mit dem Konzept der defekten Demokratie darauf hingewiesen, dass es logisch nicht stringent ist, definierende Kriterien festzulegen, die – siehe die eben ausgeführten Einschränkungen – dann doch nicht als notwendig angenommen werden: „Kernprinzipien sind Kernprinzipien und ein Minimum ist ein Minimum, von dem nichts mehr subtrahiert werden kann. Ist das Merkmal der freien und inklusiven Wahlen nicht erfüllt, handelt es sich per definitionem um eine Nicht-Demokratie und nicht um einen verminderten Subtypus der Demokratie“ (ebd.). Diese Kritik wird hier entschärft, da von einem wirkungsvollen und bedeutsamen Wahlregime als definierendem Merkmal ausgegangen wird. Ein solches liegt eben nur dann vor, wenn entweder alle vier Kriterien erfüllt sind oder die reelle Chance besteht, Herrschaftspositionen durch Wahlen neu zu besetzen, in Kombination mit der Existenz der anderen vier funktionierenden Teilregime.
[31] Ein Beispiel mag diesen Vorbehalt verdeutlichen. Italien unter der Regierung Silvio Berlusconis erlebt demokratietheoretisch bedenkliche Reformen des Rechtsstaats. Aber liegt eine solche Verzerrung der demokratischen Funktionslogik vor, dass es als defekte Demokratie gelten muss, wie Thomas Assheuer (2002) meint? Ähnelt die politische Herrschaftsordnung Italiens also stärker der Venezuelas als der Großbritanniens? Auch kann man den Blick weniger in die Ferne richten und fragen, wann aufgrund von Geldzahlungen erfolgte politische Entscheidungen – beispielsweise über den Bau von Müllverbrennungsanlagen, den Export von Rüstungsgerät oder die Privatisierung von Ölraffinerien – nur als einzelne Episoden zu verstehen sind und wann die Hürde zur dauerhaft beschädigten Funktionslogik der rechtsstaatlichen Demokratie überschritten ist. Es erscheint völlig absurd, die Bundesrepublik als defekte Demokratie zu klassifizieren, aber das Beispiel weist auf die Schwierigkeiten hin, einen eindeutigen Maßstab zu entwickeln. Vgl. auch Fn. 28.
[32] So zeigt sich in Venezuela, dass die Verletzungen der Öffentlichen Arena die Möglichkeiten alternativer Informationsbeschaffung für Venezolaner kaum beeinträchtigen, weil die wichtigsten Medienkonzerne des Landes wirtschaftlich außerordentlich potent sind und sich daher politischen Drohungen widersetzen können (s. nächstes Kapitel).
[33] Diese Ausführungen folgen im wesentlichen den Arbeiten von Wolfgang Merkel, Aurel Croissant und Peter Thiery (Merkel 1999a; Merkel/Croissant 2000; Croissant/Thiery 2000b; Thiery 2002).
[34] Dieser Variante kommt Guillermo O’Donnells (1994) prominenten Konzept der delegative democracy sehr nahe und bezeichnet den Typus defekter Demokratien, der auch in Venezuela seit 1998/99 vorliegt (s. Abschnitt 3.3).
[35] Früher hatte Linz noch ein viertes Kriterium genannt: die Machtausübung „innerhalb formal kaum definierter, aber tatsächlich recht vorhersagbarer Grenzen“ (Linz 2000: 129; [Original von 1975]). Dieses fiel ersatzlos weg.
[36] Wolfgang Merkel unterscheidet politische Systeme anhand: (1) Herrschaftslegitimation, (2) Herrschaftszugang, (3) Herrschaftsmonopol, (4) Herrschaftsstruktur, (5) Herrschaftsanspruch und (6) Herrschaftsweise (Merkel 1999a und 1999b; Merkel/Croissant 2000).
[37] Vgl. die leicht variierende, um das Kriterium der Herrschaftsarena erweiterte Herrschaftstypologie bei Thiery 2002: 84, sowie Croissant/Thiery 2000a und 2000b. Bei der anschaulichen Darstellung der verschiedenen Typen politischer Systeme ist nicht zu vergessen, dass dem Vorgehen der Konzeptbildung unvollständiger Subtypen entsprechend auch autoritäre Grauzonenregime zu erfassen wären.
[38] Die Kriterien des Herrschaftszugangs und des Herrschaftsmonopols werden auch in Adam Przeworskis Unterscheidung von Demokratie und Autokratie kombiniert. Für ihn ist „the essential feature of democracy […] referential uncertainty“ und er präzisiert „in an authoritarian system it is almost certain that political outcomes will not include those adverse to the interests of the power apparatus, while in a democratic system there is no group whose interests would predict political outcomes with a near certainty“ (1988: 61f.). Wie inzwischen deutlich geworden ist, gilt dem hier verfolgten Ansatz der eingebetteten Demokratie zufolge auch diese recht abstrakte Unterscheidung nicht als hinreichend zur Klassifikation demokratischer und autokratischer Regime.
[39] Eine solche Dominanz der Exekutive wurde von Friedbert Rüb als definierender Teil eines autoritären Minimums vorgeschlagen (2002: 104).
[40] In der Region können neben Venezuela nur Costa Rica und – mit Abstrichen ob der demokratischen Qualität der Wahlen und der schwach ausgeprägten Staatlichkeit – Kolumbien auf eine so dauerhafte Periode regelmäßig abgehaltener, kompetitiver Wahlen zur Bestellung der Herrschaftsträger aufweisen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832480585
- ISBN (Paperback)
- 9783838680583
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Philosophisch-Historische Fakultät, Politische Wissenschaft
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- regime institutionen system chárez südamerika
- Produktsicherheit
- Diplom.de