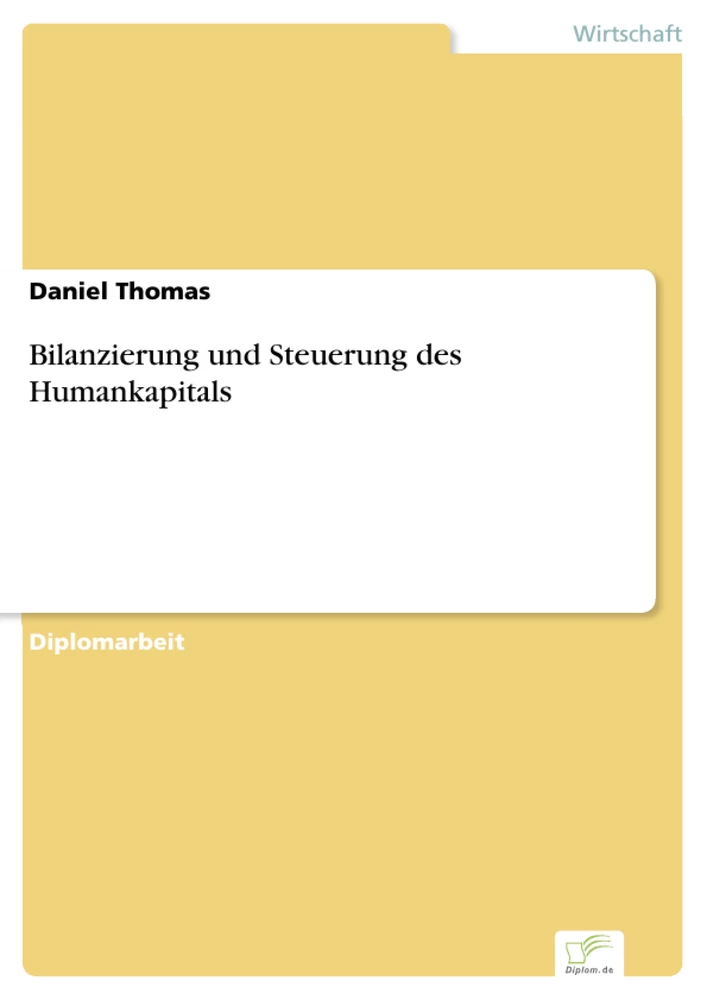Zusammenfassung
Verschiedene Faktoren wie die Dienstleistungsgesellschaft, Internet, Informationstechnologie, zunehmende Komplexität der Gesellschaft und Wirtschaft, Globalisierung sowie die Entwicklung von Innovationen verursachen einen stetig steigenden Bedarf an Mitarbeitern, die Informationen analysieren und nutzbringend einsetzen. Diese sogenannten Wissensarbeiter sind Träger von Kompetenzen und Motivationen. Diese Kompetenzen und Motivationen wiederum stellen für Unternehmen einen Wert dar: Humankapital. Das Human Capital Management beabsichtigt, das Humankapital entsprechend der Unternehmensstrategie zu entwickeln und optimal einzusetzen.
Es bedingt die Sichtweise, dass Wissensarbeiter beziehungsweise Mitarbeiter im Allgemeinen keine Kostenfaktoren, sondern langfristige Erfolgsfaktoren sind. Personalentwicklung stellt somit eine Investition in das Humankapital dar. Mithilfe von verschiedenen Instrumenten werden die Kosten, aber auch der Wert des Humankapitals gemessen. Dabei werden nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Faktoren evaluiert, um durch die personalwirtschaftlichen Aufgaben wie Personalrekrutierung, Personalentwicklung, Personalführung, Kommunikation, et cetera eine nachhaltige und wertschöpfende Personalarbeit sicherzustellen. Bei SAP beträgt das Verhältnis Personal- zu Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen auf das eingesetzte Kapital): 7,5 zu 1. Damit sind nicht mehr Maschinen der wesentliche Erfolgsfaktor, sondern die Mitarbeiter.
Jedoch wird dieser Wert oftmals nicht als solcher wahrgenommen, obwohl es ein Unterschied ist, ob ein Unternehmen durch Mitarbeiterentlassungen 20 Millionen pro Jahr spart, aber damit auch 500 Millionen Euro an Humankapital, inklusive der nicht-amortisierten Bildungsinvestitionen, vernichtet. Diese Transparenz zum Beispiel über Kennzahlensysteme herzustellen, ist eine weitere Aufgabe des Human Capital Managements. Außerdem sollte diese Transparenz den Kapitalmärkten zugänglich gemacht werden. Denn Humankapital wie auch andere immaterielle Vermögenswerte werden zurzeit nicht ausreichend in der Bilanz ausgewiesen. Heutige Bilanzen zeigen nur etwa 10 bis 15 Prozent des eigentlichen Unternehmenswertes an. Dies erschwert Aktionären die Investitionsentscheidung und kann aufgrund des Risikozuschlags aus Unternehmenssicht zu steigenden Kapitalkosten führen.
Diese Diplomarbeit Bilanzierung und Steuerung des Humankapitals zeigt den aktuellen den Stand der Humankapitaldiskussion. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis.
Tabellenverzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis
1 Zusammenfassung
2 Rahmenbedingungen
2.1 Informationsgesellschaft als Treiber immaterieller Vermögenswerte
2.1.1 Stetiger Wandel und Internet
2.1.2 Kostendruck und Digitalisierung der Geschäftsprozesse
2.1.3 Steigende Komplexität
2.1.4 Innovation
2.2 Eigenschaften von Informationen und Wissen
2.2.1 Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag
2.2.2 Gesetz vom zunehmenden Grenzertrag
2.2.3 Netzwerkeffekte
2.2.4 Kauf unter Unsicherheit
2.3 Formen immaterieller Vermögenswerte
2.3.1 Humankapital
2.3.2 Strukturkapital
2.3.3 Kundenkapital
2.3.4 Beziehung zwischen Human- und Strukturkapital
2.4 Der Kern des Humankapitals: Wissensarbeiter
2.5 Die Arbeitswelt von morgen
2.5.1 Wissensarbeiter sind die wichtigste Ressource
2.5.2 Demographie und Fachkräftemangel
2.5.3 Entwicklungen am Hochschulstandort Deutschland
3 Wertschöpfung
3.1 Evolutorische Theorien
3.1.1 Resource-based-View
3.1.2 Knowledge-based-View
3.2 Volkswirtschaftliche Wertschöpfung
3.3 Betriebswirtschaftliche Wertschöpfung
3.3.1 Prozessbedingte Wertschöpfung
3.3.2 Strategiebedingte Wertschöpfung
3.3.2.1 Discounted-Cashflow
3.3.2.2 Cashflow-ROI
3.3.2.3 Übergewinnverfahren
3.3.3 Hintergründe für ein wertorientiertes Personalmanagement
3.3.3.1 Verhaltenswissenschaftliche Theorien und Konzepte
3.3.3.2 Personalwirtschaftliche Theorien
3.3.3.3 Humankapital und Unternehmenserfolg
3.3.3.4 Mitunternehmertum
4 Human Capital Management
4.1 Begriffe
4.2 Ökonomische Bedeutung der Personalstrategie
4.3 Wertschöpfung des Personalmanagements
4.3.1 Personalcontrolling im Detail
4.3.2 Wertschöpfungscenter Personal
4.3.3 Rollen des Personalmanagements
4.3.4 Bezugsgruppenorientierung
4.3.5 Differenzierung der Wertschöpfungsdimensionen
4.3.5.1 Wertsteigernde und wertsichernde Wertschöpfung
4.3.5.2 Ergebnis- und potenzialbezogene Wertschöpfung
4.3.5.3 Direkte und indirekte Wertschöpfung
4.4 Wertschöpfungsmessung
4.4.1 Grundlagen
4.4.1.1 Kennzahlen
4.4.1.2 Kennzahlensysteme
4.4.1.3 Entwicklungsstufen im Personalcontrolling
4.4.2 Humankapitalbewertung und -steuerung
4.4.2.1 Die Ansätze im Überblick
4.4.2.2 Einführung in die Balanced Scorecard
4.4.2.3 Skandia Navigator
4.4.2.4 Strategischer Einsatz der Balanced Scorecard
4.4.2.5 Workonomics
4.4.2.6 Balanced Scorecard mit Werthebelbäumen
4.4.2.7 Werttreiber des Human Capital Managements
4.4.2.7.1 Erfolgskritische Werttreiber
4.4.2.7.2 Best Practice oder Resource-based-View?
4.4.2.7.3 Wirkungszusammenhänge
4.4.2.7.4 Das Werttreibermodell des Humankapitals
5 Bilanzierung des Humankapitals
5.1 Principal-Agent-Theorie
5.2 Personalrisiken
5.3 Ausgewählte Anwendungen
5.3.1 Basel II
5.3.2 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
5.3.3 Due Diligence bei Fusionen & Akquisitionen
5.4 Rechnungslegung
5.4.1 Bilanzierungsformen
5.4.1.1 Personalbericht
5.4.1.2 Personalwertbericht
5.4.1.3 Personalbilanz
5.4.2 Handelsgesetzbuch
5.4.3 International Financial Reporting Standards
5.4.4 US-Generally Accepted Accounting Principles
5.4.5 Fair Value als Bewertungsmaßstab
5.4.6 Umsetzungsprobleme bei der Humankapitalbilanzierung
5.4.7 Intellectual Capital Statement
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Klassisches Ertragsgesetz
Abbildung 2: Marktwertschema
Abbildung 3: Argumente für und gegen Wissensarbeit
Abbildung 4: Wissensarbeiter sind die wichtigste Mitarbeitergruppe
Abbildung 5: Sozialprodukt
Abbildung 6: Entstehungsrechnung
Abbildung 7: Wertschöpfungskette
Abbildung 8: Wertschöpfung und Gewinn
Abbildung 9: Discounted-Brutto-Cashflow
Abbildung 10: Cashflow-ROI
Abbildung 11: Wertsteigerung nach Übergewinnverfahren
Abbildung 12: Portfolio-Analyse zum Mitunternehmertum
Abbildung 13: HR-Wertschöpfungskette
Abbildung 14: Rollen des Personalmanagements
Abbildung 15: Potenzial- und ergebnisorientierter Wertschöpfung
Abbildung 16: Aufbau eines Kennzahlensystems
Abbildung 17: Entwicklungsstufen von HR-Kennzahlensystemen
Abbildung 18: Balanced Scorecard als Rahmenkonzept
Abbildung 19: Der Intellectual-Capital-Navigator der Skandia
Abbildung 20: Ursache-Wirkungszusammenhänge in der Balanced Scorecard
Abbildung 21: Mathematische Ableitung des VAP aus dem CVA
Abbildung 22: Anwendung von Workonomics bei SAP
Abbildung 23: HR-Cockpit als Werthebelbaum
Abbildung 24: Das Werttreibermodell des Humankapitals
Abbildung 25: Aktuelle Bilanzierung immateriellen Vermögens und Kapitals
Tabelle 1: Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands
Tabelle 2: Controllingdimensionen im Wertschöpfungscenter Personal
Tabelle 3: Mitarbeiterperspektive der Balanced Scorecard Deutsche Lufthansa
Tabelle 4: Vergleich der Kennzahlen
Tabelle 5: Bedeutung des Humankapitals bei den Dax-Unternehmen
Tabelle 6: Kategorie Human Capital
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Zusammenfassung
Verschiedene Faktoren wie die Dienstleistungsgesellschaft, Internet, Informations-technologie, zunehmende Komplexität der Gesellschaft und Wirtschaft, Globalisierung sowie die Entwicklung von Innovationen verursachen einen stetig steigenden Bedarf an Mitarbeitern, die Informationen analysieren und nutzbringend einsetzen. Diese sogenannten Wissensarbeiter sind Träger von Kompetenzen und Motivationen. Diese Kompetenzen und Motivationen wiederum stellen für Unternehmen einen Wert dar: Humankapital. Das Human Capital Management beabsichtigt, das Humankapital entsprechend der Unternehmensstrategie zu entwickeln und optimal einzusetzen. Es bedingt die Sichtweise, dass Wissensarbeiter beziehungsweise Mitarbeiter im Allgemeinen keine Kostenfaktoren, sondern langfristige Erfolgsfaktoren sind. Personalentwicklung stellt somit eine Investition in das Humankapital dar. Mithilfe von verschiedenen Instrumenten werden die Kosten, aber auch der Wert des Humankapitals gemessen. Dabei werden nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Faktoren evaluiert, um durch die personalwirtschaftlichen Aufgaben wie Personalrekrutierung, Personalentwicklung, Personalführung, Kommunikation, et cetera eine nachhaltige und wertschöpfende Personalarbeit sicherzustellen. Bei SAP beträgt das Verhältnis Personal- zu Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen auf das eingesetzte Kapital): 7,5 zu 1. Damit sind nicht mehr Maschinen der wesentliche Erfolgsfaktor, sondern die Mitarbeiter. Jedoch wird dieser Wert oftmals nicht als solcher wahrgenommen, obwohl es ein Unterschied ist, ob ein Unternehmen durch Mitarbeiterentlassungen 20 Millionen pro Jahr spart, aber damit auch 500 Millionen Euro an Humankapital, inklusive der nicht-amortisierten Bildungsinvestitionen, vernichtet. Diese Transparenz zum Beispiel über Kennzahlensysteme herzustellen, ist eine weitere Aufgabe des Human Capital Managements. Außerdem sollte diese Transparenz den Kapitalmärkten zugänglich gemacht werden. Denn Humankapital wie auch andere immaterielle Vermögenswerte werden zurzeit nicht ausreichend in der Bilanz ausgewiesen. Heutige Bilanzen zeigen nur etwa 10 bis 15 Prozent des eigentlichen Unternehmenswertes an. Dies erschwert Aktionären die Investitionsentscheidung und kann aufgrund des Risikozuschlags aus Unternehmenssicht zu steigenden Kapitalkosten führen.
2 Rahmenbedingungen
2.1 Informationsgesellschaft als Treiber immaterieller Vermögenswerte
Der Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft ist von einigen Entwicklungen begleitet. Im Mittelpunkt stehen jedoch immer Informationen, anwendungsorientiertes Wissen und Informationstechnologien. Sie sind für den Unternehmenserfolg zunehmend entscheidend, während die Bedeutung materieller Vermögenswerte wie Maschinen abnimmt. Erfolgreich sind diejenigen Unternehmen, die über die besten Informationen verfügen und dieses Wissen am effektivsten einsetzen.[1] In diesem Zusammenhang wird auch von dem Begriff der Neuen Ökonomie gesprochen. Die nachfolgend dargestellten Entwicklungen zeigen, dass Daten, Informationen und Wissen eine große Rolle in der heutigen Geschäftswelt spielen. Unlängst wird auch vom Produktionsfaktor Information gesprochen.[2]
Abgrenzung nach Stahlknecht/Hasenkamp:[3] Informationen werden aus Zeichen wie zum Beispiel dem Alphabet gebildet und stehen in einem Kontext. Wenn Informationen zweckorientiert und zielgerichtet angewendet werden, spricht man von Wissen. Zeichen beziehungsweise Informationen, die dem Zweck der Informationsverarbeitung dienen, heißen Daten.
2.1.1 Stetiger Wandel und Internet
Der Wechsel von der Agrar- zur Industriegesellschaft vollzog sich innerhalb eines Jahrhunderts. Der gegenwärtige Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft vollzieht sich dagegen innerhalb nur weniger Jahre.[4] Während 1950 zwei Drittel der Arbeitskräfte in produzierenden Unternehmen und weniger als ein Drittel in Dienstleistungsunternehmen beschäftigt waren, ist das Verhältnis heute genau umgedreht – und diese Entwicklung ist noch nicht beendet.[5] Ein Treiber dieser Entwicklung ist die Digitalisierung durch Kommunikations- und Informationstechnologien. Die Vernetzung durch das Internet, die Versendung von Informationen per Glasfasertechnik und permanente Innovationen der IT- und Kommunikationstechnologien führen zu einer rasanten Beschleunigung und stetigem wirtschaftlichen Wandel, weil diese Technik Transaktionskosten senkt und damit internationale Engagements rentabler macht.[6] Gleichzeit fördert der Abbau von Handelshemmnissen sowie die Öffnung der asiatischen und osteuropäischen Märkte den internationalen physischen Warenaustausch und damit die Globalisierung. Dies geht mit steigendem Konkurrenzdruck einher.
2.1.2 Kostendruck und Digitalisierung der Geschäftsprozesse
Der Wettbewerb zwingt Unternehmen, die Kosten im Griff zu haben. Die Deutsche Lufthansa konkurriert auf der Strecke Frankfurt – New York mit sechs Airlines.[7] Dieser Kostendruck führt unter anderem zur verstärkten Digitalisierung von Geschäftsprozessen, also der Nutzung von Informationstechnologien. Beispiel aus dem Personalbereich: Die softwareunterstützte Rekrutierung ist unter den elektronischunterstützten Funktionen des Personalmanagements mit am weitesten fortgeschritten: Unternehmen nutzen zur Mitarbeiterrekrutierung Jobbörsen und die Unternehmenshomepage. Inzwischen werden nicht nur Programmierer und andere internetaffine Mitarbeiter weltweit über das Internet angeworben, sondern auch Führungskräfte auf Direktorenebene. Cisco Systems ist auf diesem Gebiet führend:[8] Cisco Systems rekrutiert zwei Drittel seiner Mitarbeiter über das Internet und erhält 80 Prozent der eingesandten Lebensläufe online. Dies zahlt sich aus: Durchschnittlich kostet die Einstellung eines neuen Cisco-Mitarbeiters 6.500 US-Dollar, der amerikanische Industriedurchschnitt liegt bei etwa 11.000 US-Dollar.
Amerikanische Unternehmen haben seit Anfang der 90er-Jahre mehr Geld für Technik ausgegeben, die Informationen sammelt, analysiert und verbreitet, als für Maschinen oder sonstige Anlagen, die physisch auf Gegenstände einwirken.[9] Das Einzelhandelsunternehmen Wal-Mart hat mehr als eine Milliarde US-Dollar für Informationstechnologie ausgegeben.[10] Die Unternehmen setzen Warenwirtschaftssysteme sowie Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme ein. Diese Systeme unterstützen die Materialwirtschaft, Fertigungsplanung und Fertigungssteuerung. Somit kann zum Beispiel der Lagerbestand und damit die Kapitalbindung minimiert sowie eine reibungslose Produktion beziehungsweise Disposition gewährleistet werden. Wenn ein solches System prozessorientiert aufgebaut ist, können auch Lieferanten einbezogen werden (Supply Chain Management).[11] Dann können Unternehmen den Material- und den Informationsfluss über den gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg steuern und das Just-in-Time-Prinzip umsetzen. In diesem Zusammenhang wird von einem Werthebel gesprochen, mit dem Unternehmen fünf- bis zehnmal höhere Renditen erzielen können als mit Investitionen in traditionelles Sachkapital.[12]
Außerdem können Unternehmen mithilfe von Software nicht nur Prozesse unterstützen und beschleunigen, sondern auch Kundendaten auswerten und das Kundenverhalten analysieren. Dieses Wissen wird dann für Marketingaktionen verwendet. „Wenn ein Unternehmen in seiner Branche über die besten Kenntnisse der Vorlieben und Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe potenzieller Kunden verfügt, kann es sich darauf konzentrieren, genau diese Kunden zu bedienen und die Herstellung der entsprechenden Produkte an jemand anderen delegieren.“[13] Somit kann Wissen mittels Outsourcing Sachanlagen ersetzen. Beiersdorf führte bereits in den 90er-Jahren eine Analyse über seine Kernkompetenzen durch. Das Ergebnis war nicht Produktions- oder Vertriebskompetenz, sondern die Kompetenz zur Markenführung wie zum Beispiel die Marke Nivea.[14]
2.1.3 Steigende Komplexität
Zusammen mit dem Umfeld intensiver Konkurrenz und des raschen Wandels schwindet der Einfluss der Geschäftsführung. Die Verantwortung für den Unternehmenserfolg verschiebt sich auf viele Fach- und Führungskräfte (Wissensträger). Inzwischen teilen sich viele erfolgreiche Manager ein Geheimnis: Sie wissen nicht, warum sie erfolgreich sind. Technologie, Ökonomie und Gesellschaft sind so komplex geworden, dass sie für ein einzelnes Individuum nicht mehr erfassbar sind.[15] Friedrich von Hayek, Nobelpreisträger für Wirtschaft von 1974, schrieb bereits 1945 in seinem Werk „The Use of Knowledge in Society“, dass eine zentralisierte Entscheidungsfindung nicht so schnell und flexibel wie eine dezentralisierte Entscheidungsfindung sein kann.[16] Dezentralisierung delegiert die Entscheidungsmacht auf die Ebenen, die die relevanten Informationen besitzen, weshalb der Unternehmenserfolg von gut funktionierenden Organisationen abhängt.
Auch diese Entwicklung fördert die Verbreitung von Informationstechnologien: Führungsinformationssysteme versorgen Manager rechtzeitig und in geeigneter Form mit relevanten Informationen.[17] Die Software soll den Managementzyklus Zielsetzung, Planung, Entscheidung, Realisierung (durch Delegierung) und Kontrolle unterstützen. Das können in der Zielsetzungsphase zum Beispiel Informationen über Marktentwicklung, Käufereinstellung, Rohstoffpreise, Kapazitätsauslastung, Personalentwicklung und bisherige Planrealisierung sein.[18] Je nach Aufbau und Zielsetzung eines solchen Systems können Informationen aus einzelnen Unternehmensfunktionen wie Vertrieb, Marketing, Personal, Finanzen oder Controlling zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang werden häufig Kennzahlensysteme wie die Balanced Scorecard eingesetzt (siehe Kapitel 4.4.2 Humankapitalbewertung und -steuerung).
2.1.4 Innovation
Neben Kostensenkungen und Marktwachstum sind Innovationen eine wesentliche Triebfeder für den Unternehmenserfolg.[19] Im Hinblick auf die Globalisierung, zunehmende Marktliberalisierung und vielen gesättigten Märkten, sind Innovationen ein wichtiger Lösungsweg, um sich von Wettbewerbern zu differenzieren und dem Nullsummenspiel zu entgehen. Ein weiteres Phänomen sind sinkende Produktlebenszyklen: Das T-Modell von Henry Ford hatte eine Produktlebensdauer von einer Menschengeneration, beim PC beträgt sie gerade noch zwei Jahre. Viele Innovationen wie zum Beispiel das Tamagotchi-Spiel kommen und gehen. Zeit ist eine strategische Waffe im Konkurrenzkampf geworden. Damit Unternehmen dieses Innovationstempo überleben, brauchen sie immer neue Produktideen, weshalb heute Kreativität, Information und Wissen die wichtigsten Ressourcen sind. „Die rentabelsten Investitionen sind heute solche, die mit Innovationsarbeit und mit der Suche nach neuen Wegen zur Erfüllung der Marktanforderungen eines Unternehmens zu tun haben.“[20] Diese Aktivitäten können gewinnbringender sein als die Suche nach kleinen Verbesserungen im Produktionsablauf. Außerdem werden durch das Internet die Märkte transparenter. Dies fördert den Wettbewerb, den sich Unternehmen auf Dauer nicht mehr entziehen können. Der Druck steigt, Innovationen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.[21]
2.2 Eigenschaften von Informationen und Wissen
90 Prozent aller US-Firmen – mit Ausnahme der Stahl-, Bergbau- und Transportindustrie sowie der Immobilienbranche – investieren heute bereits mehr in Informationen als in neues Finanzkapital. Aufwendungen in Informationen und Wissen stellen Investitionen in die Fähigkeit dar, immaterielle Vermögenswerte zu schaffen und durch Outsourcing materielle Vermögenswerte durch immaterielle zu ersetzen.[22] Allerdings unterliegen immaterielle Werte wie Informationen anderen Gesetzen als materielle Werte: So kann die Kenntnis des Kaufverhaltens eines Kunden, die aus der Analyse seiner Kreditkartenzahlungen resultiert, sehr wertvoll sein – wertvoller als der Gesamtwert der von diesem Kunden getätigten Einkäufe.[23] Die Informationen über das Kundenverhalten können zum Beispiel für Handelsunternehmen und Konsumgüterhersteller von großem Nutzen sein. So könnte der Finanzdienstleister die Kundeninformationen – unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen – verkaufen. Die Kosten der Informationsgewinnung (hier am Beispiel der Kundenprofile) sind unabhängig davon, wie viele Personen diese Informationen erwerben und einsetzen. Weiteres Beispiel: Es macht für die Entwicklungskosten einer neuen Software keinen Unterschied, ob dieses Programm nur von 300 oder von einer Million Anwendern verwendet wird.[24] Sicherlich verursachen die Trägermaterialien wie CDs oder Papier für den Buchdruck Kosten, aber nicht für das Wissen selbst. Der Vorrat an Wissen (zum Beispiel über die Kundenprofile) ist unerschöpflich, unabhängig vom Faktor Raum, allerdings abhängig vom Faktor Zeit. Jeder, der über bestimmte Informationen verfügt, kann sie – bevor sie veraltet ist – nutzen und je mehr Personen sie nutzen, desto wertvoller werden sie: Je mehr Personen und Unternehmen eine bestimmte Software einsetzen, desto leichter können sie beispielsweise Informationen austauschen. Beispiele: Microsoft Office, SAP.
2.2.1 Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag
Aus den vorgenannten Gründen gilt in wissensintensiven Unternehmen das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag nicht: Das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag besagt, dass jede Geschäftsaktivität einen Punkt erreicht, von dem an zusätzliche Investitionen weniger produktiv als frühere Investitionen werden.[25] Im Detail ist dies in der Produktionstheorie dargestellt: Eine bestimmte Menge Güter wird durch den Einsatz von Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) hergestellt. Wie viel Output bei einer bestimmten Menge an Input erzeugt werden kann, beschreiben Produktionsfunktionen. Sie zeigen in mathematisch-formaler Weise den mengenmäßigen Zusammenhang zwischen Faktoreinsatz (Input) und Faktorertrag (Output):[26] Zu jeder Inputkombination wird der maximal mögliche Output berechnet. Dieses Gesetz von zunächst steigenden, dann fallenden und später negativen Grenzerträgen – ausgelöst durch zunehmende Engpässe – konnte Turgot 1767 für die Landwirtschaft beweisen und steht seitdem als klassisches Ertragsgesetz in der Literatur.[27] Das Ertragsgesetz gilt unter folgenden Annahmen:[28] Die Inputfaktoren sind in einem bestimmten Umfang substituierbar, beliebig teilbar und homogen (keine Leistungsunterschiede zwischen den Produktionsfaktoren), es wird nur eine Outputart produziert und alle Inputfaktoren sind bis auf einen konstant gehalten. Das Ertragsgesetz gilt allerdings nicht für alle industrielle Produktionsprozessen.[29]
Abbildung 1: Klassisches Ertragsgesetz [30]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die eingesetzte Menge des variablen Inputfaktors v (im Landwirtschaftsbeispiel: Arbeit) ist in Abbildung 1: Klassisches Ertragsgesetz auf der Abzisse eingetragen. Die Ordinate zeigt den Ertrag x, den Grenzertrag GE (mathematisch die erste Ableitung der Ausgangsfunktion) und den Durchschnittsertrag DE. Die beiden letztgenannten Funktionen sind auf den Inputfaktor Arbeit bezogen. Der Grenzertrag gibt an, wie sich der Ertrag ändert, wenn der variable Inputfaktor um einen infinitesimal kleinen Betrag geändert wird.[31] Bis zum Punkt A steigt der Ertrag progressiv, da die Grenzerträge positiv sind. Ab Punkt A steigt der Ertrag nur noch degressiv, weil die Grenzerträge sinken. Ab Punkt C sinken die Erträge aufgrund negativer Grenzerträge. Auf das Landwirtschaftsbeispiel bezogen heißt das, dass ab einer bestimmten Menge Arbeiter deren Effektivität abnimmt, weil sie sich zum Beispiel gegenseitig im Weg stehen oder nicht mehr Getreide aussähen können, weil nur eine begrenzte Agrarfläche zur Verfügung steht. Im Endeffekt verursachen zunehmende Engpässe sinkende Grenzerträge.
2.2.2 Gesetz vom zunehmenden Grenzertrag
In wissensbasierten Branchen gilt dagegen nicht das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag, sondern vom zunehmenden Grenzertrag, weil Informationen keinen oder nur geringeren Engpassfaktoren unterliegen.[32] Dies lässt sich am Beispiel Software zeigen: Zahlreiche und kostengünstige Speichermedien stehen mit großen Speicherkapazitäten zur Verfügung. Somit lässt sich Software mühelos kopieren. In der Verlagsbranche wird beispielsweise versucht, die Information vom Trägermaterial Papier loszulösen, so dass ein Text wahlweise auf CD gebrannt, als Buch gedruckt oder ins Internet gestellt werden kann. Somit steht einer Mehrfachnutzung und einer weiteren Verbreitung nichts mehr im Weg.
Wie oben gezeigt, halten sich die Vervielfältigungskosten von Informationen (insbesondere Software) in Grenzen und damit auch die variablen Kosten. Das Schaffen von Wissen ist aber mit erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten (Fixkosten) verbunden.[33] Damit gilt: Je höher der Absatz, umso stärker sinken die Stückkosten. „Der Profit pro Exemplar steigt mit der verkauften Stückzahl an. Und das wiederum bedeutet, dass der Gesamtprofit mit jedem verkauften Exemplar stärker als linear zunimmt: Er wächst beschleunigt, und sein Graph kann zumindest eine Zeit lang einer exponentiellen Kurve gleichen.“[34] Inwieweit das Gesetz vom zunehmenden Grenzertrag auch in der Praxis gilt, muss sicherlich im Einzelfall untersucht werden. Ferner gilt die Fixkostendegression auch für wissensbasierte Tätigkeiten in industrienahen Bereichen. Beispiel: Automobildesign.
Aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ist deshalb die genaue Einschätzung des Absatzvolumens beziehungsweise des Absatzpotenzials sehr wichtig, bevor eine neues Geschäftssegment bearbeitet wird. Ferner haben marktführende Unternehmen eine gute Ausgangsposition, um mehr Kunden zu gewinnen und damit ihre Fixkosten schneller zu amortisieren sowie weiter zu wachsen. Diese Unternehmen können sich Netzwerke, eine weitere Besonderheit immaterieller Vermögenswerte, zunutze machen.
2.2.3 Netzwerkeffekte
In wissensbasierten Branchen gelten Besonderheiten, die sich von Industriebetrieben unterscheiden: Je größer die Zahl der User einer Software ist, umso mehr steigt der potenzielle Nutzen für alle Anwender. Daraus folgt eine größere Attraktivität der Software für Neukunden. Dieser Effekt der positiven Rückkoppelung bedingt aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass Produktentwicklung und Marketing die Schlüsselfaktoren sind.[35] Netscape machte sich diese Rückkoppelung zunutze und stellte seinen Webbrowser „Netscape Navigator“ kostenlos zur Verfügung, um Marktführer zu werden und eine große Anwender-Community aufzubauen:[36] Mit der Verbreitung des Navigators entstand gleichzeitig eine große Nachfrage nach Navigator-basierten Anwendungen. Um diese Anwendungen programmieren zu können, benötigten Informatiker allerdings eine Software, die sie bei Netscape käuflich erwerben mussten. Nach Metcalf, Erfinder des Ethernets, steigt der Wert eines Netzwerks nach der Formel 2n (n = Anzahl der Netzwerkteilnehmer).[37] Weitere Beispiele: Faxgeräte, Fotohandys, World Wide Web, Microsoft Windows, Ebay.
2.2.4 Kauf unter Unsicherheit
Ein weiteres Merkmal wissensbasierter Produkte ist der Kauf unter Unsicherheit. Der Käufer kann erst dann beurteilen, ob sich die Investition in eine Information gelohnt hat, wenn er darüber verfügt.[38] Der Kunde kann also nur bedingt den Produktnutzen vor dem Kauf einschätzen. Eine engere und offenere Kundenbeziehung spielt deshalb für den Produkterfolg in wissensintensiven Geschäftszweigen eine Schlüsselrolle.[39]
2.3 Formen immaterieller Vermögenswerte
Vermögenswerte (Assets) eines Unternehmens werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Man unterscheidet Werte des:
- Anlagevermögens (zum Beispiel Grundstücke, Immobilien, Maschinen),
- Umlaufvermögens (zum Beispiel Vorräte, Forderungen, flüssige Mittel) sowie
- Beteiligungen und Finanzanlagen (Wertpapiere).
Im Zuge der oben genannten Entwicklungen zur Informationsgesellschaft sind weitere Werte für Unternehmen von entscheidender Bedeutung geworden, die aber nur bedingt in der Bilanz berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5 Bilanzierung des Humankapitals): Immaterielle Vermögenswerte (Intangible Assets). Es handelt sich um längerfristige Werte, die sich zum Beispiel bei Unternehmenskäufen im derivativen Geschäfts- und Firmenwert (Goodwill) niederschlagen (siehe Kapitel 5.4.2 Handelsgesetzbuch). Immaterielle Vermögenswerte können als die immateriellen Ressourcen eines Unternehmens umschrieben werden. Weitere Synonyme sind Begriffe wie Wissenskapital (Intellectual Capital)[40] und unsichtbare, verborgene und nicht-finanzielle Vermögenswerte. Das Wort „Intellectual“ besteht aus den lateinischen Wörtern „inter“ und „lectio“. „Inter“ bedeutet „zwischen“ und impliziert Beziehungen. „Lectio“ bedeutet „Lesen“ und „erworbenes Wissen“. „Capital“ steht für eine Gesamtsumme.[41]
Abbildung 2: Marktwertschema [42]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Edvinsson[43] /Brünig[44] unterscheiden drei Komponenten des Wissenskapitals (siehe Abbildung 2: Marktwertschema): Humankapital, Strukturkapital und Kundenkapital. Diese Komponenten sind „das Rohmaterial, aus dem der größte Teil des zukünftigen wirtschaftlichen und finanziellen Erfolgs eines Unternehmens besteht.“[45] Edvinsson/Brünig vergleichen die Rolle des Wissenskapitals mit einem Baum: Das unsichtbare immaterielle Vermögen liegt unterhalb der Erdoberfläche in den Wurzeln verborgen. Sie sind jedoch die Voraussetzung für die sichtbaren Werte des Stammes und der Äste (Organigramme, Jahresberichte, materielle Vermögenswerte) sowie der Früchte (Produkte). „Während der Geschmack der Früchte und die Farbe der Blätter darauf schließen lassen, wie gesund der Baum jetzt gerade ist, lehrt uns das Verständnis der Vorgänge in den Wurzeln doch viel effizienter, wie gesund er in den nächsten Jahren sein wird.“[46]
In vielen Unternehmen, insbesondere in Dienstleistungsunternehmen, repräsentiert die Bilanz gegenwärtig nur noch 10 bis 15 Prozent des Unternehmenswertes. 1929 betrug das Verhältnis immaterieller und materieller Vermögenswerte 30 zu 70 Prozent. 1993 betrug das Verhältnis 63 zu 37 Prozent.[47] Die traditionellen Methoden der Rechnungslegung sind nicht imstande, das immaterielle Vermögen abzubilden.
2.3.1 Humankapital
In wissensbasierten Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Nur durch seine Motivation und Ideen sind Innovationen möglich. Er analysiert die Kundenbedürfnisse und entwickelt davon ausgehend neue Produkte und Dienstleistungen. Das Humankapital eines Unternehmens umfasst die individuellen Fähigkeiten, Wertvorstellungen, Kreativität, Erfahrungen, soziale Kompetenzen und Wissen seiner Angestellten und Manager. Der Begriff Humankapital schließt auch die Unternehmenskultur ein und ist größer als die Summe der einzelnen Kompetenzen der Mitarbeiter, denn der Begriff beinhaltet auch die Fähigkeit, sich auf veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Nach Edvinsson/Brünig[48] ist Humankapital „das gesamte geistige und körperliche Potenzial der Mitarbeiter eines Unternehmens.“ Nach Daum[49] gehört hingegen nicht jeder Mitarbeiter oder Manager zum Humankapital, sondern die Personen, die durch ihre Kompetenzen Mehrwert für Kunden und andere Stakeholder schaffen und in die Abläufe eingegliedert sind. Diese Mitarbeiter und Manager generieren mit ihren Kompetenzen Marktvorteile (siehe zur Unterscheidung verschiedener Grade von Wissensarbeit das Kapitel 2.4 Der Kern des Humankapitals: Wissensarbeiter). Aber: Das Humankapital ist nicht Eigentum eines Unternehmens, sondern kann es nur solange für sich nutzen, wie die Person im Unternehmen angestellt ist.
2.3.2 Strukturkapital
Intelligente Menschen sind noch keine Erfolgsgarantie. Wenn Menschen nicht zusammenarbeiten und sie untereinander keine Informationen austauschen, ist die Gruppe als Ganzes nicht intelligent. Wirklich nutzbringendes Wissen und marktfähige Innovationen resultieren aus der Interaktion von Wissensarbeitern, indem sie Ideen und Erfahrungen austauschen.[50] Strukturkapital ist deshalb die infrastrukturelle Unterstützung des Humankapitals. Darunter sind IT-Systeme, Aufbau- und Ablauforganisation zu verstehen, die den Wissensfluss und eine inspirierende Kultur unterstützen. Weitere Beispiele für Strukturkapital sind Managementprozesse, Firmenimages, Patente, Marken, Datenbanken, Organisationskonzepte und Dokumentationen. Strukturelles Kapital kann individuelles Humankapital unabhängig von der Anwesenheit der betreffenden Person (des Wissensträgers) nutzbringend speichern. Strukturkapital gehört der Organisation selbst. Das Unternehmen kann es reproduzieren und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen.[51] Die Transformation von individuellem Wissen in strukturelles Kapital half beispielsweise dem Versicherungsdienstleister Skandia zu einem geschäftlichen Vorteil:[52] Skandia verkürzte die Zeit, eine ausländische Niederlassung zu gründen, von sieben Jahren auf sieben Monate. Das sogenannte Prototypkonzept beinhaltet unter anderem eine Sammlung von Softwareanwendungen und Handbüchern und bündelt damit individuell erworbenes Wissen, das im Zusammenhang mit einer Neugründung steht. Im Falle einer Neugründung konnten die damit beauftragten Mitarbeiter auf ein Informationspaket zurückgreifen, an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und für ein beliebiges Finanzdienstleistungsportfolio optimieren.
Das Strukturkapital kann weiter untergliedert werden in:[53]
- Organisationskapital: Investitionen in Systeme, Werkzeuge und eine Betriebsphilosophie, die den Durchfluss des Wissens beschleunigt.
- Innovationskapital: Fähigkeit zur Erneuerung, das heißt die Innovationsergebnisse in Form von Schutz- und Eigentumsrechten zu schützen sowie Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
- Prozesskapital: Arbeitsprozesse, Techniken und Mitarbeiterprogramme, die die Effizienz der Produktion optimieren.
Strukturkapital stellt einen Wert dar, weil es durch strukturierte und leicht erlernbare Prozesse die Produktivität des Humankapitals steigern kann. Die Organisation stellt die Kontinuität sicher, die Wissensarbeiter benötigen, um produktiv sein zu können. Sie transformiert das Spezialwissen der Wissensarbeiter in wirtschaftliche Ergebnisse.[54] Lev[55], Professor an der Universität von New York, konnte eine Korrelation zwischen Strukturkapital und Unternehmenswert[56] empirisch nachweisen: Nach Lev ist Strukturkapital die Voraussetzung, damit die Ressourcen – materielle Vermögenswerte, Humankapital, Kundenkapital (siehe Kapitel 2.3.3 Kundenkapital) und Innovationen – in Mehrwert und letztlich in einen höheren Aktienkurs münden, weshalb exzellentes Strukturkapital ein Indikator für gute Managerfähigkeiten sind. Die Managerqualitäten drücken sich in der Lern- und Innovationsfähigkeit einer Organisation aus, denn Lernen ist nicht nur ein individueller Prozess, sondern eine soziale Tätigkeit, mit anderen über neue Ideen zu diskutieren. So kommt es zu neuen Konzepten, die in der Organisation als Ganzes eingesetzt werden oder jeder für sich selbst nutzen kann.[57]
2.3.3 Kundenkapital
Ursprünglich wurde das Kundenkapital, also die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden, dem Strukturkapital zugeordnet. In letzter Zeit wird das Kundenkapital und damit auch Werte wie Marken und Image verstärkt einer separaten Kategorie zugeordnet, um den ökonomischen Wert von Kunden- und Partnerbeziehungen hervorzuheben. Die Bedeutung des Kunden drückt sich zum Beispiel in der Erkenntnis aus, dass es schwieriger und teurer ist, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Stammkunden zu halten. Für das traditionelle Rechnungswesen ist es in vielen Unternehmen nach wie vor unvorstellbar, Kundenkapital zu messen, obwohl im Goodwill seit vielen Jahren der Wert eines starken und loyalen Kundenstamms berücksichtigt wird:[58] In der Telekommunikationsbranche ist es bei Übernahmen üblich, die Kundenanzahl mit dem durchschnittlichen Kundenwert zu multiplizieren und als diskontierter Wert der geschätzten künftigen Nettoüberschüsse pro Kunden anzusetzen. Das Pharmaunternehmen Merck & Co. kaufte 1993 ein Unternehmen namens Medco, das über sehr gute Kenntnisse über Privatkunden verfügte.[59] Durch dieses Wissen konnte der Einsatz von Zwischenhändlern zum Verkauf von Medikamenten vermieden werden. Medco konnte Ärzten Tipps für billigere Medikamente geben und trotz niedrigerer Verkaufspreise gute Gewinne erzielen. Merck bezahlte für Medco 6,6 Milliarden US-Dollar. Fast die Hälfte dieses Betrags wurde für die Kundenbeziehungen (Kundenkapital) aufgewendet.
„In der Kundenbeziehung beginnt der Cashflow und nicht in der Buchhaltung, ungeachtet dessen, was viele Manager zu denken scheinen.“[60] Deshalb sollten Unternehmen ihr Kundenkapital messen, um die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zu verstehen. Mit Messung ist unter anderem die Stärke und Loyalität gemeint. Kennzahlen sind zum Beispiel Zufriedenheit, Dauer, Preisempfindlichkeit und Einkommen langfristiger Kunden. Wie das Humankapital befindet sich Kundenkapital nicht im Besitz eines Unternehmens und entzieht sich einer vollständigen Kontrolle. Somit kann es durch Änderungen im Unternehmen, am Markt oder in der Lieferkette schnell negativ in seinem Wert beeinflusst werden, was für Wissenskapital generell gilt.[61]
2.3.4 Beziehung zwischen Human- und Strukturkapital
Die einzelnen immateriellen Vermögenswerte lassen sich nicht einfach addieren. Wert entsteht erst aus dem Zusammenwirken aller Vermögenswerte. Sie können sich gegenseitig unterstützen und den Wert auf diese Weise für das Unternehmen multiplizieren.[62] Andererseits können sie sich auch gegenseitig negativ beeinflussen. Die Grundlagen für eine positive Beeinflussung sind die Unternehmenskultur (zum Beispiel Führungsstil, Übertragung von Verantwortung an Mitarbeiter, Motivationsanreize) und eine Unternehmensstrategie, denn die Komponenten des Wissenskapitals an sich schaffen noch keinen Wert. Ein Unternehmen braucht ein Gesamtkonzept. Anhand dieser Ziel- und Handlungsorientierung können die in den einzelnen Komponenten enthaltenen Potenziale effektiv genutzt und in finanziellen Wert umgesetzt werden.[63] Wie bereits im Kapitel 2.1.3 Steigende Komplexität erläutert, kann niemand im Alleingang ökonomischen Erfolg erzielen. Die Rolle der Organisation besteht darin, Individuen durch Strukturen zu unterstützen. Sie soll es ihnen ermöglichen, ihre Kompetenzen und Potenziale sowie gegebenen Marktchancen zu nutzen, um ökonomischen Wert zu schaffen.[64]
2.4 Der Kern des Humankapitals: Wissensarbeiter
Der amerikanische Vordenker Peter F. Drucker ist der Urheber des Begriffs Wissensarbeiter (Knowledge Workers). Nach seiner Ansicht sind diese Mitarbeiter hervorragend ausgebildete Personen, die als Kapitalwerte und nicht primär als Kostenfaktor gesehen werden sollten.[65] Drucker stellte außerdem die Forderung, nicht nur die Effizienz manueller Arbeit oder einfacher Dienstleistungstätigkeiten zu steigern, sondern auch die Effizienz anspruchsvoller geistiger Arbeit.[66]
Das Fraunhofer-Institut definiert Wissensarbeit wie folgt: „Wissensarbeit ist die Bewältigung von Arbeitsaufgaben, die zumindest für die betreffende Person komplex oder neuartig sind. Charakteristisches Merkmal der Wissensarbeit ist, dass sie vielfältige Informationen und fundiertes Wissen als Rohstoff benötigt und neues Wissen als Produkt erzeugt.“[67] Wissensarbeiter nutzen also nicht nur ihr eigenes Wissen, sondern auch das von anderen. Sie eignen sich selbst Wissen aus anderen Fachgebieten an, verständigen sich mit Personen unterschiedlicher Disziplinen und Qualifikationsniveaus und entwickeln gemeinsam neue Lösungen.[68] Deshalb kann Wissensarbeit nur dann funktionieren, wenn der Zugang zu verschiedenen Wissensquellen möglich ist und ein Wissensaustausch, zum Beispiel über Abteilungen hinweg, erfolgt.[69] Wenn Mitarbeiter Herrschaftswissen aufbauen wollen, wird dieser notwendige Austausch behindert.
Unternehmen und Mitarbeiter befinden sich in einem Konflikt:[70] Aus Sicht der Unternehmen ist Wissensarbeit anspruchsvoll und teuer und steht damit dem Bestreben entgegen, Komplexität durch Prozessstandardisierung zu reduzieren. Die Mitarbeiter sind auch an der Komplexitätsreduzierung interessiert, weil Wissensarbeit Stress und Überforderung verursachen kann. Beide brauchen aber einen gewissen Grad an Komplexität, weil „sich Systemverständnis und Kreativität nur dann herausbilden, wenn eine Person permanent mit der ganzen Komplexität realer Probleme konfrontiert wird.“[71] Wissensarbeit ist also für die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter und für die Innovationskraft des Unternehmens nötig, weshalb die richtige Balance wichtig ist. Die Abbildung 3: Argumente für und gegen Wissensarbeit verdeutlicht diese Problematik von niedriger und hoher Komplexität. Fraunhofer unterscheidet drei Grade wissensintensiver Arbeitsaufgaben[72]:
- Wissensbasierte Arbeit: Alle Tätigkeiten bei denen Erfahrung und Wissen eine Rolle spielen (in diese Kategorie fällt fast jede menschliche Tätigkeit);
- Wissensintensive Arbeit: Tätigkeiten, die eine umfassende Ausbildung oder langjährige Erfahrung in einem bestimmten Fachgebiet voraussetzen;
- Wissensgenerierende Arbeit: Tätigkeiten, bei denen das einmal erworbene Fachwissen nicht ausreicht, sondern die es erforderlich machen, das vorhandene Wissen zu revidieren, zu verbessern und zu erneuern, um eine Problemlösung zu finden. Nur diese Arbeit ist im engeren Sinne Wissensarbeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Argumente für und gegen Wissensarbeit[73]
Welche Tätigkeiten wissensgenerierende Arbeit darstellen und welche nicht, kann man mithilfe eines Modells von Quinn et al.[74] herausfinden. Die Tätigkeiten werden nach ihren Kompetenzanforderungen eingestuft. Fraunhofer[75] setzte das Modell bei der europäischen Hotelkette Accor ein, um eine Softwareimplementierung und deren Auswirkungen zu begleiten:
- Know-what: in der Ausbildung/Weiterbildung erworbenes Fachwissen (zum Beispiel Eingabe von Daten in ein Softwaresystem);
- Know-how: Erfahrung in der Anwendung des Fachwissens auf komplexe Alltagsprobleme (zum Beispiel Zimmer buchen);
- Know-why: Fähigkeit, Wechselwirkungen und Handlungsfolgen vorherzusehen (zum Beispiel Marktbeobachtung, Steuerung des Verkaufsprozesses);
- Care-why: Kreativität aus eigenem Antrieb (zum Beispiel Erstellen von Absatzvorhersagen).
Tätigkeiten im Know-why- und Care-why-Bereich stellen Wissensarbeit dar. Es stellte sich heraus, dass nach der Softwareumstellung bei Accor Verkaufskoordinatoren und Reservierungsmitarbeiter neue Tätigkeitsprofile wissensgenerierender Art aufwiesen. Verkaufskoordinatoren kontrollieren, erstellen Absatzvorhersagen und beraten die Reservierungsmitarbeiter, die wiederum komplexe Entscheidungen treffen: Wann nehme ich einen Gast an, wann vermittle ich ihn an ein anderes Haus? Aus der bisherigen Call-Center-Tätigkeit wurde eine Aufgabe mit strategischer Bedeutung.
2.5 Die Arbeitswelt von morgen
„Innovationszyklen und Projektlaufzeiten schrumpfen; die Zeit, um mit einem Produkt auf den Markt zu kommen, sinkt: Schnelligkeit wird zum Wettbewerbsfaktor. Dazu muss hochqualifiziertes Personal rekrutiert werden, das auf dem externen Arbeitsmarkt nur schwer zu finden ist. Der interne Kompetenzaufbau wird durch die technologische Dynamik erschwert. Da in immer kürzeren volkswirtschaftlichen Abständen ein Mangel an Fachkräften auftritt, führt dies zusammen mit den verkürzten Innovationszyklen zu Kompetenzengpässen im Unternehmen und damit zu einem Risiko“, schreibt Heinz Klinkhammer, Personalvorstand der Deutschen Telekom.[76] Klinkhammer beschreibt mit diesen Worten einen vollkommen anderen Arbeitsmarkt als ihn frühere Generationen kannten. Die neue Arbeitswelt verlangt von ihren Arbeitnehmern, mit ständiger Unsicherheit zu leben, weil die Anforderungen an Flexibilität, Mobilität, Einsatz- und Lernbereitschaft zunehmen. Bereits heutige Arbeitsplätze sind durch folgende Eigenschaften charakterisiert:[77]
- wachsende Komplexität der Arbeitsinhalte,
- wechselnde Arbeitsrollen,
- rasch wechselnde Unternehmensstrukturen,
- Dezentralisierung von Verantwortung,
- Flexible Beschäftigungsverhältnisse.
Wobei sich viele Arbeitnehmer diesen neuen Bedingungen noch nicht anpassen wollen: Nach dem BAT Freizeit-Forschungsinstitut[78] wollen 71 Prozent der Mitarbeiter lieber Beständigkeit, Sicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen, als Risiko und flexible Vergütung.
Fritz Schuller, ehemals Geschäftsführer Personal von Hewlett-Packard, sagte: „Heute ist jeder Mitarbeiter selbst für seine Qualifikation zuständig. Was er dazu beiträgt, das unterstützen wir. Aber wir wollen niemanden mit einer Sänfte in Qualifizierungsmaßnahmen tragen. Wir als Arbeitgeber haben aber die Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein solches Engagement möglich machen.“[79] Der ehemalige Kontrakt, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine Loyalität und Arbeitskraft für eine lebenslange Anstellung gewährt, ist nicht mehr existent. An seine Stelle tritt ein neues Konzept, dass sich Arbeitnehmer mit ihren Kompetenzen zeitweise für die Aufgaben eines Unternehmens einsetzen und sich der Arbeitgeber im Gegenzug für die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) seiner Arbeitnehmer einsetzt, damit sie im finalen Fall schnell einen neuen Arbeitsplatz finden.[80] Dieses Phänomen beschreibt Professor Scholz, Universität Saarbrücken, mit dem Begriff Darwiportunismus[81]: Die Unternehmen handeln darwinistisch, weil im globalen Wettbewerb nur der beste überlebt und sie stets optimal positioniert sein müssen. Das heißt, dass im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen auch Mitarbeiter entlassen oder umqualifiziert werden. Auf der anderen Seite handeln die Mitarbeiter opportunistisch, sie verlassen das Unternehmen, wenn sie in ihrer Karriere- und Berufsentwicklung nicht ausreichend unterstützt werden. Der Aspekt „Fehlende Perspektiven“ ist bereits heute einer der Top-3-Kündigungsgründe.[82] Kieser[83] nennt in diesem Zusammenhang folgende Leitlinien für Arbeitnehmer:
1. Entwickle vor allem generelle, unternehmensunabhängige Qualifikationen;
2. Beteilige Dich an übergreifenden Netzwerken;
3. Achte darauf, dass das höhere Beschäftigungsrisiko in der Entlohnung berücksichtigt wird, um Reserven für einen möglichen Unternehmenswechsel anzulegen. Versetze Dich also selbst in die Lage, Dir selbst den goldenen Handschlag zu geben.
Leitlinien für Arbeitgeber: Unternehmen sollten demgegenüber Aufgaben und Projekte stärker in den Mittelpunkt rücken.[84] Die Bedeutung der Hierarchie für die Karriereentwicklung wird abnehmen, weshalb Organisationen mit Projekt- und Teamarbeit an Bedeutung gewinnen. Die Weiterbildung gewinnt zum Zweck der Mitarbeiterbindung, Sicherung der Kompetenzen und Motivationsförderung an Stellenwert,[85] wobei Unternehmen dieses Bindungspotenzial aktuell zu wenig nutzen: 58 Prozent der Mitarbeiter schätzen ihre Entwicklungschancen in ihren Unternehmen als schlecht ein.[86] United Technologies Corporation legte dagegen eines der vorbildlichsten Weiterbildungsprogramme auf und senkte seine Fluktuationsquote nachweisbar.[87] Allerdings gibt es auf Unternehmensseite auch Vorbehalte gegen die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit (Employability), wie die Erfahrungen aus einem regionalen Employability-Projekt zeigen.[88]
Die Forderung nach mehr Flexibilität und Mobilität hat weitere Nebenwirkungen: Der Kapitalismus in dieser flexiblen Form fördert persönliche Eigenschaften, die mit den traditionellen Vorstellungen nicht vereinbar sind:[89] Jeder wird gezwungen, sich kurzfristig zu orientieren und somit Werte wie Treue und Verlässlichkeit aufzugeben. Dadurch wird eine Oberflächlichkeit und Kurzfristigkeit gefördert, die tiefere soziale Bindungen verhindert. Ungewissheit und Unverbindlichkeit führen zu einem Zustand des „Driftens“, dass also keine Wurzeln geschlagen werden. Seit Jahren bestätigen die Mikrozensus-Untersuchungen des Statistischen Bundesamts[90], dass der Anteil der Ein- und Zweipersonenhaushalte ständig steigt. Die neuen Bundesländer haben sich dem Niveau der alten Bundesländer angeglichen. Dementsprechend steigt die Alleinlebendenquote. Nach einer Studie der Zeitschrift „Freundin“ und der Jobbörse Jobpilot.de[91] wecken die Mobilitätsanforderungen Ängste bei den Arbeitnehmern. Die größten Bedenken sind hinsichtlich der Trennung vom Partner gegeben. Dies gaben 37 Prozent der 8.320 Befragten aus elf europäischen Ländern an. Außerdem ist zu beobachten, dass das Geburtsverhalten vom Bildungsniveau abhängt:[92] Höher Gebildete bleiben öfter kinderlos als niedrig Gebildete, weil ihnen die Opportunitätskosten zu hoch erscheinen. Der entgangene Nutzen erscheint aufgrund der Erwerbsunterbrechung für gut ausgebildete und damit gut verdienende Frauen zu hoch, um den Kinderwunsch zu realisieren. Hinzukommen fehlende Betreuungsangebote, berufliche Nachteile für diejenigen, die Kinder haben und eine kinderfeindlich gestaltete Umgebung.[93] Dies sind die wichtigsten Gründe für die niedrige Geburtenrate in Deutschland (siehe Kapitel 2.5.2 Demographie und Fachkräftemangel).
2.5.1 Wissensarbeiter sind die wichtigste Ressource
Klinkhammer spricht von hochqualifiziertem Personal, das rekrutiert werden muss, um künftige Herausforderungen zu meistern (siehe Kapitel 2.5 Die Arbeitswelt von morgen), denn 60 bis 80 Prozent der gesamten betrieblichen Wertschöpfung werden mit dem wettbewerbsrelevanten Schlüsselfaktor Wissen erzeugt.[94] Dazu werden künftig immer weniger Arbeiter und Hilfsarbeiter und mehr Informations- und Wissensarbeiter benötigt (siehe Abbildung 4: Wissensarbeiter sind die wichtigste Mitarbeitergruppe). Insgesamt löst dieser Trend eine verstärkte Nachfrage nach hoch qualifizierten Kräften aus, die mit Komplexität umgehen können (siehe Kapitel 2.4 Der Kern des Humankapitals: Wissensarbeiter).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Wissensarbeiter sind die wichtigste Mitarbeitergruppe [95]
Dass Niedrigqualifizierte vor allem im wachsenden Dienstleistungssektor Beschäftigungschancen haben, könnte sich als Trugschluss herausstellen. Nach Untersuchungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln[96] gibt es zwar diese Chancen, aber es befinden sich in diesem Sektor auch überdurchschnittlich viele Hochqualifizierte. Denn je mehr Beschäftige im Dienstleistungssektor erwerbstätig sind, desto überdurchschnittlich größer wird der Anteil an Hochqualifizierten. In den USA sind 27 Prozent der im Dienstleistungssektor Beschäftigten Akademiker. In den Deutschland sind es 14 Prozent.
2.5.2 Demographie und Fachkräftemangel
Innerhalb der westlichen Staaten sinken die Geburtenziffern und liegen inzwischen deutlich unterhalb der Werte, die für eine konstante Bevölkerungszahl notwendig wären (siehe Tabelle 1: Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands). Dieser Rückgang führt auch zu einem Rückgang des Arbeitskräfteangebots. Nach einer Prognose des Instituts für Arbeit und Technik wird sich diese Verknappung der Arbeitskräfte in den nächsten zehn Jahren auswirken.[97] Das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit schätzt, dass bis zum Jahre 2015 sieben Millionen Erwerbspersonen in Deutschland fehlen werden.[98]
Zusammenfassend ist die Demographie in Deutschland durch drei Entwicklungen gekennzeichnet:
1. Absolute Abnahme der Bevölkerungszahl;
2. Sinkender Anteil der unter 20- und unter 30-Jährigen;
3. Höherer Anteil älterer Bürger.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands [99]
2.5.3 Entwicklungen am Hochschulstandort Deutschland
Die demographische Entwicklung wird sich mittel- bis langfristig in einer geringeren Anzahl von Schulabgängern und Studentenzahlen bemerkbar machen und ist insofern besonders negativ, weil im internationalen Vergleich der Anteil 5- bis 29-Jähriger an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 28,9 Prozent beträgt. Dieser Wert liegt bereits am unteren Ende der Vergleichsskala – der OECD-Durchschnitt beträgt 33,0 Prozent.[100] Demgegenüber steht die künftig verstärkte Nachfrage nach Akademikern. Im Jahr 2000 waren ein Drittel der Schulabgänger Abiturienten. Der internationale Durchschnitt liegt dagegen bei 57 Prozent.[101] Anstelle des Studiums entscheiden sich viele für eine Lehre[102], weshalb 2001 die Studienanfängerquote 32,4 Prozent betrug und im internationalen Vergleich ebenfalls unterdurchschnittlich ist.[103] Allerdings besteht Hoffnung, dass dieser Anteil auf die von der Bundesregierung angestrebten 40 Prozent erhöht werden kann: Im Wintersemester 2003/2004 immatrikulierten sich erstmals mehr als zwei Millionen Studierende.[104] Das Durchschnittsalter betrug 22 Jahre, ein ebenfalls schlechter Wert im internationalen Vergleich.[105] Die neu geschaffenen Bachelor- und Masterstudiengänge werden angenommen: Die Zahl dieser Studierenden hat sich seit 1999 fast verzehnfacht und liegt in 2002 bei 67.000 – besonders beliebt sind sie bei ausländischen Studierenden.[106]
Die Anzahl der Studierenden, die ihr Studium mit einer erfolgreichen Abschlussprüfung beendeten, pendelt seit Jahren um die Marke von jährlich 200.000 Absolventen.[107] Nach Studiengängen betrachtet sinken die Absolventenzahlen bei Ingenieuren, Mathematikern, Naturwissenschaftlern und Ärzten.[108] Branchenverbände wie der Verein Deutscher Ingenieure schlagen bereits Alarm: Deutschland fehlen pro Jahr 20.000 Absolventen für Ingenieurwesen.[109] Durch die höheren Studierendenzahlen wird sich dies erst ist den nächsten Jahren in höheren Absolventenzahlen niederschlagen.[110] PricewaterhouseCoopers konnte in einer Studie der Fortune-Top-500-Unternehmen belegen, dass 70 Prozent der Befragten fehlendes Mitarbeiterpotenzial als größtes Wachstumshindernis empfinden.[111]
Theoretisch könnte der künftig geringere Anteil jüngerer Menschen durch die Beschäftigung von älteren Mitarbeitern kompensiert werden. Doch auch hier gibt es Defizite:[112] Von allen 55- bis 64-Jährigen in Deutschland waren nur 38,4 Prozent in 2002 erwerbstätig. Andere Länder wie Schweiz (64,8 Prozent) und die USA (59,5 Prozent) verzeichnen höhere Anteile. Die geringe Quote liegt unter anderem an den Vorbehalten gegenüber älteren Arbeitnehmern, dass sie zu teuer und zu unflexibel wären. Diese Vorurteile sind unberechtigt.[113]
3 Wertschöpfung
Bei der Definition des Begriffs Wert sind zwei gegensätzliche Ansätze zu unterscheiden:[114]
1. Der objektivistische Werbegriff: Von einem Produkt oder einer Dienstleistung geht ein inhärenter Wert aus;
2. Der subjektivistische Wertbegriff: Jeder Bezieher eines Produktes oder einer Dienstleistung bemisst den Wert individuell. Je höher der quantitative oder qualitativ empfundene Nutzen ist, desto größer ist der individuelle Wert (Nutzen = Wert). Weil der Wert subjektiv bemessen wird, kann der Unternehmenswert nur jeweils aus der Sicht einer Anspruchsgruppe bestimmt werden.
3.1 Evolutorische Theorien
m Folgenden werden zwei Theorien aus dem evolutorischen Forschungsprogramm vorgestellt, die im Zusammenhang mit dem Thema Wertschöpfung von Bedeutung sind. Evolutorische Theorien gehen von folgenden Grundproblemen und Elementen aus:[115]
- Irreversibilität: Nicht-Umkehrbarkeit von Handlungen;
- Komplexität: Vielzahl von Beziehungen;
- Kausalität ökonomischer Prozesse: Wechselwirkungen der Elemente;
- Dynamik: Berücksichtigung zeitlicher Entwicklungen.
- Erklärung von Innovationen über das zeitliche Verhalten von Systemen.
Unter Wertschöpfung[116] wird ein Prozess des Schaffens von Mehrwert (value added beziehungsweise added value) durch Bearbeitung verstanden. Mit welchen Fähigkeiten und Ressourcen Unternehmen Mehrwert und damit überdurchschnittliche Erträge schaffen können, ist Gegenstand der beiden folgenden Theorien. Daraus ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten für das strategische Management.[117]
3.1.1 Resource-based-View
as Unternehmen wird im Resource-based-View als eine Ansammlung von einzigartigen materiellen und immateriellen Ressourcen (zum Beispiel Mitarbeiter, Maschinen, Material) verstanden. Jede Firma verfügt über ein individuelles Bündel von Ressourcen, um damit Wettbewerbsvorteile sowie dauerhafte und überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften.[118] In diesem Modell wird nicht von Homogenität, also allen frei zugänglichen Ressourcen ausgegangen, wie im neoklassischen Modell des perfekten Marktes, sondern von Ressourcenheterogenität.[119] Die Unterschiede zwischen den Ressourcen bedingen Kernkompetenzen, die wiederum zu Erfolgsunterschieden unter den Unternehmen führen:[120] Kernkompetenzen sind unternehmensspezifische Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation, Flexibilität, Lernfähigkeit oder Schnelligkeit. Eine oder mehrere Kernkompetenzen bedingen zusammen mit den strategischen Erfolgsfaktoren Kosten, Qualität und Zeit eine Unique Selling Proposition. Eine Unique Selling Proposition ist eine einzigartige Verkaufsaussage, über die kein Wettbewerber verfügt und die zu überdurchschnittlichem Erfolg am Markt führt. Aus Sicht des Managements ist eine kluge Auswahlentscheidung über den Erwerb bestimmter Ressourcen entscheidend.[121] Der Resource-based-View erklärt allerdings nicht, wie das Management wertvolle von nicht-wertvollen Ressourcen unterscheiden kann. Oftmals besteht Unklarheit über die Effizienzunterschiede verschiedener Ressourcen, weil die Ressourcen in Wechselwirkungen zueinander stehen und isolierte Einzelbetrachtungen nicht möglich sind.[122] Dies wiederum macht es für Konkurrenten schwierig, effiziente Ressourcen und Ressourcenkombinationen zu imitieren.
In engem Zusammenhang mit dem Resource-based-View steht der Market-based-View. Der Market-based-View beschreitet den genau umgekehrten Weg und erklärt den überdurchschnittlichen Erfolg durch Marktorientierung und die Positionierung des Unternehmens. Letztlich gehören diese beiden Theorien zusammen.
3.1.2 Knowledge-based-View
Der Knowledge-based-View basiert auf dem Resource-based-View.[123] Während beim Resource-based-View die Ressource Wissen eine unter vielen Ressourcen ist, bekommt ihr jetzt eine eigenständige Bedeutung zu.[124] Unternehmen werden beim Knowledge-based-View als soziale Organisationen verstanden, in denen Individuen auf Grundlage ihrer Fähigkeiten und Wertvorstellungen interagieren. Wissen spielt dabei die entscheidende Rolle zur Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen.[125] Lokalisierung, Generierung, Nutzung, Transfer und die Sicherung von Wissen sind die Grundlagen für das Verhalten einer Organisation und der Fähigkeit, Renditen zu erwirtschaften.[126] Das firmenspezifische Wissen unterscheidet ein Unternehmen von seinen Wettbewerbern, weshalb einzigartiges Wissen zu einer starken Marktposition führen kann. Kritisch an diesem Ansatz ist, dass Wissen in allen Organisationen vorhanden ist und dieses Modell nicht die Frage beantwortet, wie relevantes von nicht-relevantem Wissen abgegrenzt werden kann.[127]
3.2 Volkswirtschaftliche Wertschöpfung
Der Bruttoproduktionswert eines Unternehmens wird aus den GuV-Positionen der Passivseite berechnet: Produkt- und Dienstleistungsverkäufe, Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie selbsterstellte Anlagen. Werden vom Bruttoproduktionswert die Vorleistungen (Verbrauch/Einsatz von Ressourcen) abgezogen, ergibt dies den Nettoproduktionswert, der wiederum vermindert um die Abschreibungen die Wertschöpfung (= Faktoreinkommen: Löhne, Zinsen, Pachten, Mieten, Gewinn) ergibt.[128] In der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung werden die Nettoproduktionswerte aller Unternehmen einer Volkswirtschaft aufgerechnet (Entstehungsrechnung). Diese Addition ergibt das Bruttosozialprodukt (siehe Abbildung 5: Sozialprodukt). Subtrahiert man vom Bruttosozialprodukt die Abschreibungen ergibt dies das Nettosozialprodukt (= Volkseinkommen). Das Nettosozialprodukt entspricht in der betrachteten Volkswirtschaft (staatliche Aktivitäten ausgeblendet) der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung.[129] Das Volkseinkommen kann nach seiner Entstehung (Nettoproduktionswerte minus Abschreibungen), Verteilung (Summe aller Faktoreinkommen) oder Verwendung berechnet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Sozialprodukt [130]
3.3 Betriebswirtschaftliche Wertschöpfung
Eines der wichtigsten kurzfristigen Ziele eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung, um die Ansprüche der Eigentümer (Shareholder) zu befriedigen, weil diese den ökonomischen Wert ihrer Investition maximieren wollen.[131] Das heißt auch, den Wert eines Unternehmens als ganzes zu steigern.[132] Andererseits gibt es viele andere Interessengruppen (Stakeholder), die durch ihre Beiträge ihrerseits Ansprüche (Stakeholder-Value) an das Unternehmen stellen: Gläubiger, Kunden, Staat, Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Lieferanten, et cetera. Jedes Unternehmen ist somit ein pluralistisches Gebilde.[133] „Dabei sind die beiden Value-Ansätze jedoch keine Gegensätze, vielmehr bedingen sie sich langfristig gegenseitig. Denn nur wenn es gelingt, Nutzen für alle Anspruchsgruppen zu schaffen, kann auch der Shareholder-Value langfristig gesichert werden. Zielkonflikte zwischen den beiden Ansätzen treten daher vor allem bei kurzfristigen Betrachtungszeiträumen auf, wenn einzelne Anspruchsgruppen direkt betroffen sind.“[134] Beispiele sind Lohnkürzungen und Entlassungen, um kurzfristig das Betriebsergebnis zu verbessern. Langfristig werden demotivierte Mitarbeiter dem Unternehmen und damit dem Shareholder-Value wenig nutzen, wenn Wachstumschancen verpasst werden (siehe Kapitel 3.3.3 Hintergründe für ein wertorientiertes Personalmanagement).
[...]
[1] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 17
[2] Vgl. Stahlknecht, P./Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 10. Auflage, Berlin/Heidelberg 2002, S. 440
[3] Vgl. Stahlknecht, P./Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 10. Auflage, Berlin/Heidelberg 2002, S. 10
[4] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, Seite 1
[5] Vgl. Meier, H.: Führungskraft mit hybridem Anforderungsprofil, in: Personalwirtschaft, Heft 5/2004, S. 34
[6] Vgl. Klinkhammer, H: Telekom goes T.I.M.E.S.: Neuausrichtung der Konzern-Personalstrategie, in: Klinkhammer, H. (Hrsg.): Personalstrategie. Personalmanagement als Business Partner, Neuwied/Kriftel 2002, S. 9
[7] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, S. 3
[8] Vgl. Walsh, I: Current Trends in Human Resource Management in the USA, in: Clermont, A/Schmeisser, W./Krimphove, D (Hrsg.): Strategisches Personalmanagement in Globalen Unternehmen, München 2001, Seite 167-183
[9] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 31
[10] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 30
[11] Stahlknecht, P./Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 10. Auflage, Berlin/Heidelberg 2002, S. 368
[12] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 31
[13] Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 32
[14] Vgl. Wucknitz, U.D.: Handbuch Personalbewertung. Messgrößen, Anwendungsfelder, Fallstudien, Stuttgart 2002, S. 36
[15] Vgl. Gilroy, B. M.: Globalisation, Multinational Enterprises and European Integration Processes: Some Insights for International Human Resources Management, in: Clermont, A/Schmeisser, W./Krimphove, D (Hrsg.): Strategisches Personalmanagement in Globalen Unternehmen, München 2001, Seite 25
[16] Vgl. Gilroy, B. M.: Globalisation, Multinational Enterprises and European Integration Processes: Some Insights for International Human Resources Management, in: Clermont, A/Schmeisser, W./Krimphove, D (Hrsg.): Strategisches Personalmanagement in Globalen Unternehmen, München 2001, Seite 25
[17] Vgl. Stahlknecht, P./Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 10. Auflage, Berlin/Heidelberg 2002, S. 397
[18] Vgl. Stahlknecht, P./Hasenkamp, U.: Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 10. Auflage, Berlin/Heidelberg 2002, S. 399f.
[19] Vgl. Müller-Stewens, G./Fontin, M.: Die Innovation des Geschäftsmodells – der unterschätze vierte Weg, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 172, 28.7.2003, S.18
[20] Edvinsson, L.: Interview in: Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 153
[21] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 137
[22] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 32
[23] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 53f.
[24] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 54
[25] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 55
[26] Vgl. Vossebein, U.: Materialwirtschaft und Produktionstheorie, 2. Auflage, Wiesbaden 2001, S. 65
[27] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 111
[28] Vgl. Vossebein, U.: Materialwirtschaft und Produktionstheorie, 2. Auflage, Wiesbaden 2001, S. 94f.
[29] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 113
[30] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 112
[31] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 112
[32] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 55
[33] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 56
[34] Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 56
[35] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 56
[36] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 56
[37] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 57
[38] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 59
[39] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 59
[40] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 32f.
[41] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 152
[42] Vgl. Bergmann, P./Bodrow, W.: Wissensbewertung in Unternehmen. Bilanzieren von intellektuellem Kapital, Berlin 2003, S. 97; in Anlehnung an Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 44
[43] Leif Edvinsson war bei der schwedischen Skandia-Versicherung der weltweit erste Director of Intellectual Capital.
[44] Vgl. Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 19
[45] Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 33
[46] Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 18f.
[47] Vgl. Walsh, I: Current Trends in Human Resource Management in the USA, in: Clermont, A/Schmeisser, W./Krimphove, D (Hrsg.): Strategisches Personalmanagement in Globalen Unternehmen, München 2001, Seite 167-183
[48] Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 19
[49] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 34
[50] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 37
[51] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 38
[52] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 37
[53] Vgl. Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 30
[54] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 38
[55] Vgl. Lev, B.: Intangibles at a Crossroads, in: Horváth, P./Möller, K. (Hrsg.): Intangibles in der Unternehmenssteuerung. Strategien und Instrumente zur Wertsteigerung des immateriellen Kapitals, München 2004, S. 9ff.
[56] Unternehmenswert = Aktienkurs · Anzahl ausgegebener Aktien
[57] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 38
[58] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 41
[59] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 43
[60] Edvinsson, L./Brünig, G.: Aktivposten Wissenskapital, Wiesbaden 2000, S. 31
[61] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 43f.
[62] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 51f.
[63] Vgl. Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 52
[64] Vgl. Edvinsson, L. im Interview, in: Daum, J. H.: Intangible Assets oder Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 163
[65] Vgl. Walsh, I: Current Trends in Human Resource Management in the USA, in: Clermont, A/Schmeisser, W./Krimphove, D (Hrsg.): Strategisches Personalmanagement in Globalen Unternehmen, München 2001, Seite 168
[66] Vgl. Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 49
[67] Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 49
[68] Vgl. Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 50
[69] Vgl. Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 51
[70] Vgl. ebenda, S. 50
[71] ebenda, S. 50
[72] Vgl. ebenda, S. 54
[73] Vgl. Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 51
[74] Vgl. Quinn, J.B./Anderson, P./Finkelstein, S.: Das Potenzial in den Köpfen Gewinn bringend nutzen, in: Harvard Business Manager, Heft 3/1996, S. 95-104
[75] Vgl. Hermann, S.: Wissensarbeit erkennen und organisieren, in: Personalwirtschaft, Heft 6/2002, S. 54
[76] Klinkhammer, H: Telekom goes T.I.M.E.S.: Neuausrichtung der Konzern-Personalstrategie, in: Klinkhammer, H. (Hrsg.): Personalstrategie. Personalmanagement als Business Partner, Neuwied/Kriftel 2002, S. 10
[77] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, Seite 25
[78] Vgl. Opaschowski, H.W.: Neue Welt der Arbeit. Personalführung und Wertewandel, BAT Freizeit-Forschungsinstitut (www.bat.de), Vortrag im Rahmen des 11. DGFP-Kongresses 2003 am 23.5.2003 in Wiesbaden
[79] Rose, J: Angst vor Employability, in: Personalwirtschaft, Heft 12/2003, S. 36
[80] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, Seite 36f.; Schmitt, L: Nahtlose Weiterbeschäftigung, in: Personalwirtschaft, Heft 11/2002, S. 50f.
[81] Vgl. Scholz, C.: Spieler ohne Stammplatzgarantie. Darwinismus in der neuen Arbeitswelt, Berlin/Darmstadt 2003; www.darwiportunismus.de
[82] Vgl. Wood, R.: Mit schlechter Führung ins Mittelmaß, in: Personalwirtschaft, Heft 4/2004, S. 29
[83] Vgl. Kieser, A.: Schwächung der Wettbewerbsposition durch wertorientierte Verschlankung?, in Macharzia, K/Neubürger, H. J. (Hrsg.): Wertorientierte Unternehmensführung. Strategien – Strukturen – Controlling, Stuttgart 2002, S. 162
[84] Vgl. Kieser, A.: Schwächung der Wettbewerbsposition durch wertorientierte Verschlankung?, in Macharzia, K/Neubürger, H. J. (Hrsg.): Wertorientierte Unternehmensführung. Strategien – Strukturen – Controlling, Stuttgart 2002, S. 162
[85] Vgl. Bednarczuk, P./von Bismarck, W.-B./Aleweld, T.: Attraktive Arbeitgeber haben engagierte Mitarbeiter, in: Personalwirtschaft, Heft 3/2003, S. 56
[86] Vgl. Fiebes, H./Lau, V./Pilger, N.: Viel reaktive Verwaltung, wenig kreative Gestaltung, in: Personalwirtschaft, Heft 4/2004, S. 17
[87] Vgl. Dailey, L: „Wir wollen die bestausgebildeten Mitarbeiter der Welt“, in: Personalwirtschaft, Heft 2/2004, S. 18ff.
[88] Vgl. Rose, J: Angst vor Employability, in: Personalwirtschaft, Heft 12/2003, S. 36ff.
[89] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, Seite 24
[90] Vgl. Breiholz, H./Duschek, K.-J./Heidenreich, H.-J./Nöthen, M.: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Leben und Arten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2002, Wiesbaden 2003, S. 9 und 30, www.destatis.de, (22.4.2004)
[91] Vgl.: o.V.: Geforderte Mobilität weckt Ängste bei Arbeitnehmer, in: Personalwirtschaft, Heft 5/2004, S. 8
[92] Vgl. o.V.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Bericht zur Nachhaltigen Familienpolitik, o.O., o.J., S. 14, www.gmfsfj.de, (22.4.2004)
[93] Vgl. o.V.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Deutschland muss familienfreundlicher werden, Pressemitteilung vom 21.4.2004, www.gmfsfj.de, (23.4.2004)
[94] Vgl. o.V., Deutsche Telekom AG: Personalbericht 2002, S. 86, www.telekom.de/personalbericht.de
[95] Vgl. Lombriser, R./Üpping, H (Hrsg.): Employability statt Jobsichereit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, S. 26
[96] Vgl. o.V.: Mehr Akademiker braucht das Land, in: iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Nr.14 vom 4.4.2002
[97] Vgl. o.V.: Ende Vorruhestandspraxis trotz anhaltender Arbeitslosigkeit? – Institut Arbeit und Technik untersuchte Situation älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt, Pressemitteilung des Instituts Arbeit und Technik, Gelsenkirchen, vom 28.3.2003
[98] Vgl. Lombriser, R./Uepping, H.: Employability statt Jobsicherheit. Personalmanagement für eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Neuwied/Kriftel 2001, Seite 10
[99] Vgl. Pötzsch, O./Sommer, B.: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Bevölkerung Deutschlands bis 2050. Ergebnisse der 10. koordinierten Vorausberechnung, Wiesbaden 2003, S. 31, www.destatis.de, (14.11.2003)
[100] Vgl. Flüter-Hoffmann, C.: Aus- und Weiterbildung im internationalen Vergleich, in: Personalwirtschaft, Heft 2/2004, S. 25
[101] Vgl. o.V.: Stark in der Breite, schwach in der Spitze, in: iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Nr.23 vom 5.6.2003
[102] Vgl. o.V.: Stark in der Breite, schwach in der Spitze, in: iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Nr.23 vom 5.6.2003
[103] Vgl. Beck, M./Wilhelm, R.: Statistischen Bundesamt (Hrsg.): Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, S. 6, www.destatis.de, (7.4.2004)
[104] Vgl. o.V.: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Erstmals über 2 Millionen Studierende an den Hochschulen, Pressemitteilung vom 4.12.2003, www.destatis.de, (7.4.2004)
[105] Vgl. o.V.: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Erstmals über 2 Millionen Studierende an den Hochschulen, Pressemitteilung vom 4.12.2003, www.destatis.de, (7.4.2004)
[106] Vgl. Beck, M./Wilhelm, R.: Statistischen Bundesamt (Hrsg.): Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, S. 5, www.destatis.de, (7.4.2004)
[107] Vgl. o.V.: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Erstmals über 2 Millionen Studierende an den Hochschulen, Pressemitteilung vom 4.12.2003, www.destatis.de, (7.4.2004); o.V.: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (Hrsg.): Hochschulabsolventen werden knapp, Newsletter vom April 2003
[108] Vgl. Beck, M./Wilhelm, R.: Statistischen Bundesamt (Hrsg.): Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, S. 5, www.destatis.de, (7.4.2004)
[109] Vgl. o.V.: Jährlich fehlen 20.000 Ingenieure, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.4.2003
[110] Vgl. Beck, M./Wilhelm, R.: Statistischen Bundesamt (Hrsg.): Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, S. 5, www.destatis.de, (7.4.2004)
[111] Vgl. Steffens, U., Vorstandsvorsitzender der Bankakademie e.V., beim Vortrag am 8.5.2003 in Frankfurt/Main anlässlich der Jahrestagung der kaufmännischen Ausbildungsleiter
[112] Vgl. Hertel, I./Wojtysiak,, C./Lorentz, R.: Lebensarbeitszeitmodell als Alternative, in: Personalwirtschaft, Heft 12/2003, S. 21
[113] Vgl. Böckly, W./Klischewski, J./Schürmann, V: Altersspezifisches Personalmanagement, in: Personalwirtschaft, Heft 12/2003, S. 9ff.
[114] Vgl. Wunderer, R./Jaritz, A: Unternehmerisches Personalcontrolling, Evaluation der Wertschöpfung im Personalmanagement, 2. Auflage, Neuwied/Kriftel 2002, S. 29f.
[115] Vgl. Palupski, R.: Über Führung, 2. Auflage, Essen 2003, S. 149
[116] Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, 2. Auflage, Stuttgart 2003, S. 355
[117] Vgl. Palupski, R.: Über Führung, 2. Auflage, Essen 2003, S. 150
[118] Vgl. Palupski, R.: Über Führung, 2. Auflage, Essen 2003, S. 151
[119] Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, 2. Auflage, Stuttgart 2003, S. 357
[120] Vgl. Palupski, R.: Über Führung, 2. Auflage, Essen 2003, S. 152f.
[121] Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, 2. Auflage, Stuttgart 2003, S. 358
[122] Vgl. ebenda, S. 358f.
[123] Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, 2. Auflage, Stuttgart 2003, S. 362
[124] Vgl. Müller-Stewens, G./Lechner, C.: Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, 2. Auflage, Stuttgart 2003, S. 362
[125] Vgl. ebenda, S. 363
[126] Vgl. ebenda, S. 363
[127] Vgl. ebenda, S. 363
[128] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 241
[129] Eigene Darstellung, in Anlehnung an Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 242
[130] Vgl. Cezanne, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, München/Wien 1999, S. 242
[131] Vgl. Ziegenbein, K.: Controlling, 7. Auflage, Ludwigshafen 2002, S. 88/90
[132] Vgl. Holzbaur, U.D.: Management, Ludwigshafen, 2000, S. 45
[133] Vgl. Ziegenbein, K.: Controlling, 7. Auflage, Ludwigshafen 2002, S. 88
[134] Wunderer, R./Jaritz, A: Unternehmerisches Personalcontrolling, Evaluation der Wertschöpfung im Personalmanagement, 2. Auflage, Neuwied/Kriftel 2002, S. 34
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832482398
- ISBN (Paperback)
- 9783838682396
- DOI
- 10.3239/9783832482398
- Dateigröße
- 1.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2004 (August)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- personalcontrolling human resource management wissensarbeit vermögenswerte wertschöpfung
- Produktsicherheit
- Diplom.de