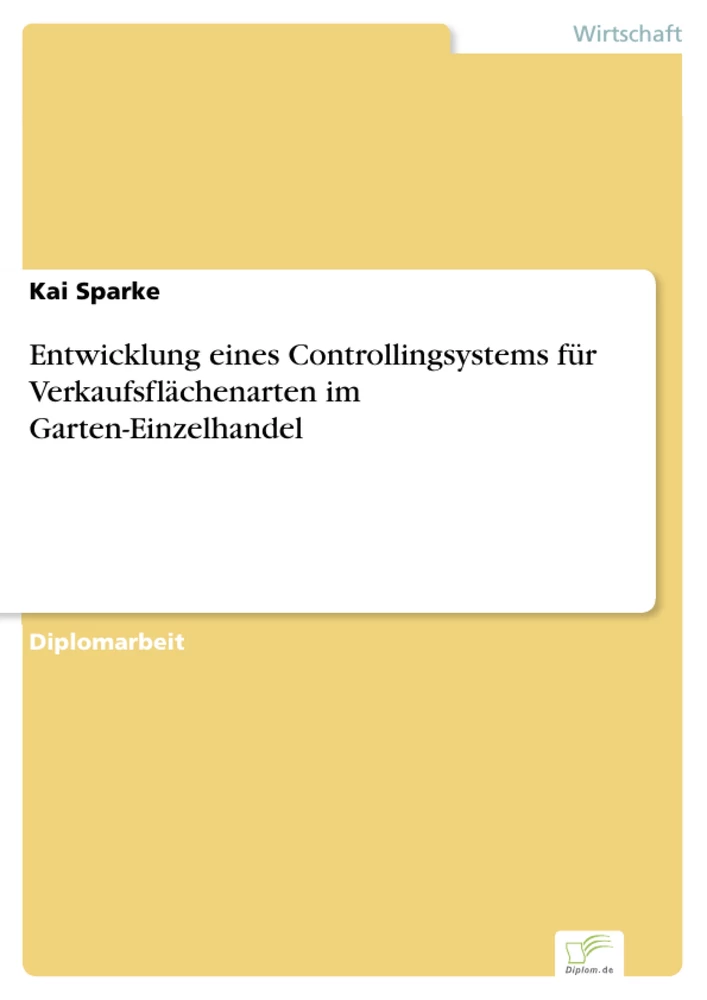Entwicklung eines Controllingsystems für Verkaufsflächenarten im Garten-Einzelhandel
©2004
Diplomarbeit
122 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Geschäfte wie Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter, die Pflanzen und andere Gartenartikel vertreiben, gliedern sich oftmals in mehrere Teilbereiche, die unterschiedlich gebaut oder ausgestattet sind. Diese verschiedenen Verkaufsflächenarten sind aufgrund der breit gefächerten klimatischen Ansprüche der Pflanzen nötig. Zimmerpflanzen brauchen warme und helle Standorte, Beet- und Balkonpflanzen benötigen Licht und Schutz vor Frost, für Gehölze sind Freilandbedingungen am besten. Daher gibt es Verkaufsflächenarten wie ein Warmhaus, ein Kalthaus oder ein Freigelände, und damit stellen Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter eine Besonderheit im Einzelhandel dar.
Die Kosten für den Verkaufsraum nehmen unter den gesamten Handlungskosten eines Einzelhandelsbetriebes stetig zu, weil etwa Personal durch Raum substituiert wird, oder trendbedingt die Verkaufsräume aufwendiger gestaltet werden. Die Unterteilung in Verkaufsflächenarten erhöht die Anforderungen an die Kontrolle der Raumkosten und das Raummanagement in Einzelhandelsgärtnereien und Gartencentern. Bislang sind diese Verkaufsflächenarten einzeln noch nicht ökonomisch analysier- und steuerbar. Dabei können sich zwei Verkaufsflächenarten wie das Warmhaus und das Freigelände in den von ihnen verursachten Kosten unterscheiden. Im Freigelände entstehen keine Abschreibungs- und Unterhaltskosten für Gebäude und keine Heizkosten. Genauso sind aber auch Unterschiede in den auf einer Verkaufsflächenart erwirtschafteten Leistungen möglich. Bei Regen und Kälte wird das Freigelände von Kunden weniger frequentiert als das Warmhaus, so dass dort die Umsätze geringer sind.
Ziel der Arbeit war es, ein Kennzahlensystem zu erstellen und eine entsprechende Anwendungsmethodik zu entwickeln, so dass Verkaufsflächenarten in ihren Kosten und auch Leistungen individuell überprüft und optimiert werden können. Die Entwicklung und methodische Arbeit stützte sich auf eine Literaturauswertung, die Resultate einer in sechs Betrieben durchgeführten Untersuchung und die Ergebnisse von Expertengesprächen mit den Betriebsleitern. Die Betriebsuntersuchung ergab u.a., dass die einzelnen Verkaufsflächenarten zeitlich ungleich lang genutzt werden, und dass zwischen den betrachteten Einzelhandelgärtnereien und Gartencentern Unterschiede in der Betriebsführung und Betriebsorganisation bestehen, beispielsweise in ihrer Größe, der Anwendung eines Warenwirtschaftssystems oder der bisherigen […]
Geschäfte wie Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter, die Pflanzen und andere Gartenartikel vertreiben, gliedern sich oftmals in mehrere Teilbereiche, die unterschiedlich gebaut oder ausgestattet sind. Diese verschiedenen Verkaufsflächenarten sind aufgrund der breit gefächerten klimatischen Ansprüche der Pflanzen nötig. Zimmerpflanzen brauchen warme und helle Standorte, Beet- und Balkonpflanzen benötigen Licht und Schutz vor Frost, für Gehölze sind Freilandbedingungen am besten. Daher gibt es Verkaufsflächenarten wie ein Warmhaus, ein Kalthaus oder ein Freigelände, und damit stellen Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter eine Besonderheit im Einzelhandel dar.
Die Kosten für den Verkaufsraum nehmen unter den gesamten Handlungskosten eines Einzelhandelsbetriebes stetig zu, weil etwa Personal durch Raum substituiert wird, oder trendbedingt die Verkaufsräume aufwendiger gestaltet werden. Die Unterteilung in Verkaufsflächenarten erhöht die Anforderungen an die Kontrolle der Raumkosten und das Raummanagement in Einzelhandelsgärtnereien und Gartencentern. Bislang sind diese Verkaufsflächenarten einzeln noch nicht ökonomisch analysier- und steuerbar. Dabei können sich zwei Verkaufsflächenarten wie das Warmhaus und das Freigelände in den von ihnen verursachten Kosten unterscheiden. Im Freigelände entstehen keine Abschreibungs- und Unterhaltskosten für Gebäude und keine Heizkosten. Genauso sind aber auch Unterschiede in den auf einer Verkaufsflächenart erwirtschafteten Leistungen möglich. Bei Regen und Kälte wird das Freigelände von Kunden weniger frequentiert als das Warmhaus, so dass dort die Umsätze geringer sind.
Ziel der Arbeit war es, ein Kennzahlensystem zu erstellen und eine entsprechende Anwendungsmethodik zu entwickeln, so dass Verkaufsflächenarten in ihren Kosten und auch Leistungen individuell überprüft und optimiert werden können. Die Entwicklung und methodische Arbeit stützte sich auf eine Literaturauswertung, die Resultate einer in sechs Betrieben durchgeführten Untersuchung und die Ergebnisse von Expertengesprächen mit den Betriebsleitern. Die Betriebsuntersuchung ergab u.a., dass die einzelnen Verkaufsflächenarten zeitlich ungleich lang genutzt werden, und dass zwischen den betrachteten Einzelhandelgärtnereien und Gartencentern Unterschiede in der Betriebsführung und Betriebsorganisation bestehen, beispielsweise in ihrer Größe, der Anwendung eines Warenwirtschaftssystems oder der bisherigen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 8235
Sparke, Kai: Entwicklung eines Controllingsystems für Verkaufsflächenarten
im Garten-Einzelhandel
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Technische Universität München, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
1
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung... 3
Darstellungsverzeichnis... 4
Abkürzungsverzeichnis... 5
Zusammenfassung ... 6
1. Einleitung... 9
1.1 Hinführung... 9
1.2 Problembeschreibung ... 10
1.2.1 Verkaufsraum... 10
1.2.2 Betriebstyp ... 12
1.3 Zielsetzung ... 13
1.4 Darlegung der Vorgehensweise... 13
1.4.1 Literaturarbeit ... 14
1.4.2 Expertengespräche und Betriebsuntersuchungen ... 14
1.4.3 Entwicklung des Zielsystems und der Methodik... 14
1.4.4 Bewertung ... 15
1.5 Kapitelergebnisse ... 15
2. Grundlagen ... 16
2.1 Der Gartenmarkt... 16
2.1.1 Der Einzelhandel mit Gartenartikeln... 16
2.1.2 Die Akteure Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter ... 17
2.2 Der Leistungsfaktor Raum im Einzelhandel ... 19
2.3 Verkaufsflächenarten im Einzelhandel... 22
2.3.1 Verkaufsflächenarten im gärtnerischen Einzelhandel ... 22
2.3.2 Besondere Verkaufsflächen im übrigen Einzelhandel ... 24
2.4 Untersuchungsbetriebe... 26
2.5 Kapitelergebnisse ... 29
3. Zielsystem... 31
3.1 Verkaufsflächenarten als Betrachtungsobjekte ... 31
3.2 Controlling als Instrumentarium für die Betrachtung... 31
3.3 Kennzahlensystem als detaillierte Betrachtungsebene ... 32
3.3.1 Zentrale Kennzahl Wirtschaftlichkeit ... 33
3.3.2 Outputgrößen ... 34
3.3.3 Inputgrößen... 36
3.3.4 Kennzahlen zur Ressourcennutzung... 41
3.4 Kapitelergebnisse ... 47
2
4. Einsatzbereiche... 48
4.1 Kosten- und Erlössteuerung der Verkaufsflächenarten ... 48
4.1.1 Management einer Verkaufsflächenart als "Control Center" ... 49
4.1.2 Einschränkungen durch Umfeld und Marketing... 51
4.2 Zeitnutzung einer Verkaufsflächenart ... 53
4.2.1 Zeitebenen der Nutzung... 54
4.2.2 Anwendung der Kennzahlen zur Zeitnutzung... 55
4.2.3 Potenziale einer besseren Zeitnutzung ... 56
4.3 Betriebsvergleich ... 58
4.3.1 Betriebsvergleiche als Informationsquellen ... 58
4.3.2 Einbindung des Kennzahlensystems in bestehende
Betriebsvergleiche... 60
4.3.3 Aussagekraft des Betriebsvergleiches ... 62
4.4 Investitionsfragen ... 63
4.4.1 Verfahren der Entscheidungsfindung bei Investitionsfragen ... 64
4.4.2 Einsatz des VFA-Kennzahlensystems bei Investitionsfragen... 66
4.5 Kapitelergebnisse ... 68
5. Methodik ... 69
5.1 Ermittlung der Strukturdaten ... 69
5.2 Ermittlung der Outputgrößen... 70
5.2.1 Problemformulierung ... 71
5.2.2 Lösungsansatz für Gartencenter ... 72
5.2.3 Lösungsansatz für Einzelhandelsgärtnereien... 77
5.3 Inventurdaten ... 80
5.4 Ermittlung der Inputgrößen... 81
5.4.1 Fixe Kosten ... 82
5.4.2 Variable Kosten... 84
5.5 Kapitelergebnisse ... 88
5.6 Modellrechnung ... 89
6. Diskussion ... 91
6.1 Exkurs: Open-Sky-Gewächshäuser... 91
6.2 Abschätzung der Praxistauglichkeit ... 93
6.2.1 Eigene Bewertung... 93
6.2.2 Bewertung der Betriebsleiter ... 94
6.3 Abschätzung des Realisierungspotentials ... 96
6.4 Kapitelergebnisse ... 97
Anhangsverzeichnis ... 98
Literaturverzeichnis ... 115
3
Vorbemerkung
Die Idee für diese Arbeit entstand aus einem Prüfungsgespräch heraus sowie vor
dem Hintergrund einer eigenen Tätigkeit in einem Gartencenter und entwickelte sich
dann zu einem Konzept.
Die Umsetzung wäre ohne die bereitwilligen Auskünfte der Betriebsleiter nicht mög-
lich gewesen. Der Autor dankt Frau Bayerstorfer (Eching), Frau Böhner-Henning
(Freising), Herrn Dierheimer (Rain am Lech), Herrn Ferchl (Peißenberg), Herrn
Scherdi (Hofstetten) und Herrn Wehking (München) herzlich für die Zeit, die sie sich
genommen haben, für die Informationen, Hinweise und Bewertungen.
Im Anhang 6 ist die Konzeption der Arbeit in einer knappen Übersicht dargestellt.
Zudem findet sich dort ein Abkürzungsverzeichnis. Ausgeklappt kann der Anhang 6
beim Lesen die Einordnung des jeweiligen Abschnittes in den Gesamtzusammen-
hang und das Verständnis der abgekürzten Begriffe erleichtern.
Eigene inhaltliche Festlegungen und Definitionen sind kursiv gehalten. In den Fuß-
noten des Textes finden sich nur Kurzbelege der zitierten Quellen, sie sind im Lite-
raturverzeichnis vollständig aufgeführt.
4
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1: Verkaufsraum und Betriebstyp im gärtnerischen
Einzelhandel... 10
Darstellung 2: Vorgehensweise bei der Themenbearbeitung ... 13
Darstellung 3: Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter in der
Betriebstypensystematisierung des Einzelhandels... 18
Darstellung 4: Verkaufsflächenarten im Garten-Einzelhandel ... 23
Darstellung 5: Besondere Teilbereiche in Verkaufsstätten des
Einzelhandels... 26
Darstellung 6: Ergebnisse der Betriebsuntersuchungen ... 30
Darstellung 7: Kostenpositionen der Verkaufsflächenarten ... 41
Darstellung 8: Kapitalbindung im Warenbestand einer
Verkaufsflächenart ... 44
Darstellung 9: Kennzahlensystem zum Controlling einer
Verkaufsflächenart ... 46
Darstellung 10: Die Verkaufsflächenarten als Organisationseinheiten im
Handelsbetrieb... 51
Darstellung 11: Anwendung der Kennzahlen zur Zeitnutzung... 55
Darstellung 12: Warenprozesse im GEH mit Bedeutung für die
Outputermittlung ... 71
Darstellung 13: Sortimentspyramide... 74
Darstellung 14: Saisonale Abweichungen bei der VFA-Zuordnung durch
Zweitplatzierung einer Warengruppe ... 76
Darstellung 15: Methodik zur Outputzuordnung in einer
Einzelhandelsgärtnerei... 79
Darstellung 16: Anleitung zur Realisierung des Kennzahlensystems .. 87
5
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungen für Begriffe, die nicht allgemein gebräuchlich sind:
BHS Betriebshandelsspanne
EHG Einzelhandelsgärtnerei
GC Gartencenter
GEH Garten-Einzelhandel
K Kennzahl
OSG Open-Sky-Gewächshaus
VFA Verkaufsflächenart
WWS Warenwirtschaftssystem
Zusammenfassung
6
Zusammenfassung
Geschäfte wie Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter, die Pflanzen und andere
Gartenartikel vertreiben, gliedern sich oftmals in mehrere Teilbereiche, die unter-
schiedlich gebaut oder ausgestattet sind. Diese verschiedenen Verkaufsflächenar-
ten sind aufgrund der breit gefächerten klimatischen Ansprüche der Pflanzen nötig.
Zimmerpflanzen brauchen warme und helle Standorte, Beet- und Balkonpflanzen
benötigen Licht und Schutz vor Frost, für Gehölze sind Freilandbedingungen am
besten. Daher gibt es Verkaufsflächenarten wie ein Warmhaus, ein Kalthaus oder
ein Freigelände, und damit stellen Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter eine
Besonderheit im Einzelhandel dar.
Die Kosten für den Verkaufsraum nehmen unter den gesamten Handlungskosten
eines Einzelhandelsbetriebes stetig zu, weil etwa Personal durch Raum substituiert
wird, oder trendbedingt die Verkaufsräume aufwendiger gestaltet werden. Die Unter-
teilung in Verkaufsflächenarten erhöht die Anforderungen an die Kontrolle der
Raumkosten und das Raummanagement in Einzelhandelsgärtnereien und Garten-
centern. Bislang sind diese Verkaufsflächenarten einzeln noch nicht ökonomisch
analysier- und steuerbar. Dabei können sich zwei Verkaufsflächenarten wie das
Warmhaus und das Freigelände in den von ihnen verursachten Kosten unterschei-
den. Im Freigelände entstehen keine Abschreibungs- und Unterhaltskosten für Ge-
bäude und keine Heizkosten. Genauso sind aber auch Unterschiede in den auf ei-
ner Verkaufsflächenart erwirtschafteten Leistungen möglich. Bei Regen und Kälte
wird das Freigelände von Kunden weniger frequentiert als das Warmhaus, so dass
dort die Umsätze geringer sind.
Ziel der Arbeit war es, ein Kennzahlensystem zu erstellen und eine entsprechende
Anwendungsmethodik zu entwickeln, so dass Verkaufsflächenarten in ihren Kosten
und auch Leistungen individuell überprüft und optimiert werden können. Die Ent-
wicklung und methodische Arbeit stützte sich auf eine Literaturauswertung, die Re-
sultate einer in sechs Betrieben durchgeführten Untersuchung und die Ergebnisse
von Expertengesprächen mit den Betriebsleitern. Die Betriebsuntersuchung ergab
u.a., dass die einzelnen Verkaufsflächenarten zeitlich ungleich lang genutzt werden,
und dass zwischen den betrachteten Einzelhandelgärtnereien und Gartencentern
Unterschiede in der Betriebsführung und Betriebsorganisation bestehen, beispiels-
weise in ihrer Größe, der Anwendung eines Warenwirtschaftssystems oder der bis-
herigen Controllingerfahrung. Auf diese Unterschiede wurde bei der Entwicklung
des Controllingsystems Rücksicht genommen.
Im Zentrum des Kennzahlensystems steht die Wirtschaftlichkeit als Beziehung zwi-
schen Output und Input. Als Outputgröße wird die auf einer Verkaufsflächenart er-
Zusammenfassung
7
wirtschaftete Betriebshandelsspanne herangezogen. Den Input stellen die Kosten
dar, die Erstellung und Betrieb einer Verkaufsflächenart verursachen. Sie unterteilen
sich in fixe und variable Kosten und umfassen Positionen wie Abschreibungen, Re-
paraturen und Heizkosten. Die Kennzahl Wirtschaftlichkeit liefert eine komprimierte
Aussage über die Effizienz einer Verkaufsflächenart und über den von ihr erbrach-
ten Beitrag zum Erfolg des gesamten Betriebes. Hinzu kommen Kennzahlen, die die
Verwendung betrieblicher Ressourcen durch eine Verkaufsflächenart beschreiben.
Flächenproduktivitäten und Kennwerte zur zeitlichen Nutzbarkeit und Nutzung lie-
fern Erkenntnisse darüber, wie effizient Einsatzfaktoren wie Fläche, Zeit oder Kapital
von einer Verkaufsflächenart in Anspruch genommen werden.
Das Kennzahlensystem bietet mehrere Einsatzmöglichkeiten. Die Verkaufsflächen-
arten können als eigenständige Organisationseinheiten hinsichtlich Output und Input
individuell kontrolliert und dementsprechend dann optimiert werden. Die aus der
Kennzahlenanalyse resultierenden Managementempfehlungen müssen allerdings
mit den zum Teil konträren Erkenntnissen aus dem Verkaufsraummarketing abge-
stimmt werden, die z.B. aus Analysen der Kundenlaufwege im Geschäft stammen.
Durch Einbindung des Kennzahlensystems in einen Betriebsvergleich können die
Betriebe anhand von Durchschnitts- und Bestwerten die Stärken und Schwächen ih-
rer Verkaufsflächenarten abschätzen und Handlungsempfehlungen ableiten. Pläne
für Neuerstellungen oder Erweiterungen einer Verkaufsflächenart können sich auch
auf Informationen aus dem Controlling der Verkaufsflächenarten stützen.
Die Datengenerierung und Datenaufbereitung für die Kennzahlenberechnung sollte
für beide betrachteten Betriebstypen möglichst einheitlich erfolgen, um die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Als Basisinformationen für die Me-
thodik werden die festgelegten verschiedenen Verkaufsflächenarten mit ihren Flä-
chengrößen und Nutzungszeiten sowie der Betriebsdurchschnittlohn benötigt. Letz-
terer dient zur Bewertung von Reinigungs- und Dekorationsarbeiten auf einer Ver-
kaufsflächenart. Die Outputermittlung erfolgt für Gartencenter und Einzelhandels-
gärtnereien auf unterschiedliche Arten, da diese beiden Betriebstypen in ihren Da-
tengrundlagen und Datenverarbeitungssystemen nicht gleich fortschrittlich sind.
Die erste Möglichkeit zur Ermittlung des Outputs kombiniert die Sortimentsgliede-
rung im Warenwirtschaftssystem mit den Verkaufsflächenarten. Artikelgruppen er-
halten in der EDV einen Vermerk über ihren Standort in der Verkaufsstätte, und ihre
Umsätze können dann einer Verkaufsflächenart zugewiesen werden. Ausnahmen
von diesem System treten auf, wenn in der Frühjahrssaison Artikelgruppen aus dem
Pflanzenbereich aus Platz- und Mengengründen auf mehreren Verkaufsflächenarten
positioniert werden. Sie können über eine individuell geeignete Erfassung berück-
sichtigt werden.
Zusammenfassung
8
Für Betriebe ohne Warenwirtschaftssystem, die bislang nur ein Warengruppencont-
rolling betreiben, wird die bestehende Umsatzzuordnung über die Kassentastatur
um die Information zum Standort des Artikels erweitert. Hinzu kommt eine Doku-
mentation der Flächenbeschickung, die die Zuweisung der Waren mit ihren
Einstandswerten zu den jeweiligen Verkaufsflächenarten vermerkt. Aus beiden In-
formationen lässt sich dann die Betriebshandelsspanne ableiten. Daten zu Lagerbe-
standsveränderungen, die für die Berechnung der Betriebshandelsspanne benötigt
werden, können bei der Inventur erhoben werden.
Auf der Inputseite werden die Verkaufsflächenarten als Kostenstellen angesehen
und ihnen die Kostenpositionen aus der Finanzbuchführung und anhand von be-
trieblichen Aufzeichnungen zugewiesen. Falls eine direkte Zuordnung nicht möglich
ist, erfolgt die Aufteilung der Kosten über geeignete Schlüsselgrößen wie die Fläche
oder andere Verteilungsverfahren.
Schließlich wurden das Kennzahlensystem und die Anwendungsmethodik kritisch
bewertet sowie den Betriebsleitern vorgestellt und von ihnen ebenfalls beurteilt.
Daraus ließ sich dann ein Realisierungspotential des Controllingsystems in der be-
trieblichen Praxis abschätzen. Aus eigener Sicht ist das Controllingsystem mit be-
grenztem Aufwand realisierbar. Die Betriebsleiter monierten hauptsächlich den Auf-
wand für die laufenden Aufzeichnungen, die Methodiken selbst seien aber praktika-
bel. Erste Realisierungsmöglichkeiten können sich in größeren Gartencenterketten
ergeben. Dort kann das Kennzahlensystem für einen Filialvergleich oder als Ent-
scheidungshilfe bei der Gestaltung neuer Einkaufsstätten benutzt werden.
Letztendlich unterliegt die Einführung des Controllingsystems selbst auch einer Kos-
ten-Nutzen-Analyse. Zudem ist seine Aussagekraft wegen fehlender empirischer
Ergebnisse noch nicht bekannt. Nächste Schritte nach dieser Arbeit sollten Veröf-
fentlichungen in Fachzeitschriften und die Kontaktaufnahme zu Verbänden, Bera-
tern und Filialunternehmen sein, um das Controllingsystem bekannt zu machen.
Einleitung
9
1. Einleitung
1.1 Hinführung
Ein Einkauf in einem Gartencenter unterscheidet sich von jenem in einem Waren-
haus, ein Bummel durch eine Gärtnerei ist anders als in einem Bekleidungsladen.
Das kann sicherlich an der andersartigen Einkaufsatmosphäre liegen, die wohl vor
allem durch die angebotenen Pflanzen geschaffen wird. Assoziationen zum heimi-
schen Garten, zur angenehmen Freizeit und zum erholsamen Urlaub können ent-
stehen.
Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Manchmal scheint einem beim Einkauf die
Sonne ins Gesicht, dann wiederum kann man vielleicht auch nassgeregnet werden
oder frieren. Eine Besonderheit von Einkaufsstätten wie Gartencentern und Gärtne-
reien liegt in der Art, Bauweise und Ausstattung der Verkaufsflächen. Es gibt warme
Räume, unbeheizte Glashäuser, überdachte Flächen oder auch einfach nur ein frei-
es Gelände.
Die Ursachen liegen bei den präsentierten Pflanzen als wichtigste Artikel, die von
der Zimmergrünpflanze über die blühende Balkonpflanze bis zum Gehölz unter-
schiedliche klimatische Ansprüche haben. Diesen Ansprüchen wird durch entspre-
chend angepasste bauliche und technische Maßnahmen Rechnung getragen. Im
-
Anhang 1 finden sich Beispiele für unterschiedliche Teilbereiche in den Gartencen-
tern oder Gärtnereien.
Wie aber sehen die daraus folgenden ökonomischen Konsequenzen aus, beispiels-
weise hinsichtlich der Investitionen oder Unterhaltskosten? Wie kann die Führung
eines solchen Unternehmens mit diesen Besonderheiten umgehen, und auf welche
Informationen soll dabei zurückgegriffen werden? Aus Äußerungen von Betriebslei-
tern und Unternehmern lässt sich auf ein Bewusstsein bezüglich der verschiedenen
Flächenarten schließen, wenn etwa die Kalthalle als umsatzstärkster Bereich ge-
nannt wird
1
, oder wenn geschildert wird, das temperierte Haus werde von den meis-
ten Betrieben unterschätzt
2
. Bislang jedoch erfolgt noch kaum ein darauf bezogenes
Handeln.
Diese Arbeit soll es dem Management von Gärtnereien und Gartencentern ermögli-
chen, zukünftig fundierte Entscheidungen zu den unterschiedlichen Verkaufsflä-
chenarten treffen und mit den Besonderheiten in der eigenen Verkaufsstätte be-
wusster umgehen zu können.
1
Scherdi, mündliche Auskunft, 2003.
2
Wehking, mündliche Auskunft, 2003.
Einleitung
10
Zunächst erfolgt eine Beschreibung und Abgrenzung des Problems, daraus wird die
Zielsetzung formuliert und die Vorgehensweise bei der Bearbeitung erläutert. Auf-
bauend auf der Darlegung der theoretischen Grundlagen und der Informations-
sammlung und -verarbeitung wird ein Instrumentarium entwickelt, das die Betriebe
anwenden könnten.
1.2 Problembeschreibung
Darstellung 1 zeigt die beiden hinsichtlich der Problemstellung existierenden Di-
mensionen Verkaufsraum und Betriebstyp und bietet zugleich eine knappen Über-
blick über den Einzelhandelsmarkt für Schnittblumen, Zierpflanzen und sonstige
Gartenartikel.
Darstellung 1: Verkaufsraum und Betriebstyp im gärtnerischen Einzelhandel
Quelle: eigene Darstellung
Verkaufsraum
Bet
ri
ebsty
p
Verkaufsfläche,
Gesamtumsatz
Eine Verkaufsflächenart... ...mehrere Verkaufsflächenarten
Verbraucher-
markt
Gartencenter
Blumengeschäft
Discounter
Einzelhandels-
gärtnerei
Verkaufsraum
Bet
ri
ebsty
p
Verkaufsfläche,
Gesamtumsatz
Eine Verkaufsflächenart... ...mehrere Verkaufsflächenarten
Verbraucher-
markt
Gartencenter
Blumengeschäft
Discounter
Einzelhandels-
gärtnerei
1.2.1 Verkaufsraum
Der Verkauf von Schnittblumen, Zierpflanzen, Gehölzen und Stauden an die
Verbraucher erfolgt auf unterschiedlichen Wegen. Dabei haben Läden eine große
Bedeutung, also Unternehmen mit für den Verkauf vorgesehenen Räumlichkeiten.
Dieser stationäre Einzelhandel bezieht seine Waren von Gärtnereien, Baumschulen
und Staudengärtnereien aus Deutschland oder dem Ausland oder auch über dazwi-
Einleitung
11
schengeschaltete Großhandelsbetriebe und ist somit der Mittler zwischen Produzen-
ten und Konsumenten von Zierpflanzen.
In gärtnerischen Produktionsbetrieben sind die Einsatzfaktoren leicht ersichtlich.
Beispielsweise entsteht aus einer Jungpflanze, Substrat, einem Topf, Dünger usw.,
eutung des Verkaufsraumes zunehmend. Nach dem Personal ist er
der zweitwichtigste Kostenfaktor eines Unternehmens, und in den Handelsbetrieben
Betrachtung des Faktors Raum immer wichtiger.
Ist etwa dieser Raum zu klein gewählt, ergeben sich Beschränkungen im Sortiment,
andere Garten-
artikel ist, wie etwa in den Einzelhandelsgärtnereien (im Folgenden kurz: EHG) und
durch menschliche Arbeit, die Zuführung von Wärme und die Nutzung eines Ge-
wächshauses und von Maschinen als absetzbares Produkt eine Topfpflanze. Im
Handel gibt es andersgeartete Einsatzfaktoren als in der Produktion, die zur Erbrin-
gung einer Verkaufsleistung beitragen. Dies sind vor allem die Ware, das Personal
und der Raum
3
.
Dabei ist die Bed
nimmt der Raumbedarf zu. Personal wird mehr und mehr durch Raum substituiert,
da die Personalkosten vergleichsweise stärker steigen als die Raumkosten
4
. Außer-
dem ist ein relativer Anstieg der Handlungskosten, also der Kosten neben jenen für
den Wareneinsatz, an den Gesamtkosten eines Handelsbetries zu beobachten
5
.
Zum einen steigen also die Handlungskosten insgesamt an, zum zweiten wachsen
darin die Anteile der Raumkosten.
Demzufolge wird die ökonomische
in den Mengen der Artikel und in der Präsentation, bei zu großer Dimensionierung
sind überhöhte laufende Kosten und eine übersteigerte Lagerhaltung die Folge
6
.
Entscheidungen im Hinblick auf den Leistungsfaktor Raum sind zumeist mittel- bis
langfristig, da der Raum kurzfristig nicht veränderbar ist. Weitere Beweggründe für
eine stärkere Beachtung der Wirtschaftlichkeitsaspekte bezüglich des Verkaufsrau-
mes und seiner Gestaltung sind ein sich wandelndes Konsumentenverhalten, der
Trend zum Erlebnishandel, Wettbewerbsverschärfungen im Markt oder auch tech-
nologische Innovationen
7
. Als Beispiel können die Open-Sky-Gewächshäuser ge-
nannt werden, die eine aufwendigere technische Ausstattung als herkömmliche
Verkaufsgewächshäuser haben und dementsprechend teurer sind
8
.
Der Verkaufsraum in den Einzelhandelsgeschäften für Pflanzen und
3
Falk und Wolf, Handelsbetriebslehre, 1992, S. 13.
4
Falk und Wolf, Handelsbetriebslehre, 1992, S. 87.
5
Müller-Hagedorn, Handel, 1998, S. 602f.
6
Falk und Wolf, Handelsbetriebslehre, 1992, S. 95.
7
Ackermann, Ladengestaltung, 1997, S. 3.
8
Vgl. Kapitel 6.1 (Exkurs).
Einleitung
12
Gartencentern (im Folgenden kurz: GC), oftmals in einzelne Verkaufsflächenarten
(im Folgenden kurz: VFA) unterteilt. Diese Geschäfte sollen in der Arbeit betrachtet
werden. Weitere Pflanzen und Blumen verkaufende Geschäftstypen wie Floristiklä-
den, Lebensmittelgeschäfte oder Verbrauchermärkte verfügen in der Regel nur über
eine VFA und werden daher im weiteren Verlauf nicht behandelt.
Bereits auf den ersten Blick sehen die VFA höchst unterschiedlich aus und scheinen
daher auch unterschiedlich hohe Kosten zu verursachen. Im Freigelände fehlt die
Betriebstyp
ngsobjekten EHG und GC sind Unterschiede zu verzeich-
leich auch Ei-
s Zielsystems.
Aufgrund der Größenunterschiede haben die EHG auf der einen und die GC auf der
h einen gewissen Anteil an Ware aus Eigen-
produktion in ihrem Sortiment. Dies wirkt sich etwa auf die Heranziehung von Wa-
Überbauung und demzufolge auch die daraus entstehenden Kosten, Kalthallen
werden oft nicht beheizt und verursachen daher auch keine Heizkosten. Bei einer
Betrachtung der Leistungen sind die Unterschiede zunächst weniger deutlich aus-
zumachen. Es ist vorstellbar, dass VFA wie die Kalthalle oder das Freigelände, in
denen sich im Frühjahr viele Kunden aufhalten, dann als umsatzstark eingeschätzt
werden. Im Winter werden sie jedoch kaum frequentiert oder sind sogar geschlos-
sen.
1.2.2
Zwischen den Betrachtu
nen. So sind in den EHG häufiger als in den GC die Betriebsleiter zug
gentümer. In der Regel gibt es zwischen beiden Betriebstypen auch Größenunter-
schiede, die zum Beispiel im Sortiment, in der Verkaufsfläche oder im Gesamtum-
satz deutlich werden
9
. Für die Bearbeitung des Themas und die Realisierung des
obigen Zielsystems sind diese Differenzen nicht bedeutsam.
Allerdings haben weitere Unterschiede Einfluss auf die Konzeption de
anderen Seite verschiedene Voraussetzungen, auf denen ein angestrebtes Control-
linginstrumentarium für VFA realisiert werden kann. So sind in den GC zumeist ge-
schlossene elektronische Warenwirtschaftssysteme vorhanden, und diese Betriebe
verfügen im Gegensatz zu den EHG eher über ein existierendes Controlling, wie es
im Einzelhandel allgemein üblich ist
10
.
Des Weiteren haben EHG oftmals noc
reneinstandskosten aus. Zudem muss der Verkauf solcher Artikel direkt aus dem
Produktionsgewächshaus heraus bei der Zugrundelegung der Flächengröße einer
VFA berücksichtigt werden.
9
Vgl. Kapitel 2.1 (Gartenmarkt).
10
Vgl. Kapitel 2.4 (Untersuchungsbetriebe).
Einleitung
13
1.3 Zielsetzung
Es soll ein Controllingsystem entwickelt werden, mit dem einzelne VFA in Geschäf-
ndels (im Folgenden auch kurz: GEH) analysiert, kontrol-
liert, gesteuert und geplant werden können. Dabei sollen alle wesentlichen Größen
Die Bearbeitung des Themas mit der Schaffung eines Controllingsystems für Betrie-
ischer Ansätze stufenweise
und aufeinander aufbauend. Die Darstellung 2
ten des Garten-Einzelha
auf der Kostenseite, der Leistungsseite und auch aus den Strukturdaten berücksich-
tigt werden, die mit dem Leistungsfaktor Raum im Einzelhandel verknüpft sind. Die
Konzeption und Beschreibung dieses Controllingsystems erfolgt im Kapitel 3 (Ziel-
system). Das Controllingsystem für VFA soll in den beiden betrachteten Betriebsty-
pen EHG und GC einsetzbar sein. Bei Unterschieden zwischen EHG und GC in den
Voraussetzungen sollen für die Betriebstypen individuelle Lösungen entwickelt und
vorgeschlagen werden, die gleichermaßen eine Realisierung des Systems ermögli-
chen. Die betriebstypischen Umsetzungsmöglichkeiten werden in Kapitel 5 (Metho-
dik) behandelt.
1.4 Darlegung der Vorgehensweise
be des GEH erfolgte unter Einbezug mehrerer method
zeigt den Ablauf und die Zusammen-
hänge bei der Vorgehensweise.
Darstellung 2: Vorgehensweise bei der Themenbearbeitung
Quelle: eigene Darstellung
Literatur
Bewertung
durch Experten
Eigene Bewertung
Abschätzung der
Praxistauglichkeit
Experten
Eigenes
Know-How
Zielsystem
Methodik
Einsatzgebiete
+
+
Literatur
Bewertung
durch Experten
Eigene Bewertung
Abschätzung der
Praxistauglichkeit
Experten
Eigenes
Know-How
Zielsystem
Methodik
Einsatzgebiete
+
+
Literatur
Bewertung
durch Experten
Eigene Bewertung
Abschätzung der
Praxistauglichkeit
Experten
Eigenes
Know-How
Zielsystem
Methodik
Einsatzgebiete
+
+
Zielsystem
Zielsystem
Methodik
Methodik
Einsatzgebiete
Einsatzgebiete
+
+
Einleitung
14
1.4.1 Literaturarbeit
Die theoretischen Grundlagen wurden aus der einschlägigen Literatur erarbeitet.
Lehrbücher und Aufsätze aus der Handelsbetriebslehre dienten als Quellen für den
gespräche und Betriebsuntersuchungen
etrieben
und zudem einen vergleichenden Überblick über die verschiedenen Betriebstypen in
ng des Zielsystems und der Methodik
n Handels-
betrieben und zur Bedeutung des Leistungsfaktors Verkaufsraum sowie der aus den
d wurden für die beiden wichtigen Betriebstypen EHG und GC individu-
elle Lösungen erarbeitet, um das Zielsystem dort installieren und betreiben zu kön-
Bereich des Leistungsfaktors Raum im Einzelhandel, für die Betriebstypisierung so-
wie für das Marketing. Hinzu kamen Literatur zur Kostenrechnung, Finanzbuchhal-
tung und zum allgemeinem Controlling. Statistiken lieferten Daten zum Gartenmarkt.
Branchenspezifische Informationen zum Gartenbaubereich wurden aus der entspre-
chenden Literatur zu den Bereichen Technik, Gewächshausbau oder Betriebsfüh-
rung entnommen.
1.4.2 Experten
Um einen Einblick in Gegebenheiten und Strukturen von Einzelhandelsb
der Gartenbranche zu erhalten, wurden einzelne Betriebe ausgewählt, besichtigt
und die Betriebsleitungen in leitfadengebundenen Expertengesprächen befragt. Bei
der Auswahl wurde darauf geachtet, alle wichtigen Betriebstypen zu berücksichti-
gen. Die Ergebnisse der Untersuchung und Befragung sind zwar nicht repräsentativ,
stellen aber einen guten Branchenquerschnitt dar und eignen sich somit, die Metho-
dik zur Realisierung des Zielsystems so zu gestalten, dass alle Betriebe diese an-
wenden können.
1.4.3 Entwicklu
Anhand der aus der Literatur erarbeiteten Grundlagen zum Controlling i
Expertengesprächen gewonnenen Informationen über bestehende betriebliche
Controllinginstrumente wurde das Zielsystem konzipiert. Dabei flossen auch eigene
Erfahrungen aus der Tätigkeit in einem Gartencenter und sonstige aus dem Bereich
Gartenbau vorhandene Kenntnisse ein. In das Controllingsystem münden somit In-
formations- und Wissensströme aus verschiedenen Quellen. Ziel war eine für das
Management sinnvolle Verknüpfung aussagekräftiger Kennzahlen. Um den Nutzen
des Kennzahlensystems zu verdeutlichen, wurden mehrere Anwendungsbereiche
aufgezeigt.
Anschließen
nen. Die Erstellung eines Musters der praktischen Vorgehensweise und eines Kal-
kulationsschemas mit konkreten Beispieldaten und -ergebnissen soll der Veran-
schaulichung und als Vorbild für die betriebliche Anwendung dienen.
Einleitung
15
1.4.4 Bewertung
Schließlich wurden die wichtigsten Kennzahlen des Controllingsystems und insbe-
nindividuellen Methodiken zur Realisierung den Betriebslei-
tern als Experten vorgestellt und von ihnen hinsichtlich der Praxistauglichkeit, der
EHG und GC unterteilen sich in verschiedene Verkaufsflächenarten.
noch nicht ökonomisch analysier- und steu-
ide Be-
triebstypen anwenden können.
owie seine Einsatzgebiete und die Methodik
zur Realisierung erarbeitet und anschließend kritisch betrachtet.
sondere die betriebstype
Qualität der zu gewinnenden Daten und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bewertet.
Dazu kam eine eigene kritische Beurteilung, auch bezüglich der diversen Einsatz-
möglichkeiten des Controllingsystems. Aus dem Vergleich der eigenen Bewertung
mit jener der Praktiker aus den Betrieben wurde dann das Potential einer wirklichen
Einführung des Kennzahlensystems in der betrieblichen Praxis der Handelsunter-
nehmen oder auf anderen Feldern abgeschätzt.
1.5 Kapitelergebnisse
Bislang sind diese VFA einzeln
erbar. Hierfür soll ein Kennzahlensystem entwickelt werden, das be
Durch Literaturrecherche, Expertengespräche und eigene Kenntnisse wer-
den dieses Controllingsystem s
Grundlagen
16
2. Grundlagen
2.1 Der Gartenmarkt
2.1.1 Der Einzelhandel mit Gartenartikeln
Unter dem Gartenmarkt soll ein Markt auf der Einzelhandelsstufe mit den Kernarti-
keln Blumen und Zierpflanzen verstanden werden. Hinzu kommen die weiteren zum
Bereich des Gartenbedarfs gehörenden Sortimente. Das Marktvolumen setzt sich
aus den Warenumsätzen ohne spezielle gärtnerische Dienstleistungen zusammen.
Dieser Markt umfasst hauptsächlich Artikel aus dem Freizeitbereich, obwohl bei-
spielsweise Waren wie Obststräucher oder Gemüsesamen auch der Versorgung der
Konsumenten zugeordnet werden können. Die meisten Produkte dienen allerdings
nicht der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Verbraucher. Die Existenz eines
solchen freizeitorientierten Konsumbereiches, wie es der Gartenmarkt ist, deutet
daher auf einen gewissen Wohlstand einer Gesellschaft hin.
Das Marktvolumen wird für das Jahr 2003 voraussichtlich etwa 11,6 Milliarden Euro
betragen, im Jahr 1998 waren es noch ca. 10,6 Milliarden Euro
11
, und 1993 betrug
es 9,5 Milliarden Euro
12
. Aus den soziodemographischen Entwicklungen wie einem
überproportionalen Anwachsen der älteren Bevölkerung, einer zunehmenden Le-
benserwartung und einer Zunahme der kleineren Haushalte
13
ergeben sich Trends,
denen der GEH unterworfen ist. Das sind die Betonung der Individualität, mehr akti-
ve ältere Konsumenten, kleiner werdende Gartenflächen oder Cocooning, das ein
Zurückziehen der Menschen in die eigene Häuslichkeit meint. Seit Mitte der Neunzi-
ger Jahre ist eine nachlassende Dynamik im Markt festzustellen, die Wachstumsra-
ten nehmen ab und liegen im Durchschnitt bei 1,5% bis 2,0%. Die Ursachen liegen
in einer allgemeinen Konsumflaute, in Preiskämpfen unter den Herstellern und an
einem Preisdruck im Handelsbereich durch das Auftreten neuer Mitbewerber wie
dem Lebensmittel-Einzelhandel oder den Baumärkten. Blumenfachgeschäfte und
EHG mussten dabei Marktanteilsverluste hinnehmen, während GC im Filialbetrieb
oder an Baumärkte angegliedert zulegen konnten
14
.
Die bedeutendste Warengruppe ist der Bereich Grün mit Pflanzen und Blumen für
das Zimmer und den Außenbereich, der im Jahr 1998 65,9% des Gesamtumsatzes
ausmachte. Mit deutlich geringeren Anteilen folgen die Bereiche Gartenausstattung
11
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 3 und S. 7, eigene Umrechnung auf Euro-Werte.
12
o.V., Skepsis auf Gartenmarkt, 1997, eigene Umrechnung auf Euro-Werte.
13
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 13ff.
14
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 2 und S. 4ff.
Grundlagen
17
mit 18,6%, der Gartenmöbel, Teichzubehör und Gartenholz umfasst, Gartengeräte
mit 10,7% und biologisch-chemischer Gartenbedarf mit 4,8%. Hierunter sind etwa
Substrate, Dünge- und Pflanzenschutzmittel einzuordnen
15
. Die Pflanzen sind also
die Kernartikel im Gartensortiment.
Handel im funktionellen Sinne meint die Beschaffung von Gütern von anderen
Marktteilnehmern und den Absatz an Dritte, zumeist ohne weitere Be- oder Verar-
beitung. Institutionen, die sich ausschließlich oder überwiegend dieser Tätigkeit
widmen, werden als Handelsunternehmungen oder Handelsbetriebe bezeichnet.
Einzelhandel liegt vor, wenn der Handelsbetrieb seine Waren an private Haushalte
absetzt
16
. Die Aufgabe des Handels ist die Überbrückung der Distanz vom Produ-
zenten zum Konsumenten. Als Entgelt für seine Tätigkeit erhält der Handel die Dist-
ributionsspanne. Sie stellt die Differenz zwischen dem Einkaufspreis des Konsu-
menten und dem Verkaufspreis des Produzenten dar
17
.
Die Akteure im Einzelhandel mit Blumen und Pflanzen sind der Blumen-Fachhandel,
die Einzelhandelsgärtnereien, Marktstände, Gartencenter, Garten-Baumschulen,
Baumärkte, Warenhäuser, Supermärkte und Discounter. Sie stellen die letzte Stufe
vor den Endverbrauchern in der Distribution von Zierpflanzen dar
18
. Die beiden Be-
triebstypen EHG und GC, die mit ihren unterschiedlichen VFA Gegenstand dieser
Arbeit sind und im weiteren Verlauf noch genauer charakterisiert werden, haben an
den Umsätzen der Warengruppe Grün einen Anteil von knapp 30%.
2.1.2 Die Akteure Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter
Bei den Einzelhandelsgärtnereien gibt es fließende Übergänge zu den Blumen-
fachgeschäften und den Garten-Baumschulen. Die Pflanzen sind mit einem Um-
satzanteil von 70% noch deutlicher als im Branchendurchschnitt der wichtigste Wa-
renbereich
19
. Hinzu kommt ein Sortiment, das Gefäße, Substrate und ähnliche un-
mittelbar mit der Pflanze in Beziehung stehende Artikel umfasst
20
. Weitere Kennzei-
chen sind ein gewisser Anteil an Pflanzen aus eigener Produktion und ein Angebot
an Dienstleistungen wie beispielsweise Grabpflege oder Überwinterungsservice für
Kübelpflanzen. In Deutschland gibt es etwa 4.000 EHG, von denen drei Viertel Mit-
gliedsbetriebe des Bundesverbandes Einzelhandelsgärtner im Zentralverband
Gartenbau sind
21
.
15
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 3.
16
Ausschuss für Begriffsdefinitionen, Katalog E, 1995, S. 28 und S. 41.
17
o.V., Gabler Wirtschaftslexikon, 1988, Sp. 1280.
18
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 9.
19
Bundesverband Einzelhandelsgärtner, mündliche Auskunft, 2003.
20
Bitsch, Wirtschaftliche Lage, 1995.
Grundlagen
18
Die Gartencenter sind in den USA entstanden und bieten annähernd ein Vollsorti-
ment in selbstbedienungsgerechter Präsentation an
22
. Als Mindestgrößen werden
400 bis 800 m² genannt
23
, wobei die tatsächlichen Größen zumeist deutlich darüber
liegen. Im Jahr 1999 hatte das größte GC in Deutschland eine Fläche von 17.500
m², insgesamt gab es 2.600 GC, darunter 640 privat betriebene Geschäfte, 240 Fili-
alen von Fachgartencenterketten und 1.720 Baumärkten angegliederte GC
24
. Jedes
Jahr werden ungefähr 100 bis 120 neue Märkte eröffnet
25
.
Im Einzelhandel werden die Betriebstypen anhand mehrerer Merkmale systemati-
siert. Dabei spielt die Betriebsgröße bzw. die Verkaufsfläche die zentrale Rolle. Des
Weiteren werden die verfolgte Preispolitik wie Hoch- oder Niedrigpreisstrategie und
das Sortiment betrachtet. Hierbei bezeichnet die Breite eines Sortiments die Anzahl
der verschiedenen Warenbereiche (breit schmal) und die Tiefe die Auswahlmög-
lichkeit zwischen ähnlichen Artikeln innerhalb eines Warenbereiches (tief flach).
Wenn mehrere Merkmale herangezogen werden, ist eine eindeutige Abgrenzung
schwierig. Es kommt häufig zu Überschneidungen
26
. In der Darstellung 3 werden die
EHG und GC in die gängige Systematisierung im Einzelhandel eingeordnet.
Darstellung 3: Einzelhandelsgärtnereien und Gartencenter in der Betriebsty-
pensystematisierung des Einzelhandels
Merkmal
Betriebstyp
"Fachgeschäft"
Betriebstyp
"Fachmarkt"
Größe
klein bis mittelgroß
großflächig
Sortiment
eng, aber tief
breit und tief
Verkaufsverfahren Bedienung und Selbstbedie-
nung
überwiegend Selbstbedie-
nung
Preisniveau
gehoben niedrig
bis
mittel
Personal
qualifizierte Mitarbeiter
fachliche Beratung möglich
Service
ergänzende Dienstleistungen sortimentsbezogene Dienst-
leistungen
hier sind die EHG einzu-
ordnen
hier sind die GC einzu-
ordnen
Quelle: eigene Darstellung nach Ausschuss für Begriffsdefinitionen, Katalog E,
1995, S. 43 und Liebmann und Zentes, Handelsmanagement, 2001, S. 373f.
21
Bundesverband Einzelhandelsgärtner, mündliche Auskunft, 2003.
22
Clemens und Klette, Gartencenter, 1967.
23
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 8.
24
Neugebauer, Wachstum, 1999.
25
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 281f.
26
Liebmann und Zentes, Handelsmanagement, 2001, S. 370ff.
Grundlagen
19
2.2 Der Leistungsfaktor Raum im Einzelhandel
Die drei elementaren Leistungsfaktoren eines Handelsbetriebes sind das Personal,
die Ware sowie der Raum und weitere sachliche Betriebsmittel. Die Betriebsleitung
soll diese in optimaler Weise miteinander kombinieren
27
. Wie bereits in der Einlei-
tung geschildert, gewinnt dabei der Leistungsfaktor Raum eine zunehmende Bedeu-
tung.
Der Geschäftsraum selbst unterteilt sich in mehrere Raumarten. Dies sind bei-
spielsweise der Lagerraum, eventuelle Arbeitsräume wie etwa ein Binderaum für
Floristik, Verwaltungs- oder Personalräume. Die für die Kunden ersichtlichste
Raumart ist der Verkaufsraum. Er gliedert in die eigentliche Warenfläche, auf der die
Artikel angeboten werden, die Kundenfläche, zu der Wege oder Treppen gehören,
und die übrige Verkaufsfläche mit dem Kassenbereich oder Ausstellungsflächen
28
.
Der Verkaufsraum stellt die wichtigste Raumart dar, auf ihn beziehen sich auch die
meisten ökonomischen Überlegungen und das in dieser Arbeit vorgestellte Control-
lingsystem.
Der Verkaufsraum hat vier wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Neben technischen
Funktionen wie dem Schutz der Ware zählt die Herstellung der Verbindung zwi-
schen Händler und Kunde zur werblichen Funktion. Oftmals stellt der Verkaufsraum
einen Ort dar, der Vergnügen und Spaß beim Einkaufen vermitteln soll und somit
eine menschlich-soziale Funktion übernimmt. Schließlich hat er durch den von ihm
geleisteten Beitrag zum Geschäftserfolg auch eine wirtschaftliche Funktion
29
.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben muss der Verkaufsraum unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht werden. Dazu gehören z.B. eine kaufanregende Atmosphäre, eine
attraktive Präsentation der Waren sowie die Ermöglichung des leichten Zugangs für
die Kunden und auch für die Mitarbeiter, die für die Warenbeschickung zuständig
sind. Als technische Anforderungen können ein ausreichendes Fassungsvermögen
für die Waren oder die Variabilität hinsichtlich wechselnder gestalterischer Maß-
nahmen angeführt werden
30
.
Haben Artikel spezielle Ansprüche an die Lagerung und Präsentation, so kann dies
auch als eine Anforderung an den Verkaufsraum betrachtet werden. Die unter-
schiedlichen klimatischen Bedürfnisse von Zimmer- und Freilandpflanzen, die durch
entsprechend ausgelegte VFA erfüllt werden, stellen eine solche Beanspruchung
27
Falk und Wolf, Handelsbetriebslehre, 1992, S. 55.
28
Falk und Wolf, Handelsbetriebslehre, 1992, S. 86.
29
Ackermann, Ladengestaltung, 1997, S. 30.
30
Berekoven, Einzelhandelsmarketing, 1990, S. 290.
Grundlagen
20
des Verkaufsraumes dar. Genauer wird dies im nächsten Abschnitt zu den Ver-
kaufsflächenarten behandelt.
Unter ökonomischer Sichtweise lassen sich die Funktionen und Aufgaben des Ver-
kaufsraumes in einen Marketing- und einen Controlling-Aspekt trennen. Die Instru-
mente, die dem Management hierfür bislang zur Verfügung stehen, sollen im Fol-
genden kurz beschrieben werden.
Die absatzpolitischen Maßnahmen können unter dem Begriff des Verkaufsraum-
marketing subsummiert werden. Verkaufsraummarketing ist einerseits der Aufbau
einer visuellen Kommunikation mit dem Kunden. Die Verkaufsraumgestaltung meint
dann ein Zusammenspiel von Ausdrucksmitteln der Architektur, der Technik, des
Designs, der Graphik und der Atmosphäre mit dem Ziel einer Beeinflussung des
Kundenverhaltens
31
. Auch für Geschäfte des Garten-Einzelhandels werden diese
Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert
32
.
Zum anderen ist im Rahmen der Warendistribution die sogenannte Space Utilization
anzusprechen. Sie umfasst die Aufteilung und Zuteilung der Verkaufsfläche. Das
Ziel einer vollständigen und intensiven Nutzung der Verkaufsfläche soll mit Hilfe der
qualitativen und quantitativen Raumzuteilung erreicht werden. Dabei meint qualitati-
ve Raumzuteilung die Anordnung der einzelnen Warengruppen oder Sortimentsbe-
reiche im Verkaufsraum. Die quantitative Raumzuteilung ist die mengenmäßige Auf-
teilung der zur Verfügung stehenden Fläche auf die Warengruppen. Kriterien hierfür
sind etwa die Attraktivität eines Verkaufsraumbereiches oder einer Warengruppe
33
.
In Abschnitt 4.1 (Kosten- und Erlössteuerung der Verkaufsflächenarten) wird noch
genauer auf Aspekte der Space Utilization eingegangen.
Anhand der Erläuterungen in den beiden vorigen Absätzen lässt sich eine Vielzahl
von Möglichkeiten für die Verkaufsraumgestaltung erahnen. Zugleich müssen sich
diese Maßnahmen betriebswirtschaftlich rechnen. Die Verkaufsfläche und ihre Ein-
richtung verursachen einen Aufwand, für den dann auch ein entsprechender Ertrag
zu erwirtschaften ist
34
.
Vor gut zehn Jahren betrugen die durchschnittlichen Einrichtungskosten im Einzel-
handel etwa 300 Euro pro Quadratmeter
35
. Die Entwicklung in der Verkaufsraum-
31
Ackermann, Ladengestaltung, 1997, S. 27ff.
32
Witt, G., Ambiente fördert Umsatz, 1999.
33
Berekoven, Einzelhandelsmarketing, 1990, S. 293.
34
Berekoven, Einzelhandelsmarketing, 1990, S. 316f.
35
Berekoven, Einzelhandelsmarketing, 1990, S. 316, Umrechnung auf Euro-Werte.
Grundlagen
21
gestaltung verursacht mit einer immer geringeren Lebensdauer der Ausstattung und
demzufolge kürzeren Umbauzyklen stetig ansteigende Investitionsbeträge
36
.
Daneben fallen laufende Unterhaltungskosten für die Verkaufsräume an. Entschei-
dungen für die Errichtung und Umgestaltung von Verkaufsräumen werden bislang
auf der Grundlage von Investitionsrechnungen getroffen, vertiefend wird dieses In-
strumentarium im Abschnitt 4.4 (Investitionsfragen) erörtert. Dem gegenüber er-
bringt der Verkaufsraum auch eine Leistung. Ihre Ermittlung und Beurteilung und je-
ne der verursachten Kosten sind Gegenstand des Controlling.
Für die Messung der Raumleistung stehen bisher verschiedene Kennzahlen zur
Verfügung. Es sind Relativzahlen, die in verdichteter Weise über Einsatz und Er-
gebnis des Leistungsfaktors Raum Auskunft geben. Zu nennen sind zum einen als
umsatzbestimmte Kennzahl der Umsatz je Quadratmeter Verkaufsfläche und zum
anderen als ertragsbestimmte Kennzahl das Betriebsergebnis je Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. Einzelhandelsbetriebe der Gartenbranche gewichten dafür die Grund-
flächen der einzelnen VFA unterschiedlich. Der Warmbereich wird mit dem Faktor
1,0 gewertet, der Kaltbereich und das überdachte Freigelände mit 0,5, und das
Freigelände hat den Faktor 0,25
37
. Bei der Ermittlung der Kennzahl Umsatz pro
Quadratmeter ist also die Bezugsfläche kleiner als die tatsächliche gesamte Ver-
kaufsfläche. Eine vergleichbare Handhabung findet man auch bei gartenbaulichen
Produktionsbetrieben mit der Umrechnung von unterschiedlich intensiven Produkti-
onsflächen auf Einheitsquadratmeter.
Die Marktleistung eines Handelsbetriebes kommt durch den kombinierten Einsatz
der Faktoren Personal, Ware und Raum zustande. Durch eine isolierte Betrachtung
der einzelnen Betriebsfaktoren lässt sich ermitteln, welche Erfolgsbeiträge jeweils
geleistet werden
38
. Die Frage, welchen Beitrag der Verkaufsraum allein betrachtet
zum Geschäftserfolg leistet, wird für einzelne VFA im Kapitel 3 (Zielsystem) wieder
aufgegriffen.
Verkaufraummarketing und Verkaufsraumcontrolling dürfen nicht isoliert voneinan-
der betrachtet werden. Eine erlebnisbetonte Gestaltung des Verkaufsraumes kann,
wenn dadurch die Einkaufsbequemlichkeit erhöht wird, mehr Kunden in den Laden
locken. Und gelingt es, die Verweildauer der Kunden zu verlängern, so resultiert
dies in einer höheren Einkaufssumme. Insgesamt ist dadurch eine Verbesserung
36
Ackermann, Ladengestaltung, 1997, S. 3.
37
Vossen, Branchenreport, 1999, S. 281.
38
Berekoven, Einzelhandelsmarketing, 1990, S. 318f.
Grundlagen
22
der Verkaufsflächenrentabilität möglich
39
. Die absatzpolitischen Instrumente sind
daher stets mit den Erkenntnissen des Controlling abzugleichen.
2.3 Verkaufsflächenarten im Einzelhandel
2.3.1 Verkaufsflächenarten im gärtnerischen Einzelhandel
Ausgehend von dem oben beschriebenen Leistungsfaktor Raum im Handelsbetrieb
soll auf die Besonderheit gartenbaulicher Einzelhandelsbetriebe im Hinblick auf die-
sen Leistungsfaktor eingegangen werden Anschließend erfolgt eine Suche nach
ähnlichen räumlichen Ausnahmen im übrigen Einzelhandel.
Alternativ lässt sich der Raum auch bezeichnen als die überbaute und nicht über-
baute Fläche von Handelsunternehmen, die für die Handelstätigkeit genutzt wird.
Dabei sind der Verkaufsraum, der Ausstellungsraum oder auch der Lagerraum in
der Regel überbaut, während der Parkraum für Kundenfahrzeuge zumeist nicht ü-
berbaut ist
40
. Allerdings sind auch Ausnahmen anzutreffen.
So gibt es in den Betrieben des Garten-Einzelhandels nicht überbaute Verkaufsflä-
chen. Zudem ist das Erscheinungsbild einer EHG oder eines GC zu inhomogen, um
im ganzen Geschäft nur von einem Verkaufsraum zu sprechen. Daher sollen die un-
terschiedlichen Teilbereiche eines gärtnerischen Handelsbetriebes als Verkaufsflä-
chenarten definiert werden.
Eine Verkaufsflächenart (VFA) ist ein zumeist großflächiger Teilbereich des Ver-
kaufsraumes, der sich baulich und in seiner festen Einrichtung deutlich von anderen
Teilbereichen unterscheidet. Eine VFA allein betrachtet kann bereits einen einzel-
nen Verkaufsraum darstellen.
Ursachen für das Vorkommen unterschiedlicher VFA sind die Ansprüche der Kern-
artikel Pflanzen, die zumeist eine lebende Ware darstellen. Die Ansprüche ergeben
sich aus den Umweltverhältnissen an ihren natürlichen Standorten.
Schnittblumen sind sehr empfindlich. Um eine hohe Qualität der Ware gewährleisten
zu können, sollte die Verdunstung durch kühle Temperaturen von 5-12 °C, eine ho-
he Luftfeuchtigkeit und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung minimiert werden.
Für viele Topfpflanzen sind Temperaturen von 18-20 °C und ein hoher Lichtgenuss
optimal, Beet- und Balkonpflanzen benötigen einen hellen und vor kühlen Tempera-
39
Liebmann und Zentes, Handelsmanagement, 2001, S. 547.
40
Lerchenmüller, Handelsbetriebslehre, 1998, S. 214f.
Grundlagen
23
turen und Frost geschützten Standort
41
. Die Ansprüche der Stauden und Gehölze
sind ein heller und nicht zu warmer Standort und eine ausreichende Luftzirkulation.
Sonstige, in EHG und GC vertriebene Artikel, wie Substrate, Pflanzgefäße oder Gar-
tengeräte können je nach Beschaffenheit der Ware oder der Verpackung eines
Schutzes vor Nässe, Frost, Sonnen- oder UV-Einstrahlung bedürfen. Bei Berück-
sichtigung dieser unterschiedlichen Ansprüche der diversen Pflanzengruppen durch
die Handelsbetriebe ergeben sich verschiedene VFA. Diese sind in der folgenden
Darstellung 4 mit ihren wesentlichen Ausstattungsmerkmalen und den typischen
Sortimenten aufgeführt.
Darstellung 4: Verkaufsflächenarten im Garten-Einzelhandel
Bezeichnung der VFA
Allgemein übliche
Bauausführung und
feste Einrichtung
Sortimente
(typische Waren-
gruppen)
1. Festbau
massiver Bau, lichtun-
durchlässige Bedachung,
Heizung (Zimmertempe-
ratur), evtl. Kühlung für
Schnittblumen
Schnittblumen
Hartware
2. Warmbereich,
Warmhaus
Glasgewächshaus, Hei-
zung (16-20 °C), Schattie-
rung, Energieschirm
Topfpflanzen
Hartware
3. Temperiertes
Haus
Glasgewächshaus, Hei-
zung (10-18 °C), Schattie-
rung, Energieschirm
Topfpflanzen
Hartware
4. Kaltbereich,
Kalthaus
Glasgewächshaus, Schat-
tierung, evtl. Heizung
Beet- und Balkon-
pflanzen
Stauden und Gehölze
Hartware
5. überdachtes
Freigelände Bedachung (zumeist
Glas), seitlich offen
Beet- und Balkon-
pflanzen
Stauden und Gehölze
Hartware
6. Freigelände
keine feste Überbauung
Beet- und Balkon-
pflanzen
Stauden und Gehölze
Hartware
Quelle: eigene Darstellung und Ergebnisse der Betriebsuntersuchung. Mit Hartware
sind alle nicht-pflanzlichen Warengruppen gemeint.
Über diese VFA hinaus präsentieren viele Einzelhandelsbetriebe Waren auch vor
dem Eingangsbereich. Zumeist handelt es sich um saisonal attraktive Pflanzen oder
sonstige Impulsartikel. Diese Präsentationsfläche kann nicht als VFA bezeichnet
werden, da sie nicht die oben genannte Großflächigkeit und auch keine Selbstän-
digkeit aufweist. Große und relativ unbewegliche Artikel wie Garten- und Gewächs-
41
Ludewig, Jansen und Hölscher, Verkaufsanlagen, 1998, S. 12.
Grundlagen
24
häuser und Grillkamine werden oft auf Flächen ausgestellt, die nicht direkt mit dem
Verkaufraum zusammenhängen, beispielsweise an der Außenfassade des Ge-
schäfts oder an einer anderen geeigneten Stelle auf dem Betriebsgelände
42
. Auch
auf diese Flächen trifft die oben erstellte Definition einer VFA nicht zu.
Diese beiden Fälle werden daher nicht als VFA betrachtet, ihre ökonomische Be-
deutung muss allerdings im Rahmen eines gewissenhaften Controlling berücksich-
tigt werden. Im Kapitel 5 (Methodik) wird darauf noch einmal eingegangen.
2.3.2 Besondere Verkaufsflächen im übrigen Einzelhandel
An dieser Stelle sollen besondere Teilbereiche des Verkaufsraumes im sonstigen
Einzelhandel beschrieben und mit den VFA verglichen werden. Zu betrachten sind
herausstechende Warenpräsentationsformen in Lebensmittelmärkten, Freiflächen in
Baumärkten und In-Shop-Flächen in Waren- oder Modehäusern.
In Supermärkten fallen Tiefkühltruhen, Kühlregale, Bedienungstheken wie für Back-
waren und manchmal auch spezielle Präsentationsregale für Obst und Gemüse auf.
Auch hier liegen wie bei den Pflanzen in EHG und GC die Ursachen in den Wa-
renansprüchen begründet. Frischeprodukte benötigen kühle Temperaturen, Back-
waren sind sehr empfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen. Diese Ver-
kaufsraumbereiche werden im Management durchaus gesondert wahrgenommen,
da sie in der Erstellung und im Unterhalt kostenintensiv sind. Die Kältetechnik ge-
hört zu den Kostentreibern bei der Einrichtung eines neuen Lebensmittelmarktes
43
.
Als eigene VFA können sie aber nicht betrachtet werden. Es handelt sich zumeist
nur um kleine Flächen, und die baulichen Unterschiede zum übrigen Verkaufsraum
sind weniger deutlich als im Garten-Einzelhandel.
Bau- und Heimwerkermärkte verfügen oft über ein Freigelände, auf dem sperrige
oder schwere Baustoffe untergebracht sind. Eine solche Fläche entspricht der obi-
gen Definition einer VFA, dennoch lassen sich zwischen dem Baumarkt-Freigelände
und dem eines Gartencenters noch Unterschiede herausarbeiten. Ein wesentlicher
liegt in dem Zweck des Besuches begründet. Wie schon erwähnt bieten EHG und
GC ein freizeitorientiertes Sortiment an, ein Besuch fällt dann in den Bereich eines
Erlebniseinkaufs. Dieser meint einen Beitrag des Einkaufs zur Lebensqualität und
die Bereitstellung von emotionalen Anregungen.
Entsprechend wird von einem Versorgungseinkauf gesprochen, wenn der Einkauf
nur der Bedürfnisbefriedigung dient und in dem Bestreben erfolgt, ihn schnell und
42
Dierheimer, mündliche Auskunft, 2003.
43
Kersch, Teurer Supermarkt, 2002.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832482350
- ISBN (Paperback)
- 9783838682358
- DOI
- 10.3239/9783832482350
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität München – Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt
- Erscheinungsdatum
- 2004 (August)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- controlling gartencenter gärtnerei verkaufsfläche einzelhandel
- Produktsicherheit
- Diplom.de