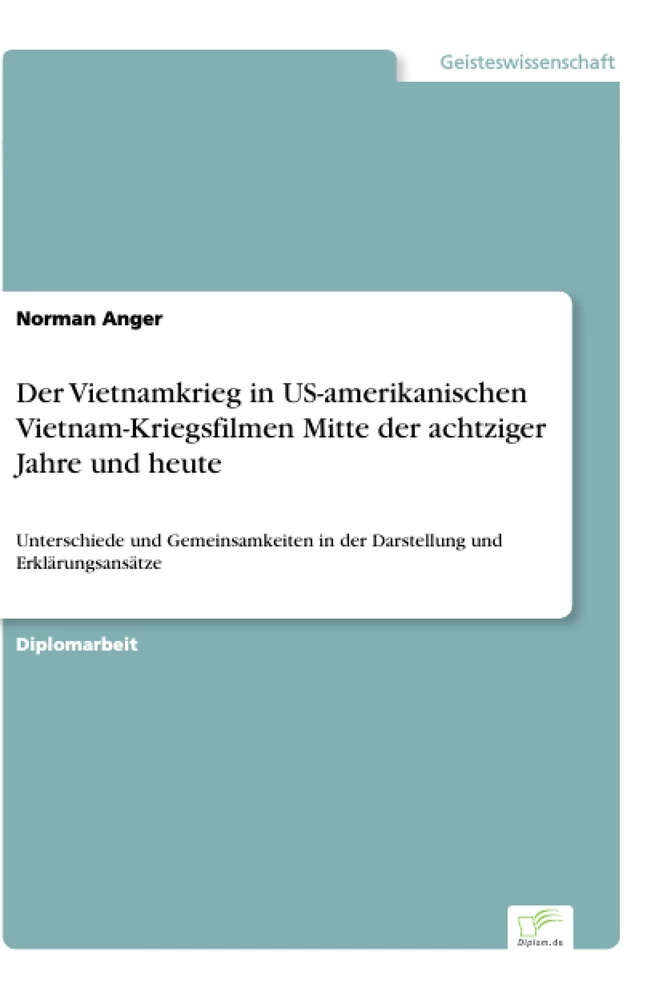Der Vietnamkrieg in US-amerikanischen Vietnam-Kriegsfilmen Mitte der achtziger Jahre und heute
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung und Erklärungsansätze
©2003
Diplomarbeit
180 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Unzählige Filme wurden über den Vietnamkrieg und die Probleme der zurückgekehrten Soldaten (so genannte Veteranen- oder Coming Home-Filme) gedreht, einige dieser Filme gelten bereits als Klassiker des Kriegsfilm-Genres, als definitives Statement. Die Filme über den Vietnamkrieg scheinen, wie der Krieg selber, Geschichte zu sein. Oder besser: sie schienen es. Denn es hat in den letzten drei Jahren erneut zwei größere Hollywood-Produktionen über diesen Krieg gegeben: Tigerland (USA, 2000. Regie: Joel Schumacher.) und We Were Soldiers (USA, 2002. Regie: Randall Wallace.). Mögen derzeit auch andere Kriege von größerem Interesse sein, filmisch ist der Vietnamkrieg wieder auf die Agenda gesetzt worden, und das wirft Fragen auf, von denen einige in der vorliegenden Arbeit gestellt und beantwortet werden sollen.
Der Vietnamkrieg war ein in den USA zunehmend umstrittener und kritisierter Krieg, über den auch nach seinem Ende 1975 noch lange kontrovers diskutiert wurde und der auch heute noch als sensibles, wenn nicht gar brisantes Thema gilt. Filme, die über diesen Krieg gedreht werden, können diese Kontroversen aufgreifen, Stellung beziehen oder sie können diese Kontroversen vermeiden. Aus welchen Motiven heraus auch immer eine dieser Möglichkeiten gewählt wird, ob aus dramaturgischen, ästhetischen oder anderen, es ist doch immer auch eine politische Position.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, ob die Filme, die Mitte der achtziger Jahre, also ungefähr zehn Jahre nach Kriegsende gedreht wurden, eine andere Position beziehen als die Filme, die aktuell, also noch einmal fünfzehn Jahre später, entstanden sind. Ziel ist es darüber hinaus, Erklärungsansätze für die entdeckten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu formulieren.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über den Vietnamkrieg gegeben. Neben dem Verlauf des Krieges werden seine Besonderheiten und die Kritik an ihm gesondert betrachtet, da sie für die spätere Filmanalyse von grundlegender Bedeutung sind (Kapitel 2).
Im Anschluss wird die Theorie der Filmanalyse dargestellt. Dafür wird zum einen auf die Grundlagen der Filmanalyse eingegangen (Kapitel 3.1), zum anderen wird das Genre des Kriegsfilms erörtert (Kapitel 3.2). Dieses ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da abgeleitete Genreregeln ebenfalls für die spätere Filmanalyse zentral sind.
In den folgenden drei Abschnitten des 3. Kapitels wird das Untersuchungsdesign dieser Arbeit […]
Unzählige Filme wurden über den Vietnamkrieg und die Probleme der zurückgekehrten Soldaten (so genannte Veteranen- oder Coming Home-Filme) gedreht, einige dieser Filme gelten bereits als Klassiker des Kriegsfilm-Genres, als definitives Statement. Die Filme über den Vietnamkrieg scheinen, wie der Krieg selber, Geschichte zu sein. Oder besser: sie schienen es. Denn es hat in den letzten drei Jahren erneut zwei größere Hollywood-Produktionen über diesen Krieg gegeben: Tigerland (USA, 2000. Regie: Joel Schumacher.) und We Were Soldiers (USA, 2002. Regie: Randall Wallace.). Mögen derzeit auch andere Kriege von größerem Interesse sein, filmisch ist der Vietnamkrieg wieder auf die Agenda gesetzt worden, und das wirft Fragen auf, von denen einige in der vorliegenden Arbeit gestellt und beantwortet werden sollen.
Der Vietnamkrieg war ein in den USA zunehmend umstrittener und kritisierter Krieg, über den auch nach seinem Ende 1975 noch lange kontrovers diskutiert wurde und der auch heute noch als sensibles, wenn nicht gar brisantes Thema gilt. Filme, die über diesen Krieg gedreht werden, können diese Kontroversen aufgreifen, Stellung beziehen oder sie können diese Kontroversen vermeiden. Aus welchen Motiven heraus auch immer eine dieser Möglichkeiten gewählt wird, ob aus dramaturgischen, ästhetischen oder anderen, es ist doch immer auch eine politische Position.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, ob die Filme, die Mitte der achtziger Jahre, also ungefähr zehn Jahre nach Kriegsende gedreht wurden, eine andere Position beziehen als die Filme, die aktuell, also noch einmal fünfzehn Jahre später, entstanden sind. Ziel ist es darüber hinaus, Erklärungsansätze für die entdeckten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu formulieren.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über den Vietnamkrieg gegeben. Neben dem Verlauf des Krieges werden seine Besonderheiten und die Kritik an ihm gesondert betrachtet, da sie für die spätere Filmanalyse von grundlegender Bedeutung sind (Kapitel 2).
Im Anschluss wird die Theorie der Filmanalyse dargestellt. Dafür wird zum einen auf die Grundlagen der Filmanalyse eingegangen (Kapitel 3.1), zum anderen wird das Genre des Kriegsfilms erörtert (Kapitel 3.2). Dieses ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da abgeleitete Genreregeln ebenfalls für die spätere Filmanalyse zentral sind.
In den folgenden drei Abschnitten des 3. Kapitels wird das Untersuchungsdesign dieser Arbeit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7953
Anger, Norman: Der Vietnamkrieg in US-amerikanischen Vietnam-Kriegsfilmen Mitte der
achtziger Jahre und heute - Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung und
Erklärungsansätze
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Universität Trier, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
...2
2
Geschichte des Vietnamkrieges
...4
2.1
Verlauf ...
4
2.2
Besonderheiten ...
6
2.3
Kritik ...
7
3
Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
...10
3.1
Grundlagen der Filmanalyse ...
10
3.2
Genre Kriegsfilm ...
.12
3.3
Filmauswahl ...
13
3.4
Analyse-Kategorien ...
15
3.5
Operationalisierung ...
17
4
Filmanalyse
...20
4.1
Vietnamkriegsfilme vor 1986 ...
20
4.2
Platoon ...
23
4.2.1
Produktionsnotizen
...23
4.2.2
Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
...24
4.2.3
Struktur des Films
...24
4.2.4
Die Analyse-Kategorien
...26
4.3
Full Metal Jacket ...
35
4.3.1
Produktionsnotizen
...35
4.3.2
Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
...36
4.3.3
Struktur des Films
...36
4.3.4
Die Analyse-Kategorien
...39
4.4
Vietnamkriegsfilme und generische Entwicklung zwischen 1987 und 2000 ...
45
4.5
Tigerland ...
47
4.5.1
Produktionsnotizen
...47
4.5.2
Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
...48
4.5.3
Struktur des Films
...48
4.5.4
Die Analyse-Kategorien
...52
4.6
We Were Soldiers ...
57
4.6.1
Produktionsnotizen
...57
4.6.2
Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
...58
4.6.3
Struktur des Films
...58
4.6.4
Die Analyse-Kategorien
...62
5
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung
...72
6
Erklärungsansätze für Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung
...77
7
Fazit
...83
8
Literaturverzeichnis
...85
1 Einleitung
2
1 Einleitung
Unzählige Filme wurden über den Vietnamkrieg und die Probleme der zurückgekehrten Soldaten
(so genannte Veteranen- oder ,,Coming Home"-Filme) gedreht, einige dieser Filme gelten bereits
als Klassiker des Kriegsfilm-Genres, als definitives Statement. Die Filme über den Vietnamkrieg
scheinen, wie der Krieg selber, Geschichte zu sein. Oder besser: sie schienen es. Denn es hat in
den letzten drei Jahren erneut zwei größere Hollywood-Produktionen über diesen Krieg gegeben:
Tigerland (USA, 2000. Regie: Joel Schumacher.) und We Were Soldiers (USA, 2002. Regie:
Randall Wallace.). Mögen derzeit auch andere Kriege von größerem Interesse sein, filmisch ist
der Vietnamkrieg wieder auf die Agenda gesetzt worden, und das wirft Fragen auf, von denen ei-
nige in der vorliegenden Arbeit gestellt und beantwortet werden sollen.
Der Vietnamkrieg war ein in den USA zunehmend umstrittener und kritisierter Krieg, über den
auch nach seinem Ende 1975 noch lange kontrovers diskutiert wurde und der auch heute noch
als sensibles, wenn nicht gar brisantes Thema gilt. Filme, die über diesen Krieg gedreht werden,
können diese Kontroversen aufgreifen, Stellung beziehen oder sie können diese Kontroversen
vermeiden. Aus welchen Motiven heraus auch immer eine dieser Möglichkeiten gewählt wird, ob
aus dramaturgischen, ästhetischen oder anderen, es ist doch immer auch eine politische Positi-
on.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, ob die Filme, die Mitte der achtziger Jahre, also un-
gefähr zehn Jahre nach Kriegsende gedreht wurden, eine andere Position beziehen als die Fil-
me, die aktuell, also noch einmal fünfzehn Jahre später, entstanden sind. Ziel ist es darüber hin-
aus, Erklärungsansätze für die entdeckten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu formulieren.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über den Vietnamkrieg gegeben. Neben dem Ver-
lauf des Krieges werden seine Besonderheiten und die Kritik an ihm gesondert betrachtet, da sie
für die spätere Filmanalyse von grundlegender Bedeutung sind (Kapitel 2).
Im Anschluss wird die Theorie der Filmanalyse dargestellt. Dafür wird zum einen auf die Grund-
lagen der Filmanalyse eingegangen (Kapitel 3.1), zum anderen wird das Genre des Kriegsfilms
erörtert (Kapitel 3.2). Dieses ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da abgeleitete Genre-
regeln ebenfalls für die spätere Filmanalyse zentral sind.
In den folgenden drei Abschnitten des 3. Kapitels wird das Untersuchungsdesign dieser Arbeit
vorgestellt:
In Kapitel 3.3 wird die Auswahl der Filme erläutert. Für die Analyse werden die schon erwähnten
Tigerland und We Were Soldiers als die beiden aktuellsten Vietnamkriegsfilme herangezogen.
Ihnen gegenübergestellt werden zwei Filme, die sowohl unter Kritikern als auch unter Filminte-
ressierten als Klassiker gelten und die somit auch heute noch als relevant gelten dürfen: Platoon
(USA, 1986. Regie: Oliver Stone.) und Full Metal Jacket (USA, 1987. Regie: Stanley Kubrick.).
1
Für die Fragestellung der Arbeit sind drei inhaltliche Bereiche der Filme von besonderem Interes-
se und sollen zunächst separat analysiert werden (Kapitel 3.4):
1
Zwei weitere und wohl auch die einzigen Filme, die ebenfalls diesen Kriterien genügen, sind The Deer Hunter (USA,
1978. Regie: Michael Cimino) und Apocalypse Now (USA, 1979. Regie: Francis Ford Coppola).
1 Einleitung
3
1.
Die Beurteilung des Krieges
2.
Die Darstellung des US-Militärs
3.
Die Darstellung der Vietnamesen: der FNL (Nationale Befreiungsfront von Süd-Vietnam),
der NVA (Nordvietnamesische Armee), der ARVN (Südvietnamesische Armee) und der
vietnamesischen Zivilbevölkerung
In Kapitel 3.5 wird schließlich die Operationalisierung der Filmanalyse erläutert. Filmanalytische
Grundlagen werden hier auf die drei zuvor benannten Analysekategorien angewendet.
Kapitel 4 gibt zunächst einen Überblick über Vietnamkriegsfilme bis 1986 und untersucht, inwie-
weit zu diesem Zeitpunkt bereits Genreregeln für Vietnamkriegsfilme bestehen (Kapitel 4.1). Dar-
an anschließend folgt die Analyse der Filme Platoon und Full Metal Jacket (Kapitel 4.2 und 4.3).
In Kapitel 4.4 werden Vietnamkriegsfilme zwischen 1987 und 2000 betrachtet, und es wird unter-
sucht, ob sich gegenüber 1986 Genreregeln etabliert oder geändert haben. Danach werden die
Filme Tigerland und We Were Soldiers analysiert (Kapitel 4.5 und4.6).
Nach der Analyse jedes einzelnen Films in Bezug auf die charakterisierten drei Bereiche werden
in Kapitel 5 die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Fragestellung miteinander verglichen.
Abschließend soll in Kapitel 6 herausgefunden werden, welche Ursachen für die gefundenen Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten verantwortlich gemacht werden können. Dafür werden politi-
sche, ökonomische und soziale Erklärungsmuster herangezogen und analysiert.
In einem gesonderten Anhang befinden sich die Sequenzprotokolle der analysierten Filme, Zu-
satzinformationen zu diesen Filmen und Verständnishilfen allgemeinerer Art.
2 Geschichte des Vietnamkrieges
4
2 Geschichte des Vietnamkrieges
Die Analyse von Vietnamkriegsfilmen setzt zuallererst die Kenntnis dieses Krieges, der Gründe
für sein Zustandekommen, seines Verlaufs sowie seiner Auswirkungen voraus. Nur vor diesem
Hintergrund ist eine Bewertung der Darstellung dieses Krieges im Film möglich. Im Folgenden
wird deshalb zunächst kurz der Verlauf des Vietnamkriegs skizziert. Daran anschließend werden
die Besonderheiten dieses Krieges gegenüber vorhergehenden kriegerischen Auseinanderset-
zungen herausgearbeitet. In einem letzten Schritt wird die Kritik am Vietnamkrieg wiedergegeben.
Vor allem die Erkenntnisse aus den letzen beiden Punkte bilden später den Rahmen für die Ana-
lyse der einzelnen Filme (vgl. Kapitel 3.4).
2.1 Verlauf
Der Vietnamkrieg, auch 2. Indochinakrieg genannt, kann als ein vietnamesischer Bürgerkrieg
verstanden werden, in dem Südvietnam von den USA und Nordvietnam von der UdSSR und
China unterstützt wurden.
2
Er kann aber auch als ein Krieg der USA gegen Südvietnam verstan-
den werden, in den sich Nordvietnam einmischte.
3
Doktrinäre Grundlage für das Engagement der USA in Vietnam war die so genannte ,,Domino-
Theorie", nach der ein Land nach dem nächsten umfallen würde, könnte man das Fallen eines
ersten nicht verhindern. Nach allgemeiner Lesart bezog sich diese Doktrin auf den Kommunis-
mus
4
, nach kritischer Lesart auf Unabhängigkeit.
5
Das Engagement der USA begann 1950. Frankreich hatte ab 1946 versucht, seine im 2. Welt-
krieg verlorene koloniale Stellung in Indochina wiederzuerlangen. Dagegen erhob sich Wider-
stand seitens der Vietminh, der von Ho Chi Minh gegründeten nationalen und kommunistischen
vietnamesischen Bewegung, und es kam zum 1. Indochinakrieg. Die USA unterstützten Frank-
reich in diesem Krieg personell und finanziell erheblich (1954 trugen sie beinahe 80% der franzö-
sischen Ausgaben
6
).
Dennoch musste Frankreich nach der Schlacht bei Diên Biên Phu 1954 seine Niederlage hin-
nehmen; das Genfer Abkommen aus demselben Jahr sah gesamtvietnamesische Wahlen vor
und bestimmte eine vorläufige Demarkationslinie zwischen dem nun von den Vietminh geführten
Norden und dem Süden des Landes. Hier setzten die USA den Diktator Ngo Dinh Diem ein. Die
vorgesehen Wahlen (und damit das Genfer Abkommen) wiesen er und die USA aus Angst vor
einem Sieg der Vietminh zurück, worauf diese sich auf einen neuen Kampf vorbereiteten. Ihr Ziel
war die Wiedervereinigung Vietnams.
7
Das nationalistische Lager bestand aus zwei Fraktionen: Zum einen Nordvietnam, das von der
UdSSR und China unterstützt wurde, bzw. seiner Armee, der NVA (North Vietnamese Army) oder
2
Vgl. KARNOW, Stanley: Vietnam: A History. 1997. S. 28.
3
Vgl. CHOMSKY, Noam: Visions of Righteousness. 1991. S. 23 und 30.
4
Vgl. KARNOW (1997) S. 59 und 184.
5
Vgl. VLASTOS, Stephen: America's "Enemy": The Absent Presence in Revisionist Vietnam War History. 1991. S. 52;
DOMINIKOWSKI, Thomas: `Massen'medien und `Massen'krieg: Historische Annäherungen an eine unfriedliche Sym-
biose. 1993. S. 37, der zur Unterstützung dieser Sicht die US-Politik in Indonesien (1965), auf den Philippinen (1972)
und in Thailand (1973) ins Gedächtnis ruft S. 38.
6
Vgl. KARNOW (1997) S. 185.
7
Vgl. ebenda S. 139-235.
2 Geschichte des Vietnamkrieges
5
PAVN (People's Army of Vietnam); zum anderen aus den Vietminh im Süden des Landes, aus
denen sich 1960 die Nationale Befreiungsfront (National Liberation Front, NLF) gründete und die
von den USA propagandistisch Vietcong genannt wurden.
8
Während ihres Widerstandskampfes
bekam die NLF ihren Nachschub über den Ho-Chi-Minh-Pfad, ein im Laufe der Jahre zur Straße
ausgebautes Wegenetz, das von Nordvietnam über Laos und Kambodscha nach Südvietnam
führte. Auch nordvietnamesische Truppen gelangten auf diesem Wege in den Süden.
Unter Präsident Kennedy steigerten die USA ihre Unterstützung für Diem und begannen mit krie-
gerischen Maßnahmen gegen die südvietnamesische Bevölkerung, um deren Unterstützung der
NLF zu brechen. Zu diesen Maßnahmen gehörte die Vertreibung der Bauern von ihrem Land zur
Bildung von ,,Wehrdörfern".
9
Im November 1963 wurde Diem durch einen von den USA unterstützten Militärputsch ermordet,
da er die Lage in Südvietnam nicht in den Griff bekam. Im selben Monat starb auch Kennedy in
Folge eines Attentats.
10
Während in Südvietnam in der folgenden Zeit ein Putsch dem nächsten
folgte, trat in den USA Lyndon B. Johnson die Nachfolge Kennedys an. Kennedy hatte den
Grundstein für den Krieg gelegt, Johnson führte ihn. Im August 1964 wurde im Golf von Tonkin
angeblich ein US-Zerstörer auf einer Sabotagemission gegen Nordvietnam von nordvietnamesi-
schen Patrouillenbooten beschossen.
11
Der US-Kongress stellte Johnson daraufhin eine Art
,,Blankoscheck" für einen Krieg aus. Es sollte allerdings niemals zu einer offiziellen Kriegserklä-
rung kommen.
12
Aufgrund der innenpolitischen Lage in Südvietnam, die zeitweilig einer Anarchie glich, beschloss
man in Washington, den Krieg zu amerikanisieren, was 1965 erreicht wurde: beinahe tägliche
Bombenangriffe gegen Nord- und Südvietnam
13
, Missionen gegen südvietnamesische Dörfer und
Camps, um NLF-Kader oder Sympathisanten aufzuspüren.
14
Diese ,,Politik" wurde mit steigen-
dem Einsatz bis Anfang 1968 fortgesetzt. Mittlerweile befanden sich eine halbe Million amerikani-
scher Soldaten in Vietnam.
15
Ende Januar 1968 starteten die nordvietnamesische Armee und die NLF eine groß angelegte Of-
fensive, benannt nach dem vietnamesischen Neujahr Tet am 1. Februar, Tet-Offensive. Obwohl
ein militärischer Misserfolg (das Ziel, Aufstände im Süden zu erzwingen, wurde nicht erreicht),
hatte diese Offensive einen starken Einfluss auf die bis dahin überwiegend kriegs-befürwortende
amerikanische Öffentlichkeit. Sie war nämlich in den Glauben versetzt worden, der Sieg stehe
kurz bevor, der Feind sei zu keinem Gegenschlag mehr fähig. Das erwies sich nun als propagan-
distische Lüge. Zusätzlich bewirkte die Tet-Offensive, dass sich die Kriegskritiker in Washington
langsam gegen Johnson durchzusetzen begannen. Johnson verzichtete auf eine erneute Kandi-
datur.
16
Johnsons Nachfolger, Richard Nixon, ab Januar 1969 im Amt, begann zunächst mit einer weite-
ren Eskalation des Krieges: der geheimen Bombardierung Kambodschas und einer Truppenent-
8
Vgl. ebenda S. 242-255.
9
Vgl. ebenda (1997) S. 264-285; CHOMSKY, Noam: Visions of Righteousness. 1991. S. 29.
10
Vgl. KARNOW (1997) S. 293-327.
11
Vermutlich wurde dieser Vorfall von den USA fabriziert vgl. bspw. ebenda (1997) S. 379-390.
12
Vgl. ebenda (1997) S. 380-412.
13
Im Vietnamkrieg wurden dreimal so viele Bomben abgeworfen wie im gesamten 2. Weltkrieg.
14
Vgl. ebenda S. 394-487.
15
Vgl. ebenda S. 493-527.
16
Vgl. ebenda S. 536-581.
2 Geschichte des Vietnamkrieges
6
sendung in den dortigen Bürgerkrieg. Mittelfristig aber zog er Truppen aus Vietnam ab, um den
Krieg wieder zu vietnamisieren: Die amerikanische Öffentlichkeit und viele einflussreiche Politiker
verlangten dies.
17
Im Laufe des Krieges hatte es immer wieder Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien gege-
ben, doch erst ab 1972 waren sie für die USA erfolgreich. So wie sie den Krieg geführt hatten,
über die Köpfe der Südvietnamesen hinweg, schlossen sie eine Art Friedensvertrag, der am 27.
Januar 1973 in Paris unterzeichnet wurde. Der Krieg aber diesmal ohne die USA ging weiter,
bis Saigon im April 1975 in die Hände der Nordvietnamesen fiel und die sich noch im Land be-
findlichen Amerikaner panikartig ausgeflogen wurden.
18
Die USA hatten ca. 58.000 Tote zu beklagen, Vietnam über 1 Million Soldaten. Die Zahl der Zivil-
opfer ist unbekannt.
19
2.2 Besonderheiten
Der Vietnamkrieg weist einige, teilweise interdependente Besonderheiten auf. Kriegsgeschehen,
Militärstruktur und Verhalten der Soldaten unterscheiden ihn von anderen amerikanischen Krie-
gen. Einige dieser Besonderheiten bzw. deren Auswirkungen wurden in den täglichen TV-
Berichten der amerikanischen Sender während dieses ersten ,,Wohnzimmerkrieges"
20
zu audio-
visuellen Synonymen desselben.
21
Eine filmische Umsetzung kann daher erwartet oder doch
vermutet werden.
Das Kriegsgeschehen in Vietnam kannte keine wirklichen Fronten. Kämpfe fanden wieder und
wieder um dieselben Gebiete statt. Das bedeutete zum einen, dass eventuelle militärische Fort-
schritte nicht an einem ,,Vorankommen" festzumachen waren. Stattdessen wurden unsichere und
eher bedeutungslose ,,body counts" als Indikator herangezogen.
22
Es bedeutete zum anderen,
dass es keine sicheren Gebiete gab, nicht einmal Saigon, und es jederzeit und überall zum
Kampf kommen konnte.
23
Diese Kämpfe waren in den seltensten Fällen ,,traditionelle" Schlach-
ten, welche die NLF aufgrund der deutlichen militärischen Übermacht der USA vermied. Statt-
dessen wurden sie durch Überraschungsangriffe und Hinterhalte ausgelöst. Ein zusätzliches
Problem für das amerikanische Militär bestand darin, dass Freund von Feind zu unterscheiden
meist unmöglich war. Oder wie es ein Hauptmann der Marines ausdrückte: ,,They were all Viet-
namese. Some of them were Vietcong."
24
Diese psychisch schwierigen Umstände wurden durch Insekten und die klimatischen Bedingun-
gen, aber auch durch die Struktur des amerikanischen Militärs noch verschärft.
Das Durchschnittsalter der Soldaten betrug gerade 19 Jahre (im 2. Weltkrieg betrug es 26 Jah-
re).
25
Es handelte sich bei den unteren Rängen nicht um Berufssoldaten, sondern um (im Laufe
17
Vgl. ebenda S. 592-661.
18
Vgl. ebenda S. 662-684.
19
Vgl. ebenda S. 9-23.
20
Vgl. DOMINIKOWSKI (1993) S. 45.
21
Vgl. WILSON, James C.: Vietnam in Prose and Film. 1982. S.5.
22
Vgl. KARNOW (1997) S. 24 und 34.
23
Vgl. ebenda S. 33.
24
Zitiert in ebenda S. 481.
25
Ebenda S. 34.
2 Geschichte des Vietnamkrieges
7
des Krieges mehr und mehr zwangsweise) eingezogene, vorwiegend aus den unteren sozialen
Schichten stammende Soldaten, die für nur ein Jahr nach Vietnam geschickt wurden. Damit be-
stand für viele das Hauptanliegen im Überleben.
26
Befehlsverweigerungen und sogar das Töten
von Vorgesetzten (,,fragging") gehörten ebenso zu den Realitäten dieses Krieges wie ein massi-
ves Drogenproblem der amerikanischen Soldaten
27
.
28
Diese Besonderheiten verursachten und hatten Auswirkungen auf typische Situationen des Krie-
ges, besonders auf die ,,search & destroy"-Missionen. Diese bestanden darin, NLF-Kämpfer und
Sympathisanten in den (Wehr-)Dörfern aufzuspüren und zu töten. Oft jedoch hielten die Solda-
ten dem Druck und der Angst nicht stand und töteten die, die sie in diesem Krieg offiziell verteidi-
gen sollten.
29
Viele Vietnamesen, die bis dahin nichts mit der NLF zu tun hatten, begannen sie
aus Hass auf die USA zu unterstützen. Die massiven Bombardierungen des Südens, unter ande-
rem mit Brandbomben aus Napalm, und das Besprühen von Waldgebieten mit ca. 46 Millionen
Litern des dioxinhaltigen Pflanzengifts Agent Orange
30
, zeigten derart verheerende Wirkung,
dass der Ausspruch eines amerikanischen Offiziers nach einem Kampf stellvertretend für die a-
merikanische Kriegsführung stehen kann: ,,We had to destroy the town in order to save it."
31
2.3 Kritik
Es ist unmöglich für einen Film über einen Krieg, nicht in irgendeiner Form Stellung zu diesem
Krieg zu beziehen. Keine Stellungnahme ist durch die Abwesenheit von Kritik letztlich auch eine
Stellungnahme.
Mit dem Vietnamkrieg bzw. dessen Durchführung kann wohl kein Amerikaner zufrieden sein.
Selbst die Befürworter haben eine Niederlage zu verkraften. Entsprechend ist zu erwarten, dass
die Filme über den Vietnamkrieg, so sie denn eine explizite Stellungnahme vornehmen bzw.
beinhalten, auf im politisch-historischen Diskurs vorgebrachte Kritik zurückgreifen.
Diese Kritik kam und kommt also aus verschiedenen Ecken. Eine grundlegende Unterscheidung
kann zwischen zwei Positionen gemacht werden.
Die erste Position wurde (und wird) von vielen Militärs und konservativen Politikern vorgebracht
und ist prinzipiell kriegsbefürwortend. Die Kritik gilt einer zu beschränkten und vorsichtigen
Kriegsführung, die zu sehr Rücksicht auf die von den Medien missinformierte Öffentlichkeit ge-
nommen habe. Ungeschlagen auf dem Schlachtfeld sei der Krieg ,,zu Hause" verloren worden. In
den Worten George Bushs: ,,[The soldiers were] asked to fight with one hand tied behind their
back."
32
Eine Analogie zur Dolchstoßlegende in Deutschland nach dem 1. Weltkrieg ist unüber-
sehbar.
Die zweite Position war (und ist) kriegsablehnend. Ihre Argumente können analytisch in prinzipiel-
le und konkrete unterteilt werden.
26
Vgl. ebenda S. 481.
27
1971 war mehr als ein Drittel der zu dieser Zeit im Vietnamkrieg eingesetzten Soldaten drogenabhängig.
28
Vgl. KARNOW (1997) S. 31.
29
Vgl. ebenda S. 481-487.
30
Vgl. o.A.: Dioxin im Krieg. Die Zeit Nr. 17 (16. April) 2003. S. 35.
31
Vgl. KARNOW (1997) S. 453.
32
Ebenda S. 15.
2 Geschichte des Vietnamkrieges
8
1. Prinzipielle
Argumente
Wenn einmal Argumente beiseite gelassen werden, die sich gegen jeden Krieg richten (bei-
spielsweise moralische von Seiten religiöser Gruppen), können zwei prinzipielle Argumente
gegen den Krieg unterschieden werden:
a) Radikal-politisch
Diese Argumentationslinie bezweifelt die offiziellen Motive für den Krieg und unterstellt Motive
imperialistischer und letztlich ökonomischer Art. Mit den Zielen werden auch die Mittel abge-
lehnt. Eine solche Kritik war während des Krieges weder aus dem politischen noch aus dem
militärischen Establishment zu vernehmen, sondern wurde (und wird) von politischen Kom-
mentatoren mit ,,Außenseiterstatus" wie Howard Zinn und Noam Chomsky geäußert. Beson-
ders hervorgehoben werden politisch angeordnete militärische Operationen und Strategien
wie die ,,search & destroy"-Missionen, die Bombardierungen des Südens und Nordens und
der Einsatz von Agent Orange und Napalm.
33
b) Militärisch-ökonomisch
Bei dieser Argumentation wird die (offizielle) Zielsetzung propagiert und unterstützt, auch die
militärischen Mittel werden gutgeheißen. Die Bedeutung Vietnams aber sei zu gering für den
massiven und verlustreichen Einsatz der USA, teilweise wird ein Sieg (von einigen Militärs
und Angehörigen der Geheimdienste) in Zweifel gezogen. Diese Position entwickelte sich
vernehmbar erst im Laufe des Krieges und wurde als Position der ,,doves" identifiziert.
34
2. Konkrete
Argumente
,,Konkrete Argumente" gegen den Krieg meint solche, denen Details des Krieges oder seiner
Begleitumstände zugrunde liegen: Die Limi-
tierung der Einberufung auf unter Schich-
ten
35
, die spätere Steigerung der Einberu-
fungsquoten
36
, die zu hohen eigenen Ver-
luste
37
, ,,body counts" als unrühmliche Er-
folgsindizes
38,
39
, und andere.
Von besonderem Interesse soll hier ein
Komplex sein, der im vorherigen Kapitel be-
reits dargestellt wurde: Das Verhalten des
Militärs. In die Öffentlichkeit gelangte das
Verhalten der Soldaten gegenüber Freund und Feind im September 1969, als in den Medien
über das Massaker von My Lai im März 1968 berichtet wurde. In diesem südvietnamesischen
Wehrdorf hatten amerikanische Truppen 350-500 unbewaffnete Zivilisten ermordet. Im Laufe
33
Vgl. beispielsweise CHOMSKY (1991) S. 21-51; VLASTOS (1991) S. 52-74.
34
Die Position der Kriegsbefürworter und Fürsprecher zunehmender Eskalation nannte man ,,hawks". Vgl. KARNOW
(1997) S. 516-517; CHOMSKY (1991) S. 28-29.
35
Vgl. ebenda S. 358.
36
Vgl. ebenda S. 495.
37
Vgl. KARNOW (1997) S. 24.
38
Vgl. ebenda S. 34 und 494.
39
Vgl. Abb.: Kritik am ,,body count"-Index in der Kunst. In: KIENHOLZ, Ed: 11th Hour Final. 1968. (Ausschnitt)
2 Geschichte des Vietnamkrieges
9
dieser Berichterstattungen wurde auch über andere amerikanische Kriegsverbrechen berich-
tet, die vorher tabuisiert waren.
40
Auch Routine-Operationen wie beispielsweise die ,,CIA
Phoenix Operation" nach der Tet-Offensive bis 1971 mit Tausenden getöteten mutmaßlichen
NLF-Sympathisanten wurden nun publiziert.
41
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Vietnamkrieg einige Besonderheiten aufweist, die
vor allem den Verlauf des Krieges, die Einberufungspraxis der USA sowie das Verhalten der US-
Soldaten betreffen. Kritik am Vietnamkrieg kam aus sämtlichen politischen Lagern. Sie bezieht
sich auf die Kriegsgründe, das Ausmaß des Engagements der USA sowie die zuvor genannten
Besonderheiten des Krieges.
40
Vgl. besonders: WELLS, Tom: The War Within: America's Battle Over Vietnam. 1994. S. 388-389; DOMINIKOWSKI
(1993) S. 45.
41
Vgl. VLASTOS (1991) S. 63.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
10
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
Vor der Entwicklung des Untersuchungsdesigns, bei der die Ergebnisse aus Kapitel 2 in ein film-
analytisches Kategorienschema eingearbeitet werden, erfolgt zunächst die Darstellung der Theo-
rie der Filmanalyse. Dabei wird zum einen auf die Grundlagen der Filmanalyse und zum anderen
auf das Genrekonzept eingegangen.
3.1 Grundlagen der Filmanalyse
Film darunter soll hier ausschließlich Spielfilm verstanden werden ist ein Medium, das sich
einer Analyse auf den ersten Blick zu entziehen scheint. Die Rezeption eines Filmes findet inner-
halb einer vorgegeben Zeit der Filmdauer statt, in der sich seine Bestandteile Bild, Ton und
Musik normalerweise ständig ändern. Der Film beinhaltet also die Dimension ,,Zeit": Anders als
beispielsweise bei einem Foto liegt das Objekt nicht ständig in seiner Gesamtheit vor. Zumindest
das Bild kann ,,eingefroren" werden, wenn der Film als Video oder DVD rezipiert wird; es bleibt
aber dennoch nur ein Bild eines ganzen Films: Es enthält ebenso viele Informationen wie ein Fo-
to, wird jedoch durch akustische Informationen ergänzt. Das bedeutet, dass der Film neben der
analytisch problematischen Zeitdimension eine nicht zu bewältigende Komplexität aufweist. Als
Analysegrundlage dient deshalb niemals der ganze Film, sondern nur das, was aufgenommen
und verarbeitet werden kann. Aus diesen Informationen trifft der Analyst nochmals eine Auswahl,
d.h. er interpretiert sie Helmut Korte spricht von der ,,Subjektivität des Untersuchenden"
42
-, um
die immer noch unverarbeitbar große Menge auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren und bedeu-
tungsirrelevante Informationen auszublenden.
Korte versteht Filmanalyse
43
entsprechend auch als ,,Versuch", nämlich ,,das eigene subjektiv und
objektiv determinierte Filmerlebnis durch Untersuchung der rezeptionsleitenden Signale im Film,
durch Datensammlung, Datenvergleich am Film und den filmischen Kontextfaktoren, durch Beo-
bachtung und Interpretation schrittweise zu objektivieren."
44
Auch am Ende des Prozesses steht
eine Interpretation. Die hier angesprochenen Arbeitsschritte zwischen den Interpretationen, die
das Ergebnis der Analyse so weit wie möglich nachvollziehbar und verstehbar machen sollen, hat
Werner Faulstich in seinem Grundkurs Filmanalyse anschaulich systematisiert.
45
Er unterschei-
det vier Zugriffe auf den Film, die sich gegenseitig ergänzen: Die Handlungsanalyse, die Figu-
renanalyse, die Analyse der Bauformen und die Analyse der Normen und Werte.
46
Als ,,Wahr-
nehmungshorizont"
47
der Analyse soll dabei das Genre des Films
48
herangezogen werden.
49
Die Handlungsanalyse soll den Inhalt und die Reihenfolge des Films bestimmen. Sie nutzt zu
diesem Zweck zwei unterschiedliche Arten der Transkription des Films: Zum einen das Filmpro-
tokoll, das jede einzelne Einstellung mit den wichtigsten Variablen erfasst, zum anderen das Se-
42
KORTE, Helmut: Einführung in die Systematische Filmanalyse: Ein Arbeitsbuch. 2001. S. 15.
43
Die Filmanalyse hat wie jede andere (Teil-)Disziplin ihre eigene Terminologie entwickelt bzw. technische Begriffe der
Filmproduktion übernommen. Alle notwendigen und in dieser Arbeit verwendeten Begriffe werden in Kapitel 3.5 erläu-
tert.
44
KORTE, Helmut: Möglichkeiten und Bedingungen der Systematischen Filmanalyse. 1986. S. 17.
45
Vgl. FAULSTICH, Werner: Grundkurs Filmanalyse. 2002.
46
Vgl. ebenda S. 25-27.
47
Ebenda S. 27.
48
Siehe dazu das folgende Kapitel.
49
Vgl. FAULSTICH (2002) S. 27-58.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
11
quenzprotokoll, das (in seiner gegliederten Form) handlungslogisch den Film organisiert.
50
Je
nach Erkenntnisinteresse bieten sich dabei unterschiedliche tabellarische oder grafische Darstel-
lungsverfahren an.
51
Dennoch bleibt der Film (und nicht die Transkriptionen) Grundlage der Ana-
lyse.
52
Die Figurenanalyse widmet sich der Darstellung und Interpretation (potentiell) aller auftretenden
Figuren. Wesentlich sind dabei Eigen- und Fremdcharakterisierung, Rollen, Komplexität und Dy-
namik (d.h. Veränderungen).
53
Die Analyse der Bauformen untersucht die technische Seite des Films. Sie beinhaltet zum einen
die Analyse der Kamera, der Montage sowie die Audioanalyse. Die Kamera wird anhand ihrer
Einstellungsgröße, -perspektive und -länge, der Kamera- und Objektbewegung sowie der Ach-
senverhältnisse analysiert. Die Montage beinhaltet die Mise-en-scéne, d.h. die Bildkomposition
innerhalb einer Einstellung, sowie die Verbindung von Einstellungen mittels Schnitt oder Blenden.
Audio meint Dialog (vielleicht besser: Gesprochenes), Geräusch und Musik, wobei prinzipiell zwi-
schen Musik im On als Teil der Handlung, d.h. auch die Figuren können sie hören und Musik
im Off nur für den Zuschauer hörbar unterschieden wird. Die Analyse der Musik ist dabei ähn-
lich der Charakterisierung der Figurenanalyse vorzunehmen. Die Unterscheidung von On und Off
kann auch für Gesprochenes der Off-Kommentar und Geräusch gelten. Zum anderen gehö-
ren die Analyse der räumlichen Anordnung des Geschehens, von Licht und Farbe zur Analyse
der Bauformen.
54
Die Analyse der Normen und Werte schließlich nimmt die vorher aufgeführten analytischen Zu-
gänge zum Film auf und führt sie weiter, um zu einer Interpretation des Films zu gelangen. Je
nach Erkenntnisinteresse und Filmmaterial können hier nach Faulstich vier geeignete Modelle un-
terschieden werden, wobei besonders auf die Bedeutung von Symbolen als ,,Verweisungskontex-
te, die zur Entstehungszeit des Films bzw. heute allgemein bekannt sind"
55
, hingewiesen wird.
Das erste der vier Interpretationsmodelle ist die literatur- / filmhistorische Interpretation, die den
Film in den Kontext anderer kultureller Werke rückt, um Traditionslinien (und -brüche) aufzude-
cken.
56
Die biografische Filminterpretation betrachtet und analysiert den Film im Kontext der an-
deren Werke desselben Regisseurs.
57
Die soziologische Filminterpretation ordnet den Film in ei-
nen gesellschaftlichen Kontext ein und analysiert ihn als Ausdruck konkreter Bedürfnisse seiner
Entstehungszeit.
58
Schließlich stellt die genrespezifische Filminterpretation eine Verbindung film-
historischer und soziologischer Analyse dar. Sie interpretiert den Film im Kontext seines Genres.
Aufgrund der Annahme, dass bestimmte gesellschaftliche Parameter ein solches Genre erst her-
vorbringen bzw. wiederbeleben, werden diese Parameter ebenfalls zur Interpretation herangezo-
gen.
59
Dieser Interpretationsansatz integriert dabei die Zuschauer über das Genre, da in der Gen-
50
Vgl. ebenda S. 59-94.
51
Vgl. KORTE (2001) S. 32-35.
52
Vgl. den warnenden Hinweis bei SCHÖLL, Norbert: Die Methoden der Filmanalyse eine Kritik ihrer Verwandlung
des Gegenstandes. 1983. S. 28.
53
Vgl. FAULSTICH (2002) S 95-112.
54
Vgl. ebenda S. 113-158.
55
Ebenda S. 160.
56
Vgl. ebenda S. 174-183.
57
Vgl. ebenda S. 184-193.
58
Ebenda S. 193-200.
59
Vgl. ebenda S. 200-208.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
12
reforschung ,,der Zuschauer nicht als passiver Konsument betrachtet wird, sondern als aktiver
Mitproduzent."
60
Der Genrebegriff wird im nächsten Abschnitt zunächst erläutert. Daran anschließend wird auf das
Genre Kriegsfilm im Allgemeinen sowie auf das Genre Vietnamkriegsfilm im Speziellen einge-
gangen.
3.2 Genre Kriegsfilm
Genre ist ein Konzept, das individuelle Filme nach bestimmten Kriterien zusammenfasst. Es ist
jedoch kein rein wissenschaftliches Konzept, sondern für Filmschaffende, Zuschauer und Kritiker
von Bedeutung. Kriterien sind die beiden Parameter ,icons' und ,conventions'.
61
,Icons' sind (audio-),,visuelle Symbole, die in allen Filmen des Genres auftauchen"
62
, ,conventi-
ons' sind ,,bestimmte Handlungsmuster, stereotype Charaktere und allgemein anerkannte Ideen
(...), die sowohl dem Filmemacher wie auch dem Zuschauer gleichermaßen bekannt und mit
ähnlichen Konnotationen aufgeladen sind."
63
Diese Parameter identifizieren nicht nur einen Gen-
refilm, sie wirken ebenso als Regelwerk für die Filmschaffenden. Die Regeln hat der Zuschauer
durch seine eigenen Filmerfahrungen und durch Repräsentanten der Filmindustrie (vor allem Kri-
tiker) erlernt.
64
Das resultierende Genrewissen führt einerseits zu konkreten Genreerwartungen,
andererseits wird es zur Interpretation von Genrefilmen herangezogen: Genre setzt eine Art
Rahmen,
65
und das durchaus im Goffman'schen Sinne. Die Rahmengrenzen wie auch die Rah-
meninhalte werden durch die ,icons' und ,conventions' eines Genres definiert und identifiziert.
Das für diese Arbeit relevante Genre ist das des Kriegsfilms. Faulstich beschreibt dieses Genre
als ,,thematisch definiert"
66
, Solomon hingegen als ein formloses Genre, da es sehr viele unter-
schiedliche Themen beinhalte.
67
Definierbar sei es deshalb nicht über die Ikonografie oder die
narrative Struktur, sondern höchstens über ,,a certain kind of atmosphere".
68
Solomons Vorstel-
lung von Kriegsfilm ist sehr weit gefasst, während im popkulturellen Diskurs (dessen Bedeutung
Altman besonders hervorhebt
69
) wohl eher ein Verständnis vorliegt, welches das Genre des
Kriegsfilms auf das narrative Thema Krieg und daraus abgeleitete ,icons' und ,conventions' be-
schränkt.
70
Vietnamkriegsfilme
71
können der Einfachheit halber als ein Subgenre der Kriegsfilme verstanden
werden
72
. ,Icons' sind hier vor allem militärische Elemente wie Waffen(-systeme) (z.B. Huey-B
60
WINTER, Rainer: Filmsoziologie: Eine Einführung in das Verhältnis von Film, Kultur und Gesellschaft. 1992. S. 57.
Kursiv im Original.
61
MODLESKI, Tania: A Rose Is a Rose? Real Women and a Lost War.1998. S. 245.
62
HALBERSTAM, David: Platoon. 2000. S. 21.
63
Ebenda S. 21.
64
Vgl. BECK, Avent: The Christian Allegorical Structure of Platoon. Literature Film Quarterly Vol. 20 No. 3. 1992. S. 124.
65
Vgl. BATES, Milton J.: The Wars We Took to Vietnam: Cultural Conflict and Storytelling. 1996. S. 10 und 134; KA-
GAN, Norman: The Cinema of Oliver Stone. 2000. S. 77.
66
PALMER, William J.: Symbolic Nihilism in Platoon. 1990. S. 28.
67
Vgl. ROBERTS, Randy / WELKY, David: A Sacred Mission: Oliver Stone and Vietnam. 2000. S. 243.
68
Ebenda S. 244.
69
Vgl. BECK (1992) S. 123-127.
70
Vgl. beispielsweise PALMER (1990).
71
Im Sinne der für die vorliegende Arbeit als relevant definierten ,,Combat"-Filme, siehe Kap. 3.3.
72
Beispielsweise GOFFMAN, Erving: Asyle: Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen.
1972. S. 2, im Gegensatz dazu bspw. TAYLOR, Clyde: The Colonialist Subtext in Platoon. 1997. S. 109-112.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
13
Mehrzweckhubschrauber
73
, B-52 Bomber und M-16 Sturmgewehre
74
auf Seiten der Amerikaner)
und anderes Kriegsgerät sowie Uniformen u.ä.
75
, die (audio-)visuell in Szene gesetzt werden.
Dazu gehören aber auch auditive Elemente wie die Vietnam-typische Terminologie der Soldaten
in Bezug auf militärische Bezeichnungen und Abkürzungen
76
und handlungs-aktuelle (Rock-)
Musik. Die ,icons' dieses Genres haben sich nicht so sehr im Zuge einer Genreevolution entwi-
ckelt; sie entstammen vielmehr der historischen Realität des Krieges und der medialen Realität
der TV-Nachrichten, welche die Rahmengrenzen setzen.
77
Diese Rahmengrenzen sind folglich
relativ starr, Verschiebungen sind aber durch Veränderungen im kulturellen, politischen oder i-
deologischen Kontext der Filmentstehung denkbar (in Bezug auf Obszönität der Sprache, Dar-
stellung des Gebrauchs und der Wirkung von Waffen etc.).
Die ,conventions' des Vietnamgenres sind hingegen eine Mischung aus historischer Realität und
zunächst übernommenen, dann aber stark abgeänderten Rahmengrenzen des Kriegsfilmgenres.
Nach Kaminsky sind dies folgende fünf: ,,the mission, the justification for involvement of the war,
the development of the symbiotic relationships within the units to survive, the stark and open
landscape, and the elevation of characters above the madness and violence of the war."
78
Die
Einflüsse der historischen Realität bestehen aus den Besonderheiten des Vietnamkrieges
79
und
seiner Umstrittenheit
80
.
Welche konkreten ,conventions' und Rahmengrenzen im Laufe der Zeit entstanden sind, welche
Ausgangspunkte und Regeln somit für die vier ausgewählten Filme dieser Arbeit gelten, wird in
Kapitel 4.1 für die Zeit bis 1986 sowie in Kapitel 4.4 für die Zeit zwischen 1987 und 2000 unter-
sucht.
In den verbleibenden drei Abschnitten des 3. Kapitels wird das Untersuchungsdesign der Film-
analyse der vorliegenden Arbeit dargestellt.
Im nächsten Kapitel wird zunächst erklärt, welche vier Filme für die Analyse ausgewählt werden.
Ausführlich werden die Gründe für diese Auswahl erörtert. Im anschließenden Kapitel 3.4 werden
die Analysekategorien, die der Filmanalyse zugrunde liegen, erarbeitet. Im abschließenden Kapi-
tel 3.5 wird die Operationalisierung der Analysekategorien vorgenommen.
3.3 Filmauswahl
Der Vietnamkrieg brachte unzählige US-amerikanische Spielfilme hervor, die ihn durch die Filmfi-
gur des Kriegsveteranen oder als bloßen historischen Hintergrund in Erinnerung riefen und so zu
einer Modeerscheinung in den 1980er Jahren werden ließen. Die Filme, die sich ernsthaft mit
dem Krieg auseinander setzen, können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zum einen ist es
73
Vgl. besonders BAXTER, John: Stanley Kubrick: A Biography. 1998. S. 150-151 Der offizielle Name des Huey ist
HU-1 (Helicopter, Utility, 1), vgl. http://www.arkairmuseum.org/huey.html.
74
Zu Beginn des Krieges verwendete die US-Armee Gewehre des Vorgänger-Models M-14 vgl. http://www.
173rdairborne.com/weapons.htm.
75
Vgl. TAYLOR (1997) S. 247-248.
76
Vgl. MODLESKI (1998) S. 224.
77
Allerdings könnte man argumentieren, dass es Vorstellungen von der historischen Realität sind, die Rahmengrenzen
setzen, und dass diese Vorstellungen durch Vietnamfilme geschaffen werden, also sich letztlich die ,icons' durch eine
Genreevolution entwickeln. Auf eine Diskussion dieses Punktes soll hier verzichtet werden.
78
TAYLOR (1997) S. 248.
79
Siehe Kapitel 2.2.
80
Siehe Kapitel 2.3.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
14
die Gruppe der so genannten ,,Coming Home"-Filme, die Probleme der Vietnamveteranen in den
USA behandeln;
81
zum anderen ist es die Gruppe der so genannten ,,Combat"-Filme, die ,,the ex-
perience of the war by American soldiers"
82
thematisieren. Diese zweite Gruppe bildet das Sub-
genre des Vietnamkriegsfilms
83
und ist Grundlage der vorliegenden Arbeit.
Die Auswahl der Filme sollte die Klassiker des Genres beinhalten. Sie verdanken ihren Status als
Klassiker u.a. ihrem großen Einfluss auf das Genre selbst (oder besser: ihrer bedeutenden Rolle
bei der Bildung des Genres)
84
und auf nachfolgende Filmschaffende. Sie sind das Maß, an dem
spätere Filme von der Kritik und vom Publikum so es denn die Klassiker kennt gemessen
werden. Bei einem Vergleich mit aktuellen Filmen bieten sie sich daher als Basis an. Zudem ist
der Vietnamkrieg ein Thema, das in den USA lange Zeit äußerst kontrovers diskutiert wurde
85
.
Auch heute noch wird der Krieg als mahnendes Beispiel herangezogen so auch vor und wäh-
rend des Irakkrieges.
86
Da Filme nicht nur als Unterhaltung verstanden werden können, sondern
Geschichte porträtieren und interpretieren
87
, haben Filme über den Vietnamkrieg reale Konse-
quenzen: Sie tragen dazu bei, die Sichtweise über den Krieg zu formen. Das gilt in besonderem
Maße für den Vietnamkrieg, der eng mit den Filmen in den Nachrichten (,,Wohnzimmerkrieg")
verbunden ist, aber ,,immer auch die filmischen Inszenierungen des Krieges [bedeutet]."
88
Der
Status einiger Filme als Klassiker entspringt auch ihrem überproportionalen Einfluss auf diesen
Prozess. Daher ist es auch aus soziopolitischen Gründen sinnvoll, sie zu einem Vergleich mit ak-
tuellen Filmen heranzuziehen. Ebenso sinnvoll ist es, Filme aus nur einer Gesellschaft zu be-
trachten. Da es sich beim Vietnamkrieg (auch) um einen US-amerikanischen Krieg handelt und
aufgrund der internationalen Dominanz Hollywoods werden in der vorliegenden Arbeit aus-
schließlich US-amerikanische Spielfilme analysiert.
Von den Filmen, die den Status des Klassikers für sich beanspruchen können The Deer Hunter
(1978, R.: Michael Cimino), Apocalypse Now (1979, R.: Francis Ford Coppola), Platoon (1986,
R.: Oliver Stone) und Full Metal Jacket (1987, R.: Stanley Kubrick)
89
erscheint The Deer Hunter
für die vorliegende Arbeit ungeeignet, da er kein eigentlicher ,,Combat"-Film ist.
90
Bei den übrigen
drei Filmen kann eine Reduzierung auf zwei
91
nicht durch einen der Filme selbst begründet wer-
den. Es ist jedoch sinnvoll, die beiden jüngeren Filme zu analysieren, da deren Distanz zum Viet-
namkrieg größer ist. Das bedeutet filmhistorisch einen größeren Textkörper, auf den sie zurück-
greifen (können) und soziopolitisch ein weiter entwickeltes Verständnis, das sie einbeziehen
(können), so dass diese Filme über den Vietnamkrieg (potentiell) mehr zu sagen haben. Ein zwei-
ter Grund ist eher zufällig: Beide nun in Frage kommenden Filme Platoon und Full Metal Jacket
81
Vgl. bspw. PALMER, William J.: The Films of the Eighties: A Social History. 1993. S. 20-21. Palmer nennt als ersten
Film dieser Art Taxi Driver (1976, R.: Martin Scorsese).
82
RASMUSSEN, Karen / DOWNEY, Sharon D.: Dialectical Disorientation in Vietnam War Films: Subversion of the My-
thology of War. Quarterly Journal of Speech Vol. 77 No. 2 (1991). S. 176, kursiv im Original. Rasmussen und Downey
ordnen ,,Coming Home"-Filme in eine größere Gruppe der Filme ein, die den Einfluss des Krieges zeigen.
83
Siehe Kapitel 3.2.
84
Siehe Kapitel 4.4.
85
Siehe Kapitel 2.3.
86
Vgl. etwa HOFFMAN, Dustin: "Schon Vietnam begann mit einer Lüge". Gekürzte und übersetzte Rede auf der Gala
,,Cinema for Peace" während der Berlinale 2003 in Berlin. Stern Nr. 9 v. 20.02. 2003. S. 44., über die Kriegsgründe
oder NASS, Matthias: Zwei Schurken im Visier. Die Zeit Nr. 15 v. 03.04.2003. S.4. über die Folgen einer destabilisie-
renden Politik.
87
Vgl. PALMER (1993) S. 10-11.
88
REINECKE, Stefan: Hollywood goes Vietnam: Der Vietnamkrieg im US-amerikanischen Film. 1993. S. 7.
89
Vgl. für eine Einschätzung dieses Status bspw. PALMER (1990). S. 22 und 25.
90
Siehe Kapitel 4.1.
91
Die Analyse von mehr als zwei Klassikern würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
15
erschienen innerhalb nur eines halben Jahres. Sie können so zumindest zeitlich als eine Art
,,Einheit" betrachtet werden.
Nach einer langen Zeit ohne jeden größeren Vietnamfilm
92
kamen in den Jahren 2000 und 2002
zwei neue Filme heraus: Tigerland (2000 R.: Joel Schumacher) und We Were Soldiers (2002 R.:
Randall Wallace). Tigerland ist ein Film, der vollständig in den USA spielt: Zuerst in einem Trai-
ningscamp, dann in einem Vietnam simulierenden Gelände. Er ist daher kein ,,Combat"-Film im
eigentlichen Sinne. Doch diese so genannten ,,Training Camp"-Filme können durchaus zu den
,,Combat"-Filmen gerechnet werden, weil sie wie Jeanine Basinger über eine entsprechende
Zuordnung bei Filmen über den Zweiten Weltkrieg schreibt ,,present or maintain the conventi-
ons of combat in a noncombat situation (...). Although they contain no actual combat, they con-
tain fist fights, war games, and conflicts of many other kinds. These conflicts represent the war
these military men are being trained to fight."
93
Ein zweites Argument für die Analyse Tigerlands
ist, dass er mit We Were Soldiers eine ähnliche zeitliche ,,Einheit" bildet wie die beiden Filme Mit-
te der 1980er Jahre.
Diese vier Filme werden kategoriebezogen analysiert. Im Folgenden werden die für die Fragestel-
lung der vorliegenden Arbeit relevanten Analysekategorien herausgearbeitet.
3.4 Analyse-Kategorien
Die Kategorien zur Analyse eines Films sind nicht festgelegt. Ihre Auswahl hängt einerseits vom
Erkenntnisinteresse, andererseits vom Filmmaterial ab. Der Vietnamkrieg war ein besonderer und
äußerst kritisch begleiteter Krieg.
94
Daher werden zwei Kategorien für die Filmanalyse gebildet,
die besonders geeignet scheinen, die Parameter Besonderheiten des Krieges und Kritik am Viet-
namkrieg zu erfassen. Die Filme werden einerseits daraufhin geprüft, ob und wie sie diese Para-
meter beschreiben, interpretieren und veranschaulichen. Andererseits wird untersucht, inwiefern
die Filme die ,conventions' des Kriegsfilmgenres
95
übernehmen, oder ob sie von ihnen abwei-
chen, um auf diese Art die beiden Parameter des Vietnamkrieges zu kommentieren.
Eine dritte Kategorie wird gebildet, die die Darstellung der Vietnamesen analysiert. Der Vietnam-
krieg wird häufig als amerikanische Tragödie dargestellt. Die Perspektive der Vietnamesen wird
dabei meist außer Acht gelassen. Von Interesse für die Filmanalyse ist deshalb die Frage, inwie-
weit ein differenziertes Bild der Vietnamesen gezeichnet wird.
Daraus ergeben sich folgende drei Analysekategorien:
1. Die Beurteilung des Krieges
In dieser Kategorie wird analysiert, inwiefern der Film Stellung zum Vietnamkrieg (und nicht
zu Krieg im Allgemeinen) bezieht. Eine solche Stellungnahme ist auf verschiedene, analytisch
trennbare Weisen möglich, so dass diese Kategorie in drei Subkategorien unterteilt wird.
92
Der vorerst letzte war Casualties of War (1989, R.: Brian De Palma). Siehe Kapitel 4.4.
93
BASINGER, Jeanine: The World War II Combat Film: Anatomy of a Genre. 1986. S. 13.
94
Siehe Kapitel 2.2 und 2.3.
95
Siehe 3.2.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
16
a) Gründe für den Krieg
Diese Subkategorie dient der Analyse konkreter Aussagen des Films (durch Sprache
oder filmische Mittel) zu Kriegsgründen oder rechtfertigungen. Zwei Genre-,conventions' des
Kriegsfilms, die ebenfalls als solche Aussagen verstanden werden können, werden zusätzlich
herangezogen. Die erste ist "the mission". Eine Mission der Hauptfigur stellt eine nachvoll-
ziehbare Aufgabe und über Identifikation ein erstrebenswertes Ziel dar, solange die Hauptfi-
gur es als solches empfindet. Dadurch wird dem Krieg ein Sinn und eine gewisse Rechtferti-
gung gegeben. Die zweite `convention' ist "the justification for involvement of the war".
b) Kriegsschauplatz Vietnam
Eine Kritik am Vietnamkrieg war, dass Vietnam zu unbedeutend und zu weit weg für ein Ein-
greifen der USA sei. Hier wird geprüft, ob und in welcher Weise der jeweilige Film zu diesem
Kritikpunkt Stellung bezieht. Die ,convention' des Kriegsfilmgenres, die sich dem Kriegs-
schauplatz widmet, ist die der ,,stark and open landscape". Solch eine Landschaft vermittelt
Über- und Durchblick, Aspekte, die sowohl einem Großteil der Landschaft Vietnams als auch
dem Vietnamkrieg abgesprochen werden. Es wird untersucht, ob der Film mittels optischer
Eindrücke der Landschaft den Krieg beurteilt.
c) Details des Krieges
Diese Subkategorie befasst sich mit konkreter und detaillierter Kritik am Vietnamkrieg: Zu ho-
hen Verlusten der eigenen, also US-Soldaten, dem ,,body count"-Index (auch in der Form der
,,Kill Ratio") zur Ermittlung von Erfolg und der Einberufungspraxis in den USA.
Nach den Analysen der drei Subkategorien wird ein Fazit über die Beurteilung des Krieges
abgegeben.
2. Die Darstellung des US-Militärs
Im Zentrum der Kritik stand auch das Militär, nachdem Einzelheiten über das Massaker von
My Lai bekannt wurden. Deshalb wird hier untersucht, wie das Auftreten der US-Soldaten ge-
genüber den Vietnamesen (Gegner, aber auch Verbündete) dargestellt wird. Theoretisch
werden die Vietnamesen in Gegner (NVA und NLF) und Verbündete (ARVN und Zivilisten
Südvietnams) eingeteilt, wobei in den analysierten Filmen nicht unbedingt alle Gruppen vor-
kommen. Genre-,conventions' des Kriegsfilms, die allgemeineres Verhalten von Soldaten
zum Inhalt haben, gibt es zwei. Erstens "the development of the symbiotic relationships within
the units to survive", zweitens ,, the elevation of characters above the madness and violence
of the war". Beide `conventions' enthalten Elemente, den Krieg über die positiven Aspekte
des Militärs zu rechtfertigen. Sie sind aber mehr noch Ausdruck der Vorstellung, Soldaten im
Krieg zumindest die des Staates, dessen Position der Film übernimmt verhielten sich im
Kriege ehrenhaft und würden das gilt zumindest für die Hauptfigur(en) erst durch den
Krieg besondere positive Eigenschaften entwickeln. Ein ,,dem Krieg angemessenes Verhal-
ten" dem Gegner gegenüber gehört dazu und schließt Massaker oder ähnliche Grausamkei-
ten aus.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
17
3. Die Darstellung der Vietnamesen
In der Regel stellen Kriegsfilme, die einer der Kriegsparteien positiv verbunden sind, die
Gegner negativ dar. Diese Analysekategorie befasst sich mit der Frage, wie bei der Darstel-
lung des Vietnamkriegs die gegnerischen Vietnamesen charakterisiert werden. Da aber auch
die eigentlich verbündeten Südvietnamesen als potentielle NLF-Kämpfer angesehen wurden,
und sich die USA oft wie eine Besatzungsmacht verhielt, soll ebenso ihre Darstellung analy-
siert werden. Zu dieser Darstellung gehört für beide Seiten die Frage, ob und wie über ih-
re Situation, Interessen o.ä. informiert wird.
Die Konzentration auf diese drei Kategorien bedeutet, dass andere Kategorien nicht oder gege-
benenfalls nur am Rande betrachtet werden. Welche konkreten Analyseverfahren angewendet
und welche Hintergrundinformationen integriert werden, wird im folgenden Kapitel erörtert.
3.5 Operationalisierung
Die Filmanalyse bietet zahlreiche Untersuchungsinstrumente und Zugangsmöglichkeiten zu ei-
nem Film. Wie die Bildung der Analysekategorien ist ihre Wahl abhängig von Filmmaterial und
Erkenntnisinteresse, und damit auch direkt von den Analysekategorien.
96
Für die Untersuchung
der vier Vietnamkriegsfilme erweisen sich einige dieser Analyseinstrumentaria und Zugangsmög-
lichkeiten als besonders sinnvoll und ergiebig. Sie werden im Folgenden zusammen mit der
Analysestruktur sowie den wesentlichen Begrifflichkeiten erläutert.
Zunächst werden Produktionsnotizen zu den Filmen erstellt. Diese beinhalten eine kurze Entste-
hungsgeschichte des Films, ökonomische Eckdaten der Filme (Produktionskosten und Einspiel-
ergebnis), eventuelle Preisnominierungen bzw. gewinne sowie den Termin der Uraufführung.
Soweit nicht anders verfügbar, basieren die Daten auf der ,,Internet Movie Database", der wohl
seriösesten Filmdatenbank im Internet.
97
Allerdings können gerade für neuere Filme nicht immer
alle Daten ermittelt werden.
Im nächsten Schritt werden wesentliche historische Darstellungen in den Filmen vor allem die
Schlachten kurz darauf geprüft, inwieweit sie der historischen Realität entsprechen. Bis auf Full
Metal Jacket, der auf einem Roman basiert, haben die Filme teils mehr und teils weniger und
auch teils mehr und teils weniger explizit Erfahrungen der Autoren zur Grundlage. Da es sich
bei den ausgewählten Filmen jedoch um Spielfilme handelt, wird der Faktor Realismus den Ana-
lysekategorien untergeordnet.
In der anschließenden Analyse der Struktur des Films wird einerseits die Handlung des Films a-
nalytisch dargestellt, andererseits werden für die Analysekategorien grundlegende Strukturmerk-
male herausgearbeitet. Eine wichtige Unterscheidung dabei ist die zwischen Story und Plot. Story
ist die chronologisch geordnete und dargestellte Geschichte inklusive aller implizierten Ereignis-
se, Plot ist das Gezeigte vom Anfang bis Ende.
98
96
Natürlich ist die Wahl auch abhängig vom Faktor Zeit.
97
http://www.imdb.com
98
Vgl. LACEY, Nick: Narrative and Genre: Key Concepts in Media Studies. Basingstoke et al. 2000. S. 16-17.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
18
Nach der Strukturanalyse folgen die Analysekategorien, deren Untersuchung auf den für sie
sinnvollen filmanalytischen Möglichkeiten basiert.
Um eine Handlungsanalyse vornehmen zu können, wird zunächst ein gegliedertes Sequenzpro-
tokoll erstellt.
99
Neben der Funktion, das Organisationsprinzip der Handlung aufzudecken, kann
es als Verweisquelle für die Filmhandlung dienen: Entsprechend wird in den Filmanalysen auf die
Sequenz(nummer) des jeweiligen Films verwiesen.
100
Eine Figurenanalyse wird nicht grundsätzlich vorgenommen, sondern nur dann, wenn ein Para-
meter der Figurenanalyse für die Analysekategorien sinnvoll ist. Im Wesentlichen sind diese Pa-
rameter eine (Selbst-, Fremd- oder Erzähler-) Charakterisierung einer Figur, ihre dynamische
Ausgestaltung, das Casting der Rolle und die eventuelle Symbolik eines ,,telling name", d.h. eines
Namens, der über den Film hinaus eine Bedeutung besitzt.
Wie bei der Figurenanalyse dienen bei der Analyse der Bauformen des Films die Analysekatego-
rien als Maßstab bei der Entscheidung für eine Analyse. Eine wesentliche Bauform ist die Kame-
ra. Ihre Grundkategorie ist die Einstellung, die als ,,die Abfolge von Bildern, die von der Kamera
zwischen dem Öffnen und dem Schließen des Verschlusses aufgenommen werden"
101
definiert
ist. In den Sequenzprotokollen findet sich die für eine Sequenz verwendete Anzahl an Einstellun-
gen. Diese Einstellungen können in unterschiedliche Einstellungsgrößen und perspektiven, -
längen und -bewegungen der Kamera kategorisiert werden,
102
die gegebenenfalls zur Analyse
herangezogen werden. Eine zweite Bauform ist die Montage. Die Mise-en-scéne bezeichnet den
,,kalkulierten Aufbau eines Bildes und seine Veränderung ohne Schnitte"
103
, d.h. der Aufbau ist
jeweils auf eine Einstellung bezogen. Die Verbindung verschiedener Einstellungen erfolgt über
eine Blende (oder Überblende) oder durch einen Schnitt.
104
In den Sequenzprotokollen wird zu
der Anzahl der Einstellungen je Sequenz die Dauer jeder Sequenz aufgeführt, um so eine durch-
schnittliche Länge der Einstellungen je Sequenz zu erhalten. Gegebenenfalls können so analyse-
relevante Daten entnommen werden. Der gesamte Audio-Bereich eines Films wird ebenfalls zu
den Bauformen gerechnet.
105
Großer Wert bei der Analyse der Vietnamkriegsfilme wird auf Spra-
che, also Dialoge und Off-Kommentare gelegt, da sie eines der elementaren Elemente der Narra-
tion ist und wesentlich in der Bedeutungsgenerierung eines Films. Geräusch und Musik wird dort
zur Analyse herangezogen, wo es sinnvoll erscheint. Dasselbe gilt für Raumgestaltung, Licht und
Farbe.
106
Aus den vier Zugriffsmöglichkeiten der Analyse der Normen und Werte eignen sich Aspekte der
genrespezifischen Filminterpretation für die Analysekategorien. Diese bezieht das Genre ein, das
in die Analysekategorien integriert ist. Die soziologische Komponente dieses Interpretationsmo-
99
Die Sequenzprotokolle zu den Filmen finden sich im Anhang.
100
Zur Orientierung bei der Erstellung eines solchen Sequenzprotokolls werden die Beispiele bei ÖHDING, Britta-
Karolin: Thriller der 90er Jahre: Über den Zusammenhang von Struktur, Spannung und Bedeutung an ausgewähl-
ten Spielfilmen. IfAM-Arbeitsberichte Bd. 15. 1998. herangezogen.
101
FAULSTICH (2002) S. 113.
102
Für eine gelungene Übersicht siehe MONACO, James: Film verstehen: Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und
Theorie des Films und der Medien. 2002. S. 200-214.
103
FAULSTICH (2002) S. 122. Für eine ausführliche Darstellung dieser Bauform vgl. GIANNETTI, Louis: Understan-
ding Movies. 1990. S. 36-75.
104
Die Bedeutung dieser Montagetechniken wird sowohl in MONACO (2002) S. 218-228 als auch in FAULSTICH
(2002) S. 122-131 gut erläutert.
105
Für eine ausführliche Betrachtung vgl. GIANETTI (1990) 180-214.
106
Vgl. hierzu die knappe Darstellung bei FAULSTICH (2002) S. 143-149.
3 Theorie der Filmanalyse und Untersuchungsdesign
19
dells wird für die Erarbeitung möglicher Erklärungsansätze der gefundenen Ergebnisse
107
heran-
gezogen. Symbole als ,,Verweisungskontexte" werden ebenfalls im Zusammenhang mit den Ana-
lysekategorien untersucht und interpretiert.
Nach der Analyse dieser Kategorien werden die zentralen Analyseergebnisse in einem kurzen
Fazit zusammengefasst.
107
Siehe Kapitel 6.
4 Filmanalyse
20
4 Filmanalyse
In Kapitel 4 wird die Analyse der Filme vorgenommen. Zunächst jedoch werden die Vietnam-
kriegsfilme bis 1986 betrachtet. Dabei wird besonders untersucht, ob man 1986 schon von einem
Vietnamkriegsfilmgenre sprechen kann. Anschließend werden Platoon und Full Metal Jacket ana-
lysiert. Danach werden die Vietnamkriegsfilme zwischen 1987 und 2000 vorgestellt. Dabei wer-
den die Filme wiederum unter dem Genreaspekt untersucht. Es geht um die Frage, ob sich das
Genre und seine ,conventions' weiterentwickelt oder womöglich erst etabliert haben. In den letz-
ten beiden Kapitel folgen schließlich die Analysen von Tigerland und We Were Soldiers.
4.1 Vietnamkriegsfilme vor 1986
Amerikanische Kriege waren für Hollywood immer ein willkommener Anlass, unzählige Filme
darüber zu drehen, sie sich großzügig von staatlichen Stellen finanzieren zu lassen und die eige-
nen Soldaten ideologisch zu unterstützen. Während des Vietnamkrieges (und damit auch vor der
militärischen Niederlage) aber entstand nur ein einziger Hollywood-Film, der sich direkt mit ihm
beschäftigte: The Green Berets (1968, R.: John Wayne, Ray Kellogg). Dieser Film basiert in Be-
zug auf ,icons' und ,conventions' einerseits auf den anti-japanischen Filmen des 2. Weltkriegs
und den anti-kommunistischen Filmen des Koreakriegs,
108
andererseits auf einer schon 1968 an-
tiquierten Formel des Western-Genres
109
. Erste Rahmengrenzen für ein eigenes Vietnamgenre
setzte er nicht.
In den folgenden Jahren wurde der Vietnamkrieg in Spielfilmen nicht direkt thematisiert.
110
Ein
anderes Medium, das Fernsehen, sendete bereits täglich authentische Kriegsbilder in die Wohn-
zimmer.
111
Außerdem wurde Hollywood der Krieg zu kontrovers.
112
,,[U]m der Zensur und Boy-
kottmaßnahmen zu entgehen"
113
, und um überhaupt Chancen beim amerikanischen Publikum zu
haben,
114
versetzten die Filmschaffenden die Handlung in einen problemloseren Krieg
115
oder
verlegten sich auf ,,Parabeln, Metaphern und Anspielungen"
116
, wie in The Wild Bunch (1969, R.:
Sam Peckinpah) oder in Little Big Man (1970, R.: Arthur Penn).
117
Ab Mitte der siebziger Jahre wurde eine Reihe von Filmen über die Probleme der zurückkehren-
den Vietnam-Veteranen gedreht, die den Krieg als eine rein amerikanische Tragödie erscheinen
108
Vgl. WHITE, Susan: Male Bonding, Hollywood Orientalism, and the Repression of the Feminine in Kubrick's Full
Metal Jacket. 1991. S. 145.
109
Vgl. SEESSLEN, Georg / JUNG, Fernand: Stanley Kubrick und seine Filme. 1999. S. 249 und RUSSELL, Jamie:
Vietnam War Movies. 2002. S. 23.
110
Allerdings entstand eine Reihe von Dokumentarfilmen.
111
Vgl. WILLIAMS, Doug: Concealment and Disclosure: From "Birth of a Nation" to the Vietnam War Film. In: Interna-
tional Political Science Review Vol. 12 No.1. 1991. S. 34.
112
Vgl. WILSON (1982) S. 79.
113
RAMONET, Ignacio: Liebesgrüße aus Hollywood: Die versteckten Botschaften der bewegten Bilder. 2002. S.146.
114
Vgl. HÖLZL, Gebhard / PEIPP, Matthias: Fahr zur Hölle, Charlie! Der Vietnamkrieg im amerikanischen Film. 1991.
S. 14.
115
M*A*S*H (1969, R.: Robert Altman) beispielsweise spielt im Koreakrieg.
116
RAMONET (2002) S. 146.
117
Auch spätere Filme werden teilweise als Vietnam-Allegorien verstanden, beispielsweise Star Wars und Jurassic
Park. Vgl. The Rough Guide to Cult Movies. London: Rough Guides / Haymarket Customer Publishing. 2001. S.
429.
4 Filmanalyse
21
ließen.
118
1977 entstanden mit The Boys in Company C (R.: Sidney Furie) und Go Tell the Spar-
tans (R.: Ted Post) die ersten Kriegsfilme nach Kriegsende.
Ersterer ist eine Militärklamotte, noch den Konventionen des traditionellen Kriegsfilms verhaftet.
Allerdings setzt er erste Genrestandards in Bezug auf die Verarbeitung historischer Besonderhei-
ten des Krieges wie die überall lauernde Gefahr
119
und das Zeigen eines ,,fragging"-Versuchs,
außerdem etabliert er eine Erzählung durch einen Off-Kommentar
120
. Seine Aussage jedoch
bleibt konventionell: ,,[W]hatever the particular realities of the war, GI Joe is still a hero and win-
ner"
121
.
Go Tell the Spartans wird als ebenso konventionell eingestuft
122
, weicht aber in einigen interes-
santen und genrebildenden Punkten davon ab: Er zeigt die Aussichtslosigkeit des Krieges
123
,
demythologisiert den traditionellen Helden durch ständige militärische Niederlagen und sinnlose
statt heroischer Tode
124
.
Ende der siebziger Jahre entstanden zwei der berühmtesten und kontroversesten Vietnamfilme:
The Deer Hunter (1978, R.: Michael Cimino) und Apocalypse Now (1979, R.: Francis Ford Cop-
pola). The Deer Hunter ist ein dreigeteilter Film, der nur teilweise in Vietnam spielt. Für den Krieg
arbeitet er mit zwei konfligierenden Metaphern: Der Rotwildjagd des Titels und dem Russischen
Roulette (und den damit verbundenen Anforderungen, Absichten und Interessen der Akteure),
wodurch er nach Rasmussen und Downey die Kriegsmythologie des Westens sowie zentrale
Werte des Kriegerbildes unterminiere.
125
Da sich der Film überwiegend mit den Nachwirkungen
des Krieges auf die Beteiligten auseinandersetzt
126
, der Film sich auf ,conventions' des Western-
Genres stützt
127
und die Kriegsszenen wenig überzeugen
128
, hat er trotz seines großen Erfolges
nicht grundlegend zur Entwicklung eines Vietnamgenres beitragen können.
Wichtiger hierfür ist Apocalypse Now, der nicht nur unvergessliche Kinomomente schuf, sondern
auch neue Ausdrucksmöglichkeiten für eine Kritik an diesem Krieg, nämlich ,,aphoristische szeni-
sche Miniaturen, in denen die Kluft zwischen ideologischer Legitimation und Wirklichkeit der US-
Invasion ins Auge springt."
129
Aufgrund der eher ungewöhnlichen narrativen Struktur einer Reise,
die physisch wie psychisch stattfindet, wird der Film auch zu anderen Genres gezählt. Ein inte-
ressantes Beispiel findet sich bei Hellmann, der den Film dem Detektivgenre zuordnet.
130
Der
Film hat(te) großen Einfluss auf die Ikonografie des gesamten Kriegsfilmgenres, er fand sogar
Eingang in den popkulturellen Diskurs.
131
Neben Rahmengrenzen anderer Genres nimmt Apoca-
118
Vgl. RAMONET (2002) S. 80.
119
Vgl. AUSTER, Albert / QUART, Leonard: How the War was Remembered: Hollywood & Vietnam. 1988. S. 55-56.
120
Vgl. DEVINE, Jeremy M.: Vietnam at 24 Frames a Second: A Critical and Thematic Analysis of Over 400 Films
About the Vietnam War. 1995. S. 136.
121
AUSTER / QUART (1988) S. 56.
122
Vgl. bspw. REINECKE (1993) S. 35-36.
123
Vgl. RAMONET (2002) S. 161.
124
Vgl. WILLIAMS (1991) S. 36-38.
125
Vgl. RASMUSSEN / DOWNEY (1991) S. 177.
126
Vgl. DEVINE (1995) S. 158-171.
127
Vgl. HELLMANN, John: Vietnam and the Hollywood Genre Film: Inversions of American Mythology in The Deer
Hunter and Apocalypse Now. American Quarterly Vol. 34 No. 4. 1982. S. 419-429.
128
Vgl. WILSON (1982) S. 89.
129
REINECKE (1993) S. 42.
130
HELLMANN (1982). S. 429-438. Dabei kommt er zu einer recht eigenen Interpretation des Films, was anschaulich
die Bedeutung von Genre unterstreicht.
131
Bspw. spielten The Clash, die vielleicht bedeutendste Rockband ihrer Zeit, ein Lied ein, das einen Ausspruch der
Filmfigur Colonel Kilmore aufnahm: Charlie Don't Surf (1980).
4 Filmanalyse
22
lypse Now auch Bezug zu einigen des Kriegsfilms. Dabei weicht der Film von zweien ab: Zum
einen von ,,the justification for involvement of the war", zum anderen von ,,the elevation of charac-
ters above the madness and violence of the war". Aufgrund seines Sonderstatus den allgemei-
nen und den filmhistorischen Einfluss betreffend mussten und müssen sich alle folgenden
(Vietnam-)Kriegsfilm an ihm messen; aufgrund seiner für einen Kriegsfilm ungewöhnlichen Struk-
tur und seines epischen Charakters steht er allerdings in gewisser Weise etwas außerhalb des
Genres. Betrachtet man nur die Genre-,conventions', blieb sein Einfluss, gemessen an dem auf
andere Bereiche, gering.
Im Grunde endet mit Apocalypse Now eine erste Phase des Vietnamkriegsfilms, deren Anfang
auf Mitte der 1970er datiert wird. Ihren Namen erhält sie allein von den letzten beiden Filmen: die
epische Phase.
132
Zwischen 1983 und 1985 wurden einige höchst erfolgreiche Filme gedreht, die sich der Befreiung
amerikanischer Kriegsgefangener nach Kriegsende widmeten.
133
Diese zweite Phase kann auch
aufgrund inhaltlicher Vergleichbarkeit mit zu der Zeit sehr beliebten Comic-Heften über den Viet-
namkrieg Comic-Heft-Phase genannt werden.
134
Die Filme dieser Phase versuchten ,,to rewrite
the history of the war in ways that recuperate the imagery of the invincibility of the American sol-
dier/warrior, portray America as the victim in the conflict, and attempt to revivify the values and
virtues of the masculinity of war"
135
.
Allerdings entstanden bis Mitte der 1980er Jahre, bis Platoon 1986, keine nennenswerten Filme,
die sich mit dem Vietnamkrieg selber beschäftigten. Aufgrund der niedrigen Zahl an solchen Fil-
men kann zu diesem Zeitpunkt deshalb kaum von einem eigenen Genre, und sei es auch nur ein
Subgenre, gesprochen werden. Im Nachhinein betrachtet kann allerdings festgestellt werden,
dass sich einige der später als ,conventions' identifizierbaren Rahmengrenzen bereits andeu-
tungsweise zeigen. Zum einen sind dies realistische Betrachtungsweisen der Besonderheiten
dieses Krieges, auch wenn sie für die USA eher negativ sind, die Etablierung eines Off-
Kommentars durch einen der Protagonisten, und eine eher unheroische Sicht auf den Krieg und
die Charaktere.
Für Platoon und Full Metal Jacket, die in den folgenden zwei Kapiteln analysiert werden, dienen
aber hauptsächlich noch die konventionellen Kriegsfilm-,conventions' als Grundlagen und als Be-
zugspunkte.
132
Vgl. PALMER (1993) S. 21-22.
133
Uncommon Valor (1983, R.: Ted Kotcheff), Missing in Action (1984, R.: Joseph Zito), Missing in Action, Part II: The
Beginning (1984, R.: Lance Hool), Rambo: First Blood, Part II (1985, R.: George Pan Cosmatos) u. a.
134
Vgl. PALMER (1993) S. 21-22.
135
WILLIAMS (1991) S. 42.
4 Filmanalyse
23
4.2 Platoon
The first casualty of war is innocence.
4.2.1 Produktionsnotizen
Oliver Stone schrieb das Drehbuch zu Platoon im Jahre 1976. Darin verarbeitete er seine eige-
nen Erfahrungen in Vietnam. Stone konnte einige Produzenten dafür interessieren, ,,but the pro-
ducers didn't want to go up against Apocalypse Now, then in production".
136
Nach seinem Erfolg
mit Salvador waren die britische Produktionsfirma Hemdale und der U.S.-Verleiher Orion bereit,
sechs respektive zwei Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. 1986 begannen die Dreharbeiten
auf den Philippinen. Da das Verteidigungsministerium der USA das Drehbuch als ,,totally unrea-
listic" einstufte, verweigerte es ganz gegen seine Gewohnheit jegliche Kooperation.
137
Platoon wurde am 19. Dezember 1986 uraufgeführt. Der Film erhielt weltweit unzählige Aus-
zeichnungen, u. a. wurde er für acht Oscars nominiert und gewann vier: bester Film, beste Regie,
bester Schnitt und bester Ton.
138
Auch kommerziell war Platoon höchst erfolgreich: Alleine in den
USA spielte er 136 Millionen Dollar ein. Zusammen mit Einnahmen aus dem Videogeschäft er-
höhten sich diese bis zum Jahr 2000 auf 250 Millionen Dollar.
139
136
KAGAN (2000) S. 28.
137
Vgl. ebenda. S. 99.
138
Vgl.
http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/DisplayMain.jsp?curTime=1064499226881(Die Datenbank
der Academy of Motion Picture Art and Sciences); http://www.imdb.com/title/tt0091763/awards (Internet Movie Da-
tabase).
139
Vgl. ROBERTS / WELKY (2000) S. 79.
4 Filmanalyse
24
4.2.2 Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
Durch Einblendungen bzw. Off-Kommentar wird die Story zeitlich und örtlich eingeordnet. Se-
quenz 1 spielt im September 1967 nahe der kambodschanischen Grenze. Es ist die Zeit, zu der
sich das amerikanische Engagement auf seinem Höhepunkt befindet und die amerikanische Öf-
fentlichkeit aufgrund der offiziellen Erfolgsmeldungen von einem bevorstehenden Sieg überzeugt
ist. Sequenz 7 wird auf den 1. Januar 1968 datiert, die Schlacht am Ende des Films (ab Seq. 26)
wird am 3. Januar ausgetragen (mit Verweisen auf eine Schlacht am Vortag). Die historische
Schlacht fand bei Soui Cut statt, von den Amerikanern Fire Support Base (FSB) Burt genannt,
140
allerdings jeweils einen Tag früher.
141
4.2.3 Struktur des Films
Erzählt wird der Titel stellt dies bereits klar die Geschichte eines Platoons
142
, und zwar der
Bravo Company, 25th Infantry, eines ,,microcosm of America sentenced to the jungles of Viet-
nam".
143
Der Film zeigt Bilder und Ansichten über das Leben dieser Soldaten, ihre Wünsche,
Probleme und Frustrationen, über Angst, Schmerz und Tod. Aus diesem Platoon wird ein Soldat
besonders hervorgehoben und während seiner Zeit in Vietnam begleitet: Chris Taylor. Taylor
kommentiert die Handlung und seine Eindrücke gelegentlich aus dem Off (meist in Form von
Briefen an seine Großmutter), so dass der Eindruck entsteht, er erzähle diese Geschichte. Der
Film ist streng chronologisch aufgebaut und spielt ausschließlich in Vietnam. Allerdings stammt
Taylors Fazit in Sequenz 44 aus einer unbestimmten Zeit nach den gezeigten Ereignissen.
Taylor entstammt der Mittelschicht und hat das College abgebrochen, um sich freiwillig nach
Vietnam zu melden. Seine Motive hierfür sind vielschichtig, ,,involving elements of rebellion, class
guilt, and puritan self-abnegation."
144
Taylors Unerfahrenheit wird als Unfähigkeit gezeigt: Den
Dschungelstrapazen in Sequenz 1 ist er nicht gewachsen, auch weil er unnötiges Gepäck bei
sich trägt; beim Angriff eines vietnamesischen Kommandos kann er die Granaten nicht sprengen,
weil er vergisst, die Sicherung zu lösen (Seq. 4). Im anschließenden Feuergefecht wird er durch
,,friendly fire" verletzt, ca. drei Wochen ist er im Hospital.
145
Hervorgehoben wird Taylors anfängliche Unfähigkeit anhand des Kontrastes zu zwei erfahrenen
und exzellenten Soldaten: Sergeant
146
Elias und Staff Sergeant Barnes, die militärisch absolute
Vorbilder sind. Elias wird als hilfsbereiter Soldat eingeführt, mehr Freund als Vorgesetzter (Seq. 1
und 3), der sich als einziger Sergeant für die Neuen einsetzt (Seq. 2b). Barnes hingegen geht
hart ins Gericht mit den Neuen und zeigt keinerlei Geduld (Seq. 1 und 4). Beide werden anfäng-
lich von Taylor bewundert (Verweis darauf in Seq. 25).
140
PLATOON Audiokommentar des Regisseurs Oliver Stone.
141
Vgl.
http://www.vietnamtripledeuce.org/FSB_Burt.htm, http://www.187thahc.net/Stories/fsb_burt.htm.
142
Ein Platoon ist die drittkleinste militärische Einheit in der US-Armee und besteht aus 16-44 Soldaten. Geführt wird
es von einem Lieutenant. Vgl. für alle militärische Einheiten ANHANG Militärstruktur.
143
PALMER (1990) S. 263.
144
BATES (1996) S. 108 - Sie erschließen sich aus seinem ersten Brief an seine Großmutter (Seq. 2a und 3) und ei-
ner Unterhaltung mit zwei Kameraden (Seq. 5).
145
Der Film überspringt diese Zeit.
146
Für eine Einordnung der Dienstgrade siehe ANHANG Militär-Ränge.
4 Filmanalyse
25
Taylors militärischer Reifeprozess zeigt sich bei dem Hinterhalt der Vietnamesen (ab Seq. 17),
als er couragiert den verwundeten Lerner rettet. Bei der finalen Schlacht (ab Seq. 26) ist er be-
reits Vorbild für Francis und rettet auch dessen Leben (Seq. 34). Seine Fähigkeiten, aber auch
seine Adrenalin-getränkte Entschlossenheit
beim anschließenden Dschungelkampf sind von Bar-
nes' (Seq. 36) nicht zu unterscheiden, Taylor rettet vermutlich auch ihm sogar das Leben (Seq.
40).
Taylors Reifeprozess ist aber nicht auf das Militärische beschränkt parallel findet sein Erwach-
senwerden statt. Anfangs ist er ein Mensch, der seinen Platz im Leben noch sucht (Brief I in Seq.
3). Er bewundert seine Kameraden (Brief I in Seq. 3), und nach seiner Rückkehr aus dem Hospi-
tal wird er von King bei den ,,heads" (Marihuanarauchern) in deren ,,underworld" eingeführt (Seq.
6a). Diese Einführung ist als Wiederauferstehung in die Welt der lebenslustigen, aus den unteren
sozialen Schichten stammenden, vor allem schwarzen Soldaten konzipiert. Rhah
147
fragt Taylor,
was er in der "underworld" tue, und King antwortet für ihn: ,,This here ain't Taylor. Taylor been
shot. This man here is Chris. He been resurrected."
148
Elias (wie auch beinahe alle Schwarzen des Platoons) gehört zu den ,,heads", die Taylor sofort in-
tegrieren. Ein scharfer Kontrast wird zu den ,,juicers" (Alkoholtrinkern) gezeichnet: Während in der
,,underworld" die Drogenhymne White Rabbit von Jefferson Airplane erklingt, erfolgt ein harter
Schnitt auf die Hütte der ,,juicers", in der die Zeilen ,,I don't smoke marijuana" aus dem traditionel-
len Countrysong Okie from Muskogee von Merle Haggard erklingen.
149
Zu den ,,juicers" gehört neben Bunny, Junior und Sergeant O'Neill auch Barnes. Diese Welt ist
härter als die der ,,heads": grelles Licht statt abgedunkeltem, Alkohol statt Marihuana, Konföde-
riertenflagge statt Lichterketten, Poker um Geld statt gemütlichem Abhängen. Ein letzter Kontrast
wird durch einen erneuten harten Schnitt zu den ,,heads" gezeigt. Während das Gesprächsthema
der Pokerrunde der Tod ist, tanzen die ,,heads" ausgelassen ,,a celebration of life".
150
Die Freundschaft zu den ,,heads" bringt Taylor näher an Elias heran. Elias und Barnes sind als
moralische Antagonisten angelehnt: Elias steht für einen sauberen, fairen Krieg, Barnes für einen
Krieg mit allen Mitteln. Am Eingang des vietnamesischen Dorfes (Seq. 9) wird deutlich, dass Tay-
lor aber weiterhin zwischen Beiden steht. Ebenso wie alle anderen Soldaten, die über den Tod ih-
rer zuvor in einen Hinterhalt geratenen Kameraden aufgebracht sind, folgt er Barnes (Elias war
zurück geblieben), ,,[who] was at the eye of our rage and through him, our Captain Ahab we
would set things right again. That day we loved him..." (Off-Kommentar, Seq. 9) Auch Taylor wird
mitgerissen und verliert die Kontrolle (Seq. 11a), zeigt sich aber entsetzt über Bunnys (Seq. 11a)
und Barnes' Verhalten (Seq. 12a), ohne jedoch einzugreifen.
147
Sein Name verweist auf Rhadamanthus, der der griechischen Mythologie nach ein Sohn von Zeus und Europa war,
und der für seinen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn nach seinem Tode zu einem Richter in der Unterwelt ge-
macht wurde. Vgl. http://www.bartleby.com/61/52/R0215200.html (The American Heritage® Dictionary of the Eng-
lish Language: Fourth Edition. 2000.)
148
Der Name Chris deutet in diesem Zusammenhang auf einen anderen Auferstandenen hin, im englischen ,,Christ".
Für eine Auseinandersetzung mit den biblischen Metaphern und Analogien Platoons vgl. beispw. BATES (1996) S.
112-117; BECK (1992).
149
Interessanterweise stammt dieses Lied aus dem Jahr 1969, während die Szene 1967 spielt.
150
PLATOON Audiokommentar des technischen Beraters und Ex-Marine Dale Dye
4 Filmanalyse
26
Doch schon wenig später (Seq. 13b) wird er vom Beobachter zum Akteur: Er stellt sich gegen
vier Kameraden (allesamt ,,juicers") und stoppt deren Vergewaltigung eines vietnamesischen
Mädchens. Im Gegensatz zu ihnen stellt er fest: ,,She's a fucking human being".
Durch die Ereignisse im Dorf kommt es zu einem Konflikt innerhalb des Platoons, wobei die
,,heads" zu Elias und die ,,juicers" zu Barnes halten. In seinem zweiten Brief (Seq. 16) kommen-
tiert Taylor die Ereignisse im Dorf mit den Worten: ,,I don't know what's right and what's wrong
any more." Doch Taylor fällt dann eine Entscheidung: Nachdem ihm klar wird, dass Barnes Elias
getötet hat (Seq. 24c und 25)
151
, entscheidet er sich, Elias zu rächen und Barnes zu töten.
Rhah bemerkt in Seq. 25, dass nur Barnes Barnes töten könne. Physisch tut das schließlich Tay-
lor (Seq. 41), dem durch Rhahs Bemerkung und diesen Mord Wesensmerkmale Barnes zuge-
schrieben werden. Taylor selbst sieht das in seinem Fazit (Seq. 44) folgendermaßen: "I am sure
Elias will be [there the rest of my days] fighting with Barnes for what Rhah called possession
of my soul... There are times since I have felt like the child born of those two fathers."
4.2.4 Die Analyse-Kategorien
Oliver Stone hat Platoon mit dem Anspruch auf bis ins Detail gehenden größtmöglichen Realis-
mus
152
gedreht und entsprechend Vietnamveteranen als die ultimativen Kritiker betrachtet
153
. Vie-
le dieser Details sind als eine Art Gimmick angelegt und nur für den Eingeweihten zu entschlüs-
seln
154
.
1. Die Beurteilung des Krieges
a) Gründe für den Krieg
Platoon spielt in einer Art historischem Vakuum. Gründe für die Anwesenheit des US-Militärs
werden ebenso wenig thematisiert wie politische oder militärische Ziele. Gerade militärische Ziele
(,,missions") sind jedoch eine ,convention' des Kriegsfilms. Um Oliver Stone zu zitieren: ,,Here the
mission is basically to keep walking".
155
Das Fehlen der Mission, die dem Militärischen im Kriegs-
film Sinn verleiht und das Geschehen strukturiert, wird in Platoon ersetzt durch absolute Konfusi-
on. Das verdeutlichen die für die US-Soldaten (und die Zuschauer) unübersichtlichen Feuerge-
fechte und Schlachten, die schließlich in dem Befehl von Captain Harris kulminieren, sämtliche
verfügbaren Bomben über seiner Position abzuwerfen (Seq. 39d). Mit dem Auslassen der Missi-
on und dem Zeigen von Konfusion bei allen Dienstgraden wird dem Leinwandgeschehen ein
grundsätzlicher militärischer Sinn abgesprochen.
Gründe für den Vietnamkrieg sind kein Thema des Films. Immerhin gibt Taylor in seinem ersten
Brief (Seq. 3) Hinweise auf seine Einstellung zu Anfang seines Vietnam-Aufenthaltes. Zu seinen
151
Barnes schießt dreimal auf Elias und wähnt ihn tot, doch Elias überlebt, kann aber verletzt den Kämpfern der NLF
nicht entkommen und wird von ihnen erschossen.
152
Vgl. vor allem PLATOON Audiokommentar des Regisseurs Oliver Stone und PLATOON Audiokommentar des
technischen Beraters und Ex-Marine Dale Dye.
153
Vgl. A Tour of the Inferno: Revisiting Platoon. Regie: Charles Kiselyak. Ca. 51 Min. O.J., RINGNALDA, Donald:
Unlearning to Remember Vietnam. Garland. 1990. S. 64-65.
154
Für Beispiele vgl. PLATOON Audiokommentar des technischen Beraters und Ex-Marine Dale Dye.
155
PLATOON Audiokommentar des Regisseurs Oliver Stone.
4 Filmanalyse
27
schon angesprochenen Motiven, nach Vietnam zu gehen, versteht er seine Teilnahme als einen
patriotischen Akt: ,,Do my share for my country". Zusätzlich stellt er den Vietnamkrieg in eine Rei-
he mit dem 1. und 2. Weltkrieg: ,,Live up to what Grandpa did in the First War and Dad did in the
Second". Zwar nennt er seine Entscheidung im ersten Teil des Briefes einen Fehler, doch das
bezieht sich auf die körperlichen Strapazen des Krieges. Seine Kameraden beschreibt er als arm
und unerwünscht, fügt dann mit einer gewissen Bewunderung hinzu: ,,[Y]et they're fighting for our
society and our freedom." Taylor, der gebildetste des Platoons, hat die offizielle Kriegsbegrün-
dung akzeptiert.
Nach der Dorfszene kommt es zu einem Gespräch zwischen Taylor und Elias (Seq. 15). Elias er-
zählt Taylor, dass er 1965 noch an den Krieg geglaubt habe, nun (Anfang Januar 1968) nicht
mehr. Diesen verlorenen Glauben führt er auf zwei Ursachen zurück: die Ereignisse im Dorf, die
seiner Meinung nach nur ein Anfang gewesen seien und seine Überzeugung, die USA würden
den Krieg verlieren. Elias argumentiert mit politischer Gerechtigkeit: ,,We've been kicking other
people's asses for so long I figure it's time we got ours kicked". Im Gegensatz zu Taylor, der den
Krieg in Vietnam in eine Reihe mit allgemein als gerechtfertigt angesehenen Kriegen stellt, sieht
Elias Vietnam nicht nur als einen Schauplatz dreckigen Krieges (die Dorfszene), sondern auch
als Fortsetzung US-amerikanischen Imperialismus (,,other people's asses"). Die auftauchende
Sternschnuppe lässt vermuten, dass die US-amerikanische Niederlage von Elias herbeige-
wünscht wird.
Taylors Fazit (Seq. 44), das er einige Zeit nach dem Krieg zieht, lässt trotz Elias Meinung keine
Veränderung seiner Einstellung zu diesem Krieg erkennen. Er beschreibt seinen persönlichen
Reifeprozess und seine Vietnam-Erfahrung als persönlichen Wissensgewinn, den es an andere
weiterzugeben gelte. Sein einziger Kommentar zum Krieg selbst lautet: ,,I think now, looking back,
we did not fight the enemy, we fought ourselves and the enemy was in us..." Angesichts der
horrenden Zahl an toten Vietnamesen klingt diese Einschätzung ebenso US-zentristisch und zy-
nisch wie der Spruch, mit dem Platoon beworben wird: The first casualty of war is innocence.
Die `convention' des Kriegsfilmgenres jedoch, den dargestellten Krieg zu rechtfertigen, wird hier
nicht erfüllt. Allerdings lässt die vorgenommene Deutung des Krieges die vietnamesische Tragö-
die gegenüber der amerikanischen vollkommen verblassen.
156
b) Kriegsschauplatz Vietnam
Von Anfang an, schon im Prolog auf dem Flughafen, wird Vietnam als ein unliebsamer Ort einge-
führt. Die frisch aussehenden Neuankömmlinge werden den heimfliegenden, ausgemergelten
Soldaten, gegenübergestellt. Ihre Gesichter und Kleidung lassen erahnen, was sie durchgemacht
haben und was auf die Neuankömmlinge zukommt. Entsprechend sind ihre Kommentare: ,,You
dudes gonna love the Nam! For fucking ever!" und ,,365 and a wake-up! Oh Lord!" Die deutlich
gezeigten (und gefüllten) ,,body bags" bringen den Tod als eine lauernde Gefahr ins Spiel (Seq.
0).
Die Darstellung der schwierigen Verhältnisse im Dschungel Vietnams (Seq. 1) weichen von der
üblichen ,convention' in Kriegsfilmen ab, offene Landschaften zu zeigen. Die Mühe der US-
156
Vgl. auch Kael, Pauline in KAGAN (2002) S. 108 und Corliss, Richard in KAGAN (2992) S. 108.
4 Filmanalyse
28
Soldaten, sich in diesem Terrain fortzubewegen, wird nicht nur bei Taylor deutlich. Ganz anders
werden die Vietnamesen gezeigt: Geschickt und leichtfüßig bewegen sie sich durch den Dschun-
gel (Seq. 4 und 33). Doch diesen Vergleich so zu interpretieren, dass die Amerikaner dort nicht
hingehören, wäre falsch. Denn später sieht man, wie Barnes und Elias (vor allem in Seq. 21a)
und dann auch Taylor (Seq. 34 und 40) sich im Dschungel bewegen: Sie sind ihren vietnamesi-
schen Gegnern überlegen. Diese Fähig-
keiten sind folglich erlernbar. Die Darstel-
lung des Terrains ohne Sicht und die
damit verbundenen Schwierigkeiten der
Soldaten sollen realistisch sein, aber
auch die Gefahr verdeutlichen, die selten
früh erkannt werden kann. Sie soll dar-
über hinaus erklären, warum die techno-
logischen Vorteile des US-Militärs nicht
zum Tragen kamen.
157
Die Soldaten des Platoons sehnen den
Tag herbei, an dem sie dieser ,,Hölle"
(Seq. 2a) entkommen können. Der
Wunsch seiner Kameraden nach Rückkehr wird zum einen deutlich in zwei Gesprächen, die Tay-
lor führt (Seq. 5 und 28) und zum anderen an der Selbstverwundung Francis' (Seq. 42b). Taylor
äußert diesen Wunsch hingegen zu keinem Zeitpunkt. Junior versucht gar, sich der letzten
Schlacht zu entziehen und zumindest ins Hospital geschickt zu werden, indem er sich Insekten-
spray auf die Füße sprüht (Seq. 29a).
Doch es gibt einen Soldaten, der den Kriegsschauplatz Vietnam mag, nämlich Bunny: ,,I like it he-
re. You get to do what you want. Nobody fucks with you. The only worry you got is dying. And if
that happens you won't know about it anyway. So what the fuck, man?" (Seq. 31) Für Bunny ist
Vietnam reizvoll, weil er ohne jegliche moralische Beschränkung seine Emotionen ausleben kann
(Seq. 11a). Und weil ein solches Agieren zugelassen wird.
Realismus ist das Hauptmotiv bei der Darstellung des Kriegsschauplatzes. Der Hass aller auf
diesen Ort, kontrastiert mit Bunnys Aussage, impliziert Kritik an dem Ort. Da es diesen Ort ohne
diesen Krieg so nicht gäbe, wird der Krieg selber kritisiert.
c) Details des Krieges
Ein Aspekt des Krieges, der in Platoon mehrfach zur Sprache gebracht wird, ist die soziale Un-
gleichheit in den USA und in der Einberufungspraxis. Taylor beschreibt seine Kameraden in sei-
nem ersten Brief (Seq. 3) als ,,from the end of the line", arm und unerwünscht. Taylor gibt als ei-
nes seiner Motive, sich freiwillig gemeldet zu haben, die Politik, nur Jugendliche aus den unteren
sozialen Schichten zu ziehen, an (Seq. 5). King, mit dem er dieses Gespräch führt, erwidert dar-
auf: ,,You gotta be rich in the first place to think like that. Everybody know... the poor always be-
ing fucked over by the rich. Always have, always will." Seine zwar wissende, doch unberührte Art
157
Vgl. HALBERSTAM (2000) S. 117.
4 Filmanalyse
29
und sein breites Lächeln verraten, dass er bestimmt nichts unternehmen würde, daran etwas zu
ändern. King, der so etwas wie ein väterlicher Freund für Taylor wird (vor allem Seq. 28), darf
kurz vor der finalen Schlacht nach Hause fliegen. Sowohl Norman Kagan
158
als auch Clyde Tay-
lor
159
weisen darauf hin, dass hier eine typische Hollywood-Moral über das ,,korrekte" Verhalten
von Schwarzen angewendet wird. King ist ein Sympathieträger, folgt der Ideologie der Weißen
und darf überleben. Der moralische Antagonist dazu ist Junior
160
.
Junior wird von Tex (David Neidorf) verbal attackiert, worauf Junior sofort die Hautfarbe ins Spiel
bringt und gegenüber Big Harold aggressiv bemerkt: ,,Goddamn, man! You break your ass for the
white man! No justice around here!" (Seq. 3) Später (Seq. 6b) bemerkt er kämpferisch zu Bunny
auf dessen Frage, ob er schon einmal Marihuana geraucht habe: "That's right, dude! Y'all be try-
ing to keep the black man down and string him out on that shit. The time be's coming, my man,
when the black man throw that yoke off." Damit entspricht er nicht den genannten Hollywood-
Regeln eines "guten Schwarzen". Sein Charakter und seine Moral werden den ganzen Film über
kritisiert: Er ist der einzige Schwarze, der sich bei den ,,juicers" aufhält (Seq. 6b), er beteiligt sich
an der versuchten Vergewaltigung des vietnamesischen Mädchens (Seq. 13b) (auch wenn er
später die Morde im Dorf kritisiert, Seq. 14b), er versucht durch Insektenspray auf seinen Füßen
der letzten Schlacht zu entgehen (Seq. 29a). Sein Urteil ist gleichzeitig ein weiterer Beweis seiner
Feigheit: Er flieht aus dem Graben, wodurch Bunny abgelenkt und getötet wird, rennt gegen ei-
nen Baum, verliert das Bewusstsein und wird erstochen (Seq. 35).
Durch diese klassische Darstellung verliert die Kritik an der Einberufungspraxis an Glaubwürdig-
keit, auch wenn Oliver Stone diese Praxis ,,the ultimate corruption"
161
nennt.
162
Es bleibt festzuhalten, dass Platoon den Vietnamkrieg kritisiert und ihn dabei als eine beinahe
rein amerikanische Tragödie betrachtet.
2. Die Darstellung des US-Militärs
Abgesehen von der Dorfszene ist das Verhalten der US-Soldaten gegenüber den Vietnamesen
geprägt durch Barnes. Als Taylor vor einem toten Vietnamesen erschrickt (Seq. 1), stellt Barnes
fest: ,,Good gook good and dead." Er zieht damit eine Parallele zu den bekannten Aussprüchen
über Kommunisten und früher den Indianern. Zumindest er wird folglich in eine Reihe mit dem
Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern gestellt. Dass es bei Barnes nicht bei Worten
bleibt, wird kurze Zeit später deutlich. Nach dem ersten Feuergefecht erschießt er kaltblütig einen
verletzten Vietnamesen (Seq. 4). Das wirkt sehr routiniert, doch es wird nicht deutlich, ob es gän-
gige Praxis des Platoons ist. Immerhin nimmt er den Soldaten die Möglichkeit, den Vietnamesen
zu verhören. Und das will so gar nicht zu seiner Darstellung als hervorragender Soldat passen.
Seine Narbe, ein späterer Hinweis, dass er sieben Mal verwundet wurde (Seq. 25) und ein Ver-
158
KAGAN (2000) S. 106.
159
TAYLOR
(1997).
160
Auch wenn Kagan eher Francis in dieser Rolle sieht.
161
Zit. In KAGAN (2000) S. 106.
162
Interessanterweise greift Stone eine weitere Hollywood-Regel auf, sogar eine des klassischen Kriegsfilms: Gardner
zeigt Taylor nicht nur ein Bild seiner Freundin (was schon ein Todesurteil wäre), sondern auf dessen Rückseite ei-
nes von Raquel Welsh (Seq. 3). In Seq. 4 stirbt er. Vgl. MODLESKI (1998) S. 125.
4 Filmanalyse
30
gleich mit Kapitän Ahab aus Moby Dick (Off-Kommentar, Seq. 9 ) weisen darauf hin, dass er ei-
ne Art Privatfehde gegen die Vietnamesen führt.
Die Dorfszene ist die für diese Kategorie der Filmanalyse ergiebigste Szene. Wesentlich beteiligt
an den Ereignissen sind Taylor, Bunny und Barnes. Da drei ihrer Kameraden getötet wurden,
marschieren die Soldaten voller Rachegelüste zum Dorf (Off-Kommentar, Seq. 9), wo NVA-
Soldaten gesichtet wurden (Seq. 7) Daher kommt zu ihrer Spannung Angst hinzu (Seq. 11a) Bei
der Ankunft am Dorf sehen die Soldaten einen flüchtenden Vietnamesen, dem Barnes auch das
wirkt routiniert und professionell - in den Rücken schießt (Seq. 9). Die Dorfbewohner werden zu-
sammengetrieben, dabei werden einige in einem Loch entdeckt. Barnes zieht zwei Mädchen und
die Frau des Häuptlings aus dem Loch, sprengt dann die noch im Loch befindlichen zwei Männer
mit einer Handgranate in die Luft (Seq.10).
Kurze Zeit später entdecken die Soldaten Waffen und große Reisvorräte (Seq. 11b). Es drängt
sich der Verdacht einer Kollaboration der Dorfbewohner mit der NVA oder der NLF auf. Der
Häuptling wird von dem ziemlich aggressiven Tubbs zu Barnes geführt und zu Boden gestoßen
(Seq. 12a). Barnes schickt ihn weg und hilft dem Häuptling hoch, fragt ihn dann mittels des Dol-
metschers Lerner mit professioneller Geduld und Freundlichkeit aus. Doch er glaubt dem Häupt-
ling nicht, so dass er ihn (mit unterstützenden Kommentaren der herumstehenden Soldaten) an-
schreit und am Kragen packt. Die Frau des Häuptlings eilt herbei und beginnt über die Soldaten
zu klagen. Keiner der Soldaten weiß mit der Situation umzugehen, bis Barnes die Frau sichtlich
genervt erschießt. Die Gesichter der Soldaten, allesamt in Großaufnahme, ihr Entsetzen und die
absolute Stille, die nur durch das Wehklagen eines kleinen Mädchens und des Häuptlings gestört
wird, stellen klar, dass dieser Mord keine Routine, kein akzeptiertes Verhalten ist. Doch selbst der
anwesende Lieutenant Wolfe, Vorgesetzter Barnes, ist völlig überfordert und unternimmt
nichts.
163
Barnes selber hält sein Vorgehen offensichtlich für völlig legitim. Er will Informationen
des Häuptlings, egal wie. Auch vereinzelte Stimmen der Soldaten werden jetzt wieder laut, alle
Dorfbewohner zu tötem. Ein My Lai scheint möglich. Barnes geht darauf nicht ein, er schnappt
sich das schreiende Mädchen - die Tochter des Häuptlings - und bedroht sie mit einer Pistole. Er
will kein Massaker, er will Informationen. Dafür würde er aber auch das Mädchen töten. Erst der
gerade ankommende Elias kann das verhindern.
Barnes Professionalität, die allerdings keine moralischen Grenzen zu kennen scheint und sich
von seiner vorherigen Fehde absetzt, steht im Kontrast zu Bunnys und Taylors Verhalten. Bunny
geht vor Taylor ins Dorf und erschießt völlig grundlos ein Schwein (Seq. 10). Als Taylor wenig
später in einer Hütte in einem Loch einen Einbeinigen und eine alte Frau entdeckt und sie her-
ausgeholt hat, dreht er durch (Seq. 11a). Francis versucht ihn zu beruhigen, sie hätten Angst,
worauf Taylor antwortet, ER habe Angst. Dann redet er anklagend auf den Mann ein, er solle ihn
nicht so angrinsen. Bunny, der bereits eine Art Lächeln auf dem Gesicht hat, das nichts Gutes
verheißt, als er die beiden Vietnamesen sieht, stachelt Taylor an: ,,Do'em, man, do'em". Taylor
nimmt Bunnys Aufforderung auf, schreit weiter auf den Mann ein und schießt vor dessen Füße,
so dass der ,,tanzen" muss. Während Francis und der hinzugekommene Sergeant O'Neill ge-
schockt zusehen, hat Bunny ein satanisches Grinsen auf dem Gesicht. Doch rechtzeitig hat Tay-
163
Das überrascht wenig, hat sich doch schon früher Barnes als der Befehlsgeber des Platoons herausgestellt (Seq.
2b).
4 Filmanalyse
31
lor seine Emotionen wieder unter Kontrolle und lässt von ihm ab. Francis hält die Szene für eben-
falls beendet und fordert Taylor auf, mit aus der Hütte zu gehen. Doch Bunny hat anderes im
Sinn. Er hält Taylor für einen Feigling oder ein Weichei: ,,Fucking pussy, man! He's laughing at
you! That's the way the gook laughs." Ein sichtlich überforderter O'Neill und Taylor versuchen,
Bunny aus der Hütte zu bewegen, doch ohne Vorwarnung schlägt der mit seinem Gewehrkolben
mehrmals auf den Vietnamesen ein. Sein Kommentar danach: ,,Holy shit! Did you see that fuck-
ing head come apart, man? I never seen brains like that before, man! I bet you the old bitch runs
the whole fucking show, man. She probably cut Manny's
164
throat. Probably cut my balls off if she
had a chance."
165
Auf O'Neills Anweisung, zu verschwinden und zu behaupten, niemand habe
etwas gesehen, antwortet Bunny: ,,Come on, man! Let's fucking do her!
166
Let's do this whole
fucking village!"
Während später der Befehl ausgeführt wird, das Dorf niederzubrennen, sind vier Soldaten dabei,
etwas abseits ein Mädchen zu vergewaltigen. Taylor tritt dazwischen und reißt Morehouse von
dem Mädchen runter. Taylor wird mit den Worten konfrontiert: ,,You don't belong in the Nam,
man. It ain't your place at all".
Die gesamte Dorfszene zeigt drei Arten der Erklärung für das Verhalten der amerikanischen Sol-
daten gegenüber den Vietnamesen, das nach Bekanntwerden auch in den USA kritisiert wurde.
Erstens wird eine Mischung aus Wut über eigene Verluste und Angst vor den unbekannten Ge-
fahren im Dorf am Beispiel Taylors als Erklärung herangezogen. Diese Erklärung wird wohl als
Entschuldigung akzeptiert, immerhin lässt Oliver Stone Taylors moralische Maßstäbe am Ende
obsiegen.
Zweitens stehen Bunny (und andere, die ihre Kommentare abgeben) sowie die Vergewaltiger für
ein von jeglichen militärischen Zielen und moralischen Grenzen entbundenes Ausleben der Emo-
tionen und Triebe. Es wird durch Barnes' Verhalten und Wolfes Nichtstun deutlich, dass die un-
moralische Führung der Soldaten diese Eskalationen erst ermöglichen
167
.
Drittens steht Barnes für eine Kriegsführung, die rein funktionalistisch, und dabei völlig amora-
lisch und ungezügelt
168
ist. Er benutzt für die Armee bzw. den Krieg die passende Analogie einer
Maschine, deren Nichtfunktionieren er nicht dulden würde (Seq. 25), ist aber selbst anscheinend
außerhalb davon: Zum einen stellt er, wie Taylor sagt, seine eigenen Regeln auf (Seq. 28); zum
anderen erklärt er gegenüber Elias diesen Krieg zu seinem eigenen (Seq. 17: ,,You don't tell me
how to run MY war") und ,,tötet" Elias später. Barnes Art der Kriegsführung wird daher nicht als
befohlen dargestellt, sondern als persönlich motiviert und dabei pervertiert.
169
Diese übermotivier-
te Art wird deutlich, als er völlig aufgeputscht Taylor nicht erkennt und (mit rot glühenden Augen)
töten will (Seq. 40). Allerdings ist Barnes nicht der einzige, der sich den Vietnamesen gegenüber
außerhalb von Stresssituationen brutal verhält: Am Tag der finalen Schlacht wird ein vietnamesi-
164
Der von den Vietnamesen getötete Soldat.
165
Die alte Frau ist währenddessen auf dem Boden liegend zu sehen, anscheinend tot. Dass Bunny auch sie erschlug,
ist allerdings nicht zu sehen.
166
Das spricht dafür, dass sie noch nicht tot ist, allerdings könnte Bunny auch etwas mit ihrem toten Körper machen
wollen.
167
Siehe zu Bunny auch den Punkt Kriegsschauplatz Vietnam.
168
Man denke dabei auch an völkerrechtlich verbindliche Kriegskonventionen.
169
Man denke auch an Colonel Kurtz in Apocalypse Now.
4 Filmanalyse
32
scher Gefangener in Anwesenheit von Captain Harris und dem Major der Alpha Company ge-
schlagen (Seq. 26b), und ihm wird anscheinend - das ist nicht genau zu erkennen - die Kehle
durchgeschnitten; am nächsten Tag schneidet ein Soldat des ,,Rescue Team"
170
einem toten
Vietnamesen ein Ohr ab (Seq. 42d).
Barnes Gegenspieler ist Elias. Dessen Art der Kriegsführung vergleicht Barnes mit den Politikern
in Washington: ,,...trying to fight this war with one hand tied round their balls" (Seq. 14c). Dieser
Vergleich entspricht der Kritik aus dem rechten politischen Lager.
171
Platoon distanziert sich von
dieser Aussage nicht völlig. Barnes ist nicht der totale Bösewicht, sondern für die Soldaten des
Platoons, um deren Überlebenskampf es in diesem Film auch geht, ,,the best (and perhaps only)
ticket out of there alive"
172
und tatsächlicher Lebensretter (Seq. 17). Hinzu kommt, dass eine an-
dere Form der Kriegsführung, die auf massive Kritik stieß, nämlich der Einsatz von Napalm, Bar-
nes verletzt und die Vietnamesen tötet, also Taylor und den anderen Soldaten das Leben rettet
und die Schlacht für die USA entscheidet. Wie ein anonymer Kritiker bemerkte: ,,Stone implicitly
suggests the U.S. lost the war because of divisions within the ranks, and an unwillingness to go
all the way".
173
Im Großen und Ganzen aber kritisiert Stone die Art von Kriegsführung, die Bunny und Barnes
betreiben. Er identifiziert sie aber auch als nicht offiziell. Die offizielle Kriegsführung kritisiert er an
anderer Stelle.
Nachdem die US-Soldaten das vietnamesische Dorf auf einen Befehl hin, den Lieutenant Wolfe
übermittelt (Seq. 12c), angezündet haben (Seq. 13a), und nachdem Taylor die Vergewaltigung
des Mädchens hat stoppen können (Seq. 13b), wird der Abzug der Soldaten aus dem Dorf ge-
zeigt (Seq. 13c). Zu orchestraler Musik, die William Palmer als ,,the somber music of missiona-
ries"
174
beschreibt, tragen die Soldaten die vietnamesischen Kinder auf ihren Armen vor dem Hin-
tergrund des brennenden und dann explodierenden Dorfes. Dieses Mischung aus missionari-
schem Eifer und Gewaltanwendung kann für die Politik in und gegenüber Vietnam insgesamt
stehen: ,,We had to destroy the town in order to save it."
Zum Abschluss dieses Punktes sollen noch zwei Genre-,conventions' des Kriegsfilmes betrachtet
werden. Symbiotische Beziehungen zwischen den Kameraden, die das Überleben gewährleisten,
weichen bei Platoon einem ,,Bürgerkrieg". Einen Charakter, der über dem Wahnsinn und der Ge-
walt steht, gibt es zwar: Elias. Doch seine Aufgabe, Taylor in seine Richtung zu bringen, kann er
wie im vorigen Punkt gesehen nicht vollständig erfüllen.
3. Die Darstellung der Vietnamesen
Die Vietnamesen werden in Platoon zum einen als hervorragende und skrupellose Kämpfer ge-
zeigt. Zum anderen werden sie als Opfer dargestellt.
170
Dessen Panzerfahrzeug eine Hakenkreuzflagge trägt - laut Oliver Stone war das üblich vgl. PLATOON Audio-
kommentar des Regisseurs Oliver Stone.
171
Vgl. Kapitel 2.3. George Bush hat dieses Zitat während seiner Präsidentschaft, also nach Platoon gemacht.
172
HALBERSTAM (2000) S. 118.
173
"Cart." In KAGAN (2000).
174
PALMER (1993) S. 32.
4 Filmanalyse
33
Opfer sind sie vor allem in der Dorfszene. Doch eigentlich geht es hier nicht um die Vietnamesen.
Außer ein paar Ansichten des Dorfes und der Hütten erfährt der Zuschauer nur durch das Verhör,
das Barnes mittels des Dolmetschers Lerner an dem Häuptling durchführt (Seq. 12a) etwas über
sie. Aufgrund dieser Verhörsituation wird nicht deutlich, ob das Dorf zur Zusammenarbeit mit der
NVA gezwungen worden ist (wie der Häuptling erklärt), oder ob es die NVA freiwillig unterstützt
(wie Barnes annimmt). Motive oder Einstellungen der Vietnamesen bleiben unberücksichtigt. Die
Vietnamesen haben die Funktion, als Opfer verschiedener Arten der Kriegsführung zu dienen.
175
Als Kämpfer werden sie in zweifacher Hinsicht dargestellt. Zum einen sind sie hervorragende
Soldaten, die sich lautlos und schnell durch den Dschungel bewegen und dabei mit diesem zu
verschmelzen scheinen (Seq. 4 und Seq. 33). Zu diesem Zweck ist letztere Sequenz aus ihrem
Blickwinkel gefilmt. Diese Darstellung ist realistisch und hilft zu erklären, warum sie militärisch so
erfolgreich agierten.
Zum anderen führen sie einen skrupellosen und hinterhältigen Krieg. Das Hinterhältige wird durch
eine versteckte Sprengfalle, die zwei amerikanische Soldaten tötet (Seq. 7), durch einen Hinter-
halt, bei dem Lerner schwer verletzt wird (Seq. 17) und durch einen Selbstmordattentäter, der
das Zelt des Majors sprengt (Seq. 38b), gezeigt. Das Skrupellose wird durch die Ermordung und
entwürdigende Zurschaustellung Mannys (Seq. 7-8) und durch die hinrichtungsartigen Tötungen
Bunnys und Juniors (Seq. 35) dargestellt. Letztere sind zwar prinzipiell durch das Kampfgesche-
hen gerechtfertigt, doch beide Amerikaner sind schon vorher außer Gefecht gesetzt. Bunny hat
drei Schüsse in die Brust bekommen. Ein Vietnamese, bedrohlich von unten ins hasserfüllte Ge-
sicht gefilmt, setzt ihm das Gewehr auf den Mund und drückt ab. Junior ist gegen einen Baum ge-
rannt und hat das Bewusstsein verloren. Ein genau wie bei Bunnys Tod gefilmter Vietnamese
sticht dem Bewusstlosen sein Bajonett dreimal in den Bauch.
Die Kriegsführung von Bunny oder Barnes unterscheidet sich nicht von der der Vietnamesen.
Bunny und Barnes sind jedoch Repräsentanten einer Art von Kriegsführung, die als Ausnahme
gelten kann, während die nicht-individualisierten Vietnamesen für eine generelle Art der Kriegs-
führung stehen. Was die Ausnahme für die Amerikaner ist, ist für die Vietnamesen normal. Damit
kommt man zu der schon einmal formulierten Kritik: Der Film impliziert, der Krieg konnte mit ,,mo-
ralischer" Kriegsführung nicht gewonnen werden. In den Worten Colonel Kurtz' aus Apocalypse
Now: ,,You have to have men who are moral and at the same time who are able to utilize their
primordial instincts to kill without feeling, without passion, without judgement - without judgement.
Because it's judgement that defeats us".
In den ersten beiden Analysekategorien bezieht Platoon kritisch Stellung zum Vietnamkrieg und
dem Verhalten der US-Soldaten, relativiert diese Kritik aber häufig wieder. Der Vietnamkrieg fin-
det in dem Film in einer Art historischem Vakuum statt. Taylor sieht den Krieg in einer histori-
schen Linie mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, der moralisch gute Elias stellt ihn in eine Rei-
he mit imperialistischen Kriegen. Die Gründe sind für Platoon deshalb nicht wichtig, weil als ent-
scheidendes Problem und als die eigentliche Tragödie ausgemacht wird, dass die Amerikaner
sich gegenseitig bekämpften. Implizit kritisiert der Film die Kriegsgründe über das die Negation
175
Vgl. Punkt 2.
4 Filmanalyse
34
der Genre-,conventions' des Kriegsfilms. Der Kriegsschauplatz Vietnam als Möglichkeit, den
Krieg zu beurteilen, wird in Platoon zu einer deutlichen Kritik genutzt. Beinahe alle US-Soldaten
hassen das Land, nur Bunny gefällt es dort, weil er ohne jegliche moralische Grenzen agieren
kann. Die Umkehrung der Genre-,conventon' der Darstellung des Kriegsschauplatzes unterstützt
diese Kritik. Einen Schwerpunkt legt Platoon auf die umstrittene Einberufungspraxis der USA.
Dabei greift er jedoch auf eine alte Hollywoodregel zurück, die den ,,guten Schwarzen" über seine
Akzeptanz ,,weißer Ideologie" definiert, und relativiert seine Darstellung einer ungerechten Praxis.
Platoon stellt Verbrechen der US-Soldaten dar und identifiziert sie als solche. Dabei offeriert der
Film drei Erklärungsmuster für ein solches Verhalten: Erstens eine Mischung aus Wut und Angst,
die zumindest dann entschuldigt wird, wenn die Konsequenzen nicht gravierend sind; zweitens
ein grenzenloses Ausleben von Emotionen und Trieben, das durch eine unmoralische Führung
erst zugelassen wird; drittens eine rein funktionalistische Kriegsauffassung, die sich jeglicher Mo-
ral entledigt hat. Die letzten beiden Punkte kritisieren eine unmoralische Führung der Soldaten.
Allerdings wird die Kritik relativiert, da das Überleben im Vordergrund steht. Für dieses Ziel stellt
der Film die Mittel über Moral. Die offizielle Kriegspolitik der USA wird als in gewisser Weise schi-
zophren dargestellt, nämlich die zu bekämpfen, die verteidigt werden sollen.
Entsprechend seiner beinahe ausschließlich US-zentristischen Sichtweise wird kein differenzier-
tes Bild der Vietnamesen gezeichnet. Die südvietnamesische Bevölkerung wird als Opfer der US-
Soldaten dargestellt, doch sie bleibt reiner Funktionsträger, um das Verhalten der Soldaten zu er-
klären. Die NVA-Soldaten werden als hervorragende Kämpfer charakterisiert, die jedoch skrupel-
los und amoralisch scheinen. Es wird dabei impliziert, dass die USA ihrerseits den Krieg nicht
entsprechend skrupellos geführt hat, um die NVA besiegen zu können.
4 Filmanalyse
35
4.3 Full Metal Jacket
In Vietnam the wind doesn't blow, it sucks
4.3.1 Produktionsnotizen
Full Metal Jacket basiert auf dem Roman The Short Timers von Gustav Hasford. Stanley Kubrick
erwarb 1983 die Rechte und schrieb zusammen mit Michael Herr, Autor des Vietnam-Klassikers
Dispatches und Co-Autor der Filme The Deer Hunter und Apocalypse Now, das Drehbuch. War-
ner Bros. entschieden sich daraufhin, den Film zu produzieren. Die Dreharbeiten begannen im
August 1985 und waren für 18 Wochen geplant, aus denen dank Kubricks Perfektionismus 39
wurden. Der Film wurde vollständig in England gedreht und kostete 17 Millionen Dollar. Erst am
26. Juni 1987 kam er in die Kinos.
176
Stanley Kubrick, Michael Herr und Gustav Hasford wurden 1988 für den Oscar für das beste a-
daptierte Drehbuch nominiert, gewannen diese Trophäe aber nicht. Allerdings gewann der Film in
verschiedenen Kategorien bei unterschiedlichen Preisverleihungen.
177
Finanziell war Full Metal
Jacket mit 69 Millionen Dollar Einnahmen aus Kino- und Videogeschäft alleine in den USA ein Er-
folg, wenn auch nicht vergleichbar mit Platoon.
178
176
Vgl. BAXTER (1998) S. 326-353.
177
vgl.
http://us.imdb.com/title/tt0093058/awards.
178
vgl.
http://us.imdb.com/title/tt0093058/business.
4 Filmanalyse
36
4.3.2 Einordnung der Geschichte in den realen Krieg
Der zweite Teil des Films spielt zur Tet-Offensive Ende Januar 1968, folglich ist der erste Teil auf
ungefähr Mitte 1967 zu datieren. Das dargestellte Ausbildungscamp gibt es wirklich.
179
Die
Schlacht um Hué, deren Auswirkungen im zweiten Teil gezeigt werden, war die größte Schlacht
der Tet-Offensive. Die dargestellten Massenhinrichtungen durch die Nordvietnamesen sind be-
legt, ebenso die geschilderte Vorgehensweise.
180
Die Geschehnisse finden einen Monat nach
denen von Platoon statt.
4.3.3 Struktur des Films
Full Metal Jacket ist deutlich in zwei Teile geteilt. Der erste Teil spielt im ,,Marine Corps Recruit
Depot" auf Paris Island, South-Carolina, und dauert ungefähr 43 Minuten. Er nimmt etwas mehr
als ein Drittel des Films ein. Der zweite Teil spielt in Vietnam, und zwar in Da Nang sowie in Hué.
Wie Platoon ist der Film streng chronologisch erzählt und mit dem Off-Kommentar eines der Be-
teiligten versehen (Joker), der jedoch weniger Erzähler als vielmehr Berichterstatter ist.
181
Der Film beginnt
182
mit dem Country-Pop von Johnny Wrights Hello Vietnam, einem patriotischen
Lied von 1965,
183
das aber im Zusammenhang mit den sterilen Bildern sehr ironisch klingt. In die-
sen Bildern wird den Rekruten (,,Privates") ein erster Teil ihrer Persönlichkeit genommen: Ihnen
werden die Haare rasiert. Ein jeweils kurzer Blick auf die ursprüngliche Frisur ist das einzige, was
über das Vorleben der Soldaten verraten wird. (Seq. 0)
Das Ausbildungssystem funktioniert folgendermaßen: Erstens nimmt es ganz im Goffman'schen
Sinne einer ,,totalen Institution"
184
den Rekruten ihre
Persönlichkeit und ihr ziviles Selbstwertgefühl, um
sie auf eine formbare Masse zu reduzieren
.
Zwei-
tens impft es ihnen parallel neue Werte und Bindun-
gen ein, die sie zu funktionsfähigen und doch unkon-
trollierbaren Killern (Seq. 23a und b) machen sollen.
Das Nehmen der Persönlichkeit beginnt im Prolog
und wird sogleich mit der Begrüßung durch Senior
Drill Instructor Sergeant Hartman fortgesetzt. Hart-
mans Art zieht sich durch den gesamten Ausbil-
dungsteil: Er reduziert die Rekruten auf etwas ,,Untermenschliches", beleidigt allgemein und per-
sönlich, schreit und tobt, macht sie lächerlich und bestraft sie physisch.
In der ersten Sequenz werden neben diesem Umgangston auch vier Rekruten eingeführt, die
ziemlich willkürlich neue Namen erhalten: Private Brown, ein Schwarzer, übereifriger Rekrut, der
179
Vgl. http://www.mcrdpi.usmc.mil/ (Offizielle Homepage des Marine Corps Recruit Depot/Eastern Recruiting Region
Parris Island, S.C.).
180
Vgl. KARNOW (1997) S. 542-547.
181
Vgl. dazu REINECKE (1993) S. 105.
182
Er verzichtet bis auf Titel und Regisseur auf sämtliche ,credits'.
183
Vgl.
http://www.jerryosborne.com/2-23-98.htm
(Herausgeber
von Musikbüchern mit einer Seite, auf der musikspezi-
fische Fragen beantwortet werden).
184
Vgl. GOFFMAN (1972) S. 13-123.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832479534
- ISBN (Paperback)
- 9783838679532
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Trier – FB IV - Soziologie
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- filmanalyse platoon full metal jacket tigerland helden
- Produktsicherheit
- Diplom.de