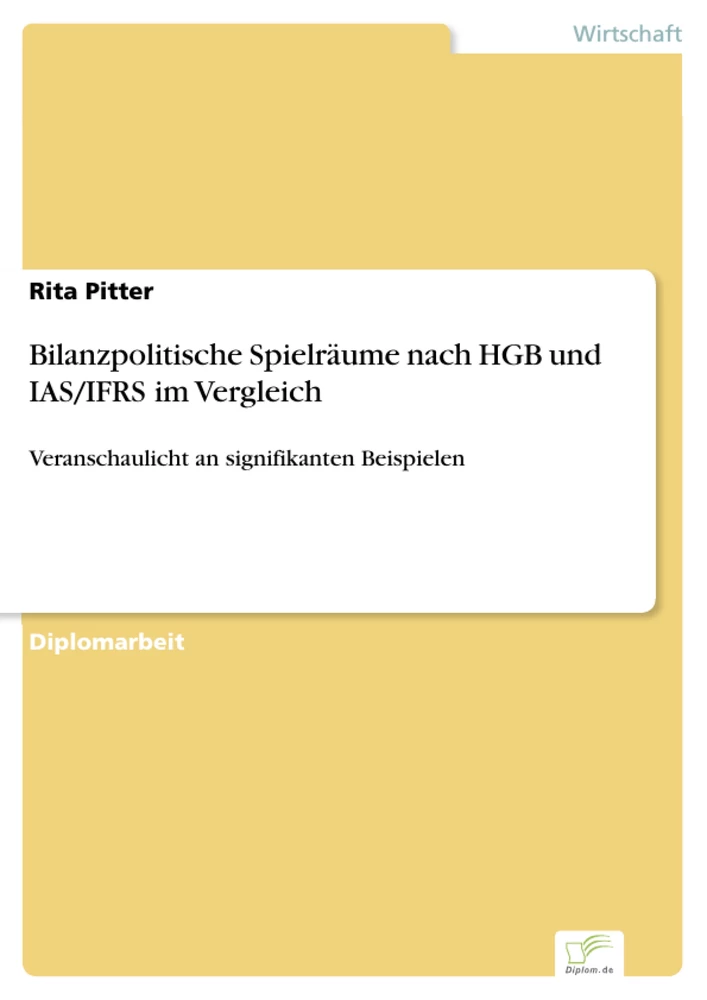Bilanzpolitische Spielräume nach HGB und IAS/IFRS im Vergleich
Veranschaulicht an signifikanten Beispielen
Zusammenfassung
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung des Wirtschaftsmarktes stehen immer mehr deutsche Unternehmen vor der Entscheidung, ihre Rechnungslegung an internationale Rechnungslegungsstandards anzupassen. Zu den international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zählen insbesondere die international ausgerichteten International Accounting Standards (IAS) und die nationalen US-amerikanischen Normen, die US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).
Insbesondere den IAS wird in letzter Zeit immer mehr Beachtung geschenkt. Ein Grund hierfür ist die Verabschiedung der EG-Verordnung vom 19.7.2002 zur IAS-Rechnungslegung. Danach müssen alle kapitalmarktorientierten Unternehmen für Geschäftsjahre, die ab dem 1.1.2005 beginnen, zwingend ihre Konzernabschlüsse nach den IAS aufstellen. Für die übrigen Konzernunternehmen und für die Einzelabschlüsse aller Unternehmen wird den Mitgliedstaaten ein Wahlrecht eingeräumt. Sie können die Anwendung der IAS-Regeln als Pflicht verbindlich vorschreiben, als Wahlrecht gestatten oder durch ein Verbot untersagen.
Abgesehen davon, wie der deutsche Gesetzgeber von der Umsetzung der IAS-Vorschriften Gebrauch machen wird, stellt sich für deutsche Unternehmen die Frage, ob man - wenn nicht pflichtgemäß, so doch freiwillig - auf eine IAS-Bilanzierung überwechseln sollte.
In diesem Zusammenhang könnte sich deutschen Unternehmen in Zukunft die Möglichkeit bieten, zwischen der Rechnungslegung nach Handelsgesetzbuch (HGB) und IAS, das für ihre unternehmerische Gesamtzielsetzung optimale Rechnungslegungssystem auszuwählen. Da Bilanzpolitik als willentliche und hinsichtlich der Unternehmensziele zweckorientierte Gestaltung der Rechnungslegung im Rahmen der Rechtsordnung verstanden werden kann, würden sich bereits mit der Auswahl des zu verwendenden Rechnungslegungssystems veränderte bilanzpolitische Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewinnt die Bilanzpolitik an Bedeutung. Krisen- bzw. Verlustsituationen werden als typische Veranlassung gesehen, Rechnungslegungspolitik zu betreiben, da die ungeschminkte Darstellung von Ereignissen, Entwicklungen und der aktuellen Lage für das betreffende Unternehmen negative oder sogar existenzbedrohenden Konsequenzen hätte. In solchen Unternehmenslagen wird eine progressive Bilanzpolitik verfolgt, die durch Maßnahmen zur Ergebniserhöhung gekennzeichnet ist. Demgegenüber wird eine ergebnismindernde Politik, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Themen- und Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
1.3 Grundlegender Hinweis zur Zitierweise
2 Grundlagen und konzeptionelle Unterschiede der Rechnungslegung nach HGB und IAS
2.1 Elemente des Jahresabschlusses und Geltungsbereich der Rechnungslegung
2.2 Das Verhältnis der Handelsbilanz zur Steuerbilanz
2.3 Das IASB und die Stufenordnung der IAS-Rechnungslegung
2.4 Rechtliche und wirtschaftliche Strukturen sowie sozioökonomische Rahmenbedingungen
2.5 Grundsätze, Zielsetzungen und Adressaten der Rechnungslegungssysteme
3 Bilanzpolitische Rahmenbedingungen
3.1 Begriff der Bilanzpolitik
3.2 Ziele der Bilanzpolitik
3.3 Instrumente der Bilanzpolitik
3.4 Bilanzpolitische Zielkonflikte
3.5 Grenzen der Rechnungslegungspolitik
4 Gestaltungsspielräume bei der Bilanzierung
4.1 Grundlegende Ansatz- und Bewertungsvorschriften
4.1.1 Ansatz nach HGB und IAS
4.1.2 Bewertung nach HGB und IAS
4.2 Gestaltungsspielräume im Anlagevermögen
4.2.1 Bilanzierung und Bewertung von Bilanzierungshilfen und von immateriellem Anlagevermögen
4.2.2 Ingangsetzungs- und Erweiterungsaufwendungen
4.2.3 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
4.2.4 Die Bilanzierung des derivativen Geschäfts- und Firmenwertes
4.2.5 Sachanlagevermögen
4.2.6 Finanzanlagevermögen
4.3 Gestaltungsspielräume im Umlaufvermögen
4.3.1 Vorräte
4.3.2 Langfristige Auftragsfertigung
4.4 Gestaltungsspielräume beim Ansatz von Rückstellungen
4.4.1 Generelle Bilanzierung
4.4.2 Pensionsrückstellungen
4.4.3 Aufwandsrückstellungen
4.5 Sonstige Gestaltungsspielräume
4.5.1 Disagio
4.5.2 Latente Steuern
5 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Quellen aus dem Internet
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Instrumente der Rechnungslegungspolitik
Abbildung 2: Umfang der Herstellungskosten nach HGB und IAS
Abbildung 3: Folgebewertung von financial assets
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Themen- und Problemstellung
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung des Wirtschaftsmarktes stehen immer mehr deutsche Unternehmen vor der Entscheidung, ihre Rechnungslegung an internationale Rechnungslegungsstandards anzupassen. Zu den international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zählen insbesondere die international ausgerichteten International Accounting Standards (IAS) und die nationalen US-amerikanischen Normen, die US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP). Insbesondere den IAS wird in letzter Zeit immer mehr Beachtung geschenkt. Ein Grund hierfür ist die Verabschiedung der EG-Verordnung vom 19.7.2002 zur IAS-Rechnungslegung. Danach müssen alle kapitalmarktorientierten Unternehmen[1] für Geschäftsjahre, die ab dem 1.1.2005 beginnen, zwingend ihre Konzernabschlüsse nach den IAS aufstellen.[2] Für die übrigen Konzernunternehmen und für die Einzelabschlüsse aller Unternehmen wird den Mitgliedstaaten ein Wahlrecht eingeräumt. Sie können die Anwendung der IAS-Regeln als Pflicht verbindlich vorschreiben, als Wahlrecht gestatten oder durch ein Verbot untersagen.[3]
Abgesehen davon, wie der deutsche Gesetzgeber von der Umsetzung der IAS-Vorschriften Gebrauch machen wird,[4] stellt sich für deutsche Unternehmen die Frage, ob man – wenn nicht pflichtgemäß, so doch freiwillig – auf eine IAS-Bilanzierung überwechseln sollte.[5]
In diesem Zusammenhang könnte sich deutschen Unternehmen in Zukunft die Möglichkeit bieten, zwischen der Rechnungslegung nach Handelsgesetzbuch (HGB) und IAS, das für ihre unternehmerische Gesamtzielsetzung optimale Rechnungslegungssystem auszuwählen. Da Bilanzpolitik[6] als willentliche und hinsichtlich der Unternehmensziele zweckorientierte Gestaltung der Rechnungslegung im Rahmen der Rechtsordnung verstanden werden kann, würden sich bereits mit der Auswahl des zu verwendenden Rechnungslegungssystems veränderte bilanzpolitische Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.[7]
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewinnt die Bilanzpolitik an Bedeutung. Krisen- bzw. Verlustsituationen werden als typische Veranlassung gesehen, Rechnungslegungspolitik zu betreiben, da die „ungeschminkte Darstellung von Ereignissen, Entwicklungen und der aktuellen Lage für das betreffende Unternehmen negative oder sogar existenzbedrohenden Konsequenzen hätte.“[8] In solchen Unternehmenslagen wird eine progressive Bilanzpolitik verfolgt, die durch Maßnahmen zur Ergebniserhöhung gekennzeichnet ist. Demgegenüber wird eine ergebnismindernde Politik, die als konservative Bilanzpolitik bezeichnet wird, eher bei einer guten Ertragslage angewandt.
Inwieweit ein Unternehmen mit Hilfe der Bilanzpolitik Einfluss auf den Jahresabschluss nehmen kann, hängt auch ganz wesentlich von den Gestaltungsspielräumen ab, die das jeweilige Rechnungslegenssystem dem Bilanzierenden eröffnet. Aufgrund der Zielsetzung und der Funktionen der beiden Rechnungslegungssysteme[9] wird den IAS nachgesagt, „bilanzpolitische Spielräume im Vergleich zur deutschen Rechnungslegung einzuschränken“.[10]
Diese These soll nun im Rahmen der vorliegenden Arbeit überprüft werden. Dazu werden die Möglichkeiten und Grenzen der Rechnungslegungspolitik nach HGB und IAS am Beispiel des Einzelabschlusses einer Kapitalgesellschaft aufgezeigt und gegenübergestellt. Die Konzernrechnungslegung wird ausgeklammert, da eine Abhandlung den Umfang dieser Arbeit bei weitem übersteigen würde.[11] Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei dem handelsrechtlichen Jahresabschluss. Steuerliche Aspekte werden nur berücksichtigt, soweit sie handelsrechtliche Vorschriften beeinflussen.
1.2 Gang der Untersuchung
Ein Vergleich der bilanzpolitischen Möglichkeiten nach HGB und IAS erfordert Hintergrundwissen über die wesentlichen Grundlagen der beiden Rechnungslegungswelten. Zu diesem Zweck werden im Gliederungspunkt 2 Grundlagen und konzeptionelle Unterschiede der Rechnungslegung nach HGB und IAS beschrieben. Dabei wird besonders auf die Einflussfaktoren und Unterschiede eingegangen, die zum Verständnis der beiden Rechnungslegungen selbst und damit auch der Rechnungslegungspolitik unabdingbar sind.
Im Gliederungspunkt 3 wird ein Überblick über die bilanzpolitischen Rahmenbedingungen gegeben. Hier wird nach einer Definition der Bilanzpolitik ein Überblick über das Instrumentarium der Bilanzpolitik gegeben. Danach erfolgt eine Beschreibung der grundsätzlichen Zielsetzungen bilanzpolitischer Maßnahmen. Dabei werden auch die Grenzen der Einsatzmöglichkeiten der Bilanzpolitik und mögliche Zielkonflikte herausgearbeitet. Im Gliederungspunkt 4 werden nach einem allgemeinen Bilanzierungsüberblick die einzelnen Bilanzpositionen analog zum Bilanzierungsschema des § 266 HGB sukzessive bezüglich ihrer bilanzpolitischen Gestaltungsfähigkeit vorgestellt. Ausgangspunkt sind jeweils die deutschen Vorschriften, die mit den Vorschriften der IAS verglichen werden. Die sehr breit angelegte Themenstellung lässt es sinnvoll erscheinen, eine Auswahl zu treffen: Aus der großen und vielschichtigen Palette bilanzpolitischer Parameter werden als Schwerpunkte die in der industriellen Praxis häufig vorkommenden und materiell gewichtigsten ausgewählt. Folglich bleiben Bilanzpositionen, in denen kaum bilanzpolitischer Spielraum vorhanden ist, und formelle und branchenspezifische Parameter ausgegrenzt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einem Ausblick.
1.3 Grundlegender Hinweis zur Zitierweise
Im Jahr 2001 fand eine weitgehende Umstrukturierung der Organisationsstruktur des International Accounting Standards Commitee (IASC) statt. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wurden das IASC, welches die Rechnungslegungsstandards herausgibt, in International Accounting Standards Board (IASB) und die IAS in International Financial Reporting Standards (IFRS) umbenannt. Um Verwirrungen zu vermeiden, wird im gesamten Text der Arbeit die Bezeichnung IASB als Bezeichnung für das Exekutivorgan verwendet, auch wenn sich der betreffende Vorgang auf die Vergangenheit bezieht und das Organ IASC hieß. Im Gegensatz dazu wird für die Rechnungslegungsstandards immer die Bezeichnung – International Accounting Standards (IAS) – beibehalten, auch wenn die seit dem 01.04.2001 neu erscheinenden Standards unter der Bezeichnung International Financial Reporting Standards (IFRS) herausgegeben werden.
2 Grundlagen und konzeptionelle Unterschiede der Rechnungslegung nach HGB und IAS
2.1 Elemente des Jahresabschlusses und Geltungsbereich der Rechnungslegung
Die Rechnungslegung nach HGB sieht je nach Rechtsform und Größe des Unternehmens
unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Elemente des Jahresabschlusses, der Gliederungsvorschrift von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und der Anhangsangaben vor. Zunächst unterscheidet das HGB zwischen Kapitalgesellschaften und sonstigen Kaufleuten. Alle Nichtkapitalgesellschaften haben gemäß § 242 HGB einen Jahresabschluss zu erstellen, der aus Bilanz und GuV besteht. Kapitalgesellschaften werden anhand der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl weiter in kleine, mittelgroße und große Kapitalgesellschaften untergliedert.[12] Dabei besteht der Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften aus Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht.[13] Für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften sind bestimmte Vereinfachungen in der Rechnungslegung vorgesehen.[14] Des Weiteren existiert im HGB eine formale Zweiteilung der Vorschriften für Einzel- und Konzernabschlüsse.
Die Bestandteile des Jahresabschlusses (financial statement) nach den IAS sind im Framework 7 aufgeführt. Der Jahresabschluss besteht hiernach aus Bilanz (balance sheet), Gewinn- und Verlustrechnung (income statement), Kapitalflussrechnung (cash flow statement), Eigenkapitalveränderungsrechnung (changes in equity) und einem Anhang (notes). Jedoch sind diese Bestandteile nicht verbindlich festgelegt. In F. 7 heißt es dazu, dass die
oben aufgeführten Bestandteile normalerweise (normally) im Jahresabschluss enthalten sind. Maßgebend sind die Informationsbedürfnisse der Jahresabschlussadressaten.[15] Mit Hilfe des cash flow statements werden Informationen über die Bewegungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente eines Unternehmens bereitgestellt. Damit soll potenziellen Investoren Informationen zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, liquide Mittel zu erwirtschaften, zur Verfügung gestellt werden.[16] In den changes in equity wird das Jahresergebnis und die mit dem Eigenkapital verrechneten Beträge dargestellt. Die notes enthalten zusätzliche Informationen zu einzelnen Posten der Bilanz und der GuV. Dabei ist vor allem auf die bei der Erstellung des Abschlusses herangezogenen Bewertungsgrundlagen und die spezifischen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einzugehen.[17] Eine Besonderheit gegenüber den Anhangsangaben nach HGB ist die Segmentberichterstattung. Sie kann z.B. nach dem Segment Produktart oder Regionen, in denen Geschäfte getätigt werden, aufgeteilt werden. Nach IAS 14 sollen die Angaben den Adressaten helfen, die Ertragslage des Unternehmens besser zu verstehen, Risiken und Erträge des Unternehmens besser einzuschätzen und das gesamte Unternehmen sachgerechter beurteilen zu können. Die IAS-Vorschriften sind in der gegenwärtigen Form grundsätzlich allgemeinverbindlich.[18] Es ist damit weder zwischen Einzel- und Konzernabschluss zu differenzieren, noch gelten branchen- oder rechtsformabhängige Sonderregelungen oder rechtsformabhängige Erleichterungen.
2.2 Das Verhältnis der Handelsbilanz zur Steuerbilanz
In Deutschland hängen die Handels- und Steuerbilanz aufgrund der Maßgeblichkeit der
Handels- für die Steuerbilanz voneinander ab. Gesetzlich kodifiziert ist die Maßgeblichkeit in
§ 5 Abs. 1 S. 1 EStG. Hierin heißt es, dass buchführende und regelmäßig Abschlüsse erstellende Gewerbetreibende prinzipiell bei der Erstellung der Steuerbilanz auf die nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellte rechtsgültige Handelsbilanz zurückgreifen müssen, sofern nicht zwingende steuerrechtliche Vorschriften diesen Handelsbilanzgrößen entgegenstehen und eine Abweichung verlangen. Aus wirtschaftspolitischen Gründen werden von staatlicher Seite Vergünstigungen wie steuerliche Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzungen oder die Bildung steuerfreier Rücklagen für die Steuerbilanz eingeräumt. Da steuerliche Wahlrechte nur übereinstimmend mit der Handelsbilanz ausgeübt werden können, tritt in einem dieser Fälle die umgekehrte Maßgeblichkeit des § 5 Abs. 1 S. 2 EStG in Kraft, nach der steuerliche Wahlrechte auch für die Handelsbilanz zwingend werden.[19] Damit kann das umgekehrte Maßgeblichkeitsprinzip in erheblichem Umfang zu bilanzpolitischen Spielräumen führen. Auf deren Darstellung wird jedoch aufgrund des gesetzten Rahmens der Arbeit verzichtet.
Entgegen dem HGB besteht für den IAS-Abschluss explizit keine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz. Die IAS-Rechnungslegung kennt auch keine umgekehrte Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handelsbilanz. Somit hat das Steuerrecht keinen Einfluss auf die IAS, d.h. die Rechnungslegung ist frei von fiskalisch begründeten Bilanzierungsregeln.
2.3 Das IASB und die Stufenordnung der IAS-Rechnungslegung
Die IAS werden nicht durch einen Gesetzgeber erlassen, sondern vom International Accounting Standards Board (IASB) mit Sitz in London entwickelt und herausgegeben. Auf Initiative von Vertretern des britischen Berufstandes des Rechnungswesens wurde das IASB 1973 in London unter dem Namen Internationale Accounting Standards Commitee (IASC) als eine unabhängige privatrechtliche Organisation gegründet.[20] Derzeit besteht das IASB aus 143 Mitgliedsorganisationen aus 103 Staaten,[21] darunter aus Deutschland: das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) und die Wirtschaftsprüferkammer (WPK). Das IASB hat sich die Entwicklung und weltweite Verbreitung von internationalen Rechnungslegungsvorschriften zur Aufgabe gemacht. Als privatrechtliche Organisation hat es allerdings keine rechtliche Handhabe, die Beachtung der Standards durchzusetzen. Die nationalen Mitgliedsorganisationen haben sich jedoch verpflichtet, die Durchsetzung der IAS in ihrem Land zu fördern.
Um eine möglichst weite Akzeptanz der IAS zu erreichen, wurden diese zunächst vom IASB mit einem weitgefassten Rahmen aus Wahlrechten und Auslegungsmöglichkeiten versehen. Dies stieß jedoch – insbesondere bei den angloamerikanischen Mitgliedern des IASB – auf Ablehnung.[22] Um eine bessere Vergleichbarkeit von IAS-Abschlüssen zu erreichen und die Akzeptanz als Alternative zu den US-GAAP zu stärken, wurden die Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte nach und nach vom IASB eingeschränkt oder gestrichen.
Die IAS-Rechnungslegung ist dreistufig aufgebaut. Sie besteht aus dem framework for the preparation and presentation of financial statements, den einzelnen standards und den interpretations. Dabei werden im framework die maßgeblichen Ziele, Grundsätze und Methoden der IAS-Rechnungslegung behandelt. Im Ansatz ist das framework der IAS mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)[23] vergleichbar. Sie bilden beide die Basis für spezielle Regelungen. In Ergänzung zum framework regeln die standards Einzelfragen der Rechnungslegung. Hinsichtlich der Normenhierarchie stellt F. 2 dazu unmissverständlich klar, dass das framework nicht die Verbindlichkeit eines standards hat. Damit gelten die Vorschriften des frameworks nur subsidiär. Enthalten die s tandards Unklarheiten oder Unvollständigkeiten, werden sie durch spezielle Interpretationen (interpretations) ergänzt. Damit sind die interpretations noch spezieller als die standards.[24]
2.4 Rechtliche und wirtschaftliche Strukturen sowie sozioökonomische Rahmenbedingungen
Die Rechnungslegung wird hinsichtlich Denkweise und Gesetzgebung vor allem stark durch die Charakteristika der nationalen Rechtssysteme geprägt. Das deutsche Handelrecht beruht auf dem kontinentaleuropäischen Rechtssystem des Code Law, das sich durch kodifizierte, abstrakte – in systematischer Weise geordnete – allgemeingültige Regelungen auszeichnet. Dem steht das Case Law der angloamerikanischen Rechtstradition gegenüber. Die zentralen Rechtsquellen des Case Law stellen richterliche Einzelfallentscheidungen dar. Sie regeln somit detailliert den Einzelfall und beinhalten weniger allgemeingültige Regelungen. Der Vorgehensweise des Case Law folgt vor allem die US-amerikanische Rechnungslegung der US-GAAP. „Obwohl die supernationale Rechnungslegung nach IAS mangels Alter oder mangels Einbettung in einen kulturellen Hintergrund nicht eine sozioökonomische Entwicklungsgeschichte wie das HGB oder die US-GAAP aufweisen“,[25] können sie der angloamerikanischen Rechnungslegung zugerechnet werden, da unbestreitbar eine starke Anlehnung an die US-Rechnungslegung vorliegt.[26] Die wesentlichen Unterschiede zwischen der Rechnungslegung nach HGB und IAS ergeben sich aus der grundverschiedenen kontinentaleuropäischen und angloamerikanischen Rechnungslegungsphilosophie. Vor diesem Hintergrund unterscheiden sich deutsche Rechnungslegungsvorschriften und solche nach IAS bereits in ihrem Entstehungsprozess grundlegend. Das deutsche Rechnungslegungssystem ist in der Hauptsache gesetzlich fixiert und zwar durch das Handelgesetzbuch, das durch Gesellschaftsrecht und Spezialgesetze für einzelne Branchen ergänzt wird. Allerdings wird im HGB auch auf die nicht kodifizierten GoB verwiesen. Folglich ist der Träger der Rechnungslegungsvorschriften nach HGB ausschließlich der Gesetzgeber.[27]
Im Gegensatz dazu stellen die IAS ein System von Rechnungslegungsgrundsätzen eines privaten Gremiums ohne Rechtskraft dar. Sie bauen sich aus einer Vielzahl von Einzelfallregelungen auf, die maßgeblich vom Berufstand der Wirtschaftsprüfer geprägt werden. Die IAS besitzen somit keine rechtliche Gültigkeit und sind daher nicht verpflichtend. Ihnen kommt in den verschiedenen Ländern bisher lediglich ein Empfehlungscharakter zu.
Auch die unterschiedliche Eigentumsstruktur und die Bedeutung des Kapitalmarktes haben wesentliche Auswirkungen auf die Ausgestaltung von Rechnungslegungssystemen.[28]
Da in den Ländern des kontinentaleuropäischen Bereichs auch heute noch kleine bis mittelgroße Unternehmen mit wenig Gesellschaftern vorherrschen, spielen börsennotierte Gesellschaften noch weitgehend eine untergeordnete Rolle. Eine Finanzierung findet noch überwiegend über Bankkredite statt.[29] Die Kapitalgeber verfügen oft über eine enge Beziehung zu den Unternehmen, so dass sie „traditionell auch auf andere Weise Ihre Informationsansprüche, so bspw. durch zusätzliche Informationen im Rahmen der Bonitätsprüfung bei der Kreditvergabe, durchsetzen können.“[30] Dadurch kommt der Publizität der Informationen weniger Bedeutung zu. Im Gegensatz hierzu sind die Anteile an Unternehmen im angloamerikanischen Rechnungslegungsraum breit gestreut. Die Finanzierung über Bankkredite spielt eine untergeordnete Rolle. Folglich zeichnet sich die angloamerikanische Rechnungslegung durch eine strikte Kapitalmarktorientierung aus. D.h. es findet ein Ausrichten nach den Investoren und weniger nach den Gläubigern statt. Unternehmen mit einer hohen Börsenkapitalisierung, verbunden mit einer wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Eigenkapitalmarkt, werden damit auch eher eine Bilanzpolitik mit dem Ziel eines hohen Gewinnausweises betreiben, um zukünftige Investoren anzulocken, als Unternehmen mit geringer Abhängigkeit vom Eigenkapitalmarkt. Diesen stehen neben einem hohen Gewinnausweis, auch noch andere Mittel, wie Sicherheiten, Bürgschaften u.s.w. zur Verfügung, um potenzielle Fremdkapitalgeber zu überzeugen, ihnen Kapital zu überlassen.
2.5 Grundsätze, Zielsetzungen und Adressaten der Rechnungslegungssysteme
Zentrale Unterschiede zwischen der deutschen und der IAS-Rechnungslegung resultieren vor allem aus den unterschiedlichen Zielen des Jahresabschlusses. Als Ziele des Jahresabschlusses nach HGB werden in der Literatur in erster Linie die Informations-, Gewinnermittlungs-, Ausschüttungsbemessungs- und die Steuerbemessungsfunktion aufgeführt.[31]
Das primäre Ziel der Rechnungslegung nach IAS besteht darin, der Öffentlichkeit einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Berichtsunternehmens zu liefern, um sie mit wirtschaftlich nützlichen, d.h. entscheidungsrelevanten Informationen (decision usefulness) zu versorgen.[32] Damit steht die Informationsfunktion im Vordergrund der IAS. Eine Ausschüttungs- oder Zahlungsbemessungsfunktion kommt der IAS-Rechnungslegung hingegen nicht zu.[33]
Ob nun eine Rechnungslegung, die primär auf die decision usefulness ausgerichtet ist, zu einer Beschränkung des rechnungspolitischen Instrumentariums führen wird, sofern durch dessen Einsatz die gewährten Informationen verfälscht werden könnten,[34] wird im Kapitel 4 geklärt.
Bezüglich der Adressaten der Rechnungslegung stellt das HGB zwar keine singuläre Anspruchsgruppe explizit in den Vordergrund, im Zweifel werden jedoch Gläubigerschutzinteressen höher als andere Interessen gewichtet.[35] Aus dieser Tatsache heraus verfolgen die handelsrechtlichen Vorschriften als Rechnungslegungszweck vorrangig den Gläubigerschutz. Im Sinne des Gläubigerschutzgedankens ist eine Rechnungslegung, die Fremdkapitalgeber wie Banken oder Lieferanten möglichst wirkungsvoll vor Vermögensverlusten schützt und damit eine Bedienung ihrer gewährten Kredite sicherstellt. Von eher sekundärer Bedeutung ist dagegen die Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner. Damit erfordert der Gläubigerschutz ein bilanzpolitisches Instrumentarium, dass es erlaubt, einen übermäßigen Mittelabfluss zu verhindern und den Unternehmenserhalt zu gewährleisten.[36]
Als Adressaten der Rechnungslegung nach IAS werden im framework Investoren als Eigenkapitalgeber, Arbeitnehmer, Kreditgeber, Kreditoren, Kunden, der Staat sowie die Öffentlichkeit genannt.[37] Allerdings wird unterstellt, dass die Informationsbedürfnisse der Investoren auch als typisch für die meisten anderen Adressaten anzusehen sind.[38] Damit sind die IAS primär an den Informationsbedürfnissen der Investoren ausgerichtet und der Investorenschutz ist also als vorrangiger Zweck der Rechnungslegung anzusehen. Die Gläubigerschutzfunktion im Sinne des HGB hat nach IAS nur eine im Zuge der wahrheitsmäßigen Informationsversorgung nachrangige Bedeutung.
Der Vergleich wesentlicher Grundsätze der Rechnungslegung offenbart insbesondere Unterschiede in Hinblick auf die periodengerechte Erfolgsermittlung und das Vorsichtsprinzip.
Das im HGB dominierende Vorsichtsprinzip schlägt sich vor allem im Realisations- und Imparitätsprinzip nieder. Hiernach dürfen Gewinne erst bilanziert werden, wenn sie realisiert sind, aber Verluste müssen bereits bilanziert werden, wenn sie absehbar sind. Das Vorsichtsprinzip ist auch eine Erklärung dafür, warum im HGB vielen Aktivierungswahlrechten kaum relevante Passivierungswahlrechte gegenüberstehen. Durch das Vorsichtsprinzip ist das deutsche Bilanzrecht und die Bilanzierungspraxis weiterhin davon geprägt, Bilanzansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände tendenziell erfolgsmindernd vorzunehmen und entsprechend stille Reserven zu bilden.[39] Man versucht damit einen vorzeitigen Mittelabfluss in Form von erhöhten Gewinnausschüttungen zu verhindern, um das Unternehmen vor einer Überschuldung und die Gläubiger vor dem Verlust ihrer Forderung zu schützen.[40]
Das Vorsichtsprinzip ist in den IAS auch verankert. Ihm kommt aber nicht die hervorragende Bedeutung zu, die es in den Rechnungslegungsvorschriften des HGB hat. Das Vorsichtsprinzip darf laut F. 37 nicht in der Weise angewandt werden, dass es zur Bildung von stillen Reserven (hidden reserves) führt. Im Vordergrund der Rechnungslegung nach IAS hingegen steht der periodengerechte Erfolgsausweis (accrual principle). Durch Beachtung dieses Grundsatzes soll die Möglichkeit der Manipulation des Gewinns durch Bildung stiller Reserven eingeschränkt werden. Des Weiteren soll dem Schutz der Investoren durch die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen durch eine möglichst reale Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Rechnung getragen werden.
Bezüglich der Generalnorm unterscheiden sich die Inhalte nach HGB nicht wesentlich von denen nach IAS. Die Gewichtung ist allerdings eine andere. Die Generalnorm des HGB ist im
§ 264 Abs.2 S. 1 HGB wie folgt verankert: “Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln.“ Die Generalnorm stellt jedoch aufgrund ihres GoB-Vorbehalts, ihrer Rechtsentwicklung und ihrer Einordnung kein overriding principle gegenüber den Einzelnormen und den GoB dar. Somit findet nur eine subsidiäre Anwendung gegenüber den Einzelvorschriften statt und „damit wird die Bedeutung leider auf eine eher unverbindliche Zielvorgabe reduziert“.[41]
Obwohl das Prinzip des true and fair view bzw. der fair presentation nicht ausdrücklich von den IAS verlangt wird, nimmt es die übergeordnete Stellung einer Generalnorm ein. Die IAS gehen davon aus, dass bei sachgerechter Anwendung der Einzelvorschriften der IAS grundsätzlich eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfolgt und damit ein true and fair view vermittelt wird.[42] Abweichungen von den Einzelvorschriften sind jedoch zu begründen und mit zusätzlichen Angaben im Anhang zu erläutern.[43] Bei dem Vergleich der beiden Rechnungslegungsnormen lässt sich feststellen, dass dem Prinzip
der zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach IAS eine wesentlich wichtigere Rolle beizumessen ist als nach HGB. Aufgrund dieser Tatsache wird die Rechnungslegung nach IAS oft mit der Voreinschätzung verbunden gegenüber einer Bilanzierung nach HGB zu einem realistischeren Gewinnausweis zu führen und nicht durch stille Reserven verzerrt zu sein.[44] Ob dies richtig ist, oder es mit der Hilfe von Bilanzpolitik unter anderem möglich ist, stille Reserven zu bilden, wird im Kapitel 4 geklärt.
3 Bilanzpolitische Rahmenbedingungen
3.1 Begriff der Bilanzpolitik
„Unter Bilanzpolitik versteht man die willentliche und hinsichtlich der Unternehmensziele zweckorientierte Einflussnahme auf Form, Inhalt und Berichterstattung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses im Rahmen der durch die Rechtsordnung gezogenen Grenzen (legale Bilanzpolitik). Sie erfolgt mit der Absicht, die Rechtsfolgen des Jahresabschlusses und das Urteil der Informationsempfänger zu beeinflussen und sie zu einem gewünschten Verhalten zu bewegen.“[45] Diese von Küting vorgeschlagene Definition von Bilanzpolitik liegt in analoger Form nahezu sämtlichen Veröffentlichungen zur Bilanzpolitik zugrunde und wird auch hier benutzt.[46] Obwohl der Begriff der Bilanzpolitik im Schrifttum weit verbreitet ist, ist der Terminus nicht ganz korrekt: Denn es ist nicht nur die Gestaltung der Bilanz wichtig für die Bilanzpolitik, sondern ebenso die Gestaltung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei Kapitalgesellschaften der Anhang und der Lagebericht.[47] Terminologisch eher geeignet wären die Bezeichnungen Jahresabschlusspolitik oder Rechnungslegungspolitik, diese haben sich aber in der Literatur und in der Praxis nicht durchgesetzt.[48]
3.2 Ziele der Bilanzpolitik
Der gängigen Abgrenzung in der Betriebswirtschaftslehre folgend, ist unter Politik ein zielgerichtetes Handeln und Gestalten zu verstehen. Bilanzpolitik kann damit nur im Hinblick auf entsprechende Ziele sinnvoll betrieben werden.[49] Abhängig von den Funktionen des Jahresabschlusses, hat die Bilanzpolitik Auswirkungen auf die Finanzlage (Ausschüttungsbemessungs- und Steuerbemessungsfunktion) und die Publizitätslage (Informationsfunktion) einer Unternehmung.[50] Damit kann die Bilanzpolitik im Rahmen einer Bilanzierung nach HGB direkt zur Erreichung finanz- und publizitätspolitischer Zielsetzungen beitragen: Die mittels der Rechnungslegungspolitik verfolgten finanzpolitischen Ziele sind auf die Beeinflussung der Steuerzahlungen und der Gewinnausschüttungen gerichtet. Da dem Jahresabschluss nach IAS keine Ausschüttungsbemessungs- und Steuerbemessungsfunktion zukommt,[51] verfolgt die bilanzpolitische Gestaltung nach IAS in erster Linie publizitätspolitische Ziele und somit die Beeinflussung des Verhaltens der Bilanzadressaten zugunsten des Unternehmens.
Im Rahmen des bilanzpolitischen Ziels der Ausschüttungsbeeinflussung wird über die Höhe des ausgewiesenen Gewinns die Gewinnverteilung beeinflusst. Soll z.B. Liquidität im Unternehmen zurückbehalten werden, so wird ein niedrigerer Gewinn als erzielt ausgewiesen, um nur einen geringeren Betrag als möglich ausschütten zu müssen. Ist dagegen beispielsweise eine Kapitalerhöhung geplant, so wird man mit Hilfe der Bilanzpolitik versuchen, den Gewinn so hoch wie möglich auszuweisen, um die Kapitalgeber positiv zu beeinflussen.[52] Bei der Verfolgung des bilanzpolitischen Ziels der Beeinflussung der Steuerzahlungen wird der Bilanzierende in der Regel das Ziel anstreben, „den Gewinn vor Ertragssteuern möglichst so auf die Abrechnungsperioden zu verteilen, dass der Kapitalwert der gewinnabhängigen Steuerzahlungen minimiert wird.“[53]
Im Rahmen der Beeinflussung der Bilanzadressaten ist die Richtung der Bilanzpolitik davon abhängig, ob ein gutes oder schlechtes Bild des Unternehmens vermittelt werden soll. Ein möglichst positives Jahresergebnis wird beispielsweise angestrebt, wenn das Unternehmen um die Aufnahme neuen Kapitals bemüht ist und/oder Ansehensverluste in der Öffentlichkeit vermieden werden sollen. Motive für möglichst niedrige Jahresüberschüsse im Rahmen von publizitätspolitischen Zielen können Ansprüche von Arbeitnehmern oder Eignern sein.[54]
Neben diesen Hauptzielen wird die Bilanzpolitik jedoch oft zur Vertuschung von Managementfehlern, zur Ergebnisverbesserung wegen des Verkaufs eines Unternehmens oder zur Erhöhung der Gewinne wegen erfolgsabhängiger Vergütungen genutzt.[55] Darüber hinaus kann Rechnungslegungspolitik auch zur Ergebnisglättung genutzt werden. Durch die Bildung stiller Reserven in guten Zeiten und deren Auflösung bei schlechter Ertragslage kann nach außen hin ein stabiles Unternehmen suggeriert werden.[56]
3.3 Instrumente der Bilanzpolitik
Um die gewünschten bilanzpolitischen Ziele zu erreichen, steht der Unternehmensleitung ein umfassendes bilanzpolitisches Instrumentarium zur Verfügung. Dieses wird im Schrifttum nach verschiedenen, letztlich jedoch nicht völlig überschneidungsfreien Kriterien systematisiert: Unterschieden wird in zeitlicher Hinsicht in Maßnahmen vor dem Bilanzstichtag (Sachverhaltsgestaltungen) und der Darstellung der wirtschaftlichen Wirklichkeit nach dem Bilanzstichtag (Sachverhaltsabbildung) und bezüglich der Auswirkung auf die Höhe des ausgewiesenen Vermögens und Erfolgs in formelle und materielle Bilanzpolitik.[57] Von formeller Bilanzpolitik spricht man in Bezug auf die Beeinflussung der Gliederung, des Ausweises und der Erläuterung von Abschlussposten. Auf diese Instrumente wird nicht weiter eingegangen, da sie eine untergeordnete Rolle im Rahmen der Bilanzpolitik spielen. In den Bereich der materiellen Bilanzpolitik, die sich mit der eigentlichen Gestaltung des Jahresabschlusses beschäftigt, fallen Wahlrechte und Ermessensspielräume. Auf diese wird im Folgenden bei den Erläuterungen der Darstellungsgestaltung näher eingegangen. Zusätzlich stehen dem Bilanzierenden Maßnahmen zur Beeinflussung des Zeitpunktes der Informationsabgabe zur Verfügung. Hierzu zählen vor allem die Wahl des Bilanzstichtags, des Bilanzvorlagetermins und des Veröffentlichungstermins. Eine Übersicht über die folgenden Ausführungen zugrunde liegende
Systematisierung gibt Abbildung 1. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Instrumente der Rechnungslegungspolitik[58]
Unter Sachverhaltsgestaltungen fallen insbesondere Maßnahmen, die vor dem Bilanzstichtag ausschließlich im Hinblick auf die Gestaltung der Bilanz getroffen werden (z.B. sale and lease back-Verfahren) und die zeitlich verlagerte Vornahme von ohnehin geplanten Geschäftvorfällen, z.B der Kauf oder Verkauf eines Vermögensgegenstandes erst im nächsten Jahr.[59] Damit wird mit Hilfe der Sachverhaltsgestaltungen das der Bilanzierung und Bewertung zugrunde liegendende Mengengerüst beeinflusst. Diese im Vorfeld der Bilanzerstellung durchgeführten Maßnahmen sind häufig für einen Bilanzleser aus dem Jahresabschluss nicht erkennbar und stellen deshalb ein wirksames bilanzpolitisches Instrument dar. Sachverhaltsabbildungen setzen dagegen nach dem Bilanzstichtag an und greifen auf das bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gegebene Mengengerüst zurück. Im Rahmen des Abbildungsprozesses kann dabei sowohl auf das Ausnutzen von Ermessensspielräumen als auch auf das Ausschöpfen gesetzlicher Wahlrechte zurückgegriffen werden.
Ein Wahlrecht liegt immer dann vor, wenn für die Einbeziehung eines gegebenen Tatbestandes mindestens zwei eindeutig bestimmte, sich gegenseitig ausschließende Handlungsmöglichkeiten bestehen und der zur Rechnungslegung Verpflichtete zu entscheiden hat, welche der alternativen Rechtsfolgen eintritt.[60]
Innerhalb der Wahlrechte wird zwischen Bilanzansatzwahlrechten und Bewertungswahlrechten unterschieden. Im Rahmen der Bilanzansatzwahlrechte kann der Bilanzierende beeinflussen, ob ein Sachverhalt in die Bilanz aufgenommen wird oder nicht. Die Aktivierung oder Nichtpassivierung eines Sachverhalts führt entsprechend zu einem höheren Nettovermögens- und Erfolgsausweis und die Nichtaktivierung oder Passivierung führt dagegen zu einem niedrigeren Nettovermögens- und Erfolgsausweis. Im Gegensatz zum HGB stellen die IAS grundsätzlich keine Bilanzansatzwahlrechte zur Verfügung. Bei den Bewertungswahlrechten unterscheidet man Wertansatzwahlrechte und Bewertungsmethodenwahlrechte.
Von Wertansatzwahlrechten wird gesprochen, soweit hinsichtlich der Höhe des Wertansatzes Wahlrechte bestehen. Ein Beispiel bieten die Herstellungskosten zur Bewertung fertiger und unfertiger Erzeugnisse nach HGB oder die Bewertung von Finanzanlagen zu historischen Kosten nach IAS.
Durch Methodenwahlrechte wird dem Bilanzierenden die Möglichkeit eröffnet, zwischen bestimmten in ihrem Ablauf definierten Verfahren der Wertfindung zu wählen.[61] Als Beispiel lassen sich die Wahl zwischen verschiedenen Methoden der planmäßigen Abschreibung sowohl nach HGB als auch nach IAS anführen.
Demgegenüber ergeben sich Ermessensspielräume dann, wenn gesetzliche Regelungen zwar einen bestimmten Wertansatz bzw. einen bestimmten Wertmaßstab festlegen, nicht aber die jeweilige Methode oder die relevanten Tatbestände bezüglich Ansatz oder Bewertung vorschreiben.[62] Innerhalb der Spielräume werden Individual- und Verfahrensspielräume unterschieden.
Individualspielräume ergeben sich dann, wenn aufgrund unvollkommener Informationen über die gegenwärtige Lage und die zukünftige Entwicklung der Ansatz oder der Wert von Vermögensgegenständen zwangsläufig auf subjektiven Einschätzungen, Schätzungen oder Prognosen beruhen muss.[63] Sie bestehen beispielsweise im Zusammenhang mit der Schätzung der Nutzungsdauer von Anlagen oder bei der Bemessung der Höhe bestimmter Rückstellungen für Einzelrisiken. Verfahrensspielräume resultieren daraus, dass aufgrund der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe verschiedene Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes oder Schulden von der Rechtssprechung oder von der Bilanzierungspraxis als zulässig erachtet werden.[64] Spielräume sind – im Gegensatz zu den Wahlrechten – gesetzlich nicht gewollt, sie ergeben sich aus der Unmöglichkeit, alle denkbaren Abbildungsmöglichkeiten zu erfassen und gesetzlich zu normieren.[65]
3.4 Bilanzpolitische Zielkonflikte
Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die Beeinflussung des Jahresabschlusses sowohl unter finanz- als auch unter publizitätspolitischen Gesichtspunkten erfolgen kann. Die Verfolgung der verschiedenen Zielvorstellungen kann jedoch zu Zielkonflikten führen. Dies gilt für die verschiedenen Ziele jeweils in sich, aber auch für das Verhältnis der Bereiche zueinander.[66] Bei einer Bilanzierung nach HGB resultieren die häufigsten Zielkonflikte aus der Verkettung der Handelsbilanz mit der Steuerbilanz. Ein typischer Zielkonflikt besteht darin, in der Handelsbilanz die Ertragslage zum Zwecke der Verbesserung der Außen- und Innenfinanzierung möglichst positiv darzustellen, während man in der Steuerbilanz aufgrund ihrer Steuerbemessungsfunktion einen niedrigeren Gewinn anstrebt.[67] Andererseits können Zielkonflikte auch innerhalb der Handelsbilanz auftreten. Eine Zielkonkurrenz besteht beispielsweise in der Handelsbilanz zwischen dem Ziel, aus oben genannten Gründen einen möglichst hohen Gewinn auszuweisen, und dem Ziel einer Dividendenminimierung oder möglichst geringer Lohnerhöhungen.
Da der Rechnungslegung nach IAS keine Steuerbemessungs- und Ausschüttungsfunktion zukommt, entfällt ein beträchtlicher Teil des bilanzpolitischen Konfliktpotenzials. Zu Zielkonflikten kann es nur innerhalb des publizitätspolitischen Ziels kommen. So kann der Konflikt auftreten, dass zwar ein hoher Gewinnausweis die Möglichkeiten der Außenfinanzierung verbessert, aber Ansprüche von Arbeitnehmern auf Ergebnisbeteiligung weckt und damit die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens verringert. Zur Lösung bilanzpolitischer Zielkonflikte werden im Schrifttum verschiedene Vorschläge gemacht. Die am häufigsten genannten sind: Präferenzbildung, Kompromissstrategie, Gewinnglättung, Objektivierungsthese, Doppelstrategie und die Nichterkennbarkeit bilanzpolitischer Maßnahmen.[68]
3.5 Grenzen der Rechnungslegungspolitik
Durch die Vielfältigkeit der dargestellten Möglichkeiten zur Beeinflussung des ausgewiesenen Jahreserfolges kann der Eindruck entstehen, dass dieser beliebig manipulierbar sei. Das ist jedoch nicht der Fall. Sowohl gesetzliche Vorschriften wie auch einige andere Tatbestände verhindern ein willkürliches Vorgehen bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Bereits die Definition zur Bilanzpolitik macht deutlich, dass sich Bilanzpolitik nur innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens bewegen darf.[69] Die Grenzen für die Aktivitäten des Bilanzpolitikers werden somit durch die gesetzlichen Vorschriften gezogen. Das sind in Deutschland die handelrechtlichen und die steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung. Für IAS-Abschlüsse sind die geltenden IAS zu beachten.
Eine besondere Bedeutung im Hinblick auf eine einschränkende Wirkung der bilanzpolitischen Möglichkeiten wird den Generalnormen der beiden Rechnungslegungen beigemessen. Die Generalnorm des HGB verlangt, dass zusätzliche Angaben im Anhang immer dann zu machen sind, wenn besondere Umstände dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.[70] Pfleger[71] diskutiert, ob auch bilanzpolitische Maßnahmen, insbesondere der materiellen Bilanzpolitik, besondere Umstände sein können. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das normalerweise nicht der Fall ist, da Bilanzleser damit rechnen müssen, dass der Abschluss im Vergleich zwischen bilanzrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht durch die Inanspruchnahme von legalen bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten verzerrt ist. Auch nicht erkennbare Maßnahmen sind dabei eingeschlossen. Eine Angabepflicht im Anhang hat jedoch zu erfolgen, wenn das Bild so verfälscht wird, dass auch ein sehr bewanderter Bilanzleser getäuscht werden kann. Dieser Fall tritt z.B. ein, wenn sämtliche bilanzpolitischen Handlungsalternativen in eine Richtung ausgenutzt werden oder wenn Entwicklungstendenzen des Unternehmens über mehrere Jahre hinweg durch den Einsatz von bilanzpolitischen Maßnahmen verborgen oder umgedreht werden. Damit hat die Generalnorm des HGB nur eine geringe einschränkende Wirkung auf die bilanzpolitischen Möglichkeiten.[72]
Da die IAS davon ausgehen, dass bei sachgerechter Anwendung der Einzelvorschriften die Generalnorm einer zutreffende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfüllt ist, ergeben sich auch aus dieser grundsätzlich keine Einschränkungen.[73]
Überdies kann der bilanzpolitische Spielraum durch vertragliche Anforderungen an die Rechnungslegung begrenzt sein. Neben theoretisch jedem Vertrag zwischen Gesellschaft und einem Vertragspartner (insbesondere Kreditverträgen, aber auch Arbeits- oder Leistungsverträgen), kann vor allem die Unternehmenssatzung Beschränkungen für die Rechnungslegungspolitik enthalten.[74] Eine weitere Grenze der Bilanzpolitik liegt in ihrer Erkennbarkeit bzw. in der Antizipation bilanzpolitischer Gestaltungen durch Bilanzanalytiker. Der Erkennbarkeit bilanzpolitischer Maßnahmen kann durch die sog. verdeckte Bilanzpolitik entgangen werden. Eine verdeckte Bilanzpolitik ist durch eine entsprechende Gestaltung der Aufwands- und Ertragsströme sowie durch verschiedene Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume möglich, die nicht sofort eine Berichtspflicht im Anhang auslösen.[75]
4 Gestaltungsspielräume bei der Bilanzierung
4.1 Grundlegende Ansatz- und Bewertungsvorschriften
4.1.1 Ansatz nach HGB und IAS
Die Ansatzvorschriften bzw. die Bilanzierungsfähigkeit sind für bilanzpolitische Gestaltungen von grundlegender Bedeutung. Bei der Bilanzierungsfähigkeit geht es darum, welche Vermögensgegenstände oder Schulden in die Bilanz aufgenommen, d.h. aktiviert oder passiviert werden dürfen. Dabei bewirkt eine unterlassene Aktivierung eines Vermögensgegenstandes eine Ergebnisminderung und eine vollzogene eine Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr. Im Gegenzug führt der Ansatz eines Passivpostens zu einer Ergebnisminderung und eine Unterlassung zu einer Ergebnisverbesserung.
[...]
[1] Als kapitalmarktorientiert gelten dabei Unternehmen, deren Wertpapiere auf einem geregelten Markt gehandelt werden.
[2] Europäische Unternehmen, die auch einen organisierten Kapitalmarkt eines Drittstaates in Anspruch nehmen und nach anderen international anerkannten Grundsätzen ihren Abschluss als den IAS aufstellen, erhalten einen Aufschub zur Anwendung der IAS-Regeln bis 2007.
[3] Vgl. PEEMÖLLER /SPANIER/WELLER (2002), S. 1799.
[4] Kontrovers diskutiert wird derzeit insbesondere die Frage, ob und inwieweit die IAS auch in den Einzelabschluss Eingang finden sollen. Für eine Anwendung der IAS im Einzelabschluss, vgl. z.B. SELCHERT (2003),
S. 3; WEBER (2003), S. 105; BÖCKING (2001), S. 1433; SCHMALENBACH-GESELLSCHAFT (2001), S. 161; STELLUNSNAHME DES IDW (2002), S. 886; kritisch dagegen EULER (2002), S. 875; MOXTER (2001),
S. 605 f.; ARBEITSKREIS BILANZRECHT DER HOCHSCHULLEHRER RECHTSWISSENSCHAFT (2002),
S. 2372.
[5] Zu Vor- und Nachteilen einer Rechnungslegung nach den IAS für den Einzelabschluss, vgl. BUCHHOLZ (2002), S. 1280 ff.; BÖCKING (2001), S. 1435.
[6] Im weiteren Verlauf werden die Begriffe Rechungslegungspolitik, Jahresabschlusspolitik und Bilanzpolitik synonym verwendet.
[7] Vgl. PELLENS/SÜRKEN (1998), S. 197.
[8] PFLEGER (2001), S. 9.
[9] Vgl. Kapitel 2.5.
[10] ZIMMERMANN (2002), S. 573; vgl. auch FLÜCHTER, der die Auffassung vertritt, dass man mit einem Abschluss nach HGB im Gegensatz zu einer Bilanzierung nach IAS die Jahresabschlussadressaten bewusst täuschen kann, http://www.legamedia.net/legamall/2001/01-03/0103_fluechter_lars_bilanzpolitik.php. (14.04.03); ähnlich MÜLLER/WULF (2001), S. 2206.
[11] Wobei die Ergebnisse der Gegenüberstellung weitgehend auf Konzernabschlüsse übertragbar sind, da der Einzelabschluss einer Unternehmung die Basis für einen eventuell zu erstellenden Konzernabschluss darstellt.
[12] Vgl. § 267 HGB.
[13] Vgl. § 267 Abs. 1 HGB.
[14] Beispielsweise müssen kleine Kapitalgesellschaften nur eine verkürzte Bilanz sowie GuV aufstellen, brauchen bestimmte Angaben im Anhang nicht zu machen und müssen keinen Lagebericht erstellen, vgl. §§ 264 Abs. 1
S. 1, 266 Abs. 1 S. 3, 276, 288 HGB. Für mittelgroße Kapitalgesellschaften sind dagegen Erleichterungen in GuV und Anhang vorgesehen, vgl. §§ 276, 288 HGB.
[15] Vgl. DAUB (2000), S. 297.
[16] Vgl. IAS 7.
[17] Vgl. IAS 1.97.
[18] Vgl. IAS 1.2.
[19] Vgl. für viele WÖHE (1997), S. 167 ff.
[20] Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Berufsverbände aus Australien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Japan, Kanada, Mexiko, den Niederlanden und den USA, vgl. KPMG (1999), S. 2.
[21] Vgl. http://www.idw.de/idw/generator/id=281018 (13.05.03).
[22] Vgl. ARNDT (1999), S. 29.
[23] Jedoch sind die GoB vom Standpunkt der Rechtswissenschaft gesehen ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in Einzelfällen eine Interpretation durch die Rechtssprechung notwendig macht.
[24] Vgl. BUCHHOLZ (2002b), S. 19.
[25] ARNDT (1999), S. 29.
[26] Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Gründungsorganisationen des IASB zum überwiegenden Teil aus Ländern mit einem angelsächsisch geprägten Rechtssystem stammten und folglich dem angelsächsisch geprägten Rechtssystem folgten, vgl. auch HOVE (1990), S. 64.
[27] Während die Verlautbarungen des IDW nur beratenden Charakter und damit geringen Einfluss auf die Rechnungslegung haben.
[28] Vgl. ACHLEITNER (2003), S. 11.
[29] Jedoch findet im kontinentaleuropäischen Raum eine grundlegende Veränderung des Finanzierungsverhaltens der Unternehmen weg von der traditionellen Kreditfinanzierung hin zu einer zunehmenden Inanspruchnahme der Kapitalmärkte statt.
[30] ACHLEITNER (2003), S. 11.
[31] Vgl. für viele COENENBERG (2000), S. 36 ff.; Manche Autoren nennen als Ziel explizit noch die Dokumentationsfunktion, vgl. GRÄFER/DEMMING (1994), S. 312; BITZ/SCHNEELOCK/WITTSTOCK (2000),
S .27 ff.
[32] Vgl. F. 12, 15 ff.
[33] Vgl. BUCHHOLZ (2002a) S. 217; vgl. auch KPMG (1999), S. 19.
[34] Vgl. KROG (1998), S. 41.
[35] Ein Hauptgrund ist die historisch starke Bedeutung der Kreditfinanzierung für Unternehmen in Deutschland und die daraus resultierende einflussstarke Stellung von Kreditgebern; Vgl. auch BUCHHOLZ (2003a), S.216; HAYN/WALDERSEE (2002), S. 17; Kapitel 2.4.
[36] Vgl. KROG (1998), S. 41.
[37] Vgl. F. 9.
[38] Vgl. F. 10.
[39] Vgl. POOTEN (1994), S. 318.
[40] Vgl. HAPPE (2002), S. 361.
[41] KRAWITZ (2001), S. 632.
[42] Vgl. F. 46.
[43] Vgl. KRAWITZ (2001), S. 632.
[44] Vgl. GEIGER (2001), S. 917.
[45] KÜTING/WEBER (1994), S. 1.
[46] Vgl. KÜTING/WEBER (1994), S. 1; WÖHE (1997), S. 55; SIEBEN (1998), S. 5; KUSSMAUL/LUTZ (1993),
S. 399; SCHNEELOCH (1990) S. 96; PEEMÖLLER (2001) S. 2.
[47] Vgl. PFLEGER (1991), S. 22; KÜTING/WEBER (1994), S. 1.
[48] Vgl. KROG (1998), S. 43; KÜTING/WEBER (1994), S. 1.
[49] Vgl. HEINHOLD (1993), S. 235.
[50] Vgl. BIEG/KUSSMAUL (1996), S.181
[51] Vgl. Kapitel 2.5.
[52] Vgl. PACKMOHR (1984), S. 37.
[53] TANSKI/KURRAS/WEITKAMP (1998), S. 612.
[54] Vgl. VEIT (2002), S. 9.
[55] Vgl. VOLLMUTH (2002), S. 276.
[56] Vgl. PFLEGER (1991), Rd. 16 ff.
[57] Vgl. KROG (1998), S. 78 ff.
[58] KROG (1998), S. 79.
[59] Vgl. SIEBEN/COENENBERG (1997), S. 1144.
[60] Vgl. BAUER (1981), S. 66; HINZ (1990), S. 372; WASCHBUSCH (1994), S. 815 ff.
[61] Vgl. BAUS (1991), S. 34.
[62] Vgl. PFLEGER, (1991), Rd. 24.
[63] Vgl. KUSSMAUL//LUTZ (1993), S. 401; SIEBEN/COENENBERG (1997), S. 1144.
[64] Vgl. SIEBEN/COENENBERG (1997), S. 1144.
[65] Vgl. PFLEGER (1991), Rd. 26.
[66] Vgl. VEIT (2002), S. 9.
[67] Vgl. PFLEGER (1991), Rd. 12.
[68] Vgl. auch PEEMÖLLER (2001), S. 179; KÜTING/WEBER (1994), S. 13 ff.
[69] Vgl. Kapitel 3.1.
[70] Vgl. § 264 Abs. 2 S. 2 HGB.
[71] Vgl. PFLEGER (1991) Rd. 907 f..
[72] Vgl. SIEBEN (1998), S. 11; vgl. auch KROG (1998), S. 76.
[73] Vgl. KROG (1998), S. 76.
[74] Vgl. KROG (1998), S. 77.
[75] Vgl. PEEMÖLLER (1993), S. 199.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832479060
- ISBN (Paperback)
- 9783838679068
- DOI
- 10.3239/9783832479060
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften München – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2004 (April)
- Note
- 1
- Schlagworte
- bilanzierung bilanzpolitik bilanz rechnungslegungspolitik jahresabschluss
- Produktsicherheit
- Diplom.de