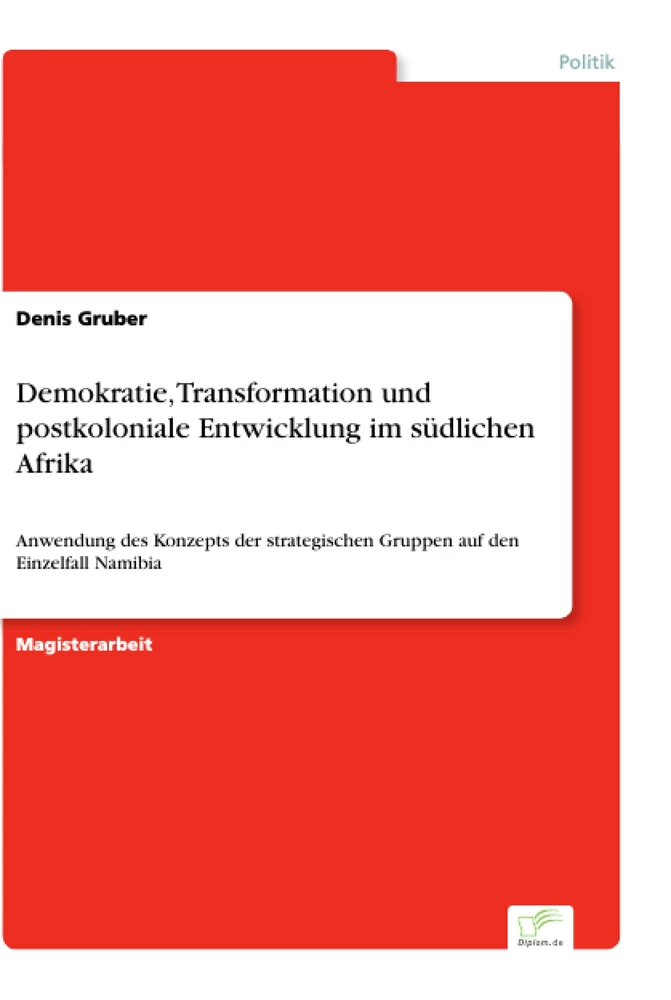Demokratie, Transformation und postkoloniale Entwicklung im südlichen Afrika
Anwendung des Konzepts der strategischen Gruppen auf den Einzelfall Namibia
Zusammenfassung
In dieser Arbeit soll das Handeln von Akteuren in Transformationsprozessen, hier bezogen auf den konkreten Einzelfall Namibia, anhand des von der Bielefelder Schule der Entwicklungssoziologie entwickelten Konzeptes der strategischen Gruppen erläutert werden, um die postkoloniale Entwicklung in Namibia analytisch zu beschreiben. Das Hauptaugenmerk beim Konzept der strategischen Gruppen richtet sich auf gesellschaftliche Eliten der alten und neuen Nomenklatur und Intelligenz, die sich zu bestimmten Gruppen zusammenschließen und ein gemeinsames Aneignungsinteresse entwickeln. Es handelt sich demnach um einen Elitenansatz, der eine historische Analyse in den jeweils zu untersuchenden Gesellschaften zum Gegenstand hat und sich durch die verschiedenen Gesellschaftsformationen erstreckt.
Zu Beginn der Arbeit werden demokratietheoretische Überlegungen in Bezug auf die Transformationsforschung diskutiert. Hierbei werden frühere und gegenwärtige Herangehensweisen miteinander verglichen und herausgearbeitet, welche Dimension dem Demokratiepostulat in Modernisierungs- und Dependenztheorien sowie in heutigen akteurtheoretischen Überlegungen zugeschrieben wird. Hierbei soll ferner auf die Bedeutung des Begriffes Demokratie im afrikanischen Kontext eingegangen werden. Zudem werden Gründe genannt, die es schwierig machen, das westlich orientierte Demokratiemodell in eine von seinem historischen Entstehungskomplex losgelöste Region zu implementieren.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den theoretischen Überlegungen des strategischen Gruppen-Konzepts. Hierbei wird sowohl auf die Konzeptionen der Gründungsväter des Ansatzes, Hans-Dieter Evers und Tilman Schiel, eingegangen als auch auf die neueren Überlegungen zum Konzept der strategischen Gruppen. Im Mittelpunkt stehen hierbei die theoretischen Konzeptionen der Begründer des Konzeptes, insbesondere ihre Ausführungen zum Wachsen und zur Hybridisierung von strategischen Gruppen. Der folgende Unterpunkt befasst sich mit den Kategorien der Strategie und des strategischen Handelns. Des weiteren wird auf die Kritik am Konzept der strategischen Gruppen eingegangen. Schubert, Tetzlaff et. al. erweiterten das strategische Gruppen-Konzept um das SKOG-Konzept, welches neben strategische auch konfliktfähige Gruppen beinhaltet. Die Berücksichtigung dieser definitorischen Unterscheidung in strategische und konfliktfähige Gruppen spielt für die Thematik dieser Arbeit insofern eine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Konzeptuelle Rahmung des Forschungsgegenstands
2.1 Demokratietheoretische Überlegungen in Bezug auf die Transformationsforschung
2.1.1 Frühere Ansätze: Modernisierungs- und Dependenztheorien
2.1.2 Gegenwärtigen Ansätze in der Entwicklungssoziologie und der Transformationsforschung
2.2 Zur Bedeutung von ‚Demokratie’ im afrikanischen Kontext
2.2.1 Demokratisierungswelle Afrikas: Ein Resultat des endenden Ost-West-Antagonismus
2.2.2 Ein neuerlicher ‚Afro-Pessimismus’: Demokratisierung der Machtlosigkeit
2.3 Verschiedene Ansätze der Transformationsforschung
2.3.1 Nie endender Antagonismus? Die zwei Soziologien: Systemtheorie vs. Akteurtheorie
2.3.2 Systemtheoretische Überlegen
2.3.3 Akteurtheoretische Überlegungen
2.3.4 Zur Kritik an systemtheoretischen und akteurtheoretischen Ansätzen
2.4 Weiterführende Überlegungen zu Akteurkonstellationen
2.4.1 Zu den Überlegen von Norbert Elias’ Spielmodellen
2.4.2 Akteur-Struktur-Dynamiken von Uwe Schimank
3. Eine akteurtheoretische Herangehensweise: Das Konzept der strategischen Gruppen
3.1 Von der Gruppe zur ‚strategischen Gruppe’
3.2 Die Gruppe – eine Figuration
3.2 Der Bielefelder Ansatz: Ein Elitenkonzept
3.3 Zur Charakteristik strategischer Gruppen
3.4 Zu den Grundlagen des Bielefelder Ansatzes: Strategie und strategisches Handeln
3.5 Zur Kritik am Konzept der ‚strategischen Gruppen’
3.6 Kategorie der ‚Konfliktfähigkeit’ als Grundlage des SKOG-Konzepts
3.7 Verschiedene strategische Gruppen und ihre Appropriationsmöglichkeiten
3.7.1 Persönliche Aneignungsweise
3.7.2 Kollektive Aneignungsweise
3.7.3 Korporative Aneignungsweise
4. Der Staat Namibia
4.1 Zur Entstehung des Namibia-Konflikts
4.2 Gegenüberstellung verschiedener Konfliktlösungsvorschläge
4.2.1 Südafrikas ‚interne Lösung I: Turnhalle’ vs. ‚westliche Kontaktgruppe’
4.2.2 UN-Resolution 435 und das Scheitern der ‚westlichen Kontaktgruppe’
4.2.3 Südafrikas ‚Totale Nationale Strategie’
4.2.4 Zum US-amerikanischen ‚constructive engagement’ und ‚cuban linkage’
4.2.5 Der Durchbruch zu Verhandlungen
4.3 Die Transition vom autoritären zum demokratischen System
4.3.1 Modell eines idealtypischen Transitionsverlaufs
4.3.2 Namibia – kein idealtypischer Transitionsverlauf
4.4 Zur gegenwärtigen Entwicklung der Demokratie in Namibia
5. Namibia als Untersuchungsgegenstand des strategischen Gruppen-Konzepts
5.1 Die SWAPO: Ausgangspunkt des Entstehens einer politischen Elite
5.2 Faktoren für die herausragende Position der ‚strategischen Elite’
5.3 Weitere strategische Gruppen in Namibia
5.3.1 Staatsbeamte
5.3.2 Das Militär
5.3.3 Wirtschaftliche Unternehmer
5.3.4 Die Rolle der Professionals
5.3.5 Traditionelle Führungsstrukturen
5.3.5 Religiöse Spezialisten in Namibia
5.4 Handlungsmuster strategischer Gruppen
5.4.1 ‚Politisierte Ethnizität’ im Kolonialstaat und im heutigen Namibia
5.4.2 Neopatrimonialismus
5.4.3 Klientelismus und Patronagebeziehungen
6. Fazit und Ausblick
7. Anhang
8. Literaturverzeichnis
9. Eidesstattliche Erklärung
1. Einleitung
Aufgrund der zahlreichen sozialwissenschaftlichen Analysen zu den historischen ‚Umbruchprozessen’ in Mittel- und Osteuropa sowie dem subsaharischen Afrika seit Ende der 1980er Jahre, kam es zu einer Fülle von Begriffen, die häufig synonym zur Beschreibung ein und derselben historischen Ereignisse und Prozesse verwendet wurden. Häufig findet man in derartigen Analysen Begrifflichkeiten wie Transformation, Transition, Revolution, Zusammenbruch, Modernisierung, Liberalisierung, Demokratisierung, Regimewandel oder Systemwechsel vor[1]. Diese Bezüge entstammen sowohl der Transformationsforschung als auch der Entwicklungssoziologie. Neuere Ansätze beider Forschungsrichtungen richten ihren Fokus auf die Benennung und Analyse der betroffenen Akteure in Transformations- und Entwicklungsprozessen.
Diese vorrangig akteurtheoretischen Herangehensweisen bewirken sowohl eine Konzentration auf die Analyse des Handelns von Akteuren, ihren Intentionen und Perzeptionen als auch auf die Beschreibung ihrer Planungs- und Handlungskorridore. Hierbei werden auch Bezüge zur Geschichte und zu kulturellen, religiösen und ökonomischen Gegebenheiten der jeweiligen Gesellschaft hergestellt. Entwicklungssoziologische analytische Konzepte nehmen sowohl Bezug auf westliche als auch auf postkoloniale Gesellschaften und sind stärker eingebunden in akteur- und globalisierungstheoretische Rahmensetzungen, wohingegen bei transformationstheoretischen Zugängen eher der Prozess einer engen Verflechtung von politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen im Mittelpunkt steht.
Der Entwicklungssoziologie muss hierbei eine Vorreiterrolle beigemessen werden, denn sie hat „eine Art Pfadfinderfunktion für die Erklärung allgemeiner gesellschaftlicher Theoriebildung“ inne und lenkte schon „sehr früh den Blick auf die Notwendigkeit (…) gesellschaftliche Transformationsprozesse unter Berücksichtigung verherrschaftlichter intergesellschaftlicher und wechselseitiger Penetrationsvorgänge zu beschreiben und zu erklären“ (Goetze 2002:13).
Goetze folgend hat die Entwicklungssoziologie darauf aufmerksam gemacht hat, „dass zahlreiche, scheinbar ‚neutrale’ und ‚objektive’ soziologische Kategorien und Theorieperspektiven tatsächlich hochgradig durchtränkt sind von ‚westlichen’, europäischen bzw. euroamerikanischen Sonderbedingungen“ (Goetze 2002:13). Mit seinem Begriff der ‚Entwicklungsoption’[2] richtet sich Kößler gegen eine unilineare Auffassung von Entwicklung. Zielten frühere Modernisierungstheorien strikt auf die Implementierung des ‚westlich geprägten Entwicklungsmodells’ in unterentwickelten Gesellschaften ab, so lässt sich durch das Aufzeigen anderer ‚Entwicklungsoptionen’ verdeutlichen, dass auch andere Entwicklungen als die zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung möglich sind.
Entwicklung wurde für lange Zeit als ein selbstständiger Prozess betrachtet, wobei kulturellen, ökonomischen, religiösen, sozialen und politischen Faktoren nur eine marginale Rolle zugeschrieben wurde. Nach Tenbruck wird ‚Entwicklung’ „infolge der Idee von der gleichen und gemeinsamen Entwicklung der Menschheit als die Erfüllung ihrer säkularen Geschichte vermittelt“ (Tenbruck 1987:22 zit. nach Goetze 2002:17). Diese Vision, so Goetze, ist durch die programmatische Übernahme seitens der Vereinigten Staaten politisiert worden, „denn die paradigmatische Formulierung dieser Vision in der Kombination von Fortschrittsglauben, politischer Unabhängigkeit und einem spezifischen Demokratieverständnis“ (Goetze 2002:17) sorge dafür, dass es zu einer weltweit gleichen und gemeinsamen Entwicklung kommen werde, wenn für Unabhängigkeit und Demokratie gesorgt sei[3].
Die westlich-liberale Demokratieform galt in den Augen der westlichen Industrieländer und ihrer Öffentlichkeit als die einzig legitime und akzeptable Herrschaftsform, die einen weltweiten Siegeszug vornehmen würde. Die Programme der Entwicklungspolitik entsprachen den auf das Demokratiepostulat (‚good governance’) gerichteten politischen und wirtschaftlichen Konditionalitäten, womit andere Entwicklungsoptionen schon von vornherein ausgeschlossen blieben.
Steigt man bei den theoretischen Annahmen der Transformationsforschung ein, erkennt man schnell, dass diese die Untersuchung von politischen, ökonomischen und sozialen Systemen zum Gegenstand hat, wobei die Transformationsprozesse zumeist simultan verlaufen. Hierbei müssen zwei miteinander verschränkte Dimensionen angemessen berücksichtigt werden[4]. Zum einen muss der Anlagegegenstand präzisiert, zum anderen geklärt werden, in welcher Form, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Sequenzen sich die Transformation vollzieht und welche Akteure an ihr beteiligt sind. Die erste Dimension bezieht sich demnach auf das gesamte gesellschaftliche System an sich. Die zweite Dimension verweist auf die Notwendigkeit der Trennung der Begrifflichkeiten der Transformationsforschung.
Dieter Neubert führt in Bezug auf neuere Studien über Afrika den Begriff der ‚postkolonialen Transformation’ ein, der eine besondere Nähe zum Begriff des ‚Prozesses der Dekolonisation’ aufweist, der in den 70er Jahren ein zentrales Thema der Afrikaforschung war[5]. Der Begriff der ‚postkolonialen Transformation’ ist für diese Arbeit von zentraler Relevanz, er soll jedoch auch entlang Reinhart Kößlers Ausführungen zu ‚postkolonialen Staaten’[6] verstanden werden wissen. Da auch auf die historischen Hintergründe Namibias eingegangen werden soll, gewinnt besonders bei der Phase der Entscheidung zur Durchsetzung eines westlich geprägten demokratischen Gesellschaftsmodells bis zum Tage der Unabhängigkeit, der von Heribert Weiland gewählte Begriff der ‚ausgehandelten (politischen) Transition’[7] an Bedeutung.
Ich möchte den Begriff der ‚postkolonialen Transformation’ bewusst vom Begriff der ‚postsozialistischen Transformation’ abgrenzen, der zur Beschreibung der Entwicklung in mittel- und osteuropäischen Staaten genutzt wird und häufig im Zusammenhang mit einer engen Verflechtung und Gleichzeitigkeit von wirtschaftlichem, politischem und sozialem Wandel verwendet wird. Der Transformationsansatz entstammt der Modernisierungstheorie und findet insbesondere als ‚nachholende Modernisierung’ in Ost- und Mitteleuropa Eingang in den sozialwissenschaftlichen Diskurs. Transformation ist nicht im Sinne von Transition[8] zu verstehen, sondern als ein Prozess der Modernisierung zu deuten. Bis Mitte der 90er Jahre war die Annahme, dass die ‚Dritte Welle der Demokratie’[9] in Afrika - von autoritären zu demokratischen Systemen[10] - eine klare Richtung besäße.
Transitionen werden hingegen als Prozesse betrachtet, die sich in den Stadien politischer Liberalisierung bis zur Demokratisierung und weiter zur Konsolidierung von Demokratien bzw. der Regression vollziehen. Sie sind vornehmlich auf die politische Sphäre der Transformation beschränkt, da sich ihr Analysegegenstand auf den Übergang von einem Systemtyp zu einem anderen bezieht[11].
Die heutige Transitionsforschung ist sich weitestgehend darüber einig, dass der Ausgang von Transitionsprozessen als ungewiss gilt, das Ergebnis entweder ein demokratisches Regime sein kann, aber auch eine Rückkehr zur alten oder die Hinwendung zu einer neuen Form autoritärer Herrschaft möglich ist.
Eine ‚ausgehandelte Transition’, wie sie in Namibia stattfand, zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass ihr Verlauf von vornherein durch bindende Vereinbarungen infolge Akteurkonstellationen wechselseitiger Verhandlungen[12] festgelegt worden ist. Sie grenzt sich von der allgemeinen Transition dadurch ab, dass hier nicht der Prozess zu einem ‚something else’ zu beobachten ist, sondern der Prozess von einem bestimmten Systemtypus zu einem vorgeschriebenen anderen Systemtypus (im Falle Namibias vom autoritären zum demokratischen System).
Für den Einzelfall Namibia bedeutet das konkret, dass die ‚ausgehandelte Transition’ zur Demokratie durch das Durchlaufen formaler externer Anforderungen und durch Einbehaltung implementierter Handlungs- und Planungsrahmen für daran beteiligte Akteure erfolgte. Eine Transition ist demnach immer nur als ein Teilprozess der Transformation zu verstehen. Um von einer erfolgreichen Transformation von einem autoritären zu einem demokratischen System sprechen zu können, muss die Demokratie als konsolidiert gelten, d.h. die Demokratie muss als gesellschaftliche Norm von den Gesellschaftsteilnehmern anerkannt werden und sich zur anerkannten Legitimationsgrundlage herausgebildet haben[13]. Gerade hierbei gewinnen die Dimensionen des ‚Projektes’ und des ‚Prozesses’ der Entwicklung an Bedeutung. Scheint das Projekt (‚Demokratie’) von vornherein konzipiert und klar, so liegen im Prozess der Transformation die eigentlichen Schwierigkeiten darin, dass der Verlauf eben nicht linear zum erwartenden Projektziel verläuft, sondern auch stark von diesem abweichen kann bzw. sich überhaupt nicht dorthin vollzieht.
In dieser Arbeit soll das Handeln von Akteuren in Transformationsprozessen, hier bezogen auf den konkreten Einzelfall Namibia, anhand des von der Bielefelder Schule der Entwicklungssoziologie entwickelten Konzeptes der ‚strategischen Gruppen’[14] erläutert werden, um die postkoloniale Entwicklung in Namibia analytisch zu beschreiben.
Mit Erhard Berner lässt sich erklären, dass es sich gerade beim strategischen Gruppen-Konzept um einen „prinzipiell dynamischen Ansatz“ (Berner 2001:125) handelt, welcher zudem durch seine begrenzten Vorannahmen besonders ergiebig ist, den durch globale Integration verursachten Wandel zu analysieren[15]. Zudem ist das Konzept hilfreich, das Problem kollektiver Handlungen und der Gruppenbildung in komplexen Umgebungen zu beschreiben. Außerdem so Berner ist der Bezug auf Orientierung und Interessen der Machteliten einer Entwicklungsgesellschaft, ebenfalls Gegenstand der strategischen Gruppen-Forschung[16].
Das Hauptaugenmerk beim Konzept der ‚strategischen Gruppen’ richtet sich auf gesellschaftliche Eliten der alten und neuen Nomenklatur und Intelligenz, die sich zu bestimmten Gruppen zusammenschließen und ein gemeinsames Aneignungsinteresse entwickeln. Es handelt sich demnach um einen Elitenansatz, der eine historische Analyse in den jeweils zu untersuchenden Gesellschaften zum Gegenstand hat und sich durch die verschiedenen Gesellschaftsformationen erstreckt.
„Strategische Gruppen bestehen also aus Personen, die durch ein gemeinsames Interesse an der Erhaltung oder Erweiterung ihrer gemeinsamen Aneignungschancen verbunden sind (...) Bestimmte Gruppen oder Organisationen entwickeln ein langfristiges angelegtes Programm zur Erhaltung oder Verbesserung der Aneignungschancen, das dann von der aktiv handelnden Führung und den Mitgliedern einer strategischen Gruppe akzeptiert wird“ (Evers 1997:155f.). Das Gruppeninteresse konstituiert sich demnach durch die gemeinsame Suche sowohl nach strategischer Nutzung wirtschaftlicher, sozialer und politischer Appropriationsmöglichkeiten als auch nach ‚strategischen Ressourcen’.
Für wichtig halte ich es im Hinblick auf neuere Diskussionen zum strategischen Gruppen-Ansatz, auf die von Erhard Berner vorgenommene kritische Revision des ursprünglichen Ansatzes einzugehen[17]. Berner schlägt vor, strategische Gruppen als „organisierte Netzwerke kollektiver strategischer Akteure“ (Berner 2001:119) zu analysieren. Für ihn ist nicht mehr die Aneignung eines gesellschaftlichen Surplus, sondern der Zugriff auf materielle und nicht-materielle „strategische Ressourcen“ das Bestimmungsmerkmal, die Herrschaftsfähigkeit bestimmen zu können[18]. Mit dieser Definition strategischer Gruppen unterstreicht Berner die mittlere Reichweite des Ansatzes. „Die Entstehung von Gruppen ist weder eine unvermeidliche Folge struktureller Entwicklungen auf der Makroebene noch das Resultat willkürlicher Entscheidungen von Individuen, ihre Kräfte zu vereinigen“ (Berner 2001:118).
Außerhalb der Südostasienforschung wurde der Bielefelder Ansatz vordergründig in der akteurszentrierten Soziologie der Entwicklungspolitik modifiziert[19]. Diese Ansätze beziehen den Begriff der strategischen Gruppen auf die Ebene der Interaktion konkreter sozialer Akteure. Das Konzept „postuliert, dass in einem gegebenen sozialen Interaktionskontext die einzelnen Akteure weder die gleichen Interessen noch die gleichen Vorstellungen haben, und dass, je nach ‚Problem’ ihre individuellen Interessen und Vorstellungen sich je unterschiedlich, aber nicht auf beliebige Weise, aggregieren. Ob diesen ‚virtuellen’ auch tatsächlich gemeinsam handelnde Gruppen entsprechen, ob die sozialen Akteure, die vergleichbare Positionen einnehmen, bestimmte Formen der Interaktion und der Abstimmung des Verhaltens teilen oder nicht, seien diese informeller (Netzwerke, Affiliation, Gefolgschaft) oder formeller (Institutionen, Mitgliedschaften, Organisationen) Natur, bleibt dabei ein empirisch offenes Problem“ (Bierschenk 2002:275).
Politikwissenschaftler um Gunter Schubert und Rainer Tetzlaff erweiterten das Konzept der strategischen Gruppen um das Konzept der ‚strategischen und konfliktfähigen Gruppen’ (SKOG-Konzept)[20]. Dieser Ansatz geht von den Transitionserfahrungen Taiwans, Südkoreas, Thailands und anderer asiatischer Ländern aus und bezieht sich von daher auf ganz spezifische Übergangsabläufe[21]. Das SKOG-Konzept zielt mit der Einführung der Kategorie der ‚Konfliktfähigkeit’ darauf ab, die von Evers und Schiel angesprochene Lücke im Bielefelder Ansatz zu schließen, um die Bedingungen des Wandels historisch-rückblickend und im Hinblick auf wahrscheinliche Entwicklungsverläufe erfassen zu können.
Für diese Arbeit, die eine Analyse strategischer Gruppen in Namibia zum Gegenstand hat, ist der SKOG-Ansatz im Hinblick auf die Transformationsprozesse des südwestafrikanischen Staates jedoch weniger geeignet, weil die von Schubert, Tetzlaff et. al. definitorisch vorgenommene Unterscheidung in (herrschende) strategische und (oppositionelle) konfliktfähige Gruppen für die Analyse politischer Prozesse in Namibia gegenwärtig wenig ergiebig ist. In der derzeitigen Phase findet man in Namibia keine ernsthaften konfliktfähigen Gruppen vor, die über ein ‚hinreichendes Droh- und Verweigerungspotential’[22] verfügen und das gesellschaftliche System umstürzen könnten.
Die theoretischen Annahmen des SKOG-Ansatzes sind jedoch hilfreich, um die Transition vom autoritären zum demokratischen System Namibias zu beschreiben. Hierin verdeutlicht sich die herausragende Rolle der SWAPO (South West African People’s Organization), die die konfliktfähigste Gruppe im jahrzehntelangen Befreiungskampf gegen das südafrikanische Besatzungsregime war.
In Namibia existieren hingegen andersartige Durchsetzungsmechanismen und Handlungsmuster, die es strategischen Gruppen geradezu ermöglichen, als „organisierte Netzwerke kollektiver strategischer Akteure“ (Berner 2001:119) zu agieren. Ich möchte bei der Beschreibung dieser organisierten Netzwerke den Begriff der ‚strategischen Allianz’ verwenden, worunter ich eine Figuration strategischer Gruppen verstehe, die ihre Vorherrschaft durch Patronagebeziehungen, klientelistische Strukturen, Nepotismus und Korruption als auch durch legitime und legale Faktoren (Durchführung freier und gleicher Wahlen, Besetzung hochrangiger Positionen eines demokratischen Systems) abzusichern versteht.
Namibia erlangte nach jahrzehntelanger Kolonialherrschaft 1990 seine Unabhängigkeit und vollzog eine schnelle und erfolgreiche Transition zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Nach der Machtübernahme der SWAPO schien Namibia den Ansprüchen der liberalen demokratischen Verfassung gerecht zu werden, denn die Durchführungen freier Wahlen wiederholten sich, zumal auch prinzipielle Verfassungsbestimmungen eingehalten wurden. In letzter Zeit vermehrten sich jedoch wissenschaftliche Meinungen, dass das demokratische ‚Antlitz’ des jungen Staates zunehmend verblasse[23]. Dies belegen zum einen die Verstetigung autoritärer Herrschaftsstrukturen und die sich herausbildende Dominanz der Befreiungsbewegung an der Macht, SWAPO, im Parteiensystem, und zum anderen ein gravierendes sozioökonomisches Gefälle zwischen einer wohlhabenden weißen Minderheit und einer schwarzen Elite, die zu den Gewinnern der postkolonialen Entwicklung gehört, und der von den Appropriationsmöglichkeiten ausgeschlossenen schwarzen Bevölkerungsmehrheit.
Zu Beginn der Arbeit werden demokratietheoretische Überlegungen in Bezug auf die Transformationsforschung diskutiert. Hierbei werden frühere und gegenwärtige Herangehensweisen miteinander verglichen und herausgearbeitet, welche Dimension dem Demokratiepostulat in Modernisierungs- und Dependenztheorien sowie in heutigen akteurtheoretischen Überlegungen zugeschrieben wird. Hierbei soll ferner auf die Bedeutung des Begriffes ‚Demokratie’ im afrikanischen Kontext eingegangen werden. Zudem möchte ich Gründe dafür nennen, die es schwierig machen, das westlich orientierte Demokratiemodell in eine von seinem historischen Entstehungskomplex losgelöste Region zu implementieren.
Im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels wird auf verschiedene Ansätze der Transformationsforschung eingegangen. Hierbei beziehe ich mich vordergründig auf systemtheoretische und akteurstheoretische Überlegungen. Es soll verdeutlicht werden, dass weder systemtheoretische noch akteurstheoretische Ansätze zur Erklärung gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse genügen, da beide unterschiedliche Gebiete zum Untersuchungsgegenstand haben und somit sowohl Analysestärken als auch –schwächen besitzen.
Nach Kritik an beiden Ansätzen wird das zweite Kapitel mit einer Betrachtung auf weiterführende Überlegungen zu Akteurkonstellationen abgeschlossen. Dabei möchte ich kurz auf die Konzeptionen von Norbert Elias’ Spielmodellen und Uwe Schimanks Akteur-Struktur-Dynamiken eingehen. Beide Ansätze gewinnen für den weiteren Verlauf der Arbeit daher an Bedeutung, da sie sich auf die Strategieausrichtung von Akteuren als auch deren Handlungsausprägungen beziehen.
Das dritte Kapitel befasst sich in erster Linie mit den theoretischen Überlegungen des strategischen Gruppen-Konzepts. Hierbei wird sowohl auf die Konzeptionen der Gründungsväter des Ansatzes, Hans-Dieter Evers und Tilman Schiel, eingegangen als auch auf die neueren Überlegungen zum Konzept der strategischen Gruppen[24].
Zunächst möchte ich auf den Begriff der ‚sozialen Gruppe’ eingehen. Dieser ist Grundlage um überhaupt erst einen Bezug zum Begriff der ‚strategischen Gruppe’ herzustellen. In diesem Abschnitt wird daher veranschaulicht, dass es sich bei Gruppen um temporäre Zusammensetzungen von Individuen handelt. Zudem soll hierbei geklärt werden, dass es sich bei strategischen Gruppen um Eliten handelt, die eine besondere Rolle in jeweiligen gesellschaftlichen Teilsystemen spielen.
Im nächsten Abschnitt gehe ich konkret auf strategische Gruppen ein. Im Mittelpunkt stehen hierbei die theoretischen Konzeptionen der Begründer des Konzeptes, insbesondere ihre Ausführungen zum Wachsen und zur Hybridisierung von strategischen Gruppen. Der folgende Unterpunkt befasst sich mit den Kategorien der ‚Strategie’ und des ‚strategischen Handelns’.
Der fünfte Abschnitt geht auf die Kritik am Konzept der strategischen Gruppen ein. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Evers und Schiel schon 1988 darauf aufmerksam machten, dass auch konterstrategische Gruppen in die Analyse einfließen müssten. Schubert, Tetzlaff et. al.[25] griffen diese Eigenkritik auf und erweiterten das strategische Gruppen-Konzept um konfliktfähige Gruppen. Daher soll im folgenden Teil auf die Kategorie der ‚Konfliktfähigkeit’[26] im SKOG-Konzept eingegangen werden. Die Berücksichtigung der definitorischen Unterscheidung in strategische und konfliktfähige Gruppen spielt für die Thematik dieser Arbeit insofern eine wichtige Rolle, dass sie eine nützliche Grundlage bietet, den Transitionsprozess Namibias vom autoritären zum demokratischen System im vierten Kapitel darzustellen.
Der letzte Abschnitte des dritten Kapitels widmet sich der Frage, welche verschiedenen Gruppen unterschieden werden müssen und welche jeweiligen Appropriationsmöglichkeiten und -strategien sie verfolgen, um den Staat als Ziel der angestrebten Veränderung zu vereinnahmen. Evers und Schiel gehen hierbei von der Unterteilung in persönlicher, korporativer und kollektiver Aneignung aus. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass man diesen Aneignungstypen eine zweite Ebene gegenüberstellen kann, die durch verschiedene Produktionsfaktoren bestimmt wird. Im Einzelnen sind es die klassischen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital. Vergleicht man neuere Literatur zum Konzept der strategischen Gruppen, so erkennt man, dass in letzter Zeit auch Informationsmonopole und die Verfügung von Wissen als wichtige Faktoren für die Bildung strategischer Gruppen angesprochen wurden[27].
Nach der abgeschlossenen theoretischen Rahmung des Forschungsgegenstandes werden die Sachverhalte nun konkret auf das zu untersuchende Fallbeispiel Namibia bezogen. Da im Vorfeld einer Analyse von strategischen Gruppen die historische Dimension und länderspezifischen Gegebenheiten untersucht werden müssen, befassen sich die ersten beiden Abschnitte des Kapitels mit der Geschichte Namibias von 1900 bis 1990, die stark durch die deutsche und später südafrikanische Kolonialpolitik bestimmt wurde.
Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels richtet sich auf die lange Periode des Befreiungskampfes des namibischen Volkes, der überwiegend von der SWAPO, gegen das südafrikanische Besatzerregime geführt wurde. Hierbei wird die Rolle der SWAPO als konfliktfähige Gruppe beschrieben, die sich der herrschenden (strategischen) pro-südafrikanischen Elite entgegenstellte. Des Weiteren wird verdeutlicht, in wieweit externe Akteure in die Namibia-Frage einbezogen waren, und dass es sich beim herauskristallisierenden Namibia-Konflikt um ein ‚weltpolitisches Szenario’ handelte. Hierbei sollen insbesondere auf die verschiedenen Konfliktlösungsinitiativen der am Konflikt Beteiligten eingegangen werden. Im Vordergrund dieser beiden ersten Abschnitte soll somit eher die internationale Dimension des Namibia-Konflikts vermittelt werden.
Der dritte Abschnitt dieses Kapitels bezieht sich auf die Transition vom autoritären zum demokratischen System in Namibia. Hierbei wird veranschaulicht, dass Namibia keinen idealtypischen Transitionsverlauf[28] vollzog, sondern aufgrund einer Fülle von Verflechtungszusammenhänge und historischen Besonderheiten, Beispiel eines eher untypischen Verlaufs ist. Namibia erfuhr vielmehr eine Transition und Demokratisierung von außen, wobei sich der Begriff der ‚ausgehandelten politischen Transition’ hervorragend verwenden lässt. Des weiteren wird verdeutlicht, dass die ‚Befreiungsbewegung an der Macht’[29], die SWAPO, von vornherein seitens der Öffentlichkeit als der einzige Dekolonisationsagent[30] wahrgenommen wurde. Das Kapitel wird mit einem kritischen Beitrag zur demokratischen Entwicklung im heutigen Namibia abgeschlossen.
Im fünften Kapitel dieser Arbeit soll das Konzeptes der ‚strategischen Gruppen’ auf den Einzelfall Namibia angewandt werden. Die Entstehung von strategischen Gruppen fällt wie auch im Falle des südwestafrikanischen Staates Namibia mit einer Periode des grundlegenden Wandels und Umbruchs des gesellschaftlichen Systems[31] zusammen. Dieser grundlegende Wandel erfolgte in Namibia mit der Phase des Übergangs vom kolonialen zum postkolonialen Staat. Für den Kontext dieser Arbeit ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Analyse des Handelns ‚strategischer Gruppen’ in Namibia nur unter Berücksichtigung der kolonialen Vergangenheit sowie der derzeitigen postkolonialen Entwicklung erfolgen kann. Hervorstechend ist hierbei die dominante Rolle der SWAPO, besser ihrer politischen Elite.
Ich möchte beim Einzelfall Namibia von einer ‚strategischen Allianz’ sprechen, die eine Gruppenfiguration darstellt, die unter der Hegemonie der politischen Elite steht. Die Herausbildung und das Wachsen dieser ‚strategischen Allianz’ stehen im Zentrum der Überlegungen in den ersten beiden Abschnitten des fünften Kapitels.
Ausgangspunkt der ‚strategischen Allianz’ ist die Analyse der strategischen Gruppe der politischen Elite, die sich aus der politischen Partei der SWAPO bildet. Diese politische Elite verstand es schnell, das politische System nach Gutdünken zu bestimmen und gemeinsame Interessen zu verfolgen, die darauf gerichtet waren, die errungenen Machtpositionen abzusichern und damit verbundene Aneignungsstrategien und -möglichkeiten aufrechtzuerhalten bzw. zu erweitern. Da Veränderungen im politischen System auch zwangsläufige Auswirkungen auf die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme haben, musste sich die politische Elite mit strategischen Gruppen dieser Teilsysteme auseinandersetzen.
Daher soll im dritten Abschnitt des fünften Kapitels auf weitere strategische Gruppen anderer gesellschaftlicher Teilsysteme eingegangen werden. Hierbei soll einerseits aufgezeigt werden, welche Koalitionen, Bündnisse und Zweckbeziehungen die einzelnen strategischen Gruppen eingehen, und anderseits verdeutlicht werden, welche Rivalitäten, Spannungen und Kämpfe zwischen solchen Gruppen bestehen bzw. ausgetragen werden, um sich sowohl gesellschaftliches Mehrprodukt (Surplus) als auch materielle und nicht-materielle ‚strategische Ressourcen’ anzueignen. Im Einzelnen beziehe ich mich hierbei auf die Gruppen der Staatsbeamten, führende Militärs, wirtschaftliche Unternehmer, Professionals, traditionelle Autoritäten und religiöse Spezialisten in Namibia.
Der vierte Abschnitt des fünften Kapitels befasst sich mit Handlungsmustern strategischer Gruppen, wobei darauf verwiesen wird, dass diese sich in erster Linie auf die Gruppe der politischen Elite beziehen. Auch für andere strategische Gruppen können die Handlungsmuster der ‚politisierten Ethnizität’, des Neopatrimonialismus, Nepotismus, Klientelismus, Korruption und der Patronage, zur Sicherung der Revenuen und Ressourcen existieren. Hierbei soll jedoch der Schwerpunkt der Analyse von Handlungsmustern, aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit und der teilweisen Nicht-Behandlung dieses Aspekts in der wissenschaftlichen Lektüre, auf der politischen Elite liegen.
Im abschließenden Fazit werden die angesprochenen Fakten nochmals verdeutlicht und Ausblicke zur postkolonialen Entwicklung im Hinblick auf die Existenz bestehender strategischer Gruppen geliefert werden. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle einen Ausblick vornehmen, wie man die Rolle von strategischen Gruppen in Demokratien bewerten könne.
Eine Analyse strategischer Gruppen in Namibia wurde in einem solchen Umfang bisher noch nicht vorgenommen. Gerade jedoch weil es sich beim strategischen Gruppen-Konzept um einen „prinzipiell dynamischen Ansatz“ (Berner 2001:125) handelt, kann man ihn in Bezug auf die Transformationsprozesse des südwestafrikanischen Staates anwenden.
Die Daten, Fakten und Statistiken, auf die ich im Rahmen der Arbeit zurückgreife, entnahm ich der derzeit zur Verfügung stehenden und zugänglichen wissenschaftlichen Literatur. Hierbei möchte ich ausdrücklich hervorheben, dass das Ziel der Arbeit darin besteht, die theoretischen Grundlagen des strategischen Gruppen-Konzepts mitsamt seinen Kritiken und Erweiterungen, mit der gegenwärtigen postkolonialen Entwicklung Namibias in Einklang zu bringen.
Ich möchte ferner anmerken, dass man die Analyse strategischer Gruppen sicherlich auch auf andere Art und Weise hätte vornehmen können, und dabei auch andere strategische Gruppen als Untersuchungsgegenstand in die Analyse einfließen hätte lassen können. Ich versuche jedoch gerade aufgrund der besonderen historischen Gegebenheiten Namibias und des Übergangs vom kolonialen Staatsgebilde zum postkolonialen Staat die Herausbildung strategischer Gruppen zu beschreiben. Deshalb möchte ich der strategischen Gruppe der politischen Elite eine besondere Rolle im Prozess der postkolonialen Entwicklung zuschreiben, da sie in der Phase des Wandels sowohl eine ‚Superstruktur’[32] errichtete als auch zu dem bestimmenden strategischen Akteur im Staat wurde[33].
2. Konzeptuelle Rahmung des Forschungsgegenstands
2.1 Demokratietheoretische Überlegungen in Bezug auf die Transformationsforschung
2.1.1 Frühere Ansätze: Modernisierungs- und Dependenztheorien
Vergewissert man sich die Geschichte soziologischer Theorien, insbesondere die der Entwicklungssoziologie, stellt man fest, dass im soziologischen Diskurs für lange Zeit ein Dualismus zwischen Modernisierungstheorie[34] und Dependenztheorie vorherrschte.
Modernisierungstheorien sind durchweg auf das Paradigma ‚westlicher entwickelter Gesellschaften’ fixiert[35]. Es wurde als eine Art Grundmodell der Modernisierung verstanden, um es als Konzept einer ‚nachholenden’ Entwicklung in andere Gesellschaften zu übertragen. Der Makel dieses ‚westlichen Entwicklungsmodells’ liegt vor allem darin, dass hierbei nicht die unterschiedlichen historischen Einzelverläufe westlicher Staaten analysiert wurden, sondern diese zu dem einen, dem Paradigma ‚westlicher Entwicklung’ zusammengefasst wurden.
Dieser uniliniare Verlauf steht den historischen Einzelverläufen der Entwicklung westlicher Nationalstaaten widersprüchlich entgegen. Dem homogenisierten Modell westlicher Entwicklung wurde seitens der westlichen Industrieländer, aber auch deren Öffentlichkeit und einem großen Teil der wissenschaftlichen Elite, eine Art Vorbildfunktion bzw. Vorreiterrolle beigemessen, die als Handlungsanleitung für unterentwickelte Gesellschaften dienen sollte. Durch die weitgehenden Adaptionen ‚westlicher’ Modellkonzepte für praktisches Transformationshandeln wurden universalistische Kriterien als allgemein gültig gesetzt, die die historischen und kulturellen Eigenwege der betroffenen Gesellschaften meist vernachlässigten.
Dieter Goetze schreibt, dass allen modernisierungstheoretischen Überlegungen eine genealogische Abfolge von Theoriebausteinen gemeinsam ist, die aus vier Kernelementen besteht[36]. Im Einzelnen sind dies a) eine kritische Rezeption funktionalistischer Postulate aus dem ethnologisch/sozialanthropologischen Diskussionshorizont; b) die Übernahme des Durkheim’schen Interesses an einem doppelt gefassten Problem der normativen Interpretation von Gesellschaft(en) und den Bedingungen der Stabilität ihrer sozialen Ordnung als einen spezifischen Erkenntnisgegenstand; c) die Zugrundelegung einer handlungstheoretischen Perspektive als Bezugsrahmen, aus dem spezifische Subsysteme entsprechender funktionaler Zuordnung abzuleiten sind (hierbei auch die besondere Bedeutung der Entfaltung (gesellschafts-)interner Faktoren) und d) die Behauptung eines spezifischen Verhältnisses dieser Faktoren zu (äußeren) (Rand-)Bedingungen.
Die Modernisierungstheorie konzentriert sich auf strukturelle Voraussetzungen für demokratische Systeme mit dem Ergebnis, dass ein bestimmtes Niveau der ökonomischen und sozialen Entwicklung notwendige Bedingung für die Herausbildung von demokratischen Strukturen ist. Entwicklung wurde in modernisierungstheoretischer Sichtweise „weitgehend als Resultat endogener Verursachungen und als Realisierung gesellschaftsimmanenter Potentiale bestimmt“ (Goetze 2002:24).
‚Demokratie’ entwickelt sich infolge ökonomischer und sozialer Entwicklung, wobei die Modernisierungstheorie von einer signifikanten Korrelation zwischen ökonomischem Entwicklungsstand und Demokratisierung ausgeht. Besonders die Mittelschicht spielt bei modernisierungstheoretischen Annahmen eine große Rolle. So spricht etwa ein gehobenes Bildungsniveau für große ökonomische Ressourcen, was zur sozioökonomischen Verbesserung führt und die Chancen zur Entwicklung und Konsolidierung der Demokratisierung des Staates erhöht. Ein wesentlicher Indikator zur Verbreitung von Demokratie in Modernisierungstheorien liegt im Verhalten der Eliten in Machtpositionen, um demokratische Prozesse durchzuführen und zu etablieren.
Als Kritikpunkte gegen Modernisierungstheorien führt Goetze fünf Einwände an[37]. Der erste richtet sich dagegen, dass die aufgeführten Faktoren ein Ausdruck der Präferenzen der Autoren seien und somit ethnozentrisch und deterministisch bestimmt sind. Zweitens können empirisch-praktische Abläufe wie Modernisierung mit Konzepten der Differenzierung, Anpassung, Integration, etc. nicht erklärt werden. Der dritte Einwand übt Kritik an der häufig mangelhaften Unterscheidung von Elementen der Definition und Elementen, die als (kausale) Faktoren in den Erklärungen der Autoren angeführt werden. Viertens werden vorangehende Ursachen zugunsten teleologisch begründeter ‚Zwänge’ zur ‚Adaption’ bzw. ‚Anpassung’ vernachlässigt. Der fünfte Einwand kritisiert jene Funktionalisten, die sich mehr für die Auflösungsprobleme ‚traditioneller’ Gesellschaft interessieren, als für die neuen und variierenden Richtungen, die solche Gesellschaften einschlagen können.
Im Gegensatz zu den Modernisierungstheorien spiegeln Dependenztheorien eine Bezeichnung für eine Vielzahl von Theorien wider, die die Unterentwicklung der Länder der so genannten ‚Dritten Welt’ durch deren einseitige Abhängigkeit von den kapitalistischen Zentren erklären wollen. Vertreter der Dependenzthese sehen im Gegensatz zu jenen der Modernisierungstheorien die Ursache für die Unterentwicklung also nicht in den unterentwickelten Ländern selbst (Peripherie), sondern in deren Verstrickung in ein Netz von Abhängigkeitsverhältnissen zu den entwickelten Industriestaaten[38].
In diesen Zentrums-Peripherie-Modellen gelten die ungleichen Handelsbeziehungen als hauptsächliche Ursache für fehlende wirtschaftliche Entwicklung und Armut in der sog. ‚Dritten Welt’. Die nachkoloniale Einbindung der ehemaligen Kolonien in den Weltmarkt als bloße Exporteure von Rohstoffen verhindere die Entstehung einer diversifizierten Wirtschaft, und die Exporterlöse dienten in erster Linie dem Import von Konsumgütern für die einheimischen Eliten. Dependenztheoretiker begreifen ‚Unterentwicklung’ als einen historischen Prozess und nicht als intrinistische Eigenschaft der ‚Dritten Welt’[39].
Dieter Goetze führt hierbei an, dass dieser Gedanke später von Weltsystem-Theoretikern aufgenommen wurde, die die ‚Unterentwicklung’ als Funktionsfolge des Weltsystems in kapitalistische Kernareale und Peripherien aufteilten[40]. Multi- bzw. transnationalen Konzernen wurde eine besondere Rolle beigemessen, denn sie griffen in die nationalen und ökonomischen Abläufe von dependenten Gesellschaften ein. In dependenztheoretischer Herangehensweise galt die Unterentwicklung als exogen verursacht, was externe Verflechtungen und Kausalzusammenhänge von Unterentwicklung zu ihrem ausschließlichen Erklärungsmoment machen ließ.
2.1.2 Gegenwärtigen Ansätze in der Entwicklungssoziologie und der Transformationsforschung
In den gegenwärtigen Untersuchungen der Entwicklungssoziologie und der Transformationsforschung herrscht eine Dominanz akteurtheoretischer Konzepte vor, um einerseits Transformationsverläufe, als auch andererseits Entwicklungsprozess zu beschreiben[41]. Bei diesen Konzepten wird der Fokus der Analysen vorrangig auf zwei Aspekte gerichtet, zum einen die Benennung und zum anderen die gleichzeitige Analyse der daran beteiligten Akteure. Untersucht werden hierbei insbesondere die Intentionen, Perzeptionen, Abhängigkeiten sowie Handlungs- und Planungskorridore der Akteure. Dadurch werden Ergebnisse zu deren Handlungsmöglichkeiten von Akteuren in Transformationsprozessen gewonnen. Die heutige Diskussion in beiden soziologischen Theoriesträngen steht zudem in einem engen Zusammenhang in Bezug auf das Demokratiekriterium. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass es nicht die (universalistische) Demokratietheorie gibt, sondern ein Nebeneinander verschiedener Demokratietheorien unterschiedlicher Qualität.
Manfred G. Schmidt unterscheidet hierbei vier Familien der Demokratietheorien: a) die prozessorientierte Richtung, b) den institutionen- und formenzentrierten Ansatz, c) die input- und outputorientierte Demokratietheorie und d) die transitions- und funktionszentrierte Theorie[42].
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der letzte Ansatz, denn ihm liegen akteurtheoretische Konzeptionen zugrunde. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die Struktur und die Dynamik der Übergänge von einem autoritären zu einem demokratischen System. Signifikant für transitions- und funktionszentrierte Theorieansätze ist ihre Ausrichtung entlang der Demokratiedefinition Robert Dahls. Schmidt schreibt, dass sich mit Dahl nicht nur der Übergang von einem Systemtypus zu einem anderen ausloten lässt, sondern auch die der ‚blockierten Transitionen’[43].
Für Dahl ist die Demokratie ein Idealtypus, der dazu dient festzustellen, wie nahe sich ein System diesem Idealtypus nähert. Unter Polyarchien können Systeme verstanden werden, die dem Idealtypus am nächsten sind. Dahl geht bei seiner Analyse von acht Demokratiegarantien aus[44]. Er betont, dass die Institutionen der Polyarchie[45] notwendig, aber nicht hinreichend für einen demokratischen Prozess sind. Dahls Polyarchiedefinition bezieht sich auf eine Minimaldefinition von Demokratie, die die Entfaltungschancen des Individuums betont, materielle Grundbedürfnisse einbezieht und als politische Richtschnur auch in jenen Gesellschaften Gültigkeit beansprucht, die nicht unbedingt an eigene Traditionen oder demokratische Vorläufer anschließen können[46].
Die von Dahl angesprochenen Institutionen schaffen ein symbolisches Netzwerk, das die kognitiven Mittel für die Interpretation von Politik bereitstellt. Inwieweit diese Institutionen als Mechanismus der Machtverteilung fungieren, hängt maßgeblich von der Fähigkeit der Gesellschaft ab, dieses symbolische Netzwerk zur Konzeptualisierung des Gebrauchs von Macht anzuwenden.
Ich schließe mich ebenfalls dem Dahl’schen Demokratiebegriff an, sehe ihn jedoch stark in Anlehnung an Bratton und de Walle, die Demokratie definieren als „form of political regime in which citizens choose, in competitive elections, the occupants of the top political offices of the state. According to this definition, a transition to democracy occurs with the installation of a government chosen on the basis of ine competitive election, as long as that election is freely and fairly conducted within a matrix of civil liberties, and that all the contestants accept the validity of the election results” (Bratton/Walle 1997:12f.).
Kann man bei der Bewertung von Systemen außerhalb der westlichen Hemisphäre, hier des südlichen Afrikas, überhaupt ein westlich geprägtes Demokratiepostulat zugrunde legen, wenn sich dort existierende, vorherige Merkmale nicht vorrangig auf demokratische Strukturen beziehen? Wird nicht allzu oft die weltweite Verbreitung von Demokratie als ein ‚Siegeszug des Westens’ als ‚end of history’[47] gewertet? Sind die heutigen Merkmale der westlich-liberalen Demokratie nicht zu ureigen ihrem historischen Entstehungskomplex (griechische Antike) und ihrem neueren universalen Charakter der Länder West- und Mitteleuropas sowie Nordamerikas, in denen sich die Demokratie im Zuge der Durchsetzung des kapitalistischen Wirtschaftssystems etablierte?
Die beschriebenen Demokratieannahmen implizieren, dass es sich um die Durchsetzung einer Demokratisierung im westlichen Verständnis handelt, die mit einer steigenden Partizipation, rechtsstaatlichen politischen Garantien und einem gewaltfreiem Austrag von Interessendivergenzen einhergeht. Worin liegen die Vorteile einer demokratischen Gesellschaftsordnung? Warum muss ein Staat überhaupt demokratisch sein? Was ist das Besondere an einer Demokratie? Warum nehmen wir Demokratie als einen Bewertungsmaßstab? Tatsache ist, dass Demokratien bis zum heutigen Tage gegeneinander noch nie Krieg geführt haben, was aber nicht ausschließt, dass Demokratien anderen Systemen den Krieg erklärt haben. Man geht in der sozialwissenschaftlichen Diskussion stark von einem ‚magischen Dreieck’ der Entwicklung, der Demokratie und des Friedens aus[48]. Das globale Wiederaufleben der Demokratie Anfang der 90er Jahre war nirgends stärker als in Afrika, wobei der Westen fest daran glaubte, dass Demokratie überall auf der Welt möglich sei, auch in Afrika, und dass dies die westliche Hegemonie vollenden würde[49].
Ich möchte hierbei die Demokratie weder ‚schön’ noch ‚kaputt’ reden, sie ist und bleibt schlicht und einfach eine suboptimale Lösung, die in der Summe für keinen Teilnehmer einen optimalen Zielerreichungsgrad darstellt, die aber alle Teilnehmer der Gesellschaft, so weit fundamentale demokratische Prinzipien eingehalten werden, davor schützt, das Recht auf Selbstbestimmung zu verlieren und sich autoritären Instanzen gegenüberzusehen. Daraus soll nicht geschlussfolgert werden, dass ich der Ansicht bin, das Demokratiepostulat weltweit zu proklamieren. Nein, ganz im Gegenteil, es gibt auf dem afrikanischen Kontinent andere Gemeinschafts- und Gesellschaftssysteme, die historisch, kulturell, sozial und politisch schwer mit einem (westlichen) demokratischen Verständnis zu vereinen sind. Das ist auch nicht zum Nachteil zu verstehen, denn es bestehen Traditionen, Sitten, Bräuche und Riten, die nach anderen Wert- und Identitätsmustern ausgerichtet sind als nach demokratischen Prinzipien.
Ich bin gegen die ‚Einpflanzung’ der Demokratie als Gesellschaftssystem in anderen Staaten, um erst dann mit ihnen (ökonomische) Verbindungen einzugehen bzw. sie als ‚Partner des Friedens’ zu bezeichnen.
Hierbei muss noch ein anderer Aspekt berücksichtigt werden. Die Staatenwelt Afrikas wurde mit dem Lineal gezogen, kein einziger heutiger afrikanischer Staat bestand in seiner jetzigen Form in präkolonialer Geschichte. Die Kolonialmächte gründeten die Kolonien ohne Rücksicht auf ethnische Strukturen und territoriale Gegebenheiten, was ein Indiz für die fragmentierten, heterogenen ethnischen Gebilde der meisten heutigen afrikanischen Staaten ist. Diese heterogenen Staatengebilde, die sich aus verschiedenen ethnischen Gruppen zusammensetzen, besaßen in präkolonialer Zeit andere Interaktionsmechanismen und Handelsbeziehungen zueinander, die durch die Etablierung der Kolonialstaaten zerstört wurden. Hierbei möchte ich den Begriff ‚Ethnizität’ in Bezug auf den Glauben an Gemeinsamkeit, Überzeugung gemeinsamer Geschichte, Wertschätzung und Praktizierung gemeinsamer Bräuche und Werte, Respekt und Aufrechterhaltung gemeinsamer sozialer Grenzmarkierungen verstanden wissen[50]. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass traditionelle Gebilde keine demokratischen Prinzipien adaptieren könnten bzw. dass diese künstlichen Staatengebilde nicht in der Lage sind sich zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung hinzubewegen[51].
Für wichtig halte ich es, dass sich die Demokratie zu allererst in einer Gesellschaft selbst entwickeln muss, sie muss seitens des Staatsvolkes zur legitimierten Gesellschaftsordnung werden. Demokratie, und wird dieser schillernde Begriff noch so weit differenziert, bedeutet noch immer, wenn auch nicht wörtlich, die Herrschaft des Volkes durch das Volk. Sie dient als Bezeichnung für eine Vielzahl von politischen Ordnungen, in denen sich die Herrschaft auf den Willen des Volkes beruft und dem Volk rechenschaftspflichtig ist. Noch in der griechischen Antike bedeutete der Begriff Demokratie die unmittelbare Teilnahme des Volkes an der Politik des jeweiligen Stadtstaates (polis)[52] und stand im Gegensatz zu den Herrschaftsformen der Oligarchie, Monarchie und Aristokratie.
Die moderne Demokratie, und werden ihr noch so negative Kognitionen angehaftet, erfüllt zwei Grundprinzipien, die notwendige Bedingungen für eine demokratische Ordnung darstellen und als Abgrenzungsvariablen zu allen anderen Systemen gelten. Zum einen das Prinzip der Gleichheit des Staatsvolkes und das damit verbundene Prinzip der Beteiligung des gesamten Volkes, zumindest seines erwachsenen, wahlberechtigten Teiles, am politischen Prozess, das als Träger der Volkssouveränität Inhaber der Staatsgewalt ist.
Die Fragen, warum man sich auf Demokratie zubewegen sollte, warum man an demokratischen Verfahren festhalten soll, warum man überhaupt ein demokratisches System errichten soll, werfen tief greifende Fragenkomplexe auf. Neben der Form der Demokratie (plebiszitär, westlich-liberal, substanziell, partizipativ, pluralistisch, etc.) spielen hierbei insbesondere die ‚Transplantationsprobleme’ der Demokratie eine große Rolle[53]. Demokratie ist und bleibt ein vieldeutiger Begriff, der viel Raum für Interpretationen lässt.
Daher schließe ich mich der Annahme von Gunter Schubert und Rainer Tetzlaff an, bei der Untersuchung „kulturübergreifende(r) Vergleichsfälle einen Demokratiebegriff zu definieren, der sich von autoritären Herrschaftsformen hinreichend klar unterscheidet, ohne jedoch durch eine zu starke Orientierung auf seinen europäischen (christlich-jüdisch-abendländlichen) Nährboden außereuropäische Spielarten demokratischer Herrschaft a priori auszuschließen“ (Schubert/Tetzlaff 1998:13). Man sollte demnach keinen unhistorischen und anspruchsvollen Demokratiebegriff für die Beurteilung der demokratischen Entwicklung in Afrika zugrunde legen.
Hierbei lässt sich auf Gero Erdmann verweisen, der die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in Afrika für problematisch genug für eine Etablierung einer liberalen Demokratie hält[54]. Erdmann zufolge ist die Beurteilung der demokratischen Entwicklung abhängig vom zugrunde gelegten Demokratiekonzept, wozu es keine einheitlichen Kategorien gibt[55]. Die traditionellen politischen Systeme Afrikas lassen sich nicht mit den westlichen Konzepten von Zivilgesellschaft, Staat, Rechtsverständnis oder Gemeinwesen verstehen und interpretieren. Hierbei müsste eine Umgebung geschaffen werden, in der auch die Mehrheit der armen Bevölkerung an den Vorzügen der Demokratie teilhaben kann.
2.2 Zur Bedeutung von ‚Demokratie’ im afrikanischen Kontext
2.2.1 Demokratisierungswelle Afrikas: Ein Resultat des endenden Ost-West-Antagonismus
‚Second independence’, ‚third wave of democratization’, ‚virtual miracle’ waren nur einige der Schlagworte in Bezug auf Afrika, mit denen die ‚historische Wende’, die ‚Wiedergeburt der politischen Freiheit’ zu Beginn der 90er Jahre schon nach kurzer Zeit gewürdigt wurde[56]. Daran wurden Hoffnungen und Versprechen an eine bessere, gleichsam neue Zukunft Afrikas geknüpft. Gerade durch die Beendigung des geopolitischen Ost-West-Antagonismus gab es anfangs berechtigte Hoffnungen, dass sich die Demokratie über den von der Kolonialzeit geprägten afrikanischen Kontinent ausweiten könnte. Die Demokratisierungswelle im südlichen Afrika wird in der wissenschaftlichen Literatur häufig als ein Produkt externer Faktoren, als eine ‚Demokratisierung von außen’[57] beschrieben. Oberster Bezugspunkt dieser Annahme ist das Ende des Dualismus zwischen westlich-liberalen und pluralistisch orientierten Demokratiemodellen sowie eines sozialistischen Planwirtschaftssystems unter dem Dogma eines Einparteienstaates. Das Ende des Ost-West-Konflikts, der auch zur politischen Veränderung der Großwetterlage in Osteuropa führte, begünstigte in mehrfacher Hinsicht liberale (und demokratische) Entwicklungen im subsaharischen Afrika[58].
Die Liberalisierungswelle kam somit im südlichen Afrika zeitlich eher als in Osteuropa in Bewegung. Das Ende des Ost-West-Konflikts, der besonders im südlichen Afrika durch Stellvertreterkriege ausgetragen wurde, hatte zudem den Rückzug der Sowjetunion vom afrikanischen Kontinent zur Folge, was für viele ‚pro-sowjetische’ Staaten bzw. Staaten, die von der der SU unterstützt wurden, schwerwiegende Folgen hatte, da sie schlagartig die Unterstützung verloren. Aber auch Staaten, die zuvor weniger direkt abhängig waren, erfuhren gravierende Auswirkungen, die bis zur Instabilität bestehender Strukturen reichten. Die Umbruchbewegungen in Afrika führten zu Prozessen des Staatsverfalls oder gar zum Staatszerfall[59]. Allein auf endogene Krisenphänomene lassen sich die Entwicklungen der politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse in den afrikanischen Staaten nicht zurückführen, hierbei müssen auch exogene Faktoren berücksichtigt werden, welche auch häufig die Ergebnisse von ‚Schneeball- und Diffusionseffekten’[60] waren.
2.2.2 Ein neuerlicher ‚Afro-Pessimismus’: Demokratisierung der Machtlosigkei
In letzter Zeit dominierten eher negative Aussagen zur demokratischen Entwicklung im südlichen Afrika, die eine Renaissance des ‚Afro-Pessimismus’[61] hervorbrachten. So spricht John Sauls im Hinblick auf Namibia von einer ‚Befreiung ohne Demokratie’[62]. Für den Namibia-Experten Henning Melber ergibt sich ein ähnliches Bild, da das anfängliche demokratische Grundverständnis immer mehr in eine Begünstigungspolitik herrschender Eliten umschlägt[63] Für Rainer Tetzlaff spannt sich der Bogen der Bewertung der Demokratieentwicklung in Afrika von Staaten, die eine demokratische Konsolidierung aufweisen können, bis hin zu Staaten, in denen es zum Staatszerfall kommt[64]. Trutz von Trotha stellt fest, dass „Afrika zu einem Experimentierraum unterschiedlichster Formen von politischer Herrschaft geworden (ist), sie reichen von der Demokratisierung über das Festhalten an nachkolonialen ‚Beuteregimen’ bis zum Staatszerfall“ (Trotha 2001:35). Sollen wir somit im afrikanischen Kontext von ‚Mini-Demokratien’ bzw. ‚low intensity democracies’[65] in Bezug auf die Analyse der Demokratieentwicklung in Afrika ausgehen?
In seinem Aufsatz über die ‚Demokratisierung der Machtlosigkeit in Afrika’[66] schreibt Claude Aké, dass für Afrikaner Demokratie die ‚Legitimierung ihrer fortbestehenden Machtlosigkeit’ bedeutet. Aké führt an, dass die afrikanische Krise im Kern keine wirtschaftliche, sondern eine politische Krise ist. Zentral rückt für die Beschreibung politischer und sozialer Entwicklungen afrikanischer Gesellschaften der Begriff der Elite in den Mittelpunkt. Die Eliten an der Macht sehen ihr primäres Ziel darin, ihr eigenes ‚Überleben’ zu sichern, was mit der Besetzung wichtiger gesellschaftlicher Positionen einhergeht, um von dort aus Appropriationsstrategien zu verfolgen.
Da der afrikanische Staat durch die Kolonialpolitik privatisiert wurde, war er nach der Unabhängigkeit einer der wichtigsten Machtfaktoren. Er nahm dabei keinen öffentlichen Charakter an, garantierte nur beschränkt (wenn überhaupt) Rechtsstaatlichkeit, und blieb eine Bedrohung für alle, außer für das Oligopol, das ihn kontrollierte. Mit Beginn der Unabhängigkeit fiel der neuen Elite der von der Kolonialmacht geschaffene Verwaltungs- und Sicherheitsapparat in die Hände. Gewählte Politiker, meist die der ‚Befreiungsbewegungen an der Macht’ besetzten sodann den Staatsapparat, wodurch sie eine große Machtfülle ohne wirksame Gegenkräfte und Kontrollen gewannen. Sowohl herrschende strategische Elitefraktionen als auch aufstrebende Gruppen streben es somit an, den Staat als Akkumulationsinstanz zu nutzen. Dies geschieht einerseits durch die Vereinnahmung von gutgläubigen Entwicklungshilfeleistungen der Geberländer und der Abschöpfung staatlicher Gewinne, und andererseits eben durch die Besetzung wichtiger Positionen und Ämter durch ihnen loyale Personen, die zur Heranziehung der Revenuen nötig sind.
Kößler und Schiel[67] kritisieren gleichermaßen, dass der Staat eben nicht im öffentlichen Interesse handelt, sondern von den Amtsinhabern als ‚Wirtschaftsgut’ zur persönlichen Bereicherung genutzt wird. „Politik, Verwaltung, Regierung sind hier keine ‚öffentliche Angelegenheit’ keine res publica, sondern res privata, welche von strategischen Gruppen besetzt werden“ (Kößler/Schiel 1997:17).
Ein prinzipielles Problem besteht darin, dass die herrschende Elite in Schwarzafrika häufig Demokratie verlangt, aber gleichzeitig nicht daran interessiert zu sein scheint, den autokratisch strukturierten Staat zu transformieren[68]. Zu dem ist der Widerhall des kolonialen Erbes in den Staaten des subsaharischen Afrikas überwältigend, denn hier war die Macht auf allen Ebenen konzentriert und verschränkt, so dass der Dorfhäuptling etwa die Kolonialregierung an der Basis vertrat. Form und Inhalt des Kolonialstaates sind beibehalten worden und werden durch den Einparteienstaat reproduziert; eine solche Staatsform kann jedoch nur schwer in eine demokratische Form umgewandelt werden, weil sie strukturell das Gegenteil von Demokratie bedeutet.
Hierbei zeigt sich das Dilemma afrikanischer Demokratie. Eine demokratische Gesellschaftsordnung muss zuvorderst von den Gesellschaftsmitgliedern getragen werden. Die Demokratie muss sich von innen (in der Gesellschaft) entwickeln, und darf nicht als ‚bloßes Implantat’ von außen, einem Staat, der keinerlei Bezüge zur westlichen Demokratie (seine weiße Minderheit ausgeschlossen) besaß, ‚übergestülpt’ werden. Es handelt sich bei der pluralistisch-parlamentarischen Demokratie um ein „spezifisches Endprodukt der okzidentalen Sozial- und Geistesgeschichte[69], der Aufklärung und der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und kapitalistischen Marktwirtschaft[70] “ (Nuscheler 1994:228).
Eine grundlegende These im Hinblick auf den zu analysierenden Einzelfall soll vorangestellt werden. Der Preis den das namibische Volk für die erreichte Unabhängigkeit zahlen musste, war die Annahme der Demokratie. Die SWAPO war den Vereinten Nationen positiv gesonnen und verfügte über außerordentlich gute informelle Kontakte, so dass sie sich bei einem Bekenntnis zur Demokratie der moralischen Unterstützung der internationalen Gemeinschaf, auch der westlichen Länder sicher sein konnte[71]. Treffend formuliert Heribert Weiland hierbei, dass sich das Bekenntnis zur Demokratie für die SWAPO als Eintrittskarte zur Macht erwies[72]. ‚Demokratie’ und demokratische Prinzipien wurden nicht prinzipiell von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit und ihres ‚authentischen Vertreters’[73], der SWAPO gewollt[74]. Demokratie stützt sich auch nicht auf endogene (historische, kulturelle und soziale) Faktoren. Die Demokratie wurde vielmehr von außen konzipiert und als gesellschaftliche Norm ‚einzupflanzen’ versucht. Demokratie wurde auch von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit Namibias stark in Verbindung mit Freiheit gedacht, jedoch nicht simultan, sondern zeitlich nach hinten versetzt: zuerst Befreiung und dann Demokratie. Das alleinige Ziel des bewaffneten Kampfes war die Unabhängigkeit.
An dieser Stelle lässt sich Sandra Düsing zitieren: „Dabei war es zunächst keineswegs das Ziel des politischen Kampfes gegen die südafrikanische Okkupation gewesen, eine Demokratie zu schaffen (...) Der SWAPO ging es vornehmlich um Ziele der Selbstbestimmung und nationalen Unabhängigkeit und erst nachrangig, wenn überhaupt, um die Durchsetzung demokratischer Werte und Institutionen“ (Düsing 2001:154)[75]. Auf der Agenda der Namibia-Frage stand in erster Linie die politische Unabhängigkeit, wo hingegen der tatsächliche Charakter des gesellschaftlichen Systems eher zweitrangig bzw. deren Ergebnis war[76].
Die Machtstruktur eines solchen Staates erschwert demokratische Prozesse, denn sie macht Politik zu Nullsummenspielen und schafft im politischen Bereich große Kluften zwischen Beteiligung (Oligopol; strategische Gruppen) und Ausgeschlossenheit (überwiegende Bevölkerungsmehrheit).
Reinhart Kößler fasst die Demokratiebewegungen in Afrika nicht als ‚Bummelzug zur Demokratie’ auf, sondern versteht sie als ein ‚Spektrum recht unterschiedlicher Verlaufsformen’[77].
Siegmar Schmidt verdeutlicht die Schwierigkeiten einer Demokratieentwicklung im südlichen Afrika auch unter einem anderen Gesichtspunkt, indem er die Frage nach demokratischen Elementen in traditionellen afrikanischen Gesellschaften aufgreift[78]. Schmidt schreibt, dass sich afrikanische Traditionen stärker auf personalisierte Herrschaften berufen, die der Etablierung demokratischer Systeme entgegenstehen. „Afrikaner identifizieren sich generell bis heute leichter mit Persönlichkeiten als mit abstrakten Zielen und Vorstellungen von Parteien“ (Schmidt 1994:237).
Für Dieter Neubert gehört die Auseinandersetzung um Demokratisierung zu den zentralen Prozessen der gesellschaftlichen Selbstorganisation in Afrika, wobei die Ergebnisse dieser Auseinandersetzungen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung haben[79].
2.3 Verschiedene Ansätze der Transformationsforschung
2.3.1 Nie endender Antagonismus? Die zwei Soziologien: Systemtheorie vs. Akteurtheorie
Welchen Weg soll man bei der Untersuchung von Transformationsprozessen einschlagen? Wie lassen sich die Begriffe ‚Struktur’, ‚Akteur’, System’ und ‚Handlung’ in Bezug auf Transitionsprozesse miteinander in Einklang bringen, besteht ein ‚Königsweg in der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung’[80] ?
Uwe Schimank pflichtet Alan Dawe bei, der die Geschichte soziologischer Theoriebildung als ein immer wieder neues Aufeinanderprallen von zwei fundamental entgegengesetzten Sichtweisen gesellschaftlicher Wirklichkeit betrachtet[81]. Bei diesen zwei konfligierenden Soziologien handelt es sich namentlich um die System- und die Akteurtheorie. Ausgangspunkt beider Paradigmen ist auch hierbei, dass die Soziologie eine fortlaufende wechselseitige Konstitution von sozialem Handeln und sozialen Strukturen zum Gegenstand hat. Sämtliche soziale Strukturen sind somit das Produkt sozialen Handelns, nämlich des handelnden Zusammenwirkens Mehrerer; und soziales Handeln wird nicht ausdrücklich, aber doch wesentlich durch soziale Strukturen geprägt[82]. Die Soziologie, wie Uwe Schimank schreibt, „abstrahiert von den nicht-sozialen Handlungsdeterminanten und konzentriert sich ganz auf das Wechselverhältnis von sozialem Handeln und Strukturen“ (Schimank 2000:14).
Die Soziologie als Wissenschaft von der Sozialität hat zwei zentrale Fragen zu beantworten: (1) Warum handeln Handelnde in einer bestimmten Situation so und nicht anders? (2) Welche strukturellen Wirkungen hat ein bestimmtes Handeln im Zusammenwirken mit anderem Handeln?[83] Damit muss sich die Soziologie mit zwei Arten von Erklärungsproblemen auseinandersetzen, zum einen mit der Erklärung von Handlungswahlen und zum anderen mit der Erklärung von strukturellen Effekten des handelnden Zusammenwirkens, insbesondere der Schaffung, Erhaltung und Veränderung sozialer Strukturen[84].
Bevor mit einem Rekurs auf systemtheoretische und akteurtheoretische Konzeptionen begonnen werden soll, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich mich im Rahmen dieser Arbeit bei der Verwendung der Begrifflichkeiten ‚Struktur’[85] und ‚Handeln’ auf die Definitionen von Anthony Giddens stützen möchte. Der britische Soziologe benutzt die Begrifflichkeiten ‚Handelnder’ und ‚Akteur’ synonym. Handeln bezieht Giddens „nicht auf die Intentionen, die Menschen beim Tun von Dingen haben, sondern auf ihre Vermögen, solche Dinge überhaupt zu tun (…) Handeln betrifft Ereignisse, bei denen ein Individuum Akteur in dem Sinne ist, dass es in jeder Phase einer gegebenen Verhaltenssequenz anders hätte handeln können (…) Handeln ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Strom, in dem die reflexive Steuerung, die ein Individuum vornimmt, fundamental für die Kontrolle des Körpers ist, die Handelnde während ihres Alltaglebens gewöhnlich ausüben“ (Giddens 1989:60). Ferner setzt er voraus, dass sie die Fähigkeit besitzen, zu verstehen, „was sie tun, während sie es tun“ (ebd. S.36).
Giddens geht bei seiner Theorie der Stukturierung davon aus, „dass die Regeln und Ressourcen, die in die Produktion und Reproduktion sozialen Handelns einbezogen sind, gleichzeitig die Mittel der Systemreproduktion darstellen“ (ebd. S.70). Giddens entwickelt ein Handlungsmodell, das darauf abzielt, Handlungsmotive und Intentionen immer als Folge ihrer reflexiven Einbindung in die soziale Wirklichkeit zu verstehen. Notwendig sei es, aufzuklären, dass jeder alltägliche Handlungsvollzug, einerseits durch das Handlungswissen (Möglichkeit der Akteure, auf der Basis individueller und sozialer Erfahrungen ihr Handeln reflexiv zu bestimmen) und anderseits durch die Handlungsfähigkeit (die Macht der Akteure, in die soziale Wirklichkeit einzugreifen und zu verändern) der Akteure, gekennzeichnet ist[86].
2.3.2 Systemtheoretische Überlegen
Die Transformationsforschung der 50er und 60er Jahre war geprägt durch die Dominanz makrosoziologisch funktionalistischer oder strukturalistischer Theoriestränge. Als Vertreter dieser Theorien sind u. a. Talcott Parsons, Seymour Martin Lipset, Barrington Moore und Samuel P. Huntington zu nennen. Sie machten die „Demokratisierung politischer Systeme zeit-, ort- und kulturunabhängig von der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft und universell gültigen Modernisierungsmustern von Wirtschaft und Gesellschaft abhängig“ (Merkel 1994b:390).
Der Kern von Talcott Parsons Argumentation führt auf das Theorem der funktionalen Differenzierung zurück. Für ihn lässt sich die Entwicklung von traditionalen zu modernen Gesellschaften als eine Ausdifferenzierung von Teilsystemen beschreiben. Dies führte in der Folge in westlichen Gesellschaften zur industriellen Revolution, mit der die Differenzierung von Ökonomie und politischer Herrschaft, politischem System und ziviler Gesellschaft einherging. Parsons Erläuterungen unterliegen vier zentralen Funktionssystemen. Wirtschaft (Anpassung), Politik (Zielerreichung), soziale Gemeinschaft (Integration) und Kultur (Erhaltung von Wertmustern) ist gestützt auf die implizite Annahme, dass die Politik den anderen gesellschaftlichen Teilsystemen übergeordnet ist. Parsons zeichnet einen normativ wie geschichtlich festgelegten Weg, der einen universellen Charakter trägt. Nur wenn Gesellschaften bestimmte „evolutionäre Universalien“ ausbilden, können sie langfristig das Niveau ihrer Anpassungskapazität an die Umwelt und damit ihren eigenen Bestand sichern. Diese Universalien richten sich auf Bürokratie, Marktorganisation, Rechtssystem, demokratisches Assoziationsrecht, allgemeine freie Wahlen[87].
Parsons versteht Strukturwandel konsequent als Wandel der normativen Kultur. Damit ein Wandel auf eine höhere Gesellschaftsstufe stattfinden kann, sind demokratische Verfahren unverzichtbar. Sie beinhalten entscheidende Aspekte der Stabilität politischer Systeme. Parsons analysiert die Gesellschaft als soziale Struktur, in der nicht die individuellen Sinnintentionen der einzelnen Menschen entscheidend sind, sondern die verschiedenen verinnerlichten sozialen Rollen der Menschen. Diese sozialen Rollen sind die eigentlichen Handlungseinheiten in einer als soziale Struktur verstandenen Gesellschaft. Ziel der soziologischen Untersuchungen ist es, mittels solcher Handlungstheorien herauszufinden, warum und wie individuelle Motivationen von Menschen und gesellschaftliche Erwartungen zur Übereinstimmung gebracht werden. Die Funktion von sozialen Handlungen für die und der strukturelle Stellenwert dieser Handlungen in der Gesellschaft als Ganzes bilden bei Parsons ein rückbezügliches, sich selbst regulierendes System.
Für die systemtheoretischen Überlegungen Barrington Moores waren im Vergleich zu Parsons nicht ‚evolutionäre Universalien’ für die gesellschaftliche Entwicklung maßgebend, sondern vergangene soziale Konflikte und jeweilige Konfigurationen von Macht- und Klassenverhältnissen entscheiden über die politische Herrschaftsform[88].
Der systemtheoretischen Theorie Parsons schließt sich die ‚autopoietische Systemtheorie’[89] Niklas Luhmanns an. Für ihn vollzieht sich die gesamtgesellschaftliche Modernisierung allein als funktionale Differenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme. Sie erfolgt durch eine elastische Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen durch den Entwurf und die Verwirklichung funktionaler Äquivalente im Rahmen der Teilsystemfunktionen und ihrer Codierungen[90].
Luhmann geht davon aus, dass kein Funktionssystem für ein anderes einspringen kann, auch kein Teilsystem ein anderes ersetzen oder auch nur entlasten könnte. Diese Teilsysteme erwachsen durch die voneinander grundsätzlich verschiedenen basalen Codes. Nach Luhmann besitzt die moderne Gesellschaft weder in Politik, noch in Moral oder Wirtschaft ein Zentrum, von dem aus alle anderen Gesellschaftsbereiche erschlossen werden können. Jedes System arbeitet dabei auf seine spezifische Weise: Das Wirtschaftssystem funktioniert über das Medium Geld, das Rechtssystem über Gesetze, und die Menschen als psychische Systeme funktionieren über Bewusstsein. Im Gegensatz zu Parsons sieht Luhmann in einem sozialen System ein reales System, d. h. die konstituierenden Elemente werden durch das beobachtete soziale System selbst bestimmt. So sind für Luhmann so genannte Kommunikationen, nicht Personen, die letzten unteilbaren Elemente eines sozialen Systems, das er als ein System sinnhafter Kommunikation definiert.
Anders ausgedrückt steht in der Systemtheorie nicht der Mensch (bzw. der Akteur) im Zentrum der Gesellschaft, sondern er gehört zu deren Umwelt. Soziale Systeme beziehen sich für die Systemtheorie nicht nur bei der Konstitution ihrer Elemente, sondern auch ihrer Operationen und Strukturen auf sich selbst und werden deshalb als selbstreferentielle Systeme bezeichnet. Obwohl sie in diesem Sinne ‚operativ geschlossen’ sind, besteht für sie die Notwendigkeit, Kontakt zur Umwelt herzustellen, da die Systemdynamik ohne Umwelt zum Erliegen käme. Bei der Systemtheorie kommt es im Vergleich zur Akteurtheorie vor allem darauf an, dass sich die einzelnen Gesellschaftsmitglieder der „Etablierung und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ordnungsmuster“ fraglos fügen (Schimank 1996:207). Auf die Ausführungen Luhmanns soll im Zusammenhang der Erklärung teilsystemischer Orientierungshorizonte und binärer Codes im achten Abschnitt des dritten Kapitels dieser Arbeit nochmals eingegangen werden um das Handeln von strategischen und konfliktfähigen Gruppen im Einzelfall Namibia zu erläutern.
2.3.3 Akteurtheoretische Überlegungen
In den 80er und 90er Jahren dominierten mikropolitologisch-akteurstheoretische Überlegungen in der Transformationsforschung, wobei insbesondere O’Donnell, Schmitter und Przeworski theoretische Standards setzten[91]. Merkel verzeichnet an dieser Stelle, dass das „makrosoziologische Paradigma, dass Demokratie von sozioökonomischen Requisiten oder klassenspezifischen Machtstrukturen abhängig“ macht, gebrochen wurde (Merkel 1996:31).
Seit den 80er Jahren nahm die Anzahl akteurtheoretischer Ansätze zur Untersuchung von Transformationsprozessen ständig zu. In diesen Ansätzen wird sich auf das Handeln von Individual- und Kollektivakteuren, die Interdependenz von Entscheidungen und Wahlhandlungen konfligierender und kooperativer Akteure, Koalitionsbildungen zwischen Oppositions- und Reformergruppen und Handlungskorridore der Akteure bezogen[92]. Besonders die Umbruchsituationen in Latein- und Südamerika, später Südosteuropa, wurden zur Grundlage von akteurtheoretischen Modellen. Hierbei wird den Forschungsarbeiten von Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter und Terry Karl besonderes Augenmerk beigemessen, die ihre Analysen auf Latein- und Südamerika bezogen und einen ‚strukturalistisch aufgeklärten deskriptiv-typologischen Akteursansatz[93] ’ entwarfen. Nach Erscheinen der transitionstheoretischen Studie von Guillermo O’Donnell und Phillipe Schmitter „Transition from Authoritarian Rule“, „rückte das Handeln von politischen Eliten in den Mittelpunkt theoretischer wie empirischer Transfomationsstudien“ (Merkel 1996:31). Dieser strukturalistisch, aufgeklärte deskriptiv-typologische Akteursansatz wurde, wie es Wolfgang Merkel formuliert, „prägend für die Zukunft der Transformationsforschung“ (ebd. S.31). Hierbei rücken im Gegensatz zu Modernisierungs- und Dependenztheorien systeminterne Herrschaftsstrukturen ins analytische Blickfeld. Es wird versucht, Entwicklung, demnach auch politische Entwicklung im Sinne einer Demokratisierung mit den Machtinteressen spezifischer Akteure bzw. Akteursgruppen zu erklären[94].
Auch Rational-Choice-Ansätze wurden zum Gegenstand akteurtheoretischer Transitionsforschung. Hierbei sind besonders die Forschungsleistungen von Adam Przeworski zu nennen[95]. Bei Rational-Choice-Ansätzen wird den Akteuren von vornherein strategisches Handeln unterstellt, das auf den Prinzipien der rationalen Wahl basiert. Diese Ansätze versuchen mit Hilfe von Rational Choice-Verfahren das Verhalten von Eliten und kollektiven Akteuren in Systemübergängen zu erklären. Przeworskis Versuche zielten auf Grundlage strategischer Konzepte darauf ab, ein abstraktes, zum Teil spieltheoretisches Modell zur Logik von Systemwechseln zu entwickeln[96]. Ein solcher Ansatz begreift die Ergebnisse von politischen Prozessen als Folge der Interaktionen zwischen den strategischen Entscheidungen der beteiligten Akteure, wobei die Wahl und die Strategie zentrale Variablen darstellen.
2.3.4 Zur Kritik an systemtheoretischen und akteurtheoretischen Ansätzen
Zur Erklärung gesellschaftlicher Entwicklung aber auch zur Erklärung von demokratischer Entwicklung genügen weder System- noch Akteuransatz allein. Weder der eine noch der andere Ansatz können die Komplexität der Einteilung, des Verlaufs noch des Ergebnisses einer Demokratisierung allein erklären. System- wie Akteurtheorie haben unterschiedliche Gebiete zum Gegenstand und besitzen somit sowohl Analysestärken als auch –schwächen. Das Ziel kann somit nur lauten, eine Verbindung zwischen beiden Ansätzen zu schaffen. Wolfgang Merkel schlägt hierbei vor, dass eine Verbindung derart logisch wäre, dass ein wechselseitig, anschlussfähiges Verbindungskonzept entsteht, das sich aus einer makrologischen Systemtheorie und einer mikrologischen Akteurtheorie zusammensetzt[97]. Denn in ihrer Summe bilden diese beiden Theoriegebäude sowohl kulturalistische und strukturalistische als auch institutions-theoretische Überlegungen.
Berner kommt zum Schluss, dass sowohl keynesianische und neoklassische Modernisierungsansätze als auch marxistische begründete Dependenz- und Weltsystemtheorien in einer „binären Sichtweise“ befangen seien, und somit die Krise der „großen Theorien“ „nur an der Schnittstelle von Struktur- und Handlungstheorien“ überwunden werden können[98]. Er plädiert dafür, dass die „Diversität, Heterogenität und Dynamik der Entwicklungsländer in Zusammenhang mit historisch entstandenen und sich dynamisch wandelnden Fraktionsbildungen innerhalb der Herrschaftseliten“ (Berner 2001:14), folglich nach den theoretischen Ansätzen des Konzepts der strategischen Gruppen von Evers und Schiel, zu interpretieren seien.
In diesem Sinne gibt Schimank den Dawe’ schen Überlegungen Recht, dass es zu einem angemessenen soziologischen Verständnis „der modernen Gesellschaft nur kommen kann, wenn beide Perspektiven immer wieder aufeinander bezogen werden, um einander wechselseitig die blinden Flecken aufzuweisen“ (Dawe 1970:70 zit. nach Schimank 1996:208). Schimank kommt beim Vergleich beider soziologischer Paradigmen zum Ergebnis, dass die ‚sociology of social action’ gegenüber der ‚sociology of social sysem’ eher eine Unter- und Nebenströmung geblieben ist[99].
Daher versucht er in seinen Ausarbeitungen ein brauchbares Konzept eines soziologischen Akteurs zu erreichen. „Soziologisch brauchbar wird das Konzept eines zielorientierten Akteurs allerdings erst dann, wenn eine darauf basierende Herangehensweise an gesellschaftliche Wirklichkeit von vornherein dem Tatbestand Rechnung trägt, dass Akteure sich beständig mit anderen Akteuren konfrontiert sehen“ (Schimank 1996:210).
Ein akteurzentrierter Ansatz geht im Vergleich zu systemtheoretischen Theorien davon aus, dass Demokratien nicht zwangsläufig aus bestimmten ökonomischen und sozialen Bedingungen entstehen, sondern von den politischen Akteuren im wahrsten Sinne des Wortes hergestellt werden[100]. Hierbei werden strukturelle Faktoren wie die Ökonomie, die Kultur, etc. als Kontext begriffen, in denen die Entscheidungen und Handlungen der Akteure eingebunden sind, die aber das Ergebnis von politischen Prozessen nicht von vornherein festlegen[101].
Der akteurtheoretische Ansatz verzichtet bewusst darauf, Voraussetzungen von Demokratisierungsprozessen zu ermitteln, sondern verfolgt das Ziel die Prozesse der Demokratisierung systematisch zu erfassen und aus der vergleichenden Beobachtung verschiedenster Fälle Aussagen über typische Verlaufsmuster und Probleme abzuleiten.
Eine akteurtheoretische Herangehensweise richtet ihr Interesse auf die Beschreibung der Konstellationseffekte des handelnden Zusammenwirkens mehrerer Akteure. Uwe Schimank verweist ferner darauf, dass sich eine akteurstheoretische Herangehensweise in fünf Merksätzen zusammenfassen lässt. „Akteure handeln erstens nicht immer, aber oftmals so, dass sie bestimmte Ziele, z.B. Interessen, verfolgen. Dafür verfügen die Akteure zweitens über soziale Einflusspotentiale wie Macht, Geld, Wissen, Moral oder Gewalt – also alles, womit sie das Handeln anderer in bestimmte Richtungen zu lenken vermögen. Durch Zielinterferenzen und wechselseitige Beeinflussung geraten Akteure drittens in Konstellationen miteinander. Diese Konstellationen handelnden Zusammenwirkens einer Pluralität von Akteuren schaffen viertens soziale Strukturen, also auch gesellschaftliche Differenzierungsstrukturen. Aber der Konstellationseffekt entspricht fünftens meistens nicht dem, was die involvierten Akteure sich jeweils gewünscht haben, sondern ist transintentional“ (Schimank 1996:211).
2.4 Weiterführende Überlegungen zu Akteurkonstellationen
In diesem Abschnitt möchte ich zunächst auf die Überlegungen von Norbert Elias in Bezug auf die Beschreibung von Spielmodellen und anschließend auf Uwe Schimanks Ausarbeitungen über Akteurkonstellationen eingehen. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass man auch andere Beispiele hätte anführen können, so z.B. spieltheoretische Überlegungen, in denen das Handeln und insbesondere die Spielzüge von Individuen simuliert wurde, um ein optimales Spielergebnis zu erhalten und die besten Strategien für Individuen zu entwickeln.
An dieser Stelle wäre auch ein Einstieg über das vielfach gewählte ‚Gefangenendilemma’ möglich gewesen, ein gutes Beispiel dafür, wie es der Spieltheorie gelingt, den Widerspruch von individueller Rationalität uns sozialer Optimalität aufzudecken[102]. Hierbei lässt sich auf Berner verweisen, der die Netzwerktheorien von Olson über die Logik kollektiver Akteure in spieltheoretischen und nicht-spieltheoretischen Varianten als Anknüpfungspunkte nennt.
Ich möchte mich aber auf Elias und Schimank beziehen, da ich ihre Ausführungen als die moderatesten und in Bezug auf diese Arbeit am hilfreichsten bewerte.
2.4.1 Zu den Überlegen von Norbert Elias’ Spielmodellen
Elias veranschaulicht anhand von Spielmodellen die Beziehungen interdependenter Menschen und richtete sein Hauptaugenmerk dabei auf die Frage, wie sich die Verflechtung der Menschen verändert, wenn sich die Verteilung der Machtgewichte verschiebt. Er entwirft dabei mehrere Spielmodelle, die von Zweipersonenspiele bis zu Vielpersonenspiele auf mehreren Ebenen reichen.
Ich möchte diese Überlegungen zu Spielmodellen deshalb aufgreifen, weil es sich hierbei um besonders konstruktive und veranschaulichte Modellanalysen handelt. Auf der anderen Seite, möchte ich dadurch verdeutlichen, inwiefern Akteure in Spielmodellen interdependenten Beziehungen mit anderen Akteuren unterliegen, und wie die Komplexität des Spiels zunimmt, wenn immer mehr Akteure am Spiel teilnehmen und dadurch die Undurchsichtigkeit und Unkontrollierbarkeit für die Einzelnen bei zunehmender Akteurzahl wächst.
Ein Spiel hat Regeln und Grenzen. In der sozialen Wirklichkeit sind diese Regeln und Grenzen viel komplexerer Art und Weise. Schon durch die Interpretation der Elias’schen Spielmodelle wird deutlich, wie schwer es für strategische Gruppen in der Realität ist, sich als Akteur zu formieren, zu behaupten, am ‚Spielverlauf’ zu partizipieren, das Spiel zu beobachten und zu beeinflussen, Machtgewinne zu verzeichnen, sich mit den Gegnern bzw. potentiellen Mitstreitern auseinanderzusetzen und eine Verhandlungsbasis aufzubauen.
„Die Vorstellungen der Spieler von ihrem Spiel – ihre ‚Ideen’, die Denk- und Sprachmittel, mit denen sie ihre Spielerfahrungen zu verarbeiten und zu meistern suchen – verändern sich in entsprechender Weise (…) Statt den Spielverlauf allein auf einzelne Spielzüge einzelner Menschen zurückzuführen, wächst unter ihnen langsam die Tendenz, unpersönliche Begriffe zur gedanklichen Bewältigung ihrer Spielerfahrungen zu entwickeln (…) Die Metaphern, derer man sich bedient, pendeln immer von neuem zwischen der Vorstellung, dass sich der Spielverlauf auf Aktionen einzelner Spieler reduzieren lässt, hin und her. Es ist lange Zeit hindurch für die Spieler außerordentlich schwer, sich klarzumachen, dass die Unkontrollierbarkeit des Spielverlaufs für sie selbst, die den Spielverlauf leicht als eine Art von ‚Überperson’ erscheinen lässt, ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und Angewiesenheit als Spieler und den dieser Verflechtung innewohnenden Spannungen und Konflikten entspringt“ (Elias 1993:95).
Ich setze bei Elias’ Ausführungen über Vielpersonenspiele an. Steigt die Zahl der Spieler, verstärkt sich dadurch auch der Druck auf die Spieler, ihre Gruppierung, ihre Beziehungen zueinander und ihre Organisation zu ändern. Hiermit steigen auch die Kosten das Spiel fortzusetzen, denn jeder Spieler muss auf seinen nächsten Zug warten. Somit wird es für den einzelnen Spieler immer schwerer, sich ein Bild vom Spielverlauf als auch von den sich wandelnden Figurationen zu machen.
[...]
[1] vgl. Merkel 1994a:10
[2] „Als ‚Entwicklungsoption’ bezeichnen wir die je bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse und einer je bestimmten historischen Situation immanente Möglichkeit konkreter Schritte weiterer Entwicklung. Damit ist
zugleich das Vorhandensein mehrerer Optionen zu einem bestimmten Zeitpunkt unterstellt. Optionen ergeben sich aus dem Zusammentreffen der Naturausstattung einer Gesellschaft mit ihren inneren und äußeren Verhältnissen. Bei diesen handelt es sich um innere Strukturen, insbesondere Herrschaftsverhältnisse, Arbeits- und Reproduktionsbeziehungen, aber auch vorhandene Kompetenzen im Umgang mit den vorhandenen produktiven Kräften (…) hinzu kommen gesellschaftliche Außenbeziehungen wie kriegerische Verwicklungen oder auch dauerhafte Austausch- und Komplementärbeziehungen“ (Kößler 1998:154).
[3] Auch Trutz von Trotha teilt diesen Aspekt, denn „trotz aller gegenteiliger Rhetorik auf den UN-Foren der Welt ist mit ‚Entwicklung’ stets ‚westlicher Fortschritt’ gemeint. Im Ergebnis hat dieser Vergleich die legitimatorischen Grundlagen der Postkolonie zerstört“ (Trotha 2001:35)
[4] vgl. Merkel 1994a:10
[5] „Beide Konzepte reichen über die Gewährung der formalen Unabhängigkeit (Dekolonisation im engeren Sinne) hinaus und betrachten einen langen Veränderungsprozess, der während der Kolonialzeit begann und sich postkolonial fortsetzte. Während Dekolonisation die Loslösung von den kolonialen Strukturen im Blick hat, richtet sich das Augenmerk bei der postkolonialen Transformation stärker auf die nach der Dekolonisierung folgenden Entwicklungsprozesse, die bis heute andauern. Der neue Begriff der postkolonialen Transformation erweitert somit den Analysezeitraum bis heute“ (Neubert 2002:10).
[6] Reinhart Kößler 1994: Postkoloniale Staaten. Elemente eines Bezugrahmens, Hamburg
[7] vgl. Weiland 2002:179ff.; vgl. Weiland 1996a:447ff.
[8] Michael Bratton und Nicholas van de Walle verstehen unter einer ‚regime transition’ „a shift from one set of political procedures to another, from an old pattern of rule to a new one. It is an interval of intense political uncertainty during which the shape of the new institutional dispensation is up for grabs by incumbent and opposition contenders” (Bratton/Walle 1997:10).
[9] Samuel P. Huntingtons 1991: The Third wave. Democratization in the late twentieth century, Oklahoma; Huntingtons These der ‚dritten Welle der Demokratie’, erwies sich spätestens zum Ende der 90er Jahre als nicht tragbar, denn die Demokratiehoffnungen blieben in den meisten Staaten Schwarzafrikas in der Liberalisierungsphase stecken.
[10] vgl. O’Donnell/Schmitter 1986: Transition from Authoritirian Rule, Baltimore
[11] Für Schmitter und O’Donnell dient der Transitionsbegriff zur Beschreibung eines Übergangs von einem bestimmten autoritären System zu einem unbestimmten ‚something else’.
[12] vgl. Schimank 2000: Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische Soziologie, Weinheim & München
[13] Dabei herrschen über die Frage, wann eine Demokratie als konsolidiert gelten kann, in der wissenschaftlichen Lektüre recht unterschiedliche Meinungen vor.
[14] „Strategische Gruppen bestehen aus Personen, die durch ein gemeinsames Interesse an der Erhaltung oder Erweiterung ihrer gemeinsamen Aneignungschancen verbunden sind. Diese Appropriationschancen beziehen sich nicht ausschließlich auf materielle Güter, sondern können auch Macht, Prestige, Wissen oder religiöse Ziele beinhalten. Das gemeinsame Interesse ermöglicht strategisches Handeln, d.h. langfristig ein ‚Programm’ zur Erhaltung oder Verbesserung der Appropriationschancen zu verfolgen“ (Evers/Schiel 1988:10)
[15] vgl. Berner 2001:127
[16] vgl. Berner 2001:114
[17] vgl. Berner 2001:113ff.
[18] vgl. Schrader 2001:9
[19] vgl. Bierschenk 2002:9
[20] Schubert/Tetzlaff/Vennewald, Werner 1994 (Hg.): Demokratisierung und politischer Wandel. Theorie und Anwendung des Konzeptes der strategischen und konfliktfähigen Gruppen (SKOG), Münster; Hamburg
[21] vgl. Heberer 2000:22
[22] „Da sie über ein hinreichendes Droh- und/ oder Verweigerungspotential (Konfliktfähigkeit) zur Durchsetzung ihres (partikularen) Gruppen- oder Standesinteresses verfügen und bestrebt sind, dieses Potential aktiv zur Durchsetzung ihrer gemeinsamen Ziele gegen strategische Gruppen durchzusetzen (Konfliktbereitschaft), werden sie zu wichtigen Beförderern von politischen Wandel“ (Schubert/Tetzlaff/Vennewald 1994:68f.).
[23] vgl. u. a.: Melber 2003:22ff.; Pisani 2003:201ff.; Saul/Leys 2003:95ff.
[24] vgl. Evers 1997, 1999, 2001, Heberer 2000, Berner 1999, 2001, Bierschenk 2002
[25] vgl. u. a.: Schubert/Tetzlaff/Vennewald 1994 (Hg.): Demokratisierung und politischer Wandel. Theorie und Anwendung des Konzeptes der strategischen und konfliktfähigen Gruppen (SKOG), Münster, Hamburg; Schubert/Tetzlaff 1998 (Hg.): Blockierte Demokratien in der Dritten Welt, Opladen
[26] Schubert und Tetzlaff verweisen darauf: „In dem hier präferierten SKOG- Konzept spielt die Kategorie der Konfliktfähigkeit eine zentrale Rolle, weil in der Tradition soziologischer Konflikttheorien jenes Axiom heute mehr denn je Gültigkeit für sich beanspruchen darf, dass in sich modernisierenden Gesellschaften mit ihrem erhöhten Dissensrisiko (als Folge zunehmender sozialer Stratifizierung) rationale Gruppenkonflikte der Motor der Entwicklung sind“ (Schubert / Tetzlaff 1998:30).
[27] vgl. Bierschenk 2000, 2002, 2003; vgl. auch Evers/Kaiser/Müller 2003:1ff.
[28] vgl. Idealtypisches Transitionsmodell des Carter-Centers in Atlanta/USA (siehe Anhang), Quelle in: Schubert/Tetzlaff/Vennewald 1994:423f.
[29] Befreiungsbewegungen bezeichnen politisch motivierte Zusammenschlüsse, deren Ziel es ist, ihr Land von der als Unterdrückung empfundenen politischen, ökonomischen und kulturellen, direkten oder indirekten Fremdherrschaft zu befreien. Zu unterscheiden gilt es, in jenen Bewegungen, die das ‚Ziel der nationalen Emanzipation mit gewaltsamen Mitteln’ anstreben als auch diejenigen Befreiungsbewegungen, die in ihren Kampf nach Unabhängigkeit und Freiheit mit gewaltlosen Mitteln bestreiten (vgl. Krumwiede/Trummer 1997:75).
[30] vgl. Weiland 2002:189
[31] vgl. Heberer 2002:18
[32] „Jede Gruppe, die zuerst auftaucht, versucht eine „Superstruktur“ (ein politisches und wirtschaftliches System) zu etablieren, die ihren Interessen entgegenkommt. Mit dem Auftauchen eines neuen Wirtschaftssystems und eines neuen Herrschaftssystems hat jede Gruppe, die zuerst auftaucht, an Zahl zunimmt oder mächtig wird, die größte Chance, das politische System zu strukturieren, Legitimationsmuster und Modelle des politischen Stils festzulegen, kurz, aktiv einen spezifischen Rahmen zu schaffen, der für ihre Interessen am geeignetsten ist“ (Evers/Schiel 1988:45).
[33] vgl. Evers/Schiel 1988:26
[34] vgl. hierzu in Folge Stojanow 2001:3ff.
[35] vgl. Kößler 1994:76
[36] vgl. Goetze 2002:18f.
[37] vgl. Goetze 2002:21
[38] ebd. S.21f.
[39] vgl. Goetze 2002:23
[40] vgl. u.a.: Immanuel Wallerstein 1974: The Modern World-System, New York.
[41] In der politischen Wissenschaft setzte sich in den letzten Jahren auch verstärkt institutionenbezogene Ansätze durch, worauf aber im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden kann.
[42] vgl. Schmidt 1996:186
[43] vgl. Schmidt 1996:191
[44] Robert A. Dahl 1971: Polyrchy: „I assue that a key characteristic of a democracy ist he continuing responsiveness of the government to the preferences of ist citizens, considered as political equals” (Dahl 1971:1). For the opportunity to have preferences weighted equally in conduct of government: a) freedom to form and join organizations, b) freedom of expression, c) right to vote, d) eligibility for public office, e) right of political leaders to compete for support and the right of political leaders to compete for votes, f) alternatives sources of informations, g) free and fair elections and h) institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference (Dahl 1971:3).
[45] “Polyarchies, then, may be thought of as relatively (but completely) democratized regimes, or, to put it in another way, polyarchies are regimes that have been substantially popularized and liberalized, that is, highly inclusive and extensively open to public contestation” (Dahl 1971:8).
[46] vgl. Schubert/Tetzlaff 1998:14
[47] vgl. Fukuyama 1992: Fukuyamas These vom ‚Ende der Geschichte’ zog eine ausgesprochen kontroverse Diskussion in der internationalen Wissenschaftsgemeinde nach sich. Mit seiner These behauptet Fukuyama nach eigenen Aussagen nicht, dass es fortan keine großen und bedeutsamen Ereignisse mehr geben werde. Zu Ende gekommen sei nach seiner Auffassung allerdings die Geschichte als der einzigartige, kohärente evolutionäre Prozess, der die Erfahrungen aller Menschen aller Zeiten umfasst. Fukuyamas These basiert auf der Idee, dass in den vergangenen Jahren ein derart weit reichender Konsens über die Legitimität der liberalen Demokratie zu verzeichnen gewesen sei, dass diese als der Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit erscheine und demnach das Ende der Geschichte markieren könne. Laut Fukuyama hat die Entwicklung deutlich gemacht, dass alle vormals konkurrierenden Regierungssysteme und Herrschaftsformen, zuletzt der Kommunismus, der liberalen Demokratie unterlegen und an ihren inneren Widersprüchen gescheitert seien.
[48] vgl. Bredow/Jäger/Kümmel 1997:13
[49] vgl. Aké 1994:59ff.
[50] vgl. Kößler/Schiel 1997:21
[51] vgl. u. a.: Bierschenk 2003:3
[52] Zum politikberechtigten Volk der ‚polis’ zählten allerdings nur die Vollbürger; die große Mehrheit der Bewohner des Staatsgebietes, u. a. Frauen, Halbfreie, Sklaven etc., waren von der Politik ausgeschlossen. Diese Form der Demokratie – die nur einem Teil der erwachsenen männlichen Bevölkerung die direkte Teilnahme an der Politik ermöglichte – galt lange Zeit als die einzig mögliche Form der Demokratie.
[53] vgl. Nuscheler 1994:228
[54] So können sie auch keine tragfähige Grundlage für eine soziale oder partizipative Demokratie sein, die als Leitbilder für industriell und demokratisch entwickelte Gesellschaften konzipiert wurden.
[55] „Für all jene, die einen komplexen, hoch aufgeladenen Demokratiebegriff zugrunde legen, der sich vom substanzlosen, prozeduralen der westlichen, liberalen Demokratie unterscheidet, gibt es bis heute keine (wahre) Demokratie in Afrika (Aké 1992; 1994; Ihonvbere 1998)“ (Gero Erdmann 2001:296).
[56] vgl. Erdmann 2000:212
[57] vgl. Weiland 2002:179
[58] Diese Aussage wissenschaftlicher Lektüre bedarf hierbei eines wesentlichen Hinweises. Denn der Umbruch in den Staaten des südlichen Afrikas ging dem der osteuropäischen Staaten zeitlich voraus, schon die Unabhängigkeit des südwestafrikanischen Staates Namibia war ein Produkt des endenden Ost-West-Antagonismus. Sie kam infolge einer neuen sowjetischen Außenpolitik und intensiver Vermittlungsbemühungen der beiden Großmächte USA und UdSSR zustande.
[59] vgl. Tetzlaff 2002:13
[60] vgl. Huntington 1991:100
[61] vgl. Hofmeister 1994:39ff.
[62] vgl. Saul 1999:167ff.
[63] „Das demokratische Grundverständnis, dass bei den Übergangsprozessen angewendet und wirksam wurde, (…) zugleich aber auch ein weiterhin prekäres, auf keinesfalls solidem Fundament gebautes Terrain. Insbesondere die Befreiungsbewegungen an der Macht haben den demokratischen Bekenntnissen die praktischen Taten zu deren Verfestigung als tragfähiges System bislang kaum folgen lassen. Ähnlich halbherzig wurden die ursprünglich proklamierten Absichten zur grundlegenden sozio-ökonomischen Transformation der durch strukturelle Ungleichheiten des kolonialen Erbes gekennzeichneten Gesellschaften (wenn überhaupt) umgesetzt. Wirtschaftliche Umverteilungsmaßnahmen scheinen eher die Begünstigung neuer Eliten als das Gemeinwohl der Bevölkerungsmehrheit im Auge gehabt zu haben“ (Melber 2003:13).
[64] vgl. Tetzlaff 2002:13
[65] vgl. Bredow/Jäger/Kümmel 1997:15
[66] vgl. Aké 1994:59ff
[67] Kößler/Schiel 1997: Ethnizität: Selbstorganisation und Strategie, in: Peripherie. Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt, Nr.67, 1997, S. 7-27
[68] Die Machthabenden verändern den Staat nicht, weil sie ihn durch ihre Macht ja ausüben, die Oppositionellen haben Angst Opfer der Herrschaft zu sein, hoffen aber gleichzeitig an die Macht zu kommen. Alle scheinen an noch mehr Macht und Kontrolle interessiert zu sein, seit Demokratisierung diskutiert wird und es gute Aussichten auf Teilnahme an einem Wettbewerb um einen wertvollen Preis gibt.
[69] So schreibt Claude Aké diesbezüglich: „Der Westen als die ‚Bastion der Demokratie’ hat seine Demokratie über Jahrhunderte nur unter großem Druck entwickelt, der ihre Bedeutung und Realität immer wieder verändert hat, so dass die Macht des Volkes und die Teilnahme an der Politik zunehmend trivialisiert wurde (..) Demokratie ist so weit trivialisiert worden, dass sie für die Eliten nicht mehr gefährlich ist, die stolz auf ihre demokratische Überzeugung sein können, ohne dass viel von ihnen gefordert würde. Demokratie wird so in einer wesentlich entleerten Demokratie universalisiert, die für die neuen politischen Realitäten im Westen außer als Ideologie kaum relevant sind“ (Aké 1994:73).
[70] „Dieses Produkt kann nicht in anderen Gesellschaften eingepflanzt werden, denen dieser gesellschaftliche und kulturelle Mutterboden fehlt, auch wenn ihre Eliten an westliche Universitäten politisch sozialisiert wurden. Solche künstlichen Transplantate werden als Fremdkörper abgestoßen“ (Nuscheler 1994:228)
[71] vgl. Weiland 1999:22
[72] vgl. Weiland 1999:22
[73] Auf der Genfer SWA/Namibia-Konferenz (07.-14.01.1981) kam es zu politisch-diplomatischen Auseinandersetzungen der ‚internen’ Südafrika-loyalen Parteien und der SWAPO. Die DTA wollte als rein namibische, nicht südafrikanisch-namibische Delegation betrachtet werden, um somit denselben Status wie die SWAPO zu besitzen. Diesem Antrag wurde jedoch nicht stattgegeben, dann hätte die UN nämlich auch alle anderen internen Parteien als Repräsentanten des namibischen Volkes anerkannt. Somit blieb die SWAPO der ‚einzige und authentische’ Vertreter der Bevölkerung von Namibia. Die SWAPO schuf sich mit der Dauer des Namibia-Konflikts und dem zugesicherten Alleinvertretungsanspruch, unter ihrem Führer Sam Nujoma, eine äußerst solide diplomatische Position.
[74] Lauren Dobell kommt bei gründlichen Untersuchungen zum Befund einer erschreckenden Abwesenheit konsistenter demokratischer Überzeugungen (vgl. Dobell 1998:17).
[75] vgl. hierzu auch Weiland 1996a:449;
[76] vgl. u.a. Melber 2003:20ff.; Saunders 2003:130ff.
[77] vgl. Kößler 1994:24
[78] vgl. Schmidt 1994:237
[79] Für Neubert liegen die Schwächen der afrikanischen Staaten in der ‚unspezifischen Grundlage für die politische Mobilisierung’ verursacht, denn bislang seien lediglich regional-ethnische Loyalitäten als potentielle übergreifende Mobilisierungsgrundlage zu erkennen (vgl. Neubert 1994:151)
[80] vgl. Merkel 1994b:303ff.
[81] Schimank 1996: Theorien gesellschaftlicher Entwicklung, Neuwied, S. 205
[82] vgl. Schimank 2000:14
[83] ebd. S. 16
[84] ebd. S.17
[85] Giddens definiert ‚Struktur’ dahingehend, dass diese Regeln und Ressourcen beinhaltet, die an der sozialen Reproduktion rekursiv mitwirken. „Institutionalisierte Aspekte sozialer Systeme besitzen Strukturmomente in dem Sinne, dass Beziehungen über Zeit und Raum hinweg stabilisiert werden“ (Giddens 1989:45)
[86] vgl. Sigmund 2000:155
[87] vgl. Merkel 1994b:306
[88] vgl. Merkel 1996:31
[89] vgl. u. a.: Merkel 1994b:307; vgl. Tetzlaff 1994:164ff.
[90] vgl. Merkel 1994b:307
[91] vgl. Merkel 1994a:31
[92] Hieraus ging später ein ‚akteursorientierter Institutionalismus’ hervor, der besonders von Renate Mayntz und Fritz Scharpf geprägt wurde. Vgl. hierzu u.a. Mayntz, Renate / Scharpf, Fritz W. 1995: Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/Main
[93] Karl, O’Donnell und Schmitter gewinnen ihre Hypothesen, Generalisierungen und Typologien induktiv aus der Analyse der Regimeübergänge Südeuropas und Lateinamerikas. Sie konzentrieren sich hierbei auf die Strategien der unterschiedlichen Akteure und versuchen so Verlauf, Form und Ergebnis des Transitionsprozesses primär als das Ergebnis der interagierenden Strategien zu erklären. Sie erarbeiten Konzepte heraus, wonach sich die Transition als gesteuert ‚von oben’ oder ‚von unten’ beschreiben lässt. Erste Kategorie ist demnach eine elitengesteuerte Transition, die entweder als Pakt oder als „Diktat von oben“ gelenkt wird. Diese Art von Transitionsprozess wird von derjenigen unterschieden, die von Massenbewegungen gelenkte Systemübergänge beschreiben, die sich entweder als Reform oder als Revolution gestalten.
[94] Schubert/Vennewald 1995: 280
[95] u.a: Przeworski, Adam 1992: The Games of Transition, in: Mainwaring, Scott/O’Donnell, Guillermo/Valenzuela, Samuel (Hg.: Issues in Democratic Consolidation: The South American Democracies in Comperative Perspective. Notre Dame, S. 105-152. Przeworski unterstellt allen an Transitionsprozessen beteiligten Akteuren bestimmte Interessen und leitet unter Anwendung von entscheidungstheoretischen Verfahren die Bedingungen ab, unter denen eine rationale Entscheidung zur Demokratisierung von autoritären Systemen möglich ist. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in der Ausblendung externer und systeminterner struktureller Faktoren, da Przeworski nur mit den von ihm angenommenen Interessen und Präferenzen der beteiligten Akteure rechnet (vgl. Bos 1994:83).
[96] vgl. Bos 1994:83
[97] vgl. Merkel 1994b:307ff.
[98] vgl. Berner 2001:113
[99] vgl. Schimank 1996:209
[100] vgl. Bos 1994: 81
[101] ebd. S.81
[102] vgl. hierzu u. a. Neumann/Morgenstern 1944; Axelrod 1984, Neyman 1985
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832478247
- ISBN (Paperback)
- 9783838678245
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- afrika gruppen entwicklungsland südafrika transformationsforschung
- Produktsicherheit
- Diplom.de