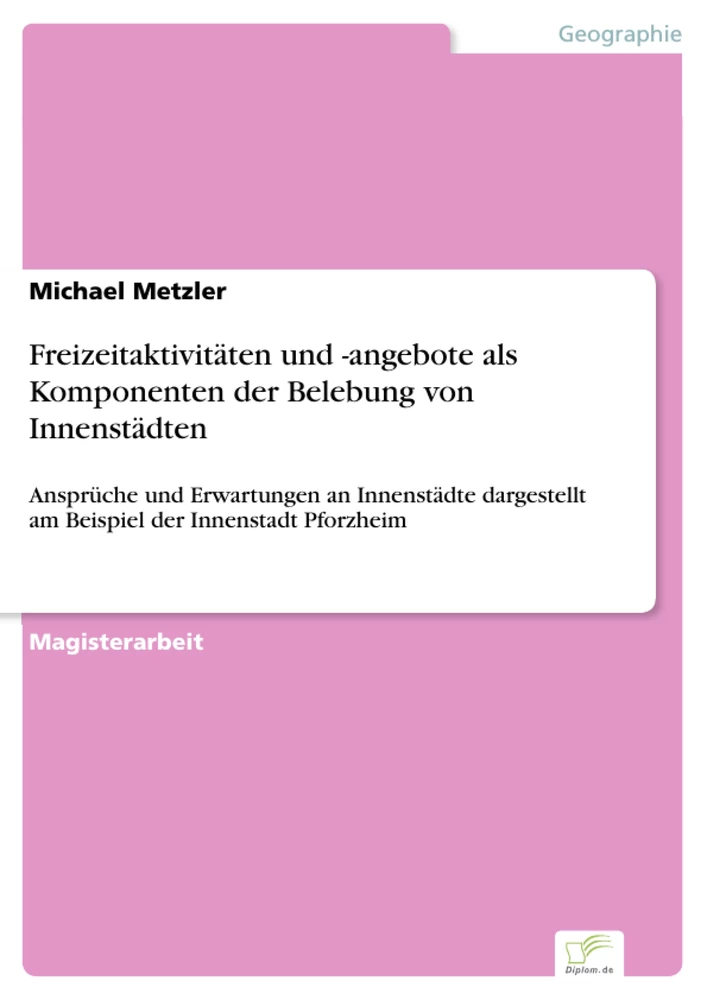Freizeitaktivitäten und -angebote als Komponenten der Belebung von Innenstädten
Ansprüche und Erwartungen an Innenstädte dargestellt am Beispiel der Innenstadt Pforzheim
©2002
Magisterarbeit
181 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Freizeitsektor hat in den letzten Jahrzehnten seine residuale Stellung gegenüber der Arbeit verloren und ist für viele Menschen zu einem zentralen Lebensbereich geworden. Als Folge dieser Entwicklung haben sich Freizeitnachfrage und Freizeitangebot deutlich verändert, wie auch das Niveau, mit dem Räume der Freizeitverbringung bewertet und in Anspruch genommen werden.
Freizeit ist ein wichtiger weicher Standortfaktor und gewinnt bei Standort- und Wohnortentscheidungen von Unternehmen und Menschen an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat sich der kommunale Freizeitwert in der Stadtentwicklungspolitik inhaltlich verändert und eine image- und marketingorientierte Komponente bekommen. Er wurde zu einem wichtigen Indikator für die Lebensqualität und die Attraktivität eines Raumes. In dieser Studie wird am Beispiel der Innenstadt von Pforzheim analysiert, ob und in welchem Maße Freizeitaktivitäten und -angebote zur Belebung von Innenstädten beitragen können.
Die Veränderungen in den Freizeitverhaltensweisen haben entscheidende Berührungspunkte mit der Herausbildung neuer Wertorientierungen in der Gesellschaft. Werte steuern indirekt die Bedürfnisse, Formen und Inhalte der Freizeitgestaltung und können daher als Erklärungsgrößen für die Veränderungen im Freizeit- und Konsumbereich herangezogen werden. Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtenden Entwicklungen im Wertesystem weisen in Richtung Selbstentfaltung, Genuss, Individualismus und führen zu einer Vielzahl von individuellen Wertekombinationen.
Dieser Wertepluralismus führte in Zusammenhang mit wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen zu einer Pluralisierung der Lebensstile. Traditionelle Segmentierungsmodelle wie Schichten oder Klassen, und die zugrundeliegenden Variablen wie Beruf, Einkommen, Alter und Haushaltsform, reichen nicht mehr aus, um die Etablierung moderner Lebensstile differenziert erklären zu können. Komplexere Erklärungsansätze werden erforderlich, die auch subjektive Faktoren wie Freizeit- und Konsumverhaltensweisen berücksichtigen.
Im konzeptionellen Teil dieser Arbeit werden die Veränderungen in der Freizeitnachfrage und im Freizeitangebot anhand einiger Einflussfaktoren und Indikatoren charakterisiert.
Gang der Untersuchung:
Die empirische Analyse besteht aus zwei Teilen. In der Bürgerbefragung wurden 184 Passanten (0,16 Prozent der Einwohnerschaft Pforzheims) erfasst. Die Stichprobe entspricht in etwa der alters- und […]
Der Freizeitsektor hat in den letzten Jahrzehnten seine residuale Stellung gegenüber der Arbeit verloren und ist für viele Menschen zu einem zentralen Lebensbereich geworden. Als Folge dieser Entwicklung haben sich Freizeitnachfrage und Freizeitangebot deutlich verändert, wie auch das Niveau, mit dem Räume der Freizeitverbringung bewertet und in Anspruch genommen werden.
Freizeit ist ein wichtiger weicher Standortfaktor und gewinnt bei Standort- und Wohnortentscheidungen von Unternehmen und Menschen an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat sich der kommunale Freizeitwert in der Stadtentwicklungspolitik inhaltlich verändert und eine image- und marketingorientierte Komponente bekommen. Er wurde zu einem wichtigen Indikator für die Lebensqualität und die Attraktivität eines Raumes. In dieser Studie wird am Beispiel der Innenstadt von Pforzheim analysiert, ob und in welchem Maße Freizeitaktivitäten und -angebote zur Belebung von Innenstädten beitragen können.
Die Veränderungen in den Freizeitverhaltensweisen haben entscheidende Berührungspunkte mit der Herausbildung neuer Wertorientierungen in der Gesellschaft. Werte steuern indirekt die Bedürfnisse, Formen und Inhalte der Freizeitgestaltung und können daher als Erklärungsgrößen für die Veränderungen im Freizeit- und Konsumbereich herangezogen werden. Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtenden Entwicklungen im Wertesystem weisen in Richtung Selbstentfaltung, Genuss, Individualismus und führen zu einer Vielzahl von individuellen Wertekombinationen.
Dieser Wertepluralismus führte in Zusammenhang mit wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen zu einer Pluralisierung der Lebensstile. Traditionelle Segmentierungsmodelle wie Schichten oder Klassen, und die zugrundeliegenden Variablen wie Beruf, Einkommen, Alter und Haushaltsform, reichen nicht mehr aus, um die Etablierung moderner Lebensstile differenziert erklären zu können. Komplexere Erklärungsansätze werden erforderlich, die auch subjektive Faktoren wie Freizeit- und Konsumverhaltensweisen berücksichtigen.
Im konzeptionellen Teil dieser Arbeit werden die Veränderungen in der Freizeitnachfrage und im Freizeitangebot anhand einiger Einflussfaktoren und Indikatoren charakterisiert.
Gang der Untersuchung:
Die empirische Analyse besteht aus zwei Teilen. In der Bürgerbefragung wurden 184 Passanten (0,16 Prozent der Einwohnerschaft Pforzheims) erfasst. Die Stichprobe entspricht in etwa der alters- und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7798
Metzler, Michael: Freizeitaktivitäten und -angebote als Komponenten der Belebung von
Innenstädten - Ansprüche und Erwartungen an Innenstädte dargestellt am Beispiel der
Innenstadt Pforzheim
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Universität Stuttgart, Universität, Magisterarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
1
1.1 Problemstellung
1
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
4
2. KONZEPTIONELLER TEIL DER ARBEIT
5
2.1 Abgrenzung der Begriffe Freizeit und Freizeitaktivität
5
2.2 Freizeittheoretische
Erklärungsansätze
8
2.2.1 Determinationskonzepte und arbeitspolare Ansätze
8
2.2.2 Freizeit als Aspekt der Lebensqualität
8
2.2.3 Der Wertewandel als Erklärung für die Veränderungen im Freizeitbereich
9
2.2.4 Lebens- und Freizeitstile
10
2.3 Einflussfaktoren auf Freizeitaktivitäten und Freizeitangebote
13
2.3.1 Einflussfaktoren der Freizeitnachfrage
13
2.3.1.1 Veränderungen in der Arbeitswelt
13
2.3.1.2 Entwicklung von Einkommen und Freizeitausgaben
14
2.3.1.3 Veränderungen im Bildungswesen
16
2.3.1.4 Entwicklungen in der Bevölkerungs- und Altersstruktur
17
2.3.1.5 Veränderungen in den Haushalts- und Familienstrukturen
19
2.3.1.6 Entwicklung der Motorisierung und der Freizeitmobilität
20
2.3.1.7 Freizeitorientierung
21
2.3.1.8 Erlebnisorientierung
22
2.3.2 Veränderungen und Trends im Freizeitangebot
25
2.3.2.1 Entwicklungen im privatwirtschaftlichen Freizeitangebot
25
2.3.2.2 Entwicklungen im kommunalen Freizeitangebot
26
2.3.2.3 Freizeit als Komponente des kommunalen Marketings
31
2.4 Freizeitstandorte
33
2.4.1 Veränderungen der Freizeitstandorte
33
2.4.2 Die Innenstadt als Freizeit- und Erlebnisraum
34
2.4.2.1 Freizeitangebote und -einrichtungen von Innenstädten
34
2.4.2.2 Erlebnisattraktivität von Innenstädten
37
2.5 Zwischenfazit und Untersuchungshypothesen
41
Inhaltsverzeichnis
II
3. MAKROANALYSE DER UNTERSUCHUNGSRAUM
42
3.1 Die
Stadt
Pforzheim
42
3.1.1 Lage im Raum
42
3.1.2 Strukturdaten zur Stadt Pforzheim
44
3.2 Das Untersuchungsgebiet Innenstadt Pforzheim
48
3.2.1 Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
48
3.2.2 Gebietsbeschreibung
48
3.2.3 Freizeitangebote in der Pforzheimer Innenstadt
49
3.2.4 Kurzbeschreibung ausgewählter Freizeiteinrichtungen
51
3.2.5 Der Einzelhandel in der Pforzheimer Innenstadt
55
4. MIKROANALYSE - ERGEBNISSE DER EMPIR. UNTERSUCHUNG
57
4.1 Datengrundlage, methodische Vorgehensweise, Ablauf
57
4.1.1 Bürgerumfrage
57
4.1.1.1 Ablauf und Methodik
57
4.1.1.2 Repräsentativität
58
4.1.1.3 Auswertung
59
4.1.2 Gespräche mit Akteursgruppen der Innenstadt
59
4.2 Bürgerumfrage
Pforzheim
61
4.2.1 Stellenwert der Innenstadt als Freizeitstandort
61
4.2.2 Bedürfnisse der Pforzheimer an die Innenstadt als Freizeitstandort
70
4.2.3 Ansprüche an die Erlebnisattraktivität der Innenstadt
81
4.3 Befragung verschiedener Akteursgruppen der Innenstadt Pforzheim
91
4.3.1 Bedeutung des Erlebniseinkaufes in der Innenstadt
91
4.3.2 Freizeit in der Pforzheimer Stadtentwicklung
93
5. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG
97
5.1 Bewertung der Untersuchung
97
5.2 Empfehlungen und Verbesserungspotenziale
100
6. LITERATUR
104
ANHANG: Fragebogen der empirischen Untersuchung im Wortlaut
117
Abbildungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Beliebtheit von Freizeittätigkeiten 1999
6
Abb. 2: Freizeitdimensionen
7
Abb. 3: Jährliche Aufwendungen eines Vierpersonenhaushaltes für Freizeitgüter
und Urlaub 1965 bis 1997; Proz. Anteile am ausgabefähigen Einkommen
16
Abb. 4: Freizeittätigkeiten nach Bildungsabschlüssen 1993 in Prozent
17
Abb. 5: Entwicklung der privaten Haushalte und der durchschnittlichen Haushalts-
größe in Westdeutschland
19
Abb. 6: Konsumentenlager nach Altersgruppen in Westdeutschland in Prozent
24
Abb. 7: Freizeitwert einer Stadt oder Region
29
Abb. 8: Handlungsfelder und Aufgabenbereiche des Citymarketings
31
Abb. 9: Trends im Freizeitmarkt
32
Abb. 10: Motive für einen Besuch von Innenstädten in Prozent
36
Abb. 11: Komponenten der Erlebnisattraktivität von Innenstädten
38
Abb. 12: Erwartete Effekte der Freizeitförderung in der Innenstadt in Prozent
40
Abb. 13: Der Mehrwert von Freizeit für die Innenstadtentwicklung
40
Abb. 14: Prozentuale Anteile der Haushaltstypen 1999 im Vergleich
45
Abb. 15: Ungebundene Kaufkraft 1998 im Vergleich
47
Abb. 16: Wo verbringen Sie vorwiegend Ihre Freizeit?
61
Abb. 17: Zu welchem Zweck besuchen Sie normalerweise die Innenstadt von Pforzheim? 63
Abb. 18: Bindungs- und Neigungsbesuche in der Pforzheimer Innenstadt (nach Alter)
65
Abb. 19: Wie oft pro Jahr und wo besuchen Sie die folgenden Freizeiteinrichtungen?
66
Abb. 20: Wie verbringen Sie den vorwiegenden Teil Ihrer Freizeit? (in Prozent)
71
Abb. 21: Bitte stufen Sie die folgenden Aspekte nach ihrer generellen Wichtigkeit für
die Lebensqualität einer Innenstadt ein. Danach bewerten Sie die aktuelle
Situation in der Innenstadt von Pforzheim
73
Abb. 22: Nennen Sie Freizeiteinrichtungen, die Sie in der Innenstadt vermissen
76
Abb. 23: Wie informieren Sie sich über das Freizeitangebot der Pforzheimer Innenstadt? 78
Abb. 24: Kombinieren Sie Freizeit und Erholung mit Einkaufen? (nach Alter)
82
Abb. 25: Was kaufen Sie eher in der Innenstadt von Pforzheim ein, was eher außerhalb? 83
Abbildungsverzeichnis
IV
Abb. 26: Bitte stufen Sie die folgenden Aspekte in einem ersten Schritt nach ihrer
generellen Wichtigkeit für den Erlebniswert einer Innenstadt ein. Danach
bewerten Sie die aktuelle Situation in der Innenstadt von Pforzheim
85
Abb. 27: Welche Verkehrsmittel benutzen Sie vorwiegend beim Besuch der Freizeit-
einrichtungen inner- und außerhalb der Innenstadt von Pforzheim?
87
Tabellenverzeichnis
V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Freizeitkonsumenten: Typologie und prozentuale Anteile an der Bevöl-
kerung ab vierzehn Jahren
12
Tab. 2: Entwicklung der durchschnittlichen tariflichen Arbeitszeit
14
Tab. 3: Entwicklung der Lebensarbeitszeit 1900 bis 1990 in Jahren
14
Tab. 4: Entwicklung des Haushaltsnettoeinkommens 1962/63 bis 1997
15
Tab. 5: Entwicklung der Bevölkerungs- und Altersstruktur 1970 bis 2000
18
Tab. 6: Personenkraftwagen je tausend Einwohner (PKW-Dichte) 1960 und 2000
20
Tab. 7: Stellenwert von Beruf und Freizeit in Westdeutschland 1988 und 1998
22
Tab. 8: Empfindungen der Verbraucher beim Einkauf und Aufenthalt in der Innen-
stadt in Prozent
36
Tab. 9: Altersstruktur der Pforzheimer Bevölkerung im Zeit- und Raumvergleich
44
Tab. 10: Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 1999/2000
46
Tab. 11: PKW je tausend Einwohner 1999 im Vergleich
47
Tab. 12: Verkaufsflächen- und Umsatzverteilung des Pforzheimer Einzelhandels
56
Tab. 13: Vergleich der Altersstruktur der Befragten mit der Pforzheimer Bevölkerung
59
Tab. 14: Gesprächspartner
60
Tab. 15: Wo verbringen Sie vorwiegend Ihre Freizeit? (nach Alter)
62
Tab. 16: Zu welchem Zweck besuchen Sie normalerweise die Innenstadt von
Pforzheim? (nach Alter)
64
Tab. 17: Besuchshäufigkeiten ausgewählter Freizeiteinrichtungen nach Bildungsstand
67
Tab. 18: Besuchshäufigkeiten und Bindungsquoten nach Standorten
68
Tab. 19: Wie oft pro Jahr und wo besuchen Sie die folgenden Freizeiteinrichtungen
(nach Alter)?
69
Tab. 20: Gibt es Freizeiteinrichtungen in der Pforzheimer Innenstadt, die Sie häufiger
nutzen würden, wenn sie andere Öffnungszeiten hätten?
77
Tab. 21: Fühlen Sie sich ausreichend über das Freizeitangebot informiert?
79
Tab. 22: Kombinieren Sie Freizeit und Erholung mit Einkaufen? (Bildung, Geschlecht)
82
Tab. 23: Benotung ausgewählter Faktoren der Erlebnisqualität (nach Bildung)
86
Tab. 24: Welche Verkehrsmittel benutzen Sie vorwiegend beim Besuch der Freizeit-
einrichtungen inner- und außerhalb der Innenstadt von Pforzheim?
88
Tab. 25: Bitte beurteilen Sie die Erreichbarkeit der Pforzheimer Innenstadt
88
Kartenverzeichnis
VI
Kartenverzeichnis
Karte 1: Lage im zentralörtlichen Gefüge der Region Nordschwarzwald
42
Karte 2: Stadt Pforzheim - Lage im Raum
43
Karte 3: Die Pforzheimer Innenstadt
124
Einleitung
1
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungsprozesse erhöhen den Handlungsdruck auf
Städte und Kommunen, die zu Konkurrenten um Einwohner, Touristen und Wirtschaftsunter-
nehmen werden (SCHALLER 1993, 12). Innerhalb des Wettbewerbs, der sich durch die
Deutsche Wiedervereinigung, die Öffnung Osteuropas und den EU-Binnenmarkt intensiviert
hat, polarisiert sich das Städtesystem in Gewinner und Verlierer (HELBRECHT 1994, 79). Bei
der Profilierung gegenüber der Konkurrenz kommt der ,,Visitenkarte" Innenstadt eine beson-
dere Bedeutung zu.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben viele Städte große Anstrengungen unternommen, um
ihre Zentren aufzuwerten. In Baden-Württemberg gibt es keine städtische Kommune, die nicht
in den letzten fünfundzwanzig Jahren Stadterneuerung betrieben hat oder immer noch betreibt.
Die vom Land gestützte Stadterneuerungspolitik hat vielerorts Früchte getragen (PESCH 1999,
11):
· Atmosphäre, gestalterisches Bild sowie Aufenthalts- und Umweltqualität der Stadtkerne
haben infolge dieser Aktivitäten deutlich an Attraktivität gewonnen,
· hohe und weiterhin steigende Besucherzahlen dokumentieren die gestiegene Beliebtheit
vieler Innenstädte,
· die Stadtzentren werden wieder als symbolische Mitte geschätzt, mit der sich Bürger-
innen und Bürger identifizieren.
Dennoch ist die heutige Situation ambivalent zu bewerten. Die Innenstädte sehen sich einigen
Problemen gegenüber, die ihren Status als ,,Aushängeschild" und ,,Schaufenster der Gesamt-
stadt" gefährden. Es scheint, als würden sie schleichend ihrer Existenzgrundlage entzogen:
· Rückläufige Umsätze und Leerstände sind Zeichen der Stagnation und haben Handel
und Politik verunsichert,
· die Abwanderung von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben, Haushalten und
Freizeiteinrichtungen an die Peripherie scheint ungebrochen,
· in der Konkurrenz mit der grünen Wiese haben die Städte deutlich an Boden verloren.
Wenn sich diese Trends fortsetzen, drohen die Innenstädte als ,,funktionaler Torso" zurück-
zubleiben. Obwohl man sich auf allen politischen Ebenen einig ist, dass sie wie kein anderer
Ort die europäische Siedlungskultur verkörpern, hat dies in der Ansiedlungspraxis wenig
bewirkt. So ist es der Regionalplanung nicht gelungen, die landespolitisch gewollte Zentren-
hierarchie durchzusetzen. Das traditionelle Zentrengefüge wird inzwischen von einem sekun-
dären Netz großflächiger Konsum- und Freizeiteinrichtungen überlagert, das sich primär auf
Einleitung
2
der grünen Wiese etabliert hat. Welches Verhältnis von Zentrum und Peripherie der Markt
langfristig herausbildet, ist innerhalb des wirtschaftlichen Strukturwandels noch völlig offen
(PESCH 1999, 12).
Konzepte für die Revitalisierung der Innenstädte werden nur als integrierte Strategien
erfolgreich sein. Eine zukunftsorientierte Politik zur Belebung der Innenstädte muss auf die
Anreicherung des Nutzungsgefüges setzen. Durch eine ausgewogene Mischung aus speziali-
siertem Einzelhandel und Gastronomie, Wohnen und Freizeit können die Zentren neu positio-
niert und strukturell gestärkt werden (PESCH 1999, 13). Innerhalb dieser Studie wird erfor-
scht, welchen Beitrag Freizeitaktivitäten und -angebote zur Belebung der Innenstädte leisten
können.
Der Freizeitsektor hat längst seine residuale Stellung gegenüber der Arbeit verloren und ist für
viele Menschen zu einem zentralen Lebensbereich geworden. Gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Umstrukturierungsprozesse haben in Zusammenhang mit gewandelten Werthaltungen zu
signifikanten Veränderungen in den Bedürfnissen, Formen und Inhalten der Freizeitgestaltung
geführt (SCHÄFLEIN 1994, 1). In diesem Zusammenhang hat sich auch das Niveau verändert,
mit dem Räume der Freizeitverbringung bewertet und in Anspruch genommen werden (DEN-
KEL 1991, 1).
Passantenbefragungen in vielen Städten zeigen, dass ein erheblicher Teil der Innenstadt-
besuche Freizeitaktivitäten zuzuordnen ist (FREHN 1996, 318f). Soziologen wie Felizitas
Romeiß-Stracke plädieren schon lange dafür, die Innenstadt als ,,zentrale Freizeiteinrichtung"
zu verstehen (GURATZSCH 2001, 9). Die Rolle des Freizeitstandortes Innenstadt wurde
jedoch lange Zeit unterschätzt. Erst in den Neunzigerjahren hat das Thema in den Kommunen
einen höheren Stellenwert eingenommen. Faktoren wie Freizeit- und Erlebniswert, Image und
Stadtgestaltung werden als weiche Standortfaktoren erkannt und in Stadtentwicklungskonzepte
integriert.
Die Wahl des Untersuchungsgebietes fiel aus mehreren Gründen auf die Innenstadt von Pforz-
heim. Zunächst wurde das Interesse für die Stadt im Rahmen eines Praktikums (Citymarketing
Pforzheim) geweckt. In diesem Zeitraum wurden die spezifischen Vorzüge der Innenstadt er-
sichtlich, aber auch die Missstände und Probleme, denen sie sich gegenüber sieht.
Die historische Altstadt, Anziehungspunkt für Einwohner und Besucher, Ort der Identifikation
und wichtiger Freizeitstandort, ist im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört worden. Seither
prägt die nüchterne, funktionale Architektur der Sechziger- und Siebzigerjahre das Stadtbild.
Pforzheim befindet sich zudem in einer ausgeprägten (über-) örtlichen Wettbewerbssituation,
die auch den Freizeitbereich erfasst. Die benachbarten Oberzentren Stuttgart und Karlsruhe
liegen nur wenige Kilometer entfernt. Auf der ,,Wilferdinger Höhe" ist ein Gewerbegebiet mit
zahlreichen Einzelhandelsbetrieben entstanden, die der Innenstadt Frequenz und Kaufkraft ent-
ziehen.
Einleitung
3
Andererseits sind aber auch vielfältige Freizeitangebote und qualitativ hochwertige Freizeitein-
richtungen mit zum Teil überregionalem Bekanntheitsgrad existent. Eine genauere Betrach-
tung der Situation erschien daher interessant. Zudem bekundeten einige lokale Entscheidungs-
träger starkes Interesse an einer wissenschaftlichen Arbeit über ,,ihre" Stadt. Sie wiesen auf
interessante Bau- und Entwicklungsmaßnahmen wie das ,,Bohnenberger Schlössle" oder das
neue Multiplexkino hin, mit denen die Innenstadt als Freizeit- und Erlebnisstandort für die Zu-
kunft gerüstet werden soll.
Die kritische Literaturrecherche bestätigte die Entscheidung über das Thema zu schreiben, da
dieses Forschungsfeld in den jüngeren wissenschaftlichen Publikationen nur rudimentär be-
rücksichtigt wurde. Über die allgemeinen Veränderungen im Freizeitverhalten wurde zwar viel
geforscht, ein räumlicher Bezug auf die Innenstadt als Freizeit- und Erlebnisstandort fehlt
jedoch zumeist, richtet sich auf die Gesamtstadt oder beschränkt sich auf das Freizeitverhalten
einzelner Bevölkerungsgruppen.
Einleitung
4
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
Diese Arbeit versteht sich als Beitrag zur sozial- und stadtgeographischen Forschung. Es wird
primär das Ziel verfolgt, die Veränderungen in den Freizeitaktivitäten aufzuzeigen, um die da-
raus resultierenden Bedürfnisse an die Innenstadt Pforzheim zu untersuchen. Im Rahmen einer
Stärken- und Schwächenanalyse soll ermessen werden, inwieweit die vorhandenen Angebote
und Einrichtungen den Erwartungen der Einwohner gerecht werden und wo bisher ungenutzte
Potenziale liegen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden Verbesserungsvorschläge und Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet, die sich auf die anstehenden Projektvorhaben und die zukünf-
tigen Freizeitplanungen beziehen.
Den Aufbau der Arbeit betreffend werden in Kapitel 2.1 zunächst die Begriffe ,,Freizeit" und
,,Freizeitaktivität" definiert. In Kapitel 2.2 werden die freizeittheoretischen Erklärungsansätze
skizziert. Neben den klassischen Ansätzen werden auch jüngere wissenschaftliche Versuche
aufgezeigt, die das Forschungsfeld in übergeordnete Konzepte einzubinden versuchen. Da bis
heute keine geschlossene und allseits akzeptierte Theorie zur Freizeit existiert, liegt dem zwei-
ten Kapitel dieser Studie ein konzeptioneller Ansatz zugrunde.
Als Basis für das weitere Vorgehen werden zunächst die wesentlichen Einflussfaktoren der
Freizeitnachfrage aufgezeigt (Kapitel 2.3.1). Anschließend folgt eine kurze Darstellung der
wichtigsten Entwicklungstendenzen auf der Angebotsseite (Kapitel 2.3.2). Dabei müssen eini-
ge Einschränkungen vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle Ver-
änderungen von Angebot und Nachfrage im Detail illustriert werden. Vielmehr konzentrieren
sich die Ausführungen auf die wesentlichen, dem Untersuchungsgegenstand angemessenen
Faktoren. Des Weiteren müssen die spezifischen Entwicklungen in den neuen Bundesländern
außer Acht gelassen werden.
In Kapitel 2.4 werden die Veränderungen von Angebot und Nachfrage in ihren Auswirkungen
auf den Raum beleuchtet. Nach einer kurzen Darstellung der wesentlichen Entwicklungen,
denen Freizeitstandorte im Allgemeinen unterliegen, wird der Fokus auf die Innenstadt gerich-
tet. Abschließend folgt die Vorstellung der aus dem konzeptionellen Teil abgeleiteten Thesen
und Untersuchungsfragen (Kapitel 2.5), die im empirischen Teil der Arbeit überprüft werden.
Im dritten Kapitel wird die Stadt Pforzheim zunächst anhand der relevanten statistischen Daten
und Merkmalen makroanalytisch skizziert (Kapitel 3.1), bevor der Untersuchungsraum, die
Pforzheimer Innenstadt, vorgestellt wird (Kapitel 3.2).
Das vierte Kapitel stellt den empirischen, mikroanalytischen Teil der Arbeit dar. Die der Em-
pirie zugrundeliegenden Hypothesen werden anhand einer Bürgerbefragung (Kapitel 4.2) und
durch Gespräche mit verschiedenen Akteuren der Pforzheimer Innenstadt (Kapitel 4.3) über-
prüft.
Basierend auf den Untersuchungsergebnissen werden die Daten im fünften Kapitel reflektiert
(Kapitel 5.1), um abschließend Handlungsempfehlungen abzuleiten (Kapitel 5.2).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
5
2. Konzeptioneller Teil der Arbeit
2.1 Abgrenzungen von Freizeit und Freizeitaktivitäten
Freizeit ist ein außerordentlich vielschichtiges Gebilde, dem sowohl wirtschaftliche und politi-
sche als auch gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung zukommt. Aufgrund unterschiedli-
cher wissenschaftstheoretischer Positionen mit abweichenden Zielsetzungen und verschieden-
en methodischen Verfahrensweisen existiert bis heute keine einheitliche Definition. Hinzu
kommt, dass der Begriff umgangssprachlich weit verbreitet ist und sowohl zeitliche als auch
inhaltliche Aspekte in sich vereinigt. WACHENFELD (1987, 11) gliedert die Freizeitdefinitio-
nen in drei Kategorien:
· quantitative/ negative Freizeitdefinitionen,
· kritisch-emanzipatorische Freizeitdefinitionen,
· qualitative/ positive Freizeitdefinitionen.
Quantitative/ negative Definitionen beschreiben das Phänomen Freizeit als zeitliches Rest-
quantum, das dem Individuum nach der formellen Arbeitszeit zur freien Verfügung steht, und
beschränken es somit auf die zeitliche Dimension (GERHARD 1998, 11). Bei einer genaueren
Betrachtung wird jedoch deutlich, dass es im individuellen Zeitbudget zwischen Arbeitszeit
und Freizeit weitere Zeitabschnitte gibt, die sich nicht eindeutig einer der beiden Kategorien
zuschreiben lassen. Die Zuordnung von sozialen Verpflichtungen, physiologischen Grundbe-
dürfnissen, politischem und familiärem Engagement bleibt beispielsweise unklar, obwohl diese
durchschnittlich acht bis zehn Stunden des täglichen Zeitbudgets in Anspruch nehmen. Die
stringente Trennung zwischen Arbeit und Freizeit wird daher als unzulänglich erachtet, um das
Gesamtphänomen in seiner komplexen Struktur erfassen zu können (TOKARSKI, SCHMITZ-
SCHERZER 1985, 228).
Zudem durchlief die Freizeit einen Bedeutungswandel, in dessen Verlauf die ehemals auf Er-
holung und Regeneration ausgerichtete Freizeit der Fünfziger- und Sechzigerjahre einem akti-
ven und erlebnisorientierten Freizeitverständnis wich. Freizeit ist nicht mehr die Zeit, in der
man von etwas frei ist, sondern in der man für etwas frei ist. In diesem Sinne sind arbeitsfreie
Zeit und Freizeit nicht mehr dasselbe. Erstere wird zunehmend durch neue, von der eigent-
lichen Arbeitszeit unabhängigen Arbeitsformen (Hausarbeit, soziale Verpflichtungen) gefüllt.
Freizeit wird dagegen als Eigenzeit verstanden, die losgelöst von äußeren Zwängen zur freien
Verfügung steht. Die kritisch-emanzipatorischen Ansätze versuchen daher Zeitstrukturen zu
ermitteln, die über die Dualität Arbeitszeit und Freizeit hinausgehen (KARST 1987, 64). Je
nach dem vorhandenen Grad an freier Verfügbarkeit über Zeit und entsprechender Wahl-,
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit unterteilt OPASCHOWSKI (1976, 107) die Gesamt-
lebenszeit in drei Zeitabschnitte:
Konzeptioneller Teil der Arbeit
6
· Determinationszeit: Zeit, in der das Individuum in der Ausübung einer Tätigkeit zeitlich,
räumlich und inhaltlich festgelegt ist,
· Obligationszeit: Zeit, in der sich das Individuum aus beruflichen, familiären, sozialen
oder gesellschaftlichen Gründen einer Tätigkeit verpflichtet fühlt (Arbeit im Haushalt,
private Erledigungen, gemeinnützige Tätigkeiten, soziale Verpflichtungen),
· Dispositionszeit: Zeit, in der das Individuum über selbst- und mitbestimmbare Zeitab-
schnitte verfügt.
Je nach individuell-subjektiver Bedeutung können Arbeit und Freizeit in allen drei Zeitab-
schnitten liegen (SCHÄFLEIN 1994, 9). Diese subjektive Komponente hat in den qualitativen/
positiven Definitionsansätzen der jüngeren Freizeitforschung an Bedeutung gewonnen. Sie
setzen Freizeit mit einem subjektiv wahrgenommenen Bewusstseinszustand gleich, der von
persönlichen Motivationen, Einstellungen und Erlebniswelten abhängt. In diesem Sinne gleicht
die Freizeit nicht mehr einer zeitlichen Restkategorie, sondern einem subjektiven Lebensgefühl
und einem individuellen Weg zur Selbstverwirklichung (GERHARD 1998, 13). Jeder Mensch
entscheidet selbst, welche Aktivitäten er den jeweiligen Zeitkategorien zuordnet. Aus wissen-
schaftlicher Sicht erweisen sich diese Definitionsansätze jedoch als problematisch, da sich
Operationalisierungsschwierigkeiten ergeben (SCHÄFLEIN 1994, 9ff).
Abb. 1: Beliebtheit von Freizeittätigkeiten 1999
Quelle: Prozentuale Häufigkeiten der Nennungen ,,gerne" und ,,besonders gerne". 31.106 Befragte über
vierzehn Jahren. Verändert nach DGF (2000, o.S.) auf Basis der Verbraucheranalysen 2000
9,0%
27,9%
32,3%
33,9%
34,1%
40,4%
41,1%
52,7%
54,8%
56,8%
70,3%
73,1%
76,2%
87,3%
90,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Internet
Sportveranstaltungen
Theater/Oper/Konzerte
Kino
Fortbildung
Sport treiben
Ausgehen (Kneipe/Bar/Disko)
Bücher lesen
Rad fahren
Auto fahren
Freunde treffen
Tageszeitung lesen
Essen gehen
Fernsehen
Musik hören
Konzeptioneller Teil der Arbeit
7
Vor diesem Hintergrund gibt es auch für den Begriff ,,Freizeitaktivität" keine einheitliche De-
finition. Allerdings haben sich im freizeitwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Konsens
im Laufe der Zeit Listen von Freizeittätigkeiten herausgebildet (AGRICOLA 2001, 141). In
der Literatur wird meist zwischen häuslichen und außerhäuslichen Freizeitaktivitäten unter-
schieden. Empirische Studien belegen, dass häusliche Aktivitäten wie ,,Musik hören" oder
,,fernsehen" insgesamt zu den beliebtesten Freizeittätigkeiten zählen (Abbildung 1). Zu den
bevorzugten außerhäuslichen Freizeitaktivitäten gehören ,,gut essen gehen", ,,mit Freunden
zusammen sein", ,,Auto fahren" und ,,ausgehen". Sozialwissenschaftliche Studien darauf hin,
dass in Zukunft aktive, außerhäusliche Freizeitaktivitäten gefragter sein werden (OPA-
SCHOWSKI 2000c, 30).
Um eine sinnvolle wissenschaftliche Operationalisierung zu erhalten, werden die vielfältigen
Freizeitaktivitäten in dieser Arbeit in Anlehnung an GIEGLER (1982, 185f) zu übergeordneten
Freizeitdimensionen gruppiert. Jede Dimension übt wichtige Funktionen für den Einzelnen und
die Gesellschaft aus. Durch diesen Ansatz wird die Freizeit nicht in zahllose, unverbunden
nebeneinanderstehende Aktivitäten aufgelöst, sondern kann funktional in die gesellschaftlichen
Bedingungen und Erfordernisse eingebettet werden. Zudem können die den Freizeitaktivitäten
zugrundeliegenden individuell-subjektiven Faktoren besser analysiert werden (AGRICOLA
2001, 141).
Abb. 2: Freizeitdimensionen
Quelle: Verändert nach GIEGLER (1982, 186ff)
Zwischen den einzelnen Dimensionen bestehen zahlreiche Wechselwirkungen. Viele Freizeit-
aktivitäten können mehreren Bereichen zugeordnet werden. Die Erlebnisfunktion wirkt bei-
spielsweise in alle anderen Freizeitdimensionen hinein. Mit der zunehmenden Kommerzialisie-
rung der Freizeit weist auch die Konsumfunktion zahlreiche Verknüpfungspunkte zu anderen
Dimensionen auf. Freizeit und Konsum sind ohnehin kaum mehr voneinander zu trennen:
,,Viele Freizeitaktivitäten sind Konsum, viele Freizeittätigkeiten beruhen auf Konsumgütern,
viele sind mit Konsum verknüpft (...) Freizeit ist Konsumzeit." (AGRICOLA 2001, 190).
Kommunikation,
Geselligkeit
Sport, Bewegung,
Fitness
Erholung,
Entspannung
Unterhaltung,
Entertainment
Konsum
Bildung,
Information
Erlebnis
Soziales
Engagement
Kultur
Konzeptioneller Teil der Arbeit
8
2.2 Freizeittheoretische Erklärungsansätze
2.2.1 Determinationskonzepte und arbeitspolare Ansätze
Zu den klassischen freizeittheoretischen Ansätzen gehören die ,,Determinationskonzepte" und
die ,,arbeitspolaren Ansätze". Determinationskonzepte versuchen das Freizeitverhalten durch
verschiedene soziodemographische und andere Variablen zu erklären. Die relative Bedeutung
der einzelnen Faktoren und ihre Interdependenzen finden jedoch keine Berücksichtigung. Frei-
zeitwünsche und -motivationen werden ausgeklammert (SCHÄFLEIN 1994, 11f).
Arbeitspolare Ansätze beruhen auf der Analyse des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit,
beschränken das strukturelle Beziehungsgefüge jedoch auf die Einflüsse, welche die Arbeit auf
die Freizeit ausübt. Sie gehen demnach vom ,,Primat der Arbeit" aus und sind nicht mehr
zeitgemäß (KOCH 1992, 26f).
Aufgrund der genannten Unzulänglichkeiten wird Freizeit in der jüngeren wissenschaftlichen
Diskussion mit übergeordneten sozialen Konzepten in Verbindung gebracht (SCHÄFLEIN
1994, 13ff). Von diesen werden im Folgenden drei vorgestellt:
· Freizeit als Aspekt der Lebensqualität,
· der Wertewandel,
· Lebens- und Freizeitstile.
2.2.2 Freizeit als Aspekt der Lebensqualität
Der Begriff Lebensqualität gewinnt in der jüngeren freizeitpolitischen Diskussion an Bedeu-
tung. Lebensqualität wurde in der Vergangenheit überwiegend über die Versorgung mit Gütern
und Dienstleistungen gemessen. Da diese aufgrund des hohen materiellen Lebensstandards in
Deutschland weitgehend gewährleistet ist und teilweise sogar Übersättigungstendenzen besteh-
en, wird Lebensqualität inzwischen vermehrt über das subjektive Wohlbefinden und die Be-
friedigung immaterieller Bedürfnisse gemessen. Den Faktoren Zeitverwendung, Zeiteinteilung
und Freizeit kommt dabei eine gewichtige Rolle zu (SCHÄFLEIN 1994, 22f).
Auch in der Stadtentwicklungspolitik findet der Aspekt der Lebensqualität zunehmende Be-
rücksichtigung. SPEER (1990, 107ff) unterscheidet zwischen ,,Lebensqualität als Rahmen-
bedingung" und ,,Lebensqualität als Attraktivierung". Als Rahmenbedingungen der Lebens-
qualität einer Stadt gelten Umweltqualität, Wohnumfeld, Versorgung und Tagesfreizeit. Kultur
und Bildung sowie Sport und Naherholung sind Faktoren der Attraktivierung einer Stadt und
können den genannten Freizeitdimensionen zugeordnet werden. Die Freizeitangebote einer
Stadt sind somit wichtige Attribute für die Lebensqualität der Einwohner und die städtische
Attraktivität.
Konzeptioneller Teil der Arbeit
9
2.2.3 Der Wertewandel als Erklärung für die Veränderungen im
Freizeitbereich
Die Veränderungen in den Freizeitverhaltensweisen der Menschen haben entscheidende Be-
rührungspunkte mit der Herausbildung neuer Wertorientierungen in der Gesellschaft (AGRI-
COLA 2001, 151).
Werte werden in der Literatur unterschiedlich definiert. Sie gelten als ,,konsistente Systeme
von Einstellungen mit normativer Verbindlichkeit" (JÜRGENS 1998, 85) und als ,,innere Füh-
rungsgrößen des menschlichen Tuns oder Lassens" (KLAGES 1985, 9). Als übergeordnete
Verhaltensleitlinien haben Werte eine Steuerungs- und Orientierungsfunktion inne. Aus ihnen
lassen sich situations- und objektbezogene Bedürfnisse, Einstellungen und konkrete Hand-
lungen ableiten (WISWEDE 1990, 16). Da Werte auch diejenigen Bedürfnisse steuern, die zur
Freizeitgestaltung führen, können sie als Erklärungsgrößen für die Veränderungen im Freizeit-
verhalten herangezogen werden (HENNINGS 2000, 55).
Nach Ansicht vieler Autoren findet in den westlichen Industriegesellschaften ein Wertewandel
statt, der ,,Veränderungen von Werten und Wertebeziehungen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums" beschreibt (OPASCHOWSKI 1986, 347). Die Auffassungen zu den Veränderung-
en im Wertesystem sind unterschiedlich. Es besteht beispielsweise Dissens darüber, ob sie eine
lineare Werteänderung implizieren oder ob sie in einer Werteprioritätenverschiebung begrün-
det sind (INGLEHART 1977, NOELLE-NEUMANN 1978, KLAGES 1985, DIGEL 1986).
KLAGES (1985, 17ff) datiert den einsetzenden Wertewandelschub auf die Mitte der Sech-
zigerjahre. Er stützt die These, dass der Wertewandel eine Verschiebung von Werten auf zwei
oder mehr getrennten Dimensionen beschreibt. Da in verschiedenen Bereichen gleichsam
Werteverlust, Wertesubstitution und Entwertung auftreten können, entstehen je nach Lebens-
umständen, Lebensalter und äußeren Gegebenheiten individuelle Kombinationen der für wich-
tig gehaltenen Werte. Zentraler Aspekt des Wertewandelprozesses ist der Abbau von individu-
ellen und gesellschaftlichen ,,Pflicht- und Akzeptanzwerten" (wie Disziplin, Gehorsam,
Leistung, Ordnung, Fügsamkeit, Enthaltsamkeit) zugunsten einer Expansion von neuen Wert-
haltungen. Zu diesen ,,Selbstentfaltungswerten" gehören (HENNINGS 2000, 56):
· Werthaltungen des Individualismus (wie Kreativität, Spontaneität, Selbsterfüllung, Un-
gebundenheit, Eigenständigkeit),
· Werthaltungen des Hedonismus (wie Genuss, Abenteuer, Spannung, Abwechslung, Aus-
leben emotionaler Bedürfnisse),
· Werthaltungen einer individualistischen Gesellschaftskritik (wie Emanzipation, Gleich-
behandlung, Partizipation und Autonomie).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
10
Obwohl es immer einen gewissen Trend in Richtung der Selbstentfaltungswerte gibt, ist der
Wertewandel von Schwankungen geprägt (KLAGES 1985, 14). Die sich daraus ergebende
Vielfalt von individuellen Wertekombinationen äußert sich in der Pluralisierung der Lebens-
stile und Lebenslagen (WISWEDE 1990, 14).
Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass die Verschiebungen in den Wertemustern genera-
tionenspezifische Intensitätsunterschiede aufweisen. Die Jugend, wesentlicher Träger des Wer-
tewandels, tendiert zu hedonistischen und freizeitorientierten Verhaltensweisen. Traditionelle
Pflicht- und Akzeptanzwerte sind dagegen für ältere Menschen von weitaus höherer Bedeu-
tung (KLAGES 1998, 703). Der Wertewandel besteht darin, dass die jüngere Generation mit
ihren gewandelten Lebensauffassungen nach und nach die ältere Generation ablöst (OPA-
SCHOWSKI 1993, 18).
Auch räumlich sind Unterschiede in der Intensität der Werteverschiebungen zu erkennen. Die
städtische Gesellschaft gilt als ,,Motor des Wertewandels" (SCHULZ ZUR WIESCH 1988,
46). Hedonistische, konsum- und freizeitorientierte Lebensentwürfe zeigen sich am deutlich-
sten in Städten (SCHÄFERS 1998, 12).
2.2.4 Lebens- und Freizeitstile
Seit den Achtzigerjahren werden die klassischen freizeittheoretischen Ansätze durch das
Konzept der Lebensstilanalyse verdrängt. Freizeit wird inzwischen weitgehend als Stilphäno-
men aufgefasst (MÜLLER-SCHNEIDER 1998, 223).
Diese theoretische Neuorientierung ist eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen
der letzten fünfzig Jahre. Der Wertepluralismus resultierte in Zusammenhang mit dem techno-
logischen Fortschritt und der Zunahme von Wohlstand und Mobilität in einem Individuali-
sierungsschub, der die Menschen aus ihren bisherigen Bindungen gelöst hat (SCHÄFLEIN
1994, 57). Dabei wurde ein Prozess der Diversifizierung von Lebenslagen in Gang gesetzt, der
unter der These der ,,Pluralisierung der Lebensstile" subsumiert wird (ZAPF, W. et al 1987,
16ff, WISWEDE 1990, 37, SPELLERBERG 1996, 54).
Auch für den Lebensstil-Begriff gibt es keine einheitliche Definition. ZAPF, W. et al (1987,
15) definieren Lebensstil als ,,relativ stabiles Muster der Organisation des Alltags im Rahmen
gegebener Lebenslagen, verfügbarer Ressourcen und getroffener Lebensplanung". TOKAR-
SKI (1989, 21) bezeichnet den Begriff als Umschreibung dafür, wie ein Individuum ,,in einer
ganz bestimmten, typischen Art und Weise sein Leben führt sowie organisiert, sich dadurch
gleichzeitig sozial definiert und von anderen abgrenzt."
Während früher vorwiegend auf soziostrukturelle Segmentierungsmodelle wie Klassen oder
Milieus zurückgegriffen wurde, mit denen Verhaltensweisen anhand einer überschaubaren
Konzeptioneller Teil der Arbeit
11
Anzahl von Variablen (Einkommen, Alter, Bildung) erklärt wurden, beschreibt Lebensstil Ver-
haltensweisen ,,quer zu den sozioökonomischen Differenzierungen nach sozialer Schicht und
Stellung im Beruf" (ZAPF, K. 1989, 467).
Auf Basis der weitgehend gewährleisteten materiellen Absicherung sind viele Menschen nicht
mehr aus einer ökonomischen Zwangslage heraus an eine bestimmte gesellschaftliche Grup-
pierung gebunden. Sie verfügen über die Mittel, ihren Lebensstil frei zu wählen (STRASDAS
1994, 33f). Trotz gleicher Einkommensverhältnisse, ähnlicher Alters- und Bildungsgruppen-
zugehörigkeit können dabei verschiedenartige Lebensstile entstehen, die auf bestimmten
Denkweisen, Interessen und Wertvorstellungen beruhen. Signalisiert werden Lebensstile durch
,,feine Unterschiede" (BOURDIEU 1999) wie Ernährung, Kleidung oder häusliche Einrich-
tung (OPASCHOWSKI 1995, 47).
Speziell die Bereiche Freizeit und Konsum dienen als Orientierungshilfe zur Gestaltung des
eigenen Lebensstils, da sie Aktivitäten in einem relativ frei bestimmbaren Lebensbereich
umfassen, der sich als Mittel zur Abgrenzung gegenüber anderen Gruppierungen besonders
eignet. Infolge dieser Entwicklung haben sich die Freizeit- und Konsumverhaltensweisen der
Menschen stark ausdifferenziert.
Mit der Etablierung moderner Lebensstile wurden die traditionellen Segmentierungsmodelle
als unzureichend erachtet, um die gesellschaftlichen Veränderungen differenziert erklären zu
können (SCHMITZ und KÖLTZER 1996, 89). Ehemals gültige Kriterien zur Erklärung von
Verhaltensdispositionen mussten um komplexere Variablencluster ergänzt werden. Freizeitver-
haltensweisen werden daher auf der übergeordneten Ebene der Freizeitstile betrachtet
(SCHÄFLEIN 1994, 18f). Unter Freizeitstil versteht man ,,die bewusste und unbewusste Ge-
staltung des Freizeitverhaltens im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des Einzelnen"
(AGRICOLA 2001, 144). Weil die Freizeitorientierung in den letzten dreißig Jahren be-
trächtlich zugenommen hat, werden sich Freizeit- und Lebensstil immer ähnlicher. Beide
Begriffe werden inzwischen weitgehend synonym verwendet: ,,Freizeittätigkeiten stellen den
Orientierungs- und Handlungskern moderner Lebensstile dar" (LÜDTKE 1995, 40).
Die wesentliche Problematik besteht in der eindeutigen Identifizierung von Freizeitstilen und
in ihrer praktischen Anwendung (KOCH 1992, 27). Die empirische Erfassung ist aufgrund der
Vielfalt der einzubeziehenden Variablen und den sich daraus ergebenden Operationalisierungs-
schwierigkeiten sehr aufwendig (AGRICOLA 2001, 156). Die Lebensstil-Analysen, auf die
inzwischen zurückgegriffen werden kann, sind kaum vergleichbar.
Ein Lebensstilkonzept stammt von OPASCHOWSKI (1995, 68ff). Er unterscheidet acht
verschiedene Freizeit-Konsumententypen mit jeweils unterschiedlichen Lebens- und
Freizeitstilen, die spezifische Grundeinstellungen in der Bevölkerung repräsentieren sollen.
Neben Freizeit- und Konsumverhaltensweisen bezieht er soziodemographische und
sozioökonomische Variablen ein. Eine eindeutige Abgrenzung der verschiedenen Typen ist
jedoch nicht möglich, in der Realität sind eher Mischtypen zu erwarten. In Kapitel 2.3.1 wird
näher auf einige Konsumtypen eingegangen.
Konzeptioneller Teil der Arbeit
12
Tab. 1: Freizeitkonsumenten: Typologie und prozentuale Anteile an der Bevölkerung ab
vierzehn Jahren
Der Anpassungskonsument (12 Prozent)
Überwiegend 14 bis 19jährige. Geldausgeben ist ihnen wichtiger als Geldverdienen. Konsumwelt und
Konsumwunsch gehören für sie zusammen.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: mit Freunden zusammen sein, Disko besuchen, Sport treiben, bei Sport-
veranstaltungen zuschauen, Musik hören, Einkaufsbummel.
Der Geltungskonsument (12 Prozent)
Überwiegend Singles/ Ledige unter 40 Jahren, vor allem weibliche Angestellte. Konsumgüter werden
zur Schau getragen; Lust auf Konsum, wenn es sein muss aus Frust.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: mit dem Auto herumfahren, Essen gehen, ins Kino gehen, Musik hören,
Einkaufsbummel.
Der Erlebniskonsument (12 Prozent)
Überwiegend Männer unter 40 Jahren, vor allem Ledige und Geschiedene. Sie konsumieren in Superla-
tiven. Konsum ist mit persönlicher Herausforderung verbunden.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: Reisen, Trendsport, in die Kneipe gehen, mit dem Auto umherfahren.
Der Anspruchskonsument (12 Prozent)
Überwiegend leitende Angestellte und Beamte, auch mittleres Management. Konsum mit Kultur und
Lebensstil, Konsum mit Qualität und Anspruchsniveau.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: Reisen, Lesen, Entspannen, exklusive Sportarten, Besuche von Oper,
Theater-, Konzerten.
Der Kulturkonsument (9 Prozent)
Überwiegend Frauen über 40 Jahren mit mittlerer und höherer Bildung. Aufbruch zu neuen Hilfsmitteln
zum schönen Leben.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: sich weiterbilden, Studienreisen, Besuche von Museen, Kunstgalerien,
Oper, Theater, Konzerte, Bücher lesen.
Der Versorgungskonsument (17 Prozent)
Überwiegend Hausfrauen, vor allem untere und mittlere Schicht. Konsum ist Arbeit, ,,Normalverbrau-
cher für den täglichen Bedarf."
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: Handarbeiten, Gartenarbeit, Illustrierten lesen, in Ruhe Kaffee trinken,
Besuche haben.
Der Sparkonsument (24 Prozent)
Überwiegend Rentner, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Studenten. Konsumeinschränkung, Preisbe-
wusstsein als Selbstbewusstsein.
Bevorzugte Freizeitaktivitäten: Wandern, Heimwerken, Fahrrad fahren, Fernsehen, Radio hören, Lesen,
Sport treiben, in die Kirche gehen.
Quelle: OPASCHOWSKI (1987, 34ff)
Konzeptioneller Teil der Arbeit
13
2.3 Einflussfaktoren auf Freizeitaktivitäten und Freizeit-
angebote
2.3.1 Einflussfaktoren der Freizeitnachfrage
Zu den Einflussfaktoren, die auf die Freizeitnachfrage einwirken und die sich maßgeblich für
den Bedeutungsgewinn der Freizeit in den letzten Jahrzehnten verantwortlich zeichnen, gehö-
ren ökonomische und soziodemographische Entwicklungen, Veränderungen im Wertesystem,
Umstrukturierungen in der Arbeitswelt und Neuverteilungen der Zeitbudgets (SCHÄFLEIN
1994, 41f). Nicht alle Einflussgrößen der Freizeitnachfrage sind direkt quantifizierbar. Subjek-
tive Komponenten wie Einstellungen, Bedürfnisse und Werte sind mit kognitiven Prozessen
verbunden und vom Einzelnen sowie von dessen spezifischem Umfeld abhängig (AGRICOLA
2001, 148).
2.3.1.1 Veränderungen in der Arbeitswelt
Der Bedeutungsgewinn der Freizeit hängt eng mit den Veränderungen in der Arbeitswelt
zusammen. In der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg war das Leben in erster
Linie durch Arbeit bestimmt. Gearbeitet wurde sechs Tage beziehungsweise 48 Stunden die
Woche. Freizeit war Erholungszeit von der Arbeit und für die Arbeit. Dies änderte sich erst ab
den Siebzigerjahren. Durch den Übergang zur fünftägigen Arbeitswoche und die Zunahme der
frei disponiblen Zeit konnte die Freizeit, speziell an Wochenenden, für aktive und außerhäus-
liche Freizeittätigkeiten genutzt werden (WACHENFELD 1987, 37).
Als wesentliche Ursache für die Zunahme der frei disponiblen Zeit kann die beträchtliche Ab-
nahme der durchschnittlich geleisteten Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit angeführt wer-
den (Tabelle 2 und 3). Die Wochenarbeitszeit verringerte sich zwischen 1950 und 2000 um
mehr als elf Stunden auf 36,7 Stunden. Die Anzahl der tariflich festgesetzten Jahresurlaubstage
erhöhte sich dagegen von 9 Tage auf 30 Tage. Mit der Wochenarbeitszeit ist auch die effektiv
geleistete Jahresarbeitszeit seit 1960 um knapp ein Drittel auf 1.540 Stunden zurückgegangen.
Durch den späteren Eintritt in das Berufsleben (längere Ausbildungszeiten) und den früheren
Austritt (Vorruhestandsregelungen) hat sich auch die Gesamtlebensarbeitszeit deutlich redu-
ziert (DGF 2000, o.S.).
Neben dem Rückgang der Arbeitszeit sind insbesondere auch Arbeitszeitflexibilisierungen für
den Freizeitbereich bedeutsam. Anfang der Neunzigerjahre wurden erweiterte Spielräume für
Wochenend- und Feiertagsarbeit geschaffen. Die Tagesarbeitszeiten wurden durch Gleitzeit-,
Teilzeitregelungen und flexible Schichtarbeitsmodelle entzerrt (SCHÄFLEIN 1994, 42f). Im
Jahr 2000 hatten rund 18,6 Mio. Menschen, mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen, flexible
Arbeitszeiten (STATIST. BUNDESAMT 2000b, 12).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
14
Tab. 2: Entwicklung der durchschnittlichen tariflichen Arbeitszeit
Jahr
Arbeitstage pro
Jahr
Freie Tage pro
Jahr
Arbeitstage pro
Woche
Arbeitsstunden
pro Woche
Urlaubstage pro
Jahr
1950 279 86 6 48,0 9
1970 238 127 5 42,0 21
1996 198 167 5 37,3 30
Quelle: DGF (2000, o. S.)
Tab. 3: Entwicklung der Lebensarbeitszeit 1900 bis 1990 (in Jahren)
Berufsjahrgang
Dauer bis Berufseintritt
Dauer Ruhestand
Lebensarbeitszeit
1900
14,2 4,8 43,8
1959
14,2 11,4 45,8
1990
19,4 16,8 40,6
Quelle: DGF (2000, o.S.)
Die Umstrukturierung der Arbeitszeiten hatte massive Konsequenzen für die persönliche Frei-
zeitgestaltung. Insgesamt bedingt sie eine zunehmende Individualisierung der Freizeittätig-
keiten und Zeitbudgets, wodurch ein hoher Aufwand an Zeitmanagement erforderlich wird.
Nachteilig wirkt sich dies speziell auf Freizeitaktivitäten aus, die Gruppen ausüben (Vereine,
Freunde, Familie), da diese einen hohen zeitlichen Koordinationsaufwand beanspruchen. Des
Weiteren bedingen die Veränderungen der Arbeitszeiten eine Neustrukturierung der Zeiten
von Angebot und Nachfrage. Für den Freizeitbereich ergibt sich eine deutliche Streuung der
ehemals gebündelten Nachfrage auf die Abendstunden und Wochenenden (KOCH 1992, 44).
Freizeitanbieter müssen diesem Umstand mit veränderten Öffnungszeiten Rechnung tragen,
beispielhaft kann die Einführung des Ladenschlussgesetzes 1992 genannt werden.
2.3.1.2 Entwicklung von Einkommen und Freizeitausgaben
Materielle Ressourcen sind von großer Bedeutung für die Nutzung der Freizeit, da sie die
ökonomischen Budgets für Freizeitaktivitäten bereitstellen. Die Einkommenshöhe von Indivi-
duen und Haushalten steht in enger Wechselwirkung zu der Höhe der Freizeitausgaben (VES-
TER 1988, 14).
Nach der Phase des Wiederaufbaus der Bundesrepublik setzte Mitte der Fünfzigerjahre eine
historisch beispiellose Steigerung der Wirtschaftsleistung und des Lebensstandards ein. Die
enorme Zunahme der materiellen Ressourcen lässt sich anhand einiger Indikatoren veran-
schaulichen. Die Privatvermögen verfünffachten sich zwischen 1950 und 1980. Die Sparquote
stieg von 9 Prozent 1950 auf rund 13 Prozent 1989 (KLOCKE 1993, 24). Die Wohneigen-
tumsquote beträgt im alten Bundesgebiet inzwischen 41 Prozent, 1960 lag der Vergleichswert
Konzeptioneller Teil der Arbeit
15
bei nur 6 Prozent (SCHÄFERS 1998, 247). Die verfügbaren Haushaltseinkommen erhöhten
sich zwischen 1962 und 1997 preis- und inflationsbereinigt um fast den fünffachen Wert
(Tabelle 4).
Tab. 4: Entwicklung des Haushaltsnettoeinkommens 1962/63 bis 1997 in Westdeutschland
Jahr
1962/ 63
1969
1980
1990
1997
Haushaltsnettoeinkommen
(nominal je Monat) in Euro
458 708 1.616 1.841 2.204
Index (1962=100)
100 155 353 402 481
Quelle: GEISSLER (1996, 58), nach Datenreport (1994, 183), STATIST. BUNDESAMT (2000a, 583)
Inzwischen reichen für große Bevölkerungsteile die zur Verfügung stehenden monetären
Mittel über die zur Befriedigung existenzieller Bedürfnisse notwendigen hinaus. Ausgaben für
Grundbedürfnisse machen heute einen deutlich geringeren Teil des Gesamtbudgets aus, wäh-
rend der Anteil für nicht-lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen steigt (STATIST.
BUNDESAMT 2000a, 117ff).
Ähnlich einem ,,Fahrstuhleffekt" partizipieren alle Bevölkerungsgruppen an dem Wohlstands-
schub (KLOCKE 1993, 24f). Die ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ist
jedoch in etwa konstant geblieben. Dies wird in der These der ,,Zwei-Drittel-Gesellschaft"
diskutiert (SPELLERBERG 1996, 28f). Bestimmte einkommensschwache Randgruppen wie
Sozialhilfeempfänger oder Asylanten können nur eingeschränkt am Freizeitkonsum partizipie-
ren: ,,Die Einkommensschere öffnet sich auch im Freizeitbereich" (AGRICOLA 2001, 179).
Dass die Bereitschaft gegeben ist, bei steigenden Einkommen entsprechend mehr in die Frei-
zeit zu investieren, zeigt die Entwicklung der Freizeitausgaben, die vom Statistischen Bundes-
amt in regelmäßigen Abständen nach Haushaltstypen ermittelt werden. Insgesamt lässt sich für
alle Haushaltstypen ein beträchtlicher Anstieg der Freizeitausgaben feststellen, der in den
Siebziger- und Achtzigerjahren besonders stark ausgeprägt war (SCHÄFLEIN 1994, 49). Seit
Mitte der Neunziger Jahren stagnieren die Freizeitausgaben auf hohem Niveau.
Bei einem durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt ist der Budgetposten Freizeit und Urlaub
zwischen 1965 und 1997 in etwa um den achtfachen Wert gestiegen und ist damit fast doppelt
so stark angewachsen wie die Gesamtausgaben für den privaten Verbrauch. 1997 wurden im
Durchschnitt 434 Euro pro Monat nur für Freizeitgüter ausgegeben. Der Anteil an den gesam-
ten privaten Verbrauchsausgaben stieg im selben Zeitraum von 10,7 Prozent auf 19,7 Prozent.
Auch bei den anderen Haushaltstypen sind die Freizeitaufwendungen überproportional ange-
stiegen (STATIST. BUNDESAMT 2000a, 152).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
16
Abb. 3: Jährliche Aufwendungen eines durchschnittlichen Vierpersonenhaushaltes für Frei-
zeitgüter und Urlaub 1965 bis 1997. Anteile am ausgabefähigen Einkommen
Quelle: STATIST. BUNDESAMT (2000a, 151), DGF (2000, o.S.)
2.3.1.3 Veränderungen im Bildungswesen
Unterschiede im Freizeitverhalten lassen sich neben altersspezifischen Merkmalen am deut-
lichsten auf verschiedene Bildungsniveaus zurückführen (HERLYN 1994, 165).
Der Bildungsstand der Bevölkerung hat sich, gemessen an den allgemeinbildenden Schulab-
schlüssen, in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Seit der Bildungsexpansion der Sech-
ziger- und Siebzigerjahre ist der Anteil der Schüler in höheren Schulen nahezu kontinuierlich
angestiegen (KLOCKE 1993, 55ff). Die schulische Ausbildung junger Menschen hat sich
nachhaltig verbessert. Während der Anteil der Schulabgänger mit (Fach-) Hochschulreife zwi-
schen 1960 und 2000 von 16 Prozent auf über 21 Prozent gestiegen ist, hat sich der Anteil der
Abgänger mit Haupt- und Volksschulabschluss von 73 Prozent auf rund 50 Prozent verringert
(STATIST. BUNDESAMT 2000a, 59). Die Studienanfängerquoten an Universitäten und
Fachhochschulen erhöhten sich zwischen 1960 und 1995 von 8 Prozent auf rund 35 Prozent
(GEISSLER 2000, 41). Waren im Jahr 2000 insgesamt knapp 1,7 Mio. über 15jährige ohne
Schulabschluss, so lag der Vergleichswert 1991 noch bei über 2,3 Mio. (STATIST. BUNDES-
AMT 2000b, 58).
Abbildung 4 gibt eine Übersicht über die Beliebtheit ausgewählter Freizeittätigkeiten, getrennt
nach Abiturienten und Hauptschulabgängern. Es zeigt sich, dass mit zunehmendem Bildungs-
576
822
1.736
2.491
2.853
3.908
4.853
5.197
5.115
9,5%
10,7%
12,9%
13,6%
14,2%
13,8%
14,8%
14,3%
14,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1997
2000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Freizeitausgaben in
Anteil der Freizeitausgaben am ausgabefähigen Einkommen in %
Konzeptioneller Teil der Arbeit
17
niveau Freizeitaktivitäten der klassischen Hochkultur stärker wahrgenommen werden. Zudem
nimmt die Neigung zu, die Freizeit außerhalb des Hauses zu verbringen und am öffentlichen
Leben teilzunehmen. ,,Essen gehen" oder ,,spazieren gehen" sind Freizeittätigkeiten, die ins-
besondere bei Befragten mit Abitur und Hochschulabschluss beliebt sind. Passiv-rezeptive
Tätigkeiten wie ,,zu Hause bleiben", ,,fernsehen" und ,,faulenzen" werden dagegen eher von
Personen mit niedrigem Schulabschluss bevorzugt (HERLYN 1994, 165). Mit der Zunahme
der höheren Schulabschlüssen werden außerhäusliche und erlebnisorientierte Freizeittätigkei-
ten weiter an Bedeutung gewinnen.
Abb. 4: Freizeittätigkeiten nach Bildungsabschlüssen 1993 in Prozent
Quelle: Prozentuale Häufigkeiten der Nennungen ,,diese Freizeittätigkeit übe ich oft aus".
Verändert nach MÜLLER-SCHNEIDER (1998, 227) auf Basis des Wohlfahrtssurveys 1993
2.3.1.4 Entwicklungen in der Bevölkerungs- und Altersstruktur
Demographische Veränderungen bestimmen nicht nur die absolute Zahl der Nachfrager nach
Freizeitgütern, sondern bewirken auch Verschiebungen zwischen den einzelnen Nachfrage-
gruppierungen (KOCH 1992, 42f).
Die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik Deutschland stagniert seit der Wiedervereinigung
bei circa 82 Mio. Einwohnern. Die quantitative Nachfrage nach Freizeitgütern bleibt somit
ungefähr konstant. Wichtiger als die absolute Bevölkerungsentwicklung sind Veränderungen
17,4%
39,7%
22,1%
10,8%
10,7%
19,5%
53,1%
67,8%
44,3%
31,0%
59,0%
24,4%
36,9%
40,7%
48,2%
79,2%
35,6%
34,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
In Kneipe gehen
Essen gehen
Sportveranstaltungen
Theater, Konzerte
Weiterbildung, Kurse
Sport treiben
Bücher lesen
Fernsehen, Video
Nichts tun, faulenzen
Abitur
Hauptschule
Konzeptioneller Teil der Arbeit
18
in der Altersstruktur. Sie erlauben Rückschlüsse über gegenwärtige und zukünftige Trends in
der Freizeitnachfrage und bilden die Basis für zukunftsorientierte Freizeitplanungen.
Durch den demographischen Wandel unserer Gesellschaft hat sich die Altersstruktur weiter
zugunsten der älteren Bevölkerung verschoben. Rückläufige Geburtenraten, das Vorrücken
von geburtenschwachen Jahrgängen und die Erhöhung der Lebenserwartung haben dazu ge-
führt, dass der Prozess der demographischen Alterung in Deutschland so weit fortgeschritten
ist wie in nur wenigen Ländern der Welt (STEINMANN 1994, 9). Im Jahr 2000 lebten im
alten Bundesgebiet 11,5 Mio. Personen über 65 Jahren, gegenüber 1970 ist diese Bevöl-
kerungsgruppe um mehr als 32 Prozent angestiegen. Der Anteil der unter 20jährigen ist
dagegen um 23 Prozent auf 10,6 Mio. gefallen (Tabelle 5).
Tab. 5: Entwicklung der Bevölkerungs- und Altersstruktur 1970 bis 2000 (Westdeutschland)
Gesamtbevölkerung in
tausend
Zu- bzw.
Abnahme in %
Anteil der Altersklasse an der
Gesamtbevölkerung in %
1970
2000
1970 bis 2000
1970
2000
bis 15 Jahre
13.755 10.592 -23,0
22,6
15,8
15 bis 20 Jahre
4.081 3.593 -12,0
6,7
5,4
20 bis 30 Jahre
7.279 7.504 +3,1
11,9
11,2
30 bis 40 Jahre
8.898 10.979 +23,4
14,6
16,4
40 bis 50 Jahre
7.923 9.534 +20,3
13,0
14,2
50 bis 65 Jahre
10.316 13.289 +28,8
16,9
19,8
65 Jahre u. älter
8.674 11.479 +32,3
14,2
17,1
Gesamt
60.926
66.972
+9,9
100,0
100,0
Quelle: STATIST. BUNDESAMT (2000b, 45)
Durch die Verschiebungen in der Altersstruktur modifizieren sich die Ansprüche und Erwar-
tungen an Freizeitangebote. Öffentliche und private Freizeitanbieter müssen sich auf die struk-
turell veränderten Nachfragegruppen einstellen (MÜLLER-SCHNEIDER 1998, 227f). Vor
allem die Freizeit-Ansprüche der über 50jährigen ,,jungen Alten" werden an Gewicht gewin-
nen. Sie sind zumeist gesund, verfügen über freie finanzielle Mittel, ausgeprägte Freizeit- und
Konsumerfahrungen und wollen ihr Leben aktiv genießen (WEINBERG 1992, 14). Jugend-
liche gelten in ihrer Freizeitgestaltung als aktions- und erlebnisorientiert und bevorzugen
außerhäusliche Freizeitaktivitäten. Da sie Kaufentscheidungen in hohem Maße beeinflussen,
wird ihnen eine Leitbildrolle in Bezug auf Konsum- und Freizeitverhalten zugesprochen
(SZALLIES 1990, 49).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
19
2.3.1.5 Veränderungen in den Haushalts- und Familienstrukturen
Mit den Veränderungen in der Altersstruktur und den Verschiebungen in den Wertemustern
hat sich auch die Struktur der privaten Haushalte geändert. Die Anzahl der Privathaushalte ist
im alten Bundesgebiet allein zwischen 1957 und 2000 um 70 Prozent auf 31,1 Mio. Haushalte
angestiegen und damit deutlich stärker gewachsen als die Bevölkerungszahl. Die unproportio-
nale Entwicklung von Haushalten und Bevölkerung ist auf eine deutliche Verkleinerung der
durchschnittlichen Haushaltsgröße zurückzuführen. Während im früheren Bundesgebiet 1957
noch 2,94 Personen in einem Haushalt lebten, waren es 2000 nur noch 2,17 Personen.
Der Trend geht zum Ein- und Zweipersonenhaushalt. Zwischen 1957 und 2000 nahm die An-
zahl der Singlehaushalte von 3,4 Mio. auf 11,4 Mio. zu, ihr Anteil an allen Haushalten stieg
von 18,3 Prozent auf 36,5 Prozent. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der Zweipersonenhaus-
halte von 4,9 Mio. auf 10,3 Mio. Haushalte. In 33,1 Prozent aller Haushalte leben heute zwei
Personen, 1957 lag der entsprechende Wert bei 26,7 Prozent. Die Anzahl der Haushalte mit
fünf und mehr Personen nahm dagegen von 2,8 Mio. auf 1,5 Mio. ab, ihr Anteil an allen
Haushalten minderte sich von 15,3 Prozent 1957 auf 4,7 Prozent 2000 (STATIST. BUNDES-
AMT 2000b, 60).
Abb. 5: Entwicklung der privaten Haushalte und der durchschnittlichen Haushaltsgröße in
Westdeutschland
Quelle: STATIST. BUNDESAMT (2000b, 61)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1957
1967
1979
1986
1993
2000
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Einpersonenhaushalte
Mehrpersonenhaushalte
Personen je Haushalt
Konzeptioneller Teil der Arbeit
20
Die Veränderungen der Haushaltsstrukturen implizieren in Zusammenhang mit den rück-
läufigen Heirats- und Kinderquoten, den steigenden Scheidungszahlen und dem sinkenden An-
teil an Familien mit Kindern, dass sich die Formen und Bedürfnisse des Zusammenlebens
geändert haben. Die ,,Normalfamilie" befindet sich eindeutig auf dem Rückzug, der Wunsch
nach persönlicher Unabhängigkeit und individueller Entfaltung steigt. Ehe und Familie ver-
lieren weiter zugunsten der Freizeit an Attraktivität. SCHÄFERS (1998, 130) spricht in diesem
Zusammenhang von einem ,,Verlust von familienzentrierter Geselligkeit an die Freizeitin-
dustrie".
Mit den Veränderungen in den Haushaltsstrukturen ergibt sich ein Rückgang an häuslichen
und familiären Freizeitaktivitäten. Singlehaushalte (Jugendliche, junge Erwachsene, allein-
stehende ältere Menschen) haben insbesondere in Städten an Zahl und Bedeutung gewonnen
(LICHTENBERGER 1998, 249). Junge Singles bevorzugen konsum-, kontakt- und kommuni-
kationsorientierte Freizeittätigkeiten. Ältere Alleinlebende tendieren dagegen eher zu häus-
lichen Freizeittätigkeiten mit der Gefahr der sozialen Isolierung (SCHÄFLEIN 1994, 47).
2.3.1.6 Entwicklung der Motorisierung und Freizeitmobilität
Die Entwicklungen in den Bereichen Einkommen, Bildung und Freizeit stärkte in den letzten
Jahrzehnten das Bedürfnis nach außerhäuslichen Freizeitaktivitäten. Dies lässt sich anhand der
zunehmenden Beliebtheit von Tages- und Wochenendausflügen nachweisen. Wie stark Frei-
zeitangebote außer Haus nachgefragt werden können, hängt jedoch insbesondere von dem
räumlichen Mobilitätsvermögen des Einzelnen ab.
Schon lange lässt sich eine deutliche Zunahme der Motorisierung beobachten. Zwischen 1960
und 2000 hat sich der Bestand an Personenkraftwagen in Deutschland von rund 4,8 Mio. auf
42,8 Mio. PKW erhöht. Kamen 1960 auf tausend Einwohner 81 PKW, so lag der entsprechen-
de Wert 2000 bei 523 PKW. Inzwischen sind mehr als 50 Prozent aller Deutschen und rund
drei Viertel aller privaten Haushalte im Besitz eines Fahrzeugs (STATIST. BUNDESAMT
2000a, 350). Für das Jahr 2010 prognostiziert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
einen Bestand von circa 50 Mio. Fahrzeugen. Auf tausend Einwohner entfallen dann 595 PKW
(HEINTZE 1997, 38).
Tab. 6: Personenkraftwagen je tausend Einwohner (PKW-Dichte) 1960 und 2000
Jahr
1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
PKW-Dichte
81 228 296 333 385 494 523
Index (1960=100)
100 228 365 411 475 610 646
Quelle: KRAFTFAHRT-BUNDESAMT (2000, 75/116)
Konzeptioneller Teil der Arbeit
21
Die Zunahme von Motorisierung und Freizeitmobilität hat tiefgreifende Einflüsse auf das
Freizeitverhalten und die Freizeitorganisation der Menschen. Räumliche Distanzen werden un-
bedeutender und die Aktionsräume vergrößern sich. Damit erhöht sich auch die Zahl der Frei-
zeitangebote, die in der Freizeit potenziell aufgesucht werden können (AGRICOLA 2001,
226). Freizeitaktivitäten sind nicht mehr auf die Angebote vor Ort beschränkt. Speziell in den
Blockfreizeiten (Feiertage, Wochenenden) und im Urlaub können Freizeiteinrichtungen an
weit vom Wohnort entfernt gelegenen Standorten aufgesucht werden. Bereits seit den Acht-
zigerjahren entfällt mehr als die Hälfte der Gesamtfahrleistung eines PKW auf Freizeitzwecke
(AGRICOLA 2001, 210).
2.3.1.7 Freizeitorientierung
In Zusammenhang mit den Einkommens- und Arbeitszeitentwicklungen sowie den gewandel-
ten Wertemustern hat sich das Bewusstsein für Freizeit grundlegend verändert. Empirische
Studien bestätigen eine zunehmende Freizeitorientierung in der Bevölkerung, die alle Alters-
gruppen berührt, aber insbesondere bei den eigentlichen Trägern des Wertewandels stark aus-
geprägt ist: bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Paaren sowie bei Hochgebildeten und
Singles (OPASCHOWSKI 1995, 20).
Studien des Statistischen Bundesamtes zur Ermittlung der individuellen Wichtigkeit von
Arbeit und Freizeit zeigen, dass 1998 rund 31 Prozent aller Erwerbstätigen in Westdeutschland
der Beruf wichtiger war als die Freizeit, während umgekehrt 32 Prozent die Freizeit als wich-
tiger einschätzten. 38 Prozent empfanden beide Bereiche als gleich bedeutsam. Bezogen auf
die Beschäftigten- und Einkommensgruppen ergibt sich ein differenzierteres Bild. Bei weibli-
chen Beschäftigten ist die Freizeitorientierung stärker ausgeprägt als bei männlichen. Mit
steigendem Einkommen nimmt der Anteil der Freizeitorientierten ab (STATIST. BUNDES-
AMT 2000a, 493).
Obwohl die Freizeitorientierung in der Bevölkerung insgesamt zunimmt, kann nicht von einem
absoluten Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit zugunsten der Freizeit gesprochen werden.
1998 stufte jeder zweite Erwerbstätige die Arbeit als ,,sehr wichtig" für das individuelle
Wohlbefinden ein. Die Erwerbsarbeit hat für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
ihren hohen Stellenwert hinsichtlich der materiellen Existenzsicherung behalten, während die
Freizeit als gleichrangiger Lebensbereich respektiert wird. Im Sinne einer ,,neuen Balance
materieller und immaterieller Wertorientierungen" möchte man einerseits regelmäßige Arbeit
und gesicherte Einkommen haben, andererseits aber auch nicht auf den Lebensgenuss in der
Freizeit verzichten (OPASCHOWSKI 1994, 19).
Die Freizeitorientierung beeinflusst auch das Verhalten am Arbeitsplatz. Der Beruf wird nicht
mehr ausschließlich auf das Geldverdienen reduziert. Freizeitorientierte Ansprüche und Ideale
Konzeptioneller Teil der Arbeit
22
wie Spaß und Selbstverwirklichung finden Eintritt in die Arbeitswelt. Die ehemals getrennten
Lebensbereiche Arbeit und Freizeit nähern sich zunehmend an. Aber auch Arbeitsinhalte,
Arbeitsanforderungen und -motivationen bestimmen die Freizeitgestaltung mit. Menschen, die
monotone und stumpfsinnige Arbeiten ausführen, tendieren zu passiven Formen der Freizeit-
gestaltung (WISWEDE 1990, 28). Umgekehrt bedeutet dies, dass mit der durch den wirtschaft-
lichen Strukturwandel bedingten Zunahme der höherqualifizierten Beschäftigten aktive und
erlebnisorientierte Freizeittätigkeiten weiter an Bedeutung gewinnen. Hochqualifizierte Be-
schäftigte konzentrieren sich vor allem in städtischen Räumen und stellen hohe Ansprüche an
deren Freizeitwert und Lebensqualität (SCHULZ ZUR WIESCH 1989, 47).
Tab. 7: Stellenwert von Beruf und Freizeit in Westdeutschland 1988 und 1998 in Prozent
Beruf wichtiger
als Freizeit
Beides
gleich wichtig
Freizeit wichtiger
als Beruf
1988
1998
1988
1998
1988
1998
Insgesamt:
27
31
44
38
29
32
Männer
27 34 47 38 26 29
Frauen
26 26 38 38 36 37
Altersgruppen:
18
bis
24
Jahre 17 21 42 38 41 41
25
bis
34
Jahre 20 28 45 38 35 34
35
bis
49
Jahre 31 31 45 38 24 32
50
bis
65
Jahre 33 39 43 35 25 26
Bruttoeinkommen:
unterstes
Quintil 18 31 38 24 45 46
oberstes
Quintil 41 38 38 33 21 29
Quelle: STATIST. BUNDESAMT (2000a, 493)
2.3.1.8 Erlebnisorientierung
Die Freizeitorientierung steht in direktem Zusammenhang mit der Erlebnisorientierung des
Alltagslebens. Sie kennzeichnet das moderne Freizeitbewusstsein und bildet die Grundlage
vieler Freizeittätigkeiten: ,,Die wichtigste Funktion der Freizeit stellt heute auf individueller
Ebene die Erlebnisfunktion dar" (GERHARD 1998, 21).
In seiner Arbeit ,,Die Erlebnisgesellschaft" stellt SCHULZE (1992) die These von einer relativ
stark von innenorientierten Lebensauffassungen geprägten Erlebnisgesellschaft auf, in der für
einen wachsenden Teil der Bevölkerung ,,das Leben schlechthin zum Erlebnisprojekt gewor-
den" ist. Der erlebnisorientierte Mensch lebt nach dem Lust- und Spaßprinzip, urteilt nach
Konzeptioneller Teil der Arbeit
23
ästhetischen Gesichtspunkten und sucht in allen Lebensbereichen Abwechslung, emotionales
Erleben, Unterhaltung und Abenteuer (SCHULZE 1992, 35f).
Erlebnisse sind psychophysische Konstruktionen und Ereignisse, die sich im Innenleben der
Menschen abspielen. Sie sind subjektiv bedeutsam, lösen intensive und angenehme Empfin-
dungen aus und leisten einen Beitrag zur Lebensqualität (SCHULZE 1993, 35).
Die Erlebnisorientierung muss vor dem Hintergrund des Wertewandels und der Zunahme von
Wohlstand, Individualisierung und Wahlfreiheit gesehen werden. Die materielle Ausstattung
ist in vielen Haushalten kaum mehr zu steigern. Als Konsequenz sind in den letzten Jahrzehn-
ten neue Bedürfnisse nach sensueller Anregung und emotionalen Erlebnissen entstanden
(OPASCHOWSKI 1980, 8).
Die Erlebnisorientierung wird als eine umfassende Einstellung bezeichnet, die alle Alltags-
bereiche der Menschen beeinflusst, sich aber am deutlichsten im Freizeit- und Konsumverhal-
ten manifestiert. In der jüngeren Freizeitforschung gilt ,,Erlebnis" als Schlüsselwort. Der Frei-
zeitsektor bietet vielfältige Möglichkeiten der erlebnisorientierten Lebensgestaltung. Bereiche
wie Kultur, Sport, Spiel und Unterhaltung stellen positiv besetzte Erlebniswerte dar, auf die
man selbst in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nicht verzichten will oder kann (OPA-
SCHOWSKI 2000b, 19).
In Zusammenhang mit der Erlebnisorientierung haben sich die Einstellungen zu Gütern und
Dienstleistungen grundlegend geändert. Die Attraktivität von Produkten, Gütern, Freizeitak-
tivitäten und Freizeitstandorten wird zunehmend an dem Erlebniswert gemessen, den der
Einzelne damit verbindet (AGRICOLA 2001, 105).
So kündigt sich schon seit Jahrzehnten ein Wandel vom Versorgungs- zum Erlebniskonsum an
(SZALLIES 1990, 44ff). In der Literatur gibt es keine exakte Definition für diese Konsum-
typen, beide weisen aber jeweils spezifische Merkmale auf. Der Versorgungskonsum erfolgt
meist zweckorientiert und pflichtbewusst, reduziert sich auf Bequemlichkeit und Preis und
bezieht sich auf Güter, welche die Versorgung täglicher Grundbedürfnisse sicherstellen. Der
Kauf von Gütern des individuellen, des speziellen mittelfristigen und des gehobenen langfris-
tigen Bedarfs dient dagegen der Befriedigung von Erlebniswerten (OPASCHOWSKI 1995,
44). Der Erlebniskonsum gilt als Freizeitaktivität, weil er über die eigentliche Bedarfsdeckung
hinausgeht. Im Mittelpunkt steht nicht die Beschaffung des Gutes, sondern die Tätigkeit als
Selbstzweck, die mit Spaß, Genuss und Lebensfreude verbunden ist (JÜRGENS 1998, 83).
Bei einem Vergleich von Versorgungs- und Erlebniskonsum sind altersspezifische Unterschie-
de zu berücksichtigen (Abbildung 6). Während die älteren Bevölkerungsgruppen, geprägt von
den materiellen Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs, mehrheitlich versorgungsorientiert
konsumieren, dominiert bei jungen Menschen zwischen vierzehn und dreißig Jahren der
erlebnisorientierte Einkauf. Sie sind in der Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, wollen in
Konzeptioneller Teil der Arbeit
24
ihrer Freizeit Außergewöhnliches erleben und leisten sich Dinge, die Prestige verheißen. Für
sie wird der Erlebniswert zum entscheidenden Kaufkriterium (WISWEDE 1990, 31).
Empirischen Studien zeigen, dass zwei Erlebniskonsumenten drei Versorgungskonsumenten
gegenüberstehen (OPASCHOWSKI 2000b, 25). Wie sich die Konsummuster in Zukunft genau
entwickeln, wird durch die wirtschaftliche und politische Gesamtentwicklung maßgeblich mit-
bestimmt. Tendenziell ist jedoch mit einer weiteren Polarisierung zugunsten des Erlebniskon-
sums zu rechnen (OPASCHOWSKI 1997, 61).
Abb. 6: Konsumentenlager nach Altersgruppen in Westdeutschland in Prozent
Quelle: OPASCHOWSKI (1990, 114), Datenbasis: 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren
Beim Erlebniseinkauf steigen Ausgabenbereitschaft und Preiselastizitäten, da er als Ausdruck
des individuellen Lebensstils zu verstehen ist (FRANCK 1999, 81). Dies führt zu einer
zunehmenden Unübersichtlichkeit der Konsumverhaltensweisen. Den normierten, typisierten
Freizeitkonsumenten mit einheitlichem Verbrauchsverhalten gibt es nicht mehr. Stattdessen
werden die Konsumenten immer unberechenbarer. Sie lassen sich nur unter großem Aufwand
klaren Zielgruppen zuordnen (WISWEDE 1990, 35ff). In der Literatur wird diese Entwicklung
umschrieben als ,,Zielgruppenatomisierung" der ,,Heterokonsumenten" und als Entwicklung
von ,,Otto Normalverbraucher" zu ,,Markus Möglich" (KOCH 1992, 1).
18%
36%
50%
44%
63%
57%
79%
62%
48%
53%
36%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
65 Jahre u. älter
50 bis 64 Jahre
40 bis 49 Jahre
30 bis 39 Jahre
20 bis 29 Jahre
14 bis 19 Jahre
Erlebniskonsum
Versorgungskonsum
Konzeptioneller Teil der Arbeit
25
2.3.2 Veränderungen und Trends im Freizeitangebot
Im vorangegangenen Kapitel wurden die wesentlichen Einflussgrößen und Veränderungen der
Freizeitnachfrage analysiert. Mit den Entwicklungen in der Nachfrage hat sich auch das Frei-
zeitangebot geändert. Freizeitanbieter müssen den Veränderungen auf der Nachfrageseite
Rechnung tragen, bestimmen durch ihre Angebote aber auch die Freizeitnachfrage mit. Die
Veränderungen auf der Angebotsseite werden im Folgenden nach privaten und öffentlichen
Akteursgruppen getrennt erläutert.
2.3.2.1 Entwicklungen im privatwirtschaftlichen Freizeitangebot
Der Freizeitmarkt gehört zu den Märkten, die sich in den letzten Jahren kontinuierlich und
dynamisch entwickelt haben und die im Vergleich zu anderen Branchen weniger konjunktur-
anfällig sind.
Private Anbieter haben früh erkannt, dass Freizeit nicht mehr ausschließlich als sozialer An-
spruch zu sehen ist, sondern zu einer beachtlichen ökonomischen Größe geworden ist. Seit
einigen Jahren ist ein verstärktes Aufkommen kommerzieller Freizeitangebote zu verzeichnen.
Um sich an die variablen, ausdifferenzierten Verhaltensweisen anzupassen, müssen ständig
neuartige Angebotskonzeptionen kreiert werden. Alternativ werden vorhandene Angebote qua-
litativ aufgewertet oder durch spezielle Nischenkonzepte ergänzt (AGRICOLA 2001, 217).
Betreiber von Freizeit- und Konsumeinrichtungen sind mehr denn je gefordert, sich im Sinne
von Freizeit-Dienstleistern um die Bedürfnisse der erlebnisorientierten Konsumenten zu küm-
mern. Diese verknüpfen bestimmte Ansprüche mit den Freizeitangeboten. Sie suchen das Un-
verwechselbare, das Abweichen vom Alltäglichen, erwarten entsprechende Formen der Dienst-
leistung, des Ambientes und der Produktpräsentation und wollen Gemeinschafts- und Interak-
tionsmöglichkeiten (AGRICOLA 2001, 173).
Speziell Einzelhandel und Gastronomie müssen dem zunehmend emotional besetzten Freizeit-
verständnis Rechnung tragen. Die Rolle des Einzelhändlers als rein funktionaler Waren-
Distributor oder der Gastronomie als reiner Nahrungs-Dienstleister ist nicht mehr zeitgemäß
(FRANCK 1999, 81). Vielmehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass nicht nur Güter und
Dienstleistungen, sondern auch Erlebnisse ein interessantes wirtschaftliches Potenzial inneha-
ben. Der Einsatz von Erlebnisstrategien erlaubt eine Anpassung an die veränderten Nachfrage-
strukturen, unterstützt die Profilierung im Wettbewerb und vermittelt den Kunden einen emo-
tionalen Zusatznutzen (KROEBER-RIEL und WEINBERG 1996, 124).
Allerdings sind Erlebnisse nur begrenzt von außen planbar. Sie werden nicht als solche vom
Kunden empfangen, sondern erst in dessen Wahrnehmung zu Erlebnissen funktionalisiert.
Anbieter können also nur die Rahmenbedingungen schaffen, die den Aufenthalt zu einem
Konzeptioneller Teil der Arbeit
26
Erlebnis werden lassen. Ansatzpunkte bieten Architektur (Begrünung, räumliche Enge), Ange-
bote (Design, Vielfalt, Beratung), Atmosphäre (Ambiente, Erleben von Lebendigkeit) und
Aktionen (FREHN 1996, 317ff). Durch das Ausblenden negativer Begleitumstände wie Witte-
rung oder Kriminalität können zudem Sicherheit und Sauberkeit vermittelt werden.
Eine weitere Erlebnisstrategie ist die Thematisierung der Angebote, die in ihrer Präsentation
unter ein spezifisches Motto gestellt werden. Durch die Anreicherung des Angebotes mit Un-
terhaltung und Entertainment soll ein inszenierter Erlebnisinhalt vermittelt werden (JÜRGENS
1998, 69). Themenkomplexe wie ,,Planet Hollywood" oder ,,Hard Rock Café" haben sich
inzwischen - mit unterschiedlichem Erfolg - zu eigenständigen Marken entwickelt. Im Bereich
Einzelhandel und Gastronomie können beispielhaft die ,,Venezianischen Wochen" der Galeria
Kaufhof oder die ,,Themenhäuser" von Karstadt genannt werden (PROBST 2000, 110).
Während Freizeitangebote früher eher unsystematisch in die Angebote integriert wurden, ge-
schieht dies inzwischen sehr umfassend. Freizeiteinrichtungen, die sich lediglich auf einzelne
Angebotssegmente beschränken, sind eher die Ausnahme. Meist werden aufwendige Konsum-
und Einkaufseinrichtungen angelagert, die systematisch als ,,Kundenfänger" und ,,Frequenz-
bringer" eingesetzt werden (RÖCK 1998, 123). In multifunktionalen Freizeitgroßkomplexen
ist die Vermischung von Konsum, Freizeit und Entertainment am stärksten ausgeprägt
(FRANCK 2000, 37). Durch die räumliche Konzentration vielfältiger Freizeit-, Handels- und
Dienstleistungsnutzungen in einem homogenen, multifunktionalen Gesamtkonzept wird den
Besuchern ein stark erlebnisorientiertes Angebot offeriert, das beispielsweise durch Multiplex-
kinos, Großdiskotheken, Erlebnisgastronomien oder Sportangebote ergänzt wird (FRANCK
1999, 94).
Auch in Innenstadtlage sind freizeit- und erlebnisorientierte Großanlagen entstanden Zu den
neuen Einrichtungen gehören innenstadtintegrierte, multifunktionale ,,City-Center". Diese sind
teilweise im Rahmen von stadtentwicklungsplanerischen Programmen zur Belebung und
Sanierung der Innenstädte entstanden. Sie schließen sich in der Regel an bestehende Einkaufs-
straßen und Passagen an. Durch Faktoren wie Klimatisierung und Begrünung versucht man,
einen halböffentlichen Raum mit natürlicher Straßenatmosphäre zu schaffen und nutzt dabei
die spezifischen Vorzüge des Standortes Innenstadt (SCHÄFER 1999, 111).
2.3.2.2 Entwicklungen im kommunalen Freizeitangebot
Inzwischen reagieren auch Städte und Kommunen auf die Freizeit- und Erlebnisorientierung
und übernehmen dabei viele der privatwirtschaftlichen Vermarktungskonzepte. Stadtfeste wer-
den beispielsweise mit historischen Ereignissen verknüpft, Kulturevents und Stadtführungen
werden thematisiert.
In der Vergangenheit wurde dem Lebensbereich Freizeit hingegen wenig Gewicht beigemes-
sen. Ein ausreichendes Freizeitangebot gehört seit den Sechzigerjahren zwar zur Daseinsvor-
Konzeptioneller Teil der Arbeit
27
sorge der Kommunen, beschränkte sich jedoch auf ein Set von Flächen, das der Erholung, der
körperlichen Ertüchtigung, der Kultur und der sozialen Teilhabe diente. Dazu zählten Parks,
Grünanlagen, Sportstätten, Theater- und Kinosäle, Bürgerhäuser und Volkshochschulen
(ROMEISS-STRACKE 2000a, 76). Mit diesen Einrichtungen wurde das sozialpolitische Ziel
,,Freizeit für alle" umgesetzt, ohne aber direkt in die Freizeit des Einzelnen einzugreifen, die
als Privatangelegenheit aufgefasst wurde. Freizeitangebote sollten möglichst wenig kommer-
ziell sein, defizitäre Angebote wurden notfalls subventioniert.
Erst in den Siebzigerjahren wurden neue Konzepte der Stadtentwicklungsplanung erarbeitet,
die als fachübergreifende Gesamtentwicklungsplanungen auch den Freizeitbereich einbezogen.
Der Stadtraum wurde intensiver unter freizeitspezifischen Gesichtspunkten beurteilt und ver-
stärkt zum Gegenstand der Planung (ROMEISS-STRACKE 1988, 18). Heute existiert eine
langfristige Planung der kommunalen Freizeitentwicklung jedoch meist gar nicht oder ist nur
in Ansätzen vorhanden. Für die jeweiligen kommunalen Verwaltungsstellen, die für die Orga-
nisation der Freizeitangebote zuständig sind, gibt es in der Regel keine klare Verteilung und
Koordination, die Zuständigkeiten für Freizeitpolitik sind zersplittert. Fortgeschriebene Frei-
zeitentwicklungspläne oder eigenständige Freizeit-Ressorts sind Ausnahmen (SCHÄFLEIN
1994, 70).
Da der Freizeitbereich nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört, blieb er zu einem
wesentlichen Teil dem privaten Markt überlassen. Verbesserungen im Freizeitsektor wurden
vergleichsweise als nachrangig eingestuft. Die private Freizeit der Bürger so die lange Zeit
vorherrschende planerische Doktrin sollte möglichst im Wohnumfeld verbracht werden, in
kleinen, dezentralen Einrichtungen in der Nachbarschaft. Gelegentliche Theater-, Opern- oder
Kinobesuche sollten für Abwechslung sorgen. Der Trend im privatwirtschaftlichen Bereich,
verschiedene Freizeitaktivitäten räumlich auf einem Areal zu zentralisieren, widersprach die-
sem Verständnis (ROMEISS-STRACKE 2000a, 76f). Dies führte zu einer gewissen Hilflosig-
keit gegenüber den rein kommerziell ausgerichteten privatwirtschaftlichen Freizeit- und Erleb-
nisanbietern.
Dass sich auch Stadtplanung und politik an die Entwicklungen im Freizeitbereich anpassen
müssen, erkannten die kommunalen Entscheidungsträger erst in den Neunzigerjahren, als sich
der Freizeitbereich zu einem wichtigen weichen Standortfaktor entwickelt hatte (GRABOW et
al 1995, 221). Diese Erkenntnis führte zu einer Neuorientierung, die RÖCK (1996, 377) als
Wandel der Freizeitplanung zur ,,erlebnisorientierten Stadtplanung" umschreibt. Nicht mehr
die Freizeiteinrichtungen an sich waren entscheidend, sondern ihre Attraktivität. Auch auf
kommunaler Ebene stiegen die Investitionen in den Erlebniswert der Innenstädte.
Freizeit wird inzwischen als Instrument angesehen, mit dem die Attraktivität der Stadt als
Stand- und Wohnort von Unternehmen und gut verdienenden Arbeitnehmern verbessert wer-
den kann. Die Innenstadt fungiert dabei als eine Art ,,Aushängeschild", weil Image, Attraktivi-
tät und Qualität der Gesamtstadt in der Wahrnehmung von Außenstehenden meist ausschließ-
Konzeptioneller Teil der Arbeit
28
lich an ihr festgemacht werden. Unternehmen und Menschen wählen umso eher eine Stadt als
Stand- oder Wohnort, wenn ihre Innenstadt attraktive Freizeit- und Konsumeinrichtungen zu
bieten hat (SCHÄFER 1999, 204f). Eine unverwechselbare Innenstadt mit vielfältigen Frei-
zeit- und Erlebnisangeboten ist ein wesentliches Kriterium, mit dem sich eine Stadt im Wettbe-
werb profilieren kann.
Aufgrund dieser Erkenntnisse erfolgt die kommunale Freizeitplanung im Gegensatz zu früher
nicht mehr rein versorgungsorientiert, sondern immer öfter unter dem ,,Primat der Wirtschafts-
förderung" (RÖCK 1996, 377). Der kommunale Freizeitwert, der in den Stadtentwicklungs-
konzeptionen der Sechziger- und Siebzigerjahre noch über das Verhältnis von Einwohnern zu
Sportanlagen, Grünflächen, Kinos oder Restaurants bestimmt wurde, hat sich dabei inhaltlich
verändert und eine imageorientierte Komponente bekommen (SCHÄFLEIN 1994, 130f). Er ist
ein wesentlicher Indikator zur Ermessung der Lebensqualität und der Attraktivität eines be-
stimmten Raumes. Mit der Zunahme der Freizeitorientierung wird der Freizeitwert weiter an
Bedeutung gewinnen.
Freizeitwert kann definiert werden als die ,,Bedeutung insbesondere von geographisch oder
politisch begrenzten Gebieten für die Freizeitgestaltung aufgrund der vorhandenen Freizeit-
infrastruktur und sonstigen, die Freizeittätigkeit anregenden, ermöglichenden bzw. erleichtern-
den Gegebenheiten" (AGRICOLA 2001, 104). Als Bezugsebene kommen mehrere Raumein-
heiten in Betracht: Region, Stadt oder Innenstadt. Zu den wesentlichen Komponenten des
Freizeitwertes zählen: materielle und immaterielle Freizeitinfrastruktur, Freizeitangebote, Frei-
zeitbewusstsein und Image (Abbildung 7). Das Freizeitbewusstsein ist ein Faktor, welcher über
die rationale Wahrnehmung hinausgeht. Der Begriff impliziert eine Steigerung des individu-
ellen Wohlbefindens und der Wahlfreiheit der Freizeitverbringung. Im Freizeitbewusstsein
geht es darum, die Möglichkeiten von Freizeitangeboten wahrnehmen zu können. Dabei ist es
nicht so wichtig, ob diese auch tatsächlich genutzt werden. Vielmehr muss ein gewisses
Spektrum an Angeboten existent sein, um bei Bedarf am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
zu können. Der Freizeitwert einer Innenstadt kann deshalb weniger durch quantifizierbare
Indikatoren (wie Kinoplätze je tausend Einwohner) als durch ,,Bilder in den Köpfen der Beur-
teilenden" bestimmt werden.
Durch die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sind die Nachfragestrukturen und die
Bedürfnisse, die an die Leistungen und Angebote der Stadt gestellt werden, sehr ausdifferen-
ziert (THIEME 1994, VII). Für die Kommunen wird es zunehmend schwierig, die entsprech-
enden freizeitinfrastrukturellen Einrichtungen und Angebote bereitzustellen. Konflikte zwi-
schen verschiedenen Nutzergruppen sind unumgänglich. Es muss deshalb genau abwägt
werden, welche Nachfragebereiche von der Kommune abgedeckt werden sollen und für
welchen Bedarf eine öffentliche Trägerschaft sinnvoll ist (SCHÄFLEIN 1994, 260).
Konzeptioneller Teil der Arbeit
29
Abb. 7: Freizeitwert einer Stadt oder Region
Quelle: Verändert nach AGRICOLA (2001, 103)
Freizeitinfrastruktur
Image
Freizeitwert
Materielle
Infrastruktur
Freizeitangebote,
Freizeitanbieter
Freizeit-
bewusstsein
Außenbild
Natur, Landschaft,
Stadtgrün
Freizeitgelegenheiten
und orte (Ausstattung,
Beschaffenheit):
Wohnung, Umfeld,
Stadtteil, Stadtzentrum,
Fußgängerbereiche
Anlagen und (Frei-)
Räume:
Unterhaltung, Kultur,
Sport, Spiel, Konsum,
Erholung, Geselligkeit
Medieneinrichtungen
Verkehrswege:
Wander- und Radwege,
Erschließung, Parken,...
Freiraum für:
Eigeninitiative,
Beteiligung,
Informationsaustausch
Dienste und Produkte
für die Freizeit
Beratungsdienste,
Programmangebote,
Freizeitinformationen
Träger:
öffentlich, privat,
gemeinnützig
Bildungsangebote:
Musik-/ Kunstschulen,
Volkshochschule,
Hobbykurse,...
Identifikationsmöglich-
keiten, Heimatgefühl:
Sprache, Traditionen,
Stadt- und Siedlungs-
bild, Kulturgüter,
Sehenswürdigkeiten,...
Bekanntheit von:
materieller und
immaterieller
Freizeitinfrastruktur
Bekanntheit von Events:
Feste, Märkte, Messen,
kulturelle Ereignisse,
Ausstellungen, Sport-
veranstaltungen,...
Ruf (Image) und
Bekanntheit der
Kommune/ Region und
ihrer Freizeitangebote
außerhalb
Bekannt durch:
Flair, Events, Erlebnis,
Stil, Eindruck
Bekannt durch:
Persönlichkeiten, Ein-
richtungen, Wirtschaft,
Attraktionen,...
Bekannt aus:
Medien, Literatur, Film
Bekannt durch:
Werbung der Freizeit-
anbieter, Werbung der
Kommune, Werbege-
meinschaften,...
Konzeptioneller Teil der Arbeit
30
Zudem begrenzt die angespannte Haushaltslage die finanziellen Handlungsspielräume der
öffentlichen Körperschaften. Der Wandel von der Daseinsfürsorge zu einer auf Wirtschaftlich-
keit, Effizienz und Ergebnisorientierung ausgerichteten Stadtpolitik erfasst speziell den Frei-
zeitbereich. Zusätzliche Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nur sehr begrenzt
möglich. Dringend notwendige Investitionen in vorhandene oder neue Anlagen unterbleiben
vielerorts.
Ein weiteres Problem ist darin zu sehen, dass die kommunalen Freizeitangebote relativ un-
flexibel sind und meist nicht kostendeckend arbeiten. Private Anbieter können schneller auf
Nachfrageänderungen reagieren und selbst neue Bedürfnisakzente setzen. Ihre Angebote
zeichnen sich durch Multifunktionalität, Flexibilität und Kundenorientierung aus. Die öffent-
lichen Angebote sind vergleichsweise unattraktiv. Schnelle und flexible Reaktionen auf Nach-
frageänderungen werden oft durch langwierige politische Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozesse erschwert und verzögert (DENKEL 1991, 168).
Angesichts des zunehmenden Problemdrucks müssen Städte und Kommunen nach neuen
Regelungs- und Steuerungsformen suchen. Kommunale Freizeiteinrichtungen wie Bäder oder
kulturelle Einrichtungen werden teilweise privatisiert, um finanzielle Defizite zu vermeiden
oder zumindest zu verringern. Als weitere Alternative gelten Kooperationen mit privaten In-
vestoren im Rahmen von Public-Private-Partnerships. Mit solchen Formen soll die Flexibilität
und die Effizienz privatwirtschaftlichen Handelns genutzt werden (KOCH 1992, 242).
Mit dem wachsenden Einfluss kommerzieller Anbieter ergeben sich allerdings auch einige
Risiken. Die Freizeitausstattung wird privaten Organisationen überlassen. Kommerzielle An-
bieter werden zur bestimmenden Größe der Versorgungsqualität. Dies kann bei fehlender
öffentlicher Steuerung zu sozialen Ungerechtigkeiten führen. Anstelle von städtischen Ämtern
greifen private Akteure (Investoren, Architekten) aktiv in das gestalterische und funktionale
Gefüge der Stadt ein. Entscheidungsabläufe, die eigentlich in den Aufgabenbereich der kom-
munalen Planungsämter fallen, werden entdemokratisiert (DENKEL 1991, 167f).
Die Aufgaben im planerischen Bereich der kommunalen Freizeitausstattung bedürfen somit
einer Reorganisation. In der Literatur wird vielfach eine an langfristigen Zielen orientierte,
vernetzte Entwicklungspolitik gefordert, in welcher der Freizeitsektor als koordinierter Aufga-
benbereich institutionalisiert ist (SCHÄFLEIN 1994, 260). Damit der Freizeitsektor nicht
ausschließlich von ökonomischen Interessen geleitet wird, soll ein möglichst breites Spektrum
kommunaler Interessensgruppen (Politik, Wirtschaft, Vereine, Verbände, Kirchen, interessierte
Bürger) konzeptionell eingebunden werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832477981
- ISBN (Paperback)
- 9783838677989
- DOI
- 10.3239/9783832477981
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Stuttgart – Geo- und Biowissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- geographie stadtmarketing marketing konsum wandel
- Produktsicherheit
- Diplom.de