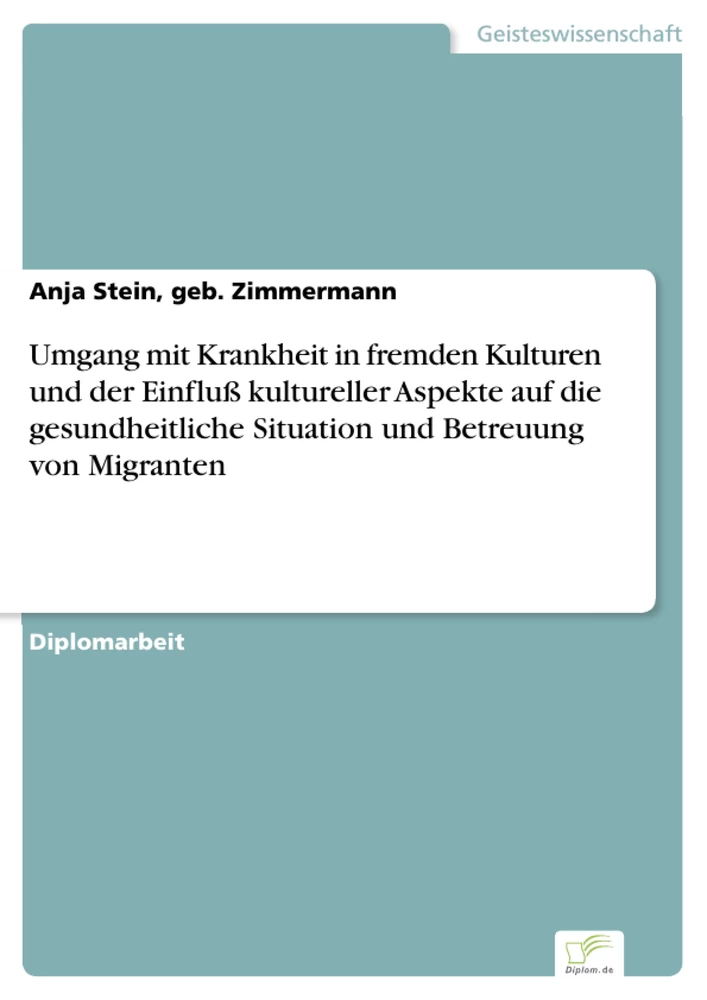Umgang mit Krankheit in fremden Kulturen und der Einfluß kultureller Aspekte auf die gesundheitliche Situation und Betreuung von Migranten
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit will Krankheit und Kultur aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Zum einen wird der Blick nach außen gerichtet auf das Krankheitsverständnis und den Umgang mit Krankheit in anderen Kulturen. Zum anderen soll der Blick nach innen klären, wie sich dieses fremde Krankheitsverständnis von Menschen anderer Kulturen auf die Situation und Betreuung von Einwanderern in unserem Gesundheitssystem auswirkt.
Im ersten Teil dieser Arbeit soll zunächst untersucht werden, ob außerhalb unseres Kulturkreises dasselbe Krankheitsverständnis herrscht oder ob dieses möglicherweise von unserem abweicht. Dabei wird der Umgang mit Krankheit und die angewandten Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit in anderen Kulturen betrachtet. Des weiteren wird beleuchtet, welche Vorstellungen von Krankheitsursachen existieren und auf welche Weise in anderen Völkern Erkrankungen geheilt werden. Hierbei soll die Auswertung ethnomedizinischer Ergebnisse behilflich sein. Das Forschungsfeld der Ethnomedizin untersucht weltweit Medizinsysteme fremder Kulturen und prüft, in welcher Weise Krankheit mit Kultur verknüpft ist. Ferner sollen im ersten Teil der Arbeit Heilerpersönlichkeiten anderer Völker und ihre Art mit auftretenden Erkrankungen umzugehen betrachtet werden.
Durch die Wanderung von einer in eine andere Gesellschaft geschieht nicht selten ein vollständiger Bruch mit dem bisherigen sozialen Umfeld. So soll im zweiten Teil dieser Arbeit zunächst geklärt werden, welche Auswirkungen der Migrationsprozess auf die körperliche und seelische Verfassung der Wandernden hat. In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Prozess der Wanderung und das Leben im Aufnahmeland ungewohnte Stresssituationen beinhalten, welche unter Umständen gesundheitsbeeinträchtigend sein können. Diese Annahme soll unter Zuhilfenahme vorliegender Studien zum Thema Gesundheit und Migration geprüft werden, des weiteren wird untersucht, in welcher Weise sich dieser Migrationsstress äußert.
Auf Grundlage der Annahme, dass sowohl Krankheitsverständnis als auch Heilmethoden in anderen Kulturen von dem hiesigen Verständnis und Behandlungssystem abweichen, interessiert als nächstes die Frage, wie Angehörige anderer Kulturen, welche aus verschiedenen Gründen nach Deutschland einwandern, mit dem Medizinsystem unserer Kultur zurechtkommen. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, in welchen Bereichen Probleme auftreten können, wie diese sich […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Migration und Gesundheit in Deutschland
Migration
Zwischen 1954 und 1999 wanderten insgesamt 30,4 Mio. Menschen nach Deutschland zu. Die Mehrzahl von ihnen (29,7 Mio.) waren Ausländer, davon wiederum 2,8 Mio. Asylbewerber und Flüchtlinge. Etliche kehrten früher oder später in ihr Heimatland zurück, viele von ihnen blieben jedoch. Seit Mitte der fünfziger Jahre verzeichnet die Bundesrepublik einen Zuwachs von neun Millionen Einwohnern allein durch Einwanderer aus der ganzen Welt. Ein nennenswerter Teil von ihnen bekommt auch in Deutschland Kinder, was einen erheblichen Beitrag zur Bevölkerungsentwicklung leistet[1].
Abbildung 3: Ausländische Bevölkerung in der BRD nach Staatsangehörigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: Statistisches Bundesamt (Stand 2002)
Der Anteil an ausländischen Mitmenschen beträgt heute kurz nach der Jahrtausendwende in der BRD rund 7,3 Mio. Das entspricht einem Anteil von ca. 8,9 % der in Deutschland lebenden Menschen[2]. Bis zum Antritt der rot-grünen Bundesregierung im Herbst 1998 beschrieb sich die BRD jedoch selbst nicht als Einwanderungsland und verleugnete damit jegliche gesellschaftliche Realität. Große Zuströme von Menschen fremder Kulturen und Sprachen schaffen dessen ungeachtet eine veränderte Gesamtsituation, auf die politisch reagiert werden muß. Anderenfalls entstehen daraus Probleme, die mit der Zeit akut werden können. Dies betrifft z.B. die Zunahme von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gegen ausländische Mitbürger aus Angst vor Fremdem, aber auch die Fragen der sozialen Sicherung. Weiterhin gewinnen bestimmte rechtliche Fragen an Bedeutung. Von besonderer Relevanz für diese Arbeit ist der Zusammenhang zwischen dem Aufenthaltsstatus von Migranten und den Möglichkeiten der Inanspruchnahme medizinischer Versorgung, denn diese variieren je nach rechtlicher Position beträchtlich. Im Folgenden wird jedoch ersichtlich werden, daß sich andererseits der aufenthaltsrechtliche Status und die damit verbundenen Probleme und Unsicherheiten umgekehrt auch auf den gesundheitsbezogenen Bedarf der Migranten auswirken.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde dargestellt, daß außerhalb unseres Landes und unserer Kultur oftmals völlig andere Auffassungen von Krankheit und Gesundheit vorherrschen, und auch, daß es verschiedenartige Vorstellungen gibt, wie bestimmte Erkrankungen entstehen und wie diese geheilt werden können. Es existiert des weiteren eine große Bandbreite von Heilertypen, welche mit unterschiedlichsten therapeutischen Mitteln Krankheiten zu heilen im Stande sind. Andere Kulturen beinhalten andere Lebensweisen, ein medizinisches System entwickelt sich aus der Kultur heraus und mit ihr. Das Auftreten einer Erkrankung, der Umgang mit selbiger, ihre Heilung oder Prävention hängt immer auch mit Kultur zusammen, der Auffassung von der Welt und vom Leben, mit der Lebensweise an sich und nicht zuletzt mit der sozioökonomischen Situation des Einzelnen.
Was passiert jedoch, wenn Menschen sich entschließen oder gezwungen sind, ihre Heimat, ihr kulturelles Umfeld, ihr System zu verlassen und in der Fremde auf ein völlig anderes System treffen? Wie ergeht es diesen Menschen beispielsweise in unserem medizinischen System?
Das zweite Kapitel will einerseits den Zusammenhang herstellen zwischen dem Prozeß der Migration sowie seine Auswirkungen auf den einzelnen Migranten und auf dessen Gesundheit, andererseits soll dargestellt werden, auf welche Schwierigkeiten und Hindernisse Migranten aus anderen kulturellen Systemen bei der Inanspruchnahme medizinischer Dienste in Deutschland treffen können.
Bevor jedoch das Gefüge Migration und Gesundheit detailliert betrachtet wird, soll hier zunächst der Begriff Migration genauer beleuchtet werden.
1.1.1. Definition des Migrationsbegriffs
„Migration ist der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. eine andere Region von einzelnen oder mehreren Menschen.“ (Treibel 1999, S.21)
Migration kann aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Jede einzelne Wissenschaft definiert den Begriff anders. Die oben aufgeführte Definition erscheint jedoch im Rahmen dieser Arbeit die angemessenste, denn sie setzt Wanderungsmotive verschiedenster Art voraus, seien sie erwerbs-, familien-, politisch oder biografisch bedingt. Sie geht von einem relativ dauerhaften Aufenthalt in der neuen Region oder Gesellschaft aus und schließt mehr oder weniger kurzfristige Aufenthalte zu touristischen Zwecken aus. Allerdings ist an dieser Stelle nur der grenzüberschreitende Wechsel in eine andere Nation bzw. Gesellschaft von Belang. Es soll hier also um die Situation von Menschen ausländischer Herkunft gehen, die dauerhaft in Deutschland leben. Die Gründe, die zur Migration führten, sind dabei eher nebensächlich.
1.1.2. Die rechtliche Position von Migranten im deutschen Gesundheitssystem
Ein legaler Aufenthaltsstatus macht die Inanspruchnahme einer umfassenden gesundheitlichen Versorgung durch Migranten in Deutschland überhaupt erst möglich. Es existieren zahlreiche Varianten des Aufenthaltsstatus, die jeweils die Möglichkeit der medizinischen Versorgung unterschiedlich regeln.
Ausländische Studierende und Touristen verfügen in der Regel über eine Auslandskrankenversicherung, die im Krankheitsfall die entstehenden Kosten abdeckt oder sie bezahlen die Behandlungsgebühr aus eigener Tasche. Gemeldete ausländische Arbeitnehmer sind wie deutsche Arbeitnehmer auch gesetzlich krankenversichert und haben somit ein Anrecht auf umfassende medizinische Versorgung. Dies sind in Deutschland ca. 2 Mio. Ausländer, welche sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind[3]. Im Zuge der Familienversicherung trifft das auch auf sämtliche, nichterwerbstätige Familienangehörige zu.
Das Recht auf medizinische Versorgung ist jedoch nur die eine Seite. Der Aufenthaltsstatus spielt auch insofern eine Rolle, als daß er an gewisse Bedingungen gebunden ist, beispielweise an einen Arbeitsplatz oder an den Status des Ehepartners. Ist die Erfüllung einer dieser entscheidenden Bedingungen nicht mehr gewährleistet, kann sich der Aufenthaltsstatus sofort ändern. Oft droht die Ausweisung, so daß die Erhaltung seines Aufenthaltsstatus den Migranten oft unter enormen Druck setzt.
Um sich als Nicht-Deutscher legal in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten, benötigt man generell eine Aufenthaltsgenehmigung. Diese kann in verschiedenen Varianten erteilt werden: Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltsbewilligung und Aufenthaltsbefugnis. Des weiteren gibt es den Status der Duldung[4]. Lediglich der Besitz einer Aufenthaltsberechtigung bietet einen weitgehenden Ausweisungsschutz. Diesen Aufenthaltsstatus haben aber nur rund elf Prozent aller Migranten[5]. Die meisten besitzen lediglich eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Dies beinhaltet die Gefahr der Ausweisung, sobald die entsprechende Person, beispielsweise durch Verlust des Arbeitsplatzes, auf Leistungen des BSHG angewiesen ist. So kann nach § 46 des Ausländergesetzes ausgewiesen werden, wer für sich, seine Familienangehörigen, die sich im Bundesgebiet aufhalten und denen er allgemein zum Unterhalt verpflichtet ist, oder für Personen in seinem Haushalt, für die er Unterhalt tragen oder aufgrund einer Zusage zu tragen hat, Sozialhilfe in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen muß[6].
Da nun die Mehrzahl der Migranten aufgrund ihrer brisanten ökonomischen Situation im Heimatland emigriert, mit der Hoffnung diese Situation im Aufnahmeland verbessern zu können, ist davon auszugehen, daß ein großer Teil der Migranten auf eine Arbeitsstelle zur Sicherung des Lebensunterhaltes angewiesen ist. Dahingehend ist mit dem Verlust des Arbeitsplatzes auch immer eine drohende Ausweisung verbunden. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe ist zwar generell vorhanden, tritt aber wie bei deutschen Arbeitnehmern erst nach einer Mindestversicherungsdauer ein[7]. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt bei Ausländern in Deutschland rund 20 Prozent[8].
Aufgrund dieser politisch-rechtlichen Unsicherheiten, der eingeschränkten Bleiberechte, wie z.B. der Nachweis einer Arbeitsstelle für eine Aufenthaltsgenehmigung kann eine Erkrankung zur Bedrohung werden, in dem sie den aufenthaltsrechtlichen Status gefährdet und damit die mit der Migration verbundenen Ziele einer Person oder einer Familie bzw. deren Existenz in Frage stellt. Im umgekehrten Fall stellt jedoch auch der permanente Druck, den Arbeitsplatz zu erhalten und damit den Aufenthalt zu sichern eine ständige Bedrohung für die Gesundheit dar[9]. Zum einen stellt erwiesenermaßen dauerhafter psychischer (und durch schwere Arbeitsbedingungen auch physischer) Streß eine enorme Belastung für den Menschen und seine Gesundheit dar (s.u.). Zum anderen können sich kleinere Erkrankungen manifestieren und akut werden, die aus Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, nicht auskuriert werden[10].
In der Bundesrepublik leben derzeit etwa 1,2 Mio. Menschen, welche aus verschiedenen Gründen gezwungen waren, ihr Heimatland zu verlassen. Für diese Flüchtlinge bzw. Asylbewerber besteht in Bezug auf die Gesundheitsversorgung nur die Gewährleistung der notwendigen medizinischen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen[11]. In Anbetracht der Tatsache, daß diese Menschen unter großem Druck und sicherlich auch begleitet von großer Angst und Unsicherheit ohne jegliche Vorbereitung ihr Land verlassen mußten, dürften die im Nachfolgenden dargestellten Auswirkungen der Migration in besonderem Maße auf diese Migrantengruppe zutreffen[12]. Sie bedürfen unter diesen Umständen besonderer medizinischer und vor allem psychologischer Betreuung, welche ihnen aufgrund der Gesetzeslage verwehrt ist. Nach ihrer Ankunft sind sie dann oftmals menschenunwürdigen Unterbringungsbedingungen ausgesetzt. Zusätzlich fehlt nahezu jegliche soziale Unterstützung und die Möglichkeit wieder abgeschoben zu werden, ist als ständige Bedrohung präsent. Die Flüchtlinge, welche sich durch ihre eigene Sprachlosigkeit selbst schon in einer randständigen Position in der neuen Gesellschaft befinden, werden durch die Ausgrenzungspraktiken der staatlichen Behörden noch zusätzlich marginalisiert[13]. Im Hinblick darauf, daß diese Faktoren die Entstehung von Krankheit stark begünstigen dürften, ist diese Regelung als besonders fatal einzuschätzen.
Noch gravierender stellt sich die Lage derer dar, welche ohne jegliche rechtliche Grundlage nach Deutschland einreisen. Es wird angenommen, daß sich ca. eine halbe bis eine ganze Million von illegalen Flüchtlingen in Deutschland aufhalten[14]. Diese Menschen, die hier aufgrund der Bedrohung für ihr Leib und Leben Zuflucht suchen, werden hier, weil sie keine Papiere besitzen, in die Illegalität gedrängt; kriminalisiert. Illegalität bedeutet völlige Rechtlosigkeit gegenüber Behörden, Arbeitgebern und Vermietern; bedeutet ständige Angst, entdeckt zu werden. Es bedeutet weiterhin, auftretenden Erkrankungen gegenüber mehr oder weniger ausgeliefert zu sein. Illegale Flüchtlinge haben zwar bei Krankheit einen Anspruch auf medizinische Notfallversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz §4, im Falle einer Erkrankung wird der Besuch beim Arzt jedoch so lange wie möglich vermieden und auf Laienhilfe aus dem Angehörigen- und Bekanntenkreis zurückgegriffen, denn das Aufsuchen von fachkundiger Hilfe birgt die Gefahr der Entdeckung[15]. Auf diese Weise ist für die Gruppe Menschen, welche sie in Folge der körperlichen und seelischen Strapazen am meisten bedarf, professionelle Gesundheitsfürsorge am wenigsten erreichbar.
Auswirkungen von Migration
Wie oben erwähnt, wirkt sich neben einem gesicherten bzw. unsicheren Aufenthaltsstatus auch die veränderte soziale und sozioökonomische Situation auf das allgemeine Befinden aus. Durch große Veränderungen entsteht oft Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Spannungen, Überforderung und daraus resultierend eine Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens. Um dies anschaulich zu machen, soll im Folgenden das Leben vor und nach der Migration exemplarisch an der türkischen, ländlichen Gesellschaft dargestellt werden. Da es sich bei den türkischen Migranten mit einem Anteil von 28% aller Einwanderer um die größte Migrantengruppe in Deutschland handelt, soll die Thematik Migration und Gesundheit insgesamt an dieser Gruppe illustriert werden. Die weitgehende Beschränkung auf eine bestimmte Migrantengruppe soll ebenfalls, angesichts der Vielzahl von in Deutschland zu findenden Nationalitäten, allzu verallgemeinernde Aussagen vermeiden.
Das Leben vor der Migration in der türkischen, ländlichen Gesellschaft
Die türkische Gesellschaft ist sehr heterogen und komplex zusammengesetzt. Es existiert eine Vielfalt von ethnischen Gruppen, kulturellen und religiösen Mischungen, es gibt große Differenzen zwischen den sozialen Klassen sowie der Entwicklung in der Stadt und auf dem Land. Hauptsächlich unterscheidet man türkische Nomaden, die Bewohner der anatolischen Region, im mittleren Osten ansässige Moslems und die Bewohner der mediterranen Region[16].
Resultierend aus dieser Vielfalt ist es schwierig, allgemeine Aussagen über den türkischen Menschen oder die türkische Familie zu treffen. Laut einer Studie von KÜRSAT-AHLERS und AHLERS stammen jedoch rund zwei Drittel der türkischen Migranten in der BRD aus anatolischen Dörfern[17]. Ihre Einstellungen und Verhaltensweisen sind somit vom ländlich-dörflichen Familienleben geprägt.
Die Merkmale des ländlichen türkischen Familienlebens werden ausführlich von KÜHRSAT-AHLERS[18] oder bei LEYER in ihrer Studie über türkische Arbeitsmigranten beschrieben. Hier sollen jedoch nur kurz die wichtigsten Merkmale dargestellt werden.
In der ländliche Region Anatoliens überwiegt die Form der Kernfamilie, d.h. zwei Generationen leben in einem Haushalt, häufig auch noch eine dritte. Intensive wechselseitige Unterstützung im Verwandtschaftsnetz ist die Regel. Die Gemeinschaft wird bestimmt durch eine patrilineare, patrilokale[19] Familienstruktur und –orientierung. Das familiäre und soziale Leben kennzeichnet sich durch Geschlechtertrennung und Altershierarchie, das Wertesystem durch Ehre und Moral[20]. Die Rolle eines Mensche in der Gemeinschaft wird bestimmt durch seine Geburt, sein Geschlecht und die Generation[21].
Das Leben eines Dorfbewohners erfährt ein hohes Maß an sozialer Kontrolle. Streng überwacht wird das Einhalten der Vorschriften im Umgang mit dem eigenen Körper, im Verhalten und bei inner- und außerfamiliären Beziehungen. Dies betrifft besonders den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Mädchen und Frauen müssen sich bedecken, ein Kopftuch tragen und sich von Männern fernhalten. In deren Gegenwart ist Schüchternheit und Zurückhaltung vorgeschrieben. Dies hat nicht zwangsläufig die absolute Unterdrückung der Frau zur Folge. Die Frauen treffen sich oft untereinander, arbeiten gemeinsam, erzählen und tauschen Informationen aus – in der Gesellschaft anderer Frauen können sie sich vollkommen frei bewegen. Das bedingungslose Befolgen der Regeln ist jedoch für das Bestehen der Gemeinschaft unerläßlich[22].
[...]
[1] Vgl. Bade/Münz 2000, S. 23ff.
[2] Vgl. Ausländerpolitik und Ausländerrecht 2000, S. 12.
[3] Vgl. Ausländerpolitik und Ausländerrecht 2000. S. 22.
[4] Siehe AuslG.
[5] Statistisches Bundesamt, Stand 04.2003
[6] Brisant kann die Lage auch für nichterwerbstätige Ehepartner werden. So fällt z.B. bei einer Scheidung der besondere Ausweisungsschutz des ausländischen Ehepartners eines Deutschen oder eines Ausländers mit Aufenthaltsberechtigung nach §48 Abs. 3+4 AuslG weg. Kann der Betroffene in seiner Situation dann nicht selbst für sich sorgen, wird er ausgewiesen.
[7] Vgl. Ausländerpolitik und Ausländerrecht 2000, S. 49.
[8] ebd. S. 23
[9] Vgl. David u.a. 1997, S. 374.
[10] ebd., sowie Lajios 1993, S.76
[11] Vgl. AsylbLG §§ 4+6.
[12] Vgl. Rauchfuss 2001, S. 3.
[13] ebd. S.4
[14] Vgl. Rauchfuss 2001, S. 5.
[15] ebd.; Rauchfuss beschreibt ausführlicher in seinem Artikel, welchen Bedingungen illegale Flüchtlinge auf ihrer Wanderung ausgesetzt sind und welche spezifischen Erkrankungen infolge dessen auftreten können.
[16] Vgl. Kâgitçibaşi 1982, S.1.
[17] Vgl. Kürsat-Ahlers/Ahlers 1985, S. 11. Ein Großteil dieser Menschen wanderte vor der endgültigen Migration nach Deutschland zunächst in die türkischen Großstädte ab. Grund hierfür ist nicht die Faszination der Städte, sondern die miserablen Lebensbedingungen in den anatolischen Dörfern. Vielerorts zwingen Hungersnöte und der Verlust des eigenen Landes die Menschen dazu nach Alternativen zu suchen, die vielerorts in der Abwanderung in die Städte liegen. Zwischen 1961 und 1973 kamen fast 650.000 türkische Arbeitskräfte nach Deutschland durch eine aktive Anwerbepolitik der BRD. Diese Menschen nahmen dieses Werbeangebot aus einer ökonomischen Notwendigkeit heraus und in der Hoffnung auf ein besseres Leben an. (S. 12f.)
[18] Vgl. Kürsat-Ahlers 1985a+b.
[19] Patrilokal bedeutet, wenn ein Mädchen heiratet, zieht sie in das Dorf und die Familie ihres Mannes.
[20] Näheres zu den im Mittelpunkt des ländlichen Wertesystems stehenden Elementen Ehre und Moral findet sich bei Kürsat-Ahers/Ahlers 1985, S. 15f.
[21] Vgl. Leyer 1991, S. 24f. sowie Kührsat-Ahlers/Ahlers 1985, S. 14f.
[22] Vgl. Leyer 1991, S. 28ff. Interessantes zur Stellung der Frau im Islam, speziell in der Türkei findet sich bei Kührsat-Ahlers/Ahlers 1985, S. 16-26 sowie Kührsat-Ahlers 1985a+b S. 89-123.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832479695
- ISBN (Paperback)
- 9783838679693
- DOI
- 10.3239/9783832479695
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Mai)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- ethnomedizin gesundheit migration ausländer medizin
- Produktsicherheit
- Diplom.de