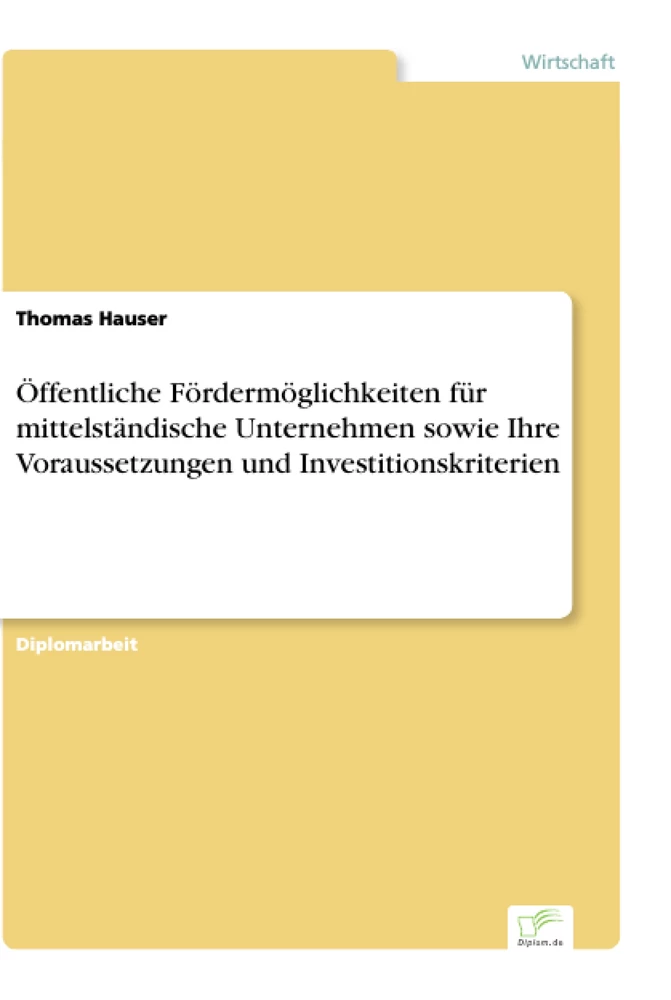Öffentliche Fördermöglichkeiten für mittelständische Unternehmen sowie Ihre Voraussetzungen und Investitionskriterien
©2003
Diplomarbeit
102 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
In Kapitel 2 wird zunächst auf die Frage, warum sich der Staat überhaupt an mittelständischen Unternehmen beteiligt, beziehungsweise diese fördert, eine Antwort gegeben. Ferner wird zu Beginn dieses Kapitels eine Definition der Begriffe öffentliche Förderung und Mittelstand vorgenommen. Im weiteren Verlauf werden sechs ausgewählte Programme im Einzelnen auf ihre Struktur, Einsatzbereiche, Rahmenbedingungen, Konditionen, deren Nutzen und in Bezug auf ihre Inanspruchnahme hin beschrieben. Durch Beispiele zu den jeweiligen Förderprogrammen und einen zusammen-fassenden Gesamtüberblick sollen die Inhalte verdeutlicht werden.
Die Vor- und Nachteile öffentlicher Fördermöglichkeiten gegenüber einem herkömmlichen Kredit, deren Prozesse der Einführung und Umsetzung, sowie dem möglichen Ressourcenaufwand für den Antragsteller bei Inanspruchnahme öffentlicher Gelder, werden in Kapitel 3 dargestellt.
Das Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen wird dann in Kapitel 4 gezogen und durch eine zukünftig zu erwartende Entwicklung abgeschlossen.
Zusammenfassung:
Seit einiger Zeit unterliegt die Konjunktur am Standort Deutschland nur wenigen positiven Einflüssen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind zunehmend von diesem Negativtrend in Mitleidenschaft gezogen und kämpfen ums Überleben. Die Zahl der Insolvenzen, gerade in diesen Unternehmensgruppen, ist durch einen stetigen Anstieg geprägt.
Vielerorts wird dazu der Ruf nach einer Verschlechterung der Kreditvergabe durch die Hausbanken lautstark. Tatsache ist, dass viele deutsche Mittelständler jahrzehntelang auf die bislang günstige Fremdfinanzierung setzten und sich ihre Eigenkapitalquote in der Bilanz dementsprechend gering ausweisen lässt. Der Anreiz, das Verhältnis aus Eigen- und Fremdfinanzierung gesünder zu gestalten, war für viele Unternehmer nicht gegeben.
Die Tatsache, dass viele Banken bei der Vergabe von Krediten aufgrund der teilweise vorherrschenden Kreditausfallrisiken vorsichtiger, hinsichtlich der Mittelvergabe geworden sind, macht es den Unternehmen zunehmend schwieriger, geplante Investitionen vorzunehmen. Da dem Mittelstand aber gerade in Deutschland rein volkswirtschaftlich eine wesentliche Rolle zuteil wird und dieser aus Sicht des Staates einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung vieler Arbeitsplätze und letztlich auch der daraus resultierenden Steuereinnahmen leistet, nimmt der Staat neben den Großbanken seit vielen Jahren eine […]
In Kapitel 2 wird zunächst auf die Frage, warum sich der Staat überhaupt an mittelständischen Unternehmen beteiligt, beziehungsweise diese fördert, eine Antwort gegeben. Ferner wird zu Beginn dieses Kapitels eine Definition der Begriffe öffentliche Förderung und Mittelstand vorgenommen. Im weiteren Verlauf werden sechs ausgewählte Programme im Einzelnen auf ihre Struktur, Einsatzbereiche, Rahmenbedingungen, Konditionen, deren Nutzen und in Bezug auf ihre Inanspruchnahme hin beschrieben. Durch Beispiele zu den jeweiligen Förderprogrammen und einen zusammen-fassenden Gesamtüberblick sollen die Inhalte verdeutlicht werden.
Die Vor- und Nachteile öffentlicher Fördermöglichkeiten gegenüber einem herkömmlichen Kredit, deren Prozesse der Einführung und Umsetzung, sowie dem möglichen Ressourcenaufwand für den Antragsteller bei Inanspruchnahme öffentlicher Gelder, werden in Kapitel 3 dargestellt.
Das Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen wird dann in Kapitel 4 gezogen und durch eine zukünftig zu erwartende Entwicklung abgeschlossen.
Zusammenfassung:
Seit einiger Zeit unterliegt die Konjunktur am Standort Deutschland nur wenigen positiven Einflüssen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind zunehmend von diesem Negativtrend in Mitleidenschaft gezogen und kämpfen ums Überleben. Die Zahl der Insolvenzen, gerade in diesen Unternehmensgruppen, ist durch einen stetigen Anstieg geprägt.
Vielerorts wird dazu der Ruf nach einer Verschlechterung der Kreditvergabe durch die Hausbanken lautstark. Tatsache ist, dass viele deutsche Mittelständler jahrzehntelang auf die bislang günstige Fremdfinanzierung setzten und sich ihre Eigenkapitalquote in der Bilanz dementsprechend gering ausweisen lässt. Der Anreiz, das Verhältnis aus Eigen- und Fremdfinanzierung gesünder zu gestalten, war für viele Unternehmer nicht gegeben.
Die Tatsache, dass viele Banken bei der Vergabe von Krediten aufgrund der teilweise vorherrschenden Kreditausfallrisiken vorsichtiger, hinsichtlich der Mittelvergabe geworden sind, macht es den Unternehmen zunehmend schwieriger, geplante Investitionen vorzunehmen. Da dem Mittelstand aber gerade in Deutschland rein volkswirtschaftlich eine wesentliche Rolle zuteil wird und dieser aus Sicht des Staates einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung vieler Arbeitsplätze und letztlich auch der daraus resultierenden Steuereinnahmen leistet, nimmt der Staat neben den Großbanken seit vielen Jahren eine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7752
Hauser, Thomas: Öffentliche Fördermöglichkeiten für mittelständische Unternehmen
sowie Ihre Voraussetzungen und Investitionskriterien
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Hochschule der Medien (ehem. Hochschule für Druck und Medien Stuttgart (FH)),
Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
-3-
II Inhaltsverzeichnis
Seite
I Ehrenwörtliche
Erklärung... 2
II Inhaltsverzeichnis ... 3
III Tabellenverzeichnis ... 6
IV Abbildungsverzeichnis... 7
V Abkürzungsverzeichnis... 8
1 Einleitung... 11
1.1
Problemstellung und Ziel dieser Arbeit ... 12
1.2 Abgrenzung... 15
1.3 Vorgehensweise ... 16
2
Öffentliche Fördermöglichkeiten für mittelständische
Unternehmen in Deutschland... 17
2.1
Definition des Begriffs ,,öffentliche Förderung" ... 20
2.2
Gesamtübersicht zu den einzelnen Programmen ... 20
2.3 KfW-Mittelstandsprogramm... 22
2.3.1
Definition des Begriffs ,,Mittelstand" ... 23
2.3.2 Einsatzbereiche ... 23
2.3.3 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 24
2.3.4 Konditionen
und
Nutzen ... 26
2.3.5
Anwendungsbeispiele aus der Praxis... 29
2.3.6
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 32
2.4
KfW-Programm ,,Kapital für Arbeit" ... 34
2.4.1 Einsatzbereiche ... 36
2.4.2 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 37
2.4.3 Konditionen
und
Nutzen ... 38
2.4.4
Anwendungsbeispiele aus der Praxis... 40
2.4.5
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 41
2.5 ERP-Beteiligungsprogramm ... 42
2.5.1 Einsatzbereiche ... 42
2.5.2 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 43
2.5.3 Konditionen
und
Nutzen ... 46
2.5.4
Anwendungsbeispiel aus der Praxis... 48
-4-
2.5.5
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 49
2.6 KfW-Umweltprogramm... 50
2.6.1 Einsatzbereiche ... 50
2.6.2 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 51
2.6.3 Konditionen
und
Nutzen ... 54
2.6.4
Anwendungsbeispiele aus der Praxis... 56
2.6.5
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 58
2.7
ERP-Förderung von Unternehmensberatung ... 59
2.7.1 Einsatzbereiche ... 59
2.7.2 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 61
2.7.3 Konditionen
und
Nutzen ... 64
2.7.4
Anwendungsbeispiel aus der Praxis... 65
2.7.5
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 65
2.8 ERP-Existenzgründungsprogramm... 67
2.8.1 Einsatzbereiche ... 67
2.8.2 Voraussetzungen
und
Rahmenbedingungen für den Einsatz ... 68
2.8.3 Konditionen
und
Nutzen ... 68
2.8.4
Anwendungsbeispiel aus der Praxis... 70
2.8.5
Ist-Situation zur Inanspruchnahme ... 71
2.9 Zusammenfassender
Gesamtüberblick... 72
3
Vor- und Nachteile der öffentlichen Finanzierungen gegenüber
eines herkömmlichen Kredits... 74
3.1
Prozess der Einführung und Umsetzung der öffentlichen
Förderung... 75
3.2
Möglicher Ressourcenaufwand für den Antragsteller einer
öffentlichen Förderung... 76
4 Fazit ... 79
5 Kurzfassung ... 81
6 Anhang... 83
6.1
Maßgebliche Umsatzgrenzen für die Förderung von Beratungen... 83
6.1.1 Allgemeine
Beratungen ... 83
6.1.2 Umweltschutzberatungen... 84
6.2
Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP- Mitteln ... 85
6.3 Checkliste
zur
Ratingvorbereitung... 89
-5-
6.4
Ansprechpartner und Adressen ... 90
7 Glossar ... 92
8
Literatur- und Quellenverzeichnis ... 99
-6-
III Tabellenverzeichnis
Seite
Tabelle 1: Übersicht über ausgewählte öffentliche Förderprogramme ... 21
Tabelle 2: Konditionen zum KfW-Mittelstandsprogramm ... 27
Tabelle 3: Investitionsplan 1 zum KfW-Mittelstandsprogramm. ... 30
Tabelle 4: Finanzierungsplan 1 zum KfW-Mittelstandsprogramm. ... 30
Tabelle 5: Investitionsplan 2 zum KfW-Mittelstandsprogramm. ... 31
Tabelle 6: Finanzierungsplan 2 zum KfW-Mittelstandsprogramm. ... 31
Tabelle 7: Konditionen zum KfW-Programm "Kapital für Arbeit" ... 40
Tabelle 8: Konditionentabelle 1 zum ERP-Beteiligungsprogramm ... 47
Tabelle 9: Konditionentabelle 2 zum ERP-Beteiligungsprogramm ... 47
Tabelle 10: Investitionsplan zum ERP-Beteiligungsprogramm ... 48
Tabelle 11: Finanzierungsplan für die Beteiligungsgesellschaft ... 48
Tabelle 12: Konditionen zum KfW-Umweltprogramm ... 56
Tabelle 13: Investitionsplan zum KfW-Umweltprogramm... 58
Tabelle 14: Finanzierungsplan zum KfW-Umweltprogramm... 58
Tabelle 15: Konditionen zum ERP-Existenzgründungsprogramm ... 69
Tabelle 16: Investitionsplan zur Errichtung einer Autolackiererei... 70
Tabelle 17: Finanzierungsplan für Gesellschafter A ... 70
Tabelle 18: Finanzierungsplan für Gesellschafter B ... 70
-7-
IV Abbildungsverzeichnis
Seite
Abbildung 1: Anteil mittelständischer Unternehmen an der
Gesamtwirtschaft in Deutschland, in Prozent ... 12
Abbildung 2: Unternehmensfinanzierungsstruktur im internationalen
Vergleich ... 13
Abbildung 3: Kreditzusagen für Unternehmen, in Mio. Euro ... 33
Abbildung 4: Erwerbstätige in Deutschland im Jahresdurchschnitt... 34
Abbildung 5: Arbeitslose in Deutschland im Jahresdurchschnitt... 35
Abbildung 6: Mögliche Untersuchungskriterien bei einem Rating... 39
Abbildung 7: Checkliste für den Beteiligungsnehmer. ... 45
Abbildung 8: Checkliste für umweltrelevante Investitionen... 53
Abbildung 9: Richtmaß zum Ressourcenaufwand ... 77
-8-
V Abkürzungsverzeichnis
AG Aktiengesellschaft
AHG Altschuldenhilfegesetz
Aufl. Auflage
BAnz Bundesanzeiger
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
BDU
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V.
BGB Bürgerliches
Gesetzbuch
BIP Bruttoinlandsprodukt
BJU
Bundesverband Junger Unternehmen der ASU e. V.
BL Bundesländer
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
BMWi Bundesministerium
für
Wirtschaft
BTU Technologie-Beteiligungsprogramm
BVK
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V.
BVW
Bundesverband der Wirtschaftsberater e.V.
bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
DIHK
Deutsche Industrie und Handelskammer
DIHT
Deutscher Industrie- und Handelstag e.V.
DIW
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Dt. Deutschland
DtA Deutsche
Ausgleichsbank
EDV
Elektronische Daten Verarbeitung
ERP European
Recovery
Program
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
f. folgende
Seite
ff. fortfolgende
Seiten
F&E
Forschung und Entwicklung
GA Gemeinschaftsaufgaben
GES. Gesellschaft
GG Grundgesetz
-9-
ggf. gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hrsg. Herausgeber
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
i.d.R.
in der Regel
IfM
Institut für Mittelstandsforschung
IHK
Industrie- und Handelskammer
i.H.v. in
Höhe
von
Jg. Jahrgang
KBGen Kapitalbeteiligungsgesellschaften
KfW Kreditanstalt
für
Wiederaufbau
KG Kommanditgesellschaft
KMU
Kleine und Mittelständische Unternehmen
MA Mitarbeiter
Mio. Million
Mrd. Milliarde
MTA
Medizinisch Technische Assistentin
Nr. Nummer
o.g. oben
genannte
ÖB Öffentliche
Beteiligungsform
p.a. per
anno
PAngV Preisangabenverordnung
p.M. per
Monat
PwC Price
Waterhouse
Coopers
RKW
Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen
Wirtschaft e.V.
s.o. siehe
oben
Tsd. Tausend
u.a. unter
anderem
u.ä.
und ähnliche
u.U. unter
Umständen
usw. und
so
weiter
VC
Venture Capital
vgl. vergleiche
-10-
WJD
Wirtschaftsjunioren Deutschland e. V.
WWW
World Wide Web
z.B. zum
Beispiel
ZDH
Zentralverband des Deutschen Handwerks
z.T. zum
Teil
-11-
1 Einleitung
In Deutschland sind die letzten drei Jahre durch eine steigende Zahl der
Insolvenzen
1
gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen geprägt.
Fortlaufend ist aus aktuellen Wirtschaftszeitungen und anderen Medien zu
vernehmen, dass sich Unternehmen durch einen Insolvenzverwalter vertreten
lassen müssen, um den Ansprüchen der jeweiligen Gläubiger nachkommen
zu können. Einhergehend mit dieser Tatsache steigen die Arbeitslosenzahlen,
die ebenfalls ihre Schatten auf die deutsche Wirtschaft werfen.
Andererseits ist gerade der deutsche Mittelstand (siehe Abb.1), mit mehr als
99 Prozent aller hier ansässigen Unternehmen und einer Beschäftigungsquote
von fast 80 Prozent der in Deutschland berufstätigen Menschen sowie einem
Auszubildendenanteil von über 80 Prozent eine tragende Säule in der
gesamtdeutschen Wirtschaft.
Diese Entwicklung zeigen, dass hier ein enormer Handlungsbedarf auch
hinsichtlich seiner möglichen Finanzierungsstrukturen entstanden ist. Denn
nur wenn sich diese Unternehmen dem vollziehenden Paradigmenwechsel
hin zu einem gesünderen finanziellen Gleichgewicht stellen und seiner
Dynamik folgen, kann auch zukünftig gewährleistet sein, dass sie in ihrer
Branchen- und Größenvielfalt für wirtschaftliche Stabilität sorgen,
Innovationen begünstigen und damit letztlich zu mehr Wachstum und
Wohlstand in der deutschen Ökonomie beitragen können.
Eine eindeutige Aussage zu den Ursachen dieser Entwicklung vermag nicht
zu geben zu sein. Vielmehr ist anzumerken, dass sich in den letzten Jahren
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben.
Missmanagement, unzureichende Transparenz der Unternehmensabläufe,
geringe Bereitschaft sich einem strukturellen Wandel zu unterziehen und eine
schlechte Informationsversorgung des Managements stellen beispielsweise
einige Einflussparameter dar, die allein die Unternehmerseite betreffen
können.
1
Quelle: www.destatis.de
-12-
99,6
81,9
79,4
46
45
12,2
0
20
40
60
80
100
Unternehmen
Auszubildende
Erwerbstätige
Investitionen
Umsatz
F&E-Aufwendungen
in %
Abbildung 1: Anteil mittelständischer Unternehmen an der Gesamtwirtschaft in Deutschland, in
Prozent
2
1.1 Problemstellung und Ziel dieser Arbeit
Der Großteil der deutschen Mittelständler bevorzugte in den letzten
Jahrzehnten die Fremdfinanzierung. Traditionell erhielten diese mittel-
ständischen Unternehmen ihr notwendiges Kapital in Form von Krediten
über ihre Hausbanken. Da die Kosten für die Fremdfinanzierung in
Deutschland bislang vergleichsweise günstig waren, gab es für viele Firmen
wenige Anreize, das Verhältnis aus Eigen- und Fremdfinanzierung
ausgeglichener zu gestalten. So ersetzten in den vergangenen Jahren die
Banken in Deutschland vielerorts faktisch Eigenkapital durch günstige
Bankkredite.
2
Quelle: IHK Berlin. Erhebung auf Basis der Daten von IfM, Statistisches Bundesamt,
Stifterverband für Deutsche Wissenschaft und dem Institut der deutschen Wirtschaft.
-13-
Das Ergebnis dieser Kapitalverteilungsstruktur ist, dass viele deutsche
Unternehmen über eine zu dünne Eigenkapitaldecke verfügen.
Diese im internationalen Vergleich ungewöhnliche Finanzstruktur wird durch
nachfolgende Abbildung 2 verdeutlicht.
71
10
18
29
90
82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
D
GB
USA
Länder
in
%
Bankkredite
Kapitalmarktfinanzierung
Abbildung 2: Unternehmensfinanzierungsstruktur im internationalen Vergleich
3
Die Tatsache, dass neben der schlechten konjunkturellen Entwicklung,
welche eine Verknappung des Eigenkapitals nur beschleunigt, auch die
Banken zu größeren Sicherheitsvorkehrungen bezüglich ihrer Mittelvergabe
aufgefordert sind, spiegelt sich in den Kreditvergaberestriktionen Basel II
wider.
Die Auswirkungen der Basler Beschlüsse spüren durch die Verknappung der
bislang gewohnten Bankkredite schon heute viele Unternehmen.
3
Quelle: KfW ,,Praxisforum Mittelstand", von Christoph Tiskens und Dr. Gregor Taistra, Berlin
4. September 2002.
-14-
Ihnen ist durchaus bewusst, dass an der Finanzierungsstruktur in ihrer
jetzigen Form nicht festgehalten werden sollte.
Aufgrund ihrer dünnen Eigenkapitaldecke könnte sich der zukünftige Zugang
zur herkömmlichen Kreditfinanzierung gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen verschlechtern. Die von den Banken
notwendigerweise vorgenommene Bonitätsprüfung, mit dem sich daraus für
sie gegebenenfalls negativ ergebende Rating
4
, stellt viele dieser Unternehmen
vor neue Herausforderungen.
Die Notwendigkeit eines Veränderungsprozesses dringt immer mehr in den
Vordergrund.
Aber nicht nur von Seiten der Unternehmen und Banken, sondern auch von
der Regierung sollten adäquate Voraussetzungen für ein gesundes
wirtschaftliches Agieren geschaffen und nachhaltig gefestigt werden.
Damit eine Abhängigkeit von ausschließlich einer Finanzierungsquelle für
zukünftige unternehmerische Aktivitäten weitgehend ausgeschlossen werden
kann, müssten sich viele mittelständische Unternehmen nach anderen bzw.
ergänzenden Finanzierungsalternativen umsehen.
Eine Finanzierungsalternative stellt die der Nutzung einer öffentlichen
Förderung dar.
Die Kenntnis um die Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher
Förderprogramme ist allerdings nur die eine, das Herausfiltern der für den
individuellen Unternehmer am sinnvollsten erscheinende Programm die
andere Sache.
Die Angebotsvielfalt alternativer Finanzierungsformen der öffentlichen Hand
ist weitreichend und unübersichtlich. Das den Unternehmern meist zur
Verfügung stehende Zeitkontingent für Informationsrecherchen steht somit in
den meisten Fällen in keinem Verhältnis zum erfahrenen Nutzen.
4
Ein Rating ist eine Aussage (,,Benotung") über die zukünftige Fähigkeit eines Unternehmens
zur vollständigen und termingerechten Rückzahlung (Tilgung und Verzinsung) seiner
Verbindlichkeiten mit dem Ziel der Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten auf der Basis
von Unternehmensanalysen.
-15-
Das Vorhaben einen praktischen und zugleich umfassenden Überblick zu den
öffentlichen Förderprogrammen zu erhalten, wird durch den überproportional
hohen Zeitaufwand gehemmt.
Mit der vorliegenden Ausarbeitung zum Thema ,,öffentliche
Fördermöglichkeiten für mittelständische Unternehmen" wird eben dieser
Adressatengruppe ein kurzer aber zugleich detaillierter Überblick über
ausgewählten Förderprogramme in Deutschland verschafft.
1.2 Abgrenzung
Aufgrund des Umfangs der angebotenen Förderprogramme werden in dieser
Arbeit die wesentlichen und eher allgemein gehaltenen Programme für kleine
und mittelständische Unternehmen, in einer Gesamtübersicht dargestellt.
Jedoch muss eine Abgrenzung hinsichtlich der Anzahl der zu erörternden
Förderprogramme vorgenommen werden.
Dadurch, dass sich einige Programme durch gewisse Einschränkungen nur
für beispielsweise Unternehmen eignen, die auf internationalen Märkten
agieren oder speziell einer Standortbedingung unterliegen, werden sie dem
Anspruch den allgemeinen Adressaten dieser Ausarbeitung anzusprechen
nicht gerecht und somit in dieser Arbeit nicht weiter behandelt. In der
Betrachtung, der in dieser Arbeit enthaltenen Programme sind sowohl
eigenkapitalnahe, als auch Programme mit Fremdkapitalcharakter auf
Bundesebene berücksichtigt. Ferner wird auch der Punkt einer
Bezuschussung mittels eines beschrieben Programms abgedeckt. Auch stellen
die beschriebenen Programme einen großen Teil derer dar, die einer häufigen
Inanspruchnahme unterliegen.
-16-
1.3 Vorgehensweise
In Kapitel 2 wird zunächst auf die Frage, warum sich der Staat überhaupt an
mittelständischen Unternehmen beteiligt, beziehungsweise diese fördert, eine
Antwort gegeben. Ferner wird zu Beginn dieses Kapitels eine Definition der
Begriffe ,,öffentliche Förderung" und ,,Mittelstand" vorgenommen. Im
weiteren Verlauf werden sechs ausgewählte Programme im Einzelnen auf
ihre Struktur, Einsatzbereiche, Rahmenbedingungen, Konditionen, deren
Nutzen und in Bezug auf ihre Inanspruchnahme hin beschrieben. Durch
Beispiele zu den jeweiligen Förderprogrammen und einen zusammen-
fassenden Gesamtüberblick sollen die Inhalte verdeutlicht werden.
Die Vor- und Nachteile öffentlicher Fördermöglichkeiten gegenüber einem
herkömmlichen Kredit, deren Prozesse der Einführung und Umsetzung,
sowie dem möglichen Ressourcenaufwand für den Antragsteller bei
Inanspruchnahme öffentlicher Gelder, werden in Kapitel 3 dargestellt.
Das Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen wird dann in Kapitel 4 gezogen
und durch eine zukünftig zu erwartende Entwicklung abgeschlossen.
-17-
2
Öffentliche Fördermöglichkeiten für mittelständische
Unternehmen in Deutschland
Neben den Großbanken nimmt der deutsche Staat über Programme, über die
öffentliche Mittel zur Unternehmensfinanzierung bereitgestellt werden seit
vielen Jahren eine große Rolle ein. Zur Beschaffung und Bereitstellung von
mittel- und langfristigen Krediten wurde per Gesetz im Jahr 1948 die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Frankfurt am Main geschaffen. Der
Aufgabenbereich dieser Anstalt öffentlichen Rechts hat sich seit dieser Zeit
neben der Gewährung von Darlehen zur Förderung der deutschen Wirtschaft
auch auf eine Vielzahl unterschiedlicher anderer Förderprogramme
ausgeweitet.
Ebenso wie alle von der KfW angebotenen Fördermaßnahmen unterliegen
auch die ERP-Programme dem Einfluss der öffentlichen Hand. ERP steht für
European Recovery Programm und wurde 1948 im Rahmen des Marshall-
Plans ins Leben gerufen.
Ziel war der Wiederaufbau der west-europäischen Wirtschaft. West-
Deutschland erhielt zu diesem Zweck von der amerikanischen Regierung
Hilfslieferungen wie Maschinen, Rohstoffe, Lebensmittel, Medikamente und
Saatgut. Empfänger dieser Lieferungen waren zunächst Unternehmen. Das
Besondere dabei war: Deutsche Importeure bezahlten diese Güter, indem sie
deren Gegenwert in Deutscher Mark bei der Deutschen Bundesbank in einen
Fonds einzahlten. Aus diesem Fonds ist 1949 das ERP-Sondervermögen
entstanden. Die Mittel der ERP-Kredite stammen aus dem ERP-Vermögen.
Diese ERP-Mittel dienen der Förderung der deutschen Wirtschaft. Seit mehr
als 50 Jahren stehen nun die ERP-Kredite als Symbol für den Wiederaufbau
und die Festigung der deutschen Wirtschaft. Der Aufbau und die
Weiterentwicklung der Betriebe sowie die Verbesserung der Umwelt und der
Innovationsfähigkeit stehen im Mittelpunkt. Die ERP-Mittel leisten einen
wirksamen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und
mittleren Unternehmen und der freien Berufe. Einhergehend damit tragen sie
zur Schaffung neuer und zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze bei.
-18-
Es werden lediglich Vorhaben gefördert, die volkswirtschaftlich
förderungswürdig sind, die die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der
geförderten Unternehmen steigern und bei denen ein nachhaltiger
wirtschaftlicher Erfolg erwartet werden kann.
Die ERP-Mittel sind zur Finanzierung von langfristigen Investitionen gedacht
und werden grundsätzlich nur gewährt, wenn die Durchführung des
Vorhabens ohne diese Förderung wesentlich erschwert würde. Zu
berücksichtigen sind dabei auch die wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse der
Eigentümer, zumal die ERP-Mittel nur einen Teil des Finanzierungs-
vorhabens abdecken.
Mit diesen historisch gewachsenen Strukturen, d.h. die Förderung von
Unternehmen, verfolgt der Staat mehrere Ziele.
Da, wie bereits eingangs erwähnt, dem Mittelstand in Deutschland
volkswirtschaftlich eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Sicherung des
sozialen Systems zuteil wird, setzt der Staat durch individuelle, präventive
Förderprogramme gezielt an dieser Stellschraube an.
Vorrangiges Ziel ist es, die Investitionsfähigkeit vieler mittelständischer
Unternehmen langfristig zu sichern und die Gründung neuer Unternehmen zu
unterstützen. Die ERP-Programme tragen zum Erhalt bestehender
Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze bei und unterstützen u.a. den
Generationenwechsel im Handwerk.
Ein weiteres wichtiges Aktionsfeld ist die Finanzierung von
Umweltschutzmaßnahmen sowie Aufbauhilfen in den neuen Bundesländern.
Die Bereitstellung von Risikokapital aus ERP-Mitteln trägt dazu bei, die
Wachstumschancen für mittelständische Unternehmen mit Hilfe eigener
Forschung, Entwicklung und Innovation zu unterstützen. Sie ist zugleich ein
Ausgleich für die hohen innovativen Risiken, die diese Unternehmen tragen
müssen. Die Förderung der Existenzgründer sowie kleiner und mittlerer
Unternehmen stärkt den Standort Deutschland und damit die Position
deutscher Unternehmen im Rahmen des europäischen und globalen
Standortwettbewerbs. Nicht zuletzt stellt die ERP-Förderung einen wichtigen
Beitrag zur Lösung der Beschäftigungsprobleme dar. Denn neue Betriebe und
-19-
die Ausweitung mittelständischer Unternehmen wirken positiv und
nachhaltig auf dem Arbeitsmarkt.
Ein hohes Sozialleistungsniveau kombiniert mit geringer Arbeitsmarkt-
dynamik führt zu hohen Lohnnebenkosten und einem großen finanziellen
Druck auf die Systeme der sozialen Sicherung.
Da die Entwicklung in Deutschland dahingehend tendiert, dass ein
zunehmend größerer Teil der inaktiven Bevölkerung, der hohe
Transferleistungen
5
erhält, von einem kleiner werdenden aktiven
Bevölkerungsteil finanziert werden muss, hat unter anderem dazu
beigetragen, dass Fördermaßnahmen, wie beispielsweise das Programm
,,Kapital für Arbeit" zur Stützung des Sozialsystems ins Leben gerufen
wurden.
Dadurch verspricht sich der Staat eine Senkung der Lohnnebenkosten, was
zum einen die Investitionen für Unternehmen attraktiver gestaltet und zum
anderen ein höheres Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum erreichbar
macht
6
. Ferner leisten aus Sicht der ökologischen Zielsetzungen unseres
Staates ERP-Förderprogramme zur Finanzierung von betrieblichen
Umweltprojekten sowie auf dem Sektor der Nutzung neuer Energiequellen
innerhalb der Fördersäulen einen wichtigen Beitrag. Dies impliziert auch eine
langfristige und nachhaltige Sicherung knapper Ressourcen durch eine
optimale Allokation eben dieser.
Allgemein gesehen verspricht sich der Staat durch alle von ihm angebotenen
Förderprogramme auch das soziale System
7
aufrecht zu erhalten bzw.
nachhaltig zu verbessern. Und demzufolge eine attraktivere Gestaltung des
Standortes Deutschland mit dem Ziel, dass sich dieser durch sowohl positive
qualitative als auch quantitative Ausprägungen weiterhin im internationalen
Wettbewerb, behaupten kann.
5
Darunter sind staatliche Ausgaben, wie beispielsweise Renten- und Sozialleistungen zu
verstehen.
6
Vgl. ,,Die Rolle der Konzertierung in der Reform kontinental-europäischer Wohlfahrtstaaten",
Anke Hassel und Bernhard Ebbinghaus, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
7
Vgl. dazu WRW-Verlag,. ,,Allgemeine Wirtschaftspolitik", 3. Auflage.
-20-
2.1 Definition des Begriffs ,,öffentliche Förderung"
Unter dem Begriff ,,öffentliche Förderung" lassen sich alle Maßnahmen
subsumieren, bei denen die öffentliche Hand, d.h. in diesem Fall der deutsche
Staat Zuwendungen jeglicher Form und Ausprägung zu dem ihn möglichen
Konditionen, zur Unterstützung der in Deutschland agierenden Unternehmen
und auch Einzelpersonen aufbringt, um diese hinsichtlich ihrer
Existenzsicherung und Investitionsvorhaben zu unterstützen. So sind
beispielsweise alle Förderprogramme der KfW und auch die gesamte
Angebotspalette der ERP-Programme dadurch charakterisiert, dass sie eben
diesem Anliegen nachkommen.
2.2 Gesamtübersicht
zu
den einzelnen Programmen
Öffentliche Finanzierungsprogramme und die Möglichkeiten der Aufnahme
eben dieser haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Einen genauen
Überblick zu bekommen ist sehr schwer geworden, da sich die
Angebotspalette permanent durch neue Programme erweitert bzw.
bestehende Programme modifiziert werden. Sei es der Bund, die Länder, die
Kommunen oder auch die Europäische Gemeinschaft, fast jede Ebene der
öffentlichen Körperschaft hat inzwischen eine Vielzahl eigener
Förderprogramme.
Nachfolgende Übersicht beinhaltet einen kleinen Auszug der für den
Mittelstand auf Bundesebene interessanten Förderprogramme. Die für diese
Arbeit relevanten Förderprogramme sind besonders hervorgehoben.
-21-
Bezeichnung Förderart
Förderbereich
Förderberechtigte
DtA-Mikro-Darlehen Darlehen
Existenzgründung und -
sicherung
Natürliche Personen, Arbeitslose
und kleine Unternehmen, im
Bereich Wirtschaft
DtA-Technologie-
Beteiligungsprogramm
Beteiligung F&E;
VC
Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft, mit max. 125 Mio.
Jahresumsatz
KfW-Beteiligungsfond-Ost
Beteiligung/
Darlehen
F&E; VC, Konsolidierung
Unternehmen im ostdeutschen
Raum und Berlin
KfW-Mittelstandsprogramm Kredit Für
Investitionen
Kleine und mittlere Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft
KfW-Mittelstandsprogramm-
Ausland
Darlehen Export
Unternehmer,
Freiberufler
KfW-Programm
,,Kapital für Arbeit"
Darlehen/
Sonderform
Humankapital
Unternehmen mit max.
500 Mio. Jahresumsatz
KfW-Risikokapitalprogramm
Garantie Garantie
und
Bürgschaft, VC
alle Unternehmen
KfW/BMWA-Technologie-
Beteiligunsprogramm
Beteiligung
Refinanzierung von
Beteiligungen oder
beteiligungsähnlichen
Finanzierungsformen
Kapitalbeteiligungsgesellschaften,
Kreditinstitute, Unternehmen und
Privatpersonen (Beteiligungsgeber)
ERP-Beteiligungsprogramm
Beteiligung
Kooperationen,
Innovationen,
Umstellungen,
Errichtungen und
Erweiterungen
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
für kleine und mittlere
Unternehmen, VC
ERP-BTU-Programm Beteiligung
Innovationen, neue
Technologien für kleine
Technologieunternehmen
Kapitalbeteiligungsgesellschaften.,
Privatpersonen und sonst.
Beteiligungsgeber, Unternehmen
bis zu 50 Mitarbeiter
ERP-Eigenkapitalhilfsprogramm
Darlehen
Existenzgründung und
sicherung
Existenzgründer
ERP-
Existenzgründungsprogramm
Darlehen
Gründung, Erwerb u.
Festigung von Betrieben,
Übernahme tätiger
Beteiligungen, Beschaffung
des ersten Warenlagers und
dessen Aufstockung
Existenzgründer in der
gewerblichen Wirtschaft und
Angehörige Freier Berufe
(ausgenommen Heilberufe)
ERP-Förderung von
Unternehmensberatung
Zuschuss
Beratung,
Existenzgründung und
sicherung, Umwelt
Unternehmen, Freiberufler,
Existenzgründer
ERP-Innovationsprogramm
Kredit
F&E-, Beteiligungs- u.
Innovationskosten
Unternehmen in der F&E-Phase für
innovative Projekte
KfW-/ERP-
Regionalförderprogramm
Beteiligung/
Darlehen/
Kredite
Individuell
Je nach Rahmenbedingungen der
Länder
KfW-Umweltprogramm Kredit
Beispielsweise Minimierung
der Umweltbelastungen
kleine und mittlere Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft,
produzierendes Gewerbe und
Wirtschaft
Tabelle 1: Übersicht über ausgewählte öffentliche Förderprogramme
-22-
2.3 KfW-Mittelstandsprogramm
Dieses Förderprogramm ist eine speziell auf die Finanzierungserfordernisse
der mittelständischen Unternehmen zugeschnittene Variante. Mit dem KfW-
Mittelstandsprogramm wird das Ziel verfolgt, die mittelständischen
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft d.h., produzierendes Gewerbe,
Handwerk, Handel, sonstiges Dienstleistungsgewerbe sowie freiberuflich
Tätige wie Ärzte, Steuerberater, Architekten dahingehend zu unterstützen,
dass liquide Mittel für eine langfristige Finanzierung von Investitions-
vorhaben am Standort Deutschland bereitgestellt werden.
Ferner existieren daneben noch spezielle Ergänzungsprogramme
8
, wie
beispielsweise:
Das KfW-Mittelstandsprogramm-Beschäftigung und
Qualifizierung,
Das KfW-Mittelstandsprogramm-Leasing,
Das KfW-Mittelstandsprogramm-Liquiditätshilfe.
So kann das Liquiditätshilfeprogramm auch für den Ausgleich
vorübergehender Liquiditätsengpässe von in Deutschland ansässigen
Unternehmen in Anspruch genommen werden.
In der weiteren Betrachtung dieser Arbeit wird auf diese ergänzenden
Sonderformen jedoch nicht eingegangen, da sie einer zu individuellen
Eigenschaft unterliegen. Von Relevanz ist das allgemein gehaltene
Mittelstandsprogramm.
8
Vgl. dazu KfW: Die Programme zur Finanzierung von gewerblichen Investitionen und
Umweltschutz.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832477523
- ISBN (Paperback)
- 9783838677521
- DOI
- 10.3239/9783832477523
- Dateigröße
- 689 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule der Medien Stuttgart – Druck und Medien
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- förderprogramm basel finanzierungsalternative investition
- Produktsicherheit
- Diplom.de