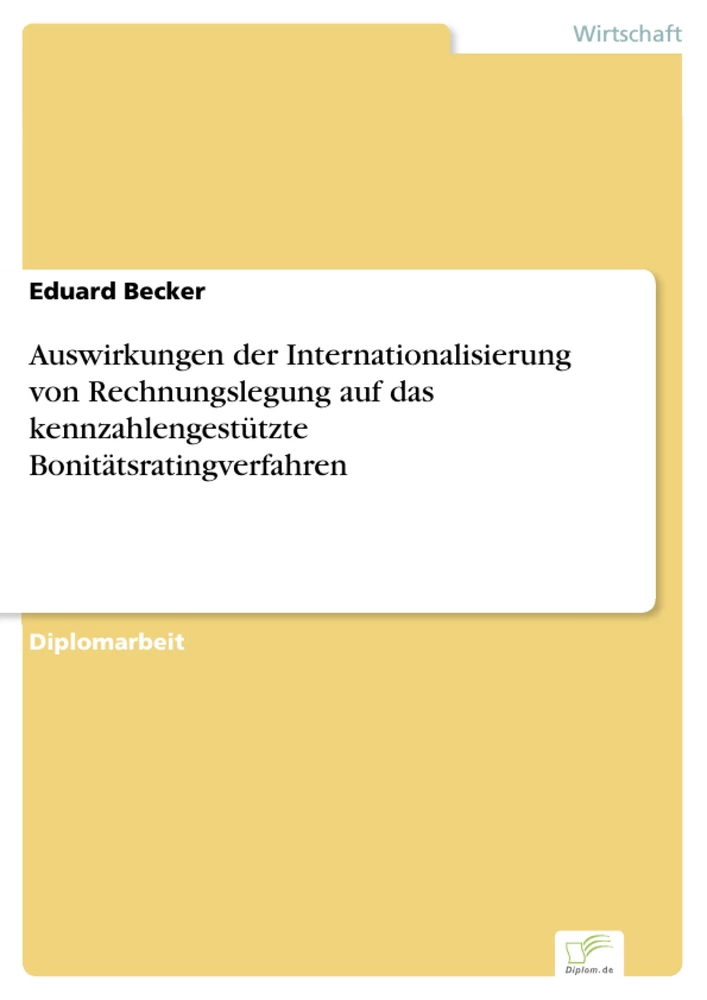Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren
©2003
Diplomarbeit
143 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Internationale Rechnungslegung ist im Vormarsch. Seit einigen Jahren ist zu beachten, dass die Unternehmen sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse nicht mehr nur an den für Deutschland gültigen Vorschriften des HGB orientieren. Zunehmend werden Abschlüsse deutscher Unternehmen nunmehr auch nach den international anerkannten US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) oder den supranationalen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.
Betrachtet man die Entwicklung der Wirtschaft während der letzten 10 Jahre, so lässt sich eine ganze Reihe von Einflüssen ausmachen, die als Auslöser für eine internationale Ausrichtung der Jahresabschlüsse deutscher Unternehmen angeführt werden können. Beispielsweise sind heute Internationale Abschlüsse ein Zulassungskriterium an vielen Börsen; an der deutschen Börse sind den Segmenten TecDAX und ab 2002 im SDAX Jahresabschlüsse nach IFRS oder US-GAAP vorzulegen.
Im Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Kapitel dieser Diplomarbeit zunächst die konzeptionellen Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS vorgestellt. Das dritte Kapitel beinhaltet die Beschreibung des Bonitätsratingprozesses sowie derer Bedeutung für Basel II. Der externe Analyst ist bei der jahresabschlussanalytischen Bonitätsbeurteilung eines Unternehmens weitgehend auf die der Rechnungslegung entnehmbaren Daten angewiesen. Daher sind im vierten Kapitel die für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren relevante Rechnungslegungsbestandteile (Bilanzpositionen) sowie deren durch das den Bilanzierungsnormen innenwohnenden bilanzpolitisch ausnutzbare Gestaltungspotential, d.h. Ermessensspielräume und Wahlrechte, zu beschreiben. Um den Informationswert der einem IFRS-Abschluss zu entnehmenden Rechnungslegungsdaten abschließend beurteilen zu können, wird ein Vergleich mit den entsprechenden HGB-Vorschriften vorgenommen.
Im fünften Kapitel wird schließlich aufbauend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Abschnitte der Frage nachgegangen, inwiefern sich aufgrund divergierender Ansatz-, Bewertung-, Ausweis-, und Konsolidierungsgrundsätzen in der IFRS-Rechnungslegung der Aufbau einzelner ausgewählten Kennzahlen verändert und ob sich daraufhin Unterschiede zwischen dem Aussagegehalt von IFRS-konformen und HGB-konformen Kennzahlen ergeben. Zudem ist anhand eines Beispieles zu untersuchen, ob die spezifischen Offenlegungsvorschriften der IFRS-Rechnungslegung Auswirkungen […]
Die Internationale Rechnungslegung ist im Vormarsch. Seit einigen Jahren ist zu beachten, dass die Unternehmen sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse nicht mehr nur an den für Deutschland gültigen Vorschriften des HGB orientieren. Zunehmend werden Abschlüsse deutscher Unternehmen nunmehr auch nach den international anerkannten US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) oder den supranationalen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.
Betrachtet man die Entwicklung der Wirtschaft während der letzten 10 Jahre, so lässt sich eine ganze Reihe von Einflüssen ausmachen, die als Auslöser für eine internationale Ausrichtung der Jahresabschlüsse deutscher Unternehmen angeführt werden können. Beispielsweise sind heute Internationale Abschlüsse ein Zulassungskriterium an vielen Börsen; an der deutschen Börse sind den Segmenten TecDAX und ab 2002 im SDAX Jahresabschlüsse nach IFRS oder US-GAAP vorzulegen.
Im Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Kapitel dieser Diplomarbeit zunächst die konzeptionellen Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS vorgestellt. Das dritte Kapitel beinhaltet die Beschreibung des Bonitätsratingprozesses sowie derer Bedeutung für Basel II. Der externe Analyst ist bei der jahresabschlussanalytischen Bonitätsbeurteilung eines Unternehmens weitgehend auf die der Rechnungslegung entnehmbaren Daten angewiesen. Daher sind im vierten Kapitel die für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren relevante Rechnungslegungsbestandteile (Bilanzpositionen) sowie deren durch das den Bilanzierungsnormen innenwohnenden bilanzpolitisch ausnutzbare Gestaltungspotential, d.h. Ermessensspielräume und Wahlrechte, zu beschreiben. Um den Informationswert der einem IFRS-Abschluss zu entnehmenden Rechnungslegungsdaten abschließend beurteilen zu können, wird ein Vergleich mit den entsprechenden HGB-Vorschriften vorgenommen.
Im fünften Kapitel wird schließlich aufbauend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Abschnitte der Frage nachgegangen, inwiefern sich aufgrund divergierender Ansatz-, Bewertung-, Ausweis-, und Konsolidierungsgrundsätzen in der IFRS-Rechnungslegung der Aufbau einzelner ausgewählten Kennzahlen verändert und ob sich daraufhin Unterschiede zwischen dem Aussagegehalt von IFRS-konformen und HGB-konformen Kennzahlen ergeben. Zudem ist anhand eines Beispieles zu untersuchen, ob die spezifischen Offenlegungsvorschriften der IFRS-Rechnungslegung Auswirkungen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7690
Becker, Eduard: Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das
kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Fachhochschule Nürtingen, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite I
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
I
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
IV
1
EINLEITUNG
1
1.1
Problemstellung
1
1.2
Vorgehensweise
3
2
GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG NACH HGB UND IFRS
4
2.1
Rechnungslegung nach HGB
4
2.1.1 Entstehung und Inhalt des HGB
4
2.1.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
5
2.1.3 Zielsetzung und Adressaten der HGB-Rechnungslegung
6
2.2
Rechnungslegung nach IFRS
8
2.2.1 Entwicklung und Zusammensetzung der IFRS
8
2.2.2 Grundsätze (Framework)
10
2.2.3 Ziele und Adressaten der IFRS-Rechnungslegung
13
3
DAS KENNZAHLENGESTÜTZTE BONITÄTSRATINGVERFAHREN
14
3.1
Grundlagen und Ziele
14
3.2
Ratingadressaten
16
3.2.1 Kreditinstitute
16
3.2.2 Leasinggesellschaften
17
3.2.3 Kunden
17
3.2.4 Lieferanten
18
3.2.5 Mitarbeiter
18
3.2.6 Andere Adressaten
18
3.3
Bonitätsratingprozess
19
3.4
Basel II und Rating
21
3.4.1 Die Standardmethode für das Bonitätsrisiko
22
3.4.2 Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRB-Ansatz)
23
3.4.3 Bedeutung von Basel II für einzelne Wirtschaftssubjekte
23
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite II
4
GRUNDLEGENDE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER DEUTSCHEN
RECHNUNGSLEGUNG UND DER IFRS-RECHNUNGSLEGUNG
26
4.1
Diskussion relevanter Bilanzpositionen
26
4.1.1 Aktiva
27
4.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
27
4.1.1.1.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
27
4.1.1.1.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
29
4.1.1.2 Sachanlagevermögen
31
4.1.1.2.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
31
4.1.1.2.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
32
4.1.1.3 Wertpapiere
33
4.1.1.3.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
33
4.1.1.3.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
34
4.1.1.4 Vorräte
36
4.1.1.4.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
36
4.1.1.4.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
38
4.1.1.5 Langfristige Auftragsfertigung
39
4.1.1.5.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
39
4.1.1.5.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
40
4.1.2 Passiva
42
4.1.2.1 Rückstellungen
42
4.1.2.1.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
42
4.1.2.1.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
44
4.1.2.2 Pensionsverpflichtungen
45
4.1.2.2.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
45
4.1.2.2.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte
Bonitätsratingverfahren
47
4.2
Sonstige Ansatz- und Bewertungsunterschiede
49
4.2.1 Leasing
49
4.2.1.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
49
4.2.1.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 50
4.2.2 Latente Steuern
52
4.2.2.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
52
4.2.2.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 53
4.2.3 Währungsumrechnung
54
4.2.3.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
54
4.2.3.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 54
4.2.4 Derivate
56
4.2.4.1 Ansatz- und Bewertungsunterschiede
56
4.2.4.2 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 57
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite III
4.3
Zusätzliche Unterschiede zwischen HGB und lFRS im Konzern-
abschluss
58
4.3.1 Konsolidierungskreis
59
4.3.2 Konzernabschlussstichtag
59
4.3.3 Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert
60
4.3.4 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren
61
4.4
Weitere Angaben
63
4.4.1 Kapitalflussrechnung
63
4.4.1.1 Kapitalflussrechnung in der deutschen Rechnungslegung
63
4.4.1.2 Kapitalflussrechnung nach IFRS
64
4.4.1.3 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 65
4.4.2 Segmentberichtersattung
66
4.4.2.1 Segmentberichtersattung in der deutschen Rechnungslegung 66
4.4.2.2 Segmentberichtersattung nach IFRS
68
4.4.2.3 Bedeutung für das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren 69
5
BEDEUTUNG DER UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN BEIDEN
RECHNUNGSLEGUNGSSYSTEMEN FÜR DAS
KENNZAHLENGESTÜTZTE BONITÄTSRATINGVERFAHREN
70
5.1
Auswirkungen der Rechnungslegungsunterschiede auf einzelne
Kennzahlen
71
5.1.1 Kennzahlengestützte Untersuchung der Vermögensstruktur
71
5.1.1.1 Intensitätskennzahlen
71
5.1.1.2 Kennzahlen zur Umschlagshäufigkeit
74
5.1.2 Kennzahlengestützte Untersuchung der Kapitalstruktur
77
5.1.3 Kennzahlengestützte Untersuchung der statischen Liquidität
80
5.1.3.1 Net Working Capital
81
5.1.3.2 Liquiditäts- und Deckungsgrade
83
5.1.4 Kennzahlengestützte Untersuchung der dynamischen Liquidität
84
5.1.4.1 Cash Flow-Analyse
85
5.1.4.2 Weitere Kennzahlen der dynamischen Liquiditätsanalyse
87
5.1.4.2.1 Innenfinanzierungskraft
87
5.1.4.2.2 Dynamischer Verschuldungsgrad
89
5.2
Auswirkungen der Rechnungslegungsunterschiede auf das gesamte
Bonitätsrating
90
6
SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK
98
ANHANG
102
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
129
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite IV
Abkürzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AfA Abschreibung für Abnutzung
Aufl. Auflage
AV Anlagevermögen
BFH Bundesfinanzhof
BGH (RG) Bundesgerichtshof (Reichsgerichtshof)
bzw. beziehungsweise
DIHT Deutsche Industrie- und Handelstag
d.h. das heißt
DRS Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
EBIT Earnings before Interests and Taxes
EstG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUR Euro
FE fertige Erzeugnisse
F & E Fertigung & Entwicklung
Fifo First in first out
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
gem. gemäß
GoB Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
GuV Gewinn- und Verlustrechnung
HFA Hauptfachausschuss
HGB Handelsgesetzbuch
Hrsg. Herausgeber
IAS International Accounting Standard(s); ab 2002: IFRS
IASB International Accounting Standards Board; bis 2002: IASC
IASC International Accounting Standards Committee
lDW Institut der Wirtschaftsprüfer
IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRS International Financial Reporting Standards (neue Bezeichnung
für IAS)
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite V
insb. insbesondere
IRB
auf internen Ratings basierend
i.V.m. in Verbindung mit
KapAEG Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz
KFR Kapitalflussrechnung
KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KWG Kreditwesengesetz
Lifo Last in first out
Nr. Nummer
o.g. oben genannt
PoC Percentage of Completion
PublG Publizitätsgesetz
RAP Rechnungsabgrenzungsposten
RHB; Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe
S. Seite
SG Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.
SIC Standing Interpretations Committee; ab 2002: IFRIC
UE unfertige Erzeugnisse
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Internationale Rechnungslegung ist im Vormarsch. Seit einigen Jahren ist
zu beachten, dass die Unternehmen sich bei der Aufstellung ihrer Jahresab-
schlüsse nicht mehr nur an den für Deutschland gültigen Vorschriften des HGB
orientieren. Zunehmend werden Abschlüsse deutscher Unternehmen nunmehr
auch nach den international anerkannten US-Generally Accepted Accounting
Principles (US-GAAP) oder den supranationalen International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) erstellt (s. Anhang 1).
1
Betrachtet man Entwicklung der Wirtschaft während der letzten 10 Jahre, so
lässt sich eine ganze Reihe von Einflüssen ausmachen, die als Auslöser für
eine internationale Ausrichtung der Jahresabschlüsse deutscher Unternehmen
angeführt werden können. Beispielsweise sind heute Internationale Abschlüsse
ein Zulassungskriterium an vielen Börsen; an der deutschen Börse sind den
Segmenten TecDAX und ab 2002 im SDAX Jahresabschlüsse nach IFRS oder
US-GAAP vorzulegen.
Als weitere Gründe für die zunehmende Bedeutung von der internationalen
Rechnungslegung können genannt werden:
·
Globalisierung der Märkte
Zugang zu internationalen Kapitalmärkten (Eigenkapital, Fremdkapital)
Zugang zu internationalen Absatz- und Beschaffungsmärkten
·
Unzulänglichkeit des deutschen Bilanzrechts (z.B. Gesetzeslücken) sowie
Reformbedürftigkeit der GoB
·
Kapitalknappheit durch Zunahme des weltweiten Wettbewerbs
·
Institutionelle Investoren (z.B. professionelle Publikumsfondsgesellschaften),
die beispielsweise durch Risikostreuung Geldmittel weltweit anlegen
1
Vgl. Grünberger (2002), S. 1.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 2
·
gewachsene Anforderungen der Anleger, wie z.B. risikoadäquate Verzin-
sung des Kapitals, wertsteigernde Unternehmenspolitik, offene Kommunika-
tion und Information
·
Neuformulierung des § 292 a Abs. 1 und 2 HGB durch Kapitalaufnahmeer-
leichterungsgesetz (KapAEG) aus dem Jahre 1998, die börsennotierten
deutschen Unternehmen ermöglicht, einen befreienden Konzernabschluss
aufzustellen, der international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
entspricht.
·
EU-Verordnung vom 13.02.2003
Diese EU-Verordnung verpflichtet börsennotierte Gesellschaften zur Aufstel-
lung eines IFRS-Konzernabschlusses ab 01.01.2005. Bei erstmaliger An-
wendung eines Konzernabschlusses nach IFRS zum 31.12.2005 sind auch
die Vorjahreszahlen anzugeben. Die Umstellung der Rechnungslegung
muss bereits für das Jahr 2003 erfolgen, da die Schlussbilanz 31.12.2003
benötigt wird.
Aufgrund der skizzierten Entwicklung ist eine fortschreitende Internationalisie-
rung der Rechnungslegung auf Unternehmensebene, d.h. die Veröffentlichung
einer steigenden Zahl von IFRS-konformen Jahresabschlüssen, zu erwarten.
Dies hat zur Folge, dass sich unternehmensexterne Jahresabschlussadressa-
ten, wie z.B. Aktionäre, institutionelle lnvestoren und Kreditgeber, künftig ver-
mehrt mit Jahresabschlüssen konfrontiert werden, die (auch) internationalen
Rechnungslegungsnormen entsprechen. Die Umstellung der Jahres- und Kon-
zernabschlüsse auf die internationalen Bilanzierungsregeln hat für die Arbeit
der Bilanzanalytiker und deren Instrumente erhebliche Auswirkungen. Die un-
terschiedliche Behandlung von Geschäftsvorfallen nach den verschiedenen
Rechnungslegungssystemen führt dazu, dass die bestehenden, auf die deut-
sche Rechnungslegung abgestimmten Analyse- und Beurteilungssysteme mög-
licherweise bei Anwendung auf internationale Abschlüsse nur noch beschränkt
aussagekräftige Ergebnisse liefern.
2
Anstoß zu den Überlegungen in der vorliegenden Diplomarbeit bildet die Frage,
inwiefern sich eine IFRS-konforme Bilanzierung auf die externe kennzahlenge-
stützte Bonitätsratingverfahren auswirkt. Dabei ist zunächst zu untersuchen, ob
2
Vgl. Dangel/Hofstetter/Otto (2001), S. 4.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 3
sich die zur Verfügung stehenden Rechnungslegungsdaten im Vergleich zum
HGB verändern und welche Auswirkungen sich daraus hinsichtlich des Aussa-
gegehalts einzelnen Kennzahlen sowie gesamten Bonitätsratingverfahren ge-
gebenenfalls ergeben und wie diese Unterschiede zu interpretieren sind.
1.2 Vorgehensweise
Im Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Kapitel dieser Diplomarbeit
zunächst die konzeptionellen Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und
IFRS vorgestellt.
Das dritte Kapitel beinhaltet die Beschreibung des Bonitätsratingprozesses so-
wie derer Bedeutung für Basel II.
Der externe Analyst ist bei der jahresabschlussanalytischen Bonitätsbeurteilung
eines Unternehmens weitgehend auf die der Rechnungslegung entnehmbahren
Daten angewiesen. Daher sind im vierten Kapitel die für das kennzahlenge-
stützte Bonitätsratingverfahren relevante Rechnungslegungsbestandteile (Bi-
lanzpositionen) sowie deren durch das den Bilanzierungsnormen innenwoh-
nendnen bilanzpolitisch ausnutzbare Gestaltungspotential, d.h. Ermessens-
spielräume und Wahlrechte, zu beschreiben. Um den Informationswert der ei-
nem IFRS-Abschluss zu entnehmenden Rechnungslegungsdaten abschließend
beurteilen zu können, wird ein Vergleich mit den entsprechenden HGB-
Vorschriften vorgenommen.
Im fünften Kapitel wird schließlich aufbauend auf den Erkenntnissen der voran-
gegangenen Abschnitte der Frage nachgegangen, inwiefern sich aufgrund di-
vergierender Ansatz-, Bewertung-, Ausweis-, und Konsolidierungsgrundsätzen
in der IFRS-Rechnungslegung der Aufbau einzelner ausgewählten Kennzahlen
verändert und ob sich daraufhin Unterschiede zwischen dem Aussagegehalt
von IFRS-konformen und HGB-konformen Kennzahlen ergeben. Zudem ist an-
hand eines Beispieles zu untersuchen, ob die spezifischen Offenlegungsvor-
schriften der IFRS-Rechnungslegung Auswirkungen auf den Informationsgehalt
einzelner Kennzahlen und Bonitätsrating insgesamt haben sowie welche diver-
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 4
gierender Ansatz-, Bewertung-, Ausweis-, und Konsolidierungsgrundsätzen da-
für verantwortlich.
Das sechste Kapitel beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse der vor-
liegenden Diplomarbeit und Ausblick über die zukünftige Entwicklung der inter-
nationalen Rechnungslegung.
2 Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS
2.1 Rechnungslegung nach HGB
2.1.1 Entstehung und Inhalt des HGB
Das HGB trat am 1. Januar 1900 in Kraft. Das im HGB enthaltene Dritte Buch
Handelsbücher ist im Laufe der Jahre zwar abgeändert worden, enthält aber
immer noch nur sehr wenige allgemeine Vorschriften. Wichtige Sachverhalte
sind im HGB überhaupt nicht geregelt. Ein wesentlicher Teil der Vorschriften
des HGB befasst sich nur mit Wahlrechten und Ausnahmen von den ohnehin
unzureichenden Regelungen.
Das Dritte Buch Handelsbücher baut stark auf der Aktiennovelle von 1884, in
der eine Reihe von Strafbestimmungen enthalten war, um Betrügereien mög-
lichst zu vermeiden, auf. Hierauf sind auch die in der deutschen Bilanzliteratur
stark betonten Begriffe Vorsichtsprinzip, Gläubigerschutz und Ausschüttungs-
bemessungsfunktion zurückzuführen.
Aufgrund der vollkommen unzureichenden Definition der Rechnungslegungs-
vorschriften in Deutschland konnten die Unternehmensleitungen die sehr weni-
gen allgemeinen Vorschriften ganz in ihrem Sinne auslegen und somit in hohem
Maße Bilanzpolitik betreiben. Aus der Sicht des Bilanzlesers ist Bilanzpolitik
nichts anderes als Bilanzkosmetik oder Ergebnisverschleierung.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 5
2.1.2 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bilanz, einen möglichst genauen Ein-
blick in die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage eines Unternehmens zu
geben. Deshalb heißt es in § 243 HGB, dass der Jahresabschluss nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen ist. Sie werden
als die obersten Bewertungsnormen für das Rechnungswesen eines Unter-
nehmens bezeichnet. Der Begriff der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und
Bilanzierung wird durch gesetzliche Bestimmungen aber nirgendwo zusam-
mengefasst definiert; er ist ein unbestimmter Rechtsbegriff.
3
Nach dem Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2000, Seite 189, können als Entschei-
dungshilfen für die GoB in Betracht kommen:
·
Gesetz und die zugrunde liegenden EU-Richtlinien,
·
Rechtsprechung des BGH (RG), des EuGH, des BFH, der Spruchstelle
(§ 324 HGB),
·
die Stellungnahmen des lDW zur Rechnungslegung einschließlich der zuge-
hörigen Hinweise,
·
gutachtliche Stellungsnahmen des DIHT und der Industrie- und Handels-
kammern,
·
die gesicherten Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre,
·
die Fachliteratur sowie
·
die Bilanzierungspraxis ordentlicher Kaufleute
Das heißt im Klartext: Das Gemenge der Erkenntnisse aus
·
Handels- und Steuergesetzen,
·
zum Teil Jahrzehnte alten Urteilen von Finanzgerichten, die unter steuerli-
chen Gesichtspunkten urteilen,
·
Stellungnahmen des IDW,
die teilweise verschiedene Bilanzierungsmöglich-
keiten zulassen,
·
nicht definierten Stellungnahmen des DIHT und der Industrie- und Handels-
3
Vgl. Born (2001), S. 20.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 6
kammern,
·
nicht genau definierten gesicherten Erkenntnissen der Betriebswirtschafts-
lehre,
·
der Fachliteratur, die nicht selten unterschiedliche Meinungen vertritt,
·
der Bilanzierungspraxis von Kaufleuten. die zwar ordentlich sein mögen, die
aber keinen Grund haben, ihre Geschäftslage zu offenbaren,
bilden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.
In der weiteren Betrachtung können die GoB in die materielle und formelle Ord-
nungsmäßigkeit aufgeteilt werden. Die materielle Ordnungsmäßigkeit geht da-
von aus, dass die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig aufgezeichnet wer-
den; die formelle Ordnungsmäßigkeit unterstellt eine Nachprüfung sämtlicher
Aufzeichnungen, d.h. alle Buchungen müssen klar und übersichtlich ausgeführt
sein. Aus dieser Unterteilung lassen sich weitere Grundsätze ableite: Bilanz-
klarheit Bilanzwahrheit Bilanzkontinuität Bilanzidentität - Bilanzierungsvor-
sicht Maßgeblichkeitsprinzip.
2.1.3 Zielsetzung und Adressaten der HGB-Rechnungslegung
Im HGB sind die Ziele der Rechnungslegung nirgends explizit konkretisiert. In
Anlehnung an die deutsche Literatur zur Bilanzierung können im Wesentlichen
folgende Aufgaben/Ziele benannt werden:
·
Vorsichtsprinzip als von der statischen Bilanzlehre geprägte Hauptmaxime
Er verbietet eine optimistische Betrachtungsweise und führt zu einem im Ver-
gleich zu anderen Konzeptionen wesentlich niedrigem Gewinnausweis. In Ver-
bindung mit nachgelagerten Prinzipien wie Realisationsprinzip, Imparitätsprinzip
und Grundsatz der Einzelbewertung ist der Bilanzierende bei Vorliegen einer
Bewertungsbandbreite gehalten, eher den niedrigeren und somit vorsichtigeren
Wert und nicht den wahrscheinlichsten ,,richtigen" Wert anzusetzen.
4
Dabei wird
es als unproblematisch angesehen, den Jahresabschluss durch bilanzpolitische
Maßnahmen ,,anzupassen". Der so entstehende Möglichkeit zur Bildung stiller
4
Vgl. Dangel/Hofstetter/Otto (2001), S. 20.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 7
Rücklagen misst der Gesetzgeber zudem der Vorteil zu, dass der Bilanzierende
die Möglichkeit zur Erfolgsglättung hat. In Krisensituationen sollen hohe Verlus-
te gegen stille Rücklagen verrechnet und so das Wirtschaftssystem stabilisiert
werden. Dies deutet darauf hin, dass der Bevölkerung und insbesondere den
privaten Anlegern nur ein eingeschränktes wirtschaftliches Verständnis zuget-
raut wird.
5
·
Gläubigerschutzprinzip
Die vorsichtige Bilanzierung kommt besonders dem Interesse der Fremdkapi-
talgeber und somit der Banken entgegen, die aufgrund der rechtlichen Stellung
des Fremdkapitals keine direkte Möglichkeit der Einflussnahme auf die Unter-
nehmensführung haben. Da sie einen Anspruch auf eine fixe Größe haben,
steht für sie eine stabile Vermögenssituation des Kreditnehmers im Mittelpunkt.
Das deutsche Bilanzrecht schafft dafür mit dem Jahresabschluss ein Instru-
ment, das in seiner Konzeption mit dem Ziel der Kreditüberwachung in Einklang
steht. Die Vorschriften des § 18 KWG (Unterlagen ab Kredithöhe von mehr als
250.000 )sowie die Bedeutung der Bilanzanalyse in der Praxis der Banken
belegen dies.
·
Ausschüttungsbemessungsfunktion
Sie schütz der Fremdkapitalgeber davor, dass die Eigenkapitalgeber, welche
die Geschäftsführung bestimmen und direkt kontrollieren, dem Unternehmen zu
viele finanzielle Mittel entziehen können. Dies würde zu einer Gefährdung des
Unternehmensfortbestandes führen, ohne dass die Fremdkapitalgeber dagegen
etwas unternehmen könnten. Die Rückzahlung der dem Unternehmen von Ih-
nen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel wäre in Frage gestellt.
·
Maßgeblichkeitsprinzip
Die deutschen Rechnungslegungsvorschriften sehen eine enge Verzahnung
von Handels- und Steuerbilanz (Handelsbilanz ist Grundlage der steuerlichen
Gewinnermittlung) vor. Über die ungekehrte Maßgeblichkeit (steuerliche Be-
5
Vgl. Dangel/Hofstetter/Otto (2001), S. 13
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 8
günstigung ist nur möglich, wenn auch in der Handelsbilanz von zwingenden
handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften abgewichen
wird) sind steuerrechtliche Vorschriften auch für die Handelsbilanz gültig. Die
Folge daraus war bisher in Deutschland, dass die Unternehmensleitung in gu-
ten Jahren das Ergebnis eher schlechter darstellen, um Ausschüttungen und
steuerliche Belastungen möglichst gering zu halten und stille Reserven für
schlechte Zeiten anzusammeln, und in schlechten Jahren das Ergebnis eher
besser darstellen, d.h. stille Reserven ohne Kommentar auflösen, um die Kritik
an der Unternehmensleitung möglichst gering zu halten, keinen Bonitätsverlust
bei den Kreditgebern zu erleiden und steuerliche Nachteile zu vermeiden.
6
Als Jahresabschlussadressaten sind insbesondere die Mitarbeiter, die Anteils-
eigner, die Gläubiger und staatlichen Stellen zu nennen. Sie alle haben einer-
seits berechtigtes Interesse an der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens,
jedoch in der Regel keinen Zugang zu internen Unternehmensdaten.
7
2.2 Rechnungslegung nach IFRS
2.2.1 Entwicklung und Zusammensetzung der IFRS
Das International Accounting Standards Committee (seit dem Jahr 2001 Inter-
national Accounting Standards Board) wurde am 29.06.1973 in London von Be-
rufsorganisationen der mit der Abschlussprüfung und Rechnungslegung befass-
ten Berufe aus Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Ja-
pan, Kanada, Mexiko, den Niederlanden sowie den USA gegründet. Als unab-
hängige Körperschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Einheitlichkeit in den Rech-
nungslegungsgrundsätzen, die von Unternehmen und anderen Organisationen
in der ganzen Welt bei Jahresabschlüssen benutzt werden, zu erreichen.
Die in der Satzung festgesetzten Ziele lauten:
·
Im öffentlichen Interesse Rechnungslegungsgrundsätze zu formulieren und
zu veröffentlichen (aktuell gültige IFRS, s. Anhang 2)
6
Vgl. Born (2001), S. 22.
7
Vgl. Dangel/Hofstetter/Otto (2001), S.3.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 9
Hinweis: Bei seiner Gründung im 2001 hat das IASB alle schon vorhandenen
Standards des damaligen IASC unter ihrem bisherigen Titel ,,International Ac-
counting Standard" übernommen und diese Bezeichnung bisher nicht verän-
dert. IAS ist daher eine Untermenge zu IFRS. Die bisherigen IAS behalten zwar
ihre Bezeichnung und Nummerierung, sie werden mit der jeweils ersten Abän-
derung in IFRS umbenannt.
·
Generell an der Verbesserung und Harmonisierung der Vorschriften, Rech-
nungslegungsgrundsätze und Verfahren für die Aufstellung von Jahresab-
schlüssen zu arbeiten.
Derzeit hat das IASB 153 Mietglieder aus 112 Ländern, darunter aus Deutsch-
land das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) als Gründungsmitglied und die
Wirtschaftsprüferkammer. Das IASB besteht aus einer Vielzahl von Gremien (s.
Anhang 3), welche an unterschiedlichen Stellen an den insgesamt acht Schrit-
ten umfassende Standard-Setting-Process (s. Anhang 4)
beteiligt sind. Das
förmliche Verfahren der Verabschiedung eines IFRS (due process) dauert meh-
rere Jahre, da in den verschiedenen Stufen des Entscheidungsprozesses die
Öffentlichkeit mit einbeziehen wird. Das Board als höchstes Gremium verab-
schiedet mit der Zustimmung von acht der vierzehn Board-Mitglieder schließlich
die neu entwickelte IFRS.
8
Das IASB hat nur wenige hauptberufliche Mitarbei-
ter, die vor allem organisatorische Aufgaben wahrnehmen. Die ehrenamtlichen
Mitglieder der einzelnen Fachgremien werden von den Mitgliedsorganisationen
entsandt. Es handelt sich meistens um Rechnungslegungsfachleute von Unter-
nehmen, Mitarbeiter der vier großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften sowie Wissenschaftler.
Das IASB finanziert seine Arbeit aus Spenden der Mitglieder, dem Verlag der
regelmäßig neu erscheinenden IFRS und der Lizenzvergabe von Veröffentli-
chungsrechten an Verlage in den einzelnen Mitgliedsländern. Aufgrund seiner
Unabhängigkeit darf das IASB keine Spenden von staatlichen Institutionen an-
nehmen. In der Vergangenheit hatten die internationalen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften einen erheblichen Anteil an der Finanzierung.
8
Vgl. Born (2001), S. 10.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 10
Als problematisch stellt sich immer wieder heraus, das die am Entschei-
dungsprozeß beteiligten Organisationen sehr unterschiedliche Denkweisen mit-
bringen. Der Verabschiedung neuer Statements geht in aller Regel ein langer
Entscheidungsprozess voraus, in dem die an der statischen Bilanzlehre orien-
tierten Interessenvertreter und die Anhänger der dynamischern Bilanztheorie
jeweils versuchen , den neuen IFRS möglichst an ihrer Denkweise auszurich-
ten. Deshalb wurden in einzelnen wenigen Standards in der Wahlrechte zwi-
schen einer eher dynamischen und einer eher statischen Rechnungslegung
bzw. zwischen einer Standardmethode (benchmark treatment) und einer zuläs-
sigen Alternativmethode (allowed alternative treatment) eingeräumt. In Zukunft
sollen diese Wahlrechte im System der IFRS allerdings weitgehend beseitigt
werden
Die einzelnen IFRS befassen sich mit konkreten Bilanzierungsfragen aber sie
stellen noch kein vollständiges Regelwerk dar. Das IASB ist derzeit bemüht, die
zahlreichen noch bestehenden Regelungslücken auszufüllen. Zu beachten sind
neben den einzelnen IFRS auch die Verlautbarungen des International Financi-
al Reporting Interpretations Committee (IFRIC); diese stellen Zweifelsfragen in
der Auslegung der Standards klar.
9
Als problematisch erweist sich, dass dem IASB als einer von staatlichen Gre-
mien unabhängigen Organisation bei Nichtbefolgen der IFRS keine Sanktions-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. Nur in einigen wirtschaftlich weniger be-
deutsamen Ländern haben die lFRS die bis dahin bestehenden nationalen Re-
gelungen inzwischen ersetzt und sind verbindlich Bilanzrecht geworden. Auf-
grund ihres starken Engagements im IASB sollte allerdings davon ausgegangen
werden können, dass die großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften bei der Prüfung von IFRS-Abschlüssen auf eine Einhaltung der ver-
bindlichen Standards bestehen.
2.2.2 Grundsätze (Framework)
Im Gegensatz zu den deutschen und den US-amerikanischen Regelungen stel-
len die lFRS ein in sich geschlossenes System dar. Es besteht aus dem ,,Fra-
9
Vgl. Grünberger (2002), S. 3.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 11
mework for the Preparation and Presentation of Financial Statements" und den
Standards, die einzelne Bilanzierungsfragen regeln. Das Framework dient als
Rahmenkonzept, in dem die Grundsätze und Leitlinien für die Erstellung und
Anwendung der lFRS festgelegt werden. Es stellt den theoretischen Unterbau
der Rechnungslegung dar und schreibt die Informationsfunktion des Jahresab-
schlusses als generelle Zielsetzung fest.
10
Der Jahresabschluss (financial statement) eines Unternehmens enthält nach
IFRS zumindest die folgenden Elemente:
·
Bilanz (balance sheet)
·
Gewinn- und Verlustrechnung (income statement)
·
Eigenkapitalveränderungsrechnung (statement of changes in equity)
·
Kapitalflussrechnung (statement of cash flows)
·
Anhang (notes to financial statement)
Die IFRS-Bilanz kann entweder nach zunehmenden oder nach abnehmender
Liquidität gegliedert werden.
Nach dem IFRS-Framework besteht die GuV nur aus Aufwendungen und Erträ-
gen; eine Abgrenzung von Gewinnen und Verlusten braucht nicht zu erfolgen.
Daher kann die Buchungstechnik nach HGB (z.B. Buchwertabgang) unverän-
dert auch auf IFRS-Abschlüsse angewendet werden. Der Nettoausweis von
Gewinnen oder Verlusten kann ausnahmsweise bei der Veräußerung von Anla-
gevermögen oder bei vergüteten Aufwendungen erfolgen (IAS 1.36). Die GuV
kann nach dem Umsatzkostenverfahren (income by function) oder nach dem
Gesamtkostenverfahren (income by nature) erstellt werden (IAS 1.77). Das ein-
fachere Gesamtkostenverfahren bietet zwar einen geringeren Informationswert,
die Wahlmöglichkeit ist aber ein wichtiger Beweggrund in der Praxis, einen
IFRS-Abschluss und keinen US-GAAP Abschluss aufzustellen.
11
Die Notes to Financial Statements sind nicht, wie der Ahnhang zum deutschen
Abschluss, eine zusätzliche Erläuterung, sondern ein integraler Bestandsteil der
10
Vgl. Dangel/Hofstetter/Otto (2001), S. 18.
11
Vgl. Grünberger (2002), S. 10.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 12
Gesamtinformation. Sie sind daher wesentlich umfangreicher als die Angaben
im deutschen Anhang.
Der Lagebericht (management's discussion and analysis)
ist kein Pflichtbe-
standteil im Jahresabschluss; er wird aber häufig freiwillig aufgestellt.
Die Prinzipien der IFRS-Rechnungslegung sind:
·
Going concern principle: Fortführungsfiktion.
·
Understandability: Übersichtlichkeit und Verständlichkeit für fachkundige
Bilanzleser.
·
Relevance; materiality: Inhalte sind im Zweifel dann zu berücksichtigen,
wenn sie Entscheidungen eines Bilanzlesers beeinflussen könnten.
·
Reliability; faithful representation; neutrality: Die Darstellungen müssen ob-
jektiv quantifizierbar, wahrheitsgetreu, willkürfrei und wertfrei sein.
·
Substance over form: Nicht die rechtliche Form (legal form), sondern der
wirtschaftliche Gehalt (actual substance) ist maßgeblich.
·
Prudence: Im Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip.
·
Completeness; comparability: Bilanzvollständigkeit und Bilanzkontinuität.
Das Prinzip einer wahren und angemessenen Darstellung (true and fair view)
bzw. einer angemessenen Präsentation (fair presentation) derogiert im Zweifel
alle anderen Prinzipien (Begriff ,,overriding principle").
Insgesamt decken sich diese Regelungen teilweise mit denen des Handelsge-
setzbuches. Anders als das deutsche Handelsrecht kennen die International
Financial Reporting Standards aber kein Maßgeblichkeitsprinzip (§ 254 HGB).
Die IFRS sind vollkommen vom Steuerrecht entkoppelt. Die sind keine steuerli-
che Rechnungslegung. Hierfür ist vielmehr eine separate, nach den Regelun-
gen der jeweiligen Länder anzufertigende Rechnungslegung erforderlich. Dies
ist nicht nur notwendig, weil es kein internationales Steuerrecht gibt, und die
IFRS also auf nationale Steuerrechte hin kompatibel sein müssen, sondern
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 13
auch sinnvoll, weil damit ein Rechtsgebiet nicht durch Detailvorschriften des
jeweils andern Rechtsgebietes überfrachtet wird.
12
2.2.3 Ziele und Adressaten der IFRS-Rechnungslegung
Die Ziele eines nach den IFRS aufgestellten Jahresabschlusses bestehen in
der Vermittlung von Informationen über die finanzielle Situation (financial positi-
on) und deren Veränderung (changes in financial position) sowie über die er-
brachte Leistung (performance) eines Unternehmens, die für wirtschaftliche
Entscheidung (economic decisions) nützlich sind. Der Jahresabschluss dient
auch der Rechenschaftslegung des Managements und soll es deshalb ermögli-
chen, über das Halten oder Verkaufen von Anteilen an der Unternehmung und
die Wiederbestellung oder Abberufung des Managements entscheiden zu kön-
nen. Des Weiteren soll es der Jahresabschluss seinen Lesern ermöglichen ab-
zuschätzen, wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen in der
Lage ist, flüssige Mittel (cash and cash equivalents) zu erwirtschaften.
13
Andere Funktionen, vor allem die Regelung von Zahlungsbemessungsinteres-
sen in erster Linie zum Zwecke der Kapitalerhaltung -, haben zweitrangige
Bedeutung.
Primäre Adressatengruppe der IFRS-Rechnungslegung sind aktuelle und po-
tentielle Investoren des Unternehmens. Gemäß der Auffassung des IASB wer-
den bei Berücksichtigung der Investorinteressen die Interessen anderer Adres-
saten gleichzeitig mitberücksichtigt. Es wird jedoch kein Interessenausgleich im
Framework gefordert, wie das in der deutschen Rechnungslegung angenom-
men werden kann.
14
12
Vgl. Zingel (2003 online), S. 12.
13
Vgl. Born (2001), S. 12.
14
Vgl. Coenenberg, M. (2000), S. 87.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 14
3 Das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren
3.1 Grundlagen und Ziele
Unter dem kennzahlengestützten Bonitätsratingverfahren versteht man ein Be-
wertungsverfahren mit derer Hilfe eine Kreditnehmerklassifizierung anhand vor-
gegebener Kennzahlen durch Zuordnung von Punktwerten abgeleitet wird.
Hierbei symbolisieren die ausgewählten und während des Bonitätsprüfungspro-
zesses zu untersuchenden Kennzahlen die Bonitätsindikatoren und die zu ver-
gebenden Punktwerte die möglichen Bonitätseinstufungen.
15
Zum Schluss ei-
nes Bonitätsratingverfahren fließen Punktwerte der einzelnen Kennzahlen mit
verschiedener Gewichtung in das gesamte Bonitätsratingergebnis mit rein. Bo-
nitätsratings stellen insofern Aussagen über die Fähigkeit eines Schuldners dar,
finanzielle Verpflichtungen vollständig und fristgerecht erfüllen zu können.
16
Es
geht dabei insbesondere um die Ableitung von Wahrscheinlichkeiten über den
Eintritt von Leistungs- und Zahlungsstörungen während der Kreditlaufzeit, also
die Unternehmen in ,,gute" und ,,schlechte" Risiken einzuteilen. Die Symbole in
Form von Buchstaben und/oder Zahlen stellen in extrem zusammengefasster
Weise ein Urteil, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredites dieses
Unternehmens aufgrund bisher gesammelter Erfahrungen ist (s. Anhang 5). Die
Buchstabenkombination oder Symbol werden von den Ratingagenturen oder
den Kreditinstituten individuell festgelegt.
17
Beim Rating wird zwischen internem und externem Rating unterschieden. Mit
internem Rating ist die Beurteilung eines Unternehmens durch ein Kreditinstitut
gemeint. Das externe Rating wird durch unabhängige Agenturen meistens im
Auftrag des Unternehmens, das beurteilt werden soll, vorgenommen.
Bei den Kriterien zum Rating wird zwischen harten und weichen Faktoren un-
terschieden. Die harten Faktoren (quantitative Faktoren) umfassen die Unter-
nehmenszahlen (z.B. aus Bilanz sowie GuV). Von weichen Faktoren (qualitative
Faktoren) wird im Zusammenhang mit nicht zahlenmäßig fassbaren Werten
(z.B. Unternehmensziele, Strategie, Management usw.) gesprochen. Auch
15
Vgl. Schiller (2001), S. 126.
16
Vgl. Munsch/Weiß (2002), S. 14.
17
Vgl. Presber/Stengert (2002), S. 7.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 15
wenn die neuen Bonitätsratingverfahren ein stärkeres Gewicht auf die Beurtei-
lung der Zukunftsperspektiven eines Unternehmens und seiner qualitativen
Faktoren wie die Managementqualität legen, behält doch die traditionelle quan-
titative Finanzanalyse ein hohes Gewicht im Rahmen der Bewertung. Klar wird
dies, wenn man sich eine Faustregel vergegenwärtigt, die besagt, dass etwa
die Gewichtung von quantitativen zu qualitativen Faktoren bei internen Ratings
oft zu 2/3 nach sogenannten harten Faktoren ausgerichtet ist, während es bei
den externen Ratings oft genau umgekehrt ist, nämlich das Verhältnis 2/3 zu-
gunsten von weichen , qualitativen Faktoren besteht.
18
Auch zukünftig wird die
Jahresabschlussanalyse, die auf eine Beurteilung der Vermögensertrags- und
Liquiditätslage (sog. hard skills) eines Unternehmens abzielt, wesentlicher Bau-
stein eines Bonitätsratingprozesses bleiben.
19
Die Zielrichtung bzw. eine der Kernaufgabe eines kennzahlengestützten Boni-
tätsratingverfahren ist mit exakter Risikoklassifikation und Bestimmung von
Ausfallwahrscheinlichkeiten der Zahlungen des Unternehmens zu beschreiben.
Gegenstand der Bonitätsratings - wie auch des Risikomanagements - sind so-
mit die Chancen und Risiken, die zur Entstehung oder Verhinderung von Unter-
nehmenskrisen führen können. Für die Ableitung von Bonitätsratings ist somit
bedeutsam, wie Unternehmenskrisen entstehen und nach außen erkennbar
sind.
20
Die Grundidee eines kennzahlengestützten Bonitätsratingverfahren besteht nun
darin,
·
wesentliche Risiken durch klare Risikomaße zu operationalisieren,
·
messbare Indikatoren zu bestimmen, die auf das Vorhandensein von Risi-
ken hindeuten und
·
möglichst schon vorhandene Informationen aus dem Rechnungswesen des
Unternehmens zu nutzen, um die Risiken quantifizieren und die Risikoindi-
katoren bestimmen zu können.
Ein kennzahlengestütztes Bonitätsratingverfahren setzt somit in erster Linie auf
18
Vgl.
Heyken (2001), S. 36.
19
Vgl. Gleißner/Füser (2002), S. 129.
20
Vgl. Munsch/Weiß (2002), S. 15.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 16
vorhandenen Informationen des Rechnungswesens auf und nutzt infolge des-
sen auch vielfältige Instrumente der traditionellen Jahresabschlussanalyse.
21
3.2 Ratingadressaten
Wenn es in einem Zusammenhang mit einem Bonitätsrating über seine Adres-
saten die Rede ist, setzt dies ein externes Rating voraus. Interne Ratings der
Kreditinstitute werden grundsätzlich nicht zur weiteren Verwendung an die Kun-
den der Banken übergeben. Dies schließt schon allein die drohende Haftung
der Kreditinstitute aus, würden die Ratings zur freien Verwendung dem Kunden
zur Verfügung gestellt. Dabei ist das Interesse an dem Rating eines Unterneh-
mens allerdings nicht auf Kreditinstitute begrenzt, sondern auch für andere
Zwecke verwendbar. Als Adressaten kommen Kreditinstitute, Leasinggesell-
schaften, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter usw. in Frage.
3.2.1 Kreditinstitute
Soweit ein Unternehmen Kredite in Anspruch nimmt, ist das interne Rating heu-
te bei den meisten Banken bereits obligatorisch. Offiziell werden externe Ra-
tings bei kleinen und mittelständischen Unternehmen durch Banken nicht ak-
zeptiert.
22
Allerdings ist es kaum vorstellbar, dass ein vorliegendes Rating einer
anerkannten Ratingagentur durch die Bank abgelehnt wird. Schließlich enthält
der externe Ratingbericht zusammen mit den sonstigen Unterlagen des Unter-
nehmens (insbesondere Jahresabschluss, Lagebericht usw.) eine Vielzahl von
Informationen, die auch bei den internen Ratings der Banken benötigt werden.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass auch die Kreditinstitute die
externen Ratings in ihre eigene Beurteilung zumindest einbeziehen.
Gelingt es einer Bank, die durchschnittlichen Kosten für Administration der
Kleinkredite durch die Nutzung externer Bonitätsratings zu senken, können un-
mittelbar positive Auswirkungen auf den Erfolg entstehen. Bestehende Kapazi-
täten der Kreditabteilung können sich auf die wirtschaftlich bedeutenden Fälle
konzentrieren.
21
Vgl. Gleißner/Füser (2002), S. 130.
22
Vgl. Presber/Stengert (2002), S. 10.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 17
3.2.2 Leasinggesellschaften
Auch Leasinggesellschaften arbeiten mit eigenen Ratings (oft in vereinfachter
Form). Grundsätzlich dürften Leasinggesellschaften jedoch an externen Ratings
ein großes Interesse haben, da im Ablauf des Leasingprozesses eine Verkür-
zung möglich erscheint, wenn auch die eigenen Verfahren immer Priorität ha-
ben. Speziell bei kleineren Leasingverträgen haben die Leasinggesellschaften
nur einen sehr eingeschränkten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Leasingnehmers. Ausgangspunkt bei der Beurteilung des Leasingnehmers sind
Auskünfte bei Auskunfteien (z.B. SCHUFA, Creditreform) oder der Bank des
Leasingnehmers. Daher wäre ein Rating mit einem besseren Einblick in die
Verhältnisse des Leasingnehmers verbunden. Der Ratingbericht bzw. die Ra-
tings einer anerkannten Agentur können die Verhandlungen mit der Leasingge-
sellschaft, nicht nur in Bezug auf den Vertragsabschluss selbst, sondern auch
im Hinblick auf die Konditionen positiv beeinflussen.
3.2.3 Kunden
Ähnlich wie bei der Zertifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagements ist
das Rating eine Möglichkeit der Kundengewinnung und Kundenbindung. Bei
größeren Aufträgen wird häufig die auf dem Briefkopf eines Auftragnehmers
aufgedruckte Bankverbindung zur Situation des Auftragnehmers befragt. Dies
erfolgt meist indirekt über die Bank des anfragenden Auftraggebers. Gerade
große Unternehmen wollen sicherstellen, dass bei Verträgen mit kleinen und
mittelständischen Unternehmen gewährleistet ist, dass der Auftrag durch den
Auftragnehmer auch (finanziell) durchgeführt werden kann. Schließlich könnte
bei in etwa gleichem Angebot der Auftragnehmer den Zuschlag erhalten, bei
dem die interne Prüfung des Auftraggebers den kürzesten Weg verspricht. Liegt
ein aktuelles Rating vor und ist der Auftraggeber mit der Ratingbewertung zu-
frieden, kann die ganze Anfrageprozedur über das eigene Kreditinstitut bei den
Kreditinstituten des Auftragnehmers komplett entfallen.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 18
3.2.4 Lieferanten
Auch für die Lieferanten kann ein Rating von Interesse sein. Schließlich ent-
steht zwischen dem Lieferanten und seinen Kunden ein Kreditverhältnis. Auf-
grund der zahlreichen Insolvenzen der letzten Jahre sind Lieferanten mit der
Lieferung und der Kreditierung ihrer Lieferungen vorsichtig geworden. Daher ist
die Anfrage von Lieferanten, bei den Banken der Auftraggeber sowie Auskunf-
teien bei neuen Geschäftsbeziehungen oder größeren Aufträgen durchaus an-
zutreffen. Schließlich kann ein gutes Rating auch die Zahlungskonditionen
verbessern. Dies betrifft sowohl das Zahlungsziel, die Skontierung wie auch das
Kreditlimit selbst. Aus der Weitergabe des Ratings an die Lieferanten ergeben
sich also unmittelbare geschäftliche Vorteile.
3.2.5 Mitarbeiter
Neben vielen anderen Faktoren sind die Identifikation und das Ergebnis des
gemeinsamen Handelns auch im Erfolg des Unternehmens dokumentiert. Es
entspricht den Bedürfnissen des Menschen, in einem erfolgreichen motivieren-
den Umfeld zu arbeiten. Dies wurde in vielen Unternehmen schon im Rahmen
der Zertifizierung, wenn sie denn ernsthaft betrieben wurde, erlebt. Auch die
Information an die Mitarbeiter über ein durchgeführtes Rating, das erfolgreich
verlaufen ist, erhöht die Identifikation mit dem Unternehmen und damit die Moti-
vation des Mitarbeiters. Schließlich ist die Bekanntgabe des Ratings zusammen
mit weiteren Informationen (z.B. Vision und Ziele des Unternehmens) eine
Maßnahme der innerbetrieblichen Kommunikation und eine Einbindung der Mit-
arbeiter in die betriebliche Erfolgstrategie.
3.2.6 Andere Adressaten
Das externe Rating kann auch für alternative Kapitalbeschaffungsmaßnahmen,
z.B. die Finanzierung von Anleihen und Emission von Aktien, verwendet wer-
den. Auch in Deutschland werden zunehmend Produkte (z.B. partiarische Dar-
lehen, typische und atypische stille Beteiligungen, Gesellschaftsanteile) zur Ei-
genkapitalfinanzierung der Unternehmen entwickelt. Der Weg zu diesen Mitteln
kann zumindest abgekürzt werden, wenn ein professionelles Rating vorliegt.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 19
Schließlich kommen in der Ratingnote auch die Zukunftsorientierung des Un-
ternehmens und die Analyse der Stärken und Schwächen zum Ausdruck. Der
Ratingbericht beantwortet eine ganze Reihe von Fragen, die von solchen Fi-
nanzierungsinstituten gestellt werden. Gleiches gilt für eine externe Beteili-
gungsfinanzierung. Eine der Möglichkeiten das Eigenkapital auf eine angemes-
sene Höhe zu bringen, und damit auch die Kreditmöglichkeit auszuweiten, ist
die Suche nach Beteiligungspartnern. Ein Rating kann einen Vertrauensvor-
schuss schaffen.
Auch bei Verkauf der Forderungen an einen Dritten (Factoringgesellschaft) dürf-
te ein positives Rating des Kunden (Schuldners) verwendbar sein. Factoring ist
bei vielen Unternehmen mittlerweile eine öfter anzutreffende Form der Finanzie-
rung, weil die Forderungen aus einer Lieferung an den Kunden sehr kurzfristig,
unabhängig vom Zahlungsziel, als liquide Mittel zur Verfügung stehen.
Schließlich kann ein positives Rating auch werbewirksam eingesetzt werden.
Es dürfte bei einer Veröffentlichung die Berichterstattung, und zwar regional wie
überregional bei entsprechender Weitergabe der Informationen an die Medien
garantiert sein. Dies stellt eine positive kostenlose Werbung für das Unterneh-
men dar.
3.3 Bonitätsratingprozess
Um sicherzustellen, dass nach Beendigung des Kreditprüfungsprozesses ein
nachvollziehbares Stärken- und Schwächen-Profil für jeden bearbeiteten Kredit-
fall vorliegt, basieren moderne kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren auf
einem zweistufigen Auswertungsverfahren:
Zuerst wird der Jahresabschluss, der einen Einblick in die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage ermöglicht, ausgewertet. Auf Basis der Jahresabschlüsse wer-
den die Kennzahlwerte berechnet, denen man in der Bonitätsanalyse eine Aus-
sagekraft und Relevanz beimisst. Bei der Entwicklung und bei den Tests eines
kennzahlengestützten Bonitätsratingverfahren überprüft man, wie sich die Er-
gebnisse verändern, wenn unterschiedliche Kennzahlen einbezogen werden.
Dabei erfolgt auch eine Gegenüberstellung der Ergebnisse zu den vergebenen
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 20
Ratings der Agenturen. Für jede Kennzahlausprägung wird auf Basis eines vor-
definierten Schemas eine Teilnote vergeben. Damit wird die Transparenz des
Ansatzes erhöht und außerdem der Vergleich mit anderen Unternehmen oder
einer Vergleichsgruppe erleichtert. Die Teilnoten werden anschließend in einem
zweiten Schritt unter Berücksichtigung von individuellen Gewichten, die den
jeweiligen Teilbereichen beizulegen sind, zu einer Gesamtnote verdichtet.
Die Bonitätsbeurteilung selbst erfolgt durch die Zuordnung zu einer Risikoklas-
se über eine simultane Bonitäts- und Sicherheitenklassenbewertung. Hinter
dem Risikoklassenprinzip steht die Überlegung, dass jede Risikoklasse einen
bestimmten Grad an (potenzieller) Bonitätsgefährdung verkörpert und infolge-
dessen eine optimale Kreditbearbeitung unterschiedliche auf die einzelnen Risi-
koklassen bezogene Handlungsanweisungen voraussetzt. Die Einführung von
kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren erfordert demzufolge eine geeig-
nete Risikosegmentierung der Kreditengagements, bei der innerhalb der einzel-
nen Risikoklassen Kredite mit einem möglichst homogenen Risikobild zusam-
mengefasst werden, während zwischen den Risikoklassen die einzelnen Kun-
denbeziehungen erkennbare Unterschiede in ihrem Risikoprofil aufweisen müs-
sen. Probleme treten bei der Risikoklassenbildung dadurch auf, dass aus Prak-
tikabilitätsüberlegungen nicht nur die Risikoklassen, sondern auch die Anzahl
der verwendeten Klassifikationskriterien limitiert werden müssen. Dies erklärt,
warum man bei den Risikoklasseneinstufungen mit vier bis acht verschiedenen
Risikoklassen arbeitet. Als grundlegende Risikokategorisierung wird häufig fol-
gende Einteilung gewählt:
23
1. Kredite ohne erkennbare Ausfallrisiken,
2. anmerkungsbedürftige Kredite,
3. notleidende Kredite und
4. uneinbringliche Kredite.
Dabei repräsentiert ein kennzahlengestütztes Bonitätsratingverfahren die Kre-
ditwürdigkeit auf Basis verfügbarer Informationen über ein Unternehmen. Das
bedeutet zwangsläufig, dass es nicht starr, sondern ständig auf Basis neuer
Informationen zu überprüfen ist.
23
Vgl. Schiller (2001), S.131.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 21
Solch eingesetzte Verfahren dienen einmal dazu, so gut wie möglich die zu-
künftige Bonität und die Fähigkeit eines Schuldners, den Verpflichtungen dau-
erhaft und fristgerecht nachzukommen einzuschätzen. Das Bonitätsrating des
Unternehmens wird zur Kalkulation von Risikokosten (sog. Standardrisikokos-
ten) eingesetzt. Der Risikoaufschlag soll für das mit einem Kredit verbundene
Ausfallrisiko entschädigen. Mit einem Zahlungsausfall ist nur in sehr seltenen
Fällen alles verloren. Nimmt der Schuldner seine Zahlungen wieder auf, so ent-
steht kein Verlust, wenn die Zeit des Zahlungsverzugs verzinst wird. Geht der
Schuldner in Konkurs, so erhält der Gläubiger mögliche Zahlungen aus der Li-
quidationsmasse. Die Kalkulation eines ausfallrisikoadäquaten Prämien basiert
auf statistischen Modellen, in die Erfahrungswerte bezüglich der Rückzahlungs-
quoten und der durchschnittlichen, laufzeitbezogenen Marktausfallraten einge-
hen, die der Ratingkategorie eines Schuldners entsprechen.
24
3.4 Basel II und Rating
Die neuen Regeln des Basler Ausschusses für Bankaufsicht haben eine grund-
legende Veränderung des Kreditgeschäftes der Banken und Sparkassen zur
Folge. Sie zielen auf eine Neuregelung der Verpflichtung zur Eigenkapitalunter-
legung des Kreditgeschäftes von Banken ab. Da Kreditausfälle grundsätzlich
die Sicherheit von Einlagen einer Bank gefährden können, müssen Banken bei
der Kreditvergabe einen bestimmten Betrag an Eigenkapitel bereithalten. Inso-
fern wird durch das zur Verfügung stehende haftende Eigenkapitel einer Bank
die Höhe des maximal zu zeichnenden Kreditvolumens der Bank bestimmt.
Schließlich wirkt die Kreditunterlegung als Wachstumsgrenze für das Kreditinsti-
tut. Diese Eigenkapitalunterlegung wird zukünftig stärker auf die Bonität der
Schuldner auszurichten sein. Je mehr Eigenkapital die Bank für einen Kredit an
einen Kunden aufwenden muss, desto teurer wird der Kredit für den Kunden
sein. Dies hat zur Folge, dass bonitätsstarke Adressen entlastet und Adressen
mit geringerer Bonität auf Grund einer höheren Eigenkapitalunterlegung bei der
Bank belastet werden.
Die neue Eigenkapitalvereinbarung hält sowohl an der geltenden Eigenkapital-
definition als auch an der Mindesteigenkapitalquote von 8 % im Verhältnis zu
24
Vgl. Munsch/Weiß (2002), S. 75.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 22
den risikogewichteten Aktiva fest. Die Neuerungen betreffen Verbesserungen
bei der Risikomessung, d.h. die Berechnung des Nenners der Eigenkapitalquo-
te. Die Messverfahren für das Bonitätsrisiko sind ausgefeilter als in der gelten-
den Eigenkapitalvereinbarung.
Für die Bemessung dieses Risikos werden zwei grundlegende Möglichkeiten
vorgeschlagen: eine Standardmethode und ein auf internen Ratings basieren-
der Ansatz (IRB-Ansatz). Beim IRB-Ansatz gibt es zwei Varianten: eine Basis-
version und eine fortgeschrittene Methode. Der Einsatz des IRB-Ansatzes wird
von der Zustimmung durch die Aufsichtsinstanz abhängen, basierend auf den
vom Ausschuss formulierten Standards.
3.4.1 Die Standardmethode für das Bonitätsrisiko
Die Standardmethode entspricht vom Konzept her der geltenden Eigenkapital-
vereinbarung, weist jedoch eine risikogerechtere Ausrichtung auf. Die Bank teilt
sämtlichen Aktiva und außerbilanziellen Positionen Risikogewichte zu und
summiert die risikogewichteten Werte der Vermögenspositionen. Ein Risikoge-
wicht von 100 % bedeutet, dass ein eingegangenes Risiko in der Berechnung
der risikogewichteten Aktiva zum vollen Wert berücksichtigt wurde, und dies
wiederum drückt sich in einer Eigenkapitalquote von 8 % dieses Wertes aus.
Analog führt ein Risikogewicht von 20 % zu einer Eigenkapitalquote von 1,6 %
(d.h. ein Fünftel von 8 %).
Die einzelnen Risikogewichte sind nach geltender Regelung von der allgemei-
nen Risikokategorie der Schuldner (d.h. Staaten, Banken oder Wirtschaftsun-
ternehmen) abhängig. In der Neuen Eigenkapitalvereinbarung sollten die Risi-
kogewichte verfeinert werden, und zwar anhand der Bewertungen durch ein
externes Bonitätsbeurteilungsinstitut (z.B. eine Ratingagentur), das strenge
Standards erfüllt. Beispielsweise sieht die geltende Eigenkapitalvereinbarung
für Unternehmenskredite ein einziges Risikogewicht von 100 % vor, während in
der neuen Regelung vier Kategorien möglich sind (20 %, 50 %, 100 % und 150
%) (s. Anhang 6).
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 23
So plausibel die risikoabhängige Eigenkapitalunterlegung des Kreditgeschäftes
auch ist, die Abgrenzung der Gewichtungsfaktoren erscheint in dem Standard-
ansatz aus Basel als zu grob. So sind wahrscheinlich die meisten mittelständi-
schen Unternehmen zwischen den Ratings BBB+ und BB- zu finden. Eine wirk-
liche Risikodifferenzierung wird bei einem Pauschalsatz von 100 % damit nicht
erreicht.
25
3.4.2 Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRB-Ansatz)
Banken, die mit dem IRB-Ansatz arbeiten, wird es gestattet sein, ihre internen
Einschätzungen der Bonität eines Schuldners für die Beurteilung des Bonitätsri-
sikos in ihren Portfolios zu verwenden. Spezielle Analyseverfahren gibt es für
verschiedene Arten von Kreditengagements, beispielsweise Kredite an Unter-
nehmen und Privatkunden, deren Verlustmerkmale sich unterscheiden.
Beim IRB-Ansatz schätzt eine Bank die Bonität sämtlicher Schuldner und über-
trägt die Ergebnisse in Schätzungen der zukünftigen potentiell anfallenden Ver-
lustbeträge, die die Grundlage für Mindesteigenkapitalanforderungen darstellen.
Die neue Regelung lässt sowohl eine Basisversion als auch eine fortgeschritte-
ne Methode für Engagements gegenüber Wirtschaftsunternehmen, Staaten und
Banken zu. Bei der Basisversion schätzt die Bank in Bezug auf jeden Schuldner
die Ausfallwahrscheinlichkeit, und die Aufsichtsinstanz liefert die übrigen Input-
Faktoren. Bei der fortgeschrittenen Methode wird es einer Bank mit einem aus-
reichend entwickelten Verfahren für die interne Kapitalallokation gestattet, wei-
tere notwendige Input-Faktoren selbst zu ergänzen. Sowohl bei der Basisversi-
on als auch beim fortgeschrittenen IRB-Ansatz ist die Palette der Risikogewich-
te viel breiter als bei der Standardmethode, wodurch diese Ansätze risikoge-
rechter werden.
26
3.4.3 Bedeutung von Basel II für einzelne Wirtschaftssubjekte
Es erfolgt bereits jetzt umfangreiche Projektarbeit in den Kreditinstituten, die
bankinternen Ratingsysteme, die bereits weit verbreitet sind und zum Standard
25
Vgl. Munsch/Weiß (2002), S. 41.
26
Vgl. Presber/Stengert (2002), S. 197.
Auswirkungen der Internationalisierung von Rechnungslegung auf das kennzahlengestützte Bonitätsratingverfahren Seite 24
des Kreditgeschäftes gehören, den Anforderungen des Baseler Ausschusses
entsprechend zu gestalten. Diese Systeme beruhen aber auf unterschiedlichen
Ansätzen und müssen mit Hilfe moderner Methoden systemgestützter Bonitäts-
bewertung weiter verbessert werden. Natürlich bedarf es Richtlinien, nach de-
nen die Aufsichtsbehörden Ratingsysteme von Ratingagenturen und bankinter-
ne Ratingsysteme überprüfen können. Nur die Ratingsysteme der Banken, die
von der Bankenaufsicht geprüft wurden, werden für die eigene Bestimmung der
erforderlichen Eigenkapitalunterlegung genutzt werden dürfen. Es soll dadurch
verhindert werden, dass eine Bank das eigene Kreditportfolio als zu gut bewer-
tet und weniger Eigenkapital bereithalten muss als andere Institute mit einem
vergleichbaren Portfolio.
27
Die Steuerung des Kreditportfolios ist eine der urei-
genen Aufgabe eines Finanzdienstleisters, die leider nur zu häufig vernachläs-
sigt wurde. Ebenso fanden bei der Kreditvergabe stark subjektive Kriterien oder
auf Wachstum ausgerichtete Strategien Berücksichtigung. Dies hat zu einem
enormen Wertberichtigungsbedarf bei diesen Kreditinstituten geführt. Die Ver-
feinerung des internen Ratingverfahrens und die verstärkte Bankenaufsicht sol-
len diese Vorgehensweise unterbinden.
Banken werden die Ergebnisse externer Ratingagenturen künftig neben einem
internen Ratingsystem aktiv für die Kreditentscheidung nutzen. Ein unabhängi-
ges und objektives externes Rating wird für Unternehmen insofern die Kür sein,
während interne Ratings zu mindestens flächendeckend Pflicht bei Krediten ab
250.000 wegen erforderlicher Offenlegung von Unterlagen durch Kreditneh-
mer nach § 18 KWG darstellen werden.
Durch die neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken (Basel II) werden sich die
Kreditbeziehungen zwischen Banken und Unternehmen in hohem Maße än-
dern
28
. Für Unternehmen bedeutet dies zunächst mehr Transparenz im Zu-
sammenhang mit der Bonitätsbewertung durch Banken
29
. Während bislang die
Ergebnisse bankinterner Kreditanalysen und Ratings nur in Einzelfällen dem
Kreditnehmer mitgeteilt werden, ist für die Zukunft eine offenere Kommunikati-
onspolitik zu erwarten. Da sich die Bonität deutlich im Kreditpreis widerspiegeln
wird, werden Unternehmen nachdrücklich die Ergebnisse der Bonitätsbewer-
27
Vgl. Munsch/Weiß (2002), S. 42.
28
Vgl. Schmitt (2001).
29
Vgl. Stuhlinger (2001), S. 77.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832476908
- ISBN (Paperback)
- 9783838676906
- DOI
- 10.3239/9783832476908
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- ifrs rating bilanzposition rechnungslegungssystem kapitalflussrechnung
- Produktsicherheit
- Diplom.de